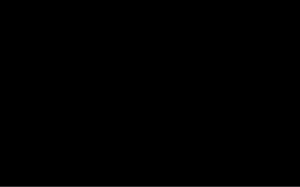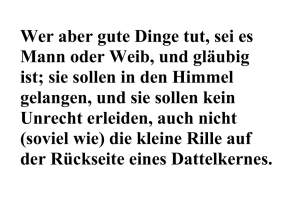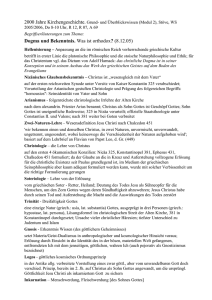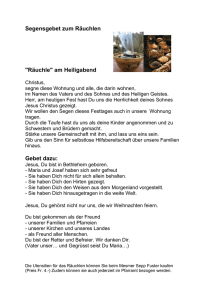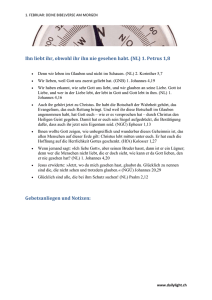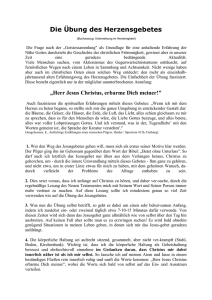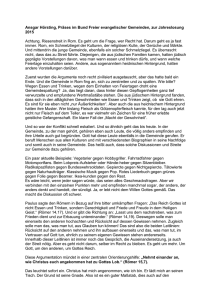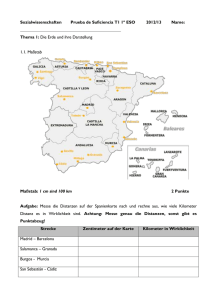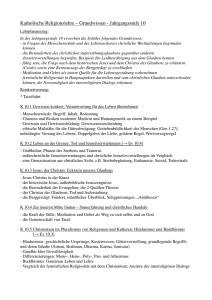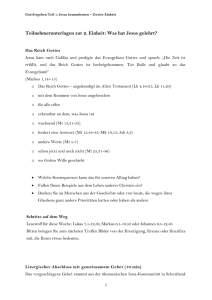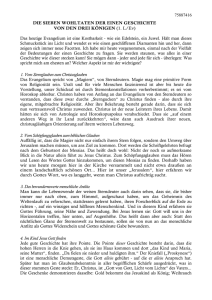Hochgeladen von
marek-kretschmann
Unterrichtseinheit Christusdarstellungen Marek Kretschmann
Werbung

Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Seminar: Theoretische Grundlagen und Vertiefung fachbezogenen Lehrens und Lernens im Fach Evangelische Religionslehre Leitung: StR’in Christiane Flachsenberg Wintersemester 2018/2019 Unterrichtseinheit: Jesus in Bildern erkennen – Christusdarstellungen im Wandel der Zeit und interreligiös vorgelegt von Marek Kretschmann Matrikelnummer: 1021907 Master of Education: Biologie, Französisch (2. Semester) Erweiterungsfach auf Bachelorebene: Ev. Religionslehre (7. Semester) Stadtfeldkamp 13 24114 Kiel E-Mail: [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .................................................................................................................... 1 2 Sachanalyse ................................................................................................................. 3 2.1 Zur Begrifflichkeit Christologie ................................................................................ 3 2.2 Christusdarstellungen ............................................................................................... 4 2.2.1 Christusdarstellungen im Wandel der Zeit ........................................................... 4 2.2.2 Christusdarstellungen in den Fremdreligionen...................................................... 6 3 Fachdidaktische Analyse ........................................................................................... 7 3.1 Die Lernenden .......................................................................................................... 7 3.2 Das Thema und die didaktische Reduktion ................................................................. 9 3.3 Umfang, Ziele und Kompetenzen ............................................................................ 11 3.4 Die Unterrichtseinheit ............................................................................................. 13 4 Methodische Analyse ............................................................................................... 14 5 Literaturverzeichnis .............................................................................................. 188 1 1 Einleitung „Bilder […] auswählen. Wir wollen die vielen schönen Bilder erdenken, achten, auferwecken, die Gott, die Natur und die Menschheit uns zur Verfügung stellen.“1 Die in dieser Arbeit vorgestellte Unterrichtseinheit trägt den Titel „Jesus in Bilder erkennen – Christusdarstellungen im Wandel der Zeit und interreligiös“. Demnach handelt sich bei dem zentralen Thema dieser Einheit um ein Teilgebiet der Christologie. Es wird im Unterricht mit Werken und Bildern aus unterschiedlichen Kunstepochen und Christusdarstellungen in Fremdreligionen gearbeitet, um den Schüler*innen einen Einblick in die Vielfalt der Abbildungen und Bildnisse von Jesus Christus zu geben und um auf deren Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten einzugehen und zu thematisieren. Im Sinne des ästhetisch religiösen Lernens und der Elementarisierung soll versucht werden, mittels Bilder als medialer Ausdrucksform einen Raum zu schaffen, in dem die Schüler*innen die Chance erhalten, mit Jesus Christus in Kontakt zu treten und damit eine Begegnung zu erleben, die zur Erweiterung ihres gegenwärtigen Selbstverständnis durch Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung beitragen kann.2 Denn ein Bild kann als Ausdruck eines Findungsprozesses von Antworten auf Ängste, den Glauben und Fragen des eigenen Lebens und der menschlichen Existenz gedeutet werden.3 Gerade in der Schule kann die Begegnung mit einer nicht physisch präsenten Person durch Bilder, wie es bei Jesus Christus der Fall ist, dazu führen, dass Schüler*innen neue Facetten und Eigenschaften der Person entdecken können, die eine theologisch erkenntnisbringende Kraft in sich tragen, um die Fragen zu beantworten, wer Jesus war oder ist und wer man selbst ist. 4 Ein fächerübergreifender Unterricht mit dem Fach Kunst erscheint deshalb lohnenswert und hilfreich, damit die Schüler*innen das nötige Handwerk zur Erschließung der Bilder erhalten, das für sie persönlich förderlich sein kann. 1 Das Zitat stammt von Pedro Casaldáliga, einem Bischof in Brasilien. Siehe Binder, A., Bilder, in: Bosold, I., Kliemann, P. (Hg.), „Ach, Sie unterrichten Religion?“. Methoden, Tipps und Trends, München 32012, S. 144-147, hier S. 144. 2 Vgl. Schmid, P. F., „Ecce homo! – Seht, was für ein Mensch!“, in: Englert, R., Mette, N., Zimmermann, M. (Hg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Unter Mitarbeit von Kerstin Ochudlo-Höbing, Münster 2015, S. 203-209, hier S. 203f. 3 Vgl. Zisler, K., Akzente des Christusbildes in der Kunst des 20. Jahrhunderts, in: Englert, R., Mette, N., Zimmermann, M. (Hg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Unter Mitarbeit von Kerstin Ochudlo-Höbing, Münster 2015, S. 145-149, hier S. 145. 4 Vgl. ebenda. 2 In dieser Unterrichtseinheit sehe ich meine eigene Rolle als Lehrkraft als Initiator von und Unterstützer bei Lernprozessen, indem ich den Schüler*innen in den verschiedenen Unterrichts- und Arbeitsphasen ausreichend Freiräume für Individualität biete, weil der Fokus eher auf Subjektorientierung liegen sollte. In der Gruppen- und Einzelarbeit muss ich für Fragen der Schüler*innen offen sein und in der Lage sein, ihnen eine fundierte und sinnvolle Antwort geben zu können, um sie bei ihrem Lernen zu unterstützen. Dabei ist meiner Meinung nach ein konstruktives Feedback der entscheidende Faktor, der zu einer Erweiterung und Förderung ihrer Kompetenzen führen kann, weshalb bereits in frühen Klassenstufen dieses eingeübt werden sollte. Gerade für die Persönlichkeitsentwicklung kann es hilfreich sein, sich mit seiner Selbst- und der Fremdwahrnehmung anderer zu befassen. Ich habe mich für dieses Unterrichtsthema aus zweierlei Gründen entschieden. Zum einen halte ich es für wichtig und notwendig, dass sich im evangelischen Religionsunterricht mit Jesus Christus als zentralen Bestandteil der christlichen Religion beschäftigt wird und den Schüler*innen Jesus Christus als Person und sein Werk näher gebracht wird. Zum anderen liegt mein persönlicher Anspruch an mich darin, meine gewählten Unterrichtsinhalte auf eine möglichst kreative und innovative Weise den Schüler*innen zu vermitteln, weshalb ich die Arbeit mit Kunstwerken als sehr nützlich und hilfreich betrachte. Denn für mich ist es immer eine besondere Erfahrung, in einem Museum wie dem Louvre beispielsweise die verschiedenen Säle der Kunstepochen entlang zu wandern und die Gemälde der Künstler unterschiedlicher Nationalitäten zu betrachten und zu bewundern. Ein Bild kann nämlich meiner Meinung nach eine Person auf emotionale Weise „berühren“ und zu Denkprozessen und zur Selbstreflexion anregen, wenn man etwas von sich in dem Bild wiederfindet. Auf diesen beiden Punkten gründet meine Motivation für diese Unterrichtseinheit. 3 2 Sachanalyse Keine Person der Weltgeschichte ist so häufig künstlerisch dargestellt worden, wie die Person Jesus Christus.5 Dabei wurde sie über die Jahrhunderte hinweg immer wieder neu interpretiert und so dargestellt, dass sie für die Menschen der Zeit verständlich ist. Im Folgenden wird zunächst der Begriff der Christologie kurz erläutert, um dann die Geschichte der Christusdarstellungen in der Kunst und fremdreligiösen sowie fremdkulturellen Kreisen zu präsentieren.6 2.1 Zur Begrifflichkeit Christologie „Die Person Jesu steht am Anfang jeder Christologie.“7 Diese Aussage muss zudem dahingehend erweitert werden, dass sich der christliche Glaube seit seinen Anfängen dazu bekennt, dass „Jesus von Nazareth der Christus ist, er bekennt sich zu ihm als dem Sohn Gottes, dem Herrn und Retter der Welt.“8 Diese systematische Teildisziplin untersucht dabei die Frage nach Jesus Christus unter zweifacher Perspektive. „Die historische Frage fragt nach dem geschichtlichen Jesus von Nazareth, der zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten kulturellen Kontextgelebt hat und gestorben ist und blickt in die Vergangenheit; die Glaubensfrage fragt nach seiner geglaubten theologischen Bedeutung für die Gegenwart.“9 Es ergibt sich daraus, dass sowohl Aspekte seines Lebens und seiner Person als auch seines Werkes, seines Handelns und seiner Botschaft von Relevanz sind. Die Interpretation dieser Gesichtspunkte führt in der Konsequenz zur Ausbildung von christologischen Konzepten, die jeweils einen bestimmten Schwerpunkt besitzen. Diese christologischen Modelle versuchen in der heutigen Zeit, Antworten auf die Christusfrage zu finden, die zur Selbstklärung der persönlichen und existentiellen Beziehung zu Jesus Christus und des eigenen Glaubens und der individuellen Identität beitragen können.10 5 Vgl. Pfeiffer, H., Gottes Wort im Bild. Christusdarstellungen in der Kunst, München 1986, S. 9. 6 In diesem Zusammenhang werden aus Platzgründen dieser Arbeit keine konkreten Kunstwerke dargestellt, sondern allgemeine und charakteristische Merkmale herauszuarbeitet. In der unterrichtlichen Umsetzung ist es ebenso möglich, unterschiedliche Bilder einzusetzen, weshalb sich auch nach allgemeingültigen Kennzeichen gesucht wird. Der Fokus kann jedes Mal neu gesetzt werden. 7 Siehe Küster, V., Die vielen Gesichter Jesu Christi. Christologie interkulturell, NeukirchenVluyn 1999, S. 9. 8 Siehe Kühn, U., Christologie, Göttingen 2003, S. 13. 9 Siehe Pemsel-Maier, S., Gott und Jesus Christus. Orientierungswissen Christologie, Stuttgart 2016, S. 16. 10 Vgl. Kühn (2003), S. 93f.; Pemsel-Maier (2016), S. 13-16. 4 2.2 Christusdarstellungen Kunstwerke können die eigenständige Deutung und Auslegung religiöser und biblischer Schriften aus der Sicht des Künstlers und aus der Sicht seiner Zeit als Beispiel einer Kunstströmung repräsentieren. Die Gemälde, Mosaike, Skulpturen oder anderen Darstellungsformen von Jesus Christus zeigen jeweils die aktuelle Bedeutung, die dieser Mythos für die Kunstschaffenden und ihren Glauben hatte oder immer noch hat.11 2.2.1 Christusdarstellungen im Wandel der Zeit In der Geschichte der christlichen Tradition und Gemeinden existierte immer der Drang oder die Sehnsucht der Gläubigen, sich eine bildhafte Vorstellung von Jesus zu machen. In den ersten Jahrhunderten wurde diesem Wunsch allerdings nicht nachgegangen. Es gab eine deutliche Zurückhaltung in der bildhaften Darstellung Jesu.12 Stattdessen wurde sich in der frühchristlichen Kirche auf Geschichten aus dem Neuen Testament konzentriert, die die Werke und Heilsaussagen Christi in den Vordergrund stellten.13 Dabei stellte die Figur des Hirten als Form der Menschenfreundlichkeit und des Schutzes eine allegorische Annäherung an Christus dar.14 Nach der konstantinischen Wende ändert sich die Stellung der Christen und Jesus Christus wurde in Anlehnung an die römischen Illustrationen zum einen als Philosoph und Lehrer und zum anderen als siegreicher Kämpfer und Herrscher oder König dargestellt, wobei eine charakteristische Haltung und Komposition auszumachen ist.15 In der Gotik wurden die Leiden Jesu Christi thematisiert, da diese Verbildlichung des Schmerzens den Menschen Trost für ihre eigenen Leidenserfahrungen spendete und so eine Identifikation mit der Gestalt Christi erlaubte.16 Im Zeitalter der Renaissance wurde sich wieder an den antiken Ideen und Kunstformen orientiert. Infolgedessen wurde mit Jesus Christus erneut eine Macht und Herrlichkeit assoziiert, was dazu führte, dass er als Weltenrichter und 11 Vgl. Küster (1999), S. 53. Vgl. Winnekes, K., Entwicklung des Christusbildes bis zum 19. Jahrhundert, in: Dies. (Hg.), Christus in der bildenden Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Einführung, München 1989, S. 11-45, hier. S. 19. 13 Vgl. Pfeiffer (1986), S. 17-19. 14 Vgl. ebenda, 19f. 15 Vgl. Winnekes (1989), S. 20ff. 16 Vgl. ebenda, S. 27-29. 12 5 Herrscher definiert wurde.17 Dabei bietet die Gestalt Christi eine ideale Projektionsfigur für den Kunstschaffenden zum Diskurs seiner Biographie, seiner Person und seines Glaubens. Denn in der Renaissance wurde die Einmaligkeit des Individuums hervorgehoben, weshalb auch die Künstler zu einer Art Schöpfer erhöht wurden, die sich selbst, ihre Persönlichkeit und ihr Selbstverständnis als schaffender Künstler in ihren Kunstwerken ausdrückten. Gerade die Motive der Kreuzigung und der Passion offenbarten die Möglichkeit zur Expression verschiedenster Emotionen, die von Angst, Wut und Enttäuschung bis hin zur Ehrerbietung und Frömmigkeit reichen können.18 In den darauffolgenden Epochen des Barock und der Romantik kam es zur realistischen Vermenschlichung Christi. So wurde er als einfacher Mann gemalt, der eine betonte Frömmigkeit und Schönheit repräsentierte. 19 Die religiöse Kunst dieser Jahrhunderte stand dabei oft im Widerspruch zu den vorherrschen Problemen und Zuständen der Zeit und versuchte eine Hoffnung auf ein besseres Leben auszudrücken, indem man sich aus der Gegenwart in eine idealisierte Vergangenheit flüchtete. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wollten die expressionistischen Kunstschaffenden dann das Wesentliche eines Gegenstandes zum Ausdruck bringen und lösten dafür die konventionellen Regeln der Malerei auf. Sie veränderten die Formen und wählten Farben, die nicht mehr der Realität entsprachen.20 Im 20. und 21. Jahrhundert lässt sich hingegen kein gemeinsamer Nenner für die Art der Christusdarstellungen finden. Charakteristisch für diese Zeit sind allerdings die Verfremdung, die Abstraktion, die als Ausdruck einer Provokation, einem Protest oder einer Kritik an der Gesellschaft fungieren. Schließlich spielen in diesen Jahrhunderten aufgrund der Weltkriege und der zunehmenden Probleme der Menschheit der Tod und das Leid eine zentrale Rolle.21 Beispielsweise wird Jesus nun wieder als Gekreuzigter zum Symbol für die Leiden oder aber als ein einfacher Mensch der heutigen Zeit dargestellt, der 17 Vgl. Winnekes (1989), S. 24f. Vgl. Pfeiffer (1986), S.46-51 19 Vgl. Winnekes (1989), S. 37f. 20 Vgl. ebenda, S. 58f. 21 Vgl. Mennekes, F., Winnekes, K., Das Christusbild in der Moderne, in: Dies. (Hg.), Christus in der bildenden Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Einführung, München 1989, S. 45-81, hier S. 67. 18 6 an den gesellschaftlichen Zuständen zugrunde geht.22 Die Darstellungsformen sind zudem auch nicht mehr einheitlich, sodass selbst abstrakte Elemente wie Skulpturen und Rauminstallationen Jesus Christus repräsentieren, da sie in spiritueller Weise unter Hinzunahme der eigenen Erfahrungen gedeutet werden müssen.23 Heute in der Welt der Moderne gibt es nur noch wenige Darstellungen und Porträts Jesu Christi jenseits der Kreuzesthematik, da sich durch die Säkularisierung die Kunst von der Kirche als vorgebende Institution distanziert hat und zu einer autonomen Ausdrucksform geworden ist. Insgesamt zeigt sich, Identifikationsangebot dass die Tendenz, zurückzugreifen, auf Christusbilder untrennbar mit als dem Emanzipationsprozess der Kunst verbunden ist, welcher vorrangig auf der Kritik an gesellschaftlichen und historischen Gegebenheiten und Zuständen basiert. So ergibt sich, dass für unterschiedliche zeitliche Epochen und künstlerische Strömungen charakteristische Jesusbilder existieren, die den jeweiligen Zeitgeist einfangen und widerspiegeln. Die Christusdarstellungen selbst sind dabei vollkommen unterschiedlich, verlieren aber in der zeitgenössischen Kunst zunehmend an Wert aufgrund der diffusen Religiosität unserer Gegenwart und der Herausforderungen der heutigen Gesellschaft.24 2.2.2 Christusdarstellungen in den Fremdreligionen Das Motiv Jesus Christus inspirierte nicht nur europäische Künstler*innen, sondern auch Kunstschaffende aus dem fremdreligiösen und fremdkulturellen Raum. So existieren auch individuelle Darstellungen Christi im Islam, auf dem afrikanischen Kontinent und in der religiösen Pluralität der asiatischen Welt. Zurückzuführen sind diese Bilder wiederum auf die charakteristischen christologischen Konzepte und christlichen Einflüsse.25 In den afrikanischen Kulturen findet „Jesus Christus als Sieger über die Mächte des Bösen Verehrung“.26 Eine große Rolle spielen dabei Masken. Denn „eine 22 Vgl. Pfeiffer (1986), S. 66ff. Vgl. Mennekes, Winnekes (1989), S. 75f. 24 Vgl. Mennekes, F., Winnekes, K., Christusbezüge in der Gegenwartskunst, in: Dies. (Hg.), Christus in der bildenden Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Einführung, München 1989, S. 129-148, hier S. 131. 25 In diesem Kapitel wird nicht explizit auf die unterschiedlichen christologischen Konzeptionen eingegangen, sondern versucht anhand von exemplarischen Beispielen die künstlerischen Darstellungsformen Jesu Christi vorzustellen. 26 Siehe Küster (1999), S. 64. 23 7 der zentralen Funktionen der Masken im traditionellen Afrika ist die Repräsentation von Ahnen oder Geistern, die in ihnen Gegenwart aufnehmen. Die Christusmaske repräsentiert analog den Christus praesens. Dieser Kruzifixus ist keine Darstellung des Leidenden. Es ist der Herr am Kreuz, der Christus victor, Urquell des Lebens.“27 In der asiatischen Welt hingegen prägen beispielsweise Einflüsse aus der reichen Vielfalt an Bildern und Gottheiten des Hinduismus die Darstellung Jesu Christi. Ein typisches Motiv ist hier in Anlehnung an den Gott Shiva, den kosmischen Tänzer, die Abbildung Christi „als den Schöpfungsmittler, der vor dem Vater tanzt.“28 Die getanzte Schöpfung und die Sonnensymbolik sind unweigerlich mit dem Christusbild verbunden. Darüber hinaus taucht Jesus als ein von Allah bevorzugter Prophet im Koran auf, der durch seine Frömmigkeit eine gewisse Hochachtung bei den Muslimen gewann und deshalb in ihren künstlerischen Darstellungen ebenfalls abgebildet wurde.29 In diesen Bildern werden Szenen aus dem neuen Testament, die auch in Suren des Korans erwähnt werden, skizziert, wobei Jesus als normaler Mensch mit den typischen ethnischen Gesichtszügen beschrieben wird, der aber über einen Feuerschein zum Ausdruck seiner Bedeutsamkeit verfügt. 3 Fachdidaktische Analyse In der fachdidaktischen Analyse soll ausgehend von der Lernausgangslage und der Lebenswelt der Schüler*innen die Auswahl der Christusdarstellungen als Thema der in dieser Arbeit präsentierten Unterrichtseinheit erläutert werden. Dazu werden diese Erkenntnisse in Verbindung mit den Fachanforderungen für das Fach Evangelische Religion des Landes Schleswig-Holstein und dem religionsdidaktischen Modell der Elementarisierung sowie dem kunstdidaktischen Modell des ästhetisch religiösen Lernens vernetzt und begründet dargestellt. 3.1 Die Lernenden Eine Unterrichtseinheit muss immer auf die entsprechende Schulklasse angepasst werden, in der sie umgesetzt wird, um eine produktive Lernumgebung 27 Siehe Küster (1999), S. 62. Siehe ebenda, S. 85. 29 Vgl. Bauschke, M., Jesus im Koran und im Islam, in: Zager, W. (Hg.), Jesus in den Weltreligionen, Neukirchen-Vluyn 2004, S. 55-87, hier S. 66f. 28 8 zu schaffen, in der die Schüler*innen ihre Kompetenzen fördern und entwickeln können. Entsprechend wurde bei der Planung dieser Unterrichtssequenz, die für die 10. Jahrgangsstufe konzipiert ist, Rücksicht auf die Lebenswelt und Lernausgangslage der Jugendlichen genommen. Vor dem Hintergrund der religiösen Heterogenität in der heutigen Gesellschaft und dem sich unterscheidenden Grad an religiöser Sozialisation kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Schüler*innen sich auf einem Kenntnisstand, konkret in Bezug auf die Christologie und Jesus Christus, befinden. Es muss eher angenommen werden, dass es sich um eine heterogene Lerngruppe handelt, in der der Glaube einer jeden Schüler*in individuell ausgeprägt ist.30 Aus diesem Grund ist es notwendig, das christologische Konzept von Heranwachsenden zu thematisieren.31 Die Entwicklung dieses Konstrukts korreliert nämlich mit den Stufentheorien von Fowler beziehungsweise Oser und Gmünder.32 Aus dieser Wechselseitigkeit folgt, dass Schüler*innen im Übergang zur Oberstufe und damit in der Spätpubertät über eine „subjektorientierte Christologie“ verfügen, die „an der individuellen Erfahrung orientiert“ ist.33 Sie „befinden sich in einem Prozess der Persönlichkeitsbildung, der insbesondere gekennzeichnet ist durch einen Umbruch in der Orientierung an den Sozialisationsinstanzen sowie im Streben nach Autonomie.“34 Infolgedessen wird die mystische Person Jesus Christus als Stellvertreter Gottes verstanden. Dies entspricht in Fowlers Stufenmodell des Glaubens der Stufe des synthetisch-konventionellen Glaubens. Der Glaube mit seinen Werten und Inhalten wird dabei zur Identitätsbildung und zur Entwicklung einer persönlichen Weltanschauung instrumentalisiert, welche aber 30 Vgl. Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein (Hg.), Fachanforderungen Evangelische Religion für allgemein bildende Schulen Sekundarstufe I und II, Kiel 2016, S. 12. 31 Allgemein gilt hier zu berücksichtigen, dass es grundlegende Unterscheidungen in den christologischen Konzepten von Jugendlichen gibt. So muss der Glaube an Jesus Christus von der christologischen Konzeption und dem Begriff Jesus Christus getrennt werden. Es muss auf einer historischen und einer existentiellen Ebene Jesus Christus differenziert und geschlossene religiöse Konzepte von Teil-Christologien unterschieden werden. Vgl. Büttner, G., Dieterich, V.-J., Die Entwicklung des Christologie-Konzepts, in: Englert, R., Mette, N., Zimmermann, M. (Hg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Unter Mitarbeit von Kerstin OchudloHöbing, Münster 2015, S. 161-169, hier S: 161. 32 In dieser Arbeit wird sich an dem „Stufenmodell des Glaubens“ nach James W. Fowler orientiert. Vgl. ebenda. 33 Vgl. Büttner, Dieterich, S. 164. 34 Siehe Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein (2016), S. 12. 9 jeweils „noch unreflektiert“ sind und „kritisch überprüft“ werden müssen.35 „Der junge Mensch kann sich jetzt selbst eine Vorstellung davon machen, wie seine Person und sein Glaube sich entwickelt haben.“36 Gleichwohl müssen diese Erkenntnisse aber ebenso reflektiert werden, weil durch sie keine Allgemeingültigkeit für eine Lerngruppe vorausgesetzt werden kann. Stattdessen können sie nur als ein Richtwert zur eigenen Orientierung und als möglicher Ausgangspunkt für die eigenen Erwartungen genutzt werden. Es kann jedoch festgehalten werden, dass eine gewisse Grundskepsis charakteristisch für Jugendliche dieses Alters ist. Diese Grundhaltung kann „zum einen eine Verunsicherung, zum andern aber auch die Freude am klaren und konsequenten Durchdringen von logischen Gedankengängen zum Ausdruck bringen“.37 In Bezug auf die Christologie sind weiterhin drei Grundtendenzen festzuhalten, die definierend für das Konzept der Schüler*innen sind: die Subjektvierung, die Fokussierung auf die Ethik, aber auch ein Relevanzverlust.38 Ausschlaggebend ist hierfür oft ein nur basales Grundwissen zu Jesus Christus aufgrund einer schwachen religiösen Sozialisation. „Die religiös relevanten und existentiellen Erfahrungen, die die Heranwachsenden in ihrer außerschulischen Sozialisation nicht (mehr) machen, sollen entweder anhand von Bildern erworben, oder es sollen Alltagserfahrungen der SuS erneut ästhetisch, kritisch reflektiert werden.“39 3.2 Das Thema und die didaktische Reduktion In dieser Unterrichtseinheit werden unterschiedliche Christusdarstellungen aus verschiedenen Kunstepochen und Kulturkreisen sowie aus Fremdreligionen behandelt. Demnach handelt es sich um Teilaspekte der Christologie, die in der Sachanalyse bereits dargelegt worden sind. Nach den Fachanforderungen des Landes Schleswig-Holstein für das Unterrichtsfach Evangelische Religion ist diese Einheit für die Jahrgangsstufe 10 der Sekundarstufe I vorgesehen und dem Kompetenzbereich I „Die Frage nach Gott“ zuzuordnen.40 Konkret wird sich auf Vgl. Spaeth, F., Theorien religiöser Entwicklung, in: Bosold, I., Kliemann, P. (Hg.), „Ach, Sie unterrichten Religion?“. Methoden, Tipps und Trends, München 32012, S. 129-137, hier S. 133. 36 Vgl. ebenda. 37 Siehe Büttner, Dieterich (2015), S. 165. 38 Vgl. Büttner, Dieterich (2015), S. 165. 39 Siehe Gärtner (2015), S. 19. 40 Siehe Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein (2016), S. 20. 35 10 die Punkte „Rezeption Jesu Christi in nichtchristlichen Kontexten“ und „Christusdarstellungen in Kunst, Literatur, Musik und Film“ berufen. Im Sinne der didaktischen Reduktion wird sich auf ausgewählte Christusdarstellungen in der Kunst, die sich zum Beispiel aufgrund ihrer charakteristischen Exemplarität einer Strömung oder als Ausdruck des Glaubens einer Künstler*in und in Fremdreligionen fokussiert, um die Schüler*innen nicht mit der schieren Menge an medialen Möglichkeiten wie Liedern, Filmen, Musicals oder Romanerzählungen zu überfordern und so ihren persönlichen Lernprozess möglicherweise zu behindern. Ebenso wird sich bei der Konzeption der Unterrichtseinheit und der Auswahl der Inhalte an den Dimensionen der Elementarisierung nach Nipkow orientiert.41 Mittels der Christusdarstellungen soll versucht werden, charakteristische Grundelemente der Christologie und die entsprechenden charakteristischen Verstehensvoraussetzungen für die jeweilige Altersstufe herauszuarbeiten (Frage nach den „elementaren Strukturen“ und den „elementaren Anfängen“). Die Beschäftigung mit dem eigenen Jesusbild dient zur Entdeckung und Reflexion der eigenen Lebens- und Glaubenserfahrungen (Frage nach den „elementaren Erfahrungen“ und der „elementaren Wahrheit“). Auf diese Weise wird ein Raum eröffnet, der die Begegnung von den Schüler*innen mit Jesus Christus zulässt. Dieser Begegnungsprozess und damit verbunden die Reflexion der eigenen Person kann zu einer Stärkung und Entdeckung des eigenen Selbstverständnisses betragen. „Kunstwerke können helfen, persönliche Vorstellungen von Hintergründigem und Transzendentem zu klären, da sie andere Dimensionen unserer Wirklichkeit zugänglich machen können.“42 Die Thematik der Christusdarstellungen eignet sich unter der Prämisse der religiösen Heterogenität insofern, dass zwar ein christliches Motiv den Inhaltsschwerpunkt der Unterrichtseinheit bildet, dieses aber durch den ästhetischen Zugang anhand von Bildern für jeden Schüler*in zugänglich sein kann. Zudem wird mit Christusdarstellungen aus dem fremdreligiösen Umfeld gearbeitet, wodurch Schüler*innen, die über einen nicht-christlichen Hintergrund verfügen, die Möglichkeit eröffnet wird, sich auf ganz besondere Vgl. Kliemann, P., Elementarisierung, in: in: Bosold, I., Ders. (Hg.), „Ach, Sie unterrichten Religion?“. Methoden, Tipps und Trends, München 32012, S. 20-25, hier S. 22. 42 Vgl. Goecke-Seischab, M.-L., Christliche Bilder verstehen. München 2004. S. 138. 41 11 Weise in den Unterricht einzubringen und von eigenen Erfahrungen und Kenntnisse zu berichten. Für die gesamte Einheit bietet sich ein fächerübergreifender Unterricht in Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst an, damit die Schüler*innen die ausgewählten Werke aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten und dabei jeweils fachspezifische Aspekte genauer betrachten können. 3.3 Umfang, Ziele und Kompetenzen Für diese Unterrichtseinheit sind insgesamt acht Unterrichtsstunden anzusetzen. Die Stundenanzahl ist so gewählt, dass ausreichend Zeit für die verschiedenen Arbeitsphasen vorhanden ist und diese in einem ausgewogenen Gleichgewicht zueinanderstehen, was wiederum die zwei Arbeitsschwerpunkte der Einheit erklärt. In der Einführungsstunde der Einheit verfolgt die Lehrkraft das Ziel, einen Überblick über die bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse der Schüler*innen bezüglich von Christusdarstellungen zu gewinnen und gibt einen ersten Einblick in die folgenden Unterrichtsstunden. Dazu wird sich mit einem Jesusmosaik und einem dazu verfassten Gedicht befasst. Ebenso soll den Schüler*innen im Sinne eines kompetenzorientier Unterrichts eine Vorschau auf die kommenden Inhalte und Ziele der Unterrichtseinheit gegeben werden. Dadurch werden sowohl die Zielklarheit als auch die Transparenz hervorgehoben. In der ersten Hälfte der Einheit liegt der Schwerpunkt auf der Förderung der Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz sowie der Befähigung zu einer theologischen Deutungskompetenz, indem die Schüler*innen sich mit verschiedenen Christusdarstellungen als religiös bedeutsamen Zeugnissen auseinandersetzen.43 Denn diese Auseinandersetzung mit Kunstwerken im Sinne des ästhetisch orientierten Lernens bietet ein wichtiges Erfahrungspotential für religiöse Lernprozesse.44 Ziel ist es, dass die Schüler*innen die verschiedenen Darstellungen in ihren jeweiligen historischen, kulturellen und religiösen Kontext einordnen, die Werke beschreiben und ihren religiösen Gehalt deuten können. Darüber hinaus ist es beabsichtigt, die aktuelle Relevanz der Bilder zu 43 Vgl. Gärtner, C., Mit Bildern lässt sich besser lernen!?. Die Frage nach der Funktion und Wirkung von Bildern im Religionsunterricht aus religionspädagogischer Perspektive, in: Dieselbe, Brenne, A. (Hg.), Kunst im Religionsunterricht – Funktion und Wirkung. Entwicklung und Erprobung empirischer Verfahren, Stuttgart 2015, S. 13-27, hier S. 18. 44 „Bild- bzw. kunstorientiertes religiöses Lernen ist hierbei als ein Teilbereich ästhetischen Lernens zu betrachten.“ Siehe ebenda, S. 17. 12 erschließen und in Beziehung zum eigenen Leben und zur gesellschaftlichen Wirklichkeit zu setzen. Es ist darauf zu achten, dass die Eigenständigkeit und wertigkeit eines jeden Kunstwerkes herausgestellt wird, wodurch gleichzeitig gezeigt werden kann, dass Bilder das eigenständige Erarbeiten theologischer Erkenntnisse ermöglichen und zur Hinterfragung von christlichen Traditionen und Glaubensinhalten führen können. Demnach kann aus diesen neu entfalteten Potentialen, die Entwicklung eines Kultur- und Traditionsbewusstseins angebahnt werden.45 Im Unterschied dazu soll in der zweite Hälfte auf den erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen aufgebaut werden, indem mit dem neu erarbeiteten Wissen zu Jesus Christus gestalterisch gearbeitet wird. Die zu fördernde Hauptkompetenz ist deshalb die Gestaltungskompetenz, da die Schüler*innen ihre eigene Christusdarstellung entwickeln sollen, indem sie religiös bedeutsame Ausdrucks- und Gestaltungsformen reflektiert einsetzen und verwenden. Gleichzeitig wird der Erwerb der Fähigkeit zur Selbstreflexion begünstigt. Insgesamt wird in dieser Einheit der Versuch unternommen durch gezielte Maßnahmen seitens der Lehrkraft, motiviertes Lernen der Schüler*innen zu bewirken. Es ist ein roter Faden in der Einheit erkennbar, der den Schüler*innen durch die Zielklarheit der Aufgabenstellung mit ihrem herausfordernden Charakter verdeutlicht wird. Durch die Lehrkraft wird den Schüler*innen zudem signalisiert, dass ihnen zugetraut wird, sich die Lehrinhalte selbst und in Gruppen zu erschließen und ihre Kompetenzen auf diese Weise weiterzuentwickeln, indem sie sich auf die Lerninhalte und Thematiken einlassen und eigene Akzente bei der Bearbeitung der Aufgaben setzen. Für die Gruppenarbeitsphasen ist entsprechend dafür zu sorgen, dass in der Klasse ein Unterrichtsklima etabliert wird, bei dem der respektvolle und freundliche Umgang miteinander an erster Stelle steht. Dazu zählen beispielsweise die gemeinsame Beschließung von Gesprächs-, Verhaltens- und Feedbackregeln. Im letzten Schritt gilt es die persönliche und inhaltliche Relevanz des Themas aufzuzeigen. Wenn die Schüler*innen den Nutzen für ihre eigene Person erkennen und den Bezug zu ihrer Lebenswelt und Erfahrungen herstellen, sind sie motivierter, sich mit dem Thema Jesus Christus und seinen Darstellungen in der Kunst zu beschäftigen. 45 Vgl. Gärtner (2015), S. 17f. 13 3.4 Die Unterrichtseinheit Stunde 1. 2./3. 4./5. Thema der Stunde Hauptlernziel und Lernziele Was verbinde ich denn überhaupt mit Jesus Christus? Die Schüler*innen sollen… … ihre persönlichen Assoziationen mittels der verschiedenen Karten zu Jesus Christus äußern Von Dürer über Michelangelo bis zu Nolde und Dalí – Jesusdarstellungen im Wandel der Zeit … das Jesusmosaik mit dem dazugehörigen Gedicht beschreiben und deuten … unterschiedliche ästhetische Jesusdarstellungen in ihren historischen Kontext einordnen und beschreiben sowie präsentieren Jesusbilder in der Welt – interreligiöse und interkulturelle Darstellungen 6. Vorbereitung der Kunstausstellung 7./8. Kunstausstellung: Mein Jesusbild, dein Jesusbild, unser Jesusbild … zu den unterschiedlichen Jesusdarstellung Stellung beziehen und ihre eigene Position reflektieren … die Vielfalt interreligiöser und interkultureller Jesusdarstellungen kennen und diese als Ausdrucksformen des Glaubens beschreiben und erläutern …die Jesusdarstellungen anderer Religionen und Kulturkreise reflektieren und Konsequenzen für die Lebenswirklichkeit nachvollziehen … ihr eigenes Jesusbild in schriftlicher und künstlerischer Form erarbeiten … ihr eigenes künstlerisch erarbeitetes Jesusbild präsentieren und reflektieren … ihr eigenes Jesusbild kriteriengeleitet mit den Jesusdarstellungen anderer vergleichen Kompetenzschwerpunkt Methodik und Materialien Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz Assoziationskarten (+Blitzlicht) Mind-Map Jesusmosaik + Gedicht Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz (Deutungskompetenz) Gruppenpuzzle Deutungskompetenz (Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz, Dialogkompetenz) Stationenlernen Gestaltungskompetenz Poster, Bilder (fächerübergreifend mit dem Kunstunterricht) Galeriegang Gestaltungskompetenz (Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz) verschiedene Christusdarstellung aus unterschiedlichen Kunstepochen Beobachtungsbogen Austausch der Eindrücke im Plenum 14 4 Methodische Analyse Die in dieser Arbeit präsentierte Unterrichtseinheit zeichnet sich durch einen hohen Grad an Subjektorientierung in den unterschiedlichen Arbeitsphasen und an Produkt- beziehungsweise Prozessorientierung aus. Zu Beginn dieser Unterrichtseinheit ist es sinnvoll, in der Einführungsstunde eine Lernstandserhebung durchzuführen, um in Erfahrung zu bringen, welche Attribute, Namen, Geschichten etc. die Schüler*innen mit Jesus Christus assoziieren, um auf dieser Basis weiter in der folgenden Unterrichtsstunden aufzubauen.46 Wie in der didaktischen Analyse bereits vorgestellt, lässt sich die Einheit in zwei Arbeitsschwerpunkte untergliedern. In der ersten Phase geht es verstärkt um die Erarbeitung und Deutung des religiösen Gehalts von Kunstwerken verschiedener Künstler, die Jesus Christus darstellen, und Darstellungen aus dem Judentum, dem Islam und dem Hinduismus, die eine neue Perspektive auf die Person Jesus Christus ermöglichen. Die Bilderschließung sollte dabei aber nach einem bestimmten Muster erfolgen, welches den Schüler*innen die Begegnung mit dem Gemälde erleichtert. Im Umgang mit Bildern im Religionsunterricht existieren nämlich zwei zentrale Problemfelder. „Zum einen fehlt den allermeisten Religionslehrer/innen eine sachgemäße kunstpädagogische Ausbildung, die es ihnen ermöglichen würde, mit einer gewissen Souveränität und Leichtigkeit den Schülern einen Zugang zu Bildern zu ermöglichen.“47 Dieses Problem lässt sich insofern lösen, dass entweder die Kunstlehrkraft bei einem fächerübergreifenden diese Aufgabe übernimmt und im Kunstunterricht die entsprechende Methode einführt oder die Religionslehrkraft sich mit der entsprechenden Methodik befasst und den Rat im Kollegium sucht. Zum anderen besteht das Problem, dass „ein Großteil der Schülerinnen und Schüler weder mit der traditionellen noch mit der neueren biblischen Bildwelt vertraut ist.“ 48 Als Konsequenz daraus ergibt sich, dass eine Methodik und Zugänge gefunden werden 46 müssen, die dieser Problematik entgegentreten. In dieser Die Lernstandserhebung soll in diesem Fall so erfolgen, dass jedes Klassenmitglied sich aus einer Vielzahl an Bildkarten diejenige aussucht, mit der es persönlich Jesus Christus verbindet. Die verschiedenen Assoziationen werden dann in einer Mind-Map an der Tafel festgehalten. Die Aussagen können sowohl in mündlicher als auch schriftlicher Form und damit anonym geäußert werden. 47 Siehe Binder (2012), S. 144. 48 Siehe ebenda. 15 Unterrichtseinheit wird dabei sowohl auf eine bildimmanente Interpretation als auch auf eine kontextuelle Bildauslegung Wert gelegt.49 „Auf die spontane Wahrnehmung der Rezipient/-innen (1.) folgt die Analyse der Formensprache (2.), die wiederum an die Innenkonzentration der Betrachter/-innen rückgebunden wird (3.). Daran schließt sich die umfassende Analyse des Bildgehalts (4.) an […] Hieran kann sich die subjektive Auseinandersetzung der Rezipient/-innen mit dem Kunstwerk anschließen (5.).“50 Um eine Vielzahl an Werken aus unterschiedlichen Epochen bearbeiten zu können, wird auf die Methode des Gruppenpuzzles zurückgegriffen, bei der sich die Schüler*innen in einer Gruppe zunächst ein bestimmtes Werk anhand von Aufgabenstellungen und festgelegter Kriterien selbst erarbeiten. Im Anschluss werden neue Gruppen gebildet, in der jeweils ein Mitglied seine vorherige Gruppe und sein Kunstwerk vertritt. In dieser neuen Gruppenkonstellation werden die verschiedenen Werke vorgestellt und die Ergebnisse der Aufgaben untereinander ausgetauscht. In der Sicherungsphase werden dann die Ergebnisse der einzelnen Gruppendiskussionen an der Tafel in einer Tabelle festgehalten und so für alle Schüler*innen visualisiert und zur Verfügung gestellt. In der darauf folgenden Unterrichtsstunde werden die Christusdarstellungen der Fremdreligionen anhand des Stationenlernens in den Fokus genommen. In Kleingruppen erarbeiten sich die Schüler*innen an mehreren Stationen die verschiedenen Aspekte zu den Jesusbildern, wie sie beispielsweise im Islam oder Hinduismus vorkommen. Diesen Darstellungen kommt eine besondere Bedeutung zu, da die fremden, aus den Schüler*innen unbekannten Kulturkreisen stammenden Bilder zum kritisch-konstruktiven Überschreiten von Tradition und Glauben anregen können und so die Chance auf einen Dialog zwischen den Religionen und Kulturen eröffnen.51 Erneut sichert die Lehrkraft die Ergebnisse der Schüler*innen-Gruppen und leitet in eine Diskussion der Resultate über. In der zweiten Phase der Unterrichtseinheit soll eine Kunstausstellung mit dem Titel „Mein Jesusbild, dein Jesusbild, unser Jesusbild“ von den Schüler*innen 49 Mit der bildimmanenten Bildinterpretation wird der Dialog zwischen Betrachter und Bild bezeichnet, wohingegen bei der kontextuellen Bildauslegung zusätzliche Informationen über den Künstler und die Epoche beispielsweise hinzugezogen werden, die dem Bild selbst nicht zu entnehmen sind. Vgl. Niehl, F. W. und Thömmes, A., 212 Methoden für den Religionsunterricht, München 2014, S.14f. 50 Siehe Gärtner (2015), S. 17. 51 Vgl. ebenda, S. 18 16 gemeinsam geplant und entwickelt werden. Diese authentische Aufgabenstellung soll die Schüler*innen motivieren, sich mit dem zuvor erarbeiteten Fachinhalt des Christusbildes zu befassen, und trägt zu einer Förderung des Qualitätsbewusstseins und der ästhetischen Wahrnehmung bei.52 Dazu soll jedes Klassenmitglied auf gestalterische Weise ein eigenes Christusbild anfertigen, das in der heutigen Zeit spielt und sich gegebenenfalls an ein im Unterricht behandeltes Kunstwerk anlehnt und eine eigene Auseinandersetzung mit der Person Jesu eröffnet. In welcher Form die Schüler*innen ihr eigenes Christusbild erstellen ist ihnen freigestellt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hilfreich wäre auch hier ein fächerübergreifender Unterricht, womit den Schüler*innen mehr Zeit und Material zur Anfertigung ihrer Christusdarstellungen zur Verfügung gestellt wird. In dem sich anschließenden Galeriegang werden dann die fertigen Produkte den anderen Schüler*innen präsentiert, die zuvor im Klassenraum aufgehängt wurden.53 In dieser kooperativen Lernphase haben die Schüler*innen die Möglichkeit, sich mit den Christusbildern ihrer Mitschüler*innen auseinandersetzen, Fragen zu stellen und in Beziehung zu ihrer eigenen Darstellung setzen. Es wird zudem von der Lehrkraft ein Beobachtungsbogen an die Schüler*innen ausgeteilt, mit dessen Hilfe sie anhand von konkreten Fragestellungen die unterschiedlichen Werke betrachten können. Dieser Arbeitsschritt soll dazu dienen, dass die Schüler*innen ihr eigenes Jesusbild im Hinblick auf die Darstellungen ihrer Peers reflektieren. Das Bild regt zu einer kognitiven Aktivierung an und kann affektive Lernprozesse initiieren, indem die Kunstwerke in spiritueller Perspektive erschlossen werden.54 Hierfür eignen sich wieder die zuvor beschriebenen „5 Stufen der Bildbegegnung“. In der abschließenden Zusammenführung ist es die Aufgabe der Lehrkraft, die Eindrücke und Antworten der Schüler*innen auf die Christusdarstellungen der Mitschüler*innen und der Fragen und Anregungen des Beobachtungsbogens zu bündeln und produktiv in einer Diskussionsrunde zu besprechen. Vorrangig 52 Vgl. Niehl, F. W. und Thömmes, A. (2014), S. 40. Die erstellte Kunstaustellung kann zudem für weitere Klassenstufe oder die gesamte Schule öffentlich gemacht werden. Wenn außerdem weitere Religionskurse beziehungsweise -klassen an der Schule existieren, kann mit diesen die Ausstellung zusammengeplant und ausgerichtet werden. Denkbar wäre auch die zeitliche Abpassung der Unterrichtseinheit mit einer Projektwoche, in der dann ebenfalls die erstellen Christusdarstellung präsentiert und zugänglich gemacht werden können. 54 Vgl. Gärtner (2015), S. 16. 53 17 dient dies dazu, den Schüler*innen ein konstruktives Feedback zu ihren Arbeiten zu geben, welches sie in die schriftliche Konzeption ihres Christusbildes einfließen lassen können. Denn die Verschriftlichung ihres Konzepts mit einer begründeten Darstellung ihrer Entscheidungen und einer Selbstreflektion ersetzt die Leitungsbeurteilung in Form eines Tests oder Klausur. Bewertet wird nicht nur das fertige Produkt, sondern auch der Prozess, der zu diesem geführt hat. Auf diese Weise kann die Individualität eines jeden Schüler*in berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden die Schüler*innen bei dieser Form der alternativen Leistungsbeurteilung zu mehr Eigenständigkeit und zu einer verstärkten Verantwortungsübernahme angeregt. Als Richtlinien gelten für die Schüler*innen die zuvor im Plenum festgelegt Kriterien, die für mehr Transparenz bei der Benotung sorgen, indem Ziele offengelegt und Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt werden. 18 5 Literaturverzeichnis Abkürzungen von Monographiereihen oder Zeitschriften sowie antiker biblischer und jüdischer Quellen erfolgen nach dem Abkürzungsverzeichnis von Schwertner, Siegfried M., IATG3. Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin/New York 32014. Kurztitel wurden nach dem Muster Verf. oder Herausgeber (Publikationsjahr), Seite. gebildet. Bauschke, Martin, Jesus im Koran und im Islam, in: Zager, Werner (Hg.), Jesus in den Weltreligionen, Neukirchen-Vluyn 2004, S. 55-87. Binder, Anton, Bilder, in: Bosold, Iris, Kliemann, Peter (Hg.), „Ach, Sie unterrichten Religion?“. Methoden, Tipps und Trends, München 32012, S. 144147. Büttner, Gerhard, Dieterich, Veit-Jakobus, Die Entwicklung des Christologie-Konzepts, in: Englert, Rudolf, Mette, Norbert, Zimmermann, Mirjam (Hg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Unter Mitarbeit von Kerstin Ochudlo-Höbing, Münster 2015, S. 161-169. Gärtner, Claudia, Mit Bildern lässt sich besser lernen!?. Die Frage nach der Funktion und Wirkung von Bildern im Religionsunterricht aus religionspädagogischer Perspektive, in: Dieselbe, Brenne, A. (Hg.), Kunst im Religionsunterricht – Funktion und Wirkung. Entwicklung und Erprobung empirischer Verfahren, Stuttgart 2015, S. 13-27. Goecke-Seischab, Margarete-Luise, Christliche Bilder verstehen. München 2004. Kliemann, Peter, Elementarisierung, in: in: Bosold, Iris, Derselbe (Hg.), „Ach, Sie unterrichten Religion?“. Methoden, Tipps und Trends, München 32012, S. 20-25. Kühn, Ulrich, Christologie, Göttingen 2003. Küster, Volker, Die vielen Gesichter Jesu Christi. Christologie interkulturell, Neukirchen-Vluyn 1999. Mennekes, Friedhelm, Winnekes, Katharina, Christusbezüge in der Gegenwartskunst, in: Dieselbe (Hg.), Christus in der bildenden Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Einführung, München 1989, S. 129-148. 19 Dieselben, Das Christusbild in der Moderne, in: Dieselbe (Hg.), Christus in der bildenden Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Einführung, München 1989, S. 45-81. Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein (Hg.), Fachanforderungen Evangelische Religion für allgemein bildende Schulen Sekundarstufe I und II, Kiel 2016. Pfeiffer, Heinrich, Gottes Wort im Bild. Christusdarstellungen in der Kunst, München 1986. Niehl, Franz W., Thömmes, Arthur, 212 Methoden für den Religionsunterricht, München 2014. Pemsel-Maier, Sabine, Gott und Jesus Christus. Orientierungswissen Christologie, Stuttgart 2016. Schmid, Peter F., Ecce homo! – Seht, was für ein Mensch!, in: Englert, Rudolf, Mette, Norbert, Zimmermann, Mirjam (Hg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Unter Mitarbeit von Kerstin Ochudlo-Höbing, Münster 2015, S. 203-209. Winnekes, Katharina, Entwicklung des Christusbildes bis zum 19. Jahrhundert, in: Dieselbe (Hg.), Christus in der bildenden Kunst. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Einführung, München 1989, S. 11-45. Zisler, Kurt, Akzente des Christusbildes in der Kunst des 20. Jahrhunderts, in: Englert, Rudolf, Mette, Norbert, Zimmermann, Mirjam (Hg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Unter Mitarbeit von Kerstin Ochudlo-Höbing, Münster 2015, S. 145-149. Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Erklärung (ab Sommersemester 2008 obligatorisch den Hausarbeiten beizufügen) Name, Vorname: Kretschmann, Marek Matrikel-Nummer: 1021907 Hiermit versichere ich, dass ich die Hausarbeit mit dem Titel: Unterrichtseinheit: Jesus in Bildern erkennen – Christusdarstellungen im Wandel der Zeit und interreligiös Selbstständig verfasst habe und alle von den anderen Autoren übernommenen Gedanken wie auch Textstellen oder Passagen aus digital verfügbaren Dokumenten in der Ausführung meiner Arbeit gekennzeichnet sowie die Quellen korrekt zitiert habe. Ferner versichere ich, dass diese Arbeit noch nicht an anderer Stelle vorgelegen hat und ich die unten genannten Gesetzesgrundlagen zur Kenntnis genommen habe. Ort, Datum, Unterschrift Bei Täuschungsversuchen finden die §§ 6, 7, 12 und 21 der Studien- und Prüfungsordnung für Staatsexamens- und Magisterstudiengänge sowie § 21 der Prüfungsverordnung für Studierende der BA- und MA-Studiengänge Anwendung.