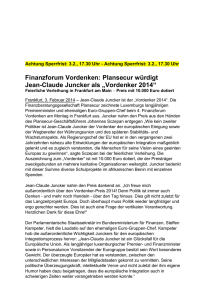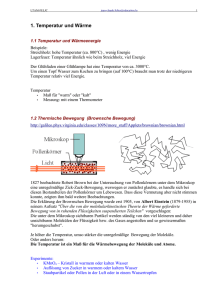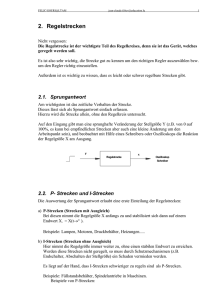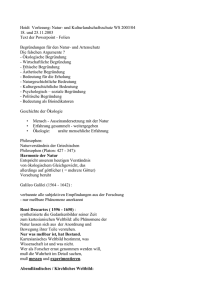Verbrannte Erde, bewegtes Leben
Werbung

VERBRANNTE ERDE, BEWEGTES LEBEN A m Beginn der Wegstrecke war nichts anderes zu sehen als hohes Steppengras und hunderte Fliegen. Schon bald bemerkte ich, dass diese Fliegen stachen und sich in der sengenden Mittagshitze mit Begeisterung auf uns stürzten. Die schroff aufsteigenden Felsen des hinter dieser flachen Graslandschaft liegenden Gebirges versprachen zwar landschaftliche Abwechslung und Schatten, wollten aber partout nicht näher kommen. Neben dem Gebirge am Horizont war das Einzige, das sich in dieser kargen Steppenlandschaft erhob, eine große Anzahl von Termitenhügeln.Spätestens als unser Führer Jean-Claude einen Stein umwendete und sich ein halbes Dutzend Skorpione zeigte, die er mit stoischer Nüchternheit als tödlich bezeichnete, bereute ich, diese Wanderung mit kurzen Hosen angetreten zu haben. Es schien, dass meine Begleiterin und ich in den Vorhof der Hölle geraten waren. Und das, nachdem wir uns in den letzten Tagen im Paradies wähnten, in Madagaskars Hochland, einer Landschaft von blühenden und noch zu erblühenden Reisfeldern in einem Farbenspiel zwischen Rot, Ocker und Grün. Tagelang begleiteten uns steil ansteigende Reisterrassen, die an Landschaften in Indochina erinnerten, und Menschen, die in ihren oft bunten Kleidern wie Farbtupfen in einer Pastelllandschaft wirkten. Hier nun war alles von der Sonne verbrannt, das Gras dunkelgelb und hart, tiefschwarz der Boden, und Mensch war in dieser unwirtlichen Gegend keiner zu sehen. Warum waren wir hierher gekommen? Um das Isalo-Gebirge zu sehen, das mit seinen Canyonlandschaften an Colorado erinnerte. Ein Nationalpark im Südosten Madagaskars, der inmitten des trockensten Gebiets der Insel lag. Was hatten wir auf uns genommen, um hierher zu gelangen? Zwölf Stunden in einen Kleinbus mit 25 Madegassen eingezwängt, waren wir über ruppige Sand- und Steinpisten geschaukelt und konnten uns danach nicht mehr bewegen. Neben den Beinen schmerzte meine Schulter, was auf meinen Sitznachbarn zurückzuführen war, einem hageren Mann, der unbegreiflicher Weise die meiste Zeit über geschlafen hatte und dessen knochiges Haupt bei unruhiger Piste schmerzhaft auf meine Schulterknochen fiel. Als wir mit verrenkten Gliedern endlich gegen Mitternacht in Ranohira, einem Bretterhaufen mitten in der Wildnis, ausstiegen, war kein Mensch zu sehen. Lange noch hörten wir die Musik unseres Busses, jene so fröhlichen afrikanischen Rhythmen, die uns stundenlang ohrenbetäubend gequält hatten und jetzt in der 1 sternenklaren Nacht verschwanden. Wir empfanden es als ein Wunder, dass wir in dem kleinen Hotel des Ortes ein wohliges Bett vorfanden. Das Zimmer war zwar ohne Strom und Warmwasser, aber das weiche Bett war eine Wohltat für unsere geplagten Glieder, die nur mehr einem sadistischen Orthopäden Freude bereitet hätten. Wenn ich irgendwelche Erfahrungen von meinen Reisen mitbrachte, dann war wohl die bedeutendste, dass ein gutes Bett der wichtigste Faktor einer gelungenen Reise war. Unser Führer war äußerst wortkarg, es schien mir, er erledigte seine Aufgabe nur mit Widerwillen. Viel zu schnell lief er über die stechende Graslandschaft, wartete dann mit gelangweiltem Blick auf uns, gönnte uns aber keine Ruhepause. Ich fühlte mich an so manche rücksichtslose, bergsteigende Älpler erinnert, die nur so taten, als würden sie Solidarität mit den Langsameren zeigen, dann aber, nachdem die Schwächeren eingetroffen waren, mit umso atemberaubenderem Tempo den Weg fortsetzten. Bei einem Dorf blieb Jean-Claude dann aber doch länger stehen. Die Häuser sahen sehr armselig aus. Anders als die hoch aufragenden Lehmhäuser im Hochland waren diese kleinen, flachen Verschläge aus Zweigen und Stroh gemacht, einsame Behausungen in dieser trockenen Einöde. Man machte sich keine Mühe, festere Häuser zu bauen. Der nächste Taifun würde sie ohnehin zerstören, zudem waren die Bewohner dieses Landstrichs, die Bera, Nomaden, die weiterzogen, wenn die Götter es von ihnen verlangten. Jean-Claude unterhielt sich mit einem Mann, der mit einer Fackel das Grasland rund um das Dorf in Brand steckte. Wir konnten ihrer Unterhaltung in Malagassy nicht folgen, aber die beiden schienen ihren Spaß zu haben. Kurz nachdem wir endlich das Gebirge erreichten, sahen wir schon, dass das Grasland rund um das Dorf brannte und sich dieses niedrige Feuer knisternd ausbreitete. Uns war nicht klar, welchen Sinn diese Brandrodung hatte, hatten wir doch keine Anzeichen von Landwirtschaft entdeckt. Die hier lebenden Menschen waren immer Viehzüchter, erklärte Jean-Claude, das Land war immer Weideland gewesen, wenngleich es über weite Teile des Jahres trockene Savanne war. Doch aus den Grasnarben der verbrannte Erde würde schon nach wenigen Tagen frisches Gras sprießen, und im Sommer, wenn der Regen käme, wäre diese Landschaft eine üppige grüne Landschaft – ein Fest für die Rinderherden. Jener Viehzüchter, der die meisten und best genährtesten Zebus, jene in Madagaskar verbreiteten Höckerrinder, besaß, würde auch am höchsten geachtet werden und konnte auch die Tochter eines anderen ehrenwerten Zebuzüchters heiraten und damit Ruhm und Reichtum vergrößern. Deshalb brannte man von jeher die Felder ab, auch wenn die Regierung es verboten hatte. In 2 anderen Teilen Madagaskars waren Primärwälder dieser alten Sitte zum Opfer gefallen und man hatte die Brandrodung unter Strafe gestellt. Aber seit jeher brannte man hier das Land nieder und würde auch jetzt nicht damit aufhören. Wir wendeten ein, dass wir weder im Dorf noch in dessen Umgebung Zebus gesehen hätten. Es gibt auch keine, lächelte Jean-Claude. Seit das Gebiet unter Naturschutz steht, Ausländer kämen, um die Canyons zu besuchen, seien die Viehzüchter weitergezogen. Diese lebten nun rund um die Stadt Ihosy, ein wanderndes Volk, das seine Herden mit Speeren und Gewehren bewachte und sich damit die Zeit vertrieb, die prachtvollsten Rinder des benachbarten Dorfes zu stehlen. Wer mehr als zehn Zebus besaß, war ein gemachter Mann. Nicht, dass er mit seinen Tieren Geld verdiente. Die Zebukühe gaben nur so viel Milch, um ihre Kälber zu ernähren, und geschlachtet wurde ein Tier nur, wenn ein Totenmahl gehalten oder der verstorbene Besitzer einer Herde geehrt wurde. Ein Zebu war ein Prestigeobjekt, und je mehr Zebuhörner auf einem Grab zu finden waren, umso mehr wurde der Verstorbene geachtet. Dennoch war mir unverständlich, warum man hier durch Brandrodung ein Weideland kultivierte, auf dem keine Tiere weideten. Es sei schwer für die Menschen, alte Gewohnheiten aufzugeben, meinte Jean-Claude lächelnd, sie hätten ja sonst nichts. Und so wanderten wir weiter und kamen nach zwei Stunden endlich vor dem ersten Felsen an, während sich hinter uns der Himmel von den Rauchwolken der brennenden Felder immer mehr verdunkelte. Wir stiegen einen steilen Fußpfad hinauf, immer noch war die Landschaft karg und unfruchtbar. Doch bei näherem Hinsehen erkannten wir auf dem brüchigen Sandstein der Felshügel, versteckt in Nischen aus Stein, kleine Bäumchen, sogenannte Zwergbaobabs - die Pachypodien. Als wir die erste Erhebung überwunden hatten, bot sich ein einmaliger Ausblick auf eine Felslandschaft, die tatsächlich mit jener der nordamerikanischen Canyons zu vergleichen war. Kerzengleich erhoben sich vor uns schroffe, bizarre Felsformationen, ein Tal von Stalagmiten, bevor am Horizont wieder höhere Steintürme aufstiegen. Le Paradis nannte unser Führer diese Landschaft, in der der Mensch der Formenvielfalt des Gesteins Namen wie “Krokodilfelsen” gegeben hatte. Nur wenige Menschen begegneten uns, darunter eine schlanke, junge Frau, die barfuß ging und auf ihrem Kopf einen Kanister mit Wasser trug. Mit schwingenden Hüften ging sie an uns vorbei und begrüßte uns mit „Bonjour Vazaha“ – „guten Tag, Fremder“, jener neugierigen wie respektvollen Begrüßung, die aus zwei Sprachen bestand, und die auf eigenartige Weise das Trennende mit dem Verbindenden in Einklang brachte. Die Frau hatte einen weiten Weg zurückgelegt, um Wasser zu holen, denn innerhalb dieser kargen Felslandschaft gab es nur 3 einen kleinen, fruchtbaren Streifen entlang eines Bächleins, das von den kleinen RavenalaBäumen gesäumt war. Die Ravenalas werden Bäume der Reisenden genannt, denn wenn man ihren Blattstamm knickt, fließt daraus reines Trinkwasser. Diesen Bäumen folgten wir, bis wir an einen oasengleichen Platz gelangten, an dem klares, hellgrünes Wasser in ein natürliches Steinbecken floss - das Piscine naturelle. Nachdem wir uns von den Strapazen der bisherigen Wanderung erholt hatten, gingen wir die Canyonlandschaft zurück, stiegen dann - wieder der prallen Sonne ausgesetzt - ein Tal hinab, das von steilen Felsen flankiert war. Dennoch waren wir sehr überrascht, in der Talsohle dichten, grünen Regenwald zu erblicken. Die Hoffnung, nun nach vier Stunden anstrengender Wanderung, in schattiges, bequem zu begehendes Terrain zu kommen, wurde alsbald enttäuscht. Denn in der kühlen Schlucht des Waldes galt es, über Felsblöcke zu klettern, bis man einen steil herabfallenden Wasserfall erreicht hatte. An allen Steinen des Felsens herrschte ein fröhliches, kühles Tropfen, nur ganz am Rande gab ein kleines Fenster im Berg den Blick auf den blauen Himmel frei. Es schien mir unglaublich, dass wir nur wenige Kilometer entfernt von einer trockenen Landschaft waren, die seit Monaten kein Wasser mehr empfangen hatte und nun in Flammen stand. Als wir durch die Schlucht zurückwanderten, war die Hälfte des Graslandes schon abgebrannt – dunkelgelbe Flächen wechselten sich mit schwarzen ab, Falken kreisten über der Landschaft, um flüchtende Nagetiere zu erhaschen. Auch wir mussten einige Umwege nehmen, um nicht in einen Brandherd zu gelangen und nicht nur einmal kam uns ein Schwarm von auseinanderstiebenden Riesenheuschrecken entgegen. Die tierischen Bewohner dieses verbrannten Landes waren in Aufruhr, nur die Menschen schienen ihren Spaß zu haben. Der Duft der verbrannten Erde und die Rauchwolken reichten bis nach Ranohira. Im einzigen Restaurant des Ortes gab es an diesem Tag zwei Speisen zur Auswahl, Huhn oder Zeburind. Wir entschieden uns für Zeburind, und während ich das Fleisch, das härter als gewöhnliches Rindfleisch war, schnitt, blickte ich hinauf zur Decke des Restaurants und bewunderte die kunstvolle Verzierung an der Mauer, auf der ein wahrscheinlich unbekannter Künstler die Tierwelt Madagaskars, hauptsächlich Spinnen und Geckos, abgebildet hatte. Dann erkannte ich aber, dass sich dieses Spektrum bewegte. Hier waren Spinnen auf der Decke, wahrscheinlich nicht weniger als zwei Dutzend. Diese Exemplare waren etwa 4 tellergroß, und ich hatte Angst, sie würden herunterkommen. Als eine Spinne der anderen über die Wand hinterher jagte, wahrscheinlich um sie zu fressen, fragte ich den Kellner, ob diese gefährlich seien. Er verneinte und meinte, diese Spinnen seien wie Katzen. Bis heute frage ich mich, ob sich dieser rätselhafte Vergleich auf deren ständige Kopulationsbereitschaft oder eher auf ihre Behaarung bezog. Wir gingen an diesem Abend früh zu Bett, und eigentlich waren wir durch die mangelnde Elektrizität froh über eine dunkle Nacht, die uns so manches Ungeziefer nicht vor Augen führte. Durch das Fenster kam nur der Schein des sich weiter ausbreitenden Feuers des Graslandes... A m nächsten Tag erwartete uns Jean-Claude für den nächsten Ausflug, zum Canyon de Maky, das Tal der Affen. Wiederum mussten wir zwei Stunden das Grasland durchwandern, doch heute war die Veränderung schon augenscheinlich. Wahrscheinlich zwei Drittel des Gebietes waren bereits abgebrannt. Wir gingen ausschließlich an Feuern und neuen Brandherden vorbei. Die Brände würden von selber aufhören, versicherte unser Führer. Meine Begleiterin, langsam beunruhigt über die verheerende Ausbreitung, fragte, ob den Menschen dieses Feuer nicht sinnlos erschien. Nein, im Feuer manifestiere sich die Macht des Schöpfergottes Zanahary, antwortete Jean-Claude. Viele Madegassen glauben, je näher sie sich beim Feuer befinden, umso mehr überträgt sich auf sie die Kraft von Zanahary. Deshalb sei der „Brandstifter“, den wir am Vortag getroffen hätten, auch so fröhlich gewesen. Und auch Jean-Claude schien es Spaß zu machen, über die allerorts verbreiteten Glutnester zu hüpfen und zu beobachten, wie die Sohlen unserer Sportschuhe langsam vor sich hin schmolzen. Als der Mittag nahte, tauchten vor uns gelb-ockere Felsen auf, dann kamen wir in ein kleines Wäldchen mit Eukalyptusbäumchen und vor uns öffnete sich das dicht bewachsene, wiederum von einem Bach durchflossene Tal der Affen. Wanderer, die uns begegneten, teilten uns mit leiser Aufregung mit, dass sie zwei verschiedene Lemurenarten, die nur in Madagaskar beheimateten Halbaffen, gesichtet hätten. Wir folgten einem Pfad, der teilweise durchs Dickicht führte. Schließlich entdeckten wir, durch Zweige von allerlei Dornengestrüpp spähend, eine Gruppe Kattas auf einem Felsvorsprung. Es waren vielleicht zehn Tiere, die es sich hier im Schatten der Felsnische gemütlich gemacht hatten und ihre langen, geringelten Schwänze hinabhängen ließen. Sie schauten neugierig in die Ferne und blickten eher beiläufig 5 auf uns herab. Danach machten wir uns auf die Pirsch nach den Sifakas, einer anderen Art, die man abschätzig als „weiße Baumpudel“ bezeichnen konnte, da sie ein sehr buschiges, weißes Fell und schwarze Nasen hatten und durch ihre Wendigkeit, mit der sie sich von Baum zu Baum schwangen, einen ausgesprochen heiteren Eindruck machten. Beeindruckend ihre Sprungkraft, mit der sie zehn Meter und mehr, nur mit dem Schwanz steuernd, von Baum zu Baum flogen. Jean-Claude, der uns beim Aufspüren der Halbaffen behilflich war, wollte ihnen dann aber doch nicht zu nahe kommen. Im Naturglauben der Madegassen sind die Lemuren die Träger von Geistern der Ahnen. Und tatsächlich kann einem mulmig werden, wenn man den nächtlichen Schauergesängen dieser kleinen Geschöpfe lauscht. Auch bei der Rückkehr nach Ranohira war einmal mehr ersichtlich, wie sehr Jean-Claude den weithin verbreiteten Naturglauben respektierte und praktizierte. Am Ausgang des Tales machte er einen großen Bogen um einen rechteckigen Steinhaufen, und als ich auf diesen zuging, pfiff er mich zurück und bedeckte die Augen mit den Händen. Als ich fragte, warum, sagte er nur „fady“ – Tabu. Hier war ein Grab, das man nicht betreten durfte. Ich sah trotzdem hin – es war mit Dutzenden Zebuhörnern geschmückt. Zurück im Grasland erwartete uns eine schwarze Landschaft aus Rauch und Staub. Es war vollendet, das gesamte Gebiet zwischen dem Ort und den Felsen des Isalo-Gebirges war abgebrannt. Wir erreichten das Dorf, an dem uns am Vortag noch der „Brandstifter“ begegnet war, und - hier war selbst Jean-Claude überrascht - auch die kleinen Hütten aus Stroh und Zweigen waren abgebrannt. Die Bewohner waren weitergezogen. Warum? Hier wusste auch Jean-Claude keine Antwort. Er selbst sei sesshaft, was in den Köpfen der Nomaden vorgehe, wisse er nicht. Er nehme aber an, dass sie der Landschaft, in der sie lebten, überdrüssig waren. Am nächsten Tag verließen wir dieses ausgebrannte, öde Land. Ich kann nicht behaupten, dass es vorher schöner als nachher war. Das Feuer hatte nichts zerstört, was nicht schon zuvor die Sonne vergewaltigt hatte. Das Feuer war die einzige Abwechslung im Leben der Menschen. Anderswo ging man auf den Kirtag, hier zündete man sein Land an – und das Feuer brachte Bewegung in das eigene Leben. _________________________________________________ 6