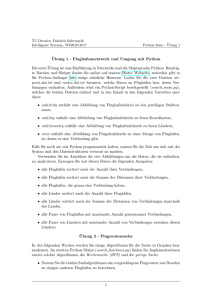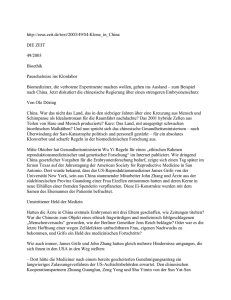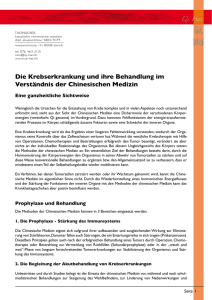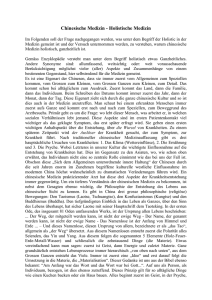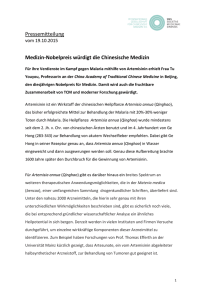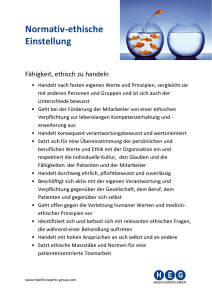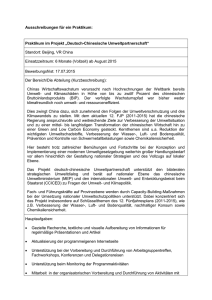als Dokument - Ruhr-Universität Bochum
Werbung

Süddeutsche Zeitung Freitag 7.3.2002 (Feuilleton) Unser aller Teil Die chinesische Philosophie, der Westen und die Bioethik Nach der Diskussion um die allgemeine Gültigkeit von Menschenrechten wissen wir: Den Menschen in China darf die universale Schutzgarantie des Menschenrechts nicht entzogen werden – auch nicht unter Hinweis auf eine „ganz andere Kultur“ der Chinesen. Weniger klar geworden ist, welche positive Antwort China bietet, wenn es um die Frage des philosophischen Rahmens einer guten und zeitgemäßen politischen Ordnung geht. Die Brisanz dieses Mankos wird angesichts bioethischer Probleme immer deutlicher. Chinas bioethische Politikberatung steht vor enormen Schwierigkeiten, die Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens so akkurat zu definieren und zu formulieren, wie es die einschlägigen Regelwerke zum Schutz von Patienten, zum Klonen und zur Stammzellforschung fordern – namentlich vor dem Hintergrund ihrer globalen Wechselwirkungen. Hier genügt es nicht, sich durch Deklaration von Prinzipien der eigenen Gutwilligkeit zu versichern. So geschieht es jedoch derzeit in Schlüsseldokumenten zur Regelung der Embryonenforschung, wenn diese die Medizin als „Kunst der Menschlichkeit“ in die Pflicht nehmen wollen oder dem ungeborenen Menschen „einen gewissen Wert“ zubilligen. Ohne einen Grundsatz wie Gerechtigkeit vergeht aber das Prinzip der Humanität – und ohne das Primat der Achtung des anderen entschwindet die Freiheit aus der politisch geregelten Geltung in die Sphären ohnmächtiger Allgemeingültigkeit. Das Boot der Menschheit Tatsächlich stehen in neueren chinesischen Regularien Ansätze für vermittelnde Grundsätze. So wird der Patientenschutz mit Hilfe des Instituts der „informierten Einwilligung“ verankert und die Freiheit der „relevanten“ Forschung durch ausdrückliche staatliche Förderung gewährleistet. Status und Schutz des Ungeborenen jedoch verbleiben im Zwielicht. Der Beijinger ChefBioethiker Qiu Renzong beruft sich auf das auch in China umstrittene „konfuzianische“ Postulat der im Prozess einer Sozialisation und somit erst nach der Geburt erworbenen Personalität. Öffnet sich hier eine Tür zur Anerkennung der Normativität des Faktischen, nämlich der verbreiteten Tötung Ungeborener? Verdichtet sich damit die Evidenz für eine kulturell begründete chinesische Praxis der unbefangenen Vernutzung embryonalen Materials für den medizinischen Bedarf? Falls dem so wäre, könnte sich damit die geostrategische Lage der deutschen Biopolitik grundlegend verschieben. Unser verfassungsmäßiges Konzept der unqualifizierten Würde wäre dann nur noch ein provinzielles Binnenproblem des deutschen oder kontinentalen moralischen Selbstverständnisses. Der Hongkonger Philosoph und Bioethiker Yu Kam Por hat nun in Bochum zum Start der von der DFG finanzierten Forschergruppe „Kulturübergreifende Bioethik. Voraussetzungen, Chancen, Probleme“ über das Konzept von „Fen“ als „Teil“ im ethisch-politischen Sinne referiert. „Fen“ ist als ethischer Begriff bislang nur einigen Experten konfuzianischer Philosophie geläufig und wird traditionell im Sinne der sozialen „Rolle“ verstanden. Dies erklärt auch sein Schattendasein. Yu stellte seinen originären Vorschlag, „Fen“ ethisch zu deuten, erstmals einem internationalen Publikum vor, indem er ihn auf die Bioethik bezog. Den Ansatz bietet die weit verbreitete Verwendung von „Fen“ in der heutigen chinesischen Alltagssprache. Hier drückt „Fen“ als Konzept konkreter Gerechtigkeit die Vorstellung von einer jedem Menschen gegebenen angemessenen Teilhabe aus. Im chinesischen Alltagsgebrauch meint „ben fen“ das, was einem Menschen ursprünglich eignet. Es dient der Abgrenzung der Individuen von einander und der Abwehr von Übergriffen, welche als Überschreiten des eigenen Teils („guo fen“) bezeichnet sind. Andererseits hat ein jeder für „seinen Teil“ einzustehen („shou fen“). Seine Pflicht tut man, indem man „jin ben fen“, „seinen ursprünglichen Teil beiträgt“, und man versteht diese Pflicht als den zu leistenden „gebührenden Teil“ („ying fen“). An der Schnittstelle von Gerechtigkeit und Achtung markiert „Fen“ einen ethisch inspirierten politischen Ordnungsbegriff, der eine gewisse Nähe zur „Fairness“ aufweist. Das „Teil“ transportiert Anwendungshilfen eines genuin ethischen Konzeptrahmens in der Praxis. Es repräsentiert die konfuzianische Vorstellung von dem „Einen, welches jegliche moralische Praxis durchzieht“. Von ausschlaggebender Bedeutung ist dabei, „Fen“ als „Einteilung“ gerade nicht im Sinne der Zuteilung durch andere zu verstehen. Mit der Anerkennung des „Teils“ des Einzelnen wird die Bedingung der Möglichkeit moralischer, ethischer, sozialer und kultureller Diversität eingeführt. „Fen“ gewährt Räume, die sich dem Zugriff durch positive Definitionen entziehen. Damit führt Yu ein Korrektiv der verbreiteten Auffassung ein, der Konfuzianismus beruhe auf der Anerkennung von in der sozialen Beziehungshierarchie erworbenen Meriten. Im Gegenteil: Moralische Handlungen werden als solche überhaupt erst vorstellbar, wenn dem Individuum eine vorgängige Würde eignet. Mit dieser Wendung erscheint eine konfuzianisch begründete Ethik systematisch gut vorbereitet, um mit einer aufklärerischen Ethik europäischer Prägung ins Gespräch zu kommen. Die Anerkennung der Tatsache, dass jedem Menschen aufgrund seines bloßen Menschseins das Seinige eignet, verbindet Yu Kam Por mit der Feststellung, dass „jedem das Seine“ inhaltlich stets Verschiedenes bezeichne. Demzufolge ist kein Experte oder Funktionsträger zu annektierenden Übergriffen befugt, da diese den Generalvorbehalt der Verschiedenheit ignorieren. Dies hat Konsequenzen für die Frage, wer die Autorität hat, eine Schwangerschaft anzuerkennen: die werdende Mutter, der Arzt oder der Reproduktionsmediziner. Die Annahme, jedes menschliche Wesen habe spezifisch seinen Anteil, zwingt in Fällen, in denen ein solches Wesen nicht in der Lage ist, „für seinen Teil einzustehen“, die Verantwortlichen, diese Funktion treuhänderisch auszuüben. „Sobald wir jemanden in unser gemeinsames Boot gelassen haben, müssen wir mit für ihn einstehen, auch wenn wir dadurch womöglich alle in Gefahr geraten“, so Yu in Anspielung auf eine chinesische Parabel. Neu ist nur, dass wir als Menschen immer schon im selben Boot sitzen. Bei der konkreten Organisation einer guten Gesellschaft besteht erheblicher Spielraum. Die programmatische Unklarheit der Grenzziehungen der „Teile“ hat in der Tat System. Sie verankert ein Element gegen die institutionelle Allmacht des Staates, im Idealfall sorgt sie für eine permanente kulturelle Evolution. Der Gedanke mag Angehörigen demokratischer Gesellschaften selbstverständlich erscheinen. China wird seine bloße Möglichkeit häufig aus prinzipiellen Gründen der chinesischen Tradition abgesprochen, nicht zuletzt von konservativen chinesischen Politikern. Neben dem Potential für kulturelle Verständigung ist „Fen“ in seinem ethischen Rahmen aktuell. Yu besteht darauf, dass es zu seiner Einsicht keiner „reinen“ Vernunft bedarf. Die allgemeine Vernunft des Common sense genügt. Ist das „Teil“ aber nicht zu unscharf, um uns in der Debatte um ethische Probleme, z.B. der Embryonenforschung oder dem Hirntodkriterium, leiten zu können? „Fen“ legt nahe, dass diese Frage von irrigen, um nicht zu sagen: unethischen Erwartungen ausgeht. Die vorbehaltlose grundsätzliche Anerkennung des anderen impliziert ja gerade, dass allenfalls der jeweilige Inhaber von „Fen“ eine inhaltliche Bestimmung treffen darf. Es gibt damit fundamentale Bereiche der Moral, die keine Ethik bestimmen darf. Die Hybris der Gentechnik Diese Zurückhaltung ist allerdings nicht als fortschrittsfeindlich zu verstehen. Entwicklung bleibt möglich und ist erwünscht. Der entsprechende Fortschritt wird in der Perspektive von „Fen“ so definiert, dass er ein genuines Interesse am Mitmenschen nimmt, dem sich jede Moralrhetorik versagt. Yu lässt einstweilen offen, wie seine Lesart von „Fen“ die Verständigung in Extrem-, Ausnahme- und Grenzfällen im Sinne der von ihm postulierten „moderierten Moral“ erlaubt. Yu weist mit der Rückbindung des ethischen Diskurses an Gerechtigkeit, Anerkennung und kritische Aufklärung auf eine weltumspannende Kultur der Humanität hin. Dieser chinesische Ansatz korrespondiert dem philosophischen Geist, der es Europa ermöglichte, im Laufe von Jahrhunderten „jedem das Seine“ auch politisch zuzubilligen und damit die geistigen Bedingungen für Humanismus, Aufklärung und Demokratie zu legen. Die Anerkennung des „ursprünglichen Teils“ beginnt für die Medizinethik, so darf man den Gedanken weiterführen, mit der säkularen Abwehr biotechnischer Hybris. OLE DÖRING Copyright © sueddeutsche.de GmbH/Süddeutsche Zeitung GmbH