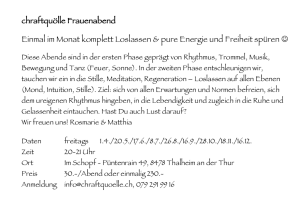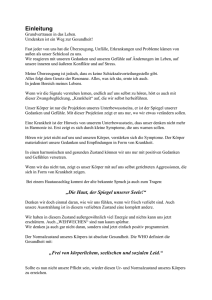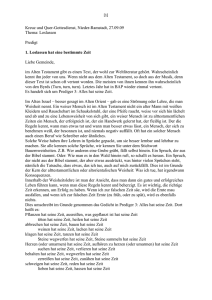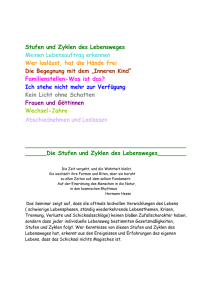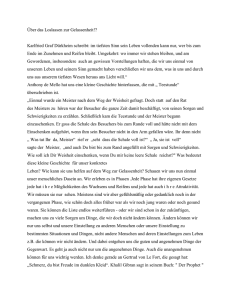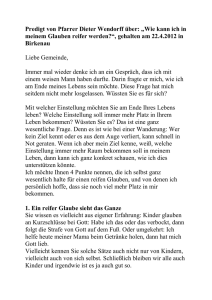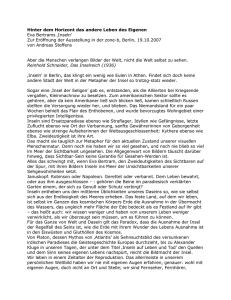Unsere Kirche wird viele und vieles l
Werbung

Konzentration durch Loslassen - ein Versuch über die Zukunft der Gemeindearbeit 1. Wenn man darauf verzichtet, Vertröstungen zu formulieren, gilt es festzuhalten: Unsere Kirche wird vieles loslassen müssen, - Kirchen, Gemeindezentren und Pfarrhäuser, vor allem aber Selbstbilder und Identitäten, Ideale und Ansprüche, Zusagen und Erwartungen. Wir werden mit einem annähernd halbierten Haushalt in der NEK vieles nicht mehr können, wir werden viele übergemeindliche Dienste nicht mehr anbieten, wir werden viele engagierte Menschen enttäuschen und vielleicht sogar wie in Holland und England leere, verfallende Kirchen wie hohle Zähne in den Städten anstarren müssen. Wir werden viel loslassen müssen, und das ist - wie jede/r Seelsorger/in weiß - sehr schmerzhaft. Vielleicht ist es deswegen eine der wichtigsten Aufgaben der Reformkommission, dass sie die Entscheidungsträger/innen in diesem Prozess immer auch daran erinnert, dass wer loslässt, auch reicher werden kann. Denn wer sein bisheriges Leben, seine bisherige Selbsteinschätzung, sein bisheriges Selbstbild verliert, der wird gewinnen. Niemand soll daher mit dem Loslassen von vertrauten Formen und Gestalten das Ende der Kirche gekommen sehen; Loslassen ist ein Umwandlungsprozess, kein Endbahnhof. Nur ein Beispiel: Mit der jüngst avisierten Schließung der evangelischen Akademiearbeit ist nicht das Ende dieser bildungsbürgerlich-gesellschaftskritisch orientierten Arbeit beschlossen, sondern der Zwang entstanden, neue Formen und Foren dafür zu finden; und warum sollten die City-, Haupt- oder Zentralkirchen in allen (!) größeren Städten der NEK nicht wieder mehr Anteil an dieser inhaltlichen Arbeit übernehmen? Und dass gewichtige Initiativen wie die Trauerarbeit an „verwaisten Menschen“ neu in der Kirche beheimatet werden kann, liegt ja auf der Hand. 2. Damit aber dieses Loslassen zu einem wirklichen Umwandlungs-, nicht zu einem Restaurationsprozess wird, müssen wohl zwei Gefahrenpunkte im Blick behalten werden: a) Zuerst gilt es etwas in den Blick nehmen, was zwar alle irgendwie kennen, aber nur schwer in gerechter Weise zu formulieren ist. Vielen unserer kirchlichen Angebote, Einlassungen, Verlautbarungen und Stellungnahmen - egal auf welcher Ebene von Kirche und Gemeinde - spürt man eine gewisse inhaltliche Verunsicherung ab. Es ist als fehlte uns die Kraft oder der Mut, missionarische, also gewinnende und einladende Kirche zu sein. Jedenfalls wird man nüchtern eingestehen müssen: Unsere evangelische Volkskirche schrumpft nicht nur die finanzielle, sondern auch die gemeindliche Basis weg. Wir berühren die Menschen zu wenig in ihren Seelen und unser Reden von Gott geht zu oft an den Lebens- und Gottesfragen der anderen vorbei. Das heißt aber auch: Die objektiv bedingte Finanzkrise (Alterspyramide; Wirtschaftskrise, Steuergesetzgebung usw.) signalisiert eine Krise der Verkündigung und der Theologie, vielleicht weil wir inhaltlich und konzeptionell ähnlich wie die Parteien, die Gewerkschaften und andere Großinstitutionen - vor einem Modernisierungsumbruch bzw. Individualisierungsschub stehen, für den wir noch keine tragfähige Antwort gefunden haben. Entsprechend fehlt uns eine Art gemeindliche Zielvision, ein Bild für das, was wir selbst im allerschlimmsten Fall als Kirche unbedingt sind und sein wollen. b) Zum anderen hört man nicht selten die Auffassung, dass die finanziellen Aderlässe schlimmstenfalls zu einem Finanzvolumen führen, das in etwa dem der 70iger oder gar 60iger Jahre entspräche. Mit der anstehenden Kürzungsphase würde man also lediglich die Fehler einer überstürzten Wachstumsphase der 68iger Generation zurücknehmen und die funktionalen bzw. übergemeindlichen Arbeitszweige könnten wieder dahin zurückkehren, wo sie hingehören: in die Gemeinden. Das Problem dieser Ziellinie liegt darin, dass damit die Krise der Gemeindearbeit nicht wirklich erfasst ist. Es stimmt eben nicht, dass in den Ortsgemeinden alles so weit o.k. sei und dass nur diese teuren „Überbauten“ wie Akademie, KDA, Frauenwerke, Diakonieausbildungen usw. der Kirche das Rückrat brächen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Die Dienste und Werke waren schon Ausdruck und Lösungsversuch einer Krise der klassischen Gemeindearbeit und insofern brauchen wir heute für den Umwandlungsprozess ein Drittes, ein Neues, eine Synthese aus Orts- und Funktionsgemeinden, eine Neudefinition dessen, was Grundgeschäft und Grundform einer evangelischen Gemeindearbeit in Zukunft ausmacht. 3. Will man in diesem Kontext der Reformkommission der NEK mit Anregungen zur Seite stehen, dann sind vielleicht ekklesiologische Prioritätenüberlegungen hilfreich, die so pointiert sind, dass man an ihnen die eigene Meinung konturieren kann. Ausgangspunkt soll dabei die wohl unumstrittene Einsicht sein, dass das Kerngeschäft unserer Kirche darin besteht, das „Evangelium rein zu verkünden und die Sakramente recht zu verwalten“ (CA VII). Wenn es hart auf hart kommt, steht das verkündigende Wort Gottes im Zentrum und sind die Kirchen mit ihren Gottesdiensten das letzte, was wir loslassen dürfen. Es ist nur eine Anwendung dieses Grundsatzes, dass die innerlichen und äußerlichen Räume, die um dieses Wort Gottes herum erbaut worden sind, Priorität besitzen. Positiv formuliert: In Krisenzeiten müssen und sollen wir uns in und um unsere Kirchen herum sammeln. Dies ist kein Rückzugsplädoyer, sondern der Beginn eines Konzentrationsprozess. Denn diese Kirchen, auf die wir uns dann konzentrieren, sehen völlig anders aus als unsere heutigen Gemeindekirchen. In den Städten Europas kann man schon eine entsprechende Tendenz erkennen: Die Kirchen sind da alles in einem und zugleich: Gottesdienstraum und Gemeindebüro, Konfirmandenunterrichtsraum und Seelsorgeinsel, Stadtteiltreffpunkt und Gruppenraum. Je kleiner die Gemeinden werden, desto mehr konzentriert sich alles auf diese spezifischen Räume, die Kirchen sind nicht mehr nur die „gute Stuben“ der Gemeinden, sondern ihr Wohn-, Eß- und Arbeitszimmer, auch Keller und Terrasse. Natürlich muss diese Tendenz zur Konzentration auf die Kirchenräume mit den konkreten Gegebenheiten vor Ort abgeglichen werden, aber bedacht bleiben sollte dies: Wir haben wunderschöne geistliche Orte ererbt und anvertraut bekommen, auf dem Lande nicht anders als in den großen Städten, in den Kleinstädten nicht anders als in den Vororten, es sind Perlen der Frömmigkeit und gleichsam „durchgebetete Räume“, die wir als „Markenkernräume“ und Zentren unseres kirchlichen Lebens stabilisieren sollten. 4. Aber der um das Wort Gottes herumgebaute Raum ist nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu verstehen: Gottesdienste als unsere Kernveranstaltungen haben oberste Priorität. Dies auch gegen den Trend; natürlich sind unsere Gottesdienste schlecht besucht und finden die diakonischen Aktivitäten mehr allgemeine Zustimmung. Aber dies ändert nichts an unserer Kernaufgabe, bei der es allerdings wieder um einen Umwandlungsprozess geht. Denn diese Priorität meint nicht nur den klassischen Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr, sondern die ganze Vielfalt „gottesdienstlicher Handlungen“ zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Themen, es meint ebenso die vielen Amtshandlungen und die zunehmende Zahl von Gottesdiensten anlässlich des noch ungeschriebenen weltlichen Fest- und Gedenkkalenders, der von Krisen- und Trauerbewältigung bis zu allgemeinen Gedenkfeiern im Stile einer `civil religion` reicht (z.B. Unternehmen Gomorrha in Hamburg). Menschen vor und zu Gott zu rufen, mit ihnen gemeinsam Sprache zu suchen für den Gott der Bibel, das ist unser zentrales „Wächteramt“, denn gemäß Jesaja bezieht sich das Wächteramt nicht auf die Gesellschaft, sondern auf Gott und die Ermahnung, er möge doch seine Verheißungen nicht vergessen (Jes 62, 6f.). Gott als Geheimnis der Welt aufzuspüren und unser modernes Leben vor ihm und mit ihm zu verstehen, das ist das Beste und Solidarischste, was wir für die Welt und die Menschen tun können. Denn nüchtern muss man doch sagen: Das diakonische Tun nach dem Prinzip der Subsidiarität in unserer Gesellschaft, das können im Zweifelsfall auch die anderen, wenn es denn bezahlt wird; aber vor Gott treten und beten, dass können nur wir für die anderen tun. Und diesen stellvertretenden Dienst für die säkular gewordenen Menschen, dass wir auch mit allerkleinster Zahl für die vielen glauben und beten solange, bis diese wieder nach Gott fragen, dies halte ich persönlich für eines der würdigsten Selbst- bzw. Gemeindebilder, die wir als Kirche entwickeln können. 5. Eine weitere Priorität scheint mir aus diesen Überlegungen ableitbar: Wenn wir uns konzentrieren müssen auf die Räume um das Wort Gottes herum und tatsächlich so immens viel loslassen und abbauen müssen, dann werden wir wohl auch das Selbstbild einer flächendeckenden Versorgungskirche umwandeln müssen. Was aber kommt dann? M.E. gibt eine Kirche Mut zur Hoffnung, die sich auch in der Fläche mit vielleicht unregelmäßig verteilten „Inseln funktionierenden Kirchlichkeit“ präsentiert. Denn es sollte die Regel gelten: Lieber einige glaubwürdige Kirchenzentren mit geistlicher Ausstrahlung und überzeugenden Angeboten als viele unzureichend ausgestattete und inhaltlich erschöpfte Gemeindekirchen. Für solche Inseln überzeugender Kirchlichkeit kann ich mir dabei zwei Grundformen vorstellen, die zusammengehören, obwohl sie komplett verschieden aussehen: a) Zuerst die sog. „kleine Form“, gleichsam der „Tante-Emma-Laden“ um die Ecke, in dem sich in und um eine Kirche Menschen sammeln, die diese Kirche und ihre Auftrag wichtig finden. Diese kleine Form funktionierender Kirchlichkeit zentriert sich auf den Erhalt der Kirche als eine Art „kulturelles Gedächtnis des Glaubens“, weil diese Räume mit all den Gebeten und Gesängen der Generationen ausgefüllt sind und diese weitergegeben werden wollen an die nächste Generation. Wie zu anderen Krisenzeiten auch sammeln sich die Glaubenden gleichsam in ihren „Wehr-Kirchen“, wobei sie sich jetzt nicht gegen Barbaren, sondern gegen die Bedeutungslosigkeit zur Wehr setzen. Sie versuchen, die Schätze des Gotteswissen in Kirche und Bibel, in Liturgie und Gebet zu hüten. Wenn man in SchleswigHolstein über Land fährt und all die spirituell starken, wunderschön gestalteten Dorfkirchen aufsucht, spürt man etwas von der Verpflichtung, diese Orte des Gebetes zu verteidigen und zu erhalten. Aber auch hier gibt natürlich es ein Loslassen: Denn für diese vielen kleinen Kirchen wird es wenig Unterstützung aus der Gesamtkirche geben können, weder große Geldströme für die Bauten noch für die personale Ausstattung; vieles wird einfach und ehrenamtlich sein müssen. Und vielleicht wird es wieder so etwas wie eine/n „Visitationspastor/in“ für eine ganze Regionen geben, die wie in alten Zeiten der Klöster nur gelegentlich die kleinen Kirchen aufsuchen können, nicht nur um Amtshandlungen vorzunehmen, sondern auch um die Anerkennung der ganzen Kirche auszudrücken, die Gemeinschaft zu stärken und die Gemeinde zu beraten. Ich glaube wohl, diese „kleinen Kirchen“ können sehr viel geistliche Ausstrahlung entwickeln, sie sind gerade in ihrer Schlichtheit überzeugende „Inseln gelungener Kirchlichkeit“, weil sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und sich nicht überfordern lassen mit der Erwartung, auch für Sozialstationen oder Altenheime zuständig sein zu müssen. b) Daneben aber sollte es auch eine Konzentration auf einige wenige sichtbare „Inseln funktionierender Kirchlichkeit“ geben. Von den mittelalterlichen Zeiten bis weit hinein ins 19. Jahrhundert hat es ja eine kirchliche Konzentration auf einige wenige Kirchen in der Mitte der (Klein-) Städte gegeben; in ihnen haben viele Pastoren Dienst getan, es gab viel `rituelles Leben` in ihnen (Amtshandlungen) und in zarten Anfängen auch so etwas wie thematische Angebote. Heute müsste man diese Profilarbeit natürlich sehr viel deutlicher herausstellen, aber im Prinzip war die Kirche mit diesem Zentralkirchenkonzept auch in den Kleinstädten oder Stadtteilen nicht überdehnt oder überfordert, sondern konzentrierte sich auf die Zahl von Kirchen, die sie auch wirklich ordentlich ausstatten und geistlich ausfüllen konnte. Und heute ist es wohl wieder für die missionarische Kraft und geistliche Ausstrahlung unser Kirche ein beachtlicher Unterschied, ob man in einer Stadt oder einer städtischen Region vier, fünf oder gar mehr Kirchen hat, die alle nur schwach ausgestattet sind und halbe, viertel und geteilte Mitarbeiter/innen aufzuweisen haben oder ob es nur eine oder zwei Zentralkirchen gibt, in denen ein verlässliches, attraktives und musikalisch-geistlich intensives Angebot bestehen kann, weil die verbleibenden Kräfte konzentriert sind. Diese Zentralkirchen übernehmen faktisch eine Art Kathedral- oder Citykirchenrolle in ihrer jeweiligen Region, dh. keine dieser Kirche kann nur eine reine Gemeinde- und Versorgungskirche sein. So entsteht ein Art flächendeckendes Zentralkirchenkonzept, dass die Stärken der Citykirchenarbeit verknüpft mit der Basisnähe der Gemeindekirchen. Woher aber sollten die neuen Impulse für diese Citykirchenkonzeption kommen? M.E. können durch eine Erweiterung des klassischen gemeindlichen Versorgungsangebotes um eines der in den Diensten und Werken herausgebildeten Profile jene Zentralkirchen thematische Kraft nach innen und missionarisches Profil nach außen gewinnen. Die vielen in den letzten Jahrzehnten erworbenen Kompetenzen in den Diensten und Werken können einfließen in die Kirchenarbeit vor Ort, so dass sich sowohl die übergemeindlichen Dienste als auch die Parochiearbeit verändern und entwickeln können; die einen erhalten größere Basisnähe, die andere mehr missionarisches Profil. Und kann man sich nicht die Marktkirche in Eutin mit einem spezifischen bildungspolitischen Profil vorstellen? Oder die Zentralkirche in Husum mit einem umweltpolitischen Zusatzschwerpunkt? Die Zukunft der Kirche liegt in einer integrierten Lösung, in der die Profile der übergemeindlichen Dienste und Werke mit der Realität basisnaher Gemeindearbeit verschmolzen werden und so mit angemessener Ausstattung eine theologisch profilierte Arbeit entwickeln können. 6. Damit ist das positive Ziel des anstehenden Umsteuerungsprozesses nur erst angedeutet; er wird sich natürlich aus unendlich vielen kleinen, schweren Entscheidungsschritten aufbauen müssen. Was aber passiert mit all den anderen unscheinbaren Kirchen auf dem Lande, in den Städten und Vororten, die das „Pech“ haben, weder jene erhaltungswürdige Dorfkirche noch solche Inseln funktionierender Zentralkirchlichkeit zu sein? Hier bekommt das Loslassen seine harte Seite: Viele der jüngeren Stadtkirchen, die nach dem Kriege erbaut wurden in einem prosperierenden Wiederaufbauland Deutschland mit einer auch aus schlechtem Gewissen gespeisten Sehnsucht nach nichtnationalistischen Werten sind wohl nicht zu halten. Und manche kleine Kapelle und unscheinbare Dorfkirche, die kein Engagement freisetzen kann bei ihren Nachbarn, Gemeinden und Kommunen, werden es auch schwer haben. Denn nüchtern muss man einsehen: Wir können kaum noch eine Kirche gegen anhaltendes Desinteresse vor Ort am Leben erhalten! Kirchen oder Gemeinden, die keine oder nur eine sehr schmale Basis in ihrem Umfeld haben, können nur mit einem enormen Kraftakt gehalten werden, ein Kraftakt, den wir uns nicht sehr oft leisten können und der natürlich eine besondere gesamtkirchliche bzw. gesamtregionale Willensbildung erfordert, - ein nicht eben einfaches Verfahren. Letztlich aber kann bei jenem Konzentrationsprozess auf die zwei Grundformen der Inseln funktionierender Kirchlichkeit zu einer Kirche führen, in der beide je auf ihre Weise genau das tun, was unser Auftrag ist: Gemeinde sammeln um Gottes Wort.