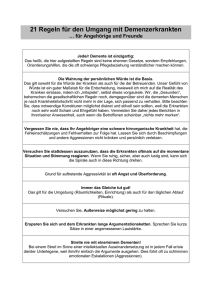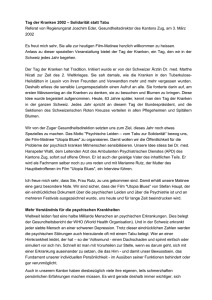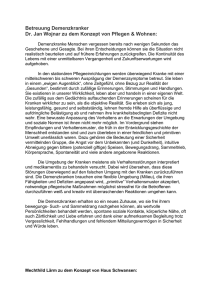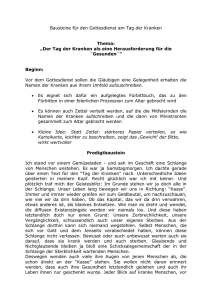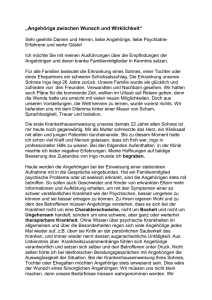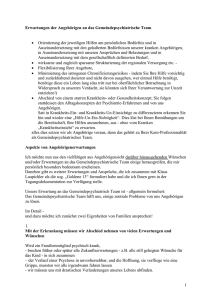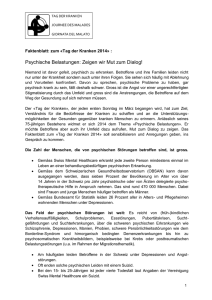Storkebaum - Evangelische Akademie Tutzing
Werbung
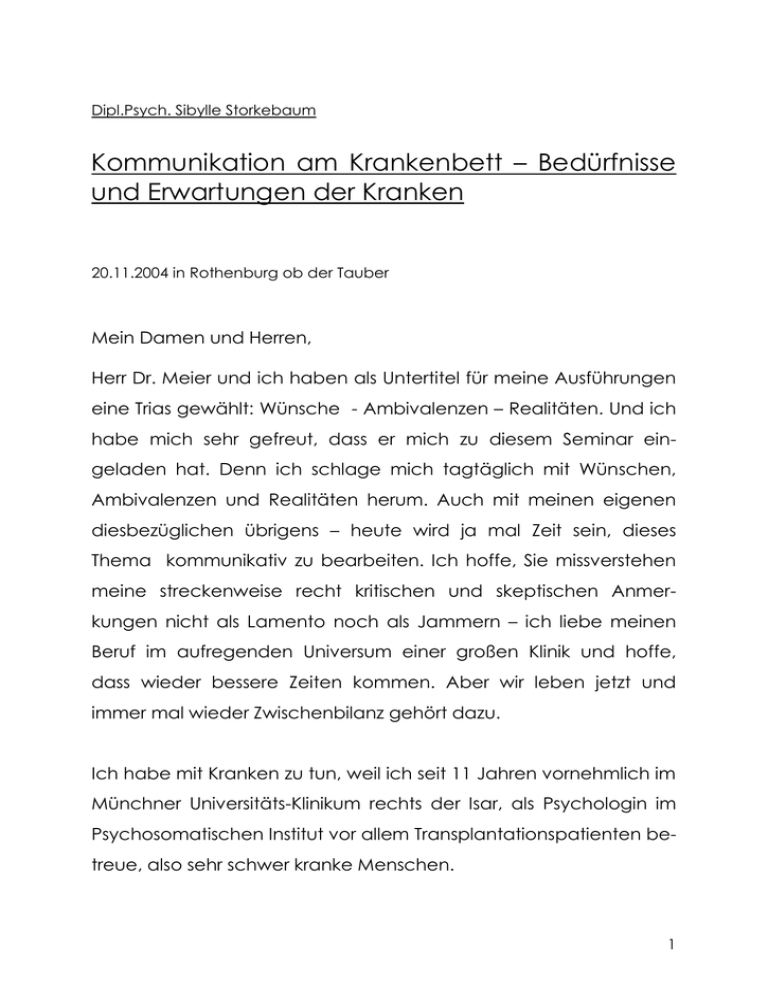
Dipl.Psych. Sibylle Storkebaum Kommunikation am Krankenbett – Bedürfnisse und Erwartungen der Kranken 20.11.2004 in Rothenburg ob der Tauber Mein Damen und Herren, Herr Dr. Meier und ich haben als Untertitel für meine Ausführungen eine Trias gewählt: Wünsche - Ambivalenzen – Realitäten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er mich zu diesem Seminar eingeladen hat. Denn ich schlage mich tagtäglich mit Wünschen, Ambivalenzen und Realitäten herum. Auch mit meinen eigenen diesbezüglichen übrigens – heute wird ja mal Zeit sein, dieses Thema kommunikativ zu bearbeiten. Ich hoffe, Sie missverstehen meine streckenweise recht kritischen und skeptischen Anmerkungen nicht als Lamento noch als Jammern – ich liebe meinen Beruf im aufregenden Universum einer großen Klinik und hoffe, dass wieder bessere Zeiten kommen. Aber wir leben jetzt und immer mal wieder Zwischenbilanz gehört dazu. Ich habe mit Kranken zu tun, weil ich seit 11 Jahren vornehmlich im Münchner Universitäts-Klinikum rechts der Isar, als Psychologin im Psychosomatischen Institut vor allem Transplantationspatienten betreue, also sehr schwer kranke Menschen. 1 Deshalb werde ich überproportional viel von sehr schwer Kranken sprechen. Vielleicht ist das auch gut so, denn bei ihnen haben wir das Brennglas auf die Probleme. Ich arbeite im Bereich der Transplantationsmedizin arbeite. In der langen Geschichte der Medizin ist diese Sparte noch ziemlich jung. Dennoch bewegt sie die Menschen innerhalb und außerhalb der Kliniken in hohem Maße. Ich zum Beispiel und einige unter Ihnen vielleicht auch, wir können uns noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem Christian Barnaard das erste Herz transplantierte . Ein Medienereignis der besonderen Art war das. Ich arbeitete damals als junge Redakteurin in der Nachrichtenredaktion einer Tageszeitung und war zutiefst erschüttert und erregt bei der Vorstellung, dass man einem Menschen ein Stück seines Körpers herausschneiden und in eines anderen Menschen Körper einsetzen kann! Und dass das dann auch noch funktioniert! Wir waren alle sehr fasziniert und ich gestehe, ich bin es immer noch, wenn ich bei einer Transplantation zuschaue, in den leeren Bauchraum gucke, Zeuge werde all dieser unbeschreiblichen Kunststücke, die Chirurgen und Anästhesisten so meisterlich beherrschen, und dann mitbekomme, wie die neue Leber an den für die Leber vorgesehenen Platz gebracht wird, weich, schimmernd, an die Blutgefässe angeschlossen wird, und dann das Wunder erlebe. Das Blut schießt in die Gefäße ein und es entsteht dieser unvergleichlich magische Moment, in dem die Leber von lauter Sternen übersät ist. Diese Beobachtung erzähle ich Patienten immer dann, wenn sie mir sehr ängstlich vorkommen; dann stockt ihr Atem und sie schauen mich mit aufgerissenen 2 Augen an und so etwas wie Trost, Erleichterung scheint ihre Seelen zu entlasten. Natürlich sind seit Barnaard mehr als 30 Jahre vergangen, und ich weiß nicht, wie viele Lebern und Herzen , ganz zu schweigen von den Nieren, durch die Hände von Transplanteuren gegangen sind. Die Transplantation ist zur Routinebehandlung geworden, und es gibt Zentren, in denen die Patienten wie Stückgut auf dem Förderband behandelt werden. Aber trotz ihres Willens zur Unterwerfung unter die Vorschriften der Ärzte, zu Folgsamkeit und Compliance – sie sind kein Stückgut auf dem Fließband und ihr unterwürfiges Verhalten maskiert nur ihre Angst, ihre Schuld- und Schamgefühle. Natürlich wissen sie heute viel mehr über die Transplantation, als Barnaards Patienten wussten, aber sie wissen auch mehr über die Risiken, über Outcomes, die nicht so glücklich waren, wie gehofft; sie verfolgen die Diskussionen über Hirntod und Organhandel, die widerlichen Dramatisierungen ihres Schicksal in manchen Fernsehprogrammen, denen die Folie Transplantation für keine noch so abwegige Geschichte entbehrlich scheint. Bedürfnis eines jeden Patienten sollte die Information sein, die Aufklärung, das Wissen um das, was da in Körper und auch Seele abläuft, was ihn krank macht. Vor jeder Transplantation gibt es einen Menschen, der krank wird , terminal krank. Wer auf der Transplantations-Warteliste auftaucht, weiß, dass dies die letzte Chance auf ein bisschen mehr Leben ist. Und auch die Information, dass schon Tausende erfolgreicher Transplantationen durchgeführt worden sind,davon Hunderte vom 3 behandelnden Chirurgen, kann kaum den individuellen Aufruhr in der Seele des Patienten minimieren, innere Ruhe und unerschütterliche Zuversicht garantieren. Was man heute so hört und liest über die Ärzte, ist ja auch nicht immer angetan, das Vertrauen in sie zu stärken. Vorgestern lief im Scheibenwischer eine fulminante Nummer über das Arzt-PatientBündnis – der grandiose Kabarettist Georg Schramm schlug vor, dass Patienten doch künftig ihre Ärzte fragen sollten „Mit welcher Krankheit kann ich Ihnen helfen?“ Er zitierte das Ärzteblatt, das die Befriedigung der ärztlichen Bedürfnisse vor die Befriedigung der Krankenansprüche placiert. Mein Zahnarzt berichtet mit Grauen, dass die Zahnärztekammer jetzt einen Korruptionsbeauftragten installiert. Selbst wenn all dies nur wenige unter den vielen, vielen Ärzten betrifft, weil es glücklicherweise viel mehr anständige Ärzte gibt, die sich aufarbeiten zum Wohl ihrer Patienten - wie soll man heute ruhig krank sein, sich einem Arzt anvertrauen, der oft jung ist und unerfahren wirkt, das nicht zugeben mag und auf alle Fälle unter Zeitdruck steht? Was wünschen sich denn heute Patienten? Gesundheit. Oder doch zumindest Beschwerdefreiheit. Oder doch wenigstens gute Betreuung. Von Ärzten und Pflegepersonal. Oder fachliche Aufklärung. Oder doch mindestens ein schönes Krankenzimmer, ja ? Das sind die drei vorne placierten Items einer aktuellen Befragung von Peter Herschbach zur Patientenzufriedenheit. Man sollte meinen, im Zeitalter der globalen Kommunikation sei wenigstens der Wunsch nach Aufklärung und Betreuung selbstverständlich zu 4 erfüllen. Aber gerade dies bleibt oft ein Wunsch. Denn die Entwicklung im Gesundheitswesen scheint einiges zu bringen, bloß nicht die Wunscherfüllung für Patienten – und medizinisches Personal. Die meisten kranken Menschen wollen natürlich nicht krank sein, sie wollen keine Angst haben vor Schmerzen, Spritzen, Sterben. Sie wünschen sich, dass ihre Angehörigen nicht zu sehr belastet sind von all dem, was sie durchmachen, sie hoffen, dass ihre Krankheit nicht zu viele Umwälzungen und Umstrukturierungen mit sich bringt. Sie wollen ihre Freunde nicht verlieren. und sie wollen auch an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Sie haben den doch durchaus berechtigten Wunsch, eben nicht auf einem Fließband durch den Heilprozess geschickt zu werden, sondern als leidende Menschen, denen andere helfen, die das gelernt haben und das Glück haben, selbst gesund zu sein. Kranke wollen mündige Bürger bleiben, auch im Krankenstand. Mich wundert immer, dass sie nicht spätestens bei Entlassung auf die Barrikaden gehen und protestieren – gegen Arroganz, Nachlässigkeit und Unmenschlichkeit mancher aus dem Kliniknetz. Warum wehren sie sich nicht? Ist es so anstrengend? Ist die Angst der Rache eines gerade angegriffenen Halbgott in Weiß, dem man erneut hilflos und krank begegnen könnte, so viel stärker als die Überzeugung, dass doch vieles in punkto Menschenwürde verbessert werden könnte? 5 Und schon sind wir bei den Realitäten. Oder bei den Ambivalenzen? Wir alle, die wir in den Kliniken oder im Gesundheitswesen arbeiten, würden ihnen das ja sehr gerne bieten. Alle Schwestern, alle Pfleger, die ich kenne, die Ärzte , Krankengymnasten, Sozialpädagogen und Psychologen sind mal ausgezogen, den Kranken das zu bieten – sie wollten helfen! Wir alle haben gelernt, was man wissen muss, um auf unserem jeweiligen Gebiet einen Beitrag zu dem großen Netz der Fürsorge für kranke Menschen beizutragen. Und was machen wir den ganzen langen Tag? Wir stecken unsere Zeit nicht in die Betreuung der Kranken, wir haben nicht die Zeit, einem vorübergehend sehr verlangsamt sprechenden Patienten zuzuhören, ihn beim Sprechen zu ermutigen – wird schon! -, nein. Wir stecken unsere Zeit in die Dokumentation dessen, was wir gearbeitet haben. Das wächst sich aus zu mindestens einem Drittel unserer Arbeitszeit, manche Untersuchungen sprechen von 60% berufsfremder Arbeit. Kliniken sind heute riesige Archivierungsanstalten. Controller, Verwalter und andere Hilfskräfte, die alles im Blick haben, was mit Kranksein zu tun hat, sitzen in den hellen Büros, die wir so dringend für Gespräche mit den Kranken brauchten. Sie entwickeln Computerprogramme, in die wir alles eingeben müssen, was wir tun – mir fehlt nur noch der Schrittzähler am Bein, die Telefonate zählen wir bereits. Jeder Husten hat seine eigene Codierungsnummer, jede Handreichung auch. Statt wie früher Stationsbesprechungen zu machen, versuche ich, die Schwestern beim konzentrierten Schreiben nicht zu stören. Statt mit Ärzten und Schwestern Strategien zur Hilfe für unsere Kranken zu entwickeln, renne ich ihnen hinterher, um wenigsten etwas über den aktuellen Stand zu 6 erfahren, 12 Minuten, hat kürzlich ein sehr engagierter Chirurg ausgerechnet hat er, die OP ausgeschlossen, Zeit für seine Patienten – Diagnose besprechen, Behandlungsplan, Therapie, Entlassung. Zwölf Minuten! Seitdem verzeihe ich den Ärzten vieles, was ich mal als Sorglosigkeit oder mangelndes Interesse an Menschen gewertet habe. Wir alle verbringen unsere Zeit – häufig übrigens die Abende und Wochenenden- nicht mit unseren Familien und Freunden, nicht mit Freizeit, nicht mit Forschung, die ja auch weitestgehend außerhalb der Dienstzeiten stattfindet, sondern damit, die DRGs und die ICD oder DSM-Codierungen ins SAP unserer Computer einzugeben, Arztbriefe zu schreiben, in denen möglichst wenig über den Menschen steht, denn das könnte ihm ja schaden. Dies gilt besonders für den Bereich, in dem ich arbeite – psychische Diagnosen müssen mit äußerster Vorsicht veröffentlicht werden, sonst werden sie zu Ausschlusskriterien oder zu Diskriminierungen. Es kommt bei uns allen zur Inflation der Diagnose "Anpassungsstörung", denn leider gibt es nur pathologische Diagnosen, krankhafte beurteilungen. So steht dann eben in den Arztbriefen der Internisten oder Chirurgen unter dem Punkt „Sozialanamnese“ meist nur „verheiratet, zwei Kinder“ – wissen Sie dann, was das für ein Mensch ist? Vielleicht sollen Sie das ja auch gar nicht wissen. Wenn wir gar nicht erst die Kommunikation zu den Menschen aufnehmen sollen, die immer kürzer bei uns verweilen, was nutzt dem Menschen dann persönliches Interesse an ihm? Und uns, die wir „an der Front“ 7 arbeiten, lasten solche Geschichten, Lebensläufe, Leidenswege ob wir wollen oder nicht auf der Seele. Zeit für Supervision ,um das alles etwas leichter zu tragen? Wo soll die denn herkommen? Und wer soll sie bezahlen? So wird der Kranke gerade wieder zur Galle oder zum Ikterus, wo er doch gerade auf dem Weg war, ein Mensch mit Namen, Geschichte und Persönlichkeit zu sein. Viele Untersuchungen gerade aus dem Gebiet der Psychosomatik haben immer wieder gezeigt, dass Menschen schneller gesund werden, wenn sie Mensch bleiben dürfen – auch im Umfeld einer hoch spezialisierten HighTech-Medizin, die durchaus bestimmte Behinderungen auf Zeit mit sich bringt, Kranke vorübergehend noch hilfloser macht – aber doch nicht entwürdigen oder klein machen. Denn am zufriedensten sind sie doch, nach einer neuen Untersuchung von Herschbach und anderen, wenn fachliches Können und Umgang der Ärzte mit ihnen stimmen. Nun ist es natürlich nicht so, dass alle Kranken so sind, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Nämlich daran interessiert, möglichst rasch wieder gesund zu werden, alle Kräfte für dies Ziel gemeinsam mit den Medizinern und Pflegenden einzusetzen, ihre Medizin zu nehmen und viel zu laufen, selbst wenn die Narbe noch wehtut. Es gibt zunehmend mehr Patienten, die glauben, sie müssten alles ausschöpfen, was irgendwo in der Pipeline ist, wie sie das gern nennen. Alle zwei Jahre steht ihnen ein neues Blutdruckmessgerät zu? Her damit , auch wenn das alte noch sehr gut funktioniert! Keine Semmeln zum Frühstück? Die junge Schwester wird nie den 8 Patienten vergessen, der ihr das Tablett ohne Semmeln nachwarf. Rund um die Uhr Betreuung trotz Ärzteknappheit möglichst zum Nulltarif! Ich hab mein Leben lang eingezahlt, da werde ich doch noch was dafür kriegen! Man muss die Kranken im System sehen: im Wirtschaftssystem, in dem heute jeder meint, er müsse für sich retten, was er noch kann. Und im Kranken – pardon, Gesundheitssystem, in dem natürlich nach derselben Maxime gehandelt wird. Wenn man dir gibt, nimm, wenn man dir nimmt, - schrei! Manche schreien viel lauter als angebracht. Von anderen hört man nichts, und auch das ist verdächtig. Es gibt wirkliche Ekelpakete, die den Klinikleuten das Leben ziemlich schwer machen – soll ich Ihnen ein paar schildern? Bitte sehr! Eine kleine Typologie des gemeinen Kranken. Da gibt es ZB den RANSCHMEISSER. Dem ist alles recht, der hängt an des Arztes Lippen, wir Psychologen nennen das die Identi- fikation mit dem Aggressor. Vorsicht vor diesem Patienten – der gibt seine Verantwortung für sein eigenes Leben und Gesundwerden ab, an die Ärzte, an die Familie, früher vielleicht an den Alkohol oder den Chef! Den schafft so schnell keine Station, machen Sie dem mal in ein paar Tagen, die auch noch geprägt sind von Operation oder aufwendiger Behandlung, klar, das jeder für sich verantwortlich ist. Die Motivationsarbeit bei dieser Gruppe ist höllisch schwer. Es gibt das Gegenstück – den OPPOSITIONELLEN. Der will seinen Doktors kein bisschen trauen, glauben, folgen - der therapiert, dosiert, evaluiert und qualifiziert, wie er es für richtig hält. Ohne 9 Rücksprache! Und wenn dann was schief geht, hat natürlich der Arzt oder die Schwester oder die Küche oder schon auch mal der Psychologe Schuld. So gut es sein kann, wenn jemand nicht alles widerspruchslos schluckt, so leicht sind das auch die Patienten, die durch Non-Compliance sich selber schädigen und allen Frust bereiten werden, weil all ihre Anstrengungen im Nichts verlaufen. Ebenso zur Risikogruppe zählt der VERDRÄNGER. Der will nicht die Schwere einer Erkrankung wahrhaben, der ist mit dem Schicksal und dem lieben Gott im Bunde. „Ich spüre es genau, es wird alles gut gehen!“ Das sagen mir immer wieder Patienten bei den Vorgesprächen zu Transplantationen. Ist ja eine gute Haltung – aber diese Menschen schotten sich leider oft ab gegen Aufklärung und sind dann eher passiv im Coping, in der Krankheitsbewältigung. Eine weitere psychoanalytische Kategorie, nämlich die Sublimierung, verkörpert der WEHLEIDIGE. Menschliche Defizite an Zuwendung werden durch dramatisch geäußertes Leiden, Tränen, Hilflosigkeit, Passivität, pardon, Unfähigkeit zu Aktivität vertuscht. Aber wenn Sie sich dann ans Bett setzen und reden und ermutigen, wenn Sie all Ihre Kraft in eine Ermunterung und Stärkung setzen, dann ernten Sie zwar ein glückseliges Lächeln .. und am nächsten Tag ist alles noch viel schlimmer . Die narzisstische Grundeinstellung ist schwer zu besiegen. Ähnlich kann es Ihnen beim CHEFARZTPATIENTEN ergehen. Sein narzisstisches Defizit will er ausgleichen, er fordert – übrigens auch 10 als Kassenpatient – größten Service, beste Behandlung, optimalen Zugang zum Arzt, das beste Zimmer, die teuerste Arznei, die aufwendigste Diagnostik. Tag und Nacht müssen Sie zur Verfügung stehen, dafür gibt’s dann manchmal - inzwischen so gut wie nie mehr - auch eine Flasche Champagner beim Abschied. Aber die brauchen Sie dann auch. Gegenstück ist der BESCHEIDENE – fast will er sich unsichtbar machen, bloß keine Arbeit bereiten, hat sich mit allem abgefunden, macht alles, tut alles, wie geheissen,und die Ärzte und Physiotherapeuten müssen schon selbst an seiner verzerrten Körperhaltung ablesen, dass er furchtbare Schmerzen hat. Er fände es ungehörig, nach Schmerzmitteln zu fragen. Seine Angehörigen kommen in der Besuchszeit, huschen sofort von der Bettseite, wenn die Visite einschwebt , bringen ihm Essen und Trinken mit, um die Krankenhauskasse zu schonen. All diese Kategorien, die ich natürlich unendlich weiter differenzieren und in Untergruppe aufsplittern könnte, gibt es auch noch in besonderen Ausprägungen, etwa als Ausländer mit uns leider völlig unbekanntem kulturellem Hintergrund, keinerlei Kenntnis der deutschen Sprache und agierenden Angehörigen. Noch so ein Punkt. Zu fast allen Kranken gehören Angehörige, und wenn es keine gibt, ist die Lage noch wesentlich verzwickter, denn Einsamkeit ist erst recht kein guter Bundesgenosse im Heilungsprozess .Dennoch möchte ich als nächste Typologie mir den gemeinen Angehörigen vornehmen. Mit ihm hat man viel zu 11 tun im Krankenhausalltag – sei es, man ihn braucht, gerade bei kranken Kindern, Langliegern oder Alten, sei es, dass er nervt, beansprucht, beschäftigt. Das tun ganz sicher die OMNIPOTENTEN . Bei ihnen spricht meistens der Mann, der Vater, der dann auch im Konfliktfall herbei eilt. Sie sind häufig privat versichert, oft aber auch arbeitslos und vom Sozialamt betreut. Für sie ist nichts zu schwierig, zu teuer oder unerreichbar. Sie drohen schnell mit Behandlung im Ausland oder mit dem Rechtsanwalt. Der Gedanke, dass ein Leben selbst im Zeitalter der Machbarkeit begrenzt sein könnte, dass Tod nicht nur als Folge ärztlicher Fehler eintritt, ist ihnen fremd. Hoher Druck , Winken mir juristischen Konsequenzen etc. bringt guten Erfolg, scheinen sie zu meinen, und sehen nicht, dass übermäßig hohe Anforderungen auch zu Widerstand führen können, zu unbewusster Ablehnung und Abwehr. Nicht nur, weil sie den Eid des Hippokrates geschworen haben, ist es Ziel aller Ärzte, das Leben von Kranken zu retten oder ihnen zumindest ein Überleben in guter Qualität zu ermöglichen. Wenn dann so gelagerte Angehörige – bewusst durchaus im Wunsch , dem Patienten Verstärkung zu bringen – die Ärzte oder Pfleger verdächtigen, sie wollten ihrem Kind, ihrem Patienten schaden oder beherrschten ihr Handwerk nicht, muss das zu Störungen des Vertrauens , der Beziehung zwischen Arzt, Patient und Angehörigen führen. Da brechen häufig sehr rasch die Kommunikationsstrukturen zusammen und sind schwer wieder her zu stellen. 12 Besonders leid tun mir immer die Patienten, die versuchen, nach Verschwinden des Angehörigen, am Ende der Besuchszeit, wieder ein gutes Verhältnis zu schaffen. Chronisch kranke Kinder geraten besonders in die Bredouille: deren Eltern packen sie oft in Watte, machen sie zu kleinen, unfähigen Leidenden. Diese Rolle spielen diese Kinder dann auch im Beisein der Angehörigen, denn sie wollen möglichst ihrem Bilde entsprechen, schließlich sorgen die Eltern ja so für sie. Aber es ist gar nicht selten, dass gerade diese Kinder, die bleich in den Kissen liegen und kaum einen Löffel selbst zum Munde führen können, auf einmal aufblühen und selbständig sind, wenn die Eltern mal nicht auftauchen können. Aber gnade Gott diesen Kindern, wenn die Eltern sie so erwischen ...Omnipotente sind nämlich Egozentriker, die alles ihrem eigenen Bilde, ihren Vorstellungen anpassen. Gegenstück zu ihnen sind die JA-SAGER. Geduldig wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden, tauchen sie auf, hören brav zu, meinen wenig. Der Arzt ist ihr Idol. Oberflächlich mögen sie ideal im Klinikalltag sein, weil sie nicht stören, in der Realität sind sie es aber keinesfalls, denn sie tragen wenig zur Heilung bei. Sie haben resigniert, die Krankheit des Angehörigen akzeptiert, und die Schuld am geradezu eingeplanten, natürlich auch befürchteten Misserfolg schon im Vorfeld der Gefahr sich selbst, dem Kranken oder auch den vorbehandelnden Ärzten zugeschoben. Sie waren stets geduldig, freundlich, opferbereit – warum geht dann doch alles anders als gedacht? Solche Mitläufer sind latent unzufrieden, traurig, wenig informativ oder hilfreich. 13 Noch schwerer haben wir es mit den ANTIAUTORITÄREN. Ihr krankes Kind darf noch weniger als ein Gesundes Grenzen gesetzt bekommen, meinen sie, glücklich sei es nur wenn es schreiend und kreischend über die Station tobe, obwohl es wegen des Ergusses wirklich ruhig im Bett liegen sollte. Anweisungen von Ärzten sind grundsätzlich in Frage zu stellen, dem Pflegepersonal wird konstantes Misstrauen und oft überhebliche Kontrolle zuteil. Eifersüchtig wachen solche Angehörige über alles. Jede Dosisveränderung muss begründet werden, jede Verschlechterung des Befindens ebenfalls. Sie haben viele Freunde und Ratgeber vom Fach, die eigentlich immer zu Gegensätzlichem raten, was dann ausführlich mit den Doktors beraten werden muss, meist, wenn die nach einem langen Arbeitstag endlich nach Hause gehen möchten... Soll ich was sagen über Angehörige, die nie auftauchen? Das ist sehr traurig. Oder über Angehörige, die die Patienten selbst nicht sehen wollen? Über Erbschleicher und neugierige , vom Helfersyndrom geplagte Menschen, die sich einen Kranken wie ein Hündchen zulegen? Oder über die Exoten, etwa Roma-Familien, die mit zwanzig Personen rauchend und debattierend im Zweibettzimmer sitzen und nicht herauszukomplimentieren sind. .. Realität . Sie ahnen die Komplexität des Themas. Aber jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, ich möchte Ihnen deshalb die Typologie des gemeinen Arztes auch nicht vorenthalten. Auch sie zerfällt bei näherem Hinsehen in mehrere Untergruppen. Der portugiesische Literatur-Nobelpreisträger Antunes, der im Nebenberuf Neurochirurg ist, hat den Don Quixote als ideale Verkör14 perung des Arztes geschildert – den, der unermüdlich gegen Windmühlenflügel läuft, aber seinen Kumpan Sancho Pansa bei sich hat und einer großen Liebe ergeben ist. Don Quixote kann sich in vielen Verkleidungen zeigen. Hören Sie ein Zitat aus einem alten Lied von Hannes Wader. Der Refrain heißt: „Ich hatte mir noch so viel vorgenommen.“ „Es begann alles damit, dass ich einen starken Schnupfen bekam. Ich bin dann auch zum Arzt gegangen und habe mich untersuchen lassen. Und er machte so’n merkwürdiges Gesicht dabei. Ich fragte ihn: Ist es denn was Schlimmes? Tja , meinte der, Sie haben Krebs, Sie leben nur noch ein paar Tage. Am besten, Sie legen sich jetzt schön ins Bett und machen sich ‚n paar feuchte Umschläge. Sie haben eben zu wüst gelebt , jetzt haben Sie den Salat.“ Diese Art der schonungslosen Aufklärung ist natürlich nicht mehr überall an der Tagesordnung. Das Lied ist auch schon sicher über 30 Jahre alt und zum Darstellen einer Lebenshaltung so ruppig geschrieben. Und dennoch. Solche Krach-bumm- koste-es-was-eswolle, Hauptsache ich hab’s hinter mir!-Aufklärung findet sich trotz Metern einschlägiger Literatur immer noch. Wieso? Für manche Ärzte stellt es wirklich und auf die Dauer eine persönliche und emotionale Überforderung dar, immer wieder schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. Und das gehört nun mal zum Arztberuf: Die Kunde von der Diagnose schwerer Krankheiten, die Aussichtslosigkeit einer Therapie, die Nähe des Todes müssen formuliert werden. Vom Arzt. Und das ist sehr schwer. 15 Patienten und ihre Angehörige sind in solchen Momenten der Wahrheit meist überrumpelt, Angst überflutet sie, Schrecken, sie fühlöen sich, wenn sie überhaupt etwas fühlen, in ihren Grundfesten erschüttert, schutzlos ihrem Schicksal gegenüber. Diese Gefühle überträgen sich auf den Arzt. Eigene Gefühle und Erlebnisse werden, oft unbewusst, aktiviert – Angst , Schuldgefühle, eigene Todeserlebnisse, Hilflosigkeit, Erinnerung an misslungene Interventionen ... Manche Ärzte nun schützen sich vor den eigenen Gefühlen durch massive Abwehr, anstatt zu lernen, wie man mit ihnen umgehen kann. Sie geben sich möglichst kurz angebunden, kommen schnell zur Sache und zu oft sogar unsinnigen Therapievorschlägen. Mechanistische Aufklärung, im wesentlichen ein Monolog statt eines Gesprächs, also eines Dialogs. Diesen Arzt möchte ich den BRUTALO nennen. Er gibt sich phantasielos und wenig empathisch. Ihn findet man oft unter Chirurgen, die dann etwa jemanden mit terminaler Kardiomyopathie über die Chancen einer Herztransplantation so aufklären: „Von 100 Patienten mit diesem Herzproblem sterben 10 auf dem Tisch oder sofort nach der Operation. Zu welcher Gruppe Sie gehören, werden wir bald herausgefunden haben.“ Abgesehen davon, dass es statistisch totaler Quatsch ist, steigert ein solcher Könner des Gesprächs Angst und Noncompliance des Patienten in ihm unvorstellbare Höhe. Ist er Sadist oder Zyniker oder nur überarbeitet und abgebrüht? Interessiert er sich nur für’s Operative? Wie auch immer: Mir erscheint so was unzulässig und mit dem Ethos des Arztberufs nicht vereinbar. Arme Patienten, die mit solchen Brutalos in eine Beziehung kommen müssen! 16 Der Brutalo hat seinen Bruder im Geiste, reziprok allerdings: den SOFTIE . Der kann es nicht ertragen, Menschen böse Nachrichten zu sagen. Lieber lässt er sie im Unklaren, die Zeit wird’s schon bringen, das Schicksal schon zu irgendeiner Entwicklung führen. Der passt man sich dann an. Erleichtert und Not gedrungen, Achsel zuckend: „Was kann ich schon dafür, aber es tut mir sehr leid, für Sie und für uns alle.“ Der Softie versteht in seiner unendlichen Milde nicht, welchen Schaden er den betroffenen Gesprächspartner zufügt, in welch innere Not er ihn bringt – und dort allein lässt. Nur wirklich gut über alle Fakten aufgeklärte Patienten und Angehörige können sich im Verbund mit Ärzten und Pflegepersonal gegen das Leiden aufbäumen, wehren und effektiv gegen es kämpfen. Ohne diesen Kampf gibt es keine Heilung oder Herausschieben des finalen Stadiums, und je mehr sich ein Patient von seinem Doktor ernst genommen fühlt, je mehr ihm als Mündigem auch Verantwortung übertragen wird, desto bessere Compliance wird er zeigen, desto besser wird er sich auf die vom Arzt definierten Erfordernisse der Behandlung einstellen, sogar auf Abschied für immer, auf Tod. Verantwortung kann man aber nur übernehmen, wenn man Bescheid weiß. So kappt der Softie mit seiner nur scheinbar rührenden Art diese Beziehung und reduziert die Möglichkeiten des Patienten, der Angehörigen, die seine Partner sein sollten. Der Softie ist ein Brutalo im Schafspelz – oder im Arztkittel? Nein, solche Ärzte kommen gerne ohne. Sie zeigen rein äußerlich, dass sie mit dem Kittel tragenden System nichts zu tun haben, dass 17 sie auf Seiten der armen, armen Kranken stehen. Der Softie ist also leider ein Feigling. Die Fauna ärztlicher Wesen ist aber natürlich noch reicher. Denken Sie an den KUMPEL . Der versucht sofort, auf die andere Seite des Schreibtischs zu kommen, setzt sich auch oft dahin. Er möchte rasch eine enge Beziehung aufbauen, ihm geht es darum, dem Kranken zu versichern, dass alles eine Frage der Gruppe ist. „ Wir machen das schon!“ sagt er gern. Bloß – wen meint er mit wir? Genau besehen ist sein Auftritt auch ein Monolog, mit wir meint er nämlich meistens sich selbst, sicherlich aber nicht in erster Linie die Betroffenen. „Wir machen das schon, wenn du dich gut führen lässt, nicht aufmuckst und alles tust, was wir anordnen, “ könnte die Übersetzung und Weiterführung dieses Satzes sein. Jetzt verstehen Sie auch, weshalb so jemand seinen Patienten fragt: „Wie geht es uns heute?“ Dann ist Vorsicht geboten, denn dann will er was , zB die Bestätigung: „Gut!“ Die scheinbare Kumpelhaftigkeit ist eben nichts als Show. Auch der Kumpel hat letztlich seine Probleme mit den traurigen Fällen, mit den bedrohlichen Grauzonen zwischen Leben und Tod. Doch man kann sie nicht einfach wegjuxen – es sind andere Formen der Kooperation und der Beziehung nötig. Die Spezies gemeiner Arzt hat noch einen weiteren herausragenden Vertreter: den COOLEN . Für den Wissenschaftler, den Vertreter der High – Tech - Medizin ist ein Arzt vor allem eines: rational. Vernünftig. Er kennt sich aus in der Wissenschaft, jeder Patient wird überprüft auf seine Eignung zum Forschungsobjekt, mindestens ein 18 Artikel in einem ansehnlichen Fachblatt sollte bei einem Fall herausspringen. Er wirft mit Statistik um sich, Erfolgschancen kann er auf zwei Stellen hinter dem Komma bekannt geben, für die letzten 5 Jahre auf jeden Fall, und er tut das auch , ohne zu bedenken, dass Statistik durchaus relativ ist, vor allem für die, die ja mit einem gewissen Recht befürchten müssen, zu den zwanzig Prozent zu zählen, die durchs Netz fallen... Mit Gedanken der Fürsorge für Patienten belastet er sich höchsten im Umfeld einer Studie. Er glaubt, dass sich alles operationalisieren und quantifizieren lässt. Was meinen Sie, was passiert wenn so einer selbst mal ärztliche Hilfe braucht! da ich die Typologie der gemeinen Pflegekraft erst frühestens im kommenden Jahr anbieten möchte, fehlt eigentlich, um das Areal von Patient zwischen Wunsch und Realität abzustecken, nur noch die Beschreibung des gemeinen Krankenhauses. Zugige Gänge, auf denen man viele Stunden auf Röntgen oder EKG warten muss. Fehlende Besprechungsräume – wie angenehm es sein muss, zB eine Krebsdiagnose auf dem Gang neben Besucherklo und Untersuchungszimmer mitgeteilt zu bekommen! Oder im Sechsbettzimmer, wo fünf Paar Ohren aufgestellt lauschen! Intensivstationen, in denen Männlein und Weiblein im selben Raum liegen, schamlos bloss, angeblich zum schnelleren Zugriff im Notfall, ohne schützende Zwischenwände oder Vorhänge, oft sogar ohne Laken oder Decken. Vom ernährungstechnisch längst vorsintflutlichen Essen, von der Sauberkeit, - aus Kostengründen putzen immer mehr Menschen aus Ländern, die viele von denen, die sie einstellen, nur mit der Sagrotanflasche im Gepäck bereisen 19 - von den ständigen Bauarbeiten wollen wir nicht sprechen. Die langen Gänge, die grellen Lichter, das Knallen der leeren NaClFlaschen , die in die Müllbehälter geworfen werden, das ständige, nie aufhörende Grundrauschen einer Klinik, der Hubschrauber, die Ambulanzen, die Särge, die manchmal unverhofft aus einem Zimmer geschoben werden, in das man, neu auf der Station und auf die kommende lebensgefährliche Aneurysma-OP konzentriert, gerade einchecken will.. Haben denn Kranke heute überhaupt noch Lebensqualität? Haben Sie! Eine weitere Untersuchung unseres Instituts belegt das. Lebensqualität ist ein Konstrukt, das sich errechnet aus der subjektiven Einschätzung des psychischen, sozialen und somatischen Befindens eines Menschen. Natürlich ist das viel schwer wiegender als nur die medizinischen Werte und Parameter! Und was bestimmt nun diese Qualität? Interessanterweise schätzen Kranke ihre Lebens- und Gesundheitssituation häufig viel besser ein, als es zu erwarten wäre oder von Ärzten und Angehörigen getan wird. Es besteht kein objektiver Zusammenhang zwischen Krankheitsschwere und subjektiver LQ! Es besteht auch kein Zusammenhang zwischen schonender Therapie und LQ – eine radikale Behandlung wie eine Amputation kann die LQ tatsächlich verbessern. Eher schon kann man einen Zusammenhang mit COPING – Strategien sehen. Wie bewältige ich meine Krankheit? Menschen reagieren sehr individuell auf dieselben Symptome und Krankheiten. Das liegt an ihrer Persön20 lichkeit und ihrer Wahrnehmung von sich und der Krankheit. Wer optimistisch in die Zukunft schauen kann, wer sich positive Illusionen über sich selbst macht, wer davon ausgeht, dass er auch bei den nun mal notwendigen Helfern Kontrollmöglichkeiten hat, der punktet auch gut in Bezug auf Lebensqualität. Dies bedeutet, dass die Lebensqualität eines jeden Kranken von seiner Psyche bestimmt wird. Da haben es Kranke gut, die Ärzten begegnen, die sie wirklich ernst nehmen, respektieren, dass sie zuweilen andere Wertmassstäbe haben als die, die sich Zeit nehmen, ein Gespräch zu führen über Krankheitsideen, Coping-Strategien und anderes, was persönlichkeitsbezogen ist. Und die Kranken können aufatmen, wenn sie selbst sich darüber klar sind, dass das Jetzt zählt, dass ihre Krankheit auch mit ihnen zu tun hat – die Frage „Warum ich?“, die nicht zu beantworten ist, mit Psychologen oder Pfarren besprechen, die erkennen, dass sie durch ihre Erkrankung die Chance haben, ihr vergangenes Leben zu überdenken, zu sortieren, zu bewerten . Patientenzufriedenheit korreliert nicht mit dem zu erwartenden Ausgang! Dietrich Grönemeyer hat mal gesagt: Der wirkliche Arzt ist der Patient selbst! Das halte ich in aller Wünschbarkeit und Ambivalenz für Realität. Es setzt aber eben viel Aktivität des Patienten, des Kranken voraus. Es fordert Selbstbewusstsein vom Patienten. Selbstbewusstsein, das auch mal NEIN sagt zu vorgeschlagenen Therapien, Nein sagt zur endlosen Verlängerung des Lebens, wenn es schon nur noch eine vita minima ist. Nein sagt zur Ausklammerung von Leiden und Tod aus dem menschlichen Leben zugunsten einer 21 Ideologie des Machbaren. Tod und Leiden als einklagbares Versagen des Arztes? Kann doch wohl nicht wahr sein. Der Tod ist das einzige Faktum, das wir bei unserer Geburt über unser Leben wissen. Und ausgerechnet die einzige Gewissheit sollen wir ausklammern, verdrängen, schuldhaft empfinden, wenn sie geschieht? Ich glaube, viele der Ambivalenzen könnten aufgehoben werden, viele der Spannungen, unter denen die Menschen oft krumm gehen. Wir sollten nur mal wieder auf unsere innere Stimme hören, sagt die nicht öfter, als wir bereit sind, zuzugeben, dass wir müde des ewigen Behandelns sind? Ich erlebe es ja immer mal wieder, dass Menschen zwar nicht direkt aussprechen, dass sie ein neues Organ ablehnen, aber trotzdem ganz leise aus dem Leben schleichen. Sie sind müde, des Lebens müde – ist das so schlimm? Anderes Beispiel. Viele Menschen kennen Nierenkranke , die jede Woche dreimal an die Dialyse müssen, weil sonst ihre Körper nicht entgiftet werden und sie recht jämmerlich sterben würden. Aber wie viele Menschen haben einen Organspenderausweis? Nicht mal zehn Prozent unserer Bevölkerung. Es gibt aber zunehmend Menschen, die eine Organlebendspende zu machen bereit sind. Sind sie bereit? Oder erfüllen sie echte oder eingebildete Erwartungen von Kranken, die sicherlich auf einem realen Bedürfnis beruhen? Will man denn als Kranke, als Mutter, wirklich, dass die junge Tochter einem ein Stück ihrer Leber spendet? Sich so selbst in Lebensgefahr begibt? Oder doch zumindest in die Gefahr, selbst eine Kranke zu werden? Können Ärzte so etwas 22 wirklich anregen, fordern, können Psychologen da zustimmen, weil sie sagen, dass es freiwillig passiert? Wie wird man denn mit so etwas fertig? Ich kenne einen Fall, in dem genau dies passiert ist. Die Mutter wurde ihres Lebens wohl nicht mehr froh, zumindest kam sie nach der Transplantation gar nicht mehr aus der Klinik, starb drei Monate später. Ihre Tochter geriet in schwere psychische Turbulenzen. Heute geht es ihr wieder besser, aber sie sagt: „Ich habe zuviel und zu wenig gemacht.“ Zuviel geleistet für ihre eigene Kraft, zu wenig – die Mutter ist dennoch gestorben. Druck findet heute überall im medizinischen System statt, Zeitdruck vor allem. Aber darauf hab ich wohl schon hingewiesen. Abschließend möchte ich deshalb nur noch sagen, dass mir immer dankbar bewusst bin, welches Glück wir haben, wenn wir krank sind, dass wir heute leben. In einer Zeit, in der so vieles machbar ist, so viel Heilung und Besserung möglich sind und auch angeboten werden. Wenn ich am späteren Abend durch die leeren Gänge der Klinik gehe, erfüllt mit neuen Geschichten meiner Patienten und vielen Gedanken dazu, emotional sehr angespannt, denke ich oft, dass all dies, unser Jubel wie unsere Verzweiflung, nur möglich ist, weil wir so viel mehr Möglichkeiten haben als die Generationen vor uns. Wie und ob wir sie nutzen, haben wir zum großen Teil selbst in der Hand – und mancher Wunsch wird trotz Ambivalenz Lebensrealität. Wer hätte vor fünfzig Jahren geglaubt, dass man Organe von einem Menschen in den anderen übertragen kann? 23 24