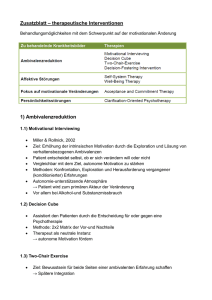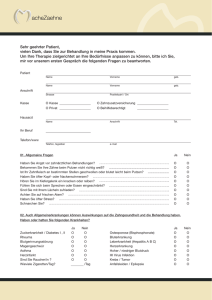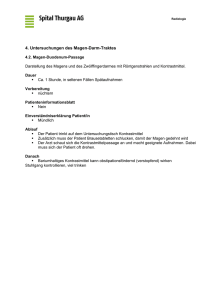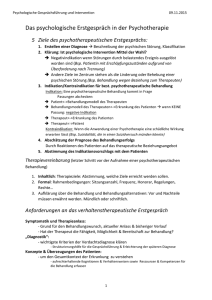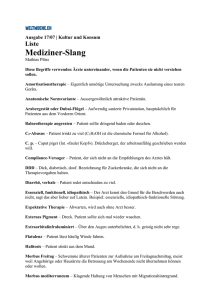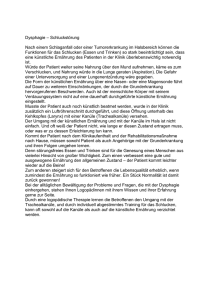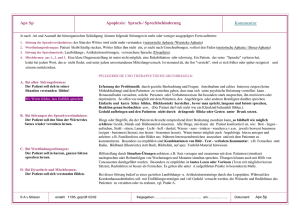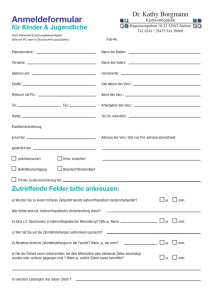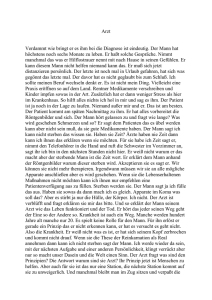Das Therapiekonzept der Analytischen
Werbung
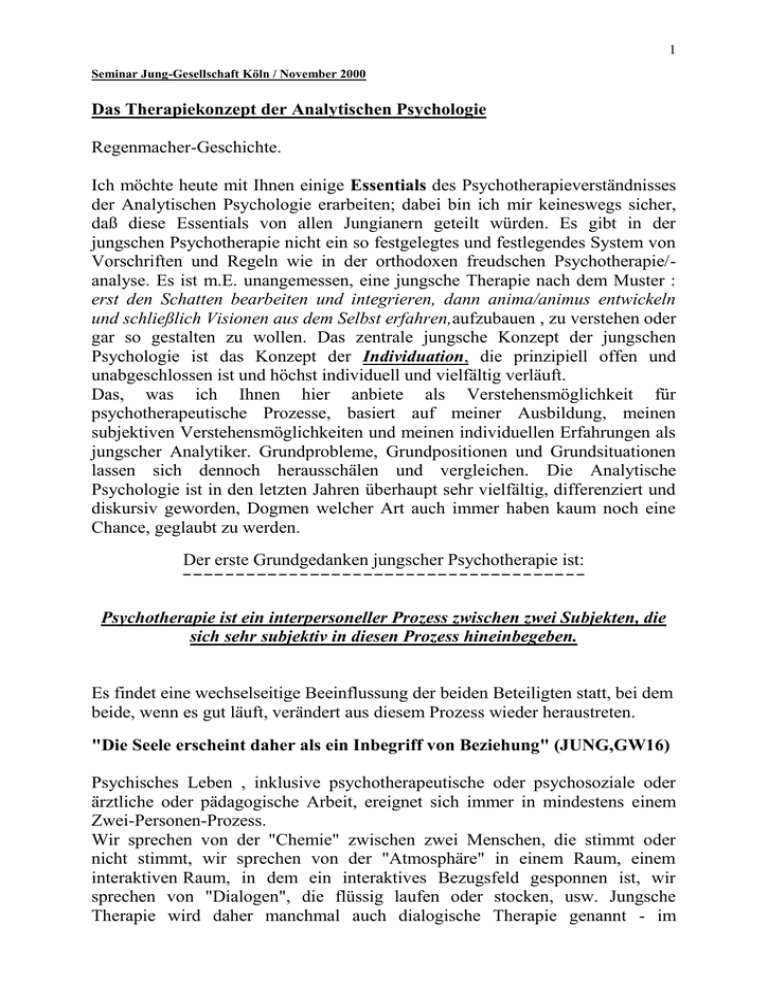
1 Seminar Jung-Gesellschaft Köln / November 2000 Das Therapiekonzept der Analytischen Psychologie Regenmacher-Geschichte. Ich möchte heute mit Ihnen einige Essentials des Psychotherapieverständnisses der Analytischen Psychologie erarbeiten; dabei bin ich mir keineswegs sicher, daß diese Essentials von allen Jungianern geteilt würden. Es gibt in der jungschen Psychotherapie nicht ein so festgelegtes und festlegendes System von Vorschriften und Regeln wie in der orthodoxen freudschen Psychotherapie/analyse. Es ist m.E. unangemessen, eine jungsche Therapie nach dem Muster : erst den Schatten bearbeiten und integrieren, dann anima/animus entwickeln und schließlich Visionen aus dem Selbst erfahren,aufzubauen , zu verstehen oder gar so gestalten zu wollen. Das zentrale jungsche Konzept der jungschen Psychologie ist das Konzept der Individuation, die prinzipiell offen und unabgeschlossen ist und höchst individuell und vielfältig verläuft. Das, was ich Ihnen hier anbiete als Verstehensmöglichkeit für psychotherapeutische Prozesse, basiert auf meiner Ausbildung, meinen subjektiven Verstehensmöglichkeiten und meinen individuellen Erfahrungen als jungscher Analytiker. Grundprobleme, Grundpositionen und Grundsituationen lassen sich dennoch herausschälen und vergleichen. Die Analytische Psychologie ist in den letzten Jahren überhaupt sehr vielfältig, differenziert und diskursiv geworden, Dogmen welcher Art auch immer haben kaum noch eine Chance, geglaubt zu werden. Der erste Grundgedanken jungscher Psychotherapie ist: Psychotherapie ist ein interpersoneller Prozess zwischen zwei Subjekten, die sich sehr subjektiv in diesen Prozess hineinbegeben. Es findet eine wechselseitige Beeinflussung der beiden Beteiligten statt, bei dem beide, wenn es gut läuft, verändert aus diesem Prozess wieder heraustreten. "Die Seele erscheint daher als ein Inbegriff von Beziehung" (JUNG,GW16) Psychisches Leben , inklusive psychotherapeutische oder psychosoziale oder ärztliche oder pädagogische Arbeit, ereignet sich immer in mindestens einem Zwei-Personen-Prozess. Wir sprechen von der "Chemie" zwischen zwei Menschen, die stimmt oder nicht stimmt, wir sprechen von der "Atmosphäre" in einem Raum, einem interaktiven Raum, in dem ein interaktives Bezugsfeld gesponnen ist, wir sprechen von "Dialogen", die flüssig laufen oder stocken, usw. Jungsche Therapie wird daher manchmal auch dialogische Therapie genannt - im 2 Unterscheid zu der alten freudianischen Auffassung von Therapie /Analyse, in der der Patient einen Monolog hält, bei dem der Analytiker zuhört und maximal Deutungen gibt - einer allerdings auch unter modernen Freudianer weitgehend veralteten Auffassung. Sie haben in Ihrem Leben vielfältige Erfahrungen in diesem interaktiven Feld auf den verschiedensten Ebenen gemacht: in der Beziehung zu ihren Eltern, zu Freunden oder Freundinnen, in Partnerschaftsbeziehungen, in sexuellen Beziehungen, vielleicht auch in Therapien, in Gruppen-Selbsterfahrungen, in Kleingruppen, in Supervision, in Seminaren. Im psychotherapeutischen Bereich geht es dabei immer darum , die Introspektion zu fördern, d.h. das Hineinschauen in die eigene Seele zu ermöglichen, zu vertiefen, zu erweitern. Introspektion ist nicht das Studieren seelischer Bilder im Elfenbeinturm, im eigenen Studierstüblein, sondern in der Begegnung und Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten und mit den sog. "Professionellen". Es geht darum, eine Beobachtung zu installieren, die auf das menschliche Innenleben eingestellt ist - was ja eine ganz andere Beobachtungsform ist als die, die sich auf die Beobachtung der äußeren gegenständlichen Welt bezieht. Dabei muß man mehr oder weniger starke zwischenmenschliche Beziehungen eingehen, die das Sammeln emotionaler und symbolischer Informationen verbessern. Was passiert in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, die zum Zwecke der Untersuchung einer Psyche eingegangen wird? Was passiert bei folgenden Konstellationen: Untersuchung der Psyche eines Anderen in meiner Psyche. Untersuchung meiner Psyche in der Psyche eines Anderen. Hereinlassen der Psyche eines Anderen in meine eigene Psyche, um sie betrachten zu können. Benutzung meiner eigenen Psyche, um herauszufinden, wie es ist, jemand anders zu sein. Es geht also einerseits um interpersonelle Zusammmnehänge, um Verbundenheit zweier Körper und Seelen als auch um die inneren Bilder dieser zwei Personen, die sich mit einander mischen, verbinden, also Körper - inneres Bild - Beziehung , Interpersonelles und Intrapersonelles. 3 Patient Ich-Du-Beziehung Arzt interpersonale Spaltung Wer krank ist, sucht Heilung außerhalb seiner selbst, bei einer anderen Person, die ihn heilen kann, der eigenen Krankheitsgeschichte zuhört und hilft. Zwischen beiden besteht ein Gefälle: wenn ich krank bin, bin ich schwach, hilfsbedürftig, verletzt, leidend, unwissend, und phantasiere den Anderen als stark, gesund, hilfsbereit und kompetent und fähig. Als Patient bin ich ohnmächtig, hilflos der Krankheit ausgeliefert, während mein Arzt/Therapeut im Besitz von Macht und Hilfsmitteln ist. Gesundheit wird dabei heutzutage oft wie eine Ware erlebt, die im Dienstleistungsgeschäft des Gesundheitswesens weitergegeben wird : als Patient bin ich ein Habenichts, während der Arzt/Therapeut der Reiche und Mächtige zu sein scheint. Nicht nur die Gesundheit habe ich verloren, mir fehlen auch das Wissen, die Heilmethoden und die Heilmittel, über welche die gesunden sog.Experten verfügen. Unter dieser interpersonellen Spaltung gibt es aber auch eine intrapersonelle Spaltung: Patient Arzt intrapersonale Spaltung innerer Heiler innere Verwundung Der Patient und zunächst mal auch der Arzt ist von seinem Unbewußten in der Regel abgeschnitten. Das individuelle Abgeschnittensein vom Unbewußten bedeutet, daß der Patient nicht die eigene Heilerseite und der Arzt nicht die eigene Verwundungsseite spürt (Beispiel O.Sacks). "Nur wo der Arzt selber getroffen ist, wirkt er. Nur der Verwundete heilt. Wo aber der Arzt einen Persona-Panzer hat, wirkt er nicht."(JUNG 1962) In der metaphorischen Sprache der Alchemie werden diese Spaltungen, die zu beginn einer Therapie bzw. eines zwischenmenschlich bedeutsamen ZweiPersonen-Prozesses am Werke sind als massa confusa, als Chaos usw. 4 beschrieben, in denen die ungeläuterten Vermischungen das opus magnum erforderlich machen. Unter dem Aspekt des konstellierten Heiler-Archetyps bedeuten diese Spaltungen eine Aufteilung: der Therapeut, Analytiker , Arzt erscheint als allmächtig, stark, gesund und kräftig, der Patient dagegen als passiv, abhängig, hilflos und zur Unterwürfigkeit neigend. Tatsächlich bestehen diese interpersonellen Spaltungen aber auch intrapsychisch, d.h. in jedem der Beiden. Wenn der Analytiker oder Therapeut innere Wunden hat - und zweifellos hat er solche dann trennt man sich von einem Teil der inneren Welt ab, wenn man sich als völlig gesund oder mehr oder weniger gesund präsentiert ( was wiederum notwendig ist für die Konstellierung des Archetyps des Heilers). Wenn der Patient dementsprechend ausschließlich als krank betrachtet wird, schneidet man ihn von seinem inneren Heiler oder der Fähigkeit, sich selbst zu heilen, ab. Tatsächlich hat der Patient das ja schon getan, sonst käme er ja gar nicht zum Therapeuten/Heiler. Sobald jemand krank ist, tritt dieses innere Bild des Gegensatzpaares HeilerVerwundeter in Aktion. Um die Behandlung in Gang zu bringen, wird der Heiler anfänglich auf den Analytiker/Arzt projeziert. Im Folgenden geht es dann darum, daß der Patient diese Projektion zurücknimmt, damit die eigenen gesunden Fähigkeiten eingesetzt werden. Umgekehrt projeziert auch der Analytiker zu Beginn seine verwundete Seite auf den Patienten, damit er Sympathie und Verständnis empfinden kann und so zu helfen bereit wird. Er muß ebenfalls diese Projektionen zurücknehmen, um die Fähigkeit des Patienten, gesund zu werden, freizusetzen. Das impliziert, daß der Analytiker/Arzt mit seiner inneren Verwundung, seinen inneren Verletzungen in Berührung bleibt. Dieser Prozess kann sich im Laufe einer Analyse/Behandlung immer aufs Neue wiederholen. Die persona medici dient vor allem - neben den narzißtischen Gratifikationen des "Gottes in weiß" - dazu, die Induktion oder Infektion durch den Patienten und dessen Krankheit vermeiden zu wollen. Induktion/Infektion Patient Arzt UBW UBW 5 Verwandte Begriffe bei JUNG bzw. ähnliche Begriffe: Induktion, Infektion , Affiziertsein, Einfühlung, projektive Identifikation, participation mystique, unbewußte Identität, archaische Identität. Diese Induktion konstelliert die analytische oder therapeutische Beziehung zwischen Patient und Therapeut, d.h. durch dieses Affiziertsein des Einen durch den Anderen entsteht eine Beziehung zwischen Menschen, die der Erforschung des Inneren dient - und zwar des Inneren der beiden Beteiligten. CONJUNCTIO Quaternio-Modell Patient UBW Innerer Heiler Arzt/Therapeut/Heiler UBW Verwundung 6 vas hermeticum Patient Therapeut Feuer Patient Therapeut mare nostrum massa confusa aqua permanens mare tenebrosum analytisches Kind mixtum compositum CONJUNCTIO Quaternio-Modell Patient UBW Innerer Heiler Arzt/Therapeut/Heiler UBW Verwundung 7 Jung ist auf die geniale Idee gekommen, die Alchemie und ihre Metaphern für ein Verständnis des Zusammenspiels interpersoneller Verbundenheit und innerpsychischerAktivität zu verwenden. Die Psychologie der Alchemie beschreibt sowohl einen Zwei-Personen-Prozess (keineswegs nur den innerhalb einer Analyse, sondern allgemeingültig für alle intensiven zwischenmenschliche Begegnungsformen) und einen Individuationsprozess innerhalb eines Menschen. Wenn man so will, kann man die Alchemie sowohl objektstufig als auch subjektstufig betrachten. Das beinhaltet auch die Notwendigkeit, Inhaltsanalyse und Prozessanalyse gleichzeitig und gleichwertig im Auge zu haben. Allerdings spricht die Alchemie in verklausulierter Sprache, in einer Sprache, in der die Alchemisten ihnen unbewußte Denkvorgänge in die Materie und die Prozeduren der Bearbeitung dieser Materie hineinprojezierten. Es handelt sich somit auch um damals unbewußte, heute entschlüsselte Imaginationen interpersoneller Verbundenheit und innerpsychischer Aktivität. Daher haben die Bilder der Alchemie eine Verbindung zum mundus imaginalis, oder wie auch gesagt wird,handelt es sich um den Bereich des feinstofflichen Körpers, des sogenannten dritten Bereichs. Für Jung war die Alchemie deshalb so fasznierend, weil sie die "merkwürdige Verwandlungsfähigkeit der menschlichen Seele ausdrückt". Er fand in ihr einen Vorläufer seines eigenen Individuationskonzepts und er bemerkte, daß die Alchemie in der Metapher der conjunctio ein Konzept für Übertragungsvorgänge besaß. Was machten die Alchemisten? ( siehe "opus magnum" im Lexikon der Alchemie). Der Alchemist arbeitete gleichzeitig an der Seele in der Materie und an den Materien in seiner Seele; dabei wurde vermutet, daß die Seele aus dem materiellen Gefängnis freigesetzt werden muß, in das die Natur sie eingeschlossen hat. Die ganze Prozedur ist subversiv, d.h. ein Werk gegen die Natur, ein opus contra naturam, eine Freisetzung des Sinns aus der materiellen und körperlichen Welt. Nichts anderes geschieht in einer Analyse auch, wenn Therapeut und Patient an das Werk gehen, die Ursache und den Sinn einer Neurose zu entdecken und herauszufinden, was und wie das darin eingesperrte seelische Wachstum freisetzen könnte. "Was der moderne Therapeut im Menschen sieht, sahhen die Alchemisten in metallischer Form"(Samuels) Betrachten wir die alchemistische Metapher angewendet auf Therapie und Analyse : Der zentrale Begriff ist die conjunctio , der sich darauf bezieht, daß sich im vas hermeticum die unterschiedlichen Elemente paaren und vermischen. Dazu wurden die Elemente am Anfang, die massa confusa oder prima materia entsprechend ihrer Kombinationsmöglichkeit ausgewählt, die man sich als 8 Gegensätze vorstellte, deren Vermischung ein neues, drittes Produkt hervorbringen würde: das ist die conjunctio. Diese Elemente wurden häufig als männliche oder weibliche Figuren dargestellt, deren sexuelle Vereinigung die conjunctio repräsentieren sollte. In der Analyse finden wir diese Metapher wieder: 1. Die Interaktion des Analytikers mit seinem analytischen Gegenteil,dem Patienten und umgekehrt 2.Trennung und Verbindung der miteinander in Konflikt liegenden Elemente innerhalb der beiden Psychen 3.die conjunctio dieser beider Psychen: persönliches Bezogensein und innerpsychische Prozesse 4. Integration der unbewußten Anteile der Psyche in das Ich des Patienten und des gleichen Prozesses beim Analytiker 5. Das alles findet im analytischen Gefäß, Rahmen, Setting, in der analytischen Beziehung, im Laboratorium (Oratorium) des Analytikers statt. Vas hermeticum ist die beste Metapher für den vollständig geschlossenen Raum der analytischen Beziehung, in die nichts Fremdes und Drittes hineinkommen sollte (Idealtypischerweise). 6. Die Conjunctio der sinnlichen, gegenständlichen, körperlichen Welt mit der geistigen Dimension ( siehe z.B. Psychisierung körperlicher Symptome, die ja meistens die Patienten in die Therapie bringen). Ein weiterer wichtiger Gedanke ist die Wandelbarkeit der Elemente. In der Alchemie arbeitet der Adept oft mit einer anderen realen opder geistigen Person zusammen, seiner soror mystica. Hat das nicht viel Ähnlichkeit mit der Vorstellung einer anima, die als Beziehungsfunktion zwischen Ich und Unbewußten beim Analytiker entwickelt sein sollte, mit der er aber keineswehgs identifiziert sein sollte? Die Stufen des alchemistischen Prozesses lassen sich auch in analytischen Prozessen wiederfinden: nigredo albedo rubedo nigredo kann z.B. sich zeigen in einem dunklen, schweren Traum, mit dem der Träumer anfangs nichts anzufangen weiß oder der ihn in depressive Stimmungen, ja in Verzweiflung und Aussichtslosigkeit stürzen kann. Oft geht einer inneren Wandlung eine Depression voraus. Oder das Ende der Flitterwochen zu Beginn einer Analyse wird durch eine Einschwärzung der hochfliegenden Gefühle bei Analytiker oder /und Patient angezeigt. 9 Die albedo ist die Weißung, d.h. die Bewußtwerdung unbeußter Inhalte. Analyse ist somit gekennzeichnet als ein dialektischer Prozess, der sich im Hin und Her von Polaritäten, Widersprüchen, Konflikten intra- und interpsychischer Art vollzieht. Analyse als archetypischer Prozess: Der Weg Es gibt viele Möglichkeiten, Therapiegeschehen zu beschreiben: tiefenpsychologische, ethnologische, soziologische, philosophische, sprachwissenschaftliche Zugänge bieten vielfältige Beobachtungs- und Beschreibungskategorien. Ich möchte hier zunächst Psychotherapie/Analyse als Verlebendigung und Inkarnieren eines Archetyps beschreiben, nämlich des Archetyps des Weges. In der Urgeschichte tauchte der Archetyp des Weges zum erstenmal beim Eiszeitmenschen auf. In einem weitgehend noch unbewußten Ritual führte der Weg in Höhlen von Bergen, in deren verborgenem und schwer erreichbarem Inneren Heiligtümer mit Tierbildern angelegt wurden, von deren Erlegung ihre Existenz abhing. Diese Bilder sowie die Höhlen hatten magisch-sakrale Bedeutung. Der schwere und gefährliche Weg zu diesen Heiligtümer gehörte mit zu der rituellen Wirklichkeit der Bergtempel. Auf späterer Kulturstufe und bei entwickelterem Bewußtsein wird dieser Archetyp des Weges zum bewußten Ritual-Weg, der zum Beispiel in der Anlage von Tempeln den Verehrenden zwingt, einen rituellen Weg von der Peripherie bis zum Zentrum des Heiligtums zu gehen, und so das Weg - Ritual zu vollziehen. Prozessionen gehen auch heute noch diesen Kollektivweg des Rituals zum Heiligtum. Der Leidens-Weg Christi ist eine weitere und andere Form dieses Archetyps, in ihm wird der Schicksalsweg zu dem der Erlösung, und mit seinem bewußten Ausspruch „Ich bin der Weg“ erreicht diese Ausprägung des Weg-Archetyps eine neue, nun schon ganz innerliche und symbolische Stufe. Die Imitatio Christi beinhaltet die Nachfolge - Haltungen, in denen der christlich innere Weg nachgegangen wird. Der Schicksalsweg des Oedipus ( übrigens wunderbar nachvollzogen in Pasolinis Oedipus-Film) ist dagegen ein Weg des Scheiterns, wenn man vom Ende des Weges des Oedipus (er wird entrückt in Begleitung von Theseus) absieht. Den Signaturen des Archetyps des Weges begegnen wir auf Schritt und Tritt. So sprechen wir von einem „inneren Weg der Entwicklung“, von Begleitsymbolen wie „Orientierung“ und „Orientierungslosigkeit“, in Politik oder Kunst sprechen 10 wir von „Richtungen“.(nach NEUMANN). In der jungschen Psychologie sprechen wie bevorzugt vom Individuationsweg eines Menschen und haben damit eine Metapher, ein Bild zur Verfügung, das jeder Mensch erfährt. Um das ganz deutlich zu sagen: jeder Mensch ist auf einem Individuationsweg, nicht nur, wie das manchmal bei einer elitären Auffassung hervorlugt, Auserwählte oder Eingeweihte oder besonders Begabte. Dieser Gedanke ist mir sehr wichtig, da er eine für mich unabdingbare Grundhaltung des Analytikers/in kennzeichnet: die möglichst vollständigste Achtung des Patienten und seiner Wege, die er gegangen ist, auch wenn diese Wege in neurotische oder krankmachende Konflikte geführt haben. Die Frage ist immer nur, mit wieviel Bewußtheit ein Mensch seinen Individuationsweg geht. Einteilung von Phasen: 1. Initialphase 2. Latenz-/Erprobungsphase, Empfängnisraum / Konstellierung Grundkonflikte 3. Phase der negativen und/oder positiven Regression 4. Individuationsphase der 1. Die Initialphase Wenn ein „Wegsuchender“ zum/r AnalytikerIn sich begibt, ist der Archetyp des Weges konstelliert. Dabei kann diese Konstellation in unterschiedlichem Maße bewußt sein. Ein Patient, der von einem Arzt geschickt wird, verfügt möglicherweise über wenig Einsicht in seine „Wegsuche“, möglicherweise nimmt er nur Symptome wahr. Krankheitseinsicht bedeutet also Bewußtsein über die Notwendigkeit einer Wegfindung, einer Wegsuche, bedeutet das Eingeständnis der Orientierungslosigkeit und ist der Ruf nach einem Wegbegleiter, oft nach einem Wegführer. Diese Anfangssituation legt fast zwingend bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen bei Wegsuchendem und Wegbegleiter nahe. So wird man sich erstmal umschauen: an welchem Ort steht der Wegsuchende? Ist es eine Sackgasse? Teilt sich der Weg ? Gibt es Licht oder herrscht Dunkelheit? Ist der Weg frei und fürchtet sich der Wegsuchende vor dieser Freiheit? Ist der Weg versperrt - vielleicht durch andere oder durch äußere Bedingungen? Ist der Wegsuchende erschöpft, weil er zu lange mit dicken Lehmklumpen an den Füßen gelaufen ist? Was ist mit seinen Füßen, seiner Erdung? Wohin geht sein Blick, in welche Richtung schreitet er aus? Hat er eine Karte, ist ihm ein sein Plan bewußt? Also das, was man aktuellen Befund nennt. 11 Woher kommt der Wegsuchende? Welchen Weg ist er bisher gegangen?Wo ist er ins Stolpern geraten? Blieben Teile von ihm irgendwo, wo er gestürzt ist (traumata), liegen? Hat er einen Rucksack dabei, in dem Verborgenes, Unentwickeltes steckt? Wem ist er auf seinem Weg bisher begegnet ? Eltern, Geschwister, Lehrer, Freunde, Freundinnen, Kollegen usw. ? Also Anamnese. Die Betrachtung des Analyseanfangs als Anfang eines Weges bewirkt unter günstigen Umständen, daß die beiden Dialogpartner zunächst einmal stehen bleiben, sich dieses Stehenbleiben auch gönnen und nicht rastlos und hektisch hin und herlaufen, sondern innehalten und sich umschauen. Ein solcher Umgang mit dieser Anfangssituation kann das Klima und die Atmosphäre in einer Analyse auf förderliche Bahnen lenken. Von einem energetischen Standpunkt aus begreift JUNG eine Neurose als eine Stockung des Lebensflusses und sieht das Ziel in einem erneuten Strömen der Libido, des Lebensflusses. Aufgrund dieser Stockung besteht zu Beginn das , was JUNG dem alchemistischen Verständnis von Wandlungsprozessen abgelauscht hat: die „nigredo“, oder „massa confusa“, „chaos“ (Gott des Anfangs) oder „prima materia“. Jeder dieser Begriffe legt einen anderen Akzent auf die Anfangssituation. „Nigredo“ bedeutet vor allem Schwärze, Dunkelheit, Unbewußtheit. „massa confusa“ weist auf Verwirrtheit hin, auf Verbindungen und Verknüpfungen im Bewußtsein des Wegsuchenden, bei denen man als Gegenüber das Gefühl hat, daß irgendwas nicht stimmt, also daß man mit der Komplexsicht des Patienten konfrontiert ist. „Chaos“ ist in der griechischen Mythologie der Gott des Anfangs, Chaos ist der klaffende, leere Raum; bei Hesiod gehen aus dem Chaos Erebos(die Unterwelt) und Nyx (die Nacht) hervor ( während man später in naturphiosophischer Spekulation in Eros den alles gestaltenden Gott sah, der aus dem Chaos den Kosmos schuf.) So wird die Angst vor den Gefahren des Weges vielleicht verständlicher sein, enn man sich die dahinterstehende Mächte deutlich macht. „Prima materia“ legt dagegen den Akzent auf das ( psychische) Material, in dem alles, das Ganze und das Eine, die schwer erreichbare Kostbarkeit, etc., von Anbeginn enthalten ist . Diese „prima materia“ muß in ein Gefäß, in das vas hermeticum, das abgeschlossene Gefäß, das wir in moderner Sprache den analytischen Rahmen nennen. Dieses Gefäß muß nach außen abgeschlossen sein, damit die materia drinnen gekocht werden kann. Der Umgang des Patienten mit diesem Gefäß kann uns dabei wichtige Aufschlüsse über seinen Stand, seine Entwicklung geben. Benutzt er es als Abfalleimer, in den er all sein Chaos hineinstopft, um es loszuwerden und macht er den AnalytkerIn dadurch zum Container für seine abgespaltenen, unverdaulichen Anteile? Benutzt er es als einen Ofen oder Topf, 12 in den er sorgsam auswählend die Zutaten hineinbegibt? Benutzt er es/ihn als Kloschüssel zum Vollscheißen? Krümelt er nur spärlich ab und zu etwas hinein? Wirft er das Meiste daneben? Die Assoziationen und Bilder, die einem dazu einfallen, stehen alle in Verbindung mit dem Zentralsymbol des Mutterarchetyps, dem Gefäß: einerseits wird der Umgang des Patienten mit diesem Gefäß zu Beginn der Analyse vom Wiederholungszwng der frühen Muttererfahrung bestimmt; andererseits zeigt sich in diesem Umgang auch das Defizit, der Mangel des Patienten an mütterlicher Symbiose. Beim Eintritt des Patienten in den analytischen Raum gerät der Patient oft in eine Krise und sieht sich gezwungen, seine Gründe für den Eintritt in diesen Raum zu überprüfen. Nicht selten entsteht der intensive Wunsch zu fliehen. Daher sind hier die haltenden, schützenden mutterspezifischen Haltungen des Analytikers gefragt und konstellieren sich meistens auch automatisch. Unter dieser Bedingung fühlt sich der Patient dann auch oft stark genug, sich der „Zerstückelung“ in der Analyse auszusetzen. Der Beginn einer Analyse scheint daher oft durch den Elementarcharkater des Weiblichen geprägt zu sein, der überall da evident wird, wo wir es noch mit einem kleinen, schwachen Ich zu tun haben und das Unbewußte dominiert (Neumann). Der negative Elementarcharkater des Weiblichen zeigt sich dabei oft in Form des Wiederholungszwanges in der Symptomatik des Patienten, in der die dynamischen Kräfte des Patienten immer wieder in den eigenen Kreis ewiger Wiederholung zurückgebogen werden. Natürlich hängt das Ausmaß der Dominanz der Großen Mutter vom Reifegrad des Ichs des jeweiligen Patienten ab. Wenn wir von Initialphase sprechen,liegt es nahe, den Beginn einer Analyse als Initiationsritus zu betrachten. Nach Arnold van Gennep und Victor Turner, den beiden bedeutendsten Forschern über Rituale, bestehen Rituale aus heiligen, kulturellen, nicht profanen (Sprech)Handlungen, die einen Orts-, Zustands-, Positions- und Altersgruppenwechsel rituell begleiten. Genau dies soll ja in einer Analyse geschehen: der innere Ort des Patienten und damit seine Perspektive auf seine innere Landschaft soll sich positionell verändern, der Zustand der blockierten oder festgehaltenen Libido soll aufgelöst werden, er soll sich altersmäßig fortentwickeln aus infantiler oder adoleszenter Zugehörigkeit oder gegebenenfalls in seiner Altersgruppe ankommen (z.B. die Leugnung der Lebensmitte).(Beispiele: Gipsbett-Pat., Frau W., depressiver Pat.HerrP.) 13 Die Analyse ist ein Übergangsritus. Dieser weist drei Phasen auf: die Trennungsphase die Schwellenphase die (Wieder)Angliederungsphase. Wenn ein Patient in die Hütte des Schamanen/Analytikers kommt, separiert er sich räumlich, zeitlich und sozial. Er verläßt sozusagen sein „Dorf“, seine Angehörigen , verbringt neue Zeit in einem gänzlich andersartig strukturiertem Dialograum, er löst sich von den bisherigen kulturellen Sprechgewohnheiten. Ein dabei häufiger auftretendes Phänomen ist bei Patienten mit mangelnden triadischen Beziehungsfähigkeiten, daß sie sich von einem Partner trennen oder - in der Projektion auf einen idealisierten Analytiker Elternbilder mit einem Schlage rauswerfen (siehe auch Psychoszene- Kontaktverbot mit Eltern u.ä.) Dies sind Anzeichen für frühe Störungsanteile und Spaltungstendenzen. Andererseits kann diese Trennungsphase von starken Widerständen begleitet sein, in denen der Patient auf seiner bisherigen Sichtweise bestehen bleibt. Er weigert sich , das rituelle Subjekt zu werden und haftet an den vertrauten Bahnen seiner Neurose.(besonders häufig und auffällig bei Zwangsneurosen) Eine sehr große Rolle beim Beginn einer Analyse spielen der Initialtraum bzw. die Initialträume des Patienten. Im Initialtraum zeigt sich, ob das Unbewußte des Patienten auf das analytische Angebot anspricht, ob das Unbewußte sozusagen bereit ist, sich in das angebotene vas hermeticum hineinzubegeben. Der Initialtraum gibt - Hinweise auf die Diagnose der psychischen Störung bzw. auf die zugrundeliegende Komplexkonstellation - Hinweise auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Patenten und erlaubt so prospektive und prognostische Einschätzungen - Hinweise an den Therapeuten: womit beginnen? Wünsche des Patienten an die Therapie und den Therapeuten, auch von der unbewußten Seite des Patienten her. - Insgesamt bilden die Initialtraüme eine "Orientierungs- oder Landkarte" (Adam) für die geplante Therapie oder für den ersten Abschnitt einer Therapie. (Im weiteren Verlauf einer Therapie kann es zu weiteren Initialträumen kommen, wenn eine neue Phase, ein neuer Komplex, eine neue Übertragungssituation engeleitet werden soll.) 14 Beispiele: Pat.A. (28.Std.) : "Ich lief durch eine menschenleere Stadt. Ich war in einem Zug und in der U-Bahn, auch dort war alles menschenleer. Dann ging ich auf einem Saumpfad im Gebirge. Links und rechts ging es steil bergab. Plötzlich stand ich wie erstarrt. Jemand kam auf mich zugeritten, auf einem Pferd. Pferd und Reiter stürzten vor meinen Augen ab. Jemand packte mich von hinten und hielt mich." Pat.B. „Eine liebe alte Frau, die alle sehen können, sagt zu mir: Vergiß nicht dem Herrn Schwind zu sagen, dich ernst zu nehmen mit deinen Ängsten und Nöten, wie schwer dir alles fällt.“ „Ich bin im Linienbus, es ist voll, ich fühle mich unwohl wegen der Hektik und dem Gedränge. Ich erreiche einen Sitzplatz, aber es ist sehr beklemmend. Sie legen Ihre Hände auf meine Schultern. Wir hatten ein stilles Einverständnis: hier versteht jemand, was läuft. Im Bus war es zu laut, zu unbezogen, ein Nebeneinander von Menschen.“ „Ein Hund, Straßenköter, in erbärmlichem Zustand. Trotzdem ist er zutraulich geblieben.“ „Ein Hund lief rum, auf der Suche nach etwas zu essen. Er war vergnügt, es war gutes Wetter. Dann kommt er an ein Erdloch, mit etwa 1m Durchmesser. Er sitzt am Rand und guckt rein. Ein kaltes Loch, feuchte modrige Kälte, feuchte Erde. Das Loch wurde immer größer. Plötzlich war es dunkel, graublauer Himmel. Eine märchenhafte, unheimliche, gespenstische Atmosphäre. Ein großer, schwarzer, abnehmender Mond, eine Sichel, war da. Auch der Hund wurde größer, zotteliger. Er fühlt sich anders an:er könnte den Mond anheulen.“ 15 Pat.C.(1.Std): "Ich habe mir eine Uhr in einer Blechdose gekauft, darin sind kleine Goldfische. Am nächsten Morgen sind alle Fische tot, weil das Wasser verdampft ist. In einem Aquarium sind getigerte Fische, Kampffische. Kampfangriffe auf mich bedrohen mich, aber ich war beruhigt wegen der Aquariumsglaswand. Hinter mir ist aber jemand, der mich warnt. In dem Moment springt ein Fisch aus dem Aquarium und will mich in den Fuß beißen, was lebensbedrohlich ist. Ein roter Oldtimer-Lastwagen rollt einen Berg runter und hat keine Bremsen mehr." (165.Std.): "Ein Begräbnis.. Das Begräbnis einer Frau. Große Kathedrale. Im Innern. Die tote Frau ist hoch aufgebahrt, unter weißen Tüchern und Decken. Drumherum die Trauergemeinde. Jemand fährt langsam und gemessen einen Rollwagen, auf den die Tote gelegt werden soll, durch den Mittelgang. Plötzlich, auf den Schultern von vier Sargträgern, richtet sich die Tote auf. Sie war noch gar nicht gestorben. Im Umkreis ein Aufschrecken, allgemeine Verwunderung, keine Panik. Ich bin an der Frau sehr interessiert, will ihr helfen. Sie muß vor ihrem Tod sehr krank gewesen sein und ist es noch. Ich hole sie aus ihren unzähligen Tüchern. Irgendwo ist mein Vater. Die Frau ist nackt, sie steht auf, ich nehme sie an die Hand und wir gehen durch ein Seitenschiff Richtung Ausgang." 16 Ich sprach oben davon, den therapeutischen Prozess auch als Ritual zu betrachten. Dieses Verständnis unterscheidet die jungsche Therapie sehr von der freudschen Variante, wo an dieser Stelle von "Arbeitsbündnis" und "Grundregel" (freies Assoziieren) die Rede ist. Natürlich gibt es auch Jungianer, die am Beginn einer Therapie allerlei Regeln einführen; z.B. einer der beliebtesten ist, daß der Patient seine Träume aufschreiben und eine Kopie dem Therapeuten geben soll. Wichtig scheint mir hier zu sein, daß jeder Analytiker gemäß seinen Möglichkeiten, aber auch unter Beachtung des archetypischen Hintergrundes Regeln aufstellen kann. Ich persönlich halte es damit, sowenig wie möglich an Regelung vorzugeben, d.h. ich teile nur mit, daß eine Stunde 50 Minuten dauert und teile meine Urlaubszeiten mit, an die der Patient sich halten soll, aber nicht muß. Mir ist daran gelegen, die Verantwortung des Patienten für seine Analyse zu stärken, zu fordern und zu fördern. 2. Latenz-/Erprobungsphase/ Konstellierung der Grundkonflikte Ist die Initialphase häufig dramatisch und gibt erste tiefe Einblicke in die Individuationssituation des Patienten, so verläuft die 2.Phase einer Therapie häufig ruhiger, leiser. Die oft überraschende Tiefendimension der Initialphase erfährt nun in der zweiten Phase eine Ebenenverschiebung hin zu den wichtigen Beziehungsfragen, die der Patient testend an den Therapeuten stellt: Wer bist du ? Wie bist du ? Was ist hier anders ? Das Ich des Patienten versucht sich im bewußten Kontaktbereich zu sichern und den Therapeuten auf seine Tragfähigkeit hin zu überprüfen. Dabei lassen sich sehr unterschiedliche Beziehungssituationen charakterisieren; einige Beispiele/Aspekte. Bei Patienten mit stärkeren Selbstwertstörungen, insbesondere auch bei starken Minderwerttigkeitskomplexen dauert diese Erprobungszeit oft länger; sie können die Wertschätzung des Therapeuten - so sie denn vorhanden ist lange nicht glauben und nicht annehmen. Beziehungsangst kann zu einem stetigen Rückzug des Patienten führen, bei dem der Patient nur auf einen Anlass wartet, die Therapie abzubrechen, bevor sie richtig beginnt. Bei Patienten mit einm schwachen Ich und bei Patienten mit schweren Traumatisierungen kann es zu Überflutungen aus dem Unbewußten kommen, sodaß die Gefahr besteht, daß das analytische Gefäß überkocht oder es überfüllt wird und zu zerberechen droht. Wichtig ist hier die richtige Dosierung des Feuers unter dem analytischen Gefäß. 17 Zwanghafte Patienten stellen große Anforderungen an die Geduld des Therapeuten, da sie nur äußerst spärlich sich in die Beziehung hineinbegeben. Verführungen aller Art werden in dieser Zeit inszeniert, um die Festigkeit oder Manipulierbarkeit des Therapeuten zu prüfen. In dieser Testphase werden die sog. Widerstandsphänomene sichtbar und bearbeitbar: flüchtet der Patient oder wendet er sich seinen Konflikten und Komplexen zu? Engt der Patient sich angstvoll ein oder kann er sich im Schutze der tragenden therapeutischen Beziehung öffnen? Welcher Art sind die Abwehrmechanismen ? Dabei ist immer zu beachten, daß Widerstand gegen die Bewußtmachung unbewußter Inhalte meistens nicht nur ein bequeme Abneigung gegen Veränderung ist, sondern eine tiefe Angst den Widerstand bedingt. Die Angst und der dazugehörige Widerstand haben die wichtige Funktion, das meist schwache Ich vor der Bedrohung oder Überwältigung durch unbewußte Inhalte zu schützen. Ein häufiges Widerstandsphänomen ist die einseitige und oft auch gegenseitige Idealisierung von Patient und Therapeut, die dahinterliegende Aggresion oder Neid abwehren soll. Die bewußte Idealisierung wird dabei häufig durch Entwertungen im Unbewußten, z.B. in Träumen, aber auch durch Agieren (z.B. zu spätkommen, nicht abmelden o.ä.) kompensiert. Auf die Schwierigkeiten der Triangulierung habe ich schon hingewiesen. Die Intensivierung der Beziehung zum Therapeuten wird häufig und bei Therapeuten, die selbst schlecht triangulieren können, dadurch erkauft, daß andere Bezugspersonen des Patienten aus dessen Beziehungsgeflecht herausgeworfen werden (Trennung von Partner, Kontaktabbruch mit Eltern o.ä.) In dieser Erprobungsphase pendelt sich auch das Nähe-Distanzverhältnis von Patient und Therapeut ein: 18 Participation mystique Konflikt/Gegensatz K Reifes Beziehungsmodell K 19 Diese flexible analytische Nähe- und Distanzregulierung ist gleichzeitig auch ein Modell der Nähe- und Distanzregulierung zwischen dem IchKomplex/bzw.Bewußtsein und dem Unbewußten. Die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt , zwischen Patient und Therapeut wird zum Modell für die Beziehungen des Subjekts, des Patienten in sich selbst. Dies ist auch eine Voraussetzung dafür, daß der Patient auch nach der Analyse ein solch flexibles , kommunikationsförderndes Modell bewahrt, das ihn befähigt, nach Abschluß der Analyse die Beziehung zu seinem Unbewußten aufrechtzuerhalten und sich weder von den daraus aufsteigenden Inhalten überfluten zu lassen noch in die Situation einer Gegnerschaft oder Isolation dem Unbewußten gegenüber zu geraten. In der analytischen Therapie mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen kann man die Erprobungsphase auch als Empfängnisraum charakterisieren. Nicht selten treten Geburtsbilder, Schwangerschaftssymbolik, Urelemente u.ä. in der symbolischen Traumarbeit auf und vermitteln beiden, Patient wie Analytiker ein Gefühl der Zeugung oder der Empfängnis. Der geistige temenos der Behandlung ist befruchtet. Ich halte es für wichtig, diese Empfängnissituation , wenn nicht unbedingt nötig, nicht zu thematiseren. Das Geheimnis der Schwangerschaft besteht in dem averbalen Kontakt. Nicht selten tauchen Bilder des Ankommens auf, um das Ende der Testphase und das gelingende Vertrauenfassen anzuzeigen. Beispiel: Pat. A. (40.Std.): "Ich steig allein in ein Bergwerk ab, über Leitern und Treppen. Es war sehr dunkel, aber ich hatte keine Angst, obwohl ich nicht richtig sehen konnte. Unten war es hell. Am Fuß des Berges bin ich wieder rausgekommen. Es lag Schnee und war kalt. Dann stieg ich wieder nach oben, den Berg hoch, jemand war mit mir. Oben auf dem Berg war eine Hütte. Ich bin völlig erschöpft in der Hütte angekommen." Schließlich konstellieren sich im Zusammenhang mit der beginnenden Übertragung in dieser Phase die zentralen, negativ dominierten Komplexe des Patienten, die zugleich auch immer das Thema der Aggression in allen seinen Schattierungen mit sich bringt. Denn in der Regel leidet der Patient - sofern es sich nicht um eine narzißtische Störung oder eine Verwöhnungsdepression 20 handelt - unter den negativen, destruktiven Wirkungen persönlicher Mutteroder Vaterkomplexwirkungen. 3. Phase der negativen und/oder positiven Regression Im Schutze der haltenden, gesicherten Patient/Therapeut-Beziehung entwickelt sich - ausgehend von der Belebung der persönlichen Komplexebene (Vater/Mutterkomplex) - die archetypische Dynamik insbesondere der negativen archetypischen Wirkfelder. Die negative Regression ist dabei verbunden mit der Energetisierung der Schattenbereiche des Patienten. BildZ Der Sinn der negativen Regressionsprozesse besteht darin, zu den beschädigten Strukturen vorzudringen, um eine Enantiodromie, d.h. ein Umschlagen von den negativen zu den positiven Elementen des archetypischen Wirkfeldes zu ermöglichen. Entsprechend dem zentralen Polaritätsprinzip ereignet sich in der Regression immer wieder das Hervorbringen der Ganzheit. Daher finden sich in den tiefsten Phasen der Regression auch immer wieder Bilder des Selbst und der Gegensatzvereinigung, die den Auftakt zur Progression und zur Rückkehr aus der Nachtmeerfahrt bilden. Dabei werden die konstellierten und energetisch aufgeladenen positiven Elemente des Archetyps mitgenommen. Anstelle des verschlingenden oder festhaltenden matriarchalen Aspektes zeigen sich nun Andeutungen des gebärenden, freigebenden und wachstumsfördernden Aspekts des Mutterarchetyps. An Stelle des kastrierend und destruktiv Übermächtigen des negativen Vater-Archetyps entwickelt sich ein kreativ ordnendes Prinzip. Eine ganz zentrale Rolle in diesem Regressions/Progressionsprozess spielt die transzendente Funktion als Mittel der Selbstregulation der Psyche. Der Analytiker hat in diesem Regressionsprozess eine Reihe von Aufgaben und Haltungen zur Verfügung zu stellen, die in der Praxis nicht leicht zu bewerkstelligen sind: Er muß die Festigkeit des vas hermeticum sicherstellen. Dies ist keine in erster Linie technische Frage, sondern beinhaltet, daß der Therapeut einen guten Ausgang des Unternehmens innerlich spürt, für möglich hält und den Patienten tatsächlich nicht im Stich läßt. Entscheidend ist, ob der Therapeut selbst genügend Erfahrung mit seinen eigenen Abgründen hat. Ein alter Spruch dazu ist, daß der Patient nur soweit kommt, wie der Therapeut selbst gekommen ist. Die Begleitung des Patienten durch den Therapeuten kann sehr verschiedene Formen annehmen. Eine der wichtigsten ist sicherlich die Deutung des unbewußten Materials. Darüber liesse sich vieles sagen, z.B. über das richtige Timing von Deutungen, über den Differenziertheit der Deutung, über 21 die Vollständigkeit von Deutungen usw. Mir besonders wichtig ist, daß der Therapeut die via Gegenübertragung gewonnenen kognitiven und emotionalen Informationen über den Patienten verwendet. Erst durch eine lange Zeit der Erlebens und des Sich-Bewußtmachens der Gegenübertragung ist genügend Einfühlung möglich, die auch eine Deutung erlaubt, die nicht emotionslos vom Therapeuten kommt. Emotionslose Deutungen bewirken m.E. nämlich gar nichts, sondern sind eine intellektuelle Verkürzung. Erst wenn die innere Beteiligung des Therapeuten in der Deutung mitschwingt, auch mitschwingen darf, entsteht eine Resonanz im Patienten, die eine Deutung eventuell als evident erleben läßt. Deutungen finden auf verschiedenen Ebenen statt: - Deutung auf der Objekt/Subjektstufe - Prospektive/reduktive Deutung - Übertragungs/Gegenübertragungsdeutung 4. Individuationsphase Zum Schluß unserer Betrachtung des Prozessverlauf von Therapien müßte ich nun auf die Abschlußphase zu sprechen kommen. Offen gesagt - ich weiß nicht, wann eine Analyse beendet ist. Natürlich gibt es klare Fälle, insbesondere dort, wo es um die reduktive Auflösung neurotischer Stockungen, die durch negative Elternkomplexe bedingt waren, ging und der Patient von sich aus klar sagen kann: Ich gehe jetzt alleine weiter. Bei Patienten der ersten Lebenshälfte geht es ja oft darum, daß diese Menschen beruflich und privat ihren Platz in der Gesellschaft finden. Unter dem Aspekt der zunehemenden Medizinalisierung des therapeutischen Geschehens und der sog. therapeutischen Professionalisierung spielt die Frage der Effektivität und damit auch das Entwickeln von Normen und Kriterien einer sog. gesunden Entwicklung eine wichtige Rolle. Wir kommen hier in die Wertediskussion, in der Psychotherapie in einem gesellschaftlichen Umfeld stattfindet und sich danach richten kann oder auch nicht. Anders ausgedrückt: möglicherweise stehen wir vor einer kulurellen Zwiespaltung. Auf der einen Seite könnte erfolgreiche Therapie darin bestehen, dem Patienten zu einer ichstarken, "männlichen" Persönlichkeitsentwicklung zu verhelfen, die ihm Realitätsbewältigung und freundliche Objektbeziehungen ermöglichen. Auf der anderen Seite - und auf dieser Seite befinden sich wohl die meisten Jungianer - könnte es um die Fähigkeiten des Patienten gehen, mit seinen inneren Teilpersönlichkeit im Dialog zu sein, prinzipiell offen zu sein für die Impulse aus dem Unbewußten. Ziel ist die innere Lebendigkeit, der intrapsychische Reichtum, der u.U. aber die für die Alltagsroutine notwendige Stabilität vermissen läßt. 22 Beispiele: 64j.Pat.(nach der Analyse): "Ich stehe auf einem Felsvorsprung in gebirgiger Landschaft. Vor mir ist ein dunkler Wald mit großen Bäumen. Plötzlich fängt der Wald an, sich zu bewegen. Ich bekomme Angst, Panik, laufe vor dem Wald hin und her, nicht wissend, wie ich ausweichen kann. Da taucht zwischen den Bäumen ein alter Mann auf, mit einem Schlapphut und einem langen Ledermantel bekleidet. Erst habe ich Angst vor diesem Mann. Er macht mir Zeichen, ähnlich der Zeichensprache für Gehörlose, nurnicht so abrupt, sondern sehr geschmeidig und weich bewegt er seine Hände. Allmählich verstehe ich, daß er mir den Weg zeigt, den ich durch den Wald gehen soll. Er ist relativ weit etnfernt von mir, ich achte auf seine Zeichen, gehe zwischen den Bäumen durch, immer wieder nach ihm Ausschau haltend und seinen Zeichen folgend. Da stehe ich auf einer großen Lichtung, de ganz viereckig ist. Das Viereck besteht aus einem großen Himbeerfeld, überall sind Himbeersträuche. Und zwischen den Himbeersträuchern sind viele Frauen, die in langen, weiten farbenfrohen Kleidern und mit großen bunten Hüten bedeckt Himbeeren pflücken. Ich beuge mich zu einem Himbeerstrauch und zögere, ob ich auch pflücken darf. In diesem Zögern wache ich auf." 23 47.j.Pat.(nach der Analyse): "Ich wandere mit einigen Menschen durch einen Kastanienwald. Ich merke auf einmal, daß ich vom Weg abgekommen und nicht mehr bei der Gruppe bin. Ich gehe aber weiter. Da stehe ich plötzlich mitten im Wald vor einem riesigen Gebäude, sehr hoch und ohne Fenster, eine Art Turm. Ich gehe hinein. Drinnen bin ich in einem großen Raum. In der Mitte steht ein Dreifuß, daran befindet sich eine Kette, an der aber nichts dranhängt. Dann sehe ich eine kleine Schachtel. Ich mache sie auf und finde eine Kugel. Ich hänge die Kugel an die Kette des Dreifußes und denke, jetzt müßte doch etwas passieren, der Raum müßte sich doch irgendwie verändern. Aber nichts geschieht. Ich berühre mit der Spitze meines Zeigefinger die Kugel da strömt an dieser Berührungsstelle ein ungemein warmes gelbes und rotes Licht aus der Kugel. Und überall , wo ich die Kugel mit der Fingerspitze berühre, kommt dieses wunderbare Licht und durchflutet den Raum." 24