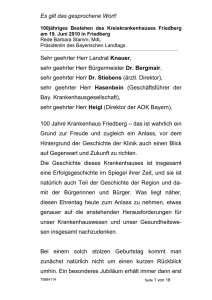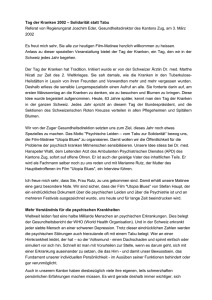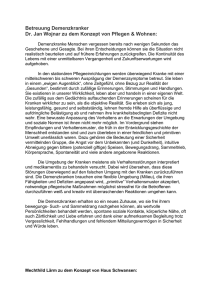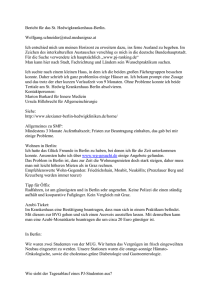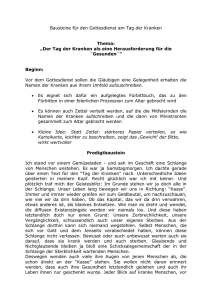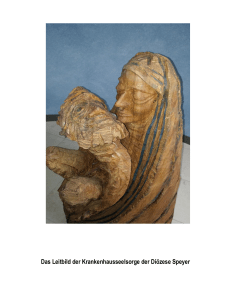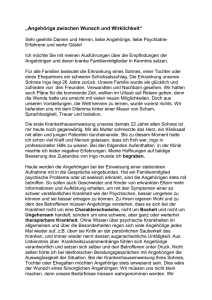„Ich war krank, und ihr habt mich besucht“ – Erwartungen eines
Werbung
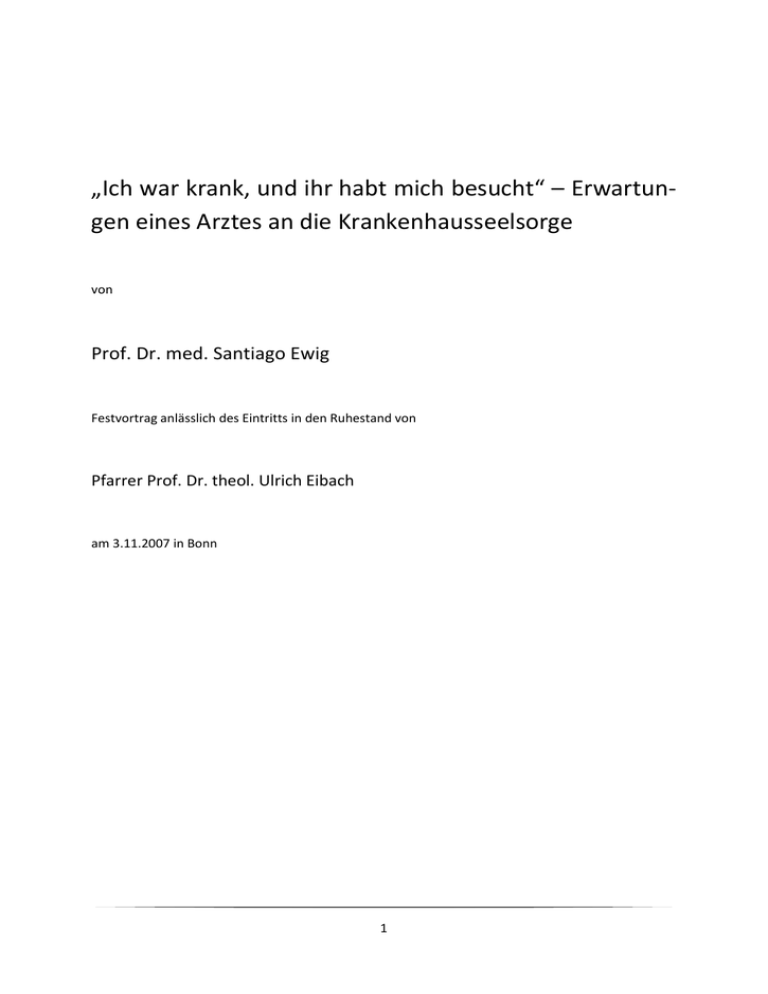
„Ich war krank, und ihr habt mich besucht“ – Erwartungen eines Arztes an die Krankenhausseelsorge von Prof. Dr. med. Santiago Ewig Festvortrag anlässlich des Eintritts in den Ruhestand von Pfarrer Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach am 3.11.2007 in Bonn 1 Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrter Herr Superintendent Wüster, sehr geehrter, lieber Herr Eibach, die Worte Jesu aus dem Evangelium, die das Leitwort meines Vortrags bilden, gehören zu denen, die mich, solange ich denken kann, immer schon sehr berührt haben. Sie sind Antwort auf eine unserer „frequently asked questions“, FAQ, der häufig gestellten Fragen, in einer für uns so typischen Mischung aus Schüchternheit und in Arglosigkeit verstecktem Schuldbewusstsein. Wo, lieber Herr Jesus Christus, wo finden wir Dich denn, wenn wir uns schon aufmachen sollen, Dich zu suchen ? Und die Antwort ist Originalton Jesus Christus: einfach verständlich, eindeutig, richtunggebend, dabei gleichzeitig richtend und aufrichtend. Wir wussten die Antwort auf unsere Frage eigentlich schon selbst, haben sie aber durch Trägheit und Eigensinn, die sich hinter Reflexion und Zweifel versteckt, unkenntlich gemacht. Die Antwort lautet noch einmal in aller Deutlichkeit: Jesus erwartet, dass wir sein Gesicht bei den Kranken wahrnehmen, mit denen er sich identifiziert. Ich war krank – mit und in allen Kranken; und ihr sollt mich – alle Kranken, die in eurer Nähe sind, besuchen. Herr Pfarrer Eibach, der als Seelsorger an den Universitätskliniken Bonn nun in den Ruhestand tritt, hat dies über viele Jahre, wie ich weiß, mit großer Hingabe und Liebe getan. Ich bin gewiss, dass er den meisten Kranken eine Hilfe, vielen ein Trost, einigen auch ein Begleiter auf dem Weg zum Innersten ihres Lebens geworden ist. Und wir wissen nicht, wie viele ihn als Bote Christi wahrgenommen haben, wie vielen er den wieder erfahrbar gemacht hat, der auch in unserem Land zunehmend ein Unbekannter zu werden droht. Nun hat Herr Pfarrer Eibach in den letzten Jahren jedoch, wie viele andere Seelsorger auch, erfahren müssen, dass im Krankenhaus „Kranke besuchen“ vor besondere und neue Herausforderungen stellt. In den letzten zwei Jahrzehnten und zuletzt in immer höherem Tempo vollzieht sich vor unseren Augen ein fundamentaler Wandel des Gesundheitswesens, der alle Aspekte der Beziehungen der Kranken zu ihren Versorgern, also auch zu ihren Seelsorgern, im Kern berührt. Die Rede ist vom struk- 2 turellen Wandel des Gesundheitswesens von einer Dienstleistung des Sozialstaates zu einer marktförmig organisierten Wachstumsbranche. Krankenhäuser und Praxen verstehen sich jetzt als Unternehmen, Pharma- und Geräteindustrie als Anbieter innovativer Technologien, Universitäten als auf sich selbst verwiesene Transmissionsriemen zur immer schnelleren Implementierung technischer Fortschritte. Der Patient ist zum Kunden umdefiniert worden, der Ansprüche stellt, die in industrieförmiger Organisation zu erfüllen sind und um die konkurriert wird. Und über allem liegen die Verheißungen der zunehmenden Abschaffung von Krankheit und Leid durch technischen Fortschritt. Über allem aber liegt auch der Verzicht der Medizin auf einen Begriff von Krankheit, der mehr ist als die molekulare Entschlüsselung körperlicher Fehlfunktionen. Schauen wir näher hin. Was bedeuten diese Entwicklungen für einen Patienten im Krankenhaus heute konkret ? Wenn ein Patient heute zur Aufnahme kommt, muss sein Zustand festgelegte Kriterien erfüllen, die eine stationäre Aufnahme rechtfertigen. Sind diese erfüllt, wird ihm eine Ziffer aus der „diagnosis related group“ (DRG) zugeordnet. Diese Ziffer beinhaltet eine untere und obere Grenzverweildauer sowie ein Entgelt, das innerhalb dieser Extreme erzielt werden kann. Ausdrücklich soll während des stationären Aufenthalts lediglich der Zielauftrag, der sich aus der Hauptdiagnose ergibt, ausgeführt werden; entsprechend wäre eine Aufmerksamkeit für andere Probleme, die nicht zu einer Erhöhung der DRG-Ziffer führen, ökonomisch nicht rentabel. Die Tendenz ist klar: der Aufenthalt soll so kurz und so gezielt wie möglich sein. Immer stärker auch wird der Druck, medizinische Leistungen ambulant zu erbringen. Wir stehen in einer Entwicklung, an deren Ende im Krankenhaus nur noch Akutkranke auf der einen und Alte, Pflegebedürftige und Sterbende auf der anderen Seite stehen werden. Man muss es deutlich aussprechen: alle sozialen Konnotationen, die das Krankenhaus bisher immer auch gehabt hat, sind ausdrücklich nicht mehr erwünscht. Das Krankenhaus in seiner Eigenschaft als Herberge ist Vergangenheit. Der Zwang zur kurzen Verweildauer zwingt zur Optimierung der Behandlungsabläufe im Sinne einer industriellen Organisation. Die Stichworte lauten Standardisierung, Behandlungspfade, workflow-Optimierung, Qualitätskontrolle und Risikomanagement. Der Patient durchläuft den Technologiepark und erhält eine hochentwickelte 3 technische Therapie. Zweifelsohne kommt der Patient im Krankenhaus heute in der Regel in den Genuss außerordentlich guter Hotelleistungen und erfährt auch die Annehmlichkeiten professioneller Freundlichkeit aller Bediensteten. Andererseits verkümmern gleichzeitig auf der ärztlichen Seite kommunikative und medizinische Basiskompetenzen wie Anamnesegespräch, einfache klinische Untersuchung und klinische Urteilskraft sowie auf der pflegerischen Seite Möglichkeiten individueller Zuwendung. Die industrieförmige Aufstellung der Krankenhäuser kann durchaus vielen Patienten zugute kommen – und zwar all denen, die eine klar definierbare und technisch gut beherrschbare Erkrankung haben. Beispiele sind akute Herzinfarkte, akute Lungenentzündungen, die Herz- und Thoraxchirurgie, Gelenkersatz usw. Solange die vordefinierten Behandlungsabläufe mit Erfolg durchlaufen werden können, profitiert der Patient von ihrer Effizienz. Ganz unbestreitbar handelt es sich insofern auch um ein medizinisches und ökonomisches Erfolgsmodell. Der Apparat gerät aber überall dort ins Stocken, wo technische Leistungen nicht mehr ohne weiteres oder jedenfalls nicht mehr allein eine angemessene Antwort darstellen. Überall, wo ein therapeutisches Verhältnis von Arzt und Patient zum Tragen kommen sollte, wo kommunikative Leistungen vonnöten sind, wo soziale Netze gesponnen werden müssten – überall dort droht sich im Krankenhaus heute ein großes Defizit aufzutun. Der Verweis auf ambulante Strukturen hilft nicht weiter – es gibt sie praktisch nicht. Aktuell jedenfalls steht keine medizinische Versorgungsstruktur im ambulanten Bereich zur Verfügung, die die im Krankenhaus aufgebrochenen Defizite auszufüllen vermöchte. Ein Patient, der in die bezeichneten Leerstellen heutiger Krankenhäuser fällt, ist in einer äußerst schwierigen Lage. Er sieht sich in seiner Not verwiesen auf seine Autonomie. Die zunehmend politisch und juristisch betriebene Zuschreibung der Autonomie an den Patienten fügt sich ein in die Zuschreibung seiner Kundenrolle: er zahlt, also soll er auch auswählen und entscheiden. Ohnehin kann eine Medizin, die jeden Anspruch auf einen geistigen Begriff von Krankheit aufgegeben hat, den Patienten immer weniger individuell beraten, wie er mit seiner Krankheit umgehen soll, welche Behandlung also für ihn die beste ist. Im Ergebnis bleibt dem Patienten oft nur die Wahl, sich an die Möglichkeiten der Technologie zu klammern oder aber in die Paramedizin auszuweichen. Manche Patienten, vor allem Tumorpatienten, tun 4 beides zugleich. Auf diese Weise erhält so mancher Patient technische Antworten auf kommunikative Bedürfnisse. Wer diese Ausführungen für abwegig hält, den möchte ich bitten, einige Fragen nachzuvollziehen, die sich für die Behandlung etwa von Tumorpatienten ergeben. Wer führt mit dem Patienten ein Aufklärungsgespräch, das zugleich aufrichtig ist und Einladung zu einer therapeutischen Beziehung, zu einem fortdauernden Gespräch ? Wer ist in der Lage, aus dem glitzernden Angebot der onkologischen Therapie dasjenige auszusuchen, das tatsächlich das Beste für diesen Patienten ist ? Wer führt ihn in seiner Achterbahn aus Ängsten und Hoffnungen? Wer kann den Patienten beraten, ob sogenannte Zweit- oder Drittlinien-Therapien für ihn lohnend sind? Wer steht bei ihm, wenn es nicht mehr um Therapien geht, sondern um die Annahme des Lebensendes? Wer steht bei ihm, wenn er stirbt? Antworten auf diese Fragen werden immer schwieriger, weil die im stationären und ambulanten Sektor gleichermaßen industriell aufgestellten Strukturen es immer weniger erlauben, diese Fragen wahrzunehmen und auf sie einzugehen. Kann die Krankenhausseelsorge, kann ein Krankenhausseelsorger diese Lücken ausfüllen? Eines kann er ganz sicher: er kann versuchen, den Kranken zuzuhören, ihre Fragen wahrzunehmen, und er kann versuchen, ihnen bei der Stellung solcher Fragen zu helfen. Allein diese Hilfe, die richtigen Fragen zu finden, sich aus den Sackgassen einseitig technischer Antworten zu befreien, kann ein Segen für die Kranken sein. Es ist keineswegs mehr selbstverständlich, dass ein Kranker in seiner häuslichen Umgebung noch auf andere Seelsorger treffen wird, wenn er sich nicht selbst zu ihnen aufmacht. Einen Kranken zu besuchen, kann heute heißen, für diesen buchstäblich eine andere Welt zu errichten, in der die Frage nach dem Befinden gleichzeitig das Angebot eines wie auch immer kurzen Stücks Wegbegleitung bedeutet. Die Frage an mich, an meinen Vortrag lautete allerdings nicht: „Wie kann ein Seelsorger für einen Kranken heilsam wirken?“ (dies wissen diese selbst und Herr Pfarrer Eibach sicher viel besser als ich), sondern vielmehr „Erwartungen eines Arztes an die Krankenhausseelsorge“. Tatsächlich habe ich als Arzt Erwartungen an die Krankenhausseelsorge, und ich bekenne, dass diese maßgeblich durch meine Freundschaft 5 zu Pfarrer Eibach geprägt wurden. Meine Erwartungen sind im wesentlichen Erfahrungen, also bereits gelebte Realität, und von dieser möchte ich noch kurz reden. Herr Pfarrer Eibach hat den von mir bezeichneten Wandel im Gesundheitswesen sehr deutlich gespürt und ist ihm beharrlich gedanklich nachgegangen. Ausgehend von der Grunderfahrung der Bedürftigkeit und Hilflosigkeit schwer kranker Patienten hat er alle wichtigen patientennahen Themen der medizinischen Ethik wie Patientenautonomie und Patientenverfügungen, Sterbebegleitung und Sterbehilfe, ethische Konsile, aber auch die für das Selbstverständnis der Medizin so wichtigen Themen des Umgangs mit vorgeburtlichem Leben umfassend durchdacht und hat entsprechend Stellung genommen. Die Positionen von Herrn Pfarrer Eibach zur PID und embryonalen Stammzellforschung lassen erkennen, welche unschätzbare Bedeutung die Erfahrungen als Seelsorger am Krankenbett für die Schärfung der kritischen Urteilskraft gegenüber abstrakten medizinischen Utopien haben. Martin Heidegger hat bekanntlich ein sehr kritisches Verhältnis zur Ethik gepflegt, weil diese sich nicht aus einer belastbar evidenten Lebenswirklichkeit speise, sondern vielmehr aus ihrer Auflösung. In dieser Perspektive ist Ethik das Symptom der Krankheit, nicht ihre Behandlung. Pfarrer Eibachs Positionen scheinen mir die Möglichkeit von Ethik zu dokumentieren, die Heidegger schon für unmöglich hielt: seine Ethik speist sich aus der Erfahrung der evidenten Lebenswirklichkeit kranker Menschen, freilich auf dem Hintergrund seines höchst präsenten christlichen Glaubens. Weil sie aus praktischer Erfahrung stammt, ist sie frei von jeder Ideologie. Seine Positionen heben sich somit wohltuend von so mancher akademischer Medizinethik ab, die sich als Begleiterin und Kommentatorin des technologischen Fortschritts genügt. Wir Ärzte, die wir nicht auf eine humane, geistig definierte Medizin verzichten wollen, brauchen Bündnispartner auf allen Ebenen. Krankenhausseelsorger sind unsere ersten Verbündeten darin, dass sie uns Ärzten aus ihrer Erfahrung am Krankenbett die richtigen Fragen stellen. Dies betrifft sowohl den medizinischen Alltag als auch unsere Positionierung innerhalb des Krankenhauses. Im Alltag bauen wir darauf, dass uns die Krankenhausseelsorge dabei hilft, die nicht einfache Aufgabe der Aufrechterhaltung einer therapeutischen Beziehung zum Patienten unter Wahrung der höchsten technischen Kompetenz zu erfüllen. Hinsichtlich unserer Positionierung hoffen wir, dass wir durch das Gespräch mit den Krankenhausseelsorgern einen geschärften 6 Blick für die strukturellen Hindernisse, dadurch aber auch Freiheitsgrade für die fortgesetzte Bewegung in diesen finden. Im fortgesetzten Gespräch über einzelne Kranke schließlich entwickeln wir die Maßstäbe dafür, dass ärztliches Tun mehr ist als das immer schnellere Abarbeiten von Standards. Auch wenn es für die medizinischen Fakultäten beschämend ist, müssen wir darüber hinaus deutlich aussprechen, dass ein nicht kleiner Teil unserer Hoffnung auf zukünftige Ärzte, die mehr sein wollen als Techniker, in den Händen der Krankenhausseelsorge liegt. Da in den Universitäten kaum mehr das Wesen des Ärztlichen zur Sprache kommt, kritische Reflexion, die diesen Namen verdient, kaum noch gepflegt wird, kann dies allenfalls noch in den klinischen Ausbildungsstätten, d.h. über die Universitätskliniken hinaus in den Lehrkrankenhäusern geschehen. Hier ist die Aktivität der Krankenhausseelsorge besonders gefragt, und hier wollen wir zuvorderst zusammenarbeiten. Kehren wir zurück zu den Erwartungen Jesu. Seine Aussage „Ich war krank“ bekommt durch die eben gemachten Ausführungen noch eine besondere Bedeutung. Jesus ist auch heute „krank“, identifiziert sich mit allen aktuell Kranken. Dies bedeutet, dass er wie viele Kranke heute genauso an seiner Situation im Krankenhaus, an den Leerstellen der Kommunikation leidet. Wenn wir ihn besuchen wollen, müssen wir seine Situation kennen. Trotz mancher Segnungen der technischen Medizin gleicht sie in mancher Hinsicht einer Gefangenschaft. Die Bemühung des Arztes um eine therapeutische Beziehung trifft sich mit der des Krankenhausseelsorgers: es geht um die Wahrnehmung der Nöte des Patienten. Als christlicher Arzt kann ich von mir sagen, dass ich hoffe, den Kranken, wenn auch auf getrennten Wegen so doch gemeinsam mit dem Krankenhausseelsorger, besuchen zu können und in ihm denjenigen zu erkennen, mit dem Jesus Christus sich stets identifiziert. Ihnen, lieber Herr Eibach, danke ich von Herzen für die gemeinsame Zeit und für die vielen Gespräche und Diskussionen. Ich hoffe und weiß, dass unser Gespräch mit Ihrem Eintritt in den Ruhestand keineswegs beendet ist. 7