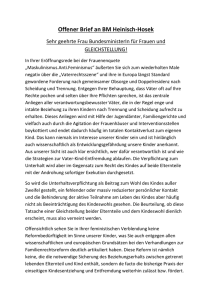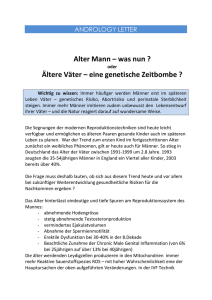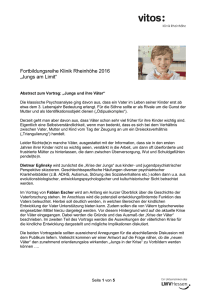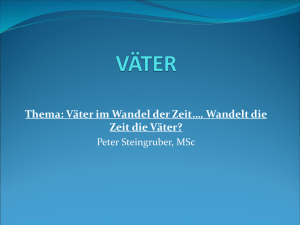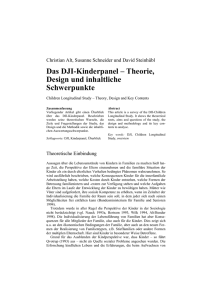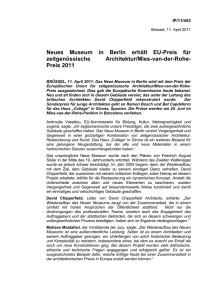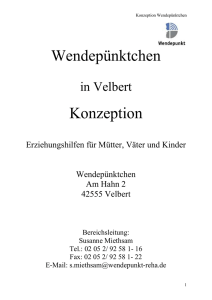Von Respekt, Toleranz und andere Wünschen – die Interviews
Werbung

Von Respekt, Toleranz und anderen Wünschen – alle Interviews Nese Biyiker: „Mit den Augen meiner Tochter die Welt sehen!“ Nese Biyiker: Mein Name ist Nese Biyiker, ich komme aus der Türkei. Mit acht Jahren war ich hier. Meine Eltern sind zuerst gekommen, danach hat mein Vater mich geholt. Ich habe drei Kinder. Meine älteste Tochter ist 27, sie ist geistig und körperlich behindert, meine mittlere ist 21, sie studiert Wirtschaft. Meine kleine Tochter geht in die vierte Klasse, sie ist neun Jahre alt. Viele Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben, erleben Benachteiligungen. Wo erleben Sie Benachteiligungen? Beim Arzt, bei den Ämtern oder wo? Nese Biyiker: Mehr bei den Ämtern und auf der Straße. Wenn ich mit meiner Tochter draußen laufe, dann sieht man mir sofort an, weil ich ein Kopftuch trage, dass ich Ausländerin bin. Und dann mit einem behinderten Kind: „Oh Gott, Ausländerin mit einem behinderten Kind!“. Man sieht dann sofort, was die Leute denken über mich und meine Tochter. Was macht Ihnen zur Zeit am meisten Sorge? Nese Biyiker: Sorgen hat man ganz viele. Ich pflege meine Tochter, soweit es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe und ich weiß auch nicht, wie lange ich gesund lebe. Wenn ich nicht mehr da bin, was ist dann mit meiner Tochter? Das macht mir am meisten Sorgen. Wodurch könnten Sie am besten unterstützt werden, welche Hilfen könnten Sie gebrauchen? Nese Biyiker: Es ist gut, dass es solche Vereine wie InterAktiv, das es solche Anlaufstellen gibt. Ich kann zwar Deutsch, aber es gibt ganz ganz viele pflegende Angehörige, die nicht Deutsch können. Die haben dann Riesenprobleme bei den Ämtern, bei den Ärzten. Wo sie auch hingehen brauchen sie Dolmetscher. Jeder Mensch hat im Leben einen großen Traum. Wenn Sie sich vorstellen, es kommt eine gute Fee, was ist Ihr Traum? Nese Biyiker: Ich würde ganz gerne die Welt mit den Augen meiner Tochter sehen wollen. Einen Tag mal sehen, wieviel sie von der Umwelt mitkriegt, wieviel sie von der Familie mitkriegt. Es kann ja auch sein, dass wir vielleicht etwas machen, was ihr nicht so gefällt. Das würde ich gerne wollen, einen Tag mal die Welt so sehen, wie meine Tochter es sieht. 2 Igor Sanin: „Den Menschen Gutes tun!“ Igor Sanin: Ich heiße Igor Sanin, bin 44 Jahre alt und stamme aus der Ukraine. Menschen mit Behinderungen, die nicht aus Deutschland kommen erleben im Alltag viele Barrieren. Welche Barrieren erleben Sie? Igor Sanin: Bis jetzt habe ich nur Hilfe gefunden. Gibt es keine Schwierigkeiten aufgrund der Tatsache, dass Sie sehbehindert sind? Beim Einkaufen oder beim Busfahren? Igor Sanin: Ich kann das alles nicht selbst machen. Ich brauche immer eine Begleitung. Und was wissen Sie über die Hilfen für behinderte Menschen in Deutschland? Igor Sanin: Es gibt Sprachkurse für Sehbehinderte, es gibt Blindengeld, es gibt finanzielle Hilfen zum Beispiel für den öffentlich Nahverkehr, mehr kenne ich nicht. Welche Unterstützung benötigen Sie? Igor Sanin: Der Sprachkurs ist sehr wichtig und dass ich einen Beruf lernen kann. Die finanzielle Unterstützung ist auch sehr wichtig, damit ich mir spezielle Hilfsmittel kaufen kann. Und was brauchen Sie im Moment am dringendsten? Igor Sanin: Ich muss die Sprache lernen, vielleicht kann ich einen Beruf lernen. Welche Berufe könnten Sie sich vorstellen zu lernen? Igor Sanin: Physiotherapeut. Wenn Sie sich einen ganz großen Traum erfüllen wollen, welcher wäre das? Igor Sanin: Ich möchte eine gute Familie, meine Kinder erziehen und den Menschen Gutes tun. 3 Ayman Mohsen: „Freie Länder, freie Grenzen!“ Ayman Mohsen: Mein Name ist Ayman Mohsen. Ich bin 37 und komme aus dem Libanon, bin aber Palästinenser und lebe jetzt seit 22 Jahren in Deutschland. Könnten Sie uns kurz Ihre Geschichte erzählen, warum Sie nach Deutschland gekommen sind? Was ist passiert? Ayman Mohsen: Ja, es war 1986/87, da herrschte Bürgerkrieg und es gab Luftangriffe der israelischen Armee. Ich komme aus einem Flüchtlingslager im Libanon. Ich wurde angegriffen und daher habe ich meine Behinderung, habe meine Beine und Finger verloren. Vom Roten Kreuz bin ich als einer der Schwerverwundeten aus dem Ort rausgeholt und nach Frankreich gebracht worden zur Weiterbehandlung. Da es für mich keine Lebensperspektive im Libanon gab, wurde ich nach Deutschland gebracht. In Deutschland sind Sie auch zur Schule gegangen. Sie haben in einem Interview einmal berichtet, dass Sie sich den Besuch einer Regelschule gewünscht hatten. Was dies für Vorteile für Sie gehabt? Ayman Mohsen: Das hätte eine ganze Menge Vorteile gehabt, da ich auf einer Behindertenschule war. Die Lehrer haben mir damals auch gesagt, dass du eigentlich gar nicht hierhin gehörst. Aber das Heim, wo ich damals gelebt habe war der Meinung, ich muss erst mal dahin, weil ich mit zwölf, dreizehn nach Deutschland gekommen bin und da konnte ich kein Wort Deutsch. Auf einer Realschule oder so wäre es auch zu schwer gewesen und dann war ich erst mal auf der Körperbehindertenschule. In der siebten, achten Klasse damals hatte ich gute Zeugnisse gehabt. Die Lehrer sagten, eigentlich gehörst du hier nicht rein, du gehörst auf eine andere Schule. Ich weiß nicht, ob da keiner hingehört hat. So habe ich dann die zehnte, elfte Klasse dort abgeschlossen und dann bin ich aus der Schule gegangen. Menschen mit Behinderungen erleben vielfach Barrieren im Alltag. Auf welche Barrieren stoßen Sie? Ayman Mohsen: In erster Linie sind das intolerante Menschen, das ist für mich die erste Barriere überhaupt. Die denken, wenn sie einen Behinderten sehen, in erster Linie an einen Bettler und nicht an einen Menschen vor sich. Ich habe es wirklich oft gehabt: Wenn ich vor einer Barriere stehe und bitte um Hilfe, dann denken die „Will der jetzt betteln?“ und dann gehen sie weiter und beachten mich nicht einmal. Barrieren gibt es aber auch an Orten, wo ich Treppen sehe. Verwandte, die in der zweiten, dritten Etage wohnen ohne Fahrstuhl, wo ich dann nur auf ihren Besuch hoffen und sie nicht selber besuchen kann. Ansonsten bin ich der Meinung, da wo Barrieren sind, habe ich nichts zu suchen. Ich suche mir was Barrierefreies, davon hat man genug inzwischen und da gehe ich dann hin. Behinderung und Herkunft sind zwei Merkmale, aufgrund derer Personen diskriminiert werden können. Haben Sie selber Diskriminierung erlebt? Wenn ja, welche war das? 4 Ayman Mohsen: Ich habe schon sehr oft Diskriminierung erlebt. Manche sehe ich mit einem Lächeln, bei manchen grübele ich tagelang drüber nach, ob ich richtig hier bin oder nicht. Was ich mit einem Lächeln erlebt habe, das ist in einem Supermarkt, wenn ich einen Kunden, der gerade da steht, darum bitte, mir eine Packung Käse von einem oberen Regal zu geben: „Nee, will ich nicht!“ Ich dachte, ok, der hat mich falsch verstanden. Dann wiederhole ich das noch mal und dann sagt er „nee, muss ich das?“ Ich sage dann „nein, musst du nicht, aber es wäre halt Höflichkeit!“ – „Nein, dann bin ich halt unhöflich! Ich will es nicht!“ Ok, danke, dafür habe ich ein müdes Lächeln. Einmal habe ich es auch erlebt, leider im Schnee. Ich bin aus der Wohnung raus und vor meiner Haustür war ein Haufen Schnee. Ich kam nicht mehr vorwärts, ich musste erst eine Rampe runter, aber hoch kam ich nicht mehr, weil die Räder gerutscht haben und da lief einer vorbei und sagte „Ich helf dir!“ Dann hat er es versucht, mich aber in eine schlimmere Lage gebracht als vorher und dann ist er gegangen. Das ist für mich Diskriminierung. Haben Sie auch Diskriminierungen erlebt aufgrund Ihrer Herkunft? Ayman Mohsen: Ja, habe ich auch schon mal, auf jeden Fall. Ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren in Reinickendorf. Vorher habe ich in Spandau gewohnt, da habe ich es nicht so erlebt, es war alles sehr harmonisch von den Leuten her in Spandau. In der Gegend, wo ich in Reinickendorf wohne ist es so, dass ich schon öfters, wenn ich abends auf der Straße war und es dunkel war, die Leute gesagt haben: „Hey, Ausländer und noch Behinderter dazu. Was willst du eigentlich hier?“ Wenn ich alleine bin, dann schweige ich einfach, sage gar nichts dazu. Falls ich sehe, dass derjenige alleine ist, dann stelle ich ihn zur Rede, dann habe ich keine Angst. Aber wenn er in einer Gruppe ist, dann schweige ich lieber. Das ist keine Angst in dem Sinne, aber die Gruppe ist immer stärker und die Hemmschwelle sehr niedrig. Die schlagen dann zu und das wollte ich dann nicht. Welches Merkmal ist Ihrer Meinung nach bestimmender? Ist es das Merkmal Behinderung oder das Merkmal Herkunft? Ayman Mohsen: Das Merkmal Herkunft ist bestimmender. Es kommt auch darauf an, was in den Nachrichten abläuft. Ich habe nach dem 11. September zum Beispiel ganz viel erlebt, wo ich sagen kann, ich habe nichts damit zu tun. Es hat mich genauso betroffen, wie euch alle. Und ich bin der letzte, der solche Gedanken hat. Ich habe damit nichts zu tun, warum greift ihr mich so an? Aber manche Leute haben halt nichts im Kopf. Da werde ich wirklich wegen meiner Herkunft angegriffen. Auch bei Ämtern ist es manchmal so. Die fragen mich „Wo kommen Sie her?“ obwohl ich jetzt deutscher Staatsbürger bin, dann sage ich trotzdem „Ich bin Palästinenser aus dem Libanon.“ Dann sagen die „Also, Sie sind Libanese.“ Dann sage ich „Nein. Ich bin Palästinenser aus dem Libanon.“ – „Ja, können Sie sich denn ausweisen, dass Sie Palästinenser sind?“ – „Nein, kann ich nicht. Ich habe einen deutschen Pass. Ich habe auch einen libanesischen Pass.“ In solchen Momenten fühle ich mich auch diskriminiert, ich vergesse meine Herkunft nicht, obwohl ich Deutscher bin. Das ist nur ein Ausweis, den ich habe. Aber mein Herz schlägt für beide. Ich habe mein halbes, mein dreiviertel Leben in Deutschland verbracht, aber meine Herkunft bleibt meine Herkunft, mein Mutterland, mein Vaterland. Sie sind ja ganz aktiv im sportlichen Bereich. Welche Rolle spielt der Sport in Ihrem Leben? 5 Ayman Mohsen: Der Sport spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Das motiviert mich, mein Leben zu meistern. Das motiviert mich, anderen Menschen ein Ziel zu geben, ihr Leben weiter zu entwickeln und an sich zu glauben und dass ich auch selber weiter an mich glaube. Dass ich meiner Familie Mut gebe, dass es mir gut geht. Denn wenn ich mich hängen lasse, nichts mehr mache, damit schade ich mir selber und meiner Familie. Mit Sport zeige ich mir selber und meiner Familie „Ich habe was drauf, ich kann`s noch! Ich mache weiter.“ Das bedeutet der Sport für mich. Jeder Mensch hat einen großen Wunschtraum, einen Lebenstraum für sein weiteres Leben. Was ist Ihr persönlicher Wunschtraum? Ayman Mohsen: Mein persönlicher Wunschtraum, da habe ich viele. Einer ist, einmal zu erleben, dass es wirklich, es hört sich zwar unsinnig an für manche, für mich nicht, dass ich sehe, dass unsere arabischen Länder so wie in Europa werden. Dass es grenzenfreie Länder gibt, damit ich überall hinreisen könnte, wohin ich möchte, ohne dass ich da angehalten werde, nach meinem Pass oder Ausweis gefragt werde. Mein zweitwichtigster Traum ist, dass ich meine Kinder erwachsen sehe und Enkelkinder sehe. 6 Begümhan Akgün: „Ganz woanders hinziehen!“ Begümhan Akgün: Mein Name ist Begümhan Akgün. Ich bin 18 Jahre alt und wohne in Deutschland, genauer gesagt hier in Berlin. Sie arbeiten in der Mosaik-Werkstatt. Was machen Sie da genau? Begümhan Akgün: Ich bin im Büro tätig. Oben im 2. Stock ist es. Da muss man einen langen Flur entlang laufen, dann kommt man in mein Büro, das ist relativ groß und da habe ich meinen Arbeitsplatz. Da arbeite ich mit meinen Kollegen zusammen, wir sind insgesamt zu acht. Alle sind hörend, ich bin die einzige, die nicht hören kann. Ich bin eben alleine dort, als taube Mitarbeiterin. Und wie ist das für Sie, allein als taube Mitarbeiterin unter Hörenden zu arbeiten? Begümhan Akgün: Also der Chef dort kann Gebärdensprache und mein Kollege auch und weil er es immer mehr übt, geht es besser – ich unterrichte ihn auch ein wenig. Wir sprechen gerade über Gebärdensprache: Viele Menschen, die gehörlos sind, erleben jeden Tag viele Barrieren. Wo erleben Sie die Barrieren? Begümhan Akgün: Also es gibt natürlich oft Leute, die gar nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen, die nicht gebärden können und die sich auch gar keine Mühe geben, mit mir anders zu kommunizieren. Oft versuche ich dann, mit einem Stift und einem Zettel zu kommunizieren und zeige das den Leuten und dann verstehen sie das auch und dann können sie mir auch antworten. Sonst ist es oft sehr schwierig. Also ich muss auch sagen, dass es vor einiger Zeit, vor allem in der Schule so war, dass es bis 2008 die Lehrer vor allem so waren, dass sie nicht gebärden konnten. Sie hatten einfach keine Gebärdensprachkompetenz und ich muss sagen, es war nicht angemessen, dem, was wir eigentlich gebraucht hätten. Viele haben versucht, das relativ schnell zu lernen, aber oft hat es nicht ausgereicht für die Schnelligkeit der Gebärdensprache der Schüler. Das war oft ein großes Problem. Wir mussten auch viel schriftlich kommunizieren und viel dann aufschreiben, weniger mündlich lernen. Wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen, was sind Ihre Hobbies, Ihre Lieblingsbeschäftigung? Begümhan Akgün: Ich mag total gern am Computer arbeiten, das brauche ich zum einen auf der Arbeit, aber ich chatte auch gerne mit anderen tauben Freunden, vielen aus meiner früheren Klasse. Wir setzten einfach die Gespräche, die wir früher in der Pause hatten, per Chat fort. Jeder Mensch hat einen großen Wunsch, einen Traum. Was ist Ihr persönlicher Traum? Begümhan Akgün: Ich bin ja jetzt in Berlin und könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht in 10 Jahren oder so auch mal ganz woanders hinziehe wo es ein bisschen ruhiger ist, wo ich auch alleine wohne. Ich müsste natürlich schauen, wie ich das 7 bezahlen kann und wieviele Zimmer ich mir dann nehmen kann. Vielleicht mal irgendwo ins Ruhigere ziehen. Ich glaube, das ist so ein Wunsch. Veli Filar: „Für 36 Stunden tauschen!“ Veli Filar: Mein Name ist Veli Filar, ich bin 40 Jahre und habe türkische Wurzeln und bin im Frankenland geboren und aufgewachsen. Sie arbeiten hier in der Beratungsstelle der Lebenshilfe. Was ist Ihre Aufgabe? Veli Filar: Ich bin hier als Koordinator in der Beratungsstelle in Neukölln in der Briesestraße eingestellt. Welche Funktion hat die Beratungsstelle? Veli Filar: Das ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die in irgendeiner Situation Hilfe benötigen und wir vermitteln, beziehungsweise begleiten sie zu den richtigen Fachleuten und Fachstellen. Mit welchen Problemen kommen die Leute zur Beratung? Veli Filar: Überwiegend sind es im Moment das Verstehen, beziehungsweise das Beantworten von behördlichen Schreiben. Die sind zum Teil existenzsichernd, wenn es etwa um ALG II geht. Bei diesen Schreiben übersetzen wir zum Teil und wirken auch unterstützend mit bei der Beantwortung. Zum Teil sind das natürlich auch Familien, die gerade für ihre behinderten Kinder nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen. Sie sind selbst Rollstuhlnutzer mit Migrationshintergrund. Ist das ein Vorteil in der Beratung? Wenn ja welcher? Veli Filar: Ich sehe es sowohl als einen Vorteil als auch einen Nachteil, aber was auch gleichzeitig ein Ansporn ist. Der Vorteil ist, dass nach dem Peer-Effekt, also Betroffene beraten Betroffene, mehr Verständnis vorhanden ist. Der Nachteil ist halt auch der selbe Grund. Dadurch, dass ich in dieser Situation bin, wird von vorne herein mehr Verständnis erwartet, die Erwartungshaltung des zu Beratenden ist dann weitaus größer, da man dieses Verständnis für die Situation voraussetzen kann. Der Ansporn ist dann auch gleichzeitig der, dass man genau dieser Erwartungshaltung gerecht werden möchte, damit dann alle mit einem Lächeln aus der Beratungsstelle hinausgehen. Personen mit einer Behinderung erleben vielfach Diskriminierungen und Benachteiligungen im Alltag. Wo erleben Sie Benachteiligung? Veli Filar: Es reicht schon, wenn man vor die Tür geht und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss. Obwohl sich in den letzten 20 Jahren viel im Personennahverkehr zum Positiven verändert hat, gibt es aber dennoch ein sehr großes Verbesserungspotenzial. Das fängt mit den Haltestellen an, die Unzulänglichkeiten der U-Bahn, die nicht funktionierenden Aufzüge oder wenn auch 8 keine Aufzüge vorhanden sind. Wohnraum für behinderte Menschen ist sehr knapp bemessen. Das alles passiert eigentlich relativ oft. Behinderung und Herkunft sind zwei Merkmale, aufgrund derer Personen diskriminiert werden können. Haben Sie selber Diskriminierung erlebt? Wenn ja, welches Merkmal war Ihrer Meinung nach bestimmender? Veli Filar: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Behinderung präsenter ist als die Herkunft, denn sprachlich bin ich bewandert und somit kann ich mich verbal relativ zur Wehr setzen. Jedoch die Behinderung, die damit verbundenen Barrieren, die sind allgegenwärtig und da stößt man dann oft einmal an Grenzen, wo die Mitmenschen, die einen „blinden“ Eindruck machen, obwohl sie sehen können, einem nicht aus dem Wege gehen. Es führt auch dazu, dass es zu Beleidigungen kommen kann. Jeder Mensch hat einen großen Traum, einen Lebenstraum. Was ist Ihr persönlicher Traum? Veli Filar: Für 36 Stunden würde ich behinderte Menschen mit nicht behinderten Menschen tauschen wollen. Damit die Bedürfnisse und die Belange behinderter Menschen gesehen werden und zum anderen auch den Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind auch mal den Traum zu ermöglichen, für 36 Stunden gesund zu sein, mobil zu sein. 9 Seyran Kismir: „Ein Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt!“ Seyran Kismir: Ich heiße Seyran Kismir und bin 21 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus der Türkei, aber ich bin hier in Berlin geboren. Sie arbeiten hier in der BWB: Was machen Sie hier genau? Seyran Kismir: Ich bin in der Abteilung „Digitale Archivierung“. Dort bearbeite ich Bilder auf dem Computer in dem Programm Photoshop. Menschen mit einer Behinderung erleben vielfach Barrieren im Alltag – wo erleben Sie Barrieren? Seyran Kismir: Wenn ich draußen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dass der Aufzug beispielsweise defekt ist. Behinderung und Herkunft sind zwei Merkmale, aufgrund derer Personen diskriminiert werden können. Haben Sie Diskriminierung erlebt? Wenn ja, was war das? Seyran Kismir: Oh ja! In der Oberschule hatte ich einen Klassenlehrer, der mich auf heftiger Weise diskriminiert hat. Welches der beiden Merkmale ist Ihrer Meinung nach das Bedeutendere? Seyran Kismir: Definitiv die Behinderung! Jeder Mensch hat einen großen Wunsch, einen Traum. Was ist Ihr persönlicher Wunschtraum? Seyran Kismir: Dass ich einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft finde, also außerhalb der Werkstatt. Mir gefällt es hier gut, aber ich will mich beweisen. 10 Irene Hagelganz: „Medizin studieren!“ Irene Hagelganz: Ich bin Irene Hagelganz, bin 25 Jahre und seit Oktober verheiratet. Ich komme ursprünglich aus Russland, aus der Republik Tatarstan. Zur Zeit versuche ich, meine Gesundheit wieder in Ordnung zu bringen, sodass ich wieder was machen kann. Sie leben mit einer nicht sichtbaren Behinderung, das macht es oft schwer. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Irene Hagelganz: Ich habe schon viele Probleme damit gehabt. Viele Ärzte kennen sich erstmal damit nicht aus. Die wissen nicht, was Fatigue ist, die wissen nicht, was hormonelle Störungen danach sind, nach einer Chemotherapie und Knochenmarktransplantation. Und da sie mich als normalen Menschen ansehen und wenn ich zu denen komme mit meinen Problemen und brauche eigentlich Hilfe, geben sie mir einen Krankenschein und sagen, dass ich trinken und gesund essen muss, was ich eigentlich permanent mache. Das reicht mir nicht, denn ich komme dahin, um Hilfe zu holen, um Rat zu erhalten. Ich hätte schon gerne gehabt, dass sie sich damit ausgekannt hätten. Es ist schon schwierig. Man muss schon Ärzte suchen, die sich damit auskennen. Das Problem ist auch, viele sagen eine Sache, die nicht wirklich stimmt: Ich kann zwar keine Kinder kriegen und das ist mir auch bewusst, aber ich komme zum Arzt und der sagt mir permanent „Nein, du kriegst keine Kinder. Du hast einen Eizellenwert von 0,05. Das ist das Gleiche, als wenn ich einem Blinden sage, du wirst sehen.“ Da habe ich den Kinderwunsch aufgegeben. Aber mein Mann sagt „Nein, wir gehen noch einmal in ein großes Krankenhaus“, obwohl ich mich schon überall erkundigt habe. Doch jetzt waren wir in einem Krankenhaus und mir wurde gesagt „Ja, es gibt Möglichkeiten.“ Das gilt auch für andere Menschen, die die gleichen Probleme haben: man muss einfach kämpfen, egal was einem gesagt wird. Wege gibt es immer, auch wenn es schwierig ist. Welche Unterstützung würden Sie sich denn von ÄrztInnen oder anderem medizinischen Personal wünschen? Irene Hagelganz: Erst einmal, dass sie sich damit auskennen. Und dass sie mich nicht als schwerbehindert anerkennen aber verstehen, dass ich wirklich krank bin und mich nicht als ganz gesunden Menschen betrachten. Ich habe hormonelle Störungen und ohne Hormone kann ich nicht leben. Wenn ich den Ärzten sage, ich habe Menopause, die lachen mich aus: „Sie sind 25, das kann nicht sein!“ Ich bin wie eine ältere Frau. Wenn ich meine Hormone absetze, werde ich älter, mein Gedächtnis lässt nach, ich habe Knochenschmerzen und alles, was ältere Frauen haben. Stimmungsschwankungen habe ich auch so, da können auch nicht mehr Hormone helfen oder dass es mir kalt und warm wird. Dass ich jetzt so normal hier sitze und so aussehe, wird von Hormonen unterstützt. Sie haben mir auch erzählt, dass Sie Probleme an der Schule hatten, mit Ihrem Lehrer. Irene Hagelganz: In der Schule wurde es auch nicht gesehen, dass ich Krankheiten habe. Ich wollte unbedingt Abitur machen. Es war so, dass ich zwei Jahre durch meine Krankheit verloren habe. Ich musste schnell meine Abschlüsse nachmachen. 11 Ich habe dann meinen mittleren Abschluss gemacht und wollte weiter mein Abitur machen. Damit konnte ich nicht aber anfangen, da ich zunächst irgend etwas benötigte, an das ich mich halten kann, einen Beruf, damit ich schon etwas habe. Ich habe Kosmetikerin gelernt und Sicherheitsfachkraft und dann angefangen mit dem Abitur. Aber wenn ich dann gesundheitliche Probleme hatte, haben die Lehrer mir einfach nicht geglaubt. Sie dachten, dass ich eine Simulantin bin. Wenn da ein drogenabhängiges Mädchen sitzt und es wird ihr schlecht, sagen sie „Geh nach Hause!“ Das ist alles ok, aber bei mir nicht. Ich hatte Geburtstag und ich wollte zur Schule gehen. Ich habe diese Schule geliebt, das war mir das Wichtigste überhaupt. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich war mir sicher, dass ich zur Schule gehen wollte, ich wurde aber krank, da konnte ich nichts mehr machen, so traurig wie das war. Und den Kuchen konnte ich nicht alleine aufessen. Ich ging dann zu meinem Professor und der sagte „Chemie liegt Ihnen wohl nicht!“. Es hat aber nichts damit zu tun, ob mir Chemie liegt oder nicht. Ich komme zur Schule, um zu lernen. Dann gab es eine Situation, in der ich zum Gericht musste und er sagte: „Nein, Sie gehen nirgendwo hin. Entweder Sie gehen in die Klasse oder das war`s mit der Schule!“ Ich konnte mein Leben nicht aufs Spiel setzen, denn Gericht ist Gericht. Ich habe alle meine Kräfte für das Abitur ausgegeben. Es ist aber auch so, dass ich nicht so ein Gedächtnis wie die anderen Kinder habe, die auch schneller lernen. Sie haben auch Eltern, die sie unterstützen und das einzige was sie machen müssen, ist lernen. Sie schaffen es sogar, Fernsehen zu gucken und ich dachte whow, wie schaffen die das? Ich habe im Leben noch viel außerhalb zu erledigen. Ich habe wirklich jede freie Minute gelernt, ich habe mich wirklich fertig gemacht. Und jetzt habe ich keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, ob es in der Zeit kaputt ging oder ob es mit meiner Krankheit zu tun hat. Ich war jetzt in einem Krankenhaus, in dem Fatigue behandelt wird, das ist bei mir eine Art der Erschöpfung, die man nach Krebs hat. Haben Sie denn auch Benachteiligungen aufgrund Ihrer Herkunft erlebt? Irene Hagelganz: So grundsätzlich vielleicht nicht. Meine Sprache ist schon ok. Ich mache da vielleicht Fehler, aber auch Deutsche machen oft Fehler. Ich kann gut schreiben ohne Fehler, was manche Deutsche auch nicht gut können. Mir kann keiner sagen, dass ich Deutsch nicht beherrsche. Ich habe mich immer bemüht und ich bemühe mich weiter. Die Sache ist die, Diskriminierung erlebe ich schon, wenn ich meine Meinung offen sage, das gefällt denen oft nicht. Ich weiß nicht, ob das Diskriminierung ist. Es gab schon Fälle, aber ich kann mich jetzt nicht richtig daran erinnern. Alles, was negativ passiert ist, versuche ich zu verdrängen Jeder Mensch hat einen großen Wunschtraum, einen Lebenstraum. Was ist Ihr Lebenstraum? Irene Hagelganz: Ich möchte Medizin studieren. Und dafür brauche ich mein Abitur und dann will ich Medizin studieren. 12 Mohammed Nasser: „Mehr Toleranz und Akzeptanz!“ Mohammed Nasser: Ich heiße Mohammed Nasser, bin gebürtiger Palästinenser, seit 1976 in Berlin-Neukölln groß geworden und lebe immer noch in Neukölln. Mittlerweile bin ich 43 Jahre alt und habe drei süße Mäuse. Momentan arbeite ich im Nachbarschaftsheim in einem Projekt, in dem wir Eltern mit kranken Kindern und Vereine in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement unterstützen. Ihre Tochter Houda lebt mit einen Behinderung. Was bedeutet das genau für Sie als Vater, der sich um seine Tochter intensiv kümmert? Mohammed Nasser: Es war für uns kein Problem, dass wir ein behindertes Kind bekommen haben. Es ist eher die Sorge und die Angst, die das mit sich bringt und viel Kraft und Mühe kostet. Man will ja auch allen drei Kindern gerecht werden. Den Alltag zu meistern ist eine einzige große Hürde, denn seit Houda bei uns ist, hat sich schlagartig alles verändert. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Kleinigkeiten, die für andere Familien nicht von Bedeutung sind, sind für uns mit großem Aufwand verbunden. Auch in Deutschland ist es nicht normal, wenn sich die Väter um ihr behindertes Kind kümmern. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Mohammed Nasser: Ich habe das Glück, dass ich aus einer Großfamilie stamme, in der mein Vater uns auch sehr viel Liebe und Zuneigung geschenkt hat, uns viele Werte beigebracht hat. Ich habe bis 30 gewartet, bis ich selber erwachsen war, um zu heiraten, da ich selber gerne Kinder haben wollte. Für mich war es vom ersten Tag an selbstverständlich, dass ich für meine Kinder da bin. Vater sein heißt, Kinder erziehen, was viele Väter leider auch mittlerweile vergessen haben. Die denken, ich mache das Kind und dann macht es die Mama weiter. Schon bevor wir Houda bekamen, habe ich versucht, andere Väter zu sensibilisieren, sich in die Erziehung ihrer Kinder mit einzubringen, in der Kita, in der Grundschule. Meine Erfahrung war, dass ich immer nur Frauen gesehen habe. Für manchen scheint es natürlich zu sein, dass die Mama über 80 Prozent übernehmen muss. Ich wollte das von Anfang an nicht. Deshalb habe ich angefangen, mich zu engagieren: Väter zu finden, die in der gleichen Situation sind wie ich, mit behinderten Kindern. In Krankenhäusern habe ich versucht, die Frauen anzusprechen, warum ihre Männer nicht dabei sind oder warum sie nicht einmal den Mann schickt. Das was nach der Geburt kommt, das bedeutet Vater zu sein. Sie haben den Verein Huda e.V. gegründet: Welche Aufgaben hat sich der Verein gestellt? Mohammed Nasser: Unser Ziel ist Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Respekt und Toleranz für Väter mit behinderten Kindern. Ich habe das durch meine eigene Erfahrung erlebt, dass migrantische Väter schon ohnehin ein Problem haben. Schwierigkeiten ganz anders als ein europäischer oder deutscher Papa in der Gesellschaft. Mit einem behinderten Kind werden die Probleme doppelt so schwer. Sie sind manchmal doppelt isoliert. 13 Erst war Huda e.V. ein Ein-Mann-Projekt. Ich habe alleine an tausend Türen geklopft, die sich nie geöffnet haben. Mittlerweile ist so, dass es viele Väter bei uns gibt, auch die, deren Kinder keine Behinderung haben. Wir arbeiten für die Inklusion, von der die anderen meistens reden. Wir tun`s einfach, dass Väter mit gesunden Kindern und schwerbehinderten Kindern zusammen etwas unternehmen. Es ist unser Ziel, dass diese Väter nicht aus der sozialen Struktur fallen, weil sie sich etwa einsperren zu Hause oder nicht mit anderen Menschen kommunizieren. Mir ist es bei mir selbst aufgefallen, dass ich eine ganz andere Kommunikationsebene habe. Wenn ich mit einem Vater rede, der selber ein behindertes Kind hat, dann stößt man auf ganz anderes Verständnis. Das sind manchmal so Gefühlssachen, dass wenn ich mit jemandem rede, der mich versteht, doch mein Herz auch aufblüht, dass mich endlich jemand versteht und auch weiß wovon ich rede. Das haben wir uns zu Herzen genommen, denn das kann nur einer verstehen, der in der gleichen Situation lebt. Wenn ich einem anderen Papa erzählt habe, ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen, dann denken Väter mit gesunden Kindern „Der übertreibt!“ Doch wenn man selbst die gleichen Situationen durchlebt, dann kann man ganz anders antworten. Mit welchen anderen Fragen kommen die Väter zu Ihnen? Mohammed Nasser: Sehr viele Väter wissen zum Beispiel noch nicht einmal über die Krankheit ihrer Kinder Bescheid. Die wissen nicht, welche Medikamente ihr Kind kriegt, die wissen nicht, welche Möglichkeiten es an Therapien, an Hilfsmöglichkeiten gibt. Wir bieten diese Plattform, wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, da die Väter nicht von alleine kommen. Wenn man helfen will, und das ist nicht böse gemeint, dann muss man die Leute erst einmal an die Hand nehmen. Erst später können die Väter dann eigene Fragen stellen: „Wie kann ich das machen?“ oder „Wie passiert das bei uns?“ Das muss sich entwickeln. Es ist selten, dass jemand mit konkreten Fragen kam. Migrantische Väter haben auch andere Problem und Sorgen: Viele haben mit dem Aufenthalt zu kämpfen, viele haben mit der Hilfsmittelversorgung zu kämpfen. Das ist für sie schon im normalen Alltag sehr schwierig zu bewältigen – mit einem behinderten Kind ist es doppelt so schwer. Wir helfen auch bei Sprachproblemen: Wir haben türkische Väter, arabische Väter, wir können rumänisch weiterhelfen. Es war unser Ziel, dass Huda e.V. interkulturell arbeitet und das nicht nur ein Wort ist, sondern dass wir uns aus verschiedenen ethnischen Herkünften gegenseitig helfen. Jede Kultur und jeder Papa hat ganz andere Sorgen, ganz andere Fragen. Wir versuchen, diese Fragen kultursensibel zu behandeln. Wo sind die Barrieren, die Sie mit Houda persönlich erleben? Mohammed Nasser: Meine Barriere ist einfach da, dass ich nicht die Freiheit habe, mit meinen Kindern viel zu unternehmen, da es durch die schwere Behinderung von Houda so eingeschränkt ist. Wir können zum Beispiel nicht verreisen. Ich bin ein Mensch, der gerne öfters draußen ist, um andere Länder, andere Kulturen kennen zu lernen. Mit einem schwerstbehinderten Kind kann man das nicht so frei machen. Ich habe zu Houda auch eine sehr große Bindung, ich kann sie nicht alleine lassen. Behinderung und Herkunft sind zwei Merkmale, aufgrund derer Personen diskriminiert werden können. Haben Sie selber Diskriminierung erlebt? Wenn ja, welche war das? 14 Mohammed Nasser: Ja, es gibt ja viele verschiedene Varianten von Diskriminierung. Leider ist das Thema Behinderung noch ein großes Tabu. Menschen, die davon offen reden, werden von anderen Menschen, die kein Mitgefühl haben, ich sage bewusst Mitgefühl, nicht Mitleid, es nicht verstehen, dass ein Mensch trotz einer schwierigen Lebenssituation offen darüber reden kann und nicht beschämt ist. Viele Männer haben das Problem, dass ihr Selbstbild als Mann gefährdet ist, wenn sie kranke Kinder haben. Die andere Art von Diskriminierung haben wir in Krankenhäusern durchlebt und durchleben sie immer noch. Seitdem meine Frau das Kopftuch getragen hat, dass sie einfach anders behandelt worden ist, dass sie öfter ignoriert worden ist, und dass wir wirklich zeitweise total auf uns gestellt waren, obwohl wir in einer Klinik waren. Die anderen Diskriminierungen kamen dann von Seiten der Pflegedienste, wenn man Pflegedienste in Anspruch genommen hat, dass sie die Familien in ihrer Not und Sorge und Angst für blöd halten und dementsprechend auch so behandeln. Die geben es nicht zu, aber die behandeln die Menschen, als ob man von nichts eine Ahnung hat. Dann gibt es die anderen Barrieren, dass ich als Mann sofort verurteilt worden bin, weil meine Frau ein Kopftuch getragen hat. Dann hieß es sofort, ich sei dran schuld, dass ich sie dazu gezwungen habe, was nicht der Fall ist. Das sind solche Art Diskriminierungen, die Männer immer wieder durchleben. Ob es bewusst oder unbewusst ist, kann man nicht sagen: der migrantische Mann steht automatisch auf der bösen Seite. Alles, was negativ ist, kommt von seiner Seite. Ich habe das Glück, ich kann gut Deutsch sprechen. Ich kann auch arabisch sprechen, aber in der arabischen Sprache verstehe ich nicht die Ironie. Wenn sich jemand anders in Deutsch neben mir über mich ironisch lustig macht, dass wir Migranten sind, dass man uns an die Hand nehmen muss, dass wir nichts auf die Reihe kriegen, wenn ich das höre in meinem Schmerz und meiner Not, dann verzichte ich gern auf diese Hilfe. Das ist uns nicht nur einmal passiert, das ist uns in den sechs Jahren schon mehrmals passiert, dass bestimmte Helfe bei uns in die Familie hineinkamen. Das waren entweder Leute, die selber gerade einen Verein aufbauten und uns als Familie in dem Sinne missbraucht haben, damit sie uns vorzeigen können. Aber wenn wir nicht so funktioniert haben wie sie das wollten, haben sie uns ganz bösartig fallen gelassen, von einem Tag auf den anderen. Jeder Mensch hat einen großen Wunsch für sein Leben, einen Lebenstraum. Was ist Ihr persönlicher Traum? Mohammed Nasser: Mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass meine Kinder, alle drei, ganz groß und stark werden. Dass meine Maus auch schmerzfreier lebt, das sind natürlich die ersten Wünsche. Natürlich gibt es auch andere Wünsche, aber durch die Krankheit von Houda haben sich die Wünsche mehr auf Gesundheit beschränkt. Dass man gesund bleibt und dass es hoffentlich irgendwann bald mehr Toleranz und Akzeptanz für Familien mit behinderten Kindern gibt. 15 Interviews: H.- Günter Heiden Übersetzung aus dem Russischen: Sven Piesker Gebärdensprachdolmetschung: Laura M. Schwengber Ein Videoprojekt der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL Mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit – BMG © ISL 2013