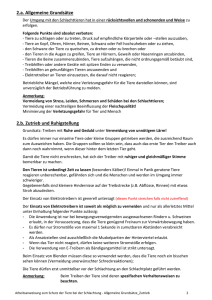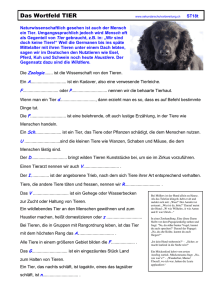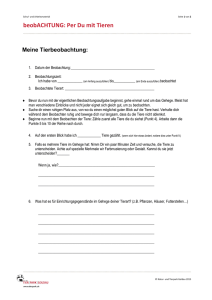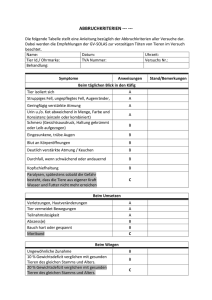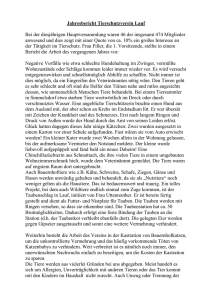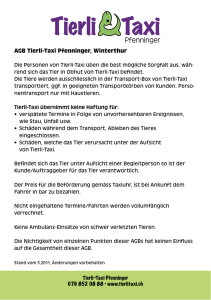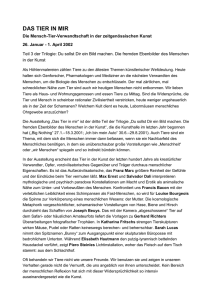können Sie den folgenden Text als Word
Werbung

TIERSCHUTZ UND MENSCHENWÜRDE* (‘979) 1 DASS DIE UNTERSCHEIDUNG zwischen Personen und Sachen keine vollständige Einteilung der Wirklichkeit ist und daß es nicht der »Natur der Sache« entspricht, Tiere unter die Sachen zu rechnen, sagt uns unser Empfinden. Und zwar nicht nur das Empfinden der Empfindsamen. Der Reiter, der sein Pferd beim Rennen schlägt oder ihm nach genommener Hürde den Hals tätschelt, geht davon aus, daß das Pferd in der Weise, wie solche Reize auf es wirken, ihm, dem Reiter selbst, ähnlicher ist als einem Rennauto. Und sogar der sadistische Tierquäler würde nicht tun, was er tut, wenn das Tier eine Sache wäre: Sachen quält man nicht aus Sadismus. Zwar lehrt uns eine bestimmte psychologische Schule, der Behaviorismus, Schmerzen und Wohlbehagen als Mystifikationen zu betrachten; real sei nur das objektiv wahrnehmbare »Schmerz-Verhalten«. Aber diese Theorie wird der Behaviorist spätestens dann vergessen, wenn jemand sich weigert, dessen eigenes Schmerzverhalten als Ausdruck von Schmerz zur Kenntnis zu nehmen. Und wollte er sagen, nur sprachliche Kommunikation könne uns über den Schmerz eines Wesens informieren, so daß wir nur von Menschen wissen können, daß sie leiden, so müßte er nicht nur allen Taubstummen Leiden absprechen, er müßte auch zu der paradoxen Behauptung kommen, daß jener extreme Schmerz, in dem jemand nicht mehr sagt: »Ich habe Schmerzen«, sondern nur noch weint oder schreit, gar kein Leiden mehr sei. Nein, gegen diese These soll man nur deshalb nicht argumentieren, weil es nach einer alten Disputationsregel nicht sinnvoll ist, etwas beweisen zu wollen, was für jedermann offenkundig ist. Zu dem Offenkundigen gehört, daß wenigstens höher entwickelte Tiere sich in Lagen befinden können, die wir sinnvollerweise nur mit Worten wie »Schmerz«, »Leiden«, »Lust« und »Sichwohlfühlen« beschreiben können. Das Gesetz unseres Landes und der meisten zivilisierten Länder erkennt dies übrigens nicht nur an, sondern folgert daraus das Verbot, mit Tieren auf beliebige Weise zu verfahren und ihnen »ohne vernünftigen Grund« Leiden zuzufügen. Lange schon, ehe es einen gesetzlichen Tierschutz gab, zählte man Tierquälerei zu den sittlich verwerflichen Handlungen, die ein anständiger Mensch zu unterlassen, und zu den Sünden, deren ein Christ sich, wenn er sie begangen hat, anzuklagen hatte. Die Begründung hierfür war - unter der Zwangsjacke der Unterscheidung von Personen und Sachen - ebenso tiefsinnig wie inkonsequent: Tierquälerei galt von Augustinus bis Kant deshalb als unsittlich, weil sie den Menschen verroht und ihn auch gegen menschliches Leiden abstumpft. Das ist vermutlich nicht falsch, obgleich hier kein Umkehrschluß erlaubt ist: Die rohesten KZ-Henker konnten mitfühlend zu ihren Hunden sein! Aber warum sollte eine Handlungsweise den Menschen verrohen, wenn sie »an sich« betrachtet nur ein harmloses Vergnügen oder eine sittlich gleichgültige Gedankenlosigkeit wäre? Es handelt sich hier offensichtlich um eine nachträgliche Anpassung der Verurteilung der Tierquälerei durch das sittliche Empfinden an ein vorgefaßtes gedankliches Schema, nach welchem es nur Pflichten gegen Menschen geben kann. Aber schon die Sprache tut hier nicht mit, wenn sie von »Grausamkeit« gegen Tiere spricht. »Grausamkeit« ist ein sittlich verwerfender Ausdruck. Er bezeichnet eine Haltung, die an sich selbst und nicht nur wegen möglicher nachteiliger Nebenfolgen verwerflich ist. Uns faßt eine spontane, durch keinerlei Gedanken vermittelte Abneigung und Empörung gegen jemanden, der ein Tier grausam behandelt. Wenn in Fernsehsendungen gegen Tierversuche solche Grausamkeiten gezeigt werden, so geschieht dies, weil jeder weiß, daß die bloße Sichtbarmachung dessen, was auf diesem Gebiete geschieht, ein wirksames Mittel ist, öffentlichen Unmut dagegen zu mobilisieren (so wie es vermutlich die beste Propaganda gegen Abtreibung wäre, den abgetriebenen Fötus im lebenden Zustand und das, was dann mit ihm geschieht, dem Fernsehpublikum vorzuführen). Es gibt Dinge, die man nur sehen muß, um zu sehen, daß sie nicht sein sollen. Es ist hier nicht der Ort zu zeigen, was es mit diesem unmittelbaren »Sehen« eines Nicht-sein-Sollens auf sich hat, worin es gründet und wie weit es trägt. Zweifellos genügt es nicht für eine endgültige sittliche und rechtliche Urteilsbildung; ohne es hingegen käme eine solche Urteilsbildung gar nicht zustande. Es ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung des sittlichen Urteils. Diese Einsicht könnte übrigens den Streit beenden zwischen jenen, die solche Fernsehsendungen veranstalten, und jenen, die mit Tierhaltung oder Tierversuchen befaßt sind und daher solche Sendungen kritisieren. Das Argument der letzteren lautet etwa so: »Es ist ja unstrittig, daß die grundlose Quälerei von Tieren unsittlich ist. Dort jedoch, wo menschliche Interessen und Bedürfnisse auf dem Spiel stehen und durch bestimmte Tierexperimente oder durch bestimmte für Tiere leidvolle Weisen der Tierhaltung gefördert werden, da gilt, daß menschliche Interessen vor tierischen Bedürfnissen den Vorrang haben; und es ist unfair, die unmittelbaren Gefühle des Publikums gegen bestimmte Praktiken zu mobilisieren, ohne den Preis zu nennen, den wir für die Unterlassung solcher Praktiken zahlen müssten. « Dieses Argument ist schwach. Gehen wir einmal davon aus, bestimmte Tierexperimente seien unter Umständen bei einer verantwortlichen Güterabwägung zu rechtfertigen, so müßten ja wohl, damit eine solche Güterabwägung überhaupt stattfinden kann, die zur Abwägung anstehenden Güter erst einmal zur Kenntnis genommen werden. Es mag ja sein, daß ich von einer schweren Krankheit mit Hilfe einer bestimmten Therapie auch dann geheilt werden möchte, wenn ich den Preis kenne, den viele Tiere dafür zahlen mußten. Jeden Preis werde ich vielleicht auch in diesem Falle nicht akzeptieren. Außerdem bleibt immer noch die Frage, ob die Versuche, alternative Therapien oder eine alternative Erprobung der praktizierten Therapie zu entwickeln, hinreichend intensiv betrieben wurden. Aber drückt es nicht ein schlechtes Gewissen aus, wenn man sich dagegen wehrt, daß der Preis, den wir die Tiere millionenweise entrichten lassen, überhaupt genannt und lebendig vor Augen geführt wird? Fürchtet man nicht eher, die Güterabwägung könne ganz anders fallen, wenn man den Gedanken an den Preis nicht mehr so erfolgreich drängen könnte? Fürchtet man nicht, mancher Raucher würde lieber auf das Rauchen oder aber auf eine weitere minimale Verringerung des Raucherrisikos verzichten, wenn er die Schäferhunde sähe, die mit Tabakrauchmasken elend zugrunde gerichtet werden? Und vielleicht fürchtet man auch, daß manche Dame sich mit den bereits vorhandenen Kosmetika begnügen würde, wenn sie wüßte, was mit Tausenden von Hasen geschieht, um neue Kosmetika auf alle möglichen Risiken zu testen. Wie sollen wir zu einer öffentlichen Güterabwägung kommen, wenn uns zwar die Vorteile, die wir uns mit dem Leiden der Tiere erkaufen, vor Augen gestellt, diese selbst uns aber sorgfältig verborgen werden? Ist die übliche Geheimhaltung auf diesem Gebiet nicht ein Zeichen dafür, daß eine verantwortliche Güterabwägung gerade nicht stattfinden soll? Emotionen ersetzen nicht das sittliche Urteil. Aber ohne eine unmittelbare gefühlsmäßige Wahrnehmung von tierischem Leiden fehlt uns die elementare Wert- und Unwerterfahrung, die jedem sittlichen Urteil vorausgeht. Wir wissen dann gar nicht, worüber wir urteilen. Dies unterscheidet den heutigen Umgang mit Tieren vom archaischen, der, auch wo er grausam war, vor aller Augen stattfand und sich vom Umgang mit Menschen, der auch oft grausam war, nicht fundamental unterschied. Die Perversität der gegenwärtigen Praxis liegt darin, daß wir unsere verfeinerte Sensibilität durch den Umgang mit den Haustieren befriedigen und davon getrennt eine Praxis institutionalisieren, gegen die wir diese Sensibilität abschirmen und in der Tiere einfachhin als »Sachen« behandelt werden. »Ich vermied um jeden Preis, mich denen zu nähern, die umgebracht werde? sollten. Menschliche Beziehungen waren mir sehr wichtig« — sagte der KZ-Kommandant von Treblinka! Das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland schreibt vor, daß Tieren nur »aus vernünftigem Grund« Leiden zugefügt werden dürfen. Das heißt zunächst Leidzufügung gegenüber Tieren ist rechtfertigungsbedürftig. Und zwar ist das schutzwürdige Gut im Tierschutzgesetz nicht das Eigentum des Besitzers sondern das Tier selbst. Der Besitzer des Tieres kann in seinem Recht nur durch eine solche Verletzung des Tieres verletzt werden, die dessen Tauschwert minder oder Kosten verursacht und daher als »Sachbeschädigung« gilt. Der Tierschutz aber gilt dem Tier selbst und schränkt in erster Linie gerade den Besitzer ein. Auch sein Handeln gegenüber dem Tier ist rechtfertigungsbedürftig. Insofern gilt gegenüber dem Tier zunächst das gleiche wie im Falle der Körperverletzung oder der Freiheitsberaubung von Menschen. Auch diese sind unter gewissen Umständen erlaubt, aber nur »aus vernünftigem Grund«, das heißt auch sie sind rechtfertigungsbedürftig. Rechtfertigungsgründe können in diesem Falle sein Rettung der Gesundheit des Verletzten selbst, so im Fall der Operation; Sühn und Schutz der Gemeinschaft - im Fall der Strafe; Notwehr - im Fall eines Überfalls, Selbstbehauptung eines Gemeinwesens im Fall eines Krieges. Es fällt auf, daß als Rechtfertigungs-gründe in diesem Falle nur Gründe in Frage kommen, denen zuzustimmen dem Betroffenen selbst im Prinzip zumutbar ist. Entweder die Schmerzzufügung geschieht ohnehin nur in seinem eigenen Interesse und mit seiner Zustimmung. Oder aber sie trifft ihn als Folge eines verallgemeinerungsfähigen Prinzips, dem er als vernünftiges Wesen zustimmen kann, auch wenn er in diesem besonderen Fall vielleicht die Anwendung dieses Prinzips zu vermeiden wünscht. Mit anderen Worten: Wir dürfen einen Menschen nur Maßnahmen unterwerfen, die seinen Charakter als »Selbstzweck«, das heißt seine Menschenwürde, nicht prinzipiell verneinen. Sind »vernünftige«, also rechtfertigende Gründe im Fall der Leidzufügung gegenüber Tieren von der gleichen Art? Offenbar nicht. Und zwar deshalb nicht, weil der Begriff der Zumutbarkeit mit Bezug auf Tiere keinen Sinn hat. Die Schmerzen eines Tieres können leicht oder schwer sein. Sie können nicht entweder zumutbar oder unzumutbar sein, weil das Tier nicht imstande ist, seine Bedürfnisse mit Bezug auf Prinzipien der Gerechtigkeit und Verallgemeinerungsfähigkeit zu relativieren, und weil es daher nicht vor der Alternative steht, eigenem Leiden zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Jedes Tier steht unaufhebbar im Zentrum seiner eigenen Welt, aus dem es sich nicht zugunsten einer »objektiven« oder »absoluten« Perspektive verrücken läßt: Tiere können nicht »Gott lieben«. Allerdings können sie sich auch nicht selbst zum Gott machen und sich der objektiven Relativierung ihrer subjektiven Zentralität widersetzen. Diese Relativierung geschieht durch die artspezifischen ökologischen Zusammenhänge, in die Tiere durch instinktive Bedürfnisregelungen eingefügt sind und aus denen sie nicht ausbrechen können und wollen. Arbeitsbienen sind bekanntlich »unterentwickelte« und »unterernährte« Königinnen. Aber sie kommen nicht auf den Gedanken, ihre Emanzipation, die den Untergang der Spezies zur Folge hätte, zu treiben. Daß sie nicht darauf kommen, ist nicht die Folge eines sittlichen Imperativs, der ihnen gebietet, die Existenz der Art nicht zu gefährden, sondern es ist die Folge der Tatsache, daß sie sind, wie sie sind. Tiere haben keine »Pflichten«. Daher stehen sie auch mit uns nicht in wechselseitigen Rechtsbeziehungen.