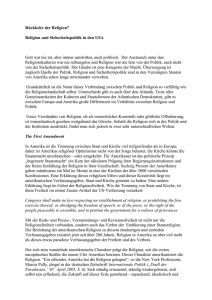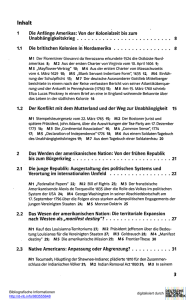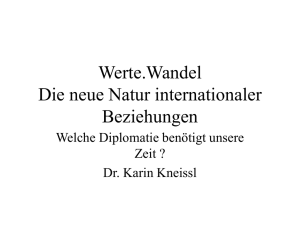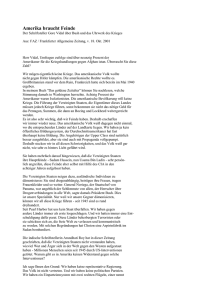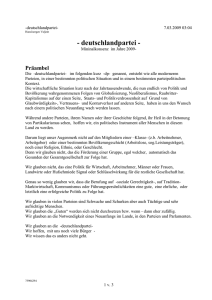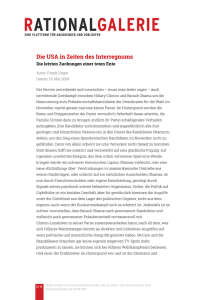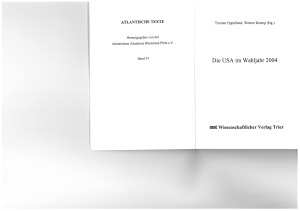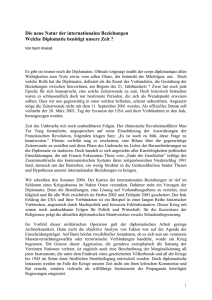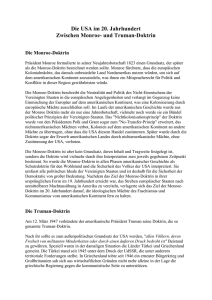Angriff auf die Diplomatie
Werbung
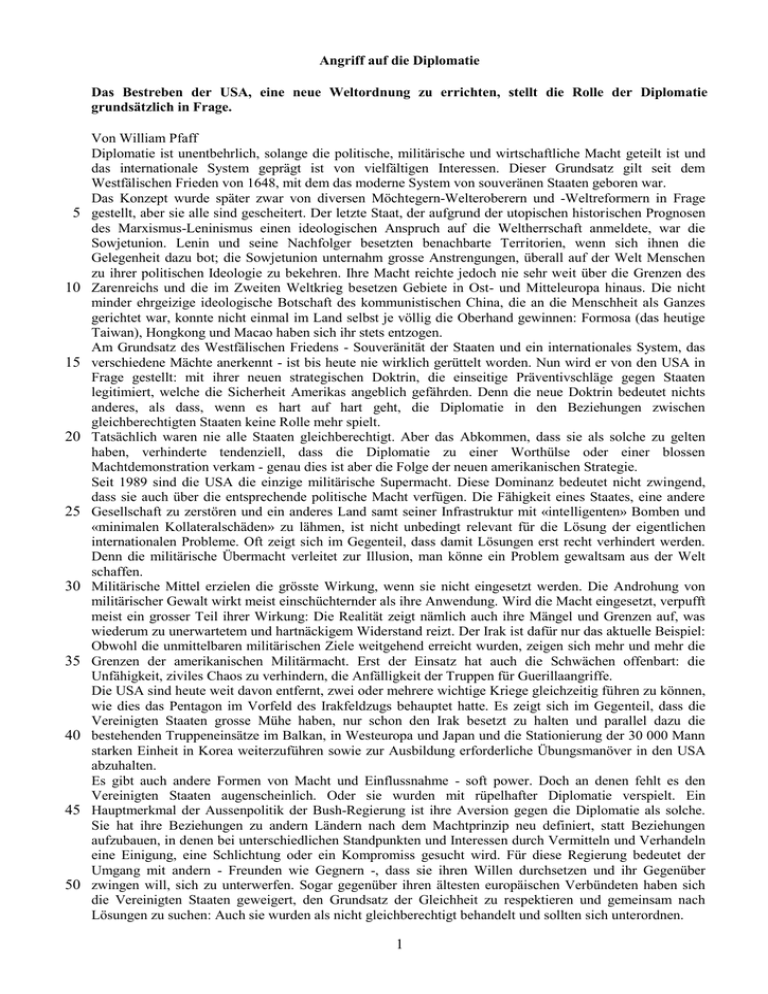
Angriff auf die Diplomatie Das Bestreben der USA, eine neue Weltordnung zu errichten, stellt die Rolle der Diplomatie grundsätzlich in Frage. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Von William Pfaff Diplomatie ist unentbehrlich, solange die politische, militärische und wirtschaftliche Macht geteilt ist und das internationale System geprägt ist von vielfältigen Interessen. Dieser Grundsatz gilt seit dem Westfälischen Frieden von 1648, mit dem das moderne System von souveränen Staaten geboren war. Das Konzept wurde später zwar von diversen Möchtegern-Welteroberern und -Weltreformern in Frage gestellt, aber sie alle sind gescheitert. Der letzte Staat, der aufgrund der utopischen historischen Prognosen des Marxismus-Leninismus einen ideologischen Anspruch auf die Weltherrschaft anmeldete, war die Sowjetunion. Lenin und seine Nachfolger besetzten benachbarte Territorien, wenn sich ihnen die Gelegenheit dazu bot; die Sowjetunion unternahm grosse Anstrengungen, überall auf der Welt Menschen zu ihrer politischen Ideologie zu bekehren. Ihre Macht reichte jedoch nie sehr weit über die Grenzen des Zarenreichs und die im Zweiten Weltkrieg besetzen Gebiete in Ost- und Mitteleuropa hinaus. Die nicht minder ehrgeizige ideologische Botschaft des kommunistischen China, die an die Menschheit als Ganzes gerichtet war, konnte nicht einmal im Land selbst je völlig die Oberhand gewinnen: Formosa (das heutige Taiwan), Hongkong und Macao haben sich ihr stets entzogen. Am Grundsatz des Westfälischen Friedens - Souveränität der Staaten und ein internationales System, das verschiedene Mächte anerkennt - ist bis heute nie wirklich gerüttelt worden. Nun wird er von den USA in Frage gestellt: mit ihrer neuen strategischen Doktrin, die einseitige Präventivschläge gegen Staaten legitimiert, welche die Sicherheit Amerikas angeblich gefährden. Denn die neue Doktrin bedeutet nichts anderes, als dass, wenn es hart auf hart geht, die Diplomatie in den Beziehungen zwischen gleichberechtigten Staaten keine Rolle mehr spielt. Tatsächlich waren nie alle Staaten gleichberechtigt. Aber das Abkommen, dass sie als solche zu gelten haben, verhinderte tendenziell, dass die Diplomatie zu einer Worthülse oder einer blossen Machtdemonstration verkam - genau dies ist aber die Folge der neuen amerikanischen Strategie. Seit 1989 sind die USA die einzige militärische Supermacht. Diese Dominanz bedeutet nicht zwingend, dass sie auch über die entsprechende politische Macht verfügen. Die Fähigkeit eines Staates, eine andere Gesellschaft zu zerstören und ein anderes Land samt seiner Infrastruktur mit «intelligenten» Bomben und «minimalen Kollateralschäden» zu lähmen, ist nicht unbedingt relevant für die Lösung der eigentlichen internationalen Probleme. Oft zeigt sich im Gegenteil, dass damit Lösungen erst recht verhindert werden. Denn die militärische Übermacht verleitet zur Illusion, man könne ein Problem gewaltsam aus der Welt schaffen. Militärische Mittel erzielen die grösste Wirkung, wenn sie nicht eingesetzt werden. Die Androhung von militärischer Gewalt wirkt meist einschüchternder als ihre Anwendung. Wird die Macht eingesetzt, verpufft meist ein grosser Teil ihrer Wirkung: Die Realität zeigt nämlich auch ihre Mängel und Grenzen auf, was wiederum zu unerwartetem und hartnäckigem Widerstand reizt. Der Irak ist dafür nur das aktuelle Beispiel: Obwohl die unmittelbaren militärischen Ziele weitgehend erreicht wurden, zeigen sich mehr und mehr die Grenzen der amerikanischen Militärmacht. Erst der Einsatz hat auch die Schwächen offenbart: die Unfähigkeit, ziviles Chaos zu verhindern, die Anfälligkeit der Truppen für Guerillaangriffe. Die USA sind heute weit davon entfernt, zwei oder mehrere wichtige Kriege gleichzeitig führen zu können, wie dies das Pentagon im Vorfeld des Irakfeldzugs behauptet hatte. Es zeigt sich im Gegenteil, dass die Vereinigten Staaten grosse Mühe haben, nur schon den Irak besetzt zu halten und parallel dazu die bestehenden Truppeneinsätze im Balkan, in Westeuropa und Japan und die Stationierung der 30 000 Mann starken Einheit in Korea weiterzuführen sowie zur Ausbildung erforderliche Übungsmanöver in den USA abzuhalten. Es gibt auch andere Formen von Macht und Einflussnahme - soft power. Doch an denen fehlt es den Vereinigten Staaten augenscheinlich. Oder sie wurden mit rüpelhafter Diplomatie verspielt. Ein Hauptmerkmal der Aussenpolitik der Bush-Regierung ist ihre Aversion gegen die Diplomatie als solche. Sie hat ihre Beziehungen zu andern Ländern nach dem Machtprinzip neu definiert, statt Beziehungen aufzubauen, in denen bei unterschiedlichen Standpunkten und Interessen durch Vermitteln und Verhandeln eine Einigung, eine Schlichtung oder ein Kompromiss gesucht wird. Für diese Regierung bedeutet der Umgang mit andern - Freunden wie Gegnern -, dass sie ihren Willen durchsetzen und ihr Gegenüber zwingen will, sich zu unterwerfen. Sogar gegenüber ihren ältesten europäischen Verbündeten haben sich die Vereinigten Staaten geweigert, den Grundsatz der Gleichheit zu respektieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen: Auch sie wurden als nicht gleichberechtigt behandelt und sollten sich unterordnen. 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Machtdemonstrationen ersetzten die Mechanismen der traditionellen Diplomatie. Die Folge wird sein, dass Washingtons Gesprächspartner ebenfalls auf Machtmittel zurückgreifen werden. Länder, die sich militärisch verwundbar fühlen, werden ihr Äusserstes geben, um irgendeine Art der Abschreckung gegen den Druck Amerikas in die Hand zu bekommen. Andere Staaten - etwa Russland und China -, die bereits Abschreckungswaffen besitzen, werden ihr Arsenal weiter verstärken. Man mag heute zwar diagnostizieren, dass Nordkorea unter einer politischen Psychopathologie leidet; aber der Wunsch des Landes nach dem Besitz von Nuklearwaffen ist nicht irrational - ebenso wenig wie derjenige von Iran. Auch Staaten, die sich nicht militärisch bedroht sehen, werden nach politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten suchen, um sich gegen die USA zu verteidigen und die potentielle Bedrohung einzudämmen. Fragt man nach der Zukunft der Diplomatie, so impliziert dies, dass ein tiefgreifender historischer Wandel unmittelbar bevorsteht. Es heisst, dass das 19. Jahrhundert politisch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 endete und das 20. Jahrhundert 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Letzteres ist aus heutiger Sicht eine voreilige Interpretation. Die Behauptung, 1991 sei eine Ära zu Ende gegangen und ein neues Zeitalter der weltweiten liberalen Demokratie und des Marktkapitalismus habe begonnen, hat sich als falsch erwiesen. Die Ereignisse seit 1991 waren zum grössten Teil nur auf jene Kräfte zurückzuführen, die schon vorher im Spiel gewesen waren, oder aber sie waren eine Reaktion darauf. Und Washington verhält sich weiterhin so, als ob die internationale Ordnung nach wie vor im Wesentlichen bipolar wäre, obwohl Amerika unterdessen die einzige Supermacht ist. Das bipolare System wurde von Washington in den neunziger Jahren umdefiniert, indem China oder ein «wiederauflebendes» Russland zu potentiell tödlichen Feinden erklärt wurden. Daneben gab es weniger dauerhafte Gegner, die als «Schurkenstaaten» bezeichnet wurden. Nach 2001 schliesslich, als der Terrorismus die Rolle übernahm, die einst die Sowjetunion innehatte, verwandelte sich der Feind in die «Achse des Bösen». Die entscheidende Veränderung in der Weltpolitik, so zeigt sich je länger, je deutlicher, ist wohl in dieser Neudefinition der Welt durch die USA zu suchen. Denn damit wurde offiziell einer Politik zum Durchbruch verholfen, mit der sich die Vereinigten Staaten die dauerhafte internationale militärische Vorherrschaft zu sichern versuchen. Ich behaupte, dass das 21. Jahrhundert in Tat und Wahrheit im Jahr 2002 begonnen hat. Nun ist es natürlich schwer vorauszusagen, in welche Richtung sich die amerikanische Außenpolitik in Zukunft bewegen wird. Sollte sich die Lage im Irak ernsthaft verschlechtern, könnte dies erneut Ängste schüren und einen Isolationismus fördern, wie dies letztmals im Anschluss an den Vietnamkrieg geschehen ist. Die amerikanische Besetzung des Iraks provoziert immer heftigeren Widerstand und bedingt ein viel längerfristiges Engagement der amerikanischen Streitkräfte, als die führenden Mitglieder der BushRegierung sich das je vorgestellt hatten. Bei der Planung und den Vorbereitungen stützte man sich hauptsächlich auf optimistische Annahmen - ein Fehler, der Ideologen häufig unterläuft. Zudem haben die Planer sowohl Verbündete wie internationale Organisationen auf eine Art und Weise behandelt, dass den USA nur noch wenige Freunde bleiben, die ihnen in dieser schwierigen Lage zu Hilfe kommen würden. Die schwierige Mission im Irak, der Verlust der Verbündeten und der internationalen Unterstützung, dazu eine wohl weiterhin schwächelnde Wirtschaft - all das könnte auch dazu führen, dass der Ära von George W. Bush bei den Präsidentschaftswahlen im November 2004 ein Ende bereitet wird. Aber auch dann dürften Bush und seine neokonservativen Gesinnungsfreunde in der Geschichte der zeitgenössischen Außenpolitik Amerikas mehr als bloß eine exzentrische, wenn auch lehrreiche Episode mit schlechtem Ausgang gewesen sein. Es war zwar Bush, der eine neue konservative Elite an die Macht gebracht hat. Und die Politik, die sie vertritt, mag in dieser Form neu erscheinen. Doch die Ideologie, die dahintersteckt, ist uralt und wird von Republikanern wie von Demokraten verfochten: Es ist die Überzeugung, Amerika sei ein Staat mit Ausnahmecharakter. Es ist der Glaube, das amerikanische Gesellschaftsmodell sei dazu auserkoren, die Welt auf die eine oder andere Weise zu beherrschen. Die Neokonservativen haben die globale Rolle und das historische Schicksal der amerikanischen Nation, die sie als außergewöhnlich wahrnehmen, bloß besonders brutal und arrogant zum Ausdruck gebracht. Während sich einige von ihnen als «wohlwollende» Hegemonisten oder Imperialisten bezeichnen, sagen andere schlicht, sie seien Neo-Wilsonianer. Woodrow Wilson, Demokrat und Präsident der Vereinigten Staaten von 1913 bis 1923, ist eine Schlüsselfigur in der Geschichte der amerikanischen Außenpolitik. 1917 plädierte Wilson für einen «Krieg ohne Sieg», aber als Deutschland seine U-Boot-Angriffe auf neutrale Schiffe ausdehnte, kam die Kehrseite seines sentimentalen Pazifismus zum Vorschein. Wilson zeigte sich wild entschlossen, für sein utopisches Ziel in den Krieg zu ziehen. Er definierte den Ersten Weltkrieg als «Krieg zur Beendigung aller Kriege»: Nachdem er ausgefochten sei, würden die Vereinigten Staaten die internationale Gemeinschaft zu einer neuen Weltordnung führen, in der es keine Kriege mehr gebe. 2 5 10 15 20 25 30 35 40 Als der Sieg 1918 Tatsache wurde und scheinbar die Möglichkeit bestand, die Vision umzusetzen, erklärte Wilson, die Rolle Amerikas im Ersten Weltkrieg sei durch eine göttliche Fügung bestimmt gewesen: Gott habe den Vereinigten Staaten den Auftrag zur Schaffung einer neuen menschlichen Gesellschaft gegeben und er, Wilson, sei hier auf Erden, um diesen wunderbaren Auftrag zu erfüllen. Damit drückte er einen grundlegenden Mythos der amerikanischen Gesellschaft aus. Schon die «Pilger» - Mitglieder der (calvinistischen) puritanischen Sekte, die sich im 17. Jahrhundert in New England niedergelassen hatten glaubten, dass sie die biblische «Stadt auf dem Berg» bauen würden; Ronald Reagan wiederholte diesen Mythos später. Auf die eine oder andere Weise durchdringt die Überzeugung, eine göttliche Mission zu erfüllen, noch heute die amerikanische Außenpolitik. Linke und Rechte glauben daran. Vielleicht kommen die Demokraten 2004 oder 2008 wieder an die Macht, und George W. Bush geht in Pension; aber schon während der Amtszeit Clintons verkündete Außenministerin Madeleine Albright, die Amerikaner hätten mehr Weitblick, weil sie über allen andern stünden. Die Ideologie findet sich auch im Programm zur Globalisierung, das Bill Clinton vehement verfolgte. Es war von seinen frühesten Anhängern, Leuten von der Wall Street, als System vorgestellt worden, mit dem die Märkte weltweit für amerikanische Investoren geöffnet werden könnten. Die Regierung erklärte dann, die Globalisierung fördere die Entwicklung der Weltgemeinschaft zur globalen Einheit in Demokratie und Marktkapitalismus - eine utopische Vorstellung, aber den Regierungsmitgliedern war die Scheinheiligkeit ihrer Argumentation offenbar nicht bewusst. Ebenfalls unter Präsident Clinton hat das Pentagon ein neuartiges Netzwerk von Regionalkommandos aufgebaut, das heute die Welt umspannt. Jeder Kommandant ist für die Überwachung der Entwicklung in einer bestimmten Region zuständig. Er kontrolliert den Aufbau oder die Intensivierung von bilateralen militärischen Beziehungen zu allen Ländern der Region, die dazu bereit sind. Und er plant regionale Interventionen für den Ernstfall, darunter die mögliche Gefährdung der Interessen der USA oder der allgemeinen Weltordnung. Die Folge war eine Machtverschiebung in der Außenpolitik - weg vom unterfinanzierten Außenministerium und von der zivilen CIA hin zum Verteidigungsministerium, das bereits über eigene politische und geheimdienstliche Organe verfügte. Das in der amerikanischen Verfassung verankerte Verbot von «stehenden Heeren», die als Bedrohung für die Demokratie angesehen wurden, gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als von der Geschichte überholt. Die Bildung der Regionalkommandos war ein weiterer Schritt in der Militarisierung der Außenpolitik zuungunsten der Diplomatie. Der amerikanische Utopismus ist der unreflektierte Hintergrund aller Außenpolitik Washingtons. Er durchdringt die Rhetorik und das Denken von Republikanern und Demokraten. Und er ist der Grund, weshalb die Vereinigten Staaten glauben können, es gebe in der Geschichte eine ultimative Lösung - und sie seien dazu bestimmt, diese Lösung zu präsentieren. Derzeit zeigt sich dieser Glaube im Bemühen der USA, die bestehende internationale Ordnung aus mehreren Mächten und einem Gleichgewicht von Machtzentren durch ein einziges großes Gebilde zu ersetzen, in dem alle industrialisierten Demokratien verbündet sind und das unter der Führung der Vereinigten Staaten die Welt beherrscht und den Frieden sichert. Ein Weltentwurf, der wenig Platz für diplomatische Zwischentöne lässt. William Pfaff ist Kolumnist der «International Herald Tribune» in Paris und Autor mehrerer Bücher zur amerikanischen Außenpolitik. [ Neue Zürcher Zeitung | NZZ FOLIO | 2.9.03] 3