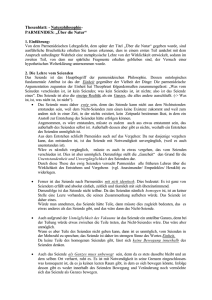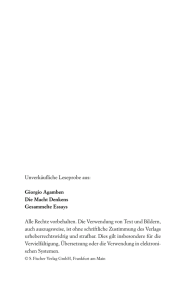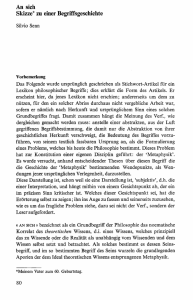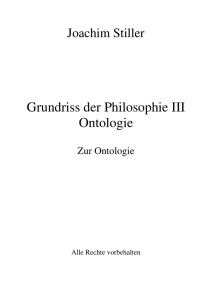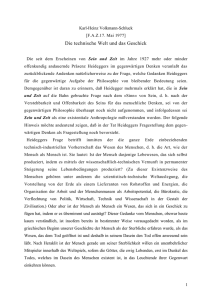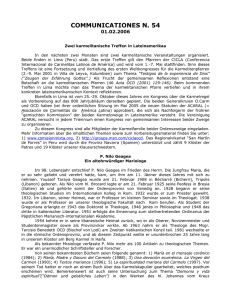Document
Werbung
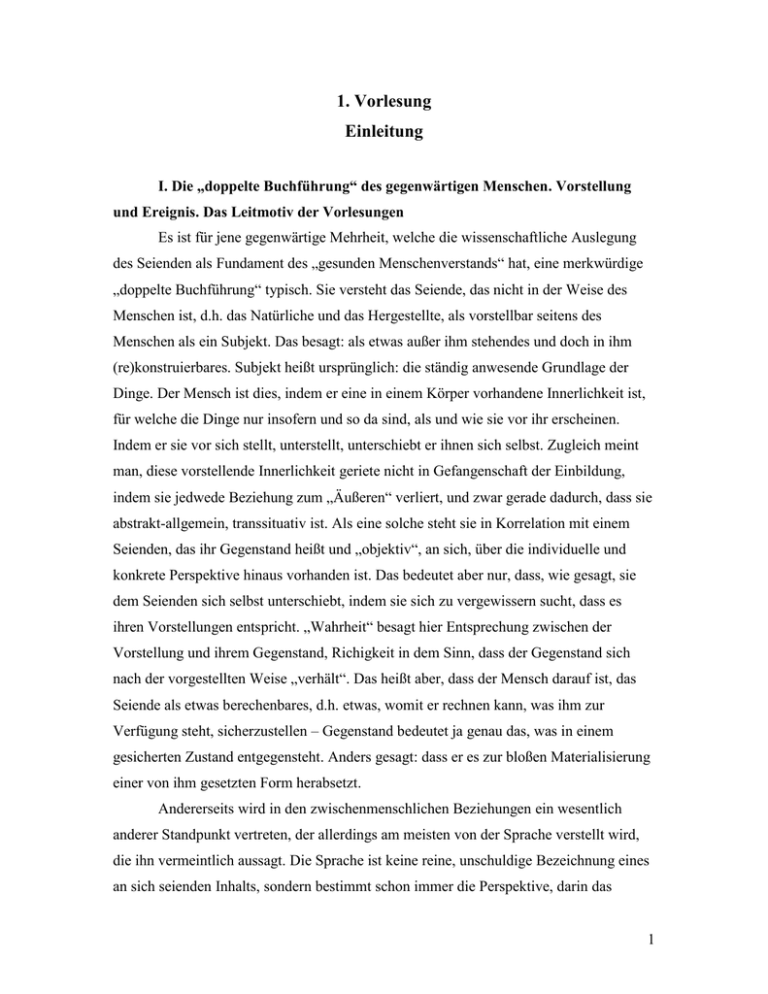
1. Vorlesung Einleitung I. Die „doppelte Buchführung“ des gegenwärtigen Menschen. Vorstellung und Ereignis. Das Leitmotiv der Vorlesungen Es ist für jene gegenwärtige Mehrheit, welche die wissenschaftliche Auslegung des Seienden als Fundament des „gesunden Menschenverstands“ hat, eine merkwürdige „doppelte Buchführung“ typisch. Sie versteht das Seiende, das nicht in der Weise des Menschen ist, d.h. das Natürliche und das Hergestellte, als vorstellbar seitens des Menschen als ein Subjekt. Das besagt: als etwas außer ihm stehendes und doch in ihm (re)konstruierbares. Subjekt heißt ursprünglich: die ständig anwesende Grundlage der Dinge. Der Mensch ist dies, indem er eine in einem Körper vorhandene Innerlichkeit ist, für welche die Dinge nur insofern und so da sind, als und wie sie vor ihr erscheinen. Indem er sie vor sich stellt, unterstellt, unterschiebt er ihnen sich selbst. Zugleich meint man, diese vorstellende Innerlichkeit geriete nicht in Gefangenschaft der Einbildung, indem sie jedwede Beziehung zum „Äußeren“ verliert, und zwar gerade dadurch, dass sie abstrakt-allgemein, transsituativ ist. Als eine solche steht sie in Korrelation mit einem Seienden, das ihr Gegenstand heißt und „objektiv“, an sich, über die individuelle und konkrete Perspektive hinaus vorhanden ist. Das bedeutet aber nur, dass, wie gesagt, sie dem Seienden sich selbst unterschiebt, indem sie sich zu vergewissern sucht, dass es ihren Vorstellungen entspricht. „Wahrheit“ besagt hier Entsprechung zwischen der Vorstellung und ihrem Gegenstand, Richigkeit in dem Sinn, dass der Gegenstand sich nach der vorgestellten Weise „verhält“. Das heißt aber, dass der Mensch darauf ist, das Seiende als etwas berechenbares, d.h. etwas, womit er rechnen kann, was ihm zur Verfügung steht, sicherzustellen – Gegenstand bedeutet ja genau das, was in einem gesicherten Zustand entgegensteht. Anders gesagt: dass er es zur bloßen Materialisierung einer von ihm gesetzten Form herabsetzt. Andererseits wird in den zwischenmenschlichen Beziehungen ein wesentlich anderer Standpunkt vertreten, der allerdings am meisten von der Sprache verstellt wird, die ihn vermeintlich aussagt. Die Sprache ist keine reine, unschuldige Bezeichnung eines an sich seienden Inhalts, sondern bestimmt schon immer die Perspektive, darin das 1 Gesagte erscheint, mithin – dieses selbst. Die heute geläufige und selbstverständliche Sprache, darin die Begriffe des gesunden Menschenverstands wurzeln und davon auch die Wissenschaft Gebrauch nimmt, ist eine Überlieferung der abendländischen Metaphysik, der gerade das oben besprochene vorstellende Denken entspringt. In diesem Bereich also ist eben die vorstellende Innerlichkeit in Gefangenschaft der Einbildung, in sich selbst verkapselt. Sie wendet sich von der konkreten Situation ab, gleichviel ob sie sich auf irgendwelche universellen Vorbilder oder auf ihre individuelle Eigentümlichkeit zuwendet. Der Andere steht „optisch“, oberflächlich, nur in den ihm von ihr vorherbestimmten Hinsichten da. Die andere Seite seiner „narzisstischen“ Vergegenständlichung, davon, dass die vorstellende Innerlichkeit in ihm keine Grenze erfährt, ist aber die Ausweglosigkeit dieser, das, dass sie dazu verurteilt wird, sich mit ihm gegenseitig auszuschließen. Indem sie unbegrenzt für sich selbst ist, d.h. die Bestimmungen, welche sie im fremden Blick haben könnte, nicht auf sich nimmt, erscheint sie für ihn gar nicht, d.h. ist sie für ihn nicht da. Während sie sich mit ihrer situativen Faktizität nicht identifiziert, werden ihr von außen her keine situativ nicht gezeigten Eigenschaften anerkannt. Somit ist hier der Mensch darauf hingewiesen, aus sich selbst als einer vor sich stellenden Innerlichkeit herauszugehen und derart sowohl den Anderen als auch sich selbst vom ereignishaften Charakter, d.h. von dem von ihnen geteilten situativen Zusammenhang her sein zu lassen. In diesem Fall sind die beiden Seiten nicht vorhanden und, was dasselbe heißt, auseinander stehend, vielmehr werden sie von ihrer Teilnahme an der Situation aus bestimmt und stehen einander gegenüber aufgrund dieser ihrer Zusammengehörigkeit. Diese Vorlesungen gehen dem Verständnis nach, dass nicht nur das Seiende, das in der Weise des Menschen ist, sondern auch ein jedes Seiende für den Menschen ursprünglich als Ereignis gegeben ist, weil er keine vorhandene und in einem Körperding eingesperrte Innerlichkeit, sondern durch seinen Leib schon immer in der jeweiligen Situation „eingeschrieben“ ist, d.h. bevor er diese oder jene Bestimmtheit hat, nimmt er je an einer Situation teil. Gerade diese Hinausgetragenheit in der Situation ist die Offenheit, welche möglich macht, einem Seienden überhaupt zu begegnen. Das Verhältnis zum Anderen ist zugleich Selbstverhältnis – das Andere ist ein Anderes immer mir gegenüber, insoweit ich in ihm auf mich selbst beziehe. Das gilt ja durchaus für die vorstellende 2 Innerlichkeit, für welche die Dinge insofern da sind, als in ihnen ihre fortwährende Vorhandenheit auf sich selbst verweist. Allein ist das Selbstverhältnis nur als Verhältnis zu etwas Anderem möglich – die von jeder Situation abgesonderte, an sich selbst gegebene Innerlichkeit, die mit dem Anderen in einer gegenseitigen Ausgeschlossenheit und einer indifferenten Verschiedenheit liegt, kann sich keineswegs als etwas Unterschiedliches wissen, d.h. auf sich selbst beziehen. Das sich zu sich selbst Verhaltende ist dies erst als das Andere des Anderen als sein eigenes Anderes. Somit sind das Selbstverhältnis des Menschen und das Verhältnis zum Seienden in ihrer Zusammengehörigkeit im Grunde ereignishaft, vollziehen sich jedesmal von einem situativen Zusammenhang her, den der Mensch und das Seiende miteinander teilen. Sind aber nicht z. B. die Tiere in ihrem Umring ganz „hineingewoben“, und gerade deswegen ganz unfähig, zwischen sich selbst und etwas anderem zu unterscheiden, mithin – sich zu so etwas wie Seiendem zu verhalten? Allerdings. Der Mensch ist dennoch von der Situation nicht hingenommen, und zwar eben dadurch, dass er Sprache hat. Die Sprache ist in ihrem Wesen kein vorhandenes Laut- oder Schriftzeichen, das eine Menge von festen Bedeutungen hat, vielmehr eine Zeichnung, Artikulierung der eigenen Befindlichkeit in der jeweiligen Situation. Als diese Zeichnung ist sie einerseits eine Erhaltung des Hervorgekommenen, des Seienden als Seiendes, und andererseits – eine Aneignung der Beziehung zu ihm als eine eigene, der Grenze, die in ihm erfahren wird, als eigene Bestimmtheit. Der Schein des vorhandenen, transsituativen Selbst wird dadurch möglich, das die Sprache vom jeweiligen Kontext abgesondert und mit festen Bedeutungen beladen wird, aus denen das Vorstellen seinen Inhalt schöpft. II. Philosophie und Wissenschaft Bei den Griechen war die Theorie immer noch ein solches Hinsehen auf das Seiende, das nicht von einem vorhandenen Verstand oder Bewusstsein, sondern von einer Befindlichkeit in der jeweiligen Situation ausgeht. Sie war eine Teilnahme am Ereignis der Unverborgenheit von etwas, an dem, was die Griechen Wahrheit nannten. Oder: das Seiende von ihm selbst, d.h. vom unverfügbaren situativen Zusammenhang her zeigen lassen. Die griechischen Begriffe sind nicht etwas erfundenes, vielmehr Artikulationen solcher Zusammenhänge. Die Römer übersetzen „theoria“ durch „contemplatio“, was 3 bedeutet: etwas in einem Abschnitt einteilen und umzäunen. Die Theorie wird zu einem Be-greifen dieses etwas, also – zu seinem Er-greifen. Die deutsche Übersetzung von contemplatio lautet: Betrachtung. Die Wurzel „trachten“ kommt vom lateinischen „tractare“ – behandeln, bearbeiten. Und „nach etwas trachten“ heißt: es verfolgen, ihm nachstellen, um es sicherzustellen. Die Theorie als Betrachtung erschließt das Seiende als Gegen-stand – das in einem gesicherten Zustand Entgegenstehende. Sie ist, wie gesagt, ein Berechnen, aber nicht in dem verengten Sinne von Operieren mit Zahlen, sondern indem sie das Seiende als etwas erschließt, womit man rechnen kann, was verfolgbar und beherrschbar ist. Die moderne Theorie, die Wissenschaft lässt mithin das Seiende nicht so erscheinen, als es an ihm selbst ist, sondern bearbeitet es virtuell, noch vor jedem Experiment, indem sie es vor sich stellt, d.h. es nur in den von ihr vorgezeichneten Hinsichten zum Vorschein bringt. Die Spezialisierung der Wissenschaften beruht eben darauf, dass jede von ihnen das Seiende im spezifischen Aspekt der von ihr konstruierten, vorgestellten Gegenständlichkeit betrachtet. Und endlich ist die Wissenschaft notwendig experimentell, insoweit sie das Seiende nur so sicherstellen kann, dass sie es befragt, ob es sich gemäß den von ihr vorgestellten Zusammenhängen melden würde. Die echte Philosophie unterscheidet sich von der Wissenschaft grundsätzlich dadurch, dass sie nicht von der Vorhandenheit, sondern von der Ereignishaftigkeit ausgeht, bzw. das Seiende nicht in diesem oder jenem Hinsicht, d.h. nicht äußerlich, oberflächlich, fragmentarisch betrachtet. Jede Wissenschaft gründet auf dem „gesunden Menschenverstand“, und das besagt, dass sie ihre Gegenständlichkeit durch bestimmte, in der Sprache sedimentierte Bedeutungen gestaltet, deren ursprünglichen Kontexte vergessen sind. Das heißt, dass sie diese Bedeutungen hypostasiert, ihnen „Realität“ gibt oder dass sie ihre eigenen Gründe nicht bedenkt. Wenn sie sich gezwungen sieht, diese Aufgabe aufzunehmen, überschreitet sie ihre konstitutiven Grenzen und wird im gleichen Moment zu Philosophie. Allerdings hat die Philosophie, wie sie hier verstanden wird, mit der Wissenschaft es gemeinsam, keine übersinnliche Welt anzunehmen. Diese ist gerade durch das Entreißen des Verhältnisses zum Seienden aus der jeweiligen Situation entstanden. Sie stellt aber ein oberflächlicher Gegensatz zum „Materialismus“ der Wissenschaft dar, weil sowohl das materielle als auch das spirituelle Seiende vorhanden ist, d.h. auf einer Vergessenheit des Seins als das Ereignis seiner Unverborgenheit, auf 4 einem Denken des Seins als fortwährende Anwesenheit beruht. Jedoch ist die Wissenschaft „fortschrittlicher“ als die Mythologie – nicht bloß durch ihre Errungenschaften, sondern dadurch, dass sie sich auf das faktische Seiende zuwendet, sei es auch nur in einem oder anderem Hinsicht. III. Philosophie und Kunst Die Philosophie teilt es mit der Kunst, dass sie zum Allgemeinen unterwegs ist. Doch hier ist keinesfalls ein abstraktes, ideel vorhandenes Allgemeines gemeint, vielmehr das, was alles durchwaltet. Wie in den Vorlesungen zu zeigen ist, ist das das Sein als ein situativer Zusammenhang, von dem her sowohl der Mensch als auch das Seiende je seine Bestimmung erhält und zum Vorschein kommt. Die Kunst hat dieses Allgemeine zum Thema, indem sie je eine situative Befindlichkeit artikuliert. Man spricht das gewöhnlich als ihre Fundiertheit im Gefühl aus. Das Gefühl ist zwar etwas, was über eine vorhandene, transsituative, in sich selbst verkapselte Innerlichkeit hinaus verweist, die Eingewobenheit des Menschen als ein leibliches Wesen je in einem situativen Zusammenhang zeigt. Bevor also das Gefühl als ein seelischer, psychologischer Zustand ausgelegt wird, ist es ein Aspekt der jeweiligen situativen Befindlichkeit, die niemals kontrolliert, sondern nur artikuliert werden kann. Insoweit außerdem diese Artikulierung eine Aneignung, Aufnahme des Konkreten, Faktischen ist, gibt es in ihr nichts „irrationelles“. Im Gegenteil: sie steht näher zum Wesen der Wahrheit als das Ereignis der Offenbarung von etwas, welche Offenbarung eben darum ein Ereignis ist, weil sie kein Äußerliches für den Menschen ist, vielmehr ihn selbst betrifft, d.h. weil in ihr der Mensch etwas Eigenes erkennt. Wenngleich aber die echte Kunst das Seiende vom Zusammenhang des Seins selbst her zum Vorschein bringt, sieht sie, im Unterschied zur Philosophie, nur das Seiende, das Bestimmte, den „Inhalt“, nicht das Sein, das Bestimmende, den rein „formalen“ Zusammenhang. In diesem Sinne sei Hegels Spruch zu verstehen, dass sie sich im Medium der Sinnlichkeit vollzieht – sie repräsentiert das Allgemeine, das Sein in einer Konfiguration von Einzelheiten, Seienden. Die Kunst schöpft also aus der „menschlichen Situation“ heraus, bedenkt aber nicht diese Situation selbst. 5