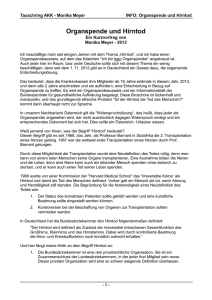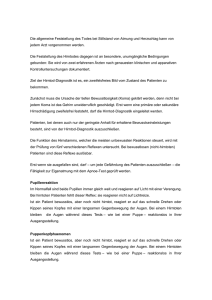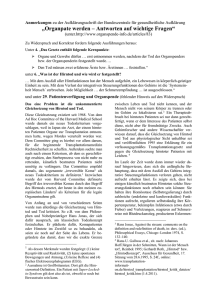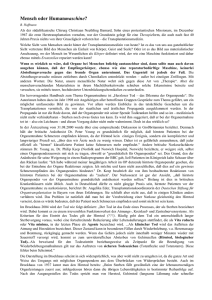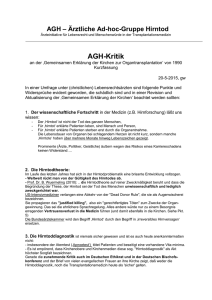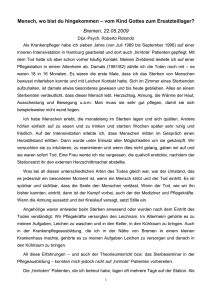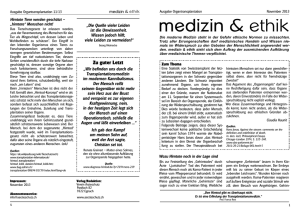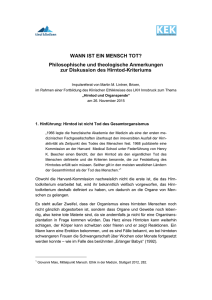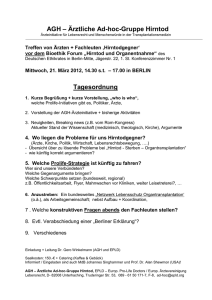Ausgabe 04/2002
Werbung
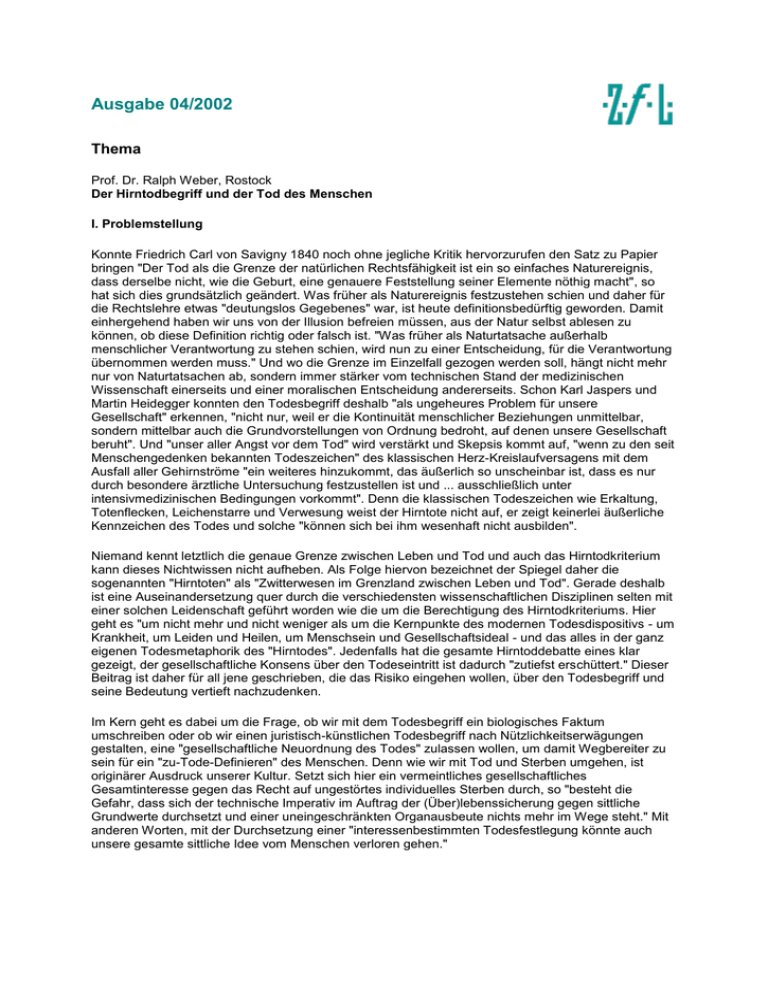
Ausgabe 04/2002 Thema Prof. Dr. Ralph Weber, Rostock Der Hirntodbegriff und der Tod des Menschen I. Problemstellung Konnte Friedrich Carl von Savigny 1840 noch ohne jegliche Kritik hervorzurufen den Satz zu Papier bringen "Der Tod als die Grenze der natürlichen Rechtsfähigkeit ist ein so einfaches Naturereignis, dass derselbe nicht, wie die Geburt, eine genauere Feststellung seiner Elemente nöthig macht", so hat sich dies grundsätzlich geändert. Was früher als Naturereignis festzustehen schien und daher für die Rechtslehre etwas "deutungslos Gegebenes" war, ist heute definitionsbedürftig geworden. Damit einhergehend haben wir uns von der Illusion befreien müssen, aus der Natur selbst ablesen zu können, ob diese Definition richtig oder falsch ist. "Was früher als Naturtatsache außerhalb menschlicher Verantwortung zu stehen schien, wird nun zu einer Entscheidung, für die Verantwortung übernommen werden muss." Und wo die Grenze im Einzelfall gezogen werden soll, hängt nicht mehr nur von Naturtatsachen ab, sondern immer stärker vom technischen Stand der medizinischen Wissenschaft einerseits und einer moralischen Entscheidung andererseits. Schon Karl Jaspers und Martin Heidegger konnten den Todesbegriff deshalb "als ungeheures Problem für unsere Gesellschaft" erkennen, "nicht nur, weil er die Kontinuität menschlicher Beziehungen unmittelbar, sondern mittelbar auch die Grundvorstellungen von Ordnung bedroht, auf denen unsere Gesellschaft beruht". Und "unser aller Angst vor dem Tod" wird verstärkt und Skepsis kommt auf, "wenn zu den seit Menschengedenken bekannten Todeszeichen" des klassischen Herz-Kreislaufversagens mit dem Ausfall aller Gehirnströme "ein weiteres hinzukommt, das äußerlich so unscheinbar ist, dass es nur durch besondere ärztliche Untersuchung festzustellen ist und ... ausschließlich unter intensivmedizinischen Bedingungen vorkommt". Denn die klassischen Todeszeichen wie Erkaltung, Totenflecken, Leichenstarre und Verwesung weist der Hirntote nicht auf, er zeigt keinerlei äußerliche Kennzeichen des Todes und solche "können sich bei ihm wesenhaft nicht ausbilden". Niemand kennt letztlich die genaue Grenze zwischen Leben und Tod und auch das Hirntodkriterium kann dieses Nichtwissen nicht aufheben. Als Folge hiervon bezeichnet der Spiegel daher die sogenannten "Hirntoten" als "Zwitterwesen im Grenzland zwischen Leben und Tod". Gerade deshalb ist eine Auseinandersetzung quer durch die verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen selten mit einer solchen Leidenschaft geführt worden wie die um die Berechtigung des Hirntodkriteriums. Hier geht es "um nicht mehr und nicht weniger als um die Kernpunkte des modernen Todesdispositivs - um Krankheit, um Leiden und Heilen, um Menschsein und Gesellschaftsideal - und das alles in der ganz eigenen Todesmetaphorik des "Hirntodes". Jedenfalls hat die gesamte Hirntoddebatte eines klar gezeigt, der gesellschaftliche Konsens über den Todeseintritt ist dadurch "zutiefst erschüttert." Dieser Beitrag ist daher für all jene geschrieben, die das Risiko eingehen wollen, über den Todesbegriff und seine Bedeutung vertieft nachzudenken. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob wir mit dem Todesbegriff ein biologisches Faktum umschreiben oder ob wir einen juristisch-künstlichen Todesbegriff nach Nützlichkeitserwägungen gestalten, eine "gesellschaftliche Neuordnung des Todes" zulassen wollen, um damit Wegbereiter zu sein für ein "zu-Tode-Definieren" des Menschen. Denn wie wir mit Tod und Sterben umgehen, ist originärer Ausdruck unserer Kultur. Setzt sich hier ein vermeintliches gesellschaftliches Gesamtinteresse gegen das Recht auf ungestörtes individuelles Sterben durch, so "besteht die Gefahr, dass sich der technische Imperativ im Auftrag der (Über)lebenssicherung gegen sittliche Grundwerte durchsetzt und einer uneingeschränkten Organausbeute nichts mehr im Wege steht." Mit anderen Worten, mit der Durchsetzung einer "interessenbestimmten Todesfestlegung könnte auch unsere gesamte sittliche Idee vom Menschen verloren gehen." II. Der Hirntod als Faktum 1. Das Hirntodkonzept Im Brennpunkt der Debatte steht insoweit das von der Mehrheit der medizinischen Sachverständigen favorisierte, von den Kirchen mitgetragene, theologisch, und philosophisch jedenfalls gebilligte und auch in der juristischen Literatur verbreitete, durch eine dynamische Verweisung in den §§ 3 II Nr. 2 i.V.m. 16 I 1 Nr. 1 TPG auch für das deutsche Transplantationsrecht hinsichtlich der vermittlungspflichtigen Organe zugrunde gelegte Hirntodkonzept. Danach soll der irreversible Ausfall aller Groß-, Klein- und Stammhirnfunktionen bei intensivmedizinisch aufrecht erhaltener HerzKreislauffunktion im übrigen Körper ein sicheres Erkennungszeichen des eingetretenen Todes sein. Letztlich liegt dem ein Hirnödem zugrunde, infolge dessen der Schädelinnendruck den arteriellen Blutdruck überschreitet. Damit kommt die Gehirndurchblutung zum Stillstand und die Gehirnzellen sterben ab und es kommt zur fortschreitenden Auflösung der Gehirnmasse (Nekrose) trotz Aufrechterhaltung des Körperkreislaufs. Diese Relevanz eines partiellen Organtodes soll durch die "besondere Stellung des Gehirns" als dem "entscheidenden integrierenden Abschlussorgan einer selbständigen Ganzheit" belegt werden. Dieser Zustand muss - jedenfalls im Falle einer beabsichtigten Organentnahme - durch zwei qualifizierte Ärzte unabhängig voneinander attestiert werden, die weder an der Organentnahme noch seiner Übertragung beteiligt sein dürfen und auch nicht den Weisungen eines daran beteiligten Arztes unterstehen. Der Tod wird danach - je nach Sichtweise - festgestellt oder definiert entweder durch eine Null-Linie im EEG oder durch eine altersabhängig unterschiedlich lange - Beobachtungszeit; der Tod als "isoelektrische Stille"! Doch trotz dieser gesetzlichen Festschreibung hat die Diskussion um die Berechtigung des Hirntodkonzeptes kein Ende genommen - zum einen schon deshalb, weil - wie schon die Römer wussten "Caesar non supra scientiam", zum anderen und vor allem aber, weil sich die legislative Mehrheitsmeinung nicht wissenschaftlich mit den Gegenargumenten des Minderheitenantrags auseinandergesetzt, sondern sie einfach unberücksichtigt gelassen hat. Dazu ist mit Tröndle zu sagen: "Mag der Gesetzgeber auch annehmen (damit) dem Fortschrittsglauben der Transplantationsmedizin in sinnvoller Weise gedient zu haben, der Wahrheit hat er nicht gedient." 2. Nachweisproblematik Hinsichtlich der erforderlichen Fixierung der Voraussetzungen dieses Hirntodkriteriums scheint dies dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer als Sicherung ausreichend. Festzuhalten bleibt dabei, dass die apparative Feststellung des Null-Linien-EEG's zur Hirntodfeststellung nicht obligatorisch ist, sondern bloße altersabhängige Beobachtungszeiten genügen - und dies in der wahrhaft existentiellen Frage nach Leben oder Tod und in einem Grenzbereich mit unzweifelhaft sehr fließenden Übergängen. Schon die hier kritisch aufgeworfene Frage nach der Zuverlässigkeit solcher Beobachtungen, aber auch der relativ aufwendigen Vorgänge, die durch verschiedene klinische wie apparative Diagnosemethoden anzeigen, dass die Hirntätigkeit irreversibel ausgefallen ist, stellt allerdings ein empirisches Problem dar, zu dessen Beantwortung primär nicht der Jurist, sondern der Neurologe berufen ist. Deshalb ist hier nur ergänzend darauf hinzuweisen, dass auch von Medizinern öffentlich ausgeführt wird, der sogenannte Hirntod, verstanden als irreversibler Funktionsverlust des gesamten Gehirns, sei in Wahrheit nicht erfüllbar. Zumindest kann das Zusammentreffen von Koma, fehlender Atmung, Hirnstammareflexie selbst in Verbindung mit dem sogenannten Null-Linien-EEG nicht den Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen nachweisen. Vielmehr sprechen wissenschaftliche Ergebnisse dafür, dass auch bei Hirntoten in Wirklichkeit noch Hirnfunktionen existieren. Teile der hypothalamisch-hypophysären Achse sollen ebenso noch funktionstüchtig sein wie die temporäre Hirnrinde, der Thalamus oder der Hirnstamm. Doch soll und kann diese medizinisch-neurologische Kontroverse hier nicht weiter vertieft werden, sondern soll nur als nachdenkenswerte Tatsache angesprochen sein. 3. Todesbegriff und "absolute Wahrheit"? Zumindest eines ist weiterhin auffällig. Obwohl wir wissen und uns einig sind, dass letztlich niemand die genaue Grenze zwischen Leben und Tod kennt, will die Hirntodkonzeption "geradezu naiv das Bild einer positivistischen Wissenschaft vom Tod konstruieren", so als sei man in der Lage, hier "absolute Wahrheiten" zu präsentieren. Der dabei gezeigte Versuch, nicht nur die Kritik zu ignorieren und alle entgegenstehenden Argumente als unbedeutend auszublenden, sondern den vermeintlich noch immer bestehenden Konsens über die Hirntodkonzeption "zuweilen mit rhetorisch ungewöhnlichen Argumentformen" aufrechtzuerhalten, zeigt ein Wissenschaftsverständnis, das gerade durch das "für die Naturwissenschaften verpflichtende Falsifikationsprinzip des kritischen Rationalismus bereits selbst ad absurdum geführt wird." In der Hirntoddebatte wurde der gegensätzliche Weg gewählt - im Vordergrund und am Anfang stand eine Zwecksetzung und was dieser entgegenstand, wurde als unbeachtlich ausgeblendet. III. Kernpunkte der Kritik 1. Abgehen vom biologischen Todesbegriff Leben beschreibt nach üblichem Sprachgebrauch einen naturwissenschaftlich erfahrbaren biologischen Status. Deshalb bemühen sich auch die Verfechter des Hirntodkonzeptes ersichtlich darum, mit diesem Kriterium an einem natürlichen, d.h. biologisch bedingten Todesbegriff festhalten um klarzustellen, dass sich die menschliche Physiologie des Todes nicht von der anderer Lebewesen unterscheidet. Das "biologische Basisfaktum menschlichen Lebens" soll durch dieses neue Todeskriterium nicht verlassen werden. Dementsprechend hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer auch nach der Anerkennung des Hirntodkonzeptes stets betont, dass es "nur einen Tod des Menschen gab und gibt". Man möchte den Hirntod also nur als neues Todeskriterium verstehen und damit unbedingt vermeiden, dass mit der Hirntodtheorie eine neue Todesdefinition, ein sogenannter "sozialer Todesbegriff" geschaffen würde. Denn dieser könnte, sofern man erst einmal das "Faktum des Todes entnaturalisiert" hat, zu leicht zu einem praktikabilitätsoffenen Verhandlungsgegenstand werden. Und darüber herrscht hoffentlich noch immer Einigkeit: Praktikabilität und Konsensfähigkeit alleine sind keine hinreichenden Bedingungen für die Zulässigkeit der Schaffung oder die Angemessenheit einer neuen Todesdefinition. Wäre der Hirntod nur ein neues Todeskriterium, keine neue Todesdefinition, müsste dies bedeuten, dass die "Besonderheit des menschlichen Todes" nicht biologisch, nicht durch seine Kriterien bestimmt wird, sondern allein durch das Wissen des Menschen um sein Sterben und seinen Tod, ansonsten aber - biologisch dem Tod eines Regenwurmes gleicht. Dann aber muss der Tod als Endpunkt des biologischen Lebens - nicht nur eines bewussten Erlebens - eine biologische Größe bleiben, weil es zwischen Tod und Leben keinen dritten Zustand geben kann. Tertium non datur! Eine Todesdefinition, die sich nicht an der physischen Existenz orientiert, sondern dem Menschen aufgrund des Fehlens bestimmter kognitiver Fähigkeiten das Recht auf Leben, auf sein Leben abspricht, ist schon deshalb mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht vereinbar. Das bedeutet, dass der Tod des Menschen nur und erst bei einem Funktionsverlust beider wesentlicher Systeme, des Bewusstseins und des physischen Organismus, eintritt; der irreversible Ausfall nur eines dieser Systeme reicht nicht aus, um vom Todeseintritt zu sprechen. Die Lebendigkeit eines Organismus wird in einem steten wechselwirkenden Prozess der Organsysteme und nicht allein vom Gehirn erzeugt. Demgegenüber suggeriert die Gleichsetzung des irreversiblen Hirnausfalles mit dem Tod des Menschen, "das Gehirn trüge gegenüber den anderen Organen etwas Besonderes zum (biologischen) Leben bei. Das ist nicht der Fall." Daher ist es nicht zu begründen, warum ausgerechnet der Ausfall der zentralnervösen Steuerung unersetzlich für das Leben sein soll, während andere Ausfälle bis hin zum vollständigen Ersatz lebensnotwendiger Organe (Nierendialyse, Herz-Lungen-Maschine) als mit dem Leben vereinbar gilt." Es bleibt also bei der schon auf den römischen Arzt Galenus zurückgehenden Erkenntnis "tres sunt atria mortis", nämlich der gemeinsame Ausfall von Herz, Lunge und Gehirn. Eine unmögliche oder fehlgeschlagene Wiederbelebung des Herzens im Sinne eines "Nicht mehr in Gang bringen Könnens" des Kreislaufs und damit des Organismus als funktionaler Einheit kann man nach dem derzeitigen Wissenstand etwa nach 15-30 Minuten nach dem Atemstopp annehmen. Schlägt man dem noch einen Sicherheitsabstand von weiteren 30 Minuten zu, so kann man nunmehr auch biologisch sagen, dass der betreffende Mensch tot sei. Verzichtet man hierauf, so beschreibt man einen Tod, den nur Menschen (vielleicht noch Schimpansen, Delphine u.ä.) sterben können. Ein Regenwurm ohne geistiges Dasein aber kann einen Tod durch Verlust seiner personalen Identität nicht sterben und umgekehrt wäre ein irreversibel Bewusstloser einen solchen Tod schon gestorben. Sieht man dies, so wird die Parallele der Hirntodtheorie mit dem biologischen Tod jedoch als "Verdrängungs-Rhetorik" oder als eine "auf einer Kategorienverwechslung beruhende petitio principii", also als ein klassischer Zirkelschluss entlarvt und damit die "erkenntnistheoretische Todsünde" begangen, die "ebenso banale wie basale juristische Unterscheidung von Sein und Sollen" zu verkennen. Semantisch ist der Versuch, das Hirntodkriterium nur als Todeszeichen und nicht als Todesdefinition auszugeben, gleichzusetzen mit der inneren Logik des Satzes: "Der nachgewiesene Hirntod ist das sichere Todeszeichen für den eingetretenen Tod des Menschen, aber er ist nicht der Tod des Menschen, obwohl der Mensch mit diagnostiziertem Hirntod tot ist." Das also soll die "denkbar unkomplizierte Botschaft" des Hirntodkonzeptes sein? Insoweit ist es sicherlich auch bemerkenswert, dass die Väter des Hirntodkonzeptes, eine Kommission der Harvard Medical School, im Jahre 1968 bei der Propagierung dieses Konzeptes keine biologische Begründung für die Notwendigkeit einer solchen neuen Todesdefinition angaben. Als Gründe wurden vielmehr nur die "Entlastung der hirngeschädigten Patienten und ihrer Familien und der Versorgungskapazitäten" sowie die Möglichkeit "der Beschaffung von Organen zu Transplantationen" genannt. Denn zur Organverpflanzung eignen sich nur "lebensfrische" Organe, die also nur einer ganz kurzen Ischämiezeit ausgesetzt waren. Ob eine solche "is-need-Argumentation" zur Schaffung einer neuen Todesdefinition wirklich hinreichend sein kann, muss wohl füglich bezweifelt werden. Zwar ist die eindeutige Zweckbezogenheit des Hirntod-Kriteriums noch kein Beweis für seine Unrichtigkeit, doch zeigt dies, dass spätere Begründungsansätze einer besonderen Prüfung bedürfen. Denn das Ziehen der Trennlinie zwischen Leben und Tod ist eben nicht beliebig, sondern liegt außerhalb der Kontingenz individueller wie auch kollektiver Entscheidungsbefugnis. Gerade aufgrund der "historischen Begründungsschuld" der Väter des Hirntodkonzeptes, die schon damals eindringlich von Hans Jonas aufgedeckt und gebrandmarkt und bis heute nicht zufriedenstellend nachgeholt wurde, muss vielmehr richtig sein und bleiben, was die Bundesärztekammer selbst mit Blick auf sogenannte Teilhirntodkonzepte stetig betont: es "muss auf die notwendige biologische Basis des Menschen selbst verwiesen werden, wenn es gilt, wertfrei und nicht manipulierbar festzustellen, ob ein Mensch lebt oder nicht." Diese biologische Basis aber ist und bleibt der endgültige Herz-Kreislaufstillstand sowie der Funktionsverlust des Zentralnervensystems. Tod und Leben sind als ontologische Apriori in letzter Konsequenz nicht von dieser Welt, d.h. nicht vom Menschen gemacht. Im Unterschied zu einem bloßen Todeszeichen umschreibt das Hirntodkonzept keinen biologischen Tod, sondern bestimmt die biologische Faktizität des Todes selbst neu, ist also nicht Todeszeichen, sondern Todes(neu)definition. Deshalb auch zeigt das Hirntodkonzept eine Dimension der Manipulierbarkeit des Todes auf, deren Konsequenz ein Substanzverlust verbindlicher sittlicher Grundwerte gegenüber dem menschlichen Leben schlechthin ist. Zudem ist ein gewisser Selbstwiderspruch nicht zu übersehen. Stellt das gesamte Hirntodkonzept doch wesentlich auf den irreversiblen Ausfall des Gehirns als "unersetzliche physische Voraussetzung des menschlichen Gefühls- und Geisteslebens" ab, werden andererseits aber ausdrücklich irreversibel Komatöse und anenzephale Kinder zu Recht zu den lebenden Menschen gerechnet, obwohl das "für den Menschen charakteristische bewusste Leben" auch bei diesen Patientengruppen bereits irreversibel erloschen oder nie entstanden ist. Gerade das apallische Syndrom wird als "Zustand vegetativer Lebendigkeit" ausgewiesen. Diese Menschen leben ohne die an sich doch unersetzliche physische Voraussetzung eines Gefühls- und Geisteslebens und man ist sich einig, dass sie leben! Dies aber hat mit der das Hirntodkonzept an sich charakterisierenden Basis des Gehirns als Voraussetzung allen Gefühls- und Geisteslebens nichts mehr zu tun. 2. Sterbeprozess als Teil des Lebens Inzwischen ist auch allgemein bekannt und konsentiert, dass das Sterben ein Prozess, ein Vorgang in der Zeit ist. Nach einer im Vordringen befindlichen Auffassung beinhaltet das Hirntodkriterium nur, dass es sich bei diesen Patienten um irreversibel auf dem Weg in den Tod befindliche Sterbende handelt, die durch intensivmedizinisches Eingreifen "in ihrem Sterben aufgehalten" wurden, ohne dass die Ärzte dieses Sterben verhindern können. Demzufolge bedeutet der Ausfall wesentlicher Gehirntätigkeiten nur eine Station auf dem Weg des Sterbens, aber nicht dessen entscheidende Zäsur, sein Ende. Vielmehr ist gerade auch der Sterbeprozess "ein existentieller Teil des menschlichen Daseins". Richtigerweise ist das Hirntodkriterium daher nur geeignet, die Unumkehrbarkeit des Sterbeprozesses zu belegen und damit die ärztliche Behandlungspflicht im Sinne eines Versuchs des Todesaufschubs enden zu lassen. In dieser Bedeutung als Behandlungsgrenze dürfte das Hirntodkriterium heute allgemeine Zustimmung finden. Alles Weitergehende aber ist zu Recht als "problemverdrängende begriffsmanipulatorische Schutzbereichsreduktion" des Rechtsgutes Leben bezeichnet worden, durch die der Tod umdefiniert und vorverlegt wird, um eine medizinische Hochtechnologie durch "moralphilosophische Aufhebung des Tötungsverbotes" zu ermöglichen. In gewissem Sinne löst man den Tod damit von dem sterbenden Menschen ab, wodurch das Hirntodkriterium "einen zielgerichteten strategischen Charakter annimmt". Es ist unbestreitbar, dass beim Hirntoten die Funktionen der übrigen Organe, soweit sie nicht anderweitig Schaden genommen haben, erhalten bleiben, ja die Vitalität von Herz, Lunge, Leber, Nieren und Pankreas ist ja die Grundvoraussetzung ihrer Transplantation. Dies kann auch nicht dadurch umgangen werden, dass man ausführt, der "Tod des Menschen bedeute nicht notwendig gleichzeitig den Tod jedes menschlichen Körperteils". So richtig es ist, einerseits nicht auf den endgültigen Gewebs- und Zelluntergang aller Zellen des menschlichen Organismus abzustellen, sowenig führen Organe eine isolierte "Separatexistenz", sondern stehen in untrennbarer Wechselwirkung mit dem Ganzen eines Organismus. Denn eines bleibt in jedem Falle festzuhalten: auch der irreversible Ausfall aller Groß-, Klein- und Stammhirnfunktionen hindern nicht daran, dass diese Menschen spinale Reflexe aufweisen, Blutdruck und spontane Herztätigkeit haben, eine innere Atmung stattfindet, künstliche Ernährung assimiliert wird und Körperausscheidungen vor sich gehen, bei falscher Ernährung Durchfall oder Verstopfung auftreten und die Blutbildung und -gerinnung ebenso funktioniert wie bestimmte Stoffwechselvorgänge und Hormonbildungen bzw. Ausscheidungen. Wunden, Knochenbrüche und selbst Krankheiten wie Lungenentzündung bei Hirntoten können heilen. Leichen aber können nicht erkranken - Krankheit bezeugt Vitalität! Medizinisch nachgewiesen sind auch ein proportionales Körperwachstum bei drei und eine sexuelle Reifung bei zwei hirntoten Kindern und ebenso in zwei Fällen ein Diabetes insipidus trotz festgestelltem Hirntod. Ebenso können diese Menschen unkoordinierte vegetative Reaktionen wie Hautrötungen oder Muskelkontraktionen zeigen und sogar schwitzen - und es sind sogar komplexe Bewegungen von Hirntoten nachgewiesen. All diese Phänomene beschreibt die Biologie zutreffend als zum Leben gehörig; Leichen können all das nicht. Und werden diese Menschen einer Operation, beispielsweise zur Organentnahme unterzogen, so zeigen sie typische vegetative Reaktionen, wie jeder Mensch sie unter derartigen Bedingungen zeigt. So bewirkt der Hautschnitt des Chirurgen einen unbewusst erlebten Schmerz, der Puls beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, die Muskulatur wird angespannt und die Hormonausschüttung um ein Vielfaches gesteigert. Auch dies alles gehört phänomenologisch zweifelsfrei zum Bereich des Lebens. Gerade aus diesem Grunde werden den "Hirntoten" die Organe unter Vollnarkose entnommen - obwohl sie doch tot sein sollen. Und ein Letztes: in diesen Menschen kann sich ein Embryo bis zur Lebensfähigkeit entwickeln, wie etwa das 1991 in der Filderklinik geborene und heute gesund lebende Kind ebenso beweist wie der spektakuläre Fall der Marion Ploch in Erlangen 1992, bei dem es allerdings zu einem Spontanabortus gekommen ist. Ist nicht "die Entwicklung eines Kindes im Mutterleib eine der wundervollsten, höchst integrativen Lebenserscheinungen, die wir kennen?" Schließlich ist es ja gerade "dieses viele Leben", das die "partikularistische eindimensionale Zerebralideologie" des Hirntotkriteriums für die Organspende so interessant macht. Und da der Tod biologisch und damit auch medizinischnaturwissenschaftlich nicht als etwas Eigenständiges, sondern nur vom Leben her, als dessen Ende bestimmt werden kann, Leben seinerseits aber ebensowenig begrifflich festgelegt, sondern anhand seiner Merkmale beschrieben werden muss, zeigen all diese Symptome des Lebens, dass das Hirntodkriterium nicht den Tod, sondern nur einen zum Leben gehörigen Sterbeprozess beschreibt. Außer Betracht gelassen wird sonst nämlich "die Einheit von Leib, Seele und Geist, als die der Mensch lebt". Selbst Hirntodtheoretiker sprechen hier von einem "Zustand vegetativer Lebendigkeit". Generell bedeutet ein Verlust wesentlicher Bedingungen des eigenständigen körperlichen Lebens noch nicht den Verlust des Lebens selbst, sondern nur den der eigenständigen Lebensfähigkeit. Und man macht es sich sehr einfach, das "Unbehagen", das sich einstellt, wenn man so vielen sichtbaren Zeichen von Leben einen hochtechnisierten Todesbegriff entgegenstellen will, damit abzutun, dass "dieser bloß vegetative Restbestand menschlichen Lebens kein Mensch mehr" sei und es sich bei derartiger Argumentation nur um emotional-psychische Argumente oder um ein "Verständnisproblem" handele, die einer rationalen Anerkennung der Hirntodtheorie nicht entgegengehalten werden können. Offen bleibt, was bitte dieser vegetative Restbestand anderes sein soll als das verlöschende Leben eines schwerstgeschädigten Menschen. 3. "Todesnähe" Zugleich gilt es mit einem zweiten Vorurteil aufzuräumen. So wenig der Hirntote schon biologisch tot ist, so unsicher ist auch das immer weder vorgebrachte Kriterium der unmittelbaren Todesnähe. Zwar ist der Prozess des Sterbens mit dem Eintritt des "Hirntodes" endgültig unumkehrbar geworden, aber eine unmittelbare Todesnähe muss damit nicht einhergehen. So hat der amerikanische Neurologe Alan Shewmon in einer Studie über die Hirntodfälle von 1966 bis 1997 anhand von medizinisch klar analysierten Fällen festgestellt, dass in sehr vielen Fällen Überlebenszeiten von mindestens einer Woche bekannt sind, gerade weil die anfänglich mit dem Hirntod einhergehende Kreislauf-Instabilität mit zunehmender Dauer dieses Zustandes vom Körper unter Steuerung des vegetativen Nervensystems selbst kompensiert wird. In 50% der nachgewiesenen Fälle konnte Shewmon "Überlebenszeiten" von mehr als einem Monat feststellen, die längste nachgewiesene Zeit im Anschluss an eine gesicherte Hirntotdiagnose betrug sogar 14,5 Jahre! So konnten Hirntote schon aus den Intensivstationen in Pflegeheime verlegt und in einem Falle sogar nach Hause "entlassen" werden. 4. Hirntod als eigenständiger Prozess Doch schon die obige Darstellung des Hirntodkriteriums hat gezeigt, dass auch der Hirntod selbst entgegen einer landläufigen Vorstellung kein auf die Sekunde oder auch nur auf Minuten genau zu bestimmender Einschnitt im Sterbeprozess ist, sondern ebenfalls in sich wiederum - wie das Sterben selbst - einen Verlauf darstellt. Da somit "beim Hirntod der wirkliche Zeitpunkt des Eintritt des Todes nicht eindeutig feststellbar ist, wird der Zeitpunkt, zu welchem die endgültigen diagnostischen Feststellungen getroffen werden (als Todeszeitpunkt) dokumentiert." Dieser so beschriebene totale Hirninfarkt, den man auch als Hirntod bezeichnet, gleicht damit selbst mehr einer schwerwiegenden Erkrankung als einer feststehenden Zäsur des Sterbeprozesses. Somit fehlt es bei diesem Todeskriterium also nicht nur an der Todesnähe, einer ersten Todesbedingung, sondern ebenso auch an der zweiten wesentlichen Todesbedingungen, der Ereignishaftigkeit, also der Fähigkeit zur Festlegung eines Todeszeitpunktes. 5. Lebenswertdiskussion Ein weiteres gilt es als gewichtig zu beachten. Der Mensch büßt - das ist an sich anerkannt - seine rechtliche Schutzwürdigkeit nicht dadurch ein, dass er bestimmten kognitiven oder psychischen Leistungskriterien nicht (mehr) entspricht oder ein "körperlich selbstorganisierter autonomer Lebenszustand" nicht mehr erreichbar erscheint. Aus dem Grundsatz des absoluten Lebensschutzes in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG folgt, dass auch das Leben des unheilbar Kranken, des Sterbenden zu achten ist und dass es dabei auf Lebensfähigkeit, Lebenserwartung, Überlebenschance und Lebensinteresse des Einzelnen nicht ankommt. "Menschliches Leben ist absolut erhaltungswürdig." Ausdrücklich führt das Bundesverfassungsgericht hierzu aus, dass "die für die menschliche Persönlichkeit spezifischen Bewusstseinsphänomene" oder eine in diesem Sinne "ausgebildete Personalität" für den Lebensbegriff des Art. 2 Abs. 2 GG nicht nötig sind. Eine Definition menschlichen Lebens, die sich an der Fähigkeit zu Bewusstseinsäußerungen orientiert, ist daher von Verfassungs wegen unhaltbar, zumal der Bewusstseinsbegriff weder inhaltlich geklärt noch ein solches oder dessen Fehlen naturwissenschaftlich exakt nachweisbar ist. Menschsein ist von unserer Verfassung "nicht exklusiv, sondern inklusiv konzeptualisiert"; jedwede Einschränkung des grundlegenden Status des allgemeinen Mensch-Seins soll ausgeschlossen sein. Das Grundrecht auf Leben wird so zum "Urrecht des Individuums". Dasselbe muss dann aber entsprechend auch für die Todesdefinition Geltung erhalten und behalten. Daher ist ein Hirntodkonzept auch mit dieser Prämisse nicht zu vereinbaren, will man nicht eine Tür öffnen hin zu technisch-utilitaristischen Todesdefinitionen. Auch insoweit muss man sich über die gerade auch rechtliche wie ethische Bedeutung klarwerden, die es bedeutet, den Tod nicht mehr festzustellen, sondern zu definieren. Man muss deshalb nicht sofort vom "Untergang der Moral" sprechen, kann sich aber der ethischen Verantwortung auch nicht mit dem Hinweis auf bloß emotionale Bedenken so einfach entziehen. Vielfach wird deshalb versucht, diese Abstufung an Lebensqualität nicht mehr unmittelbar mit dem Menschen in Beziehung zu setzen, sondern hierfür den moralethischen Kunstbegriff der "Person" einzufügen. Dieser auf die heute als verfehlt festgestellte anthropologische Grundkonzeption des Aristoteles zurückgehende "Ehrentitel" soll solchen Menschen zukommen, die bestimmte kognitive Eigenschaften erfüllen und wird vor allem dem ungeborenen Leben, aber auch komatösen Menschen und eben den Hirntoten gerne abgesprochen, als komme diesen nicht derselbe moralische Status wie anderen Menschen zu. Person sei der Mensch "als erlebendes und handelndes Ich", Selbstbewusstsein wird "als Signatur des Humanum" gedeutet. Mit dieser "philosophischen Korrumpierung der medizinischen Technik" kehrt der frühere Leib-Seele-Dualismus nunmehr in Gestalt eines Körper-Gehirn-Dualismus zurück und meint damit die alte philosophische Grundfrage "Was ist der Mensch?" umgehen zu können. Man spricht dann nicht mehr vom biologischen Tod, sondern vom "Tod des Menschen als Person in dieser Welt". Gegen solche Versuche, das Personsein als Auszeichnung der menschlichen Spezies zu etablieren und damit innerhalb des Menschseins einschneidende moralische Grenzen zu ziehen, muss von Anfang an und gerade auch in der aktuellen bioethischen Debatte um die embryonalen Stammzellen angegangen werden. Auch hier erlaubt unsere Rechtsordnung "kein rechtlich relevantes Urteil über den Wert fremden Lebens". Dies wurde bereits eindrücklich in der Formel ausgedrückt "Person ist der Mensch selbst, nicht ein bestimmter Zustand des Menschen". Spiegelbildlich taucht hier nun auch am Lebensende der gefährliche und zurückzuweisende, die Biologie des Lebens entstellende Versuch wieder auf, der schon bei der im Ergebnis fatalen Abtreibungsdebatte in die Irre geführt hat, nämlich zwischen verschiedenen Stadien der Menschwerdung bzw. nunmehr der Dehumanisierung unterscheiden zu wollen und den einzelnen evolutiven Stadien zum Teil oder in toto das Menschsein noch oder schon absprechen zu wollen. Beispielgebend spricht etwa Spittler von "dem gedankenleeren Spätstadium einer dementiellen Entwicklung" und schließt dem die Frage an, "was hat ein körperliches Überleben im Falle einer endgültigen und vollständigen Wahrnehmungs- und Kontaktunfähigkeit für einen Sinn?" Das so verbleibende Leben hat für diese Ansicht nur mehr den Status einer Zellkultur". Diesen Versuchen, unterschiedlich lebenswerte Stadien des Lebens oder "verschiedene Stufen des Todes" zu etablieren, gilt es sowohl am Anfang wie am Ende des menschlichen Lebensweges mit aller Deutlichkeit entgegenzutreten. "Der Mensch lebt, solange er stirbt" und die heute propagierte "Vergesellschaftung des Sterbenden unter dem medizinischen Primat des Lebens" ist als völlig inhuman abzulehnen. Es liegt dabei eine fatale Verwechslung von Bewusstsein und Leben vor, die es auch verbietet, von "Restleben eines Leichnams" zu sprechen. Der Todeseintritt ist eine eindimensionale und damit nicht steigerbare Größe; es gibt keinen Zustand "töter als tot". Der Schutz menschlichen Lebens, gerade wenn der Mensch besonders wehrlos ist, steht bei solchen verwirrenden Begriffsverwendungen - bei einer Aufspaltung und Trennung zwischen organischem Tod und personalem Tod - ansonsten auf dem Spiel. 6. In dubio pro vita Zumindest lässt sich aus all dem gerade deshalb, weil das Leben angesichts der Fortschritte der modernen Intensivmedizin zu einem "sumpfigen Teich mit einem breiten Ufersaum schattenhafter und vager Grenzen" geworden ist, als Minimum ableiten, dass die Richtigkeit des Hirntodkriteriums mit vernünftigen naturwissenschaftlichen und von der herrschenden Lehre nicht widerlegten Erkenntnissen angezweifelt werden kann. In diesem "Zwielicht des Zweifelhaften", dem festzustellenden Verlust an Klarheit über die Grenzen von Leben und Tod aber ist eingedenk der Tatsache, dass jede rechtliche Normierung da Entscheidungen trifft und "wirklich Maßgebliches" festlegt, wo Theologen und Philosophen noch Thesen aufstellen und diskutieren können, mit der Vermutungsregel des "in dubio pro vita" zu begegnen. Gerade hier gilt es das "menschliche Leben als Höchstwert unserer Verfassung" zur Geltung zu bringen. Dementsprechend sind namhafte Verfassungsrechtler inzwischen zu dem Ergebnis gelangt, "dass der hirntote Mensch im Grundrechtssinne lebt" und das Hirntodkriterium daher nicht den Tod eines Menschen, sondern nur die Irreversibilität und damit Endgültigkeit seines Sterbens dokumentiert. So gesehen bedeutet das Hirntodkriterium nichts anderes, als dass ein Mensch "an einem Punkt im Sterbeprozess, der definitiv zum Leben gehört, für tot erklärt wird". Wenn und weil dem aber so ist, schützt das Grundrecht auf Leben aus Art. 2 II 1 GG auch dieses Leben als bloße biologisch-physische Existenz als solche, ohne dass Bewertungen nach den Maßstäben irgendwelcher sozialer Lebensäußerungen möglich sein sollen. Diese Fassung des Lebensgrundrechts ist die normative Antwort der Verfassungsgeber auf die Erfahrungen der jüngeren deutschen Geschichte und stellt innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes einen Höchstwert dar. IV. Konsequenzen für die Transplantationsmedizin 1. Grundthese Vielleicht liegt mit der Suche nach der Berechtigung des Hirntodkriteriums eine unsere Erkenntnisfähigkeit übersteigende Verwechslung von Bewusstsein und Leben vor - gerade die vorhandene Literatur über sogenannte Nah-Tod-Erfahrungen sollte uns in Hinblick auf mögliche Bewusstseinsformen außerhalb unseres aktuellen Wahrnehmungskreises sehr vorsichtig stimmen und aufzeigen, dass es in diesem sensiblen Bereich einfache Wahrheiten nicht gibt. Jedenfalls zeigt dies alles die spürbare Gewissheit, dass an dem Hirntodkonzept ernsthafte Zweifel bestehen, die auch denen Respekt abverlangen, die aus ebenfalls beachtlichen Gründen an diesem Kriterium zumindest als Organentnahmevoraussetzung im Transplantationsrecht festhalten wollen. Zwar beschäftigen sich diese Ausführungen nicht mit der Organtransplantation als solcher, doch hat die oben eingenommene Stellung zum sogenannten Hirntod selbstverständlich ethische wie rechtliche Auswirkungen auf die aktuelle Transplantationsmedizin. "So rein" das Interesse an der Organerhaltung zur Rettung anderer Leben an sich auch sein mag, so beeinträchtigt diese Zielgerichtetheit doch den Versuch einer objektiven Definition des Todes; er gerät vielmehr im Interesse der Transplantationsmedizin zur Verhandlungssache - und das kann und darf nicht sein. Daher muss die Berechtigung des Hirntodkonzeptes unabhängig von den Möglichkeiten der Organverpflanzung beantwortet werden. 2. Persönliches Einwilligungserfordernis Konsequenz dieser Sichtweise des Hirntodkriteriums muss es für die Transplantationsmedizin jedenfalls sein, dass der Betroffene dem Abbruch seines Sterbeprozesses, d.h. der Opferung der Reststrecke seines Lebens und vor allem der Integrität seines Sterbens vorab in einer individualethischen Entscheidung persönlich zugestimmt hat - hier kann es keine erweiterte Zustimmungslösung in Gestalt einer Drittentscheidung der Angehörigen über das Leben eines anderen geben, denn "menschliche Organe sind nicht sozialpflichtig" und "der Mensch verliert sein Leben nicht aufgrund einer Hirntod-Definition". Dies ergibt sich auch schon daraus, dass der Hirntod als Behandlungsgrenze anerkannt und akzeptiert ist, so dass die Fortsetzung einer funktionserhaltenden künstlichen Beatmung nicht mehr von der Einwilligung in die lebensrettende Behandlung gerechtfertigt wird, da eine solche Rettung mit dem endgültigen Hirnausfall nicht mehr möglich, der Prozess des unumkehrbaren Sterbens eingesetzt hat. Dann aber stellt sich die weitere Fortsetzung der künstlichen Beatmung nur zur Organerhaltung als eine rein fremdnützige medizinische Behandlung dar, die der höchstpersönlichen Einwilligung des Betroffenen bedarf, will man diesen nicht zum puren Objekt fremder Interessen degradieren und damit seine Menschenwürde verletzen. Dass diese enge Zustimmungslösung den Organbedarf vielleicht nicht befriedigen wird, rechtfertigt den Verzicht auf die persönliche Einwilligung des Spenders trotz aller segensreichen Erfolge der Transplantationsmedizin nicht, zumal die Zahlen mit der erweiterten Zustimmungslösung belegen, dass auch seitens der nahen Angehörigen diese Zustimmung in der konkreten Sterbesituation nicht leichter zu bekommen ist. Auch hier darf "die gute Absicht", das lobenswerte Ziel die rechtliche Fragwürdigkeit der einzusetzenden Mittel nicht beiseite schieben; auch hier kann der Zweck die Mittel nicht heiligen. Dies gilt es einem fragwürdigen Zeitgeist entgegenzusetzen, in dem scheinbar viele dazu bereit scheinen, Verfügungen über - ja selbst Opfer an menschlichem Leben dann zuzulassen, wenn die Heilung von Krankheiten in Aussicht gestellt wird, wie es gerade die jüngste Debatte um die embryonale Stammzellforschung erneut offenbart hat. Auch hier hat sich gezeigt, dass das Festhalten an althergebrachten Werten vielen als Intoleranz gegenüber dem wissenschaftlichem Fortschrittsdenken erscheint. Nur diese hier vertretene Sichtweise sichert auch, dass der Hirntote wirklich ein Organ"spender" und kein Eingriffsopfer ist. Dies gilt es besonders angesichts vielfältiger Versuche in der Transplantationsmedizin zu betonen, die auch solche Patienten schon für tot erklärt sehen wollen, bei denen nur Teilfunktionen des Gehirns, insbesondere die personalitätsrelevanten Gehirnareale wie insbesondere das Großhirn, ausgesetzt haben, insbesondere wenn das Bewusstsein unwiederbringlich verloren scheint. 3. Problem des § 216 StGB Selbst mit der Einwilligung des Organspenders bleibt in diesen Fällen jedoch zu thematisieren, warum in diesem besonderen Fall eine Abkehr, d.h. Aufhebung des grundsätzlichen ärztlichen Tötungsverbotes, wie es sich insbesondere auch in der Strafbarkeit einer Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB ausdrückt, gerechtfertigt sein sollte. Denn es ist in jedem Falle unzutreffend, die Organentnahme bei einem Sterbenden, die dessen direkten Tod zur Folge hat, als Fall der bloßen Einstellung einer vergeblich gewordenen Behandlung zu klassifizieren und damit strafrechtlich im Bereich der Kausalitätslehren anzusiedeln. Hilfreicher, wenngleich ebenfalls noch fragwürdig ist der grundrechtsdogmatische Aspekt, insbesondere auch Art. 2 Abs. 2 GG als Freiheitsgrundrecht ernst zu nehmen und damit das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen als wirkliches Schutzgut anzusehen und auch § 216 StGB in diesem Sinne - also quasi verfassungskonform - auszulegen. Will man so durch § 216 StGB also die "Freiwilligkeit des Schutzverzichts auf das eigene Leben" als Schutzgut bewerten und bei gesicherter Freiwilligkeit der Entscheidung, die bei entsprechender Vorausverfügung des Betroffenen mit dem Eintritt des Hirntodes mangels Bewusstseins auch irreversibel geworden ist, mag es zwar m.E. sehr gekünstelt, aber doch möglich erscheinen, die Einwilligung zur Organentnahme bei festgestelltem irreversiblem Hirnausfall aus dem Anwendungsbereich des § 216 StGB auszunehmen. Der Betroffene verzichtet damit "ungestörtes Zuendegehen seines unwiderruflich endenden Lebens", "spendet" also die Integrität des Sterbeprozesses zugunsten der Ermöglichung einer Organtransplantation. Doch selbst mit einer solchen dogmatisierten Auslegung des § 216 StGB muss man sich ungeschönt klarmachen, dass diese Zulassung des Einwilligungsvorbehalts bei der Auseinandersetzung um das Hirntodkriterium unmittelbar auch den bioethischen Problembereich von Sterbehilfe und Euthanasie berührt. Deshalb auch gibt es viele und inhaltlich durchaus beachtliche Stimmen, die mit eben dieser Argumentation den Hirntod auch als bloßes Entnahmekriterium im Sinne des Transplantationsrechts ablehnen, gerade weil man Leben um des Leben selbst willen auch bei ausdrücklicher und ernsthafter Einwilligung des Betroffenen in dessen Beendigung zu schützen habe, wie auch die Strafnorm des § 216 StGB zeige. Die Gefahr, diese Sperre zu durchbrechen, also Leben verfügbar zu machen und zwischen Leben und Tod eine - je nach Sichtweise noch oder nicht mehr zum Leben zu rechnende besondere Explantationsphase zwischen Hirntod und Tod anzuerkennen, ist jedenfalls groß. Der "Alles-oder-Nichts"-Schutz des Lebens ist kein Feld für Konkordanzlehren. Nicht völlig zu Unrecht wird daher auch eine enge Zustimmungslösung im Transplantationsrecht als eine "zweckspezifische Tötungslizenz in gesellschaftlichem Auftrag" bezeichnet. Zumindest "eine gewisse Inkonsequenz" ist der Ansicht, die bei Hirntoten mit deren ausdrücklicher Einwilligung eine Organentnahme zulassen will, daher nicht abzustreiten und kann auch durch noch so hohe formale Hürden wie etwa die Forderung nach einer eigenhändigen schriftlich fixierten Fassung der Einwilligung nicht beseitigt werden. Es liegt einem hier der Begriff des "Opfer-Todes" auf der Zunge. Selbst ein Peter Singer, der Leben durchaus als verfügbare Größe begreifen will, stellt nüchtern fest, dass das Hirntodkriterium wohl deshalb seinen Siegeszug antreten konnte, weil Hirntote selbst nichts gegen ihre Todeserklärung einwenden können und alle anderen an diesem Tod profitieren, sei es durch entfallende Pflegemühen, sei es als aktueller oder potentieller Organempfänger, sei es als Maßnahme der Kostenreduktion in Krankenhäusern und gesetzlichen oder privaten Kostenträgern, sei es als Steuerzahler oder letztlich auch als Mensch, der fürchtet, selbst einmal am Beatmungsgerät "am Sterben gehindert" zu werden. Hier gilt es daran zu erinnern, dass "gerade deshalb besondere Sorgfalt geboten und notwendig ist und dem Satz des Philosophen Hans Jonas zu folgen, wonach "das Verscheiden eines Menschen von Pietät umhegt und vor Ausbeutung geschützt sein sollte". Denn angesichts des kognitiven Niemandslandes im Grenzbereich von Leben und Tod kann niemand, der eine Wand des Lebensschutzgebäudes beseitigt, ganz sicher sein, dass er damit nicht eine tragende Wand trifft. Die Ansicht, den Hirntoten einerseits als Lebenden anzusehen, aber dennoch den Hirntod als Entnahmekriterium zuzulassen, erinnert etwas an den makabren Satz, zwar ist der Hirntote nicht ganz tot, aber doch schon so viel tot, dass ihm Organe entnommen werden dürfen. "Jeder wird nun zu überlegen haben, ob er sich durch schriftlichen Widerspruch dagegen sichert, dass er am ungestörten Sterben gehindert wird und ihm während des Sterbens Organe entnommen werden, falls ein Angehöriger zustimmt." 4. Tod von Rechts wegen Misslich an der Regelung des TPG ist darüber hinaus in jedem Falle, dass hinsichtlich aller anderen, also der nicht vermittlungspflichtigen Organe auch im TPG am traditionellen Todeskriterium des irreversiblen Herz-Kreislaufstillstandes festgehalten wurde, so dass sich in diesem einen Gesetz zwei unterschiedliche Todeszeitpunkte finden und festzustellen bleibt, dass es auch hier dem Gesetzgeber nicht gelungen ist, sich auf eine Regelung festzulegen, nach der der Mensch "jedenfalls von Rechts wegen" tot ist. Dies ist grundsätzlich abzulehnen, denn der existentiell so wichtige Todesbegriff sollte so bestimmt werden, "dass die Aussage "dieser Mensch ist tot" eindeutig ist und nicht nach Hinsichten. in denen ein Mensch tot ist, weiter differenziert werden muss". Das wird deutlich, wenn man sich die Stellungnahme des Chirurgen Peter Röttgen vor Augen führt, der meinte: "Ich bin dagegen, dass man nur das, was nun wirklich mausetot ist, als tot feststellt. Damit ist dem Totengräber geholfen, aber nicht dem Chirurgen, wenn er wirklich transplantieren will." Ein solcher Gedanke, es müsse für die Medizin einen anderen Todesbegriff geben als für Bestattungsunternehmen, bleibt abzulehnen. Denn "Leben und Tod sind einstellige, nichtrelationale Begriffe". Allenfalls ist es denkbar, den irreversiblen Ausfall aller Hirnströme als absolute Behandlungsgrenze und unter den soeben geäußerten Bedenken ggf. als Entnahmekriterium zur Organentnahme dann festzulegen, wenn der Organspender selbst dies zuvor so verfügt hatte. Darüber hinaus aber bleibt unmissverständlich festzuhalten, dass der Hirntod den Tod als ultimativen Zustand nicht selbst beschreibt, sondern einen unumkehrbaren Zustand darstellt, der uns berechtigt, den Tod ungehindert stattfinden zu lassen. Erlauben wir also den Hirntoten zu sterben, anstatt sie vorzeitig für tot zu erklären! ZfL – 02/1997 OLG Frankfurt a.M.: Eintritt des Erbfalls im Zeitpunkt des Hirntodes Beschluß vom 11.7.1997 – 20 W 254/95 Leitsätze: 1. Im Erbrecht ist als Todeszeitpunkt der Eintritt des Gesamthirntodes zu verstehen. 2. Ergeben die im Erbscheinverfahren angestellten Ermittlungen zur Überzeugung des Nachlaßrichters, daß der Erblasser früher als in der Sterbeurkunde angegeben gestorben ist, so ist der Nachweis der Unrichtigkeit des beurkundeten Todeszeitpunktes erbracht. 3. Nimmt die Ehefrau des Erblassers ihren begründeten Scheidungsantrag, dem der Erblasser zugestimmt hatte, vor dem Eintritt des Herz- und Kreislaufstillstandes, aber nach Eintritt des Herz- und Kreislaufstillstandes, aber nach Eintritt des Gesamthirntodes beim Erblasser zurück, so hat dies keinen Einfluß mehr auf die Anwendbarkeit des § 1933 S. 1 BGB. Zum Verfahren: Der im Jahre 1954 geborene Erblasser schloß im Jahre 1980 mit der Bet. zu 1 die Ehe, aus der die im Jahre 1985 geborene N (Bet. zu 2) hervorgegangen ist. Seit dem 1. 4. 1991 lebten die Eheleute getrennt. Die Bet. zu 2 reichte mit Schriftsau ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 4. 5. 1992 Scheidungsklage ein. Dieser ließ mit Schriftsatz seines Prozeßbevollmächtigten vom 15. 6. 1992 vortragen: "Der Ag. wird, da die Ast. die Scheidung begehrt, sich damit einverstanden erklären." Dessen ungeachtet versuchte der Erblasser im Herbst 1992 durch Einschaltung der beiderseitigen Prozeßbevollmächtigten für das Scheidungsverfahren, sich mit der Bet. zu 1 zu versöhnen und diese zur Rücknahme ihres Scheidungsantrages zu bewegen. Die Bet. zu 1 lehnte dies damals ab. Am 20. 2. 1993 erlitt der Erblasser einen Unfall, bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Wenige Stunden danach fiel er in tiefe Bewußtlosigkeit. Von diesem Zeitpunkt an bestanden klinische Zeichen einer schweren Funktionsstörung des Gehirns; Hornhautreflex und Schluckreflex waren nicht mehr auslösbar. Die Spontanatmung war ausgefallen, so daß er fortan künstlich beatmet werden mußte. Die Funktionen von Herz und Kreislauf mußten medikamentös gestützt werden, ohne daß sie künstlich aufrechterhalten wurden. Bei dem Erblasser stellten der Chefarzt M am 23. 2. 1993 und der Oberarzt S am 24. 2. 1993 die typischen Symptome des Ausfalls der Hirnfunktion fest. Am 25. 2. 1993 nahm die Bet. zu 1 ihren Scheidungsantrag zurück. Am 26. 2. 1993 kam es bei dem Erblasser zum Herzstillstand mit nachfolgendem biologischen Tod. Die Bet. zu 1 hat beantragt, ihr einen Erbschein des Inhalts zu erteilen, daß der Erblasser, der letztwillig nicht verfügt hat, von ihr und der Bet. zu 2 zu je 1/2 beerbt worden sei. Sie hat dazu eine Sterbeurkunde vorgelegt, in der es heißt, der Erblasser sei am 26. 2. 1993 gestorben. Die Rechtspflegerin des NachlaßG hat die Erteilung eines dem Antrag der Bet. zu 1 entsprechenden Erbscheins angekündigt, sofern nicht binnen zwei Wochen Erinnerung eingelegt werde, Der gegen diesen Beschluß von der Bet. zu 2 eingelegten Erinnerung haben die Rechtspflegerin und der Richter des NachlaßG nicht abgeholfen. Das LG hat den Vorbescheid des NachlaßG aufgehoben. Die weitere Beschwerde der Bet. zu 1 blieb erfolglos. Aus den Gründen: Im BGB findet sich keine Norm, die Kriterien dafür aufstellt, wann vom Eintritt des Todes eines Menschen auszugehen ist (Staudinger/ Weick/Habermann, BGB, 13. Aufl., Vorb. § 1 VerschG Rdnr. 3; Soergel/Stein, § 1922 Rdnr. 3, Leipold, in: MünchKomm, § 1922 Rdnr. 12). Die Frage, wann der Tod eingetreten ist, hat der Gesetzgeber als naturwissenschaftlich feststehend und daher nicht regelungsbedürftig angesehen (Palandt/Heinrichs, § 1 Rdnr. 3). Nach heute weithin herrschender Auffassung ist im Erbrecht in Übereinstimmung mit der medizinischen Wissenschaft und der Beurteilung in anderen Rechtsgebieten als Todeszeitpunkt der Eintritt des Gesamthirntodes zu verstehen (OLG Köln, NJW-RR 1992,1480 = FamRZ 1992,860 = DNotZ 1993, 171; AG Hersbruck, NJW 1992, 3245 = Fam- RZ 1992, 1471 mit Anm. Schwab; Gitter, in: MünchKomm, 3. Aufl., 6 1 Rdnr. 16; Palandt/Heinrichs. 6 1 Rdnr. 3;). Ihr schließt sich der Senat an. Mit dem Ausfall der Gesamtfunktion des Gehirns ist das Lebenszentrum des Menschen zerstört, seine individuelle Existenz erloschen. Bei völligem Ausfall auch des Hirnstamms kann mit Sicherheit auf die fehlende Erholungsfähigkeit erloschener Hirnfunktionen geschlossen werden. Das Hirntod-Kriterium ist im übrigen auch Grundlage des kürzlich im Bundestag verabschiedeten Transplantationsgesetzes (zu der Diskussion darüber vgl. auch Weber/Lejeune, NJW 1994, 2392; Höfling, JZ 1995, 26; Heun, JZ 1996, 213; Rixen, ZRP 1995, 461; Beckmann, ZRP 1996, 219; Wagner/Brocker, ZRP 1996, 226; Steffen, NJW 1997, 1619; Schreiber, FAZ vom 24. 2. 1997, S. 8). Abzulehnen ist der von Stimmen im Schrifttum gemachte Vorschlag, den Todesbegriff aufzuspalten und für das Zivilrecht, vor allem das Erbrecht auf den Herz- und Kreislaufstillstand abzustellen (Ennan/ Westexmann, § 1 Rdnr. 5; Jauernig, BGB, 7. Aufl., § 1 Anm. 2 b aa; Staudinger/Weick/ Habennann, Vorb. § 1 VerschG Rdnr, 8; Schreiber, JZ 1983, 593 [594]), Er erscheint unpraktikabel und könnte einen unerwünschten Anreiz dafür geben, eine Intensivbehandlung gerade um zivilrechtlicher Folgen willen länger fortzusetzen als aus medizinischen Gründen veranlaßt, Die Kriterien zur Feststellung des Hirntodes sind von medizinischer Seite hinreichend präzisiert worden. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer hat am 4. 2.1982 Entscheidungshilfen zur Feststellung des Hirntodes aufgestellt (abgedruckt bei Schreiber, JZ 1983, 593 [594]), die später ergänzt und fortgeschrieben wurden (vgl. die Nachw. bei Staudinger/ Weick/Habennann, Vorb. § 1 VerschG Rdnr. 6). Danach tritt der Hirntod ein beim vollständigen und irreversiblen Zusammenbruch der Gesamtfunktion des Gehirns, auch wenn dann Kreislauf und Atmung noch künstliche aufrechterhalten bleiben. Die Frage, ob diese Voraussetzungen gegeben sind, liegt im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Die Feststellung des LG, bei dem Erblasser hätten zwei Neurologen am 23. und 24.2.,1993 übereinstimmend die typischen Symptome des Ausfalls der Gehirnfunktion wahrgenommen, womit die Kriterien des Hirntodes erfüllt gewesen seien, kann das Gericht der weiteren Beschwerde nur daraufhin nachprüfen, ob der Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt und daher gegen § 12 FGG verstoßen wurde, ob die Vorschriften über die Form der Beweisaufnahme verletzt wurden und ob die Beweiswürdigung fehlerhaft ist (Keidel/ Kuntze, FGG, Teil A 13. Aufl., § 27 Rdnr. 42). Derartige Rechtsfehler liegen nicht vor. Das LG hat sich bei der Beurteilung des Zeitpunktes, in dem der Hirntod des Erblassers eingetreten ist, auf die beiden schriftlichen Auskünfte des Oberarztes R gestützt, der die Unterlagen über die Behandlung des Erblassers in dem Krankenhaus, in dem der Erblasser gestorben ist, ausgewertet hat. Dagegen ist nichts zu erinnern und wird auch von der weiteren Beschwerde nichts eingewendet. Das LG ist den Angaben des Oberarztes R aufgrund eigener Würdigung gefolgt. Die vom LG vorgenommene Würdigung dieser Angaben läßt keinen Rechtsfehler erkennen. ZfL 01/1999 Transplantationsgesetz Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Beschwerden gegen das Transplantationsgesetz einstimmig als unzulässig zurückgewiesen (Beschl. v. 28. 1. 1999 – 1 BvR 2261/98 und v. 18. 2. 1999 – 1 BvR 2156/98). Es fehle an einer Grundrechtsbetroffenheit der 254 Beschwerdeführer. Sie hatten gerügt, die postmortale Organentnahme mit Zustimmung Dritter (§ 4 TPG) und die »Hirntodlösung« verstoße gegen Art. 1 und Art. 2 GG. Die Richter hielten es demgegenüber für ausreichend, daß jeder der Möglichkeit einer Organentnahme widersprechen könne. Dieser Widerspruch kann nicht durch Dritte überspielt werden. Es sei nicht grundrechtswidrig, diesen Widerspruch erklären zu müssen. Noch nicht entschieden ist über Verfassungsbeschwerden gegen die Bestimmungen im Transplantationsgesetz, die eine Organentnahme bei lebenden Spendern betreffen (55 8, 19 TPG).