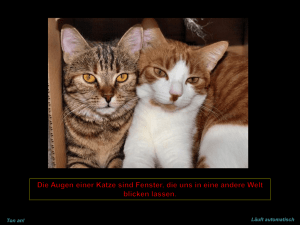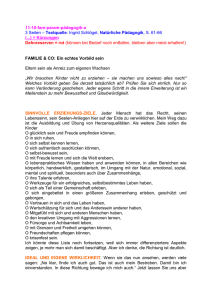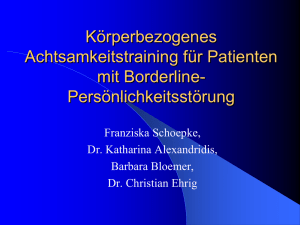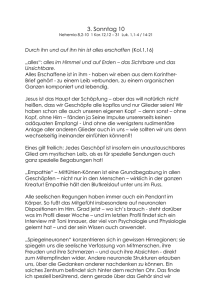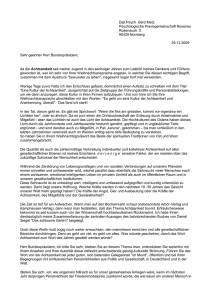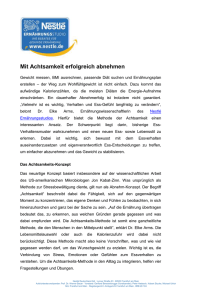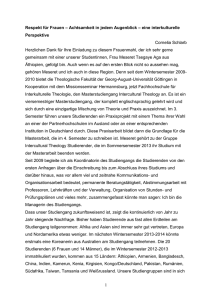Achtsamkeit und Mitgefuehl
Werbung

Trauma, Achtsamkeit und Mitgefühl Luise Reddemann Die Ausschnitte aus dem Film, den wir eben gesehen haben, zeigen ein traumatisiertes Kind. Der Junge wurde von seinem Vater im Stich gelassen, der ihn in einem Heim abgegeben hat mit dem Versprechen, sich zu melden. Das tat er aber nicht. Man kann dem Jungen ansehen, wie massiv er unter Stress steht. Sein Verhalten erscheint bizarr. Als Zuschauer hört man, dass er am Telefon eine Ansage hört, aber der Junge kann das nicht glauben. Auch im weiteren Verlauf des Films wird deutlich wie verstört dieses Kind ist und wie sehr es seine UMGEBUNG HERAUSFORDERT: Ich will zunächst darüber sprechen, was in der Psychotraumatologie als Trauma verstanden wird, um anschließend darüber nachzudenken, welche Arten von Achtsamkeit und Mitgefühl dem Umgang mit traumatisierten Menschen dienen könnten. Ich spreche hier als Ärztin und Psychotherapeutin und bitte Sie das von mir Beschriebene auf Ihre Gegebenheiten zu übertragen. Ich verstehe von Ihren Gegebenheiten nicht genug. Seit Freud versteht man unter einer traumatischen Erfahrung eine, die unsere normalen Fähigkeiten zur Anpassung überfordert. Weshalb sich vermutlich vor allem biologisch determinierte Schutzmechanismen ereignen, die sich ihrerseits im Lauf der Zeit „problematisch“ auswirken können. Wir sprechen u.a. von: Intrusion, Konstriktion, Übererregung und Dissoziation. Das kann man im Film sehr gut sehen: Der Junge ist einerseits fortwährend mit dem Verlust des Vaters beschäftigt, gleichzeitig schottet er sich ab, steht unter einem sehr hohen Stresspegel und ist „wie in einem anderen Film“, zumindest aus Sicht seiner Betreuer. Fischer und Riedesser sprechen von einem Diskrepanzerleben, das unsere Erwartungen ans Leben übersteigt. Das Leben kann nach einer traumatischen Erfahrung nie mehr sein, wie es vorher war. Hier im Film sahen wir ein Kind, das sich nicht mehr beruhigen kann. Den Verlust des Vaters kann der Junge nicht verstehen und nicht akzeptieren. 1 Schließlich kann man auch sehen, dass es sich hier um eine Erfahrung handelt, die gekennzeichnet ist von Ohnmacht und Panik und für Cyril geht es hier auf gewisse Weise um Leben und Tod, zumal er von seinen Betreuern nicht verstanden wird. Es ist klinisch wichtig, Folgen nach einmaligen und nach multiplen, komplexen Traumata zu unterscheiden. Das wird leider auch in der wissenschaftlichen Literatur nicht immer klar unterschieden. Von Menschen zugefügte Traumatisierungen wirken sich in der Regel gravierender – oft auch nachhaltiger! -aus als Naturkatastrophen u.ä. Die häufig zitierte posttraumatische Belastungsstörung (engl. PTSD, deutsch PTBS) beschreibt die Folgen einer Monotraumatisierung und sagt wenig oder nichts über komplexe Traumafolgestörungen. Somatisierung, Dissoziation und Affektdysregulation sind Hauptkomponenten der komplexen Traumatisierungen und deren Folgen und stehen in einer Korrelation zueinander. Im Film sind Affektdysreglation und Dissoziation erkennbar. Wir können fragen, Welche Entwicklungsmöglichkeiten bleiben einem Kind in einer Beziehungsmatrix, in der - Die Starken – aus Sicht des Kindes - tun, was sie wollen - Die Schwachen sich unterwerfen müssen - Wichtige Bezugspersonen sich absichtlich blind stellen - Das Kind bei niemandem – ausreichend - Schutz findet? Die zu Grunde liegenden Erlebnisse manifestieren sich, wenn die Traumatisierung von anderen Menschen zugefügt wurde, also hier vom Vater, innerhalb von Beziehungen, hier also dann auch innerhalb der Beziehung zu den Betreuern. Klinische Zuschreibungen und Diagnosen sollten stets mit Vorsicht vorgenommen werden und mit einem kritischen Bewusstsein. Noch immer sollte gelten, dass Reaktionen auf traumatische Erfahrungen nicht das Kranke sind, sondern die Erfahrungen an sich bedeuten ein Herausfallen aus dem, was wir alle normalerweise vom Leben erwarten. Ein Kind erwartet bewusst oder unbewusst, dass es von seinen Bezugspersonen nicht im Stich gelassen wird, geschieht es doch, ist das eine 2 seelische Katastrophe. Alles, was Cyril im Film anstellt, sind verzweifelte Versuche mit dieser nicht erwartbaren Situation umzugehen. Welche „inneren Modelle“ von Beziehung entwickelt ein so betroffenes Kind? Vor allem tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen Durch traumatische zwischenmenschliche Erfahrungen in der Kindheit wird die normale Fähigkeit zur Selbstregulation und zu autonomem Handeln je nach Resilienz mehr oder weniger außer Kraft gesetzt und auch im weiteren Leben reduziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in jeglicher (!) therapeutischen oder therapeutisch orientierten Beziehung alte Muster wiederholen, ist hoch! Begleitenden Menschen sollte klar sein, dass derart geschädigte Pat. Schwierigkeiten haben, sich eine Beziehung vorzustellen, die wirklich fürsorglich, frei gewählt und beiden Beteiligten gegenüber fair ist, damit zu rechnen, dass beide Partner aufeinander abgestimmt sind und die Beziehung für beide erfüllend ist. Wenn wir begleiten, ist der Aufbau einer sicheren Beziehung das Wichtigste. Wir können sie ermöglichen, indem wir bereit sind freundlich, Halt gebend und mitfühlend zu sein, zu erklären, wenn wir etwas tun, womit unser Gegenüber nicht rechnen kann. Falls erforderlich sollten wir bereit sein, uns zu entschuldigen und immer wieder zu zeigen, dass wir an einer tragfähigen Beziehung und deren Fortbestand interessiert sind. Eine hilfreiche Arbeitsbeziehung bedeutet, dass eine Verständigung über Ziele erfolgt und dass das Recht des Patienten/der Patientin auf „nein“ respektiert wird, so weit dies möglich ist. Es geht schließlich auch um die Entwicklung einer vertrauensvollen und vom Geist der Zusammenarbeit geprägten Arbeitsbeziehung. Dazu gehört die Entwicklung einer Fähigkeit zu beobachten oder auch zu mentalisieren aus einer Haltung der Achtsamkeit heraus. So lange wir selbst das nicht gut können und uns nicht ständig darum bemühen, macht es wenig Sinn, das von unseren PatientInnen oder KlientInnen zu fordern. 3 Im Film werden die Betreuer als Menschen dargestellt, die nicht bösartig sind, aber so gut wie nicht mitfühlend. Sie versuchen, die Dinge in den Griff zu bekommen, gehen aber nicht auf die Not des Kindes ein. Es lohnt sich immer, Stärken und Resilienz bei PatientInnen zu erkennen, weil dies den Aufbau einer therapeutischen Allianz fördert. So könnte z.B. die anhaltende Suche des Jungen nach seinem Vater durchaus auch als Stärke gewürdigt werden. Aufbau innerer Stabilität, die für den Patienten die Entwicklung von Selbstregulations- und Selbstberuhigungsfähigkeit bedeutet, wäre anzustreben und könnte z.B. im Film für Cyril Mitgefühl mit sich selbst ermöglichen. Der Junge im Film verhält sich allerdings in erster Linie panisch. Das hängt mit einem Phänomen zusammen, das als traumatischer Stress beschrieben wird, minimaler Stress wir als maximaler Stress erlebt und verarbeitet. Traumatisierte Menschen reagieren mit einem Bündel psychophysiologischer Reaktionen, die zunächst dazu dienen, dem Organismus zu helfen, mit einer überwältigenden Erfahrung fertig zu werden. Achtsamkeit im Fall eines solchen Kindes wie Cyril würde also zunächst bedeuten, dass Betreuer das Verhalten des Kindes nicht als Unart interpretieren und zu kontrollieren versuchen würden, sondern es einordnen könnten und womöglich erst einmal mitfühlend beantworten. Damit komme ich jetzt zum Stichwort Achtsamkeit. Dass Achtsamkeit immer mehr „in“ ist, kann man begrüßen und gleichzeitig infrage stellen. Warum? Weil das, was ursprünglich unter Achtsamkeit verstanden wird, immer mehr verwässert. Unter Achtsamkeit wird inzwischen häufig Aufmerksamkeit verstanden als einem Merken, was ist, ohne zu urteilen, das heißt, wir nehmen Phänomene einfach wahr, beobachten sie und bewerten sie nicht. Nur bemerken, was ist, ist manchmal hilfreich, aber selten heilsam in einem tieferen Sinn, schon gar nicht, wenn man schweres Gepäck mit sich herumschleppt. Die tiefere aus dem Buddhismus stammende Bedeutung bezieht sich auf Achtsamkeit aus einem Wunsch heraus, mitfühlendes und freundliches Denken, Fühlen und Handeln immer mehr – auch im Alltag- verfügbar zu haben. 4 Buddhisten geht es vor allem um Achtsamkeit, die rechte Achtsamkeit genannt wird. Hier geht es zwar auch um ein achtsames Wahrnehmen, aber eines das verbunden ist mit Mitgefühl, Freundlichkeit, Warmherzigkeit, Offenheit und Freude. Also um Achtsamkeit, die getragen ist von einer ethischen Grundhaltung und einem Bemühen um das so genannte „rechte Leben“, wie es in entsprechenden Empfehlungen beschrieben wird. Paul Grossman führt als Achtsamkeitsforscher aus, dass es in der Achtsamkeitsforschung momentan großen Enthusiasmus gebe, manchmal Übereifer, der viele Forscher anziehe. Aus seiner Sicht berge die euphorische Übernahme des Achtsamkeitskonzepts durch die westliche Psychologie eine Gefahr. Denn im buddhistischen Kontext beinhalte der Begriff Achtsamkeit stets einen ethischen Akt. „Es geht nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern auch um die Entfaltung von Mitgefühl und Offenheit. Diese ethische Komponente aber fällt in psychologischen Studien leicht unter den Tisch, weil ethische Einstellungen in der Psychologie sowieso kaum berücksichtigt werden und sie sich nur schwer operationalisieren und objektiv messen lassen.“ Dies genau erscheint mir ein wesentlicher Punkt: Man beschränkt sich auf das Messbare und lehrt und praktiziert es auch so. Darüber hinaus wollen westliche Menschen schnell etwas machen, also wird aus der Achtsamkeit dann etwas, was Stress reduzieren soll. Das ist natürlich keinesfalls falsch, aber es hat mit buddhistischer Achtsamkeit nicht mehr viel zu tun. Und wenn einem die Stressreduktion wichtiger ist als mitfühlende Anteilnahme, die ja auch eine Alternative sein kann, kann man traumatisierten Menschen nicht optimal helfen. Letztendlich beinhaltet Achtsamkeit eine bestimmte Lebenshaltung, die man schwer mit Fragebögen messen kann.….“ Paul Grossman beschreibt Achtsamkeit folgendermaßen und ich schließe mich seiner Beschreibung an: „Achtsamkeit heißt, … sich der Realität mit Offenheit, Mitgefühl, Toleranz, Geduld und Akzeptanz zuzuwenden– so gut es eben geht.“ „Es geht darum, das Leben in der Tiefe anzunehmen; sich den unvermeidbaren Aspekten des Lebens zuzuwenden. Diese Zuwendung zu oft schwierigen, schmerzlichen Erfahrungen kann nicht gelingen, ohne dabei ein gewisses Maß an Geduld, Gleichmut, Mitgefühl und sogar Mut zu entwickeln. Vor allem diese ethischen Qualitäten sind es, die dazu beitragen, sich selbst und anderen Menschen 5 offener und freundlicher zu begegnen. Und das kann sehr heilsam sein.“ (P.Grossman, Interview in die ZEIT, 22.10.2013) Auch der Dalai Lama hebt hervor, dass die ethische Dimension der Achtsamkeit im Buddhismus bei uns verloren gehe;bei uns habe die Achtsamkeit oft das Ziel, effizienter zu werden wie z.B. der Manager, der sich durch Achtsamkeitsübungen besser konzentrieren kann, wogegen wiederum nichts einzuwenden ist, aber der Dalai Lama weist darauf hin, dass auch ein Terrorist achtsam sei, ja, er müsse sogar achtsam sein in der Ausübung seiner Tätigkeit, und da sei Achtsamkeit natürlich auch nicht verbunden mit einer ethischen Dimension. Es dürfte nach dem bisher Gesagten klar sein, dass Achtsamkeit als Stressbewältigungsweg vermittelt, wenn man Heilsames bewirken will, nicht genügt. In meiner klinischen Praxis bin ich etlichen Menschen begegnet, die seit Jahren ja sogar Jahrzehnten Achtsamkeitsmeditation praktizierten, die aber immer, wenn das Leben ihnen schwierige Erfahrungen zumutete, völlig hilflos waren. Dies gilt vor allem für Menschen, die eine Traumageschichte haben. Jack Engler (2005, S.44f), der sich seit Jahrzehnten intensiv mit den buddhistischen Lehren beschäftigt, ist Gründungsmitglied der „Insight Meditation Society“ in Massachusetts und schreibt, dass spezifische Probleme wie z.B. früher Missbrauch und daraus folgende Persönlichkeitsstörungen spezifische Zuwendung sowie fortgesetzte persönliche, professionelle und sozialtherapeutische Unterstützung erfordern und nicht dadurch gelöst werden können, dass man die von Moment zu Moment auftauchenden Gedanken, Gefühle und das Körpererleben beobachtet. In der systematischen Buddhistischen Psychologie würden Depressionen oder psychiatrische Erkrankungen gar nicht erwähnt. Für buddhistische Lehrer aus Asien sei es vor Jahren neu gewesen, mit psychologischen Problemen von westlichen Praktizierenden in Kontakt zu kommen. Der Dalai Lama zeigte sich bei seinem ersten Besuch im Westen schockiert darüber, wie viel niedrigem Selbstwert und wie viel Selbsthass er bei westlichen Menschen begegnete. Meine Vermutung ist, dass die asiatischen buddhistischen Lehrer sich gar nicht vorstellen konnten, dass mit belasteten Menschen Achtsamkeit praktiziert wird und ohne Bezugnahme auf andere Übungen wie die der „Liebenden Güte“ oder für Mitgefühl, sowie Kräutermedizin, Massagen und Körperübungen. So betont der Dalai Lama in einem 6 Gespräch mit Paul Ekman, dass reguläre Achtsamkeitspraxis für Traumatisierte nicht geeignet sei. Denn das geduldige Erforschen immer tieferliegender Bewusstseinsinhalte, die uns daran hindern oder es uns auch ermöglichen, uns gemäß buddhistischer, aber sicher auch christlicher Ethik zu verhalten, ist das Ziel der Achtsamkeitspraxis. Dabei gehen Buddhisten von sehr feinen Bewußtseinszuständen aus, die die westliche Psychologie nicht kennt. Buddhisten würden das Erreichen normalen Elends anstatt neurotischen Elends, wie Freud das anstrebte, erst als Beginn der Reise ansehen. Dennoch kann ich mir vorstellen und habe es auch schon erfahren, dass wir PatientInnen erst dabei helfen, in sich mehr zur Ruhe zu kommen, sich nicht mehr vor innerem Schmerz zu fürchten, so dass dann auch Achtsamkeit im buddhistischen Sinn praktiziert werden kann. Ich will hervorheben, dass z.B. psychodynamische und humanistische Therapien ein relativ gutes Leben ermöglichen können. Ein sich freier fühlender Mensch mag selbst darauf kommen, dass ein „gutes Leben“ ohne ethische Grundhaltung nicht gelingt. Wie wenig Achtsamkeit, bei der es ausschließlich um Entspannung geht, bewirkt, will ich an einer Vignette erläutern. Eine Patientin berichtet mir emotional stark aufgewühlt von ihrer schwierigen Kindheit und wie sie diese auch jetzt noch stark belaste. Im Lauf des Gesprächs frage ich sie, ob es ihr möglich sei, dieses kindliche Ich in sich achtsam wahrzunehmen. Sie fragt, wie in der Meditation, und ich meine: ja. Da bricht es aus ihr heraus: Sie meditiere seit langer Zeit, während des Meditierens gehe es ihr gut, aber es helfe ihr im Alltag überhaupt nicht, außer, dass sie sich mit ihrer Meditation vorübergehend etwas beruhigen könne. Tatsächlich wirkt sie auf mich so, als stünde sie unter höchstem Stress. Solche und ähnliche Erfahrungen habe ich oft mit traumatisierten Menschen gemacht; bestenfalls können sie sich mit Achtsamkeitsarbeit vorübergehend beruhigen, aber sie hat keine nachhaltigen Folgen. Aus Sicht der buddhistischen Psychologie kann das so verstanden werden, dass sich in der von ihr praktizierten Art der Achtsamkeitspraxis kein Mitgefühl und keine Freundlichkeit mit ihr selbst entwickeln konnten. Vermutlich ist es so, dass Menschen, die relativ stabil sind, nicht zuletzt deshalb weil sie gute frühe Bindungserfahrungen gemacht haben, durch traditionelle Achtsamkeitspraxis ihr Mitgefühlspotential entdecken können. Menschen, die 7 traumatische Erfahrungen gemacht haben, vor allem in der frühen Kindheit, kommen eher im Umgang mit sich selbst – und später der Welt – weiter, wenn sie mit einer expliziten Praxis des Mitgefühls mit sich selbst beginnen. Sylvia Wetzel, meine buddhistische Lehrerin, spricht davon, dass westliche Menschen alles immer „richtig“ machen wollen und sich gerade deshalb viel zu viel anstrengen. Es gibt übrigens einen schönen relativ aktuellen Film, der das auf humorvolle Weise, ohne auf Buddhismus Bezug zu nehmen, thematisiert: „Ziemlich beste Freunde“. Da ist der gebildete Europäer mit seinen Verkrampfungen und andererseits der einfache Mann mit afrikanischen Wurzeln, der sehr unbekümmert meist Dinge tut, wie sie aus seinem Herzen kommen und auf raue Art mitfühlend ist. Damit komme ich zum Mitgefühl. Es ist jedenfalls nicht Empathie; dass die beiden Begriffe ständig synonym verwendet werden, trägt nicht zur Klarheit bei. Empathie ist Einfühlung, Mitgefühl hingegen Einfühlung und der Wunsch, etwas Heilsames zu bewirken. Man kann sich durchaus in andere einfühlen und nicht den Wusch haben, etwas Heilsames zu bewirken. Man kann sogar den Wunsch haben, dadurch dass man sich einfühlt, einem anderen zu schaden. Mit anderen Worten Einfühlung, also Empathie, ist nicht gerichtet, manche sagen auch, sie sei neutral. Diesen Begriff verwende ich nicht gerne, eben weil man mit Einfühlung sogar Unheil anrichten kann. Mitgefühl hingegen will etwas Heilsames und Liebevolles bewirken, also vielleicht z.B. Hoffnung im Sinn von Vertrauen und Zuflucht finden zu bewirken versuchen. Gänzlich fremd sind uns westlichen Menschen solche Gedanken natürlich nicht. So dachte der amerikanische Philosoph Richard Rorty über die Notwendigkeit des Mitgefühls nach. Er ist meint, dass Harriet Beecher Stowe mit „Onkel Tom’s Hütte“ und andere das Leiden von Menschen aufzeigende Künstler auf der Basis von Mitgefühl mehr zur Entwicklung der Menschenrechte beigetragen haben als alle Moralphilosophie. Man denke an Pablo Picassos Guernica. Ich verstehe Rorty so, dass wir nur durch Vernunft allein, die z.B. Kant ins Feld führte, nicht mitfühlend werden können. Das war nämlich Kants Idee, dass man die Würde anderer „Vernunftwesen“ respektieren solle. Aber was sind andere Vernunftwesen? Frauen gehörten zu Kants Zeit nicht dazu, Kinder auch nicht, Schwarze nicht. Arme? Wohl auch nicht. 8 Mitgefühl hat daher etwas mit Vernunft und Herzensgüte zu tun. Wenn Buddhisten von Citta sprechen, das meist mit Geist übersetzt wird, meinen sie etwas anderes, nämlich Herz-Geist, also beides zusammen. Das ist unserem Denken eher fremd. Die buddhistische Nonne Aya Khema, eine der bekanntesten buddhistischen LehrerInnen in Deutschland, hat den Paulus Brief sehr sensibel mit Texten des Buddha verglichen. Aya Khema war eine deutsche Jüdin, die während des 3. Reichs als 13-jährige mutterseelenallein nach England emigrieren musste. Sie erzählt davon in ihrer Autobiographie. Neben ihrem Humor fiel mir auf – und es machte mich traurig - dass sie sehr wenig Mitgefühl mit ihrem Leiden als Kind zu haben schien. Es schien die – vielleicht sehr deutsche? – Härte jener Zeit durchzuschimmern. Es drängte sich mir der Eindruck auf, dass sie auf gar keinen Fall Selbstmitleid zeigen wollte, und dass sie diesem „nahen Feind“ des Mitgefühls so sehr auswich, dass die alten Überlebensmuster der Zeit des Grauens wieder die Oberhand gewannen. Mitgefühl erkennt Leiden und erkennt es an und will handeln, um Leiden zu verringern. Ein Wunsch den sicher viele hier haben. Bernard Lown, ein bedeutender kardiologischer Forscher und engagierter Menschenrechtler, der „Ärzte gegen den Atomkrieg“ mitgegründet hat, weist in seinem Buch „The Lost Art of Healing: Practicing Compassion in Medicine“, was auf Deutsch bedeutet „Die verlorene Kunst des Heilens: Mitgefühl in der Medizin praktizieren“, darauf hin, wie wichtig die therapeutische Beziehung sei und legt Wert darauf zu betonen, wie wichtig das von Mitgefühl getragene ärztliche Gespräch sei und ich nehme an, dass das ebenso für pädagogische gilt. Es dürfte wohl unbestreitbar sein, dass sich PatientInnen nicht nur denkende, sondern mitfühlende Ärzte und ÄrztInnen wünschen, die sie in ihren Nöten anhören und ernst nehmen und die gewillt sind, sich auf eine heilende Beziehung einzulassen. Gerade in der Psychiatrie und Psychotherapie war es lange geradezu verpönt, mitfühlend oder gar tröstend auf PatientInnen einzugehen. Das verstieß angeblich gegen die Abstinenz. Bedürfnisbefriedigung war unerwünscht. Man wusste lange Zeit nicht, dass die Befriedigung von Grundbedürfnissen lebenslang für sichere Bindungserfahrungen, die wir auch ein ganzes Leben lang benötigen, wichtig ist. Heute können wir das wissen! 9 Ende des 19. Jahrhunderts gab der Ordinarius für Innere Medizin Naunyn die Devise aus: „Medizin muss Wissenschaft sein, oder sie wird nicht sein.“ (zitiert bei Gottstein, Vorwort zu Lown,S. 10) Was aber ist hier unter Wissenschaft gemeint? Evelyn Fox Keller beschreibt in ihrem Buch "Reflections on Gender and Science" die Angst, vor der Natur, vor der Frau, vor weichen Gefühlen und was daraus folgte. U. a. eben unsere angeblich objektive (Natur-) Wissenschaft, die Verleugnung des Subjektiven im Wissenschaftler und damit auch in der Wissenschaft. Auch Machtansprüche verhindern Mitgefühl. Die Anthropologin Emily Martin hat z.B. den Mangel an Achtsamkeit der Forscher gezeigt, die negieren, dass das Gehirn von Blut versorgt ist und sein muss, d.h. auch hier dominiert das Denken über das Denken, dass das Gehirn besonders dringend auf Genährtwerden, also einer weiblich konnotierten Tätigkeit, angewiesen ist, wird verleugnet. (Martin 2013) Nicht zuletzt unter Mitgefühlsaspekten gehe ich davon aus, dass hinter all diesen Theorien sich sehr viel Angst verbirgt: Angst, vom Schmerz der PatientInnen überwältigt zu werden, oder von Ohnmacht und Hilflosigkeit angesichts der Erfahrung, dass wir als ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen häufig nur sehr wenig tun können. Eine bittere Erfahrung, die keinem Arzt und keiner Psychotherapeutin erspart bleibt. (s. Elissa Ely 2012). Und doch: Dass es heute möglich ist, über Mitgefühlsaspekte und mitfühlendes Handeln in der Psychotherapie laut zu sprechen und nicht hinter vorgehaltener Hand, erscheint mir nach 46- jähriger ärztlicher Tätigkeit wie ein kleines Wunder. Eine von Lowns Krankengeschichten geht mir immer wieder sehr zu Herzen. Sie handelt von einer extrem übergewichtigen Patientin mit erheblichen Herzproblemen, von der er wohl recht barsch forderte, sie möge nun endlich abnehmen. Darauf geriet die Patientin in einen Zustand, den wir heute dissoziativ nennen würden, schrie ihn an, sie lasse sich von ihm nicht gefallen, auf seinen Befehl hin verhungern zu müssen. Lown erfuhr, dass die Patientin eine Auschwitz Überlebende war und bedauert in seinem Buch zutiefst seinen Mangel an Mitgefühl mit der Patientin. Er mahnt uns, uns Zeit zu nehmen, um unsere Patienten gut zu verstehen. Die Bereitschaft zu verstehen erscheint mir eine tragende Säule für Mitgefühl. Hier ein Beispiel aus meiner Arbeit: 10 In dieser Behandlung ging es lange Zeit darum, eine Beziehung zu etablieren, die es dem Patienten erlaubte, überhaupt Hoffnung in Bezug auf die gemeinsame Arbeit zu entwickeln. Dem stand die - zunächst unbewusste - Furcht entgegen, auch die Therapeutin könne so gleichgültig und entwürdigend sein wie die Eltern. Diese Befürchtung wurde zu Beginn der Behandlung von ihm nicht geäußert, sondern zu einem viel späteren Zeitpunkt thematisiert. Zunächst rechnete der Patient jederzeit damit, dass das, was er wollte, plante und sich wünschte, zunichte gemacht würde. Auch das sagte er mir viel später. Ich konnte aber empathisch seine Vorsicht und Zurückhaltung mir gegenüber spüren, und es war mir wichtig, sie mitfühlend zu respektieren. Hier wird noch einmal der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl deutlich: zunächst die Einfühlung, dann aber eine handlungsorientierte Konsequenz, nämlich die Zurückhaltung des Patienten als Manifestation traumatischer Angst zu respektieren. Jedoch war es sein Wunsch, mehr fühlen zu können. Die Geschichte dieses Patienten steht beispielhaft für viele ähnliche von Kindern der „Kriegskinder“ bzw. der KriegsteilnehmerInnen. Er erzählte, wie die extrem belasteten Eltern völlig unfähig waren, sich auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzustimmen und diese angemessen zu beantworten. Die Lebensgeschichte von Herrn C. ist daher durch die Interaktionen mit den primären Bezugspersonen von Gleichgültigkeit einerseits und mangelndem Mitgefühl, und massiver Abwertung bis hin zu Demütigungen und Beschämungsszenarien andererseits geprägt. Beide Eltern waren - wie das bei sehr vielen Patienten der Fall ist und erst in letzter Zeit mehr berücksichtigt wird – durch Krieg, Flucht und Vertreibung traumatisiert, so dass es verständlich wurde, dass sie unfähig waren, den Sohn angemessen emotional zu spiegeln. An dieser Stelle war es in der Behandlung wichtig, dass ich nicht deutete, sondern Mitgefühl für das Kind zeigte, und indem ich dann den Patienten einlud, sich zu fragen, wie schlimm es für den Jungen war, so behandelt zu werden. Viele TherapeutInnen meinen, sie müssten Partei ergreifen für die Eltern, darauf kommen Patienten aber selbst, wenn sie es sind, die Mitgefühl erfahren. Erst viel später in der Therapie, als Herr C. mehr Vertrauen zu mir gefasst hatte, konnte er davon berichten, wie er als Kind, weil er sich so unglücklich gefühlt habe, beschlossen habe, nicht mehr fühlen zu wollen und von da an jegliches Gefühl unterdrückt habe. So konnten wir erst nach vielen Stunden besser verstehen, wie die 11 Gefühlskälte zum Schutz des Kindes entstanden war. Das Abwehrsystem, das dem Patienten bis dahin Halt gegeben hatte, wäre gefährdet gewesen, hätte er zu früh darüber gesprochen. Schließlich berichtete der Patient davon, dass er sich als Kind sichere Orte vorgestellt hatte und auch andere, liebevolle Eltern. Seine Augen begannen zu leuchten, als er erzählte, dass er sich vorgestellt habe, wie er mit diesen anderen Eltern an schöne Orte reiste. Diese Mitteilung erlebte ich wie ein Geschenk, das der Patient sich selbst und mir machte. Und es war ein Wendepunkt in der Behandlung. Nun konnte der Patient, verbunden mit seiner früheren Imagination und vielleicht auch Hoffnung, mit Vergnügen Bilder von guten, heilsamen Orten für seine kindlichen, verletzten Ichs erschaffen, das heißt er begann, mit sich selbst mitfühlend und tröstend zu werden. Darüber konnten wir uns gemeinsam freuen. Ich gehe davon aus, dass PatientInnen sich danach sehnen, bewusst oder unbewusst, dass wir mitfühlend auf sie eingehen. Wenn ihnen dieses Mitgefühl begegnet und sie es annehmen können, können sie eingeladen werden, sich selbst mitfühlend zu begegnen. Im Film kann sich Cyril durch die Begegnung mit einer mitfühlenden Bezugsperson langsam öffnen. Allerdings lässt er sich auch dazu verführen, sich einem älteren kriminellen Jugendlichen, einem Vaterersatz, anzuschließen. Doch Samantha gibt nicht auf, so dass es Hoffnung für Cyril geben kann. Für manche PatientInnen besteht eine Schwierigkeit, dass sie sich genau dadurch, dass sie sich ihren lange unterdrückten Schmerzen öffnen, von Schmerz überwältigt fühlen. Das bedeutet, die Begegnung mit Schmerzlichem sollte nicht forciert werden, sondern, wie Peter Levine das beschreibt, tröpfchenweise – titriert, nennt er das – geschehen. – Was nicht ausschließt, dass manche Patienten auch einen großen Schwall von Schmerz ertragen können und wollen, aber wir sollten das jedenfalls nicht forcieren wollen. – Es sei erwähnt, dass zu viel Schmerz - ebenso wie zu viel Angst - nicht geeignet ist, Hoffnung zu ermöglichen, sondern eher Hoffnungslosigkeit, ja Verzweiflung. Hoffnung aber ist nach Fabrizio Benedetti das, was PatientInnen am meisten hilft zu gesunden und dafür benötigen sie nach Benedetti das Mitgefühl des Arztes/ der Ärztin. Benedetti ist Hirnforscher und belegt diese Erkenntnisse mit naturwissenschaftlichen Mitteln, u.a. in seinem Buch „The patients brain“(Benedetti 2011). Mitgefühl bedeutet also im therapeutischen Prozess, so viel vom Patienten zu 12 wissen und zu verstehen, dass wir in der Lage sind einzuschätzen, was ihm zuzumuten ist. Daher ist ein Ingredienz des mitfühlenden Begleitens aus meiner Sicht Geduld und Zeit haben, so dass der richtige Moment sich einstellen kann. Ich weiß, dass das in Zeiten von „immer schneller, immer kürzer“ schwierig ist. Und ich meine, wir sollten immer wieder mit Nachdruck vertreten, dass es für viele der schwer belasteten PatientInnen notwendig ist, Zeit zu haben für ihre Entwicklung. Das ist ein Akt mitfühlenden Handelns. PatientInnen dabei zu helfen, dass sie mit sich selbst mitfühlender umgehen, erscheint mir eine sinnvolle und notwendige Aufgabe zu sein. Dafür brauchen sie unsere Anregungen, nicht selten uns als Vorbild. Mitgefühl kann man nicht erzwingen, jedoch gehe ich davon aus, dass Sie alle solche Momente des Mitgefühls schon erlebt haben, und ich wünsche Ihnen, dass Sie durch Achtsamkeit die Weisheit in sich entdecken und entwickeln, das Mitgefühl in sich immer mehr zum Klingen und zum Ausdruck zu bringen. Das ist in meinen Augen etwas anderes als eine ausschließlich an Störungen und Manualen orientierte Therapeutik – oder vielleicht auch Pädagogik - und die beiden, also Mitgefühl und Manualorientierung sollten zusammen praktiziert werden. Tanja Singer hat mit wissenschaftlichen Mitteln gezeigt, dass man Mitgefühl erlernen und trainieren kann. Sie erforschte was geschieht, wenn Menschen mit einer Achtsamkeitspraxis beginnen und danach zum Mitgefühl übergehen oder das umgekehrt machen. Allerdings handelt es sich bei ihren ProbandInnen um gesunde Menschen. Meine Vermutung aufgrund klinischer Erfahrung ist, dass bei unseren PatientInnen der Weg vom Mitgefühl zur Achtsamkeit geeigneter ist. Sie können sich übrigens im Internet über ihre Forschung informieren. Mitfühlende ÄrztInnen vermitteln ihren PatientInnen für Momente die Erfahrung, dass diese sich sicher und geborgen fühlen können. Dies wiederum wirkt Stress reduzierend, und erst so kann der Patient mit uns gemeinsam Lösungen finden. Der durch seine Erkrankung gestresste Patient kommt ja mit Angst. Mitgefühl kann helfen, wieder – wie man so schön sagt - zu sich zu kommen, wieder handlungsfähiger zu werden und auch wieder nachdenken zu können. Ich nehme an, dass wir alle ziemlich genau wissen, dass wir Mitgefühl oder Barmherzigkeit brauchen, da aber die aktuelle westliche Philosophie und 13 Wissenschaft diesbezüglich nicht allzu viel zu bieten hat, verwundert es nicht, dass immer mehr Menschen Interesse an dem buddhistischen Mitgefühlskonzept zeigen. In dieser Kultur gibt es eine ausgefeilte Praxis, es zu entwickeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dabei der, dass auch das Mitgefühl für sich selbst dort eingeschlossen ist, als Basis für Mitgefühl mit anderen. Und nicht zuletzt, dass es immer um Verbundenheit geht. Freud habe die Welt so sehr entzaubert und so stark das autonome Ich betont, dass die Beschäftigung mit buddhistischen Gedanken es Psychoanalytikern erst wieder ermögliche, Verbundenheit zu erkennen und anzuerkennen, meint der amerikanische Psychoanalytiker Jeremy Safran in seinem Buch „Psychoanalysis and Buddhism“(Safran 2005). Aus meiner Sicht gilt dies genauso für die Väter der Verhaltenstherapie und die Wissenschaft insgesamt. Vor Safran hat schon Erich Fromm Ähnliches erkannt. Fromms Buch über Zen-Buddhismus und Psychoanalyse war ebenso wie seine „Kunst des Liebens“ ein Bestseller in den 70er Jahren, heute fast vergessen. Man sollte ihn wiederentdecken! Fromms Gedanken über das, was Liebe ist, hat viel mit Mitgefühl zu tun, wenngleich er das Wort nicht benutzt, er nennt vier Grundelemente, die für ihn zum Lieben und meines Erachtens auch zum Mitgefühl dazu gehören können, nämlich: Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem anderen und Erkenntnis. Es geht aus meiner Sicht vor allem um die Achtung vor der Andersheit des Anderen, so dass wir manchmal auch Mitgefühl mit uns selbst benötigen, um das ertragen zu können. Fromm illustriert seine Vorstellung von Liebe am Beispiel des Jona aus der Bibel: Jona ist ein Mann mit einem starken Gefühl für Gesetz und Ordnung. Gott erklärt Jona, dass das Wesen der Liebe darin besteht, für etwas „zu arbeiten“ und „etwas aufzuziehen“. Es handle sich um eine Antwort auf die ausgesprochenen oder unausgesprochenen Bedürfnisse eines anderen menschlichen Wesens. Das ist in anderen Worten Mitgefühl! Sich für jemand verantwortlich fühlen, heiße fähig und bereit zu sein zu antworten. Der liebende Mensch antworte. So weit Fromm. Und ich meine, dass wir, um uns an Fromm anzuschließen, Achtsamkeit und Mitgefühl benötigen. PatientInnen, die Mitgefühl erfahren, beschreiben das auch oft als ein Beantwortetwerden. Liebe und Mitgefühl bedeuten auch, zu verstehen, dass der andere um seiner selbst Willen und auf seine eigene Weise wächst und sich entfaltet. 14 Wie können wir dahin kommen? Mitgefühl, ein Begriff, von dem Buddhisten wie erwähnt, viel verstehen, wird im Buddhismus zusammen gesehen mit anderen „himmlischen Verweilungen“. Und in jedem Augenblick – wenigstens gelegentlich - ist die Zeit für alle himmlischen Verweilungen, das sind neben Mitgefühl Freundlichkeit, auch „liebende Güte“ genannt, (Mit-)Freude und Gleichmut. Als ich Mitgefühl immer genauer zu verstehen und zu leben versuchte – was natürlich nicht immer gelingt – entdeckte ich, wie wichtig es für mich ist, mich zu freuen und dankbar zu sein, und dass dies wiederum Mitgefühl begünstigt. Gleichmut entwickelt sich durch eine Fähigkeit, die Dinge des Lebens zu betrachten, ohne sich dauernd mit ihnen zu identifizieren, da scheint mir eine wie auch immer geartete Praxis der Achtsamkeit sehr nützlich. Viele unserer PatientInnen lehnen sich dafür ab, ja hassen sich sogar dafür, dass sie das, was sie sein sollten, nicht erreichen. Sie bezahlen einen hohen Preis dafür, dass sie fühlen. Die „ersten Pfeile“, die ihnen das Leben zugemutet hat, führen dazu, dass sie immer neue „zweite Pfeile“ gegen sich richten. Sie wünschen sich von ihrer Not befreit zu sein und hoffen, wenn sie nur genügend gut, sprich: angepasst sind, dann…PatientInnen praktizieren Achtsamkeit und meditieren, was manchen hilft zu überleben, manche allerdings so sehr belastet, dass sie es schnell wieder aufgeben. Deshalb empfehlen in Mediation und Achtsamkeit geschulte TherapeutInnen mit der traditionellen Achtsamkeitspraxis vor allem bei traumatisierten PatientInnen zurückhaltend zu sein, einige raten sogar völlig davon ab. PatientInnen suchen Frieden und meditieren deshalb, aber sie fühlen sich häufig überall von Dämonen umstellt. Dämonen der Vergangenheit, die sie nicht loslassen. Und dabei hilft ihnen ihre Achtsamkeitspraxis in der Regel nicht, viele werden dadurch noch unruhiger und ängstlicher, ich nehme an, weil diese Praxis sie nicht dabei unterstützt, mit sich selbst mitfühlend zu werden. Häufig weil innere Dämonen, die wir Introjekte nennen, das Mitgefühl nicht erlauben. Hier scheint es notwendig zu sein, dass wir zunächst Mitgefühl aufbringen für die verletzten und vernachlässigten Anteile in ihnen, um sie einzuladen, sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Und sie andererseits dazu ermutigen können, auch den Dämonen mitfühlend zu begegnen und anzuerkennen, dass diese früher helfen wollten und genauso wie verletzte Anteile in der Vergangenheit feststecken also nicht wissen, dass jetzt eine andere Zeit ist. 15 Es geht also darum, die „Schreie der Welt zu hören“, wie die buddhistische Lehrerin Pema Chödrön lehrt. Der Buddhismus sieht den Menschen als potentiell aus Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut heraus lebend. Also von seinem Potential her ressourcenvoll ohne Bezug auf theistische Konzepte, was heute viele Menschen anzieht. Christliche Werte sind ähnlich, aber eben mit theistischem Bezug. Und genau hier ist die Stelle, wo es Mitgefühl braucht, aber eben auch Selbstmitgefühl. Die Schreie der Welt tagein, tagaus mit offenen Ohren und offenem Herzen zu hören, das ist nicht leicht. Der Buddha war weise, deshalb stellte er dem Mitgefühl drei weitere an die Seite: liebende Güte, Gleichmut und, für mich das Wichtigste: Mitfreude. Ohne Freude im Leben und bei der Arbeit kann man nicht mitfühlend sein. Ich fand einen schönen Vergleich bei einer psychoanalytischen Kollegin vom William Allison White Institut in New York, Sandra Buechler: Die Analytikerin müsse es halten wie eine Mutter im Flugzeug, erst müsse sie selbst die Sauerstoffmaske anlegen, und dann dem Kind. Wir sollten viel tun, dass wir Freude im Leben, in der Therapie und am Leben haben. Ich stelle mir Mitgefühl als den tragenden Grund vor und Freude als den Sauerstoff der Arzt-Patient Beziehung. Ich möchte daher auch einen Weg des Sichfreuens empfehlen sowie der Dankbarkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann leichter fällt, mitfühlend zu sein, und das mag unsere Fähigkeit zu hoffen ermöglichen und diese wiederum an unsere PatientInnen zu vermitteln. Aus der Sicht von Patienten sind die meisten positiven Veränderungen im Therapieprozess weder durch strategische Interventionen noch durch kluge Deutungen des Therapeuten zustande gekommen, sondern durch Momente der Begegnung. Aus meiner Sicht gibt es eine Chance, solche Momente zu unterstützen, das ist eine achtsame und mitfühlende Haltung. Wenn man Achtsamkeit aber als eine neue Technik verwendet, ist damit wenig gewonnen. Dann hat die Seele wieder keinen Platz, weil es das Herz nicht hat. Was wir brauchen ist mehr Mut, uns auf die angeblich unspezifischen Faktoren einzulassen, sie sind möglicherweise viel spezifischer als uns die Forschung bisher sagen konnte. Der/die achtsame und mitfühlende Therapeut/Therapeutin ist gefragt, und ich bin mir sicher, dass alle hier das bereits sind. Wir müssten nur ein bisschen mehr öffentlich dazu stehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 16 Copyright: Dr. Luise Reddemann – Weitergabe bitte nur nach Rücksprache mit der Autorin 17