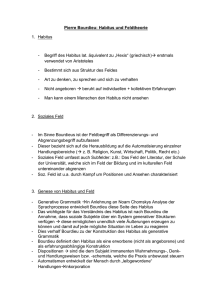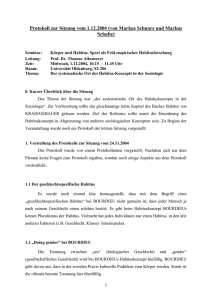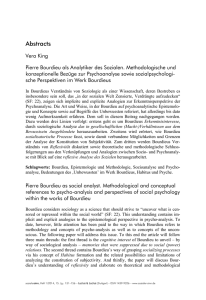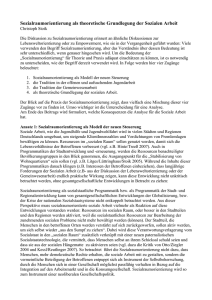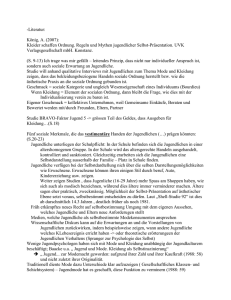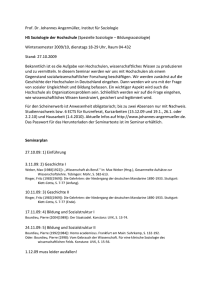Bis zum Faschismus war Deutschland eine Klassengesellschaft wie
Werbung

FernUniversität in Hagen Die Arbeit im Rahmen des Abschlusses „Master of Arts“ im Masterstudiengang „Soziologie: Individualisierung und Sozialstruktur“ Prüfer: Prof. Dr. Frank Hillebrandt Deutschland, eine Klassengesellschaft? As|M Sofija Celike Bahnstrift 44, 30179 Hannover E-Mail: [email protected] Matrikelnummer: 8606935 Abgabetermin: 18.06.2015 Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung 1 2.1 Die soziale Ungleichheit: Erläuterung verschiedener Konzepte 3 2.2 Zusammenfassung und Bewertung der Konzepte zur sozialen Ungleichheit 12 3.1 Die soziokulturelle Gesellschaftstheorie nach Bourdieu 15 3.2 Die Klassentheorie nach Marx 19 3.3 Vergleich der Theorien: Marx und Bourdieu 22 3.4 Bourdieus Beitrag: Stärken und Schwächen aus einer marxistischen Perspektive 29 4.1 Klassentheorie am Ende der Klassengesellschaft? 33 4.2 Das angebliche Ende von Stand und Klasse in Deutschland 36 5.1 Ein Exkurs: Soziale Selbstorganisationen – Gegenbewegungen im Kapitalismus 38 5.2 Pierre Bourdieus Sozialkapital 48 6. Schlussfolgerung 51 7. Literaturverzeichnis 55 0 1. Einleitung „Wenn die gegebene Gesellschaftsform das oberste Bezugssystem für Theorie und Praxis ist und bleibt, dann ist an dieser Art Soziologie und Psychologie nichts falsch. (…) Aber die Rationalität dieser Art von Sozialwissenschaft erscheint dabei in einem andern Licht, wenn die gegebene Gesellschaft, die dabei das Bezugssystem bildet, zum Gegenstand einer kritischen Theorie wird, die gerade auf die Struktur dieser Gesellschaft abzielt, die in allen besonderen Tatsachen und Bedingungen präsent ist und deren Ort und Funktion bestimmt. Dann wird ihr ideologischer und politischer Charakter offenkundig, und die Ausarbeitung angemessener Begriffe der Erkenntnis macht es erforderlich, über die trügerische Konkretheit des positivistischen Empirismus hinauszugehen“ Herbert Marcuse, 1976 Als eine der auffälligsten Äußerungsformen des gesellschaftlichen Wandels im modernen Europa wird das Verwischen einer früher offenkundigeren Klassenstrukturierung angesehen. Mittlerweile sieht eine immer mehr wachsende Zahl von Sozialwissenschaftlern die Gesellschaft jenseits von Klasse, Stand oder Schicht. Ihrer Behauptung zufolge, ist das Konzept der Schichtung oder das der Klassenstruktur nicht geeignet, um die soziale Strukturierung der gegenwärtigen Gesellschaft darzulegen. Die moderne Gesellschaft ist durch den anhaltenden Prozess der Individualisierung von Lebenslagen und Lebenschancen gekennzeichnet. Und anstatt an den historischen Klassenantagonismus zwischen Arbeit und Kapital weiter fest zuhalten, ist es viel versprechender die Klassenanalyse durch eine Soziologie der multidimensionalen Ungleichheit zu betrachten. (vgl. Bischoff/Herkommer „Von der Klassentheorie zur Ungleichheitsforschung“, 1990). In der gegenwärtigen Gesellschaft gibt es zwar keinen Klassenkampf, wie Marx und Engels ihn prognostizierten, aber andere Kriterien des Klassenbegriffs scheinen erfüllt zu sein: eine soziale Lage, die kein Einzelschicksal darstellt und die meistens an die Kinder weitergegeben wird, wie es die Analysen über die sogenannten bildungsfernen Schichten belegen. Gibt es dann eine Wiederkehr der Klassengesellschaft? Die Sozialstrukturforschung befindet sich seit ungefähr Mitte der 80er Jahre in einer heftigen Auseinandersetzung um die Relevanz von traditionellen vertikal und neueren horizontal orientierten Theorien. Vor allem die neueren Modelle üben radikale Kritik an Marx Klassentheorie. Die Hauptargumente lauten: die Pluralisierung von sozialen Milieus hat dazu geführt, dass soziostrukturelle Großgruppen sich aufgelöst haben und dass es in einem Prozess der Individualisierung zur autonomen Verselbständigung von Individuen 1 gekommen ist. Dies bedeutet: das Bewusstsein von Individuen wird nicht mehr aus ihrer objektiven Lage heraus geleitet. Der Ausgangspunkt dieser Theorien hat mit der Bourdieuschen kulturellen Klassentheorie gemeinsam, dass die kultursoziologische Milieu- und Lebensstilforschung in allen Entwürfen im Zentrum steht, wobei Bourdieu an der Vorstellung einer klassenstrukturierten Gesellschaft festhält. Er hatte bereits in den 80er Jahre mit seinem Werk „Die feinen Unterschiede“ eine Neudiskussion angestoßen, in der Bourdieu behauptet, dass neben den ökonomischen auch kulturelle Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Kultur sei nämlich auch ein Merkmal, in dem eine soziale Gruppe qua Lebensstil, Mode und Habitus sich von den anderen abgrenzen würde. Die Erkenntnis, dass Ungleichheit nicht nur durch ökonomische Umstände, sondern auch sehr stark durch kulturelle Merkmale reproduziert wird, ist somit eine bedeutende Entwicklung in der Ungleichheitsforschung. Erst Bourdieu hat diesen Gedanken zum Leben erweckt und stark gemacht. Das bedeutet: will man den Klassenbegriff weiter verwenden, so musst man neben den ökonomischen Aspekten auch andere Ebene berücksichtigen. Für die Sozialwissenschaft ist die Klassenstruktur nicht mehr die dominante Struktur moderner Gesellschaften, sie ist stattdessen bestenfalls eine unter mehreren. Die frühere Vorstellung, dass die deutsche Gesellschaft einmal eine „Klassengesellschaft“, eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ gewesen sei, oder die heutige Bezeichnung als „Risikogesellschaft“ oder als „Informationsgesellschaft“ – allen Benennungen gemeinsam ist die Gefahr der Übervereinfachung und falschen Konkretisierung des Begriffs. Man kann lediglich von der Prämisse ausgehen, dass vertikale Strukturen nicht ohne weiteres als das dominante Strukturmerkmal moderner Gesellschaften interpretiert werden können. Heute treten konkurrierende Strukturprinzipien auf, wie funktionale Differenzierung, internationale Segmentierung, Individualisierung. Demzufolge ist ein eindeutiges Primat der Klassen- oder Schichtstruktur nicht mehr vertretbar. Das bedeutet auch, dass der Klassenkonflikt nicht per se den Schlüsselkonflikt für das Konflikttheoretische Verständnis moderner gesellschaftlicher Verhältnisse darstellt. In der Theorie der begleitenden Soziologie nehmen soziale Klassen immer noch einen wichtigen Stellenwert ein, aber Klassen- und Schichtungstheorien sind in den letzten Jahren immer weiter in den Hintergrund getreten. Vor allem deshalb, weil sie ihren Stellenwert nicht mit anderen Theorien, wie zum Beispiel der „neuen sozialen Ungleichheiten“, teilen wollten. Einzige Ausnahme bildet gegenwärtig wohl die von Pierre Bourdieu (1979) inspirierte kultursoziologische Erneuerung der Klassentheorie als „Theorie der sozialen Distinktion“. Marx und seine Klassentheorie werden in diese Arbeit einbezogen, um das Verständnis von Bourdieus Klassenkonzept zu befördern. Die beiden Modelle sind der Gegenstand des theoretischen Richtungsstreits. Die anderen Konzepte werden nur in ihren Grundzügen vorgestellt, damit der rote Faden dieser Arbeit – das Bourdieuschen Konzept - nicht verloren geht. Das Ziel dieser Arbeit liegt 2 darin, genauer darzulegen, warum die Klassensemantik auch heute noch für die Ungleichheitsforschung unverzichtbar ist. 2.1 Die soziale Ungleichheit: Erläuterung verschiedener Konzepte Die Gesellschaft in der wir leben befindet sich heute in einem dauerhaften Krisenzustand: ökonomische und ökologische Krisen, Verschärfung der globalen Probleme, Massenarbeitslosigkeit. Die Kluft zwischen Arm und Reich nimmt zu, Armut wird vererbt, von Bildung profitiert meist die Oberschicht. Vor einiger Zeit demonstrierten Menschen in Frankreich auf der Straße gegen die sich immer weiter ausweitende soziale Kluft. Wie weit ist Deutschland davon entfernt? Leben wir in einer Klassen-, oder klassenlosen Gesellschaft? Würden wir beispielsweise in den USA leben, könnten wir tatsächlich von einer Klassengesellschaft sprechen: working-class und upper – class sind dort akzeptierte Begriffe. In Deutschland wird der Begriff „Arbeiterklasse“ kaum noch gebraucht und das Wort „Kapitalismus“ nicht im Zusammenhang mit einer Klassengesellschaft verwendet. Dafür stehen Begriffe wie die Individualisierung, Differenzierung und Globalisierung als gängige Stichworte der modernen sozialen Ungleichheit. Bis zum Faschismus war Deutschland eine Klassengesellschaft wie die anderen in Europa. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde ein großer Teil der Eliten vertrieben und der verbleibende Teil diskreditiert. Parallel etablierten sich durch die Partei völlig neue Aufstiegsmechanismen. In den 50er Jahren hat der Soziologe Helmut Schelsky die These aufgestellt, dass es keine typische Klassengesellschaft mehr gibt. Es gebe nur noch eine Art nivellierte Mittelstandsgesellschaft, da durch die soziale Mobilität und dem allgemeinen Wohlstand typische Klassen nach und nach verschwinden. Die bürgerliche Mitte ist demnach aufgrund ihres materiellen Wohlstands weder reich, noch weist sie Tendenzen zum Proletariat auf. Da es durch diese These gar keine Klassen mehr gibt spricht man auch von einer “Anti-Klassentheorie“. Ansehen zu speziellen Berufen/Berufsgruppen sieht Schelsky als Relikt vergangener Zeiten, das keinen Platz in einer Mittelstandsgesellschaft hätte. Während sich in Westdeutschland das entwickelte, was Schelsky die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ nannte, versuchte sich die DDR an der klassenlosen Gesellschaft. In der Utopie der DDR waren alle Menschen Arbeiter und Bauern. Die Utopie der Bundesrepublik kannte nur die Mittelschicht. Die meisten Deutschen sind also nur mit einem geringen Bewusstsein für Standesunterschiede aufgewachsen. Aus heutiger Sicht wird das Konzept der nivellierten Mittelstandsgesellschaft von Helmut Schelskys eher kritisch betrachtet. So gibt es tendenziell wieder größere Einkommensunterschiede. Zudem herrscht insbesondere im deutschen Bildungssystem eine soziale Auslese vor, die bei einer Mittelstandsgesellschaft aufgrund der Nivellierung nicht existieren sollte. Weiterhin: dass die Armut in Deutschland seit den siebziger Jahre kontinuierlich zunimmt, ist vielfach belegt. Besonders ausgeprägt ist der Trend zur Verarmung in den östlichen Bundesländern. Dort passen sich die Ausmaße der Ungleichheit zwischen ganz 3 unten und ganz oben allmählich jenen im Westen des Landes an. Über 75 Prozent der dauerhaft Armen gehören heute zur Arbeiterschichten. Insbesondere Arbeiterfamilien mit mehreren Kindern sowie ausländische ArbeiterInnen gehören zu den Kerngruppen der Armut in Deutschland. Doch auch die von der Politik massiv beworbene Dienstleistungsgesellschaft entpuppte sich schon lange als reine Wohlstands-Illusion. Die Entstehung eines neuen Dienstleistungsproletariats steht, offensichtlich, im Vormarsch. Die daraus entstehenden Folgen sind dramatisch und treffen in erster Linie die Bildungschancen der neuen Armen: wer nur mit Hilfe des Staates über die Runden kommt, kann nur sehr wenig in die Ausbildung seiner Kinder investieren. Die Pisa-Studien der letzten Jahre haben bewiesen, dass die Niedriglöhne dazu beitragen, dass immer mehr gering qualifizierte Arbeiter in Armut abrutschen. Somit ist die Arbeiterklasse vom Umbau des Wohlfahrtsstaates am schlimmsten betroffen. Seit Beginn der 80er Jahre werden zunehmend die Ungleichheitsrelationen berücksichtig, die bis dato nur in einem geringen Ausmaß von Klassen- und Schichtmodellen einbezogen worden sind. Die klassischen Schicht- und Klassenmodellen werden scharf kritisiert, weil sie die „neuen“ sozialen Ungleichheiten nicht beachten wollen. Neben Privateigentum, Einkommen, Bildung oder Berufsprestige wird auf weitere Faktoren hingewiesen: Geschlecht, regionale Disparitäten, ethnische Herkunft, Kohortenzugehörigkeit, staatliche Transferzahlungen. Im Folgenden werden die „neuen“ Dimensionen kurz vorgestellt. Regionale Disparitäten: es bestehen erheblichen Unterschiede zwischen Stadt und Land bezüglich weiterführenden Bildung. Zudem ist die Disparität im vereinigten Deutschland deutlich spürbar. Ethnische Herkunft: Sie steht im Zusammenhang mit sozialer Benachteiligung. Beispielsweise verdienen ausländische Arbeitnehmer in der Regel weniger als ihre deutschen Kollegen, zudem konzentrieren sie sich auf die Berufe mit geringem Sozialprestige. Nicht zuletzt ist die Arbeitslosigkeit unter Ausländer sehr verbreitet (geht aus dem Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung hervor, 2013). Geschlecht: Die verschiedenen sozialen Studien zeigen, dass Geschlechtsungleichheiten in vielen Lebensbereichen herrschen: im Bildungssystem, in der Arbeitswelt, in der Politik und in der Familie. Überall verdienen Frauen deutlich weniger als Männer, auch wenn sie ähnlichen Positionen wie ihre männlichen Arbeitskollegen besetzen. Auf der beruflichen Elitenebene dominieren ausschließlich Männer, Frauen stellen eher dort eine Ausnahme dar. Alter: Die Ungleichheit im Alter beruht auf den Schwankungen der zur Verfügung stehenden Ressourcen in der Nacherwerbsphase. Zusätzlich dazu kommt der Verlust von Status/Prestige. 4 Kohortenzugehörigkeit: Die Kohortenzugehörigkeit wirkt auf individuelle Lebenschancen ein, zum Beispiel: Ein radikaler gesellschaftlicher Wandel, insbesondere auch in Bezug auf die Situation am Arbeitsmarkt, wie er sich in Ostdeutschland vollzogen hat, trifft Angehörige unterschiedlicher Geburtskohorten in verschieden Phasen ihres Lebens. Denn Knappheit oder Überfluss an Arbeitskräften behindert oder fördert soziale Mobilität und beeinflussen Lebensbedingungen. Staatliche Transferzahlungen: Mit dem Ausbau des Sozialstaates in den 70er Jahren wurden staatliche Transferleistungen zu einem wichtigen Faktor für die gesamte Bevölkerung. Lebensphasen, wie die der Ausbildung oder des Ruhestands, beruhen auf der staatlichen Alimentierung. Der Anteil der Familien, der einen Teil ihres Einkommens aus Unterstützungsleistungen erhält, hat in den letzten Jahrzehnten merklich zugenommen. Indem der Staat alle wichtigen gesellschaftlichen Institutionen reguliert, wie beispielsweise das Bildungssystem oder die Infrastruktur, nimmt er Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen und individuelle Lebensumstände. Nicht selten trägt der Staat die Verantwortung, dass bestimmten Bevölkerungsgruppen der Zugang zu verschiedenen Ressourcen erschwert wird. (vgl. Hradil 1987, 39 - 47f.). Für die Neuorientierung der deutschen Sozialstrukturanalyse ist Ulrich Becks These der Individualisierung sehr bedeutsam. Mit der Formulierung „Jenseits von Klasse und Schicht“ verfestigte Ulrich Beck Mitte der 80er Jahre seine strukturellen Betrachtungen zur sozialen Ungleichheit. Einerseits konstatiert er, dass die soziale Ungleichheit in allen entwickelten Ländern sich etabliert hat, anderseits, dass sich ungeachtet der sozialpolitischen Reformen, die Ungleichheitsrelationen zwischen den sozialen Großgruppen kaum verändert haben. Gleichzeitig betont Beck, diese Ungleichheiten seien nicht mehr zentraler gesellschaftlicher Konfliktgegenstand. Darauf konstatiert er einen „Fahrstuhleffekt“ – die „Klassengesellschaft“ sei insgesamt eine Etage höher gefahren, was bedeutet: bei allen sich neu einpendelnden oder durchgehaltenen Ungleichheiten gibt es ein kollektives Mehr an Einkommen, Bildung, Massenkonsum usw. Darauffolgend werden subkulturellen Klassenidentitäten und –Bindungen aufgelöst. Ein Prozess der Individualisierung und Diversifizierung von Lebenslagen und Lebensstilen wird im Gang gesetzt, was das Hierarchiemodell sozialer Klassen und Schichten in „seinem Wirklichkeitsgehalt in Frage stellt“ (Beck 1986). Zudem erweitert Beck seine These, indem er die Individualisierungstheorie als einen Paradigmenwechsel sozialer Ungleichheit dastellt. Individualisierung bei Beck meint eine Enttraditionalisierung, einen Verlust von als selbstverständlich erlebten und gesicherten Lebensformen und Überzeugungen: Die Welt verliert an Eindeutigkeit und Klarheit. Traditionelle Institutionen wie z.B. berufliche Arbeit (was man gelernt hat, das wird ein Leben lang auch ausgeübt) - Familie und Geschlechtsrollenidentität (z.B. klare Rollenverteilung) aber auch die Identität sozialer Klassen und Milieus werden brüchig und verlieren an Orientierungskraft. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass sich die Strukturen von sozialer Ungleichheit, von Eigentumsverhältnissen, geändert haben; aber diese sozialen Ungleichheiten werden nicht mehr im großen Schicht- oder 5 Klassenzusammenhang umdefiniert: erlebt, sondern eher in persönliche Risiken "Einerseits trifft das Risiko, arbeitslos zu werden und zu bleiben, mit voller Härte sowieso schon benachteiligte Gruppen (erwerbstätige Mütter, Personen ohne berufliche Ausbildung, Kranke, Ältere und Ausländer sowie gering qualifizierte Jugendliche). (...) Diesen Risikofaktoren - so nachhaltig sich in ihnen auch das Merkmal sozialer Herkunft ausdrückt - entsprechen jedoch keine sozialen Lebenszusammenhänge, oft auch keine „Kultur der Armut“. Hier trifft also mehr und mehr Arbeitslosigkeit (und in der Folge ihrer Dauer: Armut) mit klassenzusammenhangloser Individualisierung zusammen. (...) Die Kehrseite des Vorübergehenden, mit der die Arbeitslosigkeit eintritt, ist die Verwandlung von Außenursachen in Eigenschuld, von Systemproblemen in persönliches Versagen" (Beck 1986, S. 146, S. 150). Individuelles Leistungsdenken gewinnt an Bedeutung, denn die Anforderungen an die Subjekte sind gewachsen: Wenn die Einzelnen keine Grundlage mehr in stabilen sozial-moralischen Milieus haben, müssen sie mehr denn je ihre Biographie, ihre Lebensorganisation selbst herstellen. An der Stelle der institutionellen Struktur der Standardlebensläufe tritt Individualität als entscheidende, die Biographie steuernde Institution. Lebensläufe werden mit der Individualisierung vielfältiger, gegensätzlicher, brüchiger, unsicherer und auch für katastrophale Einbrüche anfälliger. Sie werden aber auch, Erfolg verheißender, umfassender, widersprüchlicher und gleichzeitig abhängiger von Institutionen wie Arbeitsmarkt, Bildungssystem, Systemen sozialer Sicherung, die neue Formen von Normierungen des Lebens erhalten. Die Institutionen gewinnen an Definitionsmacht, so dass es eine institutionalisierte Individualisierung entsteht. Die gesellschaftliche Modernisierung mit den dazugehörigen Differenzierungsprozessen, der Pluralisierung von Werten, der Enttraditionalisierung usw. - hat sehr komplexe Auswirkungen auf die Individuen: Es haben sich neue Standards entwickelt, was vom Leben erwartet wird. Weidacher (1995) spricht von einer Angleichung schichtspezifischer Vorstellungen über das Streben nach Glück "hier und jetzt", trotz aller Verunsicherungen, Tendenzen des Sozialabbaus und dem gewachsenen Risiko von Arbeitslosigkeit. Die Erwartungen hängen mit Ideen, Deutungsmustern und Vorstellungen zusammen, die von Klaus Wahl (1989) als "Mythos der Moderne" bezeichnet werden: Erstens mit der Vorstellung eines neuen Menschenbildes (im Sinne eines autonomen, selbstbestimmten, mit Menschenwürde ausgestattetem Subjekts); zweitens mit der Vorstellung eines sich ständig weiterentwickelnden, allgemeinen Fortschritts in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft; drittens mit einem neuen Familienmodell, das auf die Liebesehe gegründet ist und als Maßstab für den Sinn des Zusammenlebens das gemeinsame Familienglück bestimmt. Individuen laufen Gefahr, in eine Falle zu geraten zwischen den verinnerlichten Verheißungen einerseits - von selbstbewusster Autonomie, Familienglück und gesellschaftlichem Fortschritt - und ihren eigenen Erfahrungen andererseits, die ihnen gezeigt haben, dass sie nur sehr bedingt am 6 gesellschaftlichen Reichtum partizipieren können, dass ihnen gesellschaftliche Anerkennung verweigert wird, und dass Familienglück und Liebesehe höchst zerbrechlich sind. Sie erfahren, dass hier eine große Diskrepanz zwischen dem Mythos der Moderne und ihrer Realität besteht. Das Scheitern wird jedoch nur als individuelles Versagen, als "beschädigtes Selbstbewusstsein" erlebt (Wahl 1990), wobei gerade die diversen gesellschaftlichen Institutionen der Anerkennung der individuellen Person eher im Wege stehen (Wahl 1990: 160 165). Die Individualisierungsthese hat sich ohne großen Widerstand als einflussreiche Diagnose der modernen Gesellschaft durchgesetzt. Auch heute unterstützen viele verschieden Autoren (Renn, Lindemann, Hahn 1999), ungeachtet des Korrekturbedarfs, die These der Differenzierung im Alltag und dadurch geleitetes Verhalten der Individuen. Ihnen zufolge erfasst das Individualisierungstheorem den Zeitgeist. Unter Berufung auf das Individualisierungstheorem, auf die „neuen“ Ungleichheiten, kam es ab den 80er Jahren zur einen regelrechten Popularität der Milieu-Lebensstilforschung. Die Grundlage für die Milieu- und Lebensstilkonzepte bildete die Argumentation, dass der Anstieg des Wohlstands, die Bildungsexpansion und die Veränderung von Arbeit, eine Enttraditionalisierung und gleichzeitige Pluralisierung von Lebenslagen und Lebensstilen nach sich zog, so dass die Klassen- und Schichtmodelle dem Zeitgeist nicht mehr entsprechen würden. In Stefan Hradils Buch (1987) „Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft“ werden die wichtigsten Argumente für diese Neuorientierung zusammengefasst. Hradil zufolge, erwachsen in den „postindustriellen“ Gesellschaften Vor- und Nachteilen für die Individuen aufgrund des Geschlechts, Alters, ihrer Wohnregion oder ethnischen Zugehörigkeiten. So können bestimmte Bevölkerungsgruppen beispielsweise hinsichtlich der Variablen wie Bildung, Einkommen oder Berufsprestige übereinstimmen, hinsichtlich aber weiterer Dimensionen sozialer Ungleichheit, wie Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Integration – sich deutlich unterscheiden: gleiche soziale Schicht aber unterschiedliche soziale Lage. Die neuere Milieu- und Lebensstilforschung wollte das Verständnis vermitteln, dass Lebensweisen heute weit weniger von äußeren Lebensbedingungen wie Klassen- oder Schichtzugehörigkeit abhängig sind. So kamen Zapf et al. auf 25 sogenannte Lebensformen, die vor allem auf den Familien- und Haushaltsstrukturen und dem Alter basieren (vgl. Zapf et al. 1987:32). Hradil wiederum unterscheidet sieben soziale Makromilieus für die Bundesrepublik (Hradil 1987: 169). Gerhard Schulze hat mit seiner Studie „Die Erlebnisgesellschaft“ einen umfassenden Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Milieustruktur vorgelegt. Aus seiner Sicht bilden sich soziale Milieus durch die Beziehungswahl und die Wahl eines persönlichen Stils, der soziale Zugehörigkeit oder Abgrenzung mit sich zum Vorschein bringt. 7 „Milieus werden den Menschen in einer gesellschaftlichen Situation, wie sie für Nationen mit einem hohen Lebensstandard charakteristisch ist, nicht einfach vom Schicksal verordnet. Man kann wählen, mehr noch: Man muss wählen, wenn man überhaupt noch irgendwo dazugehören möchte“ (Schulze 1992:177). Die Präferenzstrukturen ästhetischer Beziehungswahlen erfolgen im Rahmen des Alters, der Bildung und dem alltagästhetischem Stil der Menschen: „Genau hier sind wir am Übergang von einer Theorie gegenwärtiger Alltagsästhetik zu einer Theorie der gegenwärtigen Großgruppenstruktur angelangt. Bildung und Lebensalter disponieren psychisch und physisch für bestimmte Positionen in der fundamentalen Semantik und damit auch im dimensionalen Raum der Alltagsästhetik. Zusammen mit dem Stiltypus (…) verbinden sich Bildung und Alter zu einer signifikanten und evidenten Zeichenkonfiguration, an der sich die Menschen bei der Konstitution sozialer Milieus orientieren“ (Schulze 1992:166). Schulze präsentiert in seiner Studie ein alltagsästhetisches Schema, das insgesamt fünf soziale Milieus für die Bundesrepublik erfasst, und die durch eine Alters- und eine Bildungsgrenze strukturiert sind. Dabei werden: Harmonie-, Integrations-, Niveau-, Unterhaltungsund Selbstverwirklichungsmilieus unterschieden. Hradil argumentiert, dass die Vielgestaltigkeit der Milieus die Vielgestaltigkeit der Realität wiederspiegelt und somit die These von der Pluralität der Milieus und Lebensstile bestätige. Im Zentrum der Argumentation von Schulz steht nicht- wie bei Bourdieu – die Verknüpfung von Struktur und Praxis, sondern eine individualisierte Perspektive, die soziale Milieus als gewählte Wissens- und Zeichensysteme zusammenfasst. Zwar existieren soziale Milieus als Großgruppen weiterhin, die Mitgliedschaftsregeln von einer Beziehungsvorgabe zu einer Beziehungswahl haben sich jedoch verändert. Somit bleibt die Frage nach einer Verknüpfung von Lebensstil und soziale Ungleichheit offen. Anders gesagt: die Milieu- und Lebensstilforschung zeigt das Bild der bunten und dynamischen Vielfalt der Lebensbedingungen. Der gesellschaftskritische Gehalt ist hier verloren gegangen. Aus Bourdieuscher Sicht ist diese Grundsatzdebatte falsch, denn es geht um Stellenwert und Vorrang des „Objektiven“ oder des „Subjektiven“. Einerseits wird behauptet, dass Einkommen, Bildung und andere Ressourcen für die Lebensbedingungen der Menschen viel wichtiger wären als kulturelle Phänomene wie Einstellungen, Meinungen, Verhaltensformen. Anderseits wird immer mehr die Meinung vertreten, dass soziokulturelle Phänomene in den modernen Gesellschaften zunehmend bedeutsamer werden. Mit der ständigen Verbesserung von Lebensbedingungen können Individuen ihr Leben in immer höherem Maße eigenständig wahrnehmen, interpretieren und gestalten. Letztendlich geht es in diese Auseinandersetzung um die Frage nach Grad und Art der Differenziertheit moderner Gesellschaften und deren strukturbildenden Prinzipien. 8 Die Milieu- und Lebensstilkonzepte sind mit der Frage nach einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu konfrontieren. Nicht nur, dass die verschiedenen Modelle wenig Anknüpfungspunkte zueinander aufweisen. Die von verschiedenen Autoren diagnostizierten Lebensstile und Milieus können in einzelnen Konzepten nicht miteinander vergleichbar gemacht werden. Wenn der Vorwurf gegenüber den Klassen- und Schichtkonzepten ihre Fixierung auf objektive Dimensionen lautet, so ist es bei der Lebensstilforschung ihr Hervorheben subjektiver Handlungsdimensionen. Die reine Deskription der Erscheinungsformen von Lebensstilen und die Vernachlässigung von materiellen-strukturellen Ursachen erhebt keinen Anspruch daran soziale Ungleichheiten und deren Reproduktion zu erklären. Zudem bemüht sich eine große Zahl der Lebensstilkonzepte mehr um Plausibilitäten als um theoretische Herleitung und Begründung auf ihrer Ebene. Es verlangt aber eine gesellschaftstheoretische Begründung, wenn sich der Lebensstilansatz in der sozialen Ungleichheitsforschung behaupten will. An diesem Punkt drängen sich die Vorzüge von Bourdieu auf. Die Grundannahme Bourdieus lautet, dass Lebensstile sich als Optimierung von Handlungsressourcen ökonomischer, kultureller und sozialer Art mit dem Ziel eines symbolischen Distinktionsgewinns darstellen lassen. In seiner Analyse geht es im Prinzip um die Darstellung spezifischer Lebensstile in Bezug auf einzelne Kapitalfraktionen und ihre Homologie zu Umfang und Struktur der verfügbaren Kapitalformen. Das Wichtigste ist: Lebensstile werden nicht nur in ihren unterschiedlichen vielfältigen Erscheinungen beschrieben, sondern nach ihrer Funktion bezüglich vertikaler oder horizontaler Abgrenzung strukturiert. Moderne soziale Ungleichheit ist vor allem wirtschaftliche Ungleichheit. Dieser Ausgangpunkt wird über Karl Marx, Max Weber, Theodor Geiger bis in heutige Arbeiten überliefert. Die Differenzierungstheorie eröffnet eine andere Traditionslinie. Niklas Luhmann ist einer der wichtigsten Referenzautoren. Luhmann (1986) zufolge, gliedert sich die Moderne in etwa ein Dutzend funktional spezialisierte Teilsysteme, die jeweils selbstreferentiell geschlossene Sinnzusammenhänge darstellen und als solche um einen jeweils eigenen binären Code wie z. B. »zahlen/nicht zahlen« in der Wirtschaft oder „Recht/Unrecht“ im Rechtssystem zentriert sind. Die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft ist somit kulturell konstituiert, beruht auf evaluativen Deutungsstrukturen, die einem Akteur sagen, was in einer Situation erstrebenswert ist. Die binären Codes der Teilsysteme bzw. Leitwerte der „Wertsphären“ stellen Maßstäbe dafür dar, was in einem teilsystemischen Handlungszusammenhang etwas »zählt«, worum sich das handelnde Zusammenwirken der involvierten Akteure dreht. Pierre Bourdieu (1999: 360–365) nennt dies in seiner differenzierungstheoretisch angelegten Theorie sozialer Felder treffend die feldspezifische »illusio«. Luhmann diagnostiziert in der Entwicklung moderner Gesellschaften einen Wandel im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, der sich mit dem Übergang von stratifikatorischer zu funktionaler Differenzierung vollzieht: das 9 Individuum kann nicht mehr durch Inklusion, sondern nur noch durch Exklusion definiert werden. Das, was das Individuum ausmacht, lässt sich nicht mehr durch eine Analyse gesellschaftlicher Normen und Institutionen, d.h. sozialer Erwartungsstrukturen herausfinden. Mit steigender Komplexität der gesellschaftlichen Strukturen erhöht sich die Autonomie der Individuen, ihr Handel ist nicht mehr weitgehend durch den sozialen Zusammenhang determiniert. Luhmann bringt dabei die typischen Entfremdungsphänomene der Moderne auf eine systemtheoretische Formel, die sich auf die Inklusions„Bedürftigkeit“ des Individuums bezieht. Seinem Modell zufolge findet sich das Individuum in einer funktional strukturierten Gesellschaft zunächst außerhalb der Gesellschaft wieder und muss sich in die relevanten Teilbereichen erst einschreiben. Auf dieser Weise können die Individuen nun theoretisch an allen Funktionssystemen teilnehmen, sind selbst aber aus der Gesellschaft in ihre Umwelt verbannt. Damit wird ihre konkrete Platzierung zum Problem: Individuen müssen sich an allen Kommunikationen beteiligen können und wechseln entsprechend ihre Kopplungen mit Funktionssystemen von Moment zu Moment. Die Gesellschaft bietet ihnen folglich keinen sozialen Status mehr, der zugleich das definiert, was der Einzelne nach Herkunft und Qualität „ist“. Sie macht Inklusion von hochdifferenzierten Kommunikationschancen abhängig, die untereinander nicht mehr sicher und vor allem nicht mehr zeitbeständig koordiniert werden können. Luhmann spricht von einer „Mischexistenz“: niemand mehr kann eine ausschließliche juristische, familiäre oder religiöse Existenz führen, sondern muss jederzeit Zugang zu den verschiedenen Teilsystemen haben, ohne auch nur einem dieser Systeme jemals anzugehören. Diesen Tatbestand bezeichnet Luhmann mit dem Begriff Inklusion. Mit dieser Bestimmung von Inklusion ist gleichsam das Minimalprogramm formuliert, dass es dem einzelnen ermöglichen soll, an den Leistungen der ausdifferenzierten Funktionssysteme partizipieren zu könne. Nimmt der Einzelne keines der Angebote in Anspruch, muss er dies individuell verantworten. So drängt das Inklusionsangebot gewissermaßen mit sanfter Gewalt auf Inanspruchnahme. Aus diesem Konzept werden bereits hier entscheidende Folgen erkennbar: zum einen leistet eine funktional differenzierte Gesellschaft, nach Luhmann, die potentiell universelle Inklusion in die Teilsysteme. Damit bedient die Idealisierung der möglichen Vollinklusion des Menschen und treibt politische Partizipationskonzepte voran. Zum anderen ergeben sich aber Schwierigkeiten für das Individuum, dessen Identität durch die ständig wechselnden Partialinklusionen zersplittert scheint (vgl. Luhmann 1997: 707–865). „Die Differenzierungstheorie, sei es in der systemtheoretischen oder der handlungstheoretischen Variante, stellt eine Herausforderung für die soziale Ungleichheitsforschung dar, weil sie ein umfassenderes Verständnis der Moderne gibt – gegenüber der Ökonomielastigkeit der Ungleichheitstradition. Diese war und ist starkem Maße in eine Theorie der Kapitalismus eingebettet, an deren Stelle heute eine differenzierte Beschreibung der modernen Gesellschaft getreten ist. Ihr Kennzeichnen ist nicht nur die Verselbständigung der kapitalistischen Ökonomie, sondern der weiteren primären Bereiche (wie 10 Politik, Recht, Wissenschaft, Kunst, Familie, Religion) sowie zusätzlicher sekundärer Bereiche (Gesundheit, Sport, Medizin, Erziehung, Medien), deren Ordnungs- oder Teilsystemstatus noch nicht zufriedenstellend geklärt ist“ (Schwinn 2015: 8). Das heutige Verteilungs- und Ungleichheitsverhältnis, das die Lebenschancen von Menschen von mehreren verschiedenen Institutionen abhängig macht, übt eine ernstzunehmende Kritik an die rein klassentheoretische Erfassung von sozialer Ungleichheit: das Beharren auf dem Ansatz der Klassenanalyse erschwere nur, so die Kritik, die Erfassung von neuen Formen sozialer Ungleichheit, während die horizontalen Disparitäten bereits in zunehmendem Ausmaß an die Stelle vertikal bestimmter ökonomischer Ungleichheit treten oder diese zumindest ergänzen. Bezogen auf die Differenzierungstheorie bedeutet dies, dass Individuen je nach Lebenslage in unterschiedlichen sowohl privilegierten als auch defizitären Situationen versetzt werden können. Zusätzlich lässt die Individualisierungstheorie von Ulrich Beck neue plurale Formen sozialer Ungleichheit ins Blickfeld treten. Zusammenfassend könnte man die Differenzierungstheorie mit der folgenden These abschließen: soziale Ungleichheit ist das Ergebnis institutionalisierter Laufbahnen, die Lebenslagen differenzieren und schichtspezifisch selektiv gewählt werden. Erklärungsbedürftig bleibt aber die Frage: „wieso sind Positionen und Leistungen unterschiedlich mit Privilegien ausgestattet, obwohl diese differenziellen Gratifikationen nicht zwingend aus horizontalfunktionalen Sachgesetzlichkeiten abgeleitet werden können?“ (Schwinn 2015: 35). Denn: ein Schlosser mag in seinem Beruf extrem begabt sein, aber er wird nicht über jene Privilegien verfügen können, mit denen die anderen, mehr angesehenen Berufe ausgestattet sind. Das heißt: der institutionell vorgegebene Positionsrahmen verteilt Vor- und Nachteile – und kann auch durch individuelle Leistungen nicht in einer Art kumulativen Dynamik durchbrochen werden. Luhmann stellt fest (1985:145), dass die Entlohnung der beruflichen Leistungen nicht nach funktionalen Kriterien, sondern über den Umweg sozialer Ungleichheit geschieht. Denn es gibt keinen universellen Maßstab, über den der Wert der einzelnen differenzierten Leistungen im direkten Vergleich zu den anderen Leistungen übersetzbar oder vergleichbar wäre. Unter dem Aspekt des Entlohnungskriteriums, gilt das Angebots-NachfrageVerhältnis auf dem Arbeitsmarkt als entscheidendes Element. In vielen Tätigkeitsbereichen sind die Entlohnungskriterien fest geregelt: wie etwa im öffentlichen Dienst oder für Sozialhilfeempfänger. In beiden Fällen orientiert man sich an „eine adäquate Entlohnung im Sinne einer bestimmten Lebenshaltung sowie des angemessenen Lebensstandards“. Für Top Manager, dagegen gibt es keine Grenzen für die finanzielle „Steigerung nach oben“. Georg Simmel (1977) stellt auch fest, dass es eine Inkommensurabilität vorliegt, die jede angemessene Bezahlung für eine bestimmte Tätigkeit oder einen bestimmten Beruf illusorisch macht: „Die Bedeutung der Bezahlung kann hier nur sein, dass man das Entsprechende beiträgt, um dem Leistenden 11 die angemessene Lebenshaltung zu ermöglichen, nicht aber, dass sie und die Leistung sich sächlich entsprächen“ (ebd. 368 f.). Die ökonomische Entlohnung erfolgt somit über einen Umweg – über die für die Reproduktion der Arbeitskraft nötigen Mittel. Anders gesagt: durch die Vergleiche der Gruppen innerhalb der sozialen Ungleichheitsverhältnisse. Somit verteilt der institutionell vorgegebene Positionsrahmen Vor- und Nachteile, die man allein durch individuelle Bemühungen, nicht durchbrechen kann. Aus dieser Perspektive ist die soziale Ungleichheit ein bloß durch die Institutionen gesteuertes Ergebnis, das sich im Effekt zu differenziellen Lebenschancen kumuliert. (Vgl. Kapitel Schwinn 2015, 32-38). 2.2 Zusammenfassung und Bewertung der Konzepte zur sozialen Ungleichheit Der Begriff „Klassengesellschaft“, so wie Marx ihn zu seiner Zeit verstanden hatte, wird ohne große Einwände auf die industrielle Gesellschaft des 19. Jahrhunderts übertragen. Die besondere Angemessenheit des Begriffs für die frühen Entwicklungsstadien der Industriegesellschaft bedeutet nicht, dass dies auch für die heutigen Gesellschaften gilt. Vester (1998) ist beispielsweise der Meinung, dass die industrielle Klassengesellschaft zu Marx Zeiten lediglich einen historischen Sonderfall darstellt und für die heutigen Verhältnisse keinen Anspruch erheben kann. Seine Aussage beruht auf der „Entzauberung“ des Klassenbegriffs in der Moderne, wo Arbeit und Kapital keine konflikthervorrufenden Antagonismen mehr sind. Sinnvoll ist es den Klassenbegriff zu benutzen, wenn man die ökonomischen Reproduktionsbedingungen für die Erforschung vertikaler Ungleichheit berücksichtigen will. Zum Beispiel wenn das Angebot an Arbeit deutlich hinter der Nachfrage zurückbleibt, wenn es eine große Anzahl an Arbeitslosen gibt, dann ist die Gefahr zur Ausbeutung besonders groß. Es muss aber auch konstatiert werden, dass der Einfluss des Verhältnisses von Kapital und Arbeit nicht in allen Bereichen gegenwärtiger Gesellschaften gleiche Wirkungen aufweisen, da neben der Kapitalakkumulation im Arbeitsprozess noch andere Reproduktionsformen der modernen Gesellschaften auftreten. Darunter sind auch die neuen sozialen Ungleichheiten anzusiedeln. Im Bourdieuschen Kontext würde man dann den distinktiven Charakter des Geschmacks erwähnen. Das heißt: die Klassen werden durch die Art des Konsums reproduziert. Die Klassenstruktur ist Alltagsbeobachtungen immer weniger zugänglich. Wenn man das Ende der Klassengesellschaft an dem Fehlen einer Arbeiterklasse mit dem entsprechenden Lebensstil verweist, so übersieht man die Klassenformierung am Ende der Statusgliederung. Das Bourdieu-Konzept soll dabei die Klassenhypothese vor dem Ausschluss bewahren und verdeutlichen, dass Klassen unter der lebensweltlichen Oberfläche weiter existieren. Auch wenn die lange fungierenden Klassen- und Schichttheorien heute nahezu als unbrauchbar angesehen werden, wird mit Bourdieu deutlich, dass die ungleichen sozialen Gruppen nicht verschwunden sind. 12 Die neueren Ansätze zur Sozialstrukturanalyse deuten den Perspektivenwechsel an: Individualisierung, Pluralisierung von Milieus, Entkoppelung sind die zentralen Kernpunkte. Bourdieu – als Lebensstiltheoretiker gelingt hier eine interessante Gegenüberstellung, weil er, ungeachtet seiner Milieu- und Lebensstilkonzepten, gleichzeitig an einem Klassenmodell festhält. Der Schwerpunkt seiner Gegenüberstellung liegt darin, dass Bourdieu dem radikalen Perspektivenwechsel nicht ausnahmslos zustimmt, sondern sich um ein Zusammenwirken von vertikalen (Macht, Bildung, Einkommen, Berufsprestige) und horizontalen (Geschlecht, infrastrukturelle Anbindung) Strukturen bemüht. Die Fragen der Macht und Herrschaft haben bei ihm einen erheblichen Stellenwert, was auf einen Hang zur traditionellen Sozialstrukturanalyse hindeutet. Dass Bourdieu die Gegenwartsgesellschaft überhaupt als eine Klassengesellschaft sieht ist keineswegs für den gegenwärtigen Stand der soziologischen Diskussion selbstverständlich: „Leugnet man die Existenz der Klassen, (…), leugnet man letzten Endes die Existenz von Unterschieden und Unterscheidungsprinzipien überhaupt“ (Bourdieu 1998:25). Die Vertreter einer neueren, ausschließlich horizontal orientierten Sozialstrukturanalyse argumentieren, dass die Soziallagen und damit Lebensformen vielfältiger geworden sind, die Menschen sich aus sozialen und kulturellen Bindungen herausgelöst haben. Dabei bleibt die Frage, im Rahmen des Entstehens von neuen Freiheiten, nach dem qualitativen Ausmaß dieser Freiheiten, ungeklärt. Die von neueren Sozialstrukturtheorien diagnostizierten Pluralisierungstendenzen der Gesellschaft überschatten im Endeffekt eine Enttstrukturierungstendenz, die eine Ungleichheitsforschung zu einer Vielfaltsforschung verkommen lässt. „Mit der unkritischen Fokussierung auf die dynamische Vielfalt der Lagen, Milieus und Lebensstile wird der kritische Blick für weiterhin bestehende vertikale Ungleichheitsstrukturen getrübt. Es besteht die Tendenz, dass vertikale Strukturen wegdifferenziert, wegpluralisiert, wegindividualisiert und wegdynamisiert werden. Sie werden mit einem Schleier von Prozessen der Individualisierung, Pluralisierung, Differenzierung und Dynamisierung verhüllt und unkenntlich gemacht“ (Geißler 1996:323). Bourdieu hingegen schafft es, vertikale und horizontale Strukturen in seinem Konzept zu berücksichtigen. Er vermischt nicht die ressourcenbezogene Ebene mit der Verschiedenartigkeit. Da Bourdieu Lebensstilanalyse mit Klassenanalyse verknüpft, bleibt er der klassischen Tradition der Sozialstrukturanalyse treu. Der Vorzug dabei ist, dass die Lebensstile sich als Optimierung von Handlungsressourcen sozialer, ökonomischer und kultureller Art mit einem symbolischen Distinktionsgewinn darstellen lassen. Sie werden von Bourdieu nicht nur in ihrer unterschiedlichen Erscheinung beschrieben, sondern auch nach ihrer Funktion bezüglich vertikaler oder horizontaler Abgrenzung strukturiert. 13 Es könnte der Eindruck erweckt werden, dass die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft und damit Erweiterung der Handlungsoptionen des Einzelnen zur möglichen Reduzierung von Ausschlussmechanismen führt. Nun ist zu konstatieren, dass die neuen Freiheiten vertikale Ungleichheiten für das Individuum reproduzieren und verfestigen. Trotz individueller Handlungsspielräume erklärt Bourdieu vertikale Ungleichheiten durch den klassenspezifischen Habitus, der in jeder Generation vorhanden ist. Gleichzeitig wirft Bourdieu die Frage nach Verankerung vom klassenspezifischen Denken und Handeln der Menschen auf. Da die Klassenstruktur den Alltagsbeobachtungen immer weniger zugänglich ist, bewahrt das Bourdieusche Konzept die völlige Ausschließung von Klassenhypothese. Bourdieu stellt auch klar, dass in der modernen Sozialstruktur Klassen keine sozialen Gruppierungen mit klaren Grenzen sind. Lebensstile und Lebenschancen können dem Habitus entsprechend untypisch sein, was klare Klassengrenzen verschwimmen lässt. In diesem Sinne versucht Bourdieu die Klassen nicht als „Realtypen“ aufzufassen, sondern als heuristische Instrumente. Seine Konzepte des sozialen Raums oder des Habitus bieten eine wertvolle Grundlage zum besseren Verständnis der gegenwärtigen Gesellschaft. Schließlich zeigt Bourdieu die Perspektive, wie ein Schritt in die Richtung der sozialen Ungleichheit-Analyse gemacht wird, welche die soziale Lage und Lebensstil auf einer fruchtbaren Weise miteinander verknüpft. Bedeutsam für die heutige Sozialstrukturanalyse sind auch Bourdieus theoretische und konzeptionelle Zugänge zur Untersuchung der Phänomene sozialer Ausgrenzung- und Unterscheidungsmechanismen. Erwähnt werden müssen auch Bourdieus objektive wie subjektive Aspekte einbeziehender Lebensstilbegriff und sein Konzept der Darstellung und Anerkennung ökonomischer, sozialer und kultureller Ressourcen und Praktiken als symbolisches Kapital. Zudem hat Bourdieu gezeigt, dass nicht die Auflösung der Klassen und Schichten das Ergebnis des Modernisierungsprozesses ist, sondern die Herausbildung einer dynamischen und pluraleren Klassenstruktur. Bourdieus Ansatz stellt eine der größten kultursoziologischen Herausforderungen in der gesellschaftstheoretischen Diskussion da und führt zu einer Reorientierung in der Ungleichheitsforschung: „Im Bereich der Klassen-, Schichtungs- und Mobilitätsforschung gibt es kaum ein Pendant zu seinen Untersuchungen, die ebenso theoretisch diszipliniert, methodisch kontrolliert und empirisch kreativ in Form von Global- und Detailanalysen dem Zusammenhang von „Klasse“ und „Stand“ und damit der Bedeutung der sozialen Ungleichheit in fortgeschritten Konsumgesellschaften nachgehen. Bourdieus Ansatz ist daher in besonderer Weise zur theoretischen Reorientierung der Ungleichheitsforschung geeignet“ (Müller 1992:365). Abschließend lässt sich die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass der richtige Weg zur angemessen Analyse der gegenwärtigen Sozialstruktur nicht in der vollständigen Ablehnung von der Marxschen Klassentheorie erfolgen kann. 14 Dabei ist zu beachten, dass es der Ergänzung seiner Theorie mit den „neuen“ Sozialen Ungleichheiten der Gegenwart bedarf. Es muss der Mittelweg zwischen den beiden extremen Gesellschaftsinterpretationen gefunden werden: zwischen der These von dem unverminderten Fortbestehen einer Klassengesellschaft und der These einer hochdifferenzierten und individualisierten Gesellschaft. Bourdieus soziokulturelle Klassentheorie stellt einen möglichen Mittelweg zwischen den vorgestellten Extrempositionen da. (vgl. Kapitel: Bourdieu 1998: 18-25; Geißler 1996: 320-323; Müller 1992: 360-365). 3.1 Die soziokulturelle Gesellschaftstheorie nach Bourdieu Kultur ist für Bourdieu das entscheidende Medium zur Reproduktion von Klassenstrukturen. Die zentrale These dabei lautet, dass Klassenzugehörigkeit am deutlichsten in differenziellen Lebensstilen zum Ausdruck kommt. Seine Gesellschaftstheorie erfasst die Beziehungen zwischen Klassenzugehörigkeit, kultureller Praxis, Bildungspartizipation und Lebensstilen. Als das Kernstück der Bourdieuschen Theorie kann die Analyse der Zusammenhänge zwischen Sozialstruktur und Kultur angesehen werden. Die Auseinandersetzung mit Herrschaft bzw. Reproduktion von Herrschaft stellt den Hintergrund für seine Untersuchung dar. Die Theorie der Klassen ist bei Bourdieu in seine soziokulturellen Gesellschaftsstudien eingebettet. Eine separate Klassentheorie hat Bourdieu nicht entwickelt. Um zu verstehen, was er unter Klassen meint, muss dem inhaltlichen Zusammenhängen gefolgt werden: so ist der Begriff Klasse eng mit den Begriffen sozialer Raum, Feld und Habitus verbunden. Der soziale Raum bei Bourdieu ist der Rahmen, in dem die gesellschaftlichen Positionen der Individuen und ihre Lebensstilen verortet werden. Dabei nutzt Bourdieu für die Konstruktion des sozialen Raumes zwei Kapitalarten: das ökonomische und das kulturelle Kapital. Der soziale Raum zeichnet sich durch seine Dreidimensionalität aus: die vertikale Dimension umfasst das Gesamtvolumen an kulturellem und ökonomischem Kapital. In der horizontalen Dimension wird eine Differenzierung nach Zusammensetzung des Kapitals und in einer dritten die zeitliche Differenzierung vorgenommen. Die quantitative wie qualitative Kapitalbestimmung lassen die Positionen der Individuen im sozialen Raum bestimmen. Dabei ist der Raum der Positionen gleich dem Raum der Lebensstilen: „Der soziale Raum und die in ihm sich spontan abzeichnenden Differenzen funktionieren auf der symbolischen Ebene als Raum von Lebensstilen“ (Bourdieu 1985:21). Die Lebensstile versteht Bourdieu als strukturierte Zeichensysteme, die eine soziale Kategorisierung durch Klassifikation erlauben: 15 „Das Wesentliche aber ist, dass diese unterschiedlichen Praktiken, Besitztümer, Meinungsäußerungen, sobald sie mit Hilfe der entsprechenden sozialen Wahrnehmungskategorien, Wahrnehmungs- und Gliederungsprinzipien wahrgenommen werden, zu symbolischen Unterschieden werden und eine regelrechte Sprache bilden“ (Bourdieu 1998:21f.). Bourdieu verwendet einen relationalen Klassenbegriff, der in seiner Unterscheidung in Klassenstellung und Klassenlage zum Ausdruck kommt. Die Klassenlageergibt sich Bourdieu zufolge aus einer Reihen sozioökonomischer Faktoren. Die entsprechende Klasse steht in diesem Sinn für sich. Die Stellung einer Klasse gibt wieder, wie diese in Relation zu anderen Klassen innerhalb einer gesellschaftlichen Totalität dasteht. Bourdieus Klassentheorie, die auf den Zusammenhang zwischen Klasse und Klassifikation gerichtet ist, erhält folgende Kernelemente: das Volumen des Kapitals; die Struktur des Kapitals; die soziale Konstruktion von Klassen durch symbolische Auseinandersetzungen zwischen Subjekten und Gruppen. Der letzte Punkt des Klassenkonzepts berücksichtigt die Laufbahneffekte, die in der zeitlichen Dimension des sozialen Raums verankert sind. Als Ausdruck kollektiver Laufbahnen sind wiederum die Positionen der Individuen, die tendenziell den Aufstieg oder Abstieg sozialer Karrieren aufzeigen. Bourdieus Vorstellung von Klassen wird jedoch erst deutlich, wenn der Habitus- Begriff in das Konzept der Klasse eingeführt wird. Zum empirischen Ausdruck kommen die Klassen nach Bourdieu aber hauptsächlich im Raum der Lebensstile, der sich homolog zum Raum der sozialen Positionen, aufgrund differenzierter Praktiken der Lebensführung, bildet. Und so „bietet sich der Geschmack als bevorzugtes Merkmal von „Klasse“ an“ (Bourdieu 1982:18). Geschmack ist dabei keine zufällige Kategorie, sondern resultiert aus der Sozialstruktur der Individuen. Die Verknüpfung zwischen Struktur- und Handlungsebene erfolgt, wie schon bereits erwähnt, über das Konzept des Habitus. Der Habitus ist die Grundhaltung eines Menschen zu sich selbst und zur Welt. Der Begriff umfasst Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkkategorien, Verhaltensstrukturen und Möglichkeiten des Individuums. Die unterschiedlichen Habitus zeigen sich in unterschiedlichen Arten sich zu kleiden, essen, amüsieren, aber auch in unterschiedlicher Lebensführung- und Zielen, Weltsichten und Einstellungen der Menschen. Bourdieu nennt den Habitus auch „strukturierte Struktur“ in dem Sinne, dass der durch Erfahrungen geprägt wird. In ihm ist die soziale Ordnung inkorporiert. Anderseits ist Habitus auch „strukturierende Struktur“ – er generiert das Handeln eines Menschen, so dass die Geschichte und die Umwelt, in der er lebt, bis zu einem gewissen Grad von ihm strukturiert wird. In der Bourdieuschen Theorie stellt der Habitus die Vermittlungsinstanz zwischen Struktur und Praxis dar: zum einen werden die mit dem Habitus vermittelten (Geschmacks-)Vorstellungen von dem Individuum in seiner 16 psychischen Struktur internalisiert, zum anderen geht der Habitus auch in die physische Struktur des einzelnen ein. Der Habitus basiert auf der Klassenzugehörigkeit und der damit verbundenen kollektiven Geschichte. Die Frage nach Zusammenschlüssen gesellschaftlicher Gruppen wird bei Bourdieu so erklärt: eine Klasse kann als eine „Klasse auf dem Papier“ durch die Nähe der Positionen im sozialen Raum objektivistisch betrachtet werden, zu einer wahren wird sie jedoch erst durch die klassifikatorische Praxis der Subjekte. Die Praxisformen der Individuen können distinktive oder integrative Segmente zum Vorschein bringen. Im Bourdieus Sinne sind dann die Lebensstile als Kampfinstrumente aufzufassen. Denn es wird nicht nur um Verteilung von Gütern und Dienstleistungen konkurriert, sondern auch um die legitimen Standards und die distinktiven Lebensstile. Die durch soziale Positionen bedingten Unterschiede führen somit zu symbolischen Auseinandersetzungen. Praktisch alle Lebensäußerungen der Individuen erhalten von dieser Situation des niemals anzusetzenden Kampfes um die soziale Position ihre soziale Bedeutung, ihren objektiven Sinn. Bourdieu unterscheidet drei stilistische Einheitlichkeiten als verbindendes Element innerhalb der Klassen: den legitimen Geschmack, den mittleren Geschmack, den populären Geschmack. Die drei großen Geschmacksdimensionen leiten sich aus der Differenz ab, die zwischen den drei großen Klassen im sozialen Raum bestehen. Der „legitime“ Geschmack ist bei den Menschen mit großem Kapitalbestand, mit hohem ökonomischem und kulturellem Kapital, zu finden. Diese Klasse, die Bourdieu der herrschenden zuordnet, zeichnet sich durch einen Sinn der Distinktion aus. Der „mittlere“ Geschmack resultiert als Geschmacksform der Mittelklasse, die Geschmacksnormen der herrschenden Klasse zu kopieren versucht. Wenn die herrschende Klasse sich durch Selbstbewusstsein, Natürlichkeit im Umgang mit den selbst definierten Normen auszeichnet, so haftet das Kleinbürgertum die Schwerfälligkeit und das permanente Gefühl die Vertreter des „legitimen“ Geschmacks nachahmen zu müssen. An der untersten Stufe der drei Dimensionen befindet sich der „populäre“ Geschmack, der von Bourdieu auch als „Notwendigkeitsgeschmack“ genannt wird: es wird sich nur das gewünscht, was man auch erfüllen kann. Bedürfnis und Möglichkeit sind hier miteinander verwoben. Im Unterschied zu den beiden anderen Geschmacksrichtungen, ist diese am häufigsten in unteren Schichten mit niedrigem Bildungskapital zu finden. Insgesamt sollen diese drei großen Klassen nur als Grobgliederung betrachtet werden, sie stellen keine Bestimmung der einzelnen homogenen gesellschaftlichen Gruppen da. Bourdieu war sich wohl bewusst, dass die Klassen differenzierter sind und dass auch innerhalb der Klassenfraktionen Machtverhältnisse und Kämpfe und die Positionen existieren. Daraufhin entwickelte Bourdieu das Konzept des sozialen Feldes. Bourdieu geht davon aus, dass die internen Habitus Strukturen nur eine Seite der Praxis ausmachen, die andere sind die externen, objektiven Strukturen der 17 sozialen Felder. Ihm zufolge sind Felder, strukturierte Räume, in denen die Praxis vom Habitus stattfindet. Ein Feld ist dabei eine Art Spielraum, in dessen Autonomie nach gewissen Regeln gespielt wird. Die Regeln des Feldes legen fest, was im Rahmen des Spieles möglich und unmöglich ist, beispielsweise: ein ausdifferenziertes ökonomisches Feld in kapitalistischer Gesellschaft, in dem nach den Regeln einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz gespielt wird. Diese Feldspezifischen Regeln stellen einen Zwang da, dem sich die Akteure dieses Feldes nicht entziehen können, ohne das Spiel zu verlassen. Ein weiterer Zwang ergibt sich aus der Knappheit der Ressourcen, die in diesem Feld zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bestimmt die Verfügbarkeit der entsprechenden Sorte von Kapital die Handlungs- und Profitchancen der Akteure. Das Feld ist demnach die „Kampfarena“, in der die Spielteilnehmer durch Einsatz ihrer Kapitalarten um günstige Positionen kämpfen. Es ist festzuhalten, dass die Akzeptanz bzw. Internalisierung der feldbezogenen Normen als Grundvoraussetzung für die Position des Individuums in einem Feld gilt. Der Glaube an eine Feldzugehörigkeit ist wie der Habitus inkorporiert. Für das Individuum ist das Feld natürlich kein Spiel, sondern etwas Selbstverständliches, das zur eigenen Identität gehört. Mit dem Konzept des Habitus hat Bourdieu das Eingehen des Sozialen in das Individuum aufgezeigt, mit dem Konzept des Feldes wird dieser Gedanke ausgedehnt. Bourdieu möchte damit sagen, dass die soziale Welt nicht nur im Habitus existiert, sondern auch in Form des Feldes, in physischen Objekten: „Die soziale Welt existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, in den Feldern und in den Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure“ (Bourdieu 1996:161). Die Individuen werden zwar durch verschiedensten gesellschaftliche Institutionen geprägt, doch auch sie selbst verändern und prägen die Strukturen. Daher ist es angebracht, von einem Doppelverhältnis zwischen dem Habitus und dem Feld zu sprechen. Aus den Konstruktionsleistungen der Individuen bei Bourdieu ergeben sich wichtige Ausgangspunkte für die Sozialstrukturanalyse. Nach Bourdieu sind es objektive Strukturen der ungleichen Verteilung der verschiedenen Kapitalarten, die eine Klassenkonstitution reproduzieren, sprich: ausgehend von den daraus resultierenden ungleichen Positionen der Individuen im sozialen Raum lassen sich Klassen konstruieren. Anderseits: die Klassen sind nicht allein aus der objektiven Situation heraus zu analysieren, sondern sie sind zu einem wichtigen Teil erst durch Klassifizierungen geschaffen worden, welche die Individuen, die eine Klasse bilden, selbst vornahmen. Nicht zuletzt tragen ihre „Kämpfe“ um Rangordnungen und Klassifikationen zum Bestand der Klassen bei. „Eine soziale Klasse lässt sich niemals allein aus ihrer Lage und Stellung innerhalb einer gesellschaftlichen Struktur, d.h. aus den Beziehungen bestimmen, die sie objektiv zu anderen Klassen der Gesellschaft unterhält. Eine Reihe ihrer Eigenschaften verdankt sie nämlich dem Umstand, dass die Individuen, die diese Klasse bilden, absichtlich oder ohne es zu merken in symbolische Beziehungen zueinander treten“ (Bourdieu 1970:57). 18 Streng genommen sind diese Klassen für Bourdieu nur ein Produkt der Theorie. Vielmehr geht es ihm um den analytischen Status des Begriffs, darum, ein „Modell“ sozialer Realität hervorzubringen. Und das Klassenverhältnis wird dementsprechend durch die klassifikatorische Praxis der Individuen oder Gruppen bestimmt. Zum Vergleich: wenn Bourdieu die Auseinandersetzungen um Klassifikations- und Ordnungssysteme als „symbolische Kämpfe“ bezeichnet, so spricht Marx vom ideologischen Klassenkampf. Indem ökonomische Ausbeutung und soziale/kulturelle Unterdrückung bei ihm in einen Topf geworfen werden, kommt als Ergebnis immer ein Verteilungskampf um Ressourcen heraus. (vgl. Kapitel: Bourdieu 1985, 11-21; Bourdieu 1998, 13-21f; Bourdieu 1982, 15-20; Bourdieu 1996, 145- 167; Bourdieu 1970, 46-60). 3.2 Die Klassentheorie nach Marx Bis heute hat der klassische Klassenbegriff von Marx in der Diskussion um die Klassengesellschaft eine prägende Kraft. Der marxistischen Theorie zufolge waren die menschlichen Urgesellschaften in ihrer primitiven Form klassenlos. Mit dem Übergang zu Ackerbau und Viehzucht wurde es zum ersten Mal möglich ein Mehrprodukt zu produzieren, also mehr, als jeder Einzelne zum Leben brauchte. Dem Marxismus zufolge ermöglichte dies die Klassengesellschaft, da das Mehrprodukt dazu dienen konnte, eine herrschende Klasse, die selbst am unmittelbaren Produktionsprozess nicht beteiligt war, zu ernähren. Das Wachstum der ursprünglichen Gesellschaft führte zur Arbeitsteilung und Spezialisierung der Produktionsschritte, was wiederum zu Produktivitätssteigerungen führte. Durch erheblichen Zugewinn entstand das Privateigentum – der private Besitz an Produktionsmitteln. Dies ermöglichte, dass sich eine kleine Klasse der Besitzenden und eine große – die der Besitzlosen - bildeten. Eigentum wird dann zur Trennlinie zwischen dem Proletariat und der Bourgeoise, die den von der Arbeiterklasse erzeugten Mehrwert zur Maximierung ihres Profits nutzt. Indessen ist das Proletariat gezwungen seine Arbeitskraft als Ware zu verkaufen und immer mehr zu verelenden. Beide Klassen stellten somit komplementäre Seiten eines Produktionsverhältnisses dar, welches den Reichtum der Wenigen auf Kosten der Mehrheit erzeugte. Der Ausgangpunkt von Marx Klassentheorie ist ein ununterbrochener Konflikt innerhalb der und zwischen den Klassen, welcher entsteht, weil die Bourgeoisie das Proletariat ausbeutet. Marx Interesse richtet sich vor allem auf die moderne kapitalistische Gesellschaft, die mit der industriellen Revolution im Entstehen war. Ungeachtet dessen, dass er die Differenziertheit der modernen Gesellschaft durchaus erkennt, gliedert er die Gesellschaft in 19 ökonomischer Hinsicht in zwei Großklassen: die Kapitalisten und die Arbeiterklasse. Die Kapitalisten üben eine Kommandogewalt über die Arbeiter aus, können also bestimmen, wie gearbeitet wird oder welche Produkte hergestellt werden. Die Grundbeziehung zwischen diesen beiden Klassen basiert auf dem Gegensatz von Arbeit und Kapital. Die Machtkonstellation in dieser Beziehung sieht so aus, dass die Besitzer des Kapitals den Arbeitern Löhne für eine vereinbarte Zahl von Arbeitsstunden zahlen, nicht für die erstellten Produkte selbst. Die Arbeitsprodukte landen im Besitz der Kapitalisten. Das heißt: die Arbeiterklasse erschafft den Wert, vermehrt das fremde Eigentum, hat aber gleichzeitig keine Kontrolle über Ziele und Methoden oder die Entlohnung des Arbeitsprozesses (vgl. Marx 1973, Herz 1983: 20 f.) Zentral für Marx Klassentheorie ist die Tatsache, dass die Arbeiter in der Produktion einen Wert schaffen, der ihren Lohn übersteigt – den Mehrwert. Die Bedeutung für die Klassenanalyse erhält das Mehrprodukt aufgrund seiner ungleichen Verteilung: die Kapitalisten zahlen nur existenzerhaltende Löhne und akkumulieren den Mehrwert. Das Mehrprodukt wird wiederum der unterdrückten Klasse vom Arbeitsergebnis abgezogen. Privilegierte Aneignung und Verwendung des Mehrprodukts wird somit über Macht- und Herrschaftsverhältnisse abgesichert. Während auf der Seite der Kapitalisten sich der Reichtum kontinuierlich vermehrt, entsteht auf der Seite der Arbeiter Leistungsdruck, Arbeitshetze, Existenzunsicherheit. Die Besitzlosigkeit zwingt die Arbeiterklasse ihre Arbeitskraft als Ware lebenslänglich zu verkaufen, wobei keine Garantie weder für angemessenen Lohn, noch für einen sicheren Arbeitsplatz besteht. Marx weist auf den Interessengegensatz hin: Die Kapitalbesitzer sind daran interessiert, die bestehende Lage aufrechtzuhalten, während das Proletariat auf die Auflösung der Misere zielt. Dies ist der Moment, wo das revolutionäre Interesse des Proletariats die Entwicklung des Klassenbewusstseins andeutet. Indem Menschen ihre gemeinsame Lage erkennen und ein „Wir-Gefühl“ entwickeln, wird Marx zufolge aus einer „Klasse an sich“ eine „Klasse für sich“. Mit Klassenbildung ist die Organisation des Klasseninteresses auf der politischen Ebene verbunden. Als Voraussetzung für eine klassenlose Gesellschaft wird im Marxismus die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und des Privateigentums an Produktionsmitteln angesehen. Im revolutionären Klassenkampf solle die „historische Mission“ des Kapitals vollzogen werden: Privatbesitz an Produktionsmitteln gibt es nicht mehr, die Produktionsmittel sind ausschließlich das Eigentum der Gesellschaft. Nach Marx Vorstellung soll die Gesellschaft als genossenschaftlicher Zusammenschluss freier Produzenten organisiert werden, die gleichzeitig ihre eigene Angestellten und Besitzer der Produktionsmittel sind. Der Staat als Instrument der Klassenherrschaft wird überflüssig, denn alles wird auf basisdemokratischer Ebene entschieden und geregelt. Nach der proletarischen Revolution, würde die Wirtschaft nicht mehr zu Fehlentwicklungen und Krisen tendieren, da kaum noch etwas vom kapitalistischen Konkurrenzgeist übrig bliebe. Es würde gelingen den 20 bestehenden Mangel zu beseitigen – jeder Mensch könnte nach seinen vernünftigen Bedürfnissen und in Würde leben. Einen wichtigen Punkt sieht Marx darin, dass die Arbeit nicht mehr entfremdet, sondern Ausdruck der Persönlichkeit wäre und das Entscheidende dabei: Menschen würden den Produktionsprozess mitgestalten können. Die Klassenunterschiede zwischen Arbeitern, Bauern, Intelligenz und anderen Schichten verschwinden, gleiche Rechte und Pflichten werden gesetzlich geschafft, eine klassenlose Gesellschaft entsteht. Als Voraussetzung dafür sieht Marx die Diktatur des Proletariats überall auf der Welt und die Enteignung der Kapitalisten. (vgl. Marx/Engels 1972). Marx kritisiert das Ziel der kapitalistischen Produktionsweise scharf: Geldbesitzer kaufen die Quelle des Wertes, nämlich lebendige Arbeit, organisieren die Mehrwertproduktion und vermehren dadurch ihr Eigentum. Die Vermehrung vom privaten Reichtum ist Inhalt und Zweck des ganzen wirtschaftlichen Prozesses, die Herstellung von Gebrauchswerten spielt dabei nur die Rolle eines Mittels. Zudem stellen die wiederkehrenden ökonomischen und politischen Krisen im Kapitalismus eine wichtige Bedingung für eine organisierte, bewusste Arbeiterklasse, die im revolutionären Klassenkampf die kapitalistischen Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft überwinden würde. „Denn die Produktionsverhältnisse, die auf einer bestimmten Stufe die Entwicklung der Produktivkräfte fesseln, sind auch die Fesseln der Arbeiter. Folglich werden mit der Selbstbefreiung der Arbeiter aus der Unterdrückung gleichzeitig die Produktionsverhältnisse umgewälzt“ (vgl. Korsch 1967:137). Die Diktatur des Proletariats markiert im Verlauf der historischen Entwicklung nach Marx nur eine Übergangsphase. Das eigentliche Ziel ist die Überführung der Produktionsmittel in die Hände der unmittelbaren Produzenten. In der Praxis der „kommunistischen Staaten“ war die ausgebliebene Weltrevolution nicht überflüssig geworden, sondern sie wurde das Ziel der klassenlosen Gesellschaft als anzustrebendes Ideal beibehalten. Ungeachtet der herausragenden Bedeutung der Marxschen Klassentheorie in der klassischen sozialen Ungleichheitsforschung, wird die gesellschaftliche Klassenanalyse von Marx in vielen Punkten scharf kritisiert. Ein großer Teil der Kritik wird in der Aussagegruppe begründet, dass bei Marx die soziale Ungleichheit in der modernen Gesellschaft durch und durch klassenförmig ist. Als Erklärungsziel nimmt Marx den gesamtgesellschaftlichen sozialen Wandel. Die notwendige Bedingung für den gesamtgesellschaftlichen Wandel sieht er in den die Gesellschaft kennzeichnenden Konflikt zwischen Arbeit und Kapital. Während die Kapitalisten an der Aufrechthaltung der bestehenden Verhältnisse interessiert sind, gelten die Arbeiter als die Träger des sozialen Wandels, da sie um Veränderung kämpfen. Darauf gründet Marx die Annahme, dass die gleiche Klassenlage von Menschen zu gemeinsamen Klassenhandeln führt. Aus der Klassenkampf-Perspektive heißt es: das Proletariat, im gemeinsamen Kampf mit den Leidensbrüdern, überwindet die Bourgeoisie und bekämpft gleichzeitig den ausbeuterischen Kapitalismus. Die geschichtliche Entwicklung konnte dies 21 jedoch nicht bewahrheiten: Klassenlagen haben sich nicht vereinheitlicht, der Klassengegensatz hat sich nicht vertieft. Im Gegenteil: die Klassenstruktur ist pluraler geworden, die wirtschaftlichen Lagen der Klassen haben sich mit der Zeit angeglichen, („insgesamt sind alle eine Etage höher gefahren“ (Beck)). Auch Dahrendorf sah die Annahme der Marxschen Auffassung, dass Eigentum als grundlegender Faktor der Klassenbildung fungiere, als viel zu einseitig dasan. Darauf aufbauend zweifelt er auch daran, dass die Herrschaftsverhältnisse ausschließlich aus dem Besitz von Privateigentum hervorgehen. Dass die Herrschaft auch ohne Besitz an Produktionsmitteln ausgeübt werden kann, zeigt ein simples Beispiel: ein hochqualifizierter Lohnempfänger kann zwar durch die Besitzer von Kapital ausgebeutet werden, er kann aber gleichzeitig durch den Rückgriff auf seine große Qualifikationsressource andere Lohnabhängige ausbeuten (vgl. Dahrendorf 1957: 234f). Die Zentralität der Eigentumsverhältnisse in der Marxschen Theorie tritt der heutigen Überlegung gegenüber, dass die Produktionsweisen und somit Gesellschaft in Zeiten der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Vergleich zur Marxschen Zeit sich verändert haben. Das Primat der Ökonomie und des Privateigentums wurde durch das Primat des Wissens ersetzt. Die Ausdehnung des Angestelltensektors bei gleichzeitiger Schrumpfung des traditionellen Arbeitersektors stellt die Frage nach der Veränderung von Arbeit in der Diskussion um die Klassengesellschaft. Die Frage lautet, ob durch diese gesellschaftliche Entwicklung der Antagonismus von Arbeit und Kapital tatsächlich aufgehoben und durch ein neues Prinzip des Wissens ersetzt wurde, oder ob der Gegensatz Wissen – Nichtwissen neben den Antagonismus von Arbeit und Kapital hinzugetreten ist und somit das Klassenverhältnis zusätzlich verkompliziert. Anschließend an die Kritikpunkte zu Marx Klassentheorie, lassen sich folgende Aussagen treffen: die gegenwärtigen Gesellschaften sind weit davon entfernt durch den Einfluss von Klassenzugehörigkeit neutralisiert zu werden. Auch wenn der große Zusammenbruch des Kapitalismus, wie Marx ihn prophezeite, nicht stattgefunden hat, so muss man anerkennen, dass Marx die Entwicklungsund Konfliktpotentiale, die Gefahren, ökonomischen Tendenzen und sozialen Folgen der kapitalistischen Produktionsweise analysiert und belegt hat. Auch wenn seine Theorie des Untergangs des Kapitalismus weniger fruchtbar ist, sind seine ökonomischen Analysen des Kapitals bis heute von größter Relevanz für das Verständnis einer kapitalistischen Gesellschaft (vgl. Kapitel: Marx, Karl (1849) 1973: Lohnarbeit und Kapital. In: Marx/Engels Werke Bd. 6. Berlin: Dietz). 3.3 Vergleich der Theorien: Marx und Bourdieu 22 „Es ist nur möglich, der Struktur und dem Funktionieren der gesellschaftlichen Realität gerecht zu werden, wenn man den Begriff des Kapitals in allen seinen Erscheinungsformen einführt, nicht nur in der aus der Wirtschaftstheorie bekannten Form“ (Bourdieu 1983:1984). Das Verhältnis zwischen Marx Klassentheorie und Bourdieuschen soziokulturellen Gesellschaftstheorie ergibt ein sehr indifferentes Bild. Dies beginnt schon bei der Konstruktion von theoretischen Klassen: Bourdieu zufolge ergeben sich gesellschaftliche Klassen zum einen durch ihren nahezu identischen Besitz an kulturellem und ökonomischen Kapital und zum anderen durch die klassifikatorische Praxis der Individuen während bei Marx der Besitz von Produktionsmitteln das Entscheidende für die Konstitution von Klassen ist und gleichzeitig ein Versuch zur Erklärung von sozialer Ungleichheit. Ähnlich ist es bei dem für die Marxsche Analyse so wichtigen Begriff der Ausbeutung. Bourdieu identifiziert zwar vereinzelt die Klassenverhältnisse als Ausbeutungsverhältnisse, ohne diesen Gedanke jedoch konsequent aufzuschlüsseln. Es wird offensichtlich, dass seine Theorie nicht auf einer eingehenden Kapitalismusanalyse basiert. Nichtsdestotrotz beschäftigt sich Bourdieu durchaus mit der Frage des Klassenkampfs. Er hat jedoch ein anderes Verständnis von Klassenkampf als Marx. Die Konflikttheorie bei Bourdieu ist auf den ständigen Kampf der Individuen um die Positionen im Feld ausgerichtet: Menschen setzten sich immer wieder neu mit dem Status quo auseinander. Das entscheidende dabei ist, dass die Kämpfe im sozialen Raum nicht ausschließlich auf ökonomische Vorteile zu beziehen sind. Neben dem Kampf um Verteilung von Gütern, entstehen Auseinandersetzungen um die Wertigkeit der einzelnen Kapitalarten, die ihren Ausdruck in symbolischen Kämpfen und Lebensstile finden. Die Ausdehnung des Bereichs der Ökonomie auf nicht ökonomische Bereiche im Rahmen der symbolischen Kämpfe bildet die Grundlage des Begriffs „Kapital“ bei Bourdieu. Denn Kapital, sowie Profit, haben bei Bourdieu verschiedene Erscheinungsformen: nicht nur Geld, sondern Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man in Bildungs- und Erziehungsprozessen erwerben kann. In der Bourdieuschen Theorie wird dies im Weiteren in das ökonomische, kulturelle, soziale und symbolische Kapital unterschieden. Kapital wird von Bourdieu somit als Wirkung gesellschaftlicher Beziehungsstrukturen verstanden, die er mit dem Konzept der „Macht“ gleich setzt. Es muss vorab betont werden, dass allein aus Bourdieus nicht-ökonomischen Kapitalarten noch keine Herrschaftsbeziehungen entstehen. Erst in der Verbindung zum ökonomischen Kapital entfaltet sie ihre Kraft und es können Herrschaftsbeziehungen impliziert werden. Somit unterscheiden sich die Machtmittel, die sich aus ökonomischem Kapital ergeben, von den Machtmitteln der anderen Kapitalarten. Bourdieu zufolge, unterschätzt die Betrachtung der Gesellschaft aus rein ökonomischer Sicht die „symbolische Logik der Distinktion und die Effekte des kulturellen Kapitals“, die den Besitzern eines ausgeprägten Kulturkapitals 23 aufgrund dessen Seltenheitswerts erhebliche Profite, wie etwa schulische Bildungserfolge, bringen können: „D.h., derjenige Teil des Profits, der in unserer Gesellschaft aus dem Seltenheitswert bestimmter Formen von kulturellem Kapital erwächst, ist letzten Endes darauf zurückzuführen, dass nicht alle Individuen über ökonomischen und kulturellen Mittel verfügen, die es ihnen ermöglichen, die Bildung ihrer Kinder über das Minimum hinaus zu verlängern, das zu einem gegebenen Zeitpunkt für die Reproduktion der Arbeitskraft mit dem geringsten Marktwert erforderlich ist“ (Bourdieu 1983:188). Anhand des kulturellen Kapitals wird bereits deutlich, dass die Kapitalarten gesellschaftlich ungleich verteilt sind, wobei deren Verteilungsstruktur der innenwohnenden Struktur der Gesellschaft entspricht. Mit anderen Worten: die Verknüpfung und Korrelation der verschiedenen Kapitalarten bedeutet Vorund Nachteilen in den verschiedenen sozialen Klassen. Das kulturelle Kapital bei Bourdieu besteht aus drei verschiedenen Formen: dem inkorporierten, dem objektivierten und dem institutionalisierten Kulturkapital. Das inkorporierte Kapital meint Fähigkeiten, die zwar gelernt, jedoch zum großen Teil nicht institutionalisiert werden: es können Sprachkompetenzen Tischmanieren oder die Fähigkeit ein Musikinstrument zu spielen sein. Diese Art von Kulturkapital wird meistens von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben als mögliches Erbe, jedes Individuum muss es sich aber selbst aneignen. Objektiviertes Kulturkapital kann beispielsweise ein Musikinstrument sein, das durch seine materielle Form viel leichter übertragen werden kann als das Inkorporierte. Einen besonderen Wert erhält er allerdings erst in der Kombination mit dem inkorporierten Kulturkapital. Denn: das Musikinstrument kann nicht ohne dazu nötige Fähigkeit gespielt werden. Gleichzeitig heißt es auch: ohne das Musikinstrument ist die Fähigkeit des Musikers nutzlos. Demzufolge besteht zwischen den beiden Kapitalarten eine ambivalente Beziehung. Institutionalisiertes kulturelles Kapital wird in Bildungsinstitutionen erworben und kann aus verschiedenen Abschlüssen bestehen. Es ist somit eine Art Vergegenständlichung von inkorporiertem Kulturkapital. Bourdieu schreibt in diesem Zusammenhang der Schule eine zentrale Bedeutung zu. Ihm zufolge besitzt sie eine „Gatekeeperfunktion“ durch die Sanktionierung des sozial vererbten kulturellen Kapitals. Das heißt: durch die Institutionalisierung des kulturellen Kapitals bekommt das inkorporierte kulturelle Kapital einen institutionalisierten, vergleichbaren Wert, wie den Bildungstitel, der mit anderen Bildungstiteln vergleichbar ist. Dieser Wert kann wiederum am Arbeitsmarkt in das ökonomische Kapital umgewandelt werden. „Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind“ (Bourdieu 1983:190). 24 Bourdieu betont, dass die Reproduktion des sozialen Kapitals unaufhörliche Beziehungsarbeit erfordert, durch die die gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestätigt wird. Die Größe des Sozialkapitals hängt von der Größe, Art sowie des Kapitalvolumens des sozialen Netzes ab. Für die Weitergabe des kulturellen Kapitals in der Familie oder Gruppe spielt das Sozialkapital im Vergleich zu den anderen Kapitalarten die entscheidende Rolle. Der Nachteil dabei ist, dass soziales Kapital ein relativ hohes Maß an Fragilität besitzt, nicht direkt in Geld transformierbar ist, der Pflege bedarf und nicht juristisch abgesichert werden kann. An verschiedenen Stellen erwähnt Bourdieu immer wieder die vierte Kapitalsorte – das symbolische Kapital. Das symbolische Kapital beschreibt die soziale Wertschätzung oder in Webers Worten „das Prestige“, welches durch andere Akteure zugerechnet wird. Die durch das symbolische Kapital erzielten sozialen Anerkennungen und Wertschätzungen können sich in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen realisieren. Die symbolische Macht zeigt sich hier in der Verwendung von Statussymbolen und Distinktionsmerkmalen. Nicht selten ist das symbolische Kapital eng mit den anderen Kapitalarten verknüpft. „Die symbolische Macht ist eine Macht, die in dem Maße existiert, wie es ihr gelingt, sich anerkennen zu lassen, sich Anerkennung zu verschaffen; d.h. eine (ökonomische, politische, kulturelle oder andere) Macht, die die Macht hat, sich in ihrer Wahrheit als Macht, als Gewalt, als Willkür verkennen zu lassen“ (Bourdieu 1990:82). Bei den kapitalreichen Akteuren und Gruppen bekommt das symbolische Kapital eine wichtige gesellschaftliche Funktion: aus der Anerkennung dieser Akteure und Gruppen folgt die Anerkennung und Legitimation der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Denn die symbolische Macht schafft es, Beeindruckung und Einschüchterung zu erzeugen. Bourdieu stellt somit den symbolischen Klassenkampf dem ökonomischen Klassenkampf gegenüber. Zusammengefasst: die einzelnen Felder sind durch Machtmechanismen miteinander verbunden, gleichzeitig aber voneinander abgegrenzt. Diese wechselseitigen Verknüpfungen der Felder sowie die hohe Transformierbarkeit des Kapitals erklärt die besondere Stellung des Kapitals in Bourdieus Theorie. Vor allem auch warum dem ökonomischen Kapital so ein großer symbolische Wert verliehen wird. Gleichzeitig erklärt es die überragende Dominanz des ökonomischen Kapitals in fast allen anderen sozialen Feldern. Nichtsdestotrotz, beschränkt sich Bourdieu nicht auf die Wichtigkeit des ökonomischen Feldes, sondern expandiert das Kapital in die Bereiche der öffentlichen Meinung und des individuellen Bewusstseins. Das von Bourdieu entwickelte Modell des sozialen Raumes verbindet Fragmente der Theorien von Karl Marx und Max Weber. Er erweitert das Schichtungsmodell von Weber, mit der Übertragung der Sichtweise Marx auf die Bereiche, die von ihm unberücksichtigt blieben. Dabei entsteht ein 25 mehrdimensionaler sozialer Raum, in dem die Individuen ihren Platz dort, je nach ihrem Gesamtkapitalvolumen und nach der Zusammensetzung der Kapitalstruktur, erhalten. Über die vertikale Position und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse (obere, mittlere, untere Klasse) entscheidet das Gesamtkapitalvolumen. Horizontal ist der soziale Raum in verschiedene Klassenfraktionen unterteilt. Der soziale Raum befindet sich in einer ständigen Bewegung, die Grenzen verändern sich mit der Zeit. Während die einzelnen Klassen innerhalb dieses Systems versuchen ihren Status zu verbessern oder zu verteidigen, sind die herrschenden Klassen in der Lage ihre Machtposition zu verteidigen, indem sie beispielsweise bestimmte Kulturkapitalien auf- oder abwerten. Die Möglichkeit der Anerkennung, die symbolisches Kapital schafft, ist eine andere als die Möglichkeit einer ökonomisch basierten Repression. Metaphorisch betrachtet: Bei einer Angleichung der kulturellen an eine ökonomische Sphäre stößt man beim kulturellen Kapital, welches z.B. Fähigkeiten beim Umgang mit Informationen oder ästhetischen Genüssen beinhaltet, schon allein bei der Frage nach der quantitativen Messbarkeit auf Probleme (vgl. Honneth 1984:153). Die Beharrlichkeit des sozialen Status der Individuen erklärt Bourdieu durch das Zusammenspiel von Habitus, Kapital und Feld, und bezieht sowohl gesellschaftliche Bedingungen als auch individuelle Dispositionen ein. Dem ökonomischen Kapital bleibt zwar in Bourdieus Theorie seine zentrale Bedeutung, er betont aber immer wieder, dass die gesellschaftlichen Machtverhältnisse im Großen und Ganzen über die „feinen Unterschiede“ reproduziert werden. Da der Habitus so viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens beeinflusst, hat er auch prägende Auswirkung auf den individuellen „Geschmack“. Durch den Geschmack ist es möglich eine Person einer Klasse zuzuordnen, die aufgrund der bestimmten Vorlieben einen bestimmten klassenspezifischen Lebensstil pflegt. Bourdieu beschreibt die Lebensstile immer im direkten Zusammenhang mit den drei Kapitalarten. Die Menschen mit ähnlichem Geschmack, gehören nach seiner Auffassung, zu einer sozialen Klassen. Die Hierarchisierung der Geschmäcke veranlasst die vertikale Positionierung verschiedener Lebensstile. Denn die Geschmäcke sowie die Lebensstile unterliegen einer gesellschaftlichen Bewertung. Zum Beispiel: die obere Klasse hat die Vorliebe für klassische Musik und exklusives essen, während der Unterschicht volkstümliche Musik und Fastfood bevorzugt. So bestehen nach Bourdieus Lebensstillmodel zwar nicht mehr nur zwei antagonistischen Klassen – die Bourgeoisie und das Proletariat, dennoch erfolgt über „die feinen Unterschiede“ eine Spaltung der Gesellschaft. Über die Lebensstile geschieht fast wie von selbst eine Vereinheitlichung der sozialen Praxis – eine Angleichung im Handeln und Denken an die bestimmte Klasse, auch wenn die Distinktionsmechanismen verschleiert wirken. So hat das verdeckt wirkende inkorporierte Kapital zusammen mit dem Habitus einen 26 großen Einfluss auf die Reproduktion der Gesellschaftsstruktur (vgl. Bourdieu 1992, 31-47). Im Vergleich der marxschen- und Bourdieus Kapitaltheorie ergeben sich entscheidenden Differenzen: Bourdieus Versuch, Marx ökonomischen Kapitalbegriff auf der sozialen Ebene auszudehnen, ist nachvollziehbar, seine objektivierte Machtausübung eher fraglich. Aus diesem Hintergrund geht hier das Spezifikum des Marxschen Kapitalbegriffs verloren, nämlich der Zusammenhang von Akkumulation, Mehrwertproduktion und Ausbeutung. Mit dem Bourdieuschen Konzept verliert zum einen der Kapitalbegriff seine ökonomische Schlüsselstellung, zum anderen wird die Marxsche Werttheorie revidiert. Anderseits zeigt Bourdieu somit auf, dass die soziale Anerkennung eines Lebensstils nicht auf dieselben Wege wie ein ökonomisches Gut zu erwerben ist. Nicht zuletzt deshalb, weil die herrschaftsgenerierenden Mechanismen von ökonomischen und kulturellen Kapital schwer miteinander vergleichbar sind. Das Primat der Ökonomie ist nicht nur das Markenzeichen der marxistischen Klassentheorie, sondern hat zentrale Bedeutung für die Freiheit und Entwicklung des Individuums. Marx stützt seine Theorie auf die Annahme, dass die Art und Weise, wie die Menschen ihre materielle Produktion organisieren, die Grundlage der gesellschaftlichen Beziehungen bildet. Dabei kann der einzelne sich lediglich als „Klassenindividuum“ entfalten. Das heißt, die Entwicklung des Individuums ist auf die Grenzen seiner Klasse beschränkt: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bilden die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entspricht. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt“ (Marx 1964, MEW 13:8f). Bourdieu grenzt sich immer wieder von Marx strengen Ökonomismus ab. Ihm zufolge reproduzieren die konkreten Lebensäußerungen der Menschen noch keine gesellschaftliche Struktur, erst mit den alltagsweltlichen Praxen wird die Struktur zum Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und dadurch verändert. Auch für die Verlagerung der Verfügungsgewalt über Produktionsmittel sieht Marx streng die historisch notwendige Umwälzung der bestehenden Produktionsverhältnisse. In der Marxschen Geschichtsauffassung muss die notwendige Entwicklung der Ökonomie zum Aufbrechen der an Produktionsprozess gebundenen Klassendichotomie von Kapitalist und Arbeiter, führen: 27 „Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre Produktionsweise und mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, verändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Marx/Engels 1972, MEW 4:130). Bourdieu bezeichnet einen solchen Übergang als „salto mortale“. Er verweist auf die grundlegende Problematik der Marxschen Theorie: Der Übergang von der „Klasse an sich“ zur „Klasse für sich“ ist trotzt Marx Prophezeiungen, im Rahmen der Entwicklung des Kapitalismus, nicht zustande gekommen. Bourdieu bezieht sich dabei auf die These, dass ein Klassenbewusstsein nicht mechanisch mit der Existenz von Klassen verbunden, sondern erst herzustellen sei. Die Marxsche Klassenanalyse wiederum bindet das Verhältnis der Reproduktion an die Konstitution eines Klassenbewusstseins. Bourdieus Gegenargument darauf lautet: Klassenbewusstsein kann nicht allein durch eine ökonomischen Konstellation entstehen, er müsste durch soziale Praxis der Individuen generiert werden. Der Habitus, der klassenspezifischen Charakter besitzt, lagert das Klassenverhältnis direkt in das Individuum ein. Durch die Generierung eines „Klassenkörpers“ wird der Habitus zur Pseudonatur des Individuums. Der eigene Habitus erscheint als Selbstverständigkeit, wird nicht reflektiert. Wenn aber der eigene Lebensstil sich der Reflexion entzieht, wird dieser als natürlich angenommen, dann bleibt die eigene Klassenzugehörigkeit im Dunkeln. Damit will Bourdieu sagen, dass der Habitus eher ein kollektives Klassen-Unbewusstsein ist, als eine bewusste Entscheidung über das Klassendasein. Und weiter: dass das Klassenverhältnis nicht nur außerhalb (wie Marx behauptet), sondern auch innerhalb des Individuums besteht. Bourdieu sieht insgesamt die Chancen einer revolutionären Umwälzung eher pessimistisch. Er verdeutlicht dies in der Allegorie des Spiels:: „Gibt es Leute, die daran Interesse haben, den Tisch umzuwerfen und damit dem Spiel ein Ende zu machen? (…) In meinen Augen sind viele Revolutionen innerhalb der herrschenden Klasse, d.h., in jenen Kreisen, die Chips besitzen und die auch mal auf die Barrikaden steigen, damit ihre Chips an Wert gewinnen“ (Bourdieu 1982:38). Die Wahrscheinlichkeit einer Revolution, wenn überhaupt, sieht Bourdieu in dem Zusammentreffen eines kritischen Diskurs und einer objektiven Krise. Denn er geht davon aus, dass die Stabilität der Ordnung im Grunde durch die Überstimmungen zwischen den Strukturen der sozialen Welt und den Dispositionen der Akteure abhängt. Diesem Gedanken zufolge, können die daraus folgenden Reproduktionsmechanismen durch eine Beeinträchtigung dieser Übereinstimmung infolge einer objektiven strukturellen Krise durchbrochen werden (vgl. Bourdieu 1990:104). Dass das Klassenverhältnis schon immer ein integraler Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft gewesen ist, bestreitet auch Bourdieu nicht. Vielmehr geht es um die Frage, wie ein Klassenbewusstsein in der gegenwertigen historischen Situation entstehen soll. War das Ausbeutungsverhältnis im Feudalismus noch in einem direkten persönlichen 28 Verhältnis eingebettet, so ist das Ausbeutungsverhältnis im Kapitalismus in den Produktionsprozess eingelagert. Das Erkennen eines Klassengegensatzes wird somit erschwert, es fehlt ein greifbarer Gegner. Ein großer Teil der Arbeiter sieht sich nicht als Proletariat, und in den Unternehmer, für den sie arbeiten, nicht als blanke Verkörperung der Kapitalinteressen. Die Arbeiterklasse fühlt sich als weitgehend in die gesellschaftlichen Prozesse integriert. Noch mehr: Die Arbeiter identifizieren sich mit ihrem Arbeitgeber, orientieren sich an ihnen. Es wird die Überzeugung gepflegt, dass es jeder „oben schaffen“ kann. Die Mitglieder der herrschenden Klasse samt ihren Vorlieben werden gesellschaftliche Vorbilder. Nicht umsonst nennt Bourdieu den Geschmack der herrschenden Klasse den „legitimen Geschmack“. Aus dem fehlenden Klassenbewusstsein sollte nicht voreilig der Schluss gezogen werden, dass ein Klassenantagonismus nicht existiere oder dass Marx nicht mehr relevant sei: „Das von einem proletarischen Klassenbewusstsein in den maßgebenden kapitalistischen Ländern nicht gesprochen werden kann, widerlegt nicht an sich, im Gegensatz zur communis opinio, die Existenz von Klassen: Klasse war durch die Stellung zu den Produktionsmitteln bestimmt, nicht durchs Bewusstsein ihrer Angehörigen“ (Adorno 1997b: 358). Außerdem: wenn ein Mensch sich nicht ausgebeutet fühlt, bedeutet das noch nicht, dass er nicht ausgebeutet wird. Krankenversicherung, Unfallversicherung- und Alterssicherung lassen die sozialen Verhältnisse der Arbeitnehmer als spürbar verbessert empfinden. Dabei sollen die Arbeiter als Objekt sozialsstaatlicher Fürsorge durch die Hilfe von oben stärker an den Staat gebunden werden. Paradox ist hier: die Sozialpolitik wirkt im Prinzip gegen die kapitalistische Ordnung, ist gleichzeitig notwendig für die Erhaltung dieser. „Die herrschende Klasse wird so gründlich von fremder Arbeit ernährt, dass sie ihr Schicksal, die Arbeiter ernähren zu müssen, entschlossen zur eigenen Sache macht und dem „Sklaven die Existenz innerhalb seiner Sklaverei“ sichert, um die eigene zu befestigen“ (Adorno 1997a:386). Es wäre nicht unangebracht zu behaupten, dass Bourdieus Klassenverständnis zu einem großen Teil auf der Grundlage von Marx entstanden ist. Bourdieu betont zwar immer wieder, dass er für seine Theorie mit einer Reihe von Marxschen Theorie brechen musste, gleichzeitig weist er viele Gemeinsamkeiten damit auf. Eine der wichtigsten davon ist, dass beide Autoren die Gesellschaft nicht als Reich der Freiheit betrachten, sondern den Zusammenhang von objektiver Lage und Lebenschancen hervorheben. Außerdem sind in beiden Konzepten die Klassen relativ kurz geschlossen. Allerdings beginnen die Unterschiede schon bei der Konstruktion von Klassen. Bourdieus Klassentheorie ist eng mit Kultursoziologie verbunden, was bei Marx kaum Beachtung findet. Bourdieu geht über einen Ökonomismus hinaus, der den sozialen Raum im Prinzip auf ökonomische Produktionsverhältnisse reduziert und die Sozialstruktur der Gesellschaft an 29 ihrer Wirtschaft bannt. Er erweitert den Ökonomismus, indem er viele andere Kapitalbegriffe zufügt. Somit finden sich die objektiven Kapitalausstattungen der Individuen in einer Nebenrolle. Es zeigt sich auch in dem Beispiel, dass Bourdieu die herrschende Klasse nicht ausschließlich über Privateigentum an Produktionsmitteln definiert, eher ganz oft in Verbindung von hohem kulturellem und relativ geringem ökonomischem Kapital sieht. Bourdieus Klassentheorie ist somit auch eine Klassifizierungstheorie. 3.4 Bourdieus Beitrag: Stärken und Schwächen aus einer marxistischen Perspektive „Man muss von dem akademischen Gegensatz zwischen Beharrung und Veränderung Abschied nehmen um zu begreifen, dass Reproduktion der Klassenstruktur nicht heißen muss: Verewigung der jeweils empirisch beobachtbaren sozialen Klassen als konkrete, durch die Gesamtheit ihrer substantiellen Eigenschaften definierten Gruppen. Bei der Sozialstruktur geht es darum, wie die (…) Kapitalarten zwischen (…) Klassen verteilt sind, die sich in vielen Merkmalen (…) ändern können, ohne dass das etwas an ihrer herrschenden oder beherrschten Position (…) ändert. Deshalb kann die Reproduktion der Sozialstruktur durchaus die Form der Strukturverlängerung annehmen“. Pierre Bourdieu et al. (1981:71) Pierre Bourdieu hat immer behauptet, dass die „Klassenherrschaft“ i„ein Ding feiner Unterschiede“ ist. Anders als Marx, der Klassenherrschaft im Rahmen der Ausbeutung und Unterdrückung behandelt hat, sieht Bourdieu hier vor allem eine Sache der Distanzierung und Unterscheidung zwischen den Klassen. Das ist auch der Grund, warum bei Bourdieu die Feststellung der antikapitalistischen Tendenz im Kampf der Klassen fehlt, während Marx in seiner dialektischen Gesellschaftstheorie wenigstens die Perspektiven der Überwindung von Kapitalismus und Klassengesellschaft ermöglicht. Bourdieu ist kein antikapitalistischer Theoretiker, denn „Kapital“ und „Klasse“ werden bei ihm ganz weit aufgefasst. Im Grunde genommen ist „Kapital“ bei Bourdieu eine Ansammlung von sozialen Beziehungen, Fähigkeiten und materiellem Besitz. Das „ökonomische Kapital“ bekommt hier einen ganz anderen Stellenwert im Vergleich zu Marx. Aus Bourdieus Verständnis, stellt diese Kapitalsorte eine gesellschaftliche Beziehung dar, die die konkrete Stellung eines Menschen und Klassen in der Gesellschaft definiert. Bei Marx wiederum ist das ökonomische Kapital eine Form zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich in Form von Ware, Geld, Profit verselbständigt. Das wichtigste dabei ist, dass das Kapital das Bewusstsein der Menschen prägt. Hierbei spricht Marx von „Entfremdung“ und „Fetisch“, 30 einer übermächtigen Macht, die über die Menschen bestimmt: Die für die kapitalistische Verhältnisse charakteristische Trennung von Arbeitsprodukt und Arbeit selbst, steht dementsprechend der Trennung von menschlicher Subjektivität und Objektivität im Rahmen des Produktionsprozesses gegenüber. Noch bevor der Arbeiter in den Produktionsprozess eintritt, ist ihm seine Arbeit bereits entfremdet, aufgrund der Einverleibung der Arbeit durch das Kapital und der Aneignung des Mehrwerts durch Kapitalisten. Auch wegen des Warencharakters der Arbeit ist der Produktionsprozess immer ein Konsumptionsprozess der Arbeitskraft durch den Kapitalisten: das Arbeitsprodukt durchläuft eine permanente Transformation in Ware, Wert, Kapital, Produktionsmittel. Dem Kapitalbegriff bei Bourdieu ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen der Warenwirtshaft fremd: Tauschwaren, Arbeiterlohn, Geld als Zahlungsmittel – alles wird hier gleichgesetzt. Somit wird das kritische Potenzial des Kapitalbegriffs entwertet und verliert somit die große Bedeutung, die ihm bei Marx zukommt. Gerade die Konzentration auf den Produktionsprozess ist ein großer Vorzug der marxistischen Klassentheorie. Ohne Marx Grundidee, dass die Art und Weise der Produktion und das Eigentum an der Produktion, die gesellschaftlichen Beziehungen und Klassenverhältnisse prägen, würde die gesamte marxistische Gesellschaftstheorie zu Bruch gehen. Für Bourdieu wiederum sind alle Gesellschaften immer zugleich kapitalproduziereden Klassengesellschaften. Eine praktische Orientierung für proletarische Sozialisten in Verbindung mit anderen unterdrückten Klassen bietet seine Theorie jedoch nicht. Denn aus Bourdieus Sicht können gut bezahlte Arbeiter genauso zu den Herrschenden gezählt werden wie Lehrer, Professoren, Handelsunternehmer usw. Das heißt: wer entweder sehr viel ökonomisches-, soziales oder kulturelles Kapital besitzt, kommt in die Gruppe der „Herrschenden“. Dieser von Bourdieu zu weit gefasster Klassenbegriff führt zu vielen Unverständnissen und sorgt teilweise zur Verwirrung. Und solche „Schwammigkeit“ führt zum unklaren Verständnis der kritischen Bedeutung von Klassengegensätzen und der revolutionären Praxis. Wenn bei Marx der Klassenkampf im Kapitalismus identisch ist mit dem Sieg der revolutionären Bewegung, so sind bei Bourdieu Revolutionen mehr oder weniger glückliche Zufälle oder Verschwörungen. Und nach Marx sind die herrschenden Klassen diejenigen Klassen, die gerade den Produktionsprozess und die Staatsmacht dominieren, während Bourdieu arme Intellektuelle, die über viel „kulturelles Kapital“ verfügen, für mehr oder weniger Herrschende hält. Demzufolge gilt nach Bourdieus Verständnis: wenn jeder „Kapital“ hat, dann kann „dieser jeder“ im Grunde als „Kapitalist“ gelten. In einer unpraktischen soziologischen Theorie stellt Bourdieus These von den herrschenden arbeitslosen Intellektuellen oder Lehrern kein großes Problem dar. Für die marxistische Theorie ist es nicht akzeptabel, da sie als Handlungsanleitung für Revolutionäre praktisch sein muss. Aus Bourdieus kulturwissenschaftlichem, postmodernen Ansatz mit der bürgerlichen 31 Ökonomie ergibt sich eine bürgerlich-ökonomistische Gesellschaftstheorie, die nicht über Kapitalismus und Klassengesellschaft hinausweist. Im Ganzen fehlt bei Bourdieu die antikapitalistische Tendenz im Kampf der Klassen. Er unterstreicht zwar, dass die „unteren Schichten“ gegen die Herrschenden kämpfen, aber dieser Kampf sei, politisch gesehen, für eine Revolution gleichgültig. Es kann allerdings nicht behauptet werden, dass es bei Bourdieu keine Unterscheidung der Gesellschaftsformationen gibt; vielmehr ist es so, dass Bourdieu nicht interessiert ist an der die Erklärung eines Entwicklungsprozesses, sondern eher an den immer und überall anzutreffenden Strukturen als „Relationssystem“ (vgl. Bourdieu 1974:7ff.). Auch nach der Ausweitung des Kapitalbegriffs über den Bereich der Ökonomie hinaus, fallen die Produktion und die unmittelbare Sphäre der Arbeit aus seiner Analyse komplett heraus. Anders gesagt: indem Bourdieu das Kapital nur als Ressource von Macht oder als Verfügbarkeit über bestimmte knappe Mittel betrachtet, schneidet er aus seiner Theorie die Möglichkeit heraus, das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis zu sehen, das auf der Ausbeutung und Aneignung fremder Arbeit beruht. Daraus folgt, dass Bourdieu die objektive Struktur als Gesamtheit der Felder des sozialen Raumes über die „Praxis“ zu vermitteln vermag, er geht aber nicht von der Totalität der ökonomischen Verhältnisse (Produktionsweise) aus, die, nach Auffassung von Marx, einen spezifischen historischen Stellenwert einnehmen. Weiterhin problematisch erscheint, dass Bourdieu sich zu sehr auf soziale Relationen konzentriert, anstatt sein Augenmerk auf die Inhalte, wie Wohlfahrtzu richten. Aus diesem Grund entgeht Bourdieu der geschichtliche Zugewinn in der Ästhetisierung des Alltagslebens. Hier ist an das Beispiel mit dem „Fahrstuhleffekt“ von Hradil zu erinnern (1989:122): „Mit dem ihm fahren alle eine Etage nach oben“ zusammen mit dem Rest der Gesellschaft, konnten die Arbeiter sich einen Anteil an den wachsenden gesellschaftlichen Reichtum erkämpfen, ohne das die sozialen Unterschiede und soziale Ungleichheiten kleiner geworden wären. Indem Bourdieu den Arbeitergeschmack als rein barbarisch, als einen Notwendigkeitsgeschmack, bezeichnet, geringschätzt er ihren Kampfes um legitime Kultur, die Perspektive der gesellschaftlichen und individuellen Risiken und Kosten scheinen in Bourdieus strukturalistischer Theorie der Homologie von Räumen verschwunden zu sein. So ist auch das Verhältnis vom Habitus und dem Bewusstsein bei Bourdieu widersprüchlich: aus seiner Sicht liegen die beiden unverbunden nebeneinander – das Habituelle neben dem Reflexive. Das lässt eine systematische Bestimmung gesellschaftlichen Bewusstseins jedoch nicht zu. Nun sollen auch die positiven Leistungen von Bourdieu zur Klassen- und Ungleichheitsforschung zusammengefasst werden. Bourdieu reflektiert die Bedeutung der symbolischen Dimension von sozialer Ungleichheit und Klassenauseinandersetzung. Dabei werden Kultur und Bildung als Systeme eigener Logik und eigener Qualität betrachtet, die eng in Bezug zu ökonomischen Grundverhältnissen und den Strukturen der Machtverteilung 32 stehen. Bourdieus Theorie zeigt außerdem, dass im Kampf um das „Surplus Produkt“ e nicht nur ökonomischen Faktoren entscheidend sind: Mit den Kategorien des Habitus und des ästhetischen Geschmacks werden objektiven Klassenlagen und Klassenstrukturen sowie weitere Determinanten sozialen Handelns und Bewusstseins mit den Lebensstilen bzw. der kulturellen Praxis vermittelt. Damit will Bourdieu zeigen, dass sich das Individuum ein breites Spektrum der gesellschaftlichen Verhältnisse aneignet, das über die ökonomischen Strukturen hinausgeht. Eine große Bedeutung hat Bourdieus These, dass Lebensstile zur Reproduktion der Klassengesellschaft beitragen und dass soziale Ungleichheit in der symbolischen Dimension legitimiert wird. Mit seinem Habituskonzept konnte Bourdieu zeigen, dass Lebensstile systematische Produkte einer Klassenstruktur und dazu „homolog“ sind bezogen auf die objektiven Struktur des klassenstrukturierten Raums der Positionen. Durch die Übernahme des Klassenhabitus, auf dem Weg der Sozialisation, macht sich das Individuum die allgemeinen Erfahrungen seiner Klasse zu eigenen und damit auch das gesellschaftlich anerkannte Bild seiner Klasse. Das Gerangel um die Ressourcen und Positionen, der reale Klassenkampf, ist deshalb immer begleitet von symbolischen Auseinandersetzungen, er drückt sich immer als symbolischer Kampf aus. Dabei ist die Auseinandersetzung um den „legitimen“ Geschmack insbesondere geeignet, die sozialen Unterschiede zu legitimieren: „Kunst und Kunstkonsum eignen sich – ganz unabhängig vom Willen und Wissen der Beteiligten – glänzend zur Erfüllung einer gesellschaftlichen Funktion der Legitimierung sozialer Unterschiede“ (Bourdieu 1982:27). „Bedeutsam ist deshalb auch die mit dem Ansatz von Bourdieu verbundene Möglichkeit, die Ideologietheorie weiterzuentwickeln. Bemerkenswert ist die Hervorhebung des Vorreflexiven in der verzerrten Wahrnehmungsweise, die Verdeckung der realen Strukturen, ohne dass deshalb die altherwürdige Priestertrugtheorie zu bemühen wäre oder die platte Manipulationsvermutung. Im „amor fati“, der Liebe und Ergebenheit, in das Schicksal der eigenen subalternen Lage, ist das eingefangen, was auch Gramsci für moderne westliche Gesellschaft als so entscheidend hervorgehoben hat: das konsensuelle Moment in der Klassenherrschaft, das insbesondere die kulturelle Hegemonie ermöglicht und damit zugleich die politisch-ökonomische festigt (vgl. Bourdieu 1982:378). Damit ist ein weiterer Verdienst schon benannt: einerseits die Bedingungen der Stabilität des Habitus aus der Notwendigkeit von Alltagshandeln (…) in versachlichten Verhältnissen herzuleiten, anderseits aber auch das „odium fati“ und die Bedingungen von Erkenntnis. In der Krise besteht die Möglichkeit, sich über die Bedingungen des eigenen Schicksals als eines Klassenschicksals bewusst zu werden. Das kann zur veränderten Praktiken führen, die das Moment der bewussten, in demokratischen Formen sich vollziehenden Gestaltung des Gemeinwesens (in seinen ökonomischen, politischen und kulturellen Institutionen) wesentlich einschließt“ (vgl. Kapitel: www.rote-ruhr-uni.com). 33 4.1 Klassentheorie am Ende der Klassengesellschaft? Reinhard Kreckel fragt sich in seinem Aufsatz mit dem Titel „Klassentheorie am Ende der Klassengesellschaft“, welche Bedeutung einer spezifisch klassentheoretischen Argumentation innerhalb des allgemeinen ungleichheitstheoretischen Diskurses heute noch zukommt und stellt fest, dass die Klassensemantik auch heute noch für die Ungleichheitsforschung unverzichtbar ist. Kreckel kommt nicht an der Einsicht vorbei, dass das Konzept der sozialen Klassenstrukturierung für die lebensweltliche Erfassung der sozialen Ungleichheiten im heutigen Deutschland nicht ausreicht. In seiner früheren Schrift (Kreckel 1991) hat er bereits die vier zentralen Organisationsprinzipien von sozialer Ungleichheit in der heutigen westlich beherrschten Weltgesellschaft identifiziert: Territorialität, Vertikalität, Geschlecht und Alter. „Das heißt, die üblicherweise mit Klassen- oder Schichtbegriffen erfassten vertikalen Strukturierungen interferieren mit territorial verankerten internationalen Ungleichheitsstrukturen sowie mit den jeweils herrschenden Formen ungleicher Geschlechter- und Altersstrukturierung, also: mit „nichtvertikalen“ Varianten von sozialer Ungleichheit“ (in: http://www.soziologie.uni-halle.de/emeriti/kreckel/docs/klassen-97.pdf). Kreckel will damit sagen, dass für die Bestimmung der Stellung jedes einzelnen Erdenbewohners innerhalb der Ungleichheitsordnung dessen Lage, Geschlecht und Altersgruppenzugehörigkeit, sowie seine nationale, kulturelle oder/und ethnische Zugehörigkeit innerhalb des vertikalen Gefüges und im jeweiligen sozio-kulturellen Kontext berücksichtigt werden muss. Demzufolge ist die immer noch aktuelle Konzentration auf jeweils nur einen der vier Aspekte genauso unbefriedigend wie die Gleichstellung von vertikaler und sozialer Ungleichheit. Indem man die theoretische Perspektive mit geforderten Faktoren ausweitet, tut man ein Schritt in die Richtung zur These „Klassentheorie am Ende der Klassengesellschaft“: die Klassenproblematik ist der vertikalen Achse des vierdimensionalen ungleichheitstheoretischen Raumes zuzurechnen. Was heißt: eine allgemeine Theorie der sozialen Ungleichheit lässt sich nicht vom Klassenbegriff her aufbauen. „Es wäre nämlich zu simple, wenn man nun alle theoretischen Anstrengungen, die sich auf die Analyse der vertikalen Achse von soziale Ungleichheit konzentrieren, einfach als „Klassentheorie“ titulieren würde. Ich habe deshalb in meinem Buch „Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit“ den Versuch unternommen, der Klassentheorie einen spezifischen Ort innerhalb der Theorie der vertikalen Ungleichheit zuzuweisen. Dabei habe ich mich von der auf Karl Marx zurückgehenden Theorietradition leiten lassen, der zufolge der strukturelle Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital die Grundlage der Klassenstrukturanalyse in modernen kapitalistischen Gesellschaften bildet. Das 34 heißt, ich vermeide das handlungstheoretische Konzept der „sozialen Klassen“, (…) behalte ich aber den Begriff des „Klassenverhältnisses“ als Strukturmerkmal marktwirtschaftlich geprägter Ungleichheitsordnungen bei“ (ebd.). Seine Aussage stützt Kreckel auf die Bedeutung ökonomischer Reproduktionsbedingungen: viele Autoren der so genannten „Lebensstiltheorien“ neigen die ästhetische, kognitive Faktoren der subjektiven Konstruktion vor objektiven ökonomischen Bedingungen zu stellen. Auch wenn diese Ansätze die „neuen“ Erscheinungs- und Ausdrucksformen von sozialer Ungleichheit berücksichtigen, unterschätzen sie die fortdauernde Wirkung ökonomischer Kräfte. Nichtsdestotrotz, wäre es zu gewagt, alle empirisch auftretenden vertikalen Ungleichheiten als Klassenfragen zu behandeln. „Im Hinblick auf die heutigen modernen Staatsgesellschaften lässt sich vielmehr zeigen, dass keineswegs alle vertikalen Ungleichheiten – geschweige denn die internationalen, die geschlechtsspezifischen und die altersspezifischen Ungleichheiten – auf die kapitalistische Grundstruktur der Trennung von Lohnarbeit und Kapital zurückgeführt werden können. Das Kräftefeld, das dabei ins Spiel kommt, ist weitaus vielfältiger und von großer historischer Variabilität“ (ebd.). Das Kräftefeld bei Kreckel ist das „korporatistische Dreieck“ zwischen Kapital, Arbeit und Staat, das im Zentrum des Kräftefeldes ausgeht und darüber hinaus das Wirken von Interessengruppen, sozialen Bewegungen und dem praktischen Handeln der sozial strukturierten Bevölkerung berücksichtigt (Kreckel 1992: 149-165). Kreckel betont, dass in den heutigen, modernen Gesellschaften der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit immer noch einen nachweisbaren Einfluss auf die fortlaufende Reproduktion von vertikaler Ungleichheit hat. Etwa die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung ist in privaten und öffentlichen Betrieben oder Behörden in einer abhängigen Erwerbstätigkeit beschäftigt. Sie alle sind auf einen „Arbeitgeber“ angewiesen, um ein Einkommen erzielen zu können. Der Verlust des Arbeitsplatzes stellt für sie eine reale Bedrohung da und die Abhängigkeit vom Chef ist eine ständige Erfahrung. Demzufolge ist die Vorstellung, dass der Arbeitnehmer mit dem Begriff „Ware - Arbeitskraft“, deren Preis und Qualität verhandelt wird, nachvollzierbar. Die selbständige Tätigkeit als Alternative zum Arbeitsmarkt ist jedoch unrealistisch, da der Anteil der Selbständige in der Erwerbstätigenstatistik fortgeschrittener westlicher Staatsgesellschaften unterhal b der 10%-Grenze liegt. Das zeigt, dass für die Mehrzahl der Menschen die wirtschaftliche Selbständigkeit keine Option ist. Sie bleiben somit in den Zwängen des privaten oder des öffentlichen Arbeitsmarktes. Die reale existentielle Angewiesenheit auf einen nach kapitalistischen Prinzipien funktionierenden Warenmarkt erfolgt auch nicht zuletzt deshalb, weil alle Menschen Konsumenten sind, die zur Selbstversorgung nicht in der 35 Lage und auf stetiges Geldeinkommen angewiesen sind. Die Gruppe dieser „Abhängigen“ umfasst in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften etwa 90% der erwachsenen Bevölkerung. In der schwierigsten Lage befinden sich die Arbeitslosen. „Auch sie gehören nicht zu den „Arbeitsmarktparteien“, ihnen fehlt es an Organisations- und Konfliktfähigkeit. Wenn sie innerhalb des „korporatistischen Dreiecks“ von Kapital, Arbeit und Staat überhaupt auf nachdrückliche Fürsprache hoffen können, so am ehesten von staatlicher Seite. Auch das ergibt sich, per Umkehrschluss, aus der generalisierten kapitalistischen Arbeitsmarktlogik“ (ebd.). Kreckel zufolge ist die ungleichtheoretisch aufgestellte Aufschlüsselung des korporaristischen Regulierungsmodelles von Arbeit, Kapital und Staat aus den historischen Gegebenheiten der „alten“ Bundesrepublik erwachsen. Damit meint Kreckel den Institutionentransfer von West nach Ost im Zuge der deutschen Vereinigung, während dessen die marktwirtschaftlichen Verhältnisse, korporative Interessenvertretungen und die föderalistische parlamentarisch-demokratische Regierungsform in ganz Deutschland umgesetzt wurden, allerdings nicht das DDR-spezifische „Recht auf Arbeit“. In Ostdeutschland hat dies zu zahlreichen ungleichheitsrelevanten Folgen geführt: hohe Arbeitslosigkeit, zahlreiche Karrierebrüche, Einkommens- und Vermögensrückstände im Vergleich zum Westen Deutschlands. Diese Sonderentwicklung lässt sich mit dem in ganz Deutschland ausgedehnten ungleichheitsgenerierenden Kräftefeldes erklären, dass sich im Rahmen des „korporatistischen Dreiecks“ bewegt. „Diese wenigen Bemerkungen müssen hier genügen. Sie zeigen, auf welche Weise das von der historischen Erfahrung der „alten“ bundesrepublikanischen Gesellschaft herrührende idealtypische Modell des „korporatistischen Dreiecks“ für eine theoretisch anspruchsvolle Ungleichheitsforschung nutzbar gemacht werden kann, ohne zu unerträglichen Vereinfachungen führen zu müssen“ (ebd.). Kreckel betont, dass die vorgestellte Diskussion zum „korporatistischen Dreieck“ eine eigentümlich deutsche Färbung enthält, weil das Wort „Klasse“ im deutschen Sprachraum besonders durchschlägt. Im deutschen Kontext werden mit dem Begriff „Klasse“ unweigerlich politische Überzeugungen und emphatische Definitionskämpfe verbunden. Dieser „deutsche Bezugsrahmen“ habe zum Ausgangspunkt die Institutionalisierung des Klassengegensatzes und die ökonomische Ungleichheit in der Gesellschaft, die seit 1990 erkennbar an Bedeutung zugenommen hat. (vgl. Kapitel: http://www.soziologie.unihalle.de/emeriti/kreckel/docs/klassen-97.pdf) 4.2 Das angebliche Ende von Stand und Klasse in Deutschland Vor ungefähr dreißig Jahren löste Ulrich Beck (1983) mit seinem Aufsatz „Jenseits von Stand und Klasse?“ eine kontroverse Debatte aus, deren 36 Ausgangpunkt war, dass sich subkulturelle Klassenidentitäten und ständisch gekennzeichneten Klassenlagen im Zuge der Diversifizierung und Individualisierung von Lebenswegen aufgelöst haben und seinen Realitätsgehalt unterlaufen. Durch Bildungsexpansion, wirtschaftlichen Aufschwung und der damit einhergehenden Niveauverschiebungen, erfolge ein historisch spezifischer Prozess der Vergesellschaftung – die Freisetzung der Menschen aus dem Kontext der Familie oder den klassenspezifischen Milieus. Beck sagt dazu: “ Mit zunehmender Individualisierung schwinden die Voraussetzungen, das Hierarchiemodell sozialer Ungleichheit lebensweltlich zu interpretieren“ (Beck 1983:53). Zudem werden Klassenidentitäten bedeutungslos, da infolge der Individualisierung, der Sozialcharakter der Menschen aus den gesellschaftlich prägenden Kontexten wie Klasse und Schicht herausgelöst würden. Beck behauptet, dass vor allem der „Fahrstuhleffekt“ – die so von ihm beschriebene kollektive Mobilität in der deutschen Nachkriegszeit, bei der alle gesellschaftlichen Schichten eine „Etage höher gefahren“ sind, dazu geführt hat, dass die sozialstrukturellen vertikalen Ungleichheiten im Rahmen des individualisierten Sozialcharakters in den Hintergrund traten. „Wir leben trotzt fortbestehender und neu entstehender Ungleichheiten heute in der Bundesrepublik in Verhältnissen JENSEITS der Klassengesellschaft, in denen das Bild der Klassengesellschaft nur noch mangels einer besseren Alternative am Leben erhalten wird“ (Beck 1986:121). Die Individualisierung nach Beck läuft im Sinne der Aufhebung der lebensweltlichen Grundlage eines Denkens in traditionalen Kategorien – in sozialen Klassen, Stände oder Schichten. Mit der Auflösung der Klassenstruktur und der wachsenden sozialen Mobilität, solle die gesellschaftliche Orientierung von Menschen nicht mehr klassen- bzw. schichtenspezifisch sein. Es gäbe keine Kategorisierungen, wie: „Die da oben, wir da unten“ usw. Was die Bildungsexpansion betrifft, so führte dies zu Niveaueffekten bei der Bildungsbeteiligung und dem Bildungsniveau in der Bevölkerung, aber nicht zu Auflösung von struktureller sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich. Auch wenn im Zuge der Bildungsexpansion die traditionellen Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft erheblich reduziert wurden, ist der Bildungszugang weiterhin von beträchtlicher Chancenungleichheit geprägt. Bis in die jüngste Vergangenheit lässt sich die Tatsache bestätigen, dass die Kinder der oberen Dienstklasse immer noch eine 15-mal bessere Chancen haben, das Abitur zu erwerben, als die Kinder aus der Arbeiter- oder Mittelklasse. „In der Zwischenzeit liegt eine Vielzahl von Studien vor, die erklären, warum es trotzt Bildungsexpansion und sozialer Öffnung des Bildungssystems dauerhafte Bildungsungleichheiten nach Klassenlage des Elternhaus bzw. nach der Schichtzugehörigkeit der Kohortenmitglieder gibt (Boudon 1974; Breen/Goldthorpe 1997; Becker 2006, 2007). An die Klassenlage gebundene 37 Ressourcen des Elternhauses, die für die Bildung und Ausbildung der Kinder investiert werden können, sowie die Motivation, den bislang erreichten Sozialstatus in der Generationenabfolge erhalten zu wollen, sind wichtige Mechanismen für diese soziale Tatsache“ (Berger/Hitzler (Hrsg.) 2010:58). Becker und Breen zeigen zudem, dass trotzt der erheblichen Steigerung von Bildungsanstrengungen der Arbeiterklasse, die Bildungsungleichheiten bestehen bleiben und erst dann abnehmen, wenn die Bildungsnachfrage der sozial privilegierten Schichten gesättigt ist. Somit bestimmen die sozialen Herkunftsrestriktionen, die von der Klassenlage und Positionierung des Elternhauses hervorgehen, immer noch die Bildungschancen einer Klasse oder eines Standes. Zitierend mit Worten von Max Weber (1988: 247-248) heißt es: „Unterschiede der Bildung sind heute, gegenüber dem klassenbildenden Element der Besitz- und ökonomischen Funktionsgliederung, zweifellos der wichtigste eigentlich ständebildende Unterschied. (…) Unterschiede der „Bildung“ sind – man mag das noch so sehr bedauern – eine der allerstärksten rein innerlich wirkenden sozialen Schranken. Vor allem in Deutschland, wo fast die sämtlichen privilegierten Stellungen innerhalb und außerhalb des Staatdienstes nicht nur an eine Qualifikation von Fachwissen, sondern außerdem von „allgemeiner Bildung“ geknüpft sind und das ganze Schul- und Hochschulsystem in deren Dienst gestellt ist. Alle unsere Examensdiplome verbriefen auch und vor allem diesen ständisch wichtigen Besitz“. Im Zuge der fortschreitenden Individualisierung sollte die intergenerationale Mobilität, Beck zufolge, immer weniger durch soziale Herkunft strukturiert werden. Das bedeutet, dass nur noch individuelle Leistungsqualifikationen entscheidend für den Erwerb ökonomischer Güter seien. In der Tat, im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs in der westdeutschen Nachkriegszeit konnten immer mehr Personen in die obere Dienstklasse aufsteigen und auch die Klassenschranken wurden deutlich niedriger. Aber bei der Realisierung des Statuserhalts und beim intergenerationalen Aufstieg in den Arbeitsmarkt waren und sind die Herkunftseffekte evident geblieben. „Die Persistenz von Klassenstruktur, die Abhängigkeit der Bildungs- und Mobilitätschancen von sozialer Herkunft sowie die durch die soziale Herkunft erzeugte Kontingenz des individuellen Lebensverlaufs belegen trotz gestiegener Optionen für individuelle Entscheidungen und restriktiver institutioneller Handlungsvorgaben eher, dass der lange Schatten der sozialen Herkunft auch die Mobilität möglicher Individualisierungsschübe im Sinne von Beck (1983, 1986) unterläuft“ (Berger/Hitzler (Hrsg) 2010:63). Angesichts der hier vorgestellten Gegenbeispiele zu Becks „Individualisierungsthese“ kann kaum die Rede sein vom Ende von Stand und Klasse in der deutschen Gesellschaft. Auch wenn mehr Bildung und Mobilität sowie gestiegener Wohlstand Eindruck erwecken, dass es das Gegenteil ist. Historisch gesehen gibt es zwar keine soziokulturell homogenen Großgruppen mit Klassenkampfideologie und politischen Organisationen, aber die subjektive 38 Wahrnehmung der Bevölkerung und ihre Selbstidentifikation folgt immer noch dem Verständnis einer Klassenstruktur und einer vertikaler Ungleichheit. Niemand könnte den augenfälligen Wandel in der Klassenstruktur Deutschlands ernsthaft bestreiten. Aber von der Ablösung von Schichtunterschieden durch ausschließlich kulturelle Unterschiede oder von einem „class dealignment“ kann auch heute nicht ausgegangen werden. „Im Zuge der Entwicklung des modernen Wohlfahrtstaates sind Verelendung und Entfremdung im Sinne von Marx (1921) überwunden, aber für eine Gesellschaft jenseits von Stand und Klasse fehlen immer noch intersubjektiv nachvollzieh- und überprüfbare Hinweise. (…) Der Zugang zu knappen Gütern (Bildung) und Position (Klassenlage) hängt weiterhin zu einem großen Teil von der sozialen Herkunft nach Klassenlage des Elternhauses ab und es gibt folglich – bei einer relativen Öffnung in der Klassenstruktur – eine Persistenz der intergenerationalen Transmission von Lebenschancen nach Klassenlage des Elternhauses“ (Berger/Hitzler (Hrsg.) 2010: 68). 5.1 Ein Exkurs: Soziale Selbstorganisationen – Gegenbewegungen im Kapitalismus Moderne Gesellschaften werden heute zunehmend mit den neuen sozialen und kulturellen Ungleichheiten konfrontiert: mit einer zunehmenden Kluft zwischen arm und reich, mit wachsender Exklusion und Prekarisierung. Gleichzeitig setzen die Protagonisten der „New Economy“ große Hoffnungen in den technischen Fortschritt. Angesichts der Richtung der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung wird jedoch bezweifelt, dass sich eine Humanisierung der Lebensverhältnisse unter den bestehenden Bedingungen ergeben wird. Denn kritisches Denken ist heute nicht unbedingt in Mode, obwohl oder gerade die soziale Situation der Menschen sich permanent verschärft. Dem gegenüber stehen das bürgerliche Engagement und die Bildung des Sozialkapitals: hier werden die Ressourcen für soziale und politische Integration praktiziert und eingeübt, das Vermögen gesellschaftlicher Selbstorganisation gestärkt, die Sicherung sozialer Reformen über die „Bürgergesellschaft“ definiertes Staatsverständnis. Die Theorie der Selbstorganisation bietet nämlich eine Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklungen dialektisch und nichtdeterministisch zu fassen. „Die Welt darf (…) nicht bleiben, wie sie ist. Nur die Etablierung einer qualitativ anderen Gesellschaft wäre die Basis für die Lösung der globalen Probleme. Dazu bedarf es aber des aktiven gesellschaftstransformierenden und emanzipatorischen Handelns des Menschen. (…) Ein kritisch-praktisch Handelner muss wissen, worauf er sich bezieht, was er verändern will und 39 wogegen bzw. eine Aufhebungsbewegung stattfinden soll. Eine kritische Theorie der Gesellschaft kann dabei die Rolle spielen, bestehende Verhältnisse und die Möglichkeit zu deren Veränderung zu verdeutlichen. Was sie nicht kann und nicht soll, ist den Menschen vorzugeben, wie ein alternativer Gesellschaftsentwurf auszusehen hat. Denn eine Transformations- und Aufhebungsbewegung in Richtung einer anderen Gesellschaft kann nur eine von unten sein“ (Marcuse 1937:122). Das aktive selbstorganisierte Handeln der Menschen ist also von grundsätzlicher Bedeutung. Und hier kommt nun ein neues wissenschaftliches Paradigma zum Vorschau: die Theorie der Selbstorganisation. Dieser interdisziplinäre Ansatz kann emanzipatorisch die Möglichkeiten gesellschaftskritischen Handelns näher analysieren sowie Grenzen und Perspektiven verdeutlichen. Christian Fuchs (2001), der Marx ideologische Einstellung zur Arbeit und Kapital ziemlich genau übernommen hat, ist der Ansicht, dass heute, wie auch in der Zeit von Marx, sich Kapital und Lohnarbeit in einem Ausbeutungsverhältnis gegenüberstehen, da die Arbeitenden nach wie vor unbezahlte Mehrarbeit leisten. Dieser Mehrwert wird von den Kapitalisten angeeignet und ist die Basis der kapitalistischen Ökonomie. Eine immer kleiner werdende Zahl der Kernarbeiter könne ihre Vollzeitarbeit nur dadurch absichern, indem die Kapitalisten dafür sorgen, dass die Arbeitsverhältnisse peripherer Arbeiter immer miserabler werden. Der Kapitalismus braucht Milieus der Ausgebeuteten oder der Ausgeschlossenen damit die Kapitalakkumulation funktionieren und der Kapitalismus seine Reproduktionsfähigkeit garantieren kann. Mit Ausbeutung ist gemeint, dass patriarchale und rassistische Verhältnisse geschafft werden, um unter deregulierten Arbeitsbedingungen und unter Minimierung des variablen Kapitals ein Maximum an Mehrwert auszupressen und Surplusprofite zu erzielen, so Fuchs. Fuchs zufolge bestehe ein ökonomischer Antagonismus des Kapitalismus auch darin, dass die Akkumulation von Reichtum auf der einen zur Akkumulation von relativer Verarmung auf der anderen Seite führt. Mit Marx Worten: „Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das Kapital und die Energie seines Wachstum, desto größer ist die industrielle Reservearmee. Und je größer diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee ist, desto massenhafter sind die konsolidierte Überbevölkerung und deren Verelendung“ (in Schwan 1983:160). Wir sehen also, dass der Kapitalismus eine Form der Gesellschaft ist, die durch Antagonismen geprägt wird. Doch welche Rolle spielt die Technik im Kapitalismus? Nach Fuchs Verständnis erleichtert die Technik im Prinzip die Arbeit aber im Kapitalismus wird sie zum Herrschaftsmittel über die Arbeitenden, da der Kapitalismus die Anwendung und Entwicklung der Technik als Mittel der kapitalistischen Herrschaft nutzt. 40 „Es werden nicht mehr Zwecke identifiziert, zu deren Erreichen Technik ein Hilfsmittel ist, sondern Technik wird zum Selbstzweck. (…) Technik dient nicht mehr den Menschen zur Erleichterung ihres Daseins und ihrer Auseinandersetzung mit der Natur, sondern der effektiven Ausbeutung der Arbeitender durch das Kapital und der Produktion des Mehrwerts. (…) Technik ist eine Form der relativen Mehrwertproduktion. Durch ihre Entwicklung als Produktivkraft ist sie Mittel um die lebendige Arbeitskraft effizienter zu gestalten. D.h., dass der permanente Fortschritt von Wissenschaft und Technik dafür sorgt, dass die Mehrwertproduktion zeitlich immer mehr komprimiert wird. Mit Hilfe immer neuer und besserer Maschinen kann immer mehr Mehrwert in immer kürzerer Zeit hergestellt werden. Der Ausbeutungsgrad der Arbeitenden steigt dadurch immer mehr an“ (Fuchs 2001:47). Mit dem beschriebenen Widerspruch, also aufgrund der permanenten Automatisierung der Arbeit, steigt die Arbeitslosigkeit langfristig relativ an. Die Lohnarbeiter selber sind im Kapitalismus zum Anhängsel geworden: alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft vollziehen sich auf Kosten des einzelnen Arbeiters. Zudem werden Arbeiter dem geistigen Prozess der Arbeit entfremdet, werden zu Bedienern der Maschinen und nicht umgekehrt. Die Rolle des Staates im Kapitalismus begründet Fuchs in folgenden Punkten: 1. Der Staat organisiert die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen der Kapitalakkumulation sowie der kapitalistischen Produktion und Reproduktion: die Garantie der Verfügbarkeit von Lohnarbeit für das Kapital, Subventionspolitik, Steuerpolitik, Reproduktion des Arbeitenden usw. Außerdem: wenn der Reproduktionsprozess des Kapitals versagt und unterbrochen wird, hat der Staat die Funktion, die Bedingungen für die Selbstreproduktion des Kapitals herzustellen. 2. Der Staat hat die Funktion der repressiven Absicherung des Kapitalverhältnisses durch Gesetzgebung, Justiz, Polizei und Militär. Der Staat dient also der repressiven Niederhaltung der ausgebeuteten Gesellschaftsgruppen. 3. Der Staat bemüht sich im Falle der Zusammenbruchtendenzen des Kapitalismus auf eine schnellstmögliche Wiederherstellung des Systems und um die Beseitigung der Elemente, die eine mögliche gesellschaftliche Unruhe stiften könnten. 4. Der Staat hält die kapitalistische Gesellschaftsform zusammen, die geprägt durch eine Vielzahl von Konflikten ist: das sind religiöse, kulturelle, geschlechtliche Konflikte, nicht nur Konflikte zwischen sozialen Klassen. 5. Der Staat agiert als ideologischer massenintegrativer Apparat: das soll den Schein wecken, dass der Staat die Klassenverhältnisse durch Sozialpartnerschaften, Gewerkschaften usw. reguliert (vgl. Fuchs 2001:50) 41 „ In der Tat gehört es zur Ideologie und zur Verschleierungstendenz des heutigen Kapitalismus, Planungselemente, Krisenmanagement und Systematisierung kollektiver Vorgänge als nicht mehr kapitalistische auszugeben, sondern als (positive) Folgeerscheinung des Machtantritts klassenenthobener, an Verwertungsinteressen nicht mehr gebundener und vom Kapital daher nicht mehr gesteuerter oder steuerbarer Führungsgruppen“ (Agnoli 1995:62). Bourdieu hat, genau wie Marx, wiederum keine systematische Analyse des modernen Staates hinterlassen. Marx leitete den Staat aus den ökonomischen Verhältnissen eines Gesellschaftstypus ab und äußerte demzufolge verschiedene negative Einschätzungen zum Staat: Der Staat war für ihn Teil des Systems der Klassenherrschaft, parasitäre Institution oder ausführendes Organ der Bourgeoisie. Bourdieu begreift den Staat als Ort von Kämpfen, auch wenn es sich hier interessanterweise nicht um einen Klassenkonflikt handelt. Es geht vielmehr um die Konkurrenz zwischen Ministerien und ihr Durchsetzungsvermögen bei der Verfolgung eigener Ziele und Strategien. Was das Verhältnis des Staates zu Ökonomie betrifft, so erweist sich Bourdieus Analyse als eindimensional: „So finden sich immer wieder (bei Bourdieu) Hinweise darauf, dass der Staat schlicht der Handlanger des neoliberal durchorganisierten Kapitals ist: sei es, indem sich jene Fraktionen der Staatsagenten durchsetzen, die den Rückzug des Staates proklamieren; sei es, indem der Staat eben nicht mehr als Wahrer der sozialen Rechte seiner Bürger auftritt, also als Wohlfahrtsstaat, sondern regrediert zu einem Staatstypus, der gegen einen Teil seiner Bürger mit Gewalt vorgeht und ein Strafregime durchsetzt“ (vgl. Western/Beckett 1998, in Florian/Hilldebrandt (Hrsg.) 2006:205). Aus der zeitdiagnostischer Perspektive Bourdieus wirkt der Staat als hilfloses Opfer der Globalisierung: er ist hilflos der Dynamik der Märkte ausgeliefert und es bleibe nichts übrig, als den Rückzug anzutreten. Bourdieu vertritt hier die These der Entstaatlichung, dass sich im Zuge der totalen Ökonomisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse das amerikanische Modell des Wohlfahrtstaates durchsetzen wird. Das bedeutet: eine grundlegende Transformation des Staates und den Verlust seiner regulativen und umverteilenden Funktionen. Betrachtet man die amerikanische Wirtschaftspolitik näher, so wird schnell deutlich, dass Bourdieus Verständnis vom amerikanischen Staat nicht der Realität entspricht. Er meint vielmehr die reine Ideologie des Staates. „So rächt sich am Ende, dass sich Bourdieus Zeitdiagnose des „neuen“ Kapitalismus zu stark auf die Ideologie des Neoliberalismus und dabei insbesondere auf Bewusstseinsphänomene konzentriert, statt durch eine politisch-ökonomische Analyse das Verhältnis von Staat und Markt zu klären und von hier aus die Rolle des Staates unter Bedingungen der Globalisierung zu diskutieren. Bourdieu stimmt damit das Lied 42 umfassender und ideologisch abgesicherter Ökonomisierung an, statt auf Brüche, Widersprüche und Gegenbewegungen dieses Prozesses hinzuweisen“ (Florian/Hillebrandt (Hrsg.) 2006: 216). Nach Fuchs ist es im kapitalistischen Weltsystem, aus der kulturellen und ideologischen Hinsicht betrachtet, unmöglich, dass sämtliche Kulturen, religiöseGemeinschaften in gemeinsamen Wohlstand und Frieden miteinander leben. Denn Ausbeutung und Herrschaft im Kapitalismus funktionieren nicht von selbst, sondern es wird immer eine ideologische Legitimation bzw. Ideologie benötigt für die Konstruktion der Unterscheidungskategorien. Eine solche typische Ideologie stellt der Rassismus dar. Eine Dialektik von Gleichem und Verschiedenem kann durch die Verknüpfung von Selbstorganisations- und Informationskonzept erreicht werden. Wissen ist heute zu einer wesentlichen Produktivkraft geworden. Es schafft Bedingungen und Infrastrukturen der Kapitalakkumulation, ist verantwortlich für die Entwicklung der geistigen Grundlagen des konstanten Kapitals und der immer effektiver werdenden Methoden der Produktivkraftentwicklung. Das heißt: die techno-wissenschaftliche Arbeit ist für das Bestehen des kapitalistischen Weltsystems unerlässlich. Wenn Marx zu seiner Zeit behauptete, dass die Wissenschaft kostet dem Kapitalismus überhaupt nichts, dann war er nicht besonders vorausschauend. Denn die Wissensarbeit, im als „Informationsgesellschaft“ titulierten Kapitalismus, wird immer bedeutender. Sie ist im Postfordismus zu einer herausragenden Quelle des Profits in der Kapitalakkumulation geworden. Von großer Bedeutung ist dabei die Softwareproduktion, da sie eine wesentliche Antriebskraft der Verwertungsmaschine darstellt. Man kann Software als eine Form kodierten Wissens betrachten, die nur einmal hergestellt werden muss, aber dafür billig reproduziert und extrem teuer verkauft werden kann. Die kapitalistischen Softwarefirmen versuchen mit Patenten und Urheberrechten die exklusive Nutzung von diesem Wissen einzuschränken, für die breite Masse schwer zugänglich zu machen und nur denjenigen es zu verkaufen, die es sich leisten können. Der Wunschtraum eines jeden Kapitalisten ist die Konvergenz des konstanten und variablen Kapitals gegen Null. Wird dem Kapital nun neues Wissen quasi gratis zur Verfügung gestellt, so entspricht es diesem Wunschtraum des Kapitalisten. Im Rahmen von Klassenverhältnissen wird soziale Information produziert. Dabei erfolgt die Information im Rahmen dieser antagonistischen Verhältnisse nicht selbstorganisierend und exklusiv. Das totalitäre Element der Marktwirtschaft verlangt, dass Zwang und Fremdbestimmung als Selbstverständlichkeiten dargestellt werden. Die Kategorien sämtlicher Lebensbereiche wie: Lohnarbeit, Tausch oder Konsumzwang sind eben nicht selbstverständlich, sondern nur typisch für den Kapitalismus. 43 Die ganze westliche Welt, die durch Repräsentativdemokratie und den Kapitalismus geprägt ist, beruht auf asymmetrische Machtbeziehungen, die soziale Klassen in einflussreiche und einflusslose unterteilen. Die einflussreichen haben uneingeschränkten privilegierten Zugang zu Informationen, der den einflusslosen Klassen vorenthalten werden. Bei dieser Art sozialer Informationen handelt es sich um soziale Exklusion. Die benachteiligten sozialen Gruppen haben kaum oder gar keine Mitwirkung beim Konstitutionsprozess sozialer Informationen. Ihre Mitbestimmung reduziert sich auf Volksbefragungen und auf Wahlen, bei denen soziale Exklusionen schon vorgegeben sind. Das heißt: die asymmetrische Machtverteilung zeigt sich auch in ungleicher Verteilung der Verfügbarkeit von Information in der Form von Wissen. Zusammengefasst: bei sozialer Information kann es sich demnach um eine soziale Inklusion oder um eine soziale Exklusion handeln. Hat jedes beteiligte Individuum den gleichen Zugang zur Informationsstruktur und die gleichen Möglichkeit, diese in seinem eigenen Sinn zu beeinflussen, so ist die Rede von inklusiver sozialer Information. „Diese Art der sozialen Information entsteht durch soziale Kooperation der betroffenen Individuen. Sie wird als emergente Eigenschaft eines sozialen Systems kollektiv von den beteiligten und betroffenen Individuen in einem Selbstorganisationsprozess hervorgebracht. Selbstorganisation bedeutet dabei, dass die von entstehenden Strukturen betroffenen Individuen Eintreten, Form, Verlauf sowie das Ergebnis dieses Prozesses selbst bestimmen und gestalten können und durch mikroskopische Wechselwirkungen untereinander makroskopische Strukturen hervorbringen“ (Fuchs, 2001: 67). Soziale Exklusion liegt vor, wenn soziale Information nicht kollektiv von den Betroffenen, sondern von einem in einer sozialen Hierarchie stehendem Teilsystem konstituiert wird. Sie entsteht durch soziale Konkurrenz, mit dem Zweck Herrschaft und Macht über die anderen auszuüben, die Vorteile auf Kosten anderer zu gewinnen. „Informationsmonopole sind Machtmonopole. Sie sind zu brechen, wenn eine humane Gesellschaft erreicht werden soll“ (Hörz 1993:122). Es gibt wohl kaum ein Individuum, das mit sämtlichen Gesetzen und politischen Entscheidungen in seinem Staat einverstanden wäre. Jeder verfügt über eine eigene individuelle Informationsstruktur, auch wenn individuell konstituierten Realitäten häufig die Widerspiegelung herrschender exklusiver Normen, Regeln und Werte ist. Anders gesagt: Menschen werden mit Desinformationen und Manipulation aus Politik, Medien und Wirtschaft konfrontiert. Die mächtigen Klassen verfügen über monopolisierte Kontrolle in der Information und in Wissensform. Der Kampf für neue Verhältnisse sollte an zwei Fronten erfolgen: in emanzipativen Bewegungen und in Netzwerken mit den anderen Menschen in der Gesellschaft. Es gab und es gibt in der Realität Menschen auf 44 verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, die sich organisieren, um gemeinsam weitreichende emanzipative Ziele umzusetzen. Sie wollen eine Gesellschaft, in der die Individuen ohne jegliche persönliche oder sachliche Herrschaft eingeschränkt zu sein, selbstbestimmt handeln können. Wichtige Kriterien für das Binnenverhältnis emanzipatorischer Bewegungen sind: 1. Bindung an individuell vertretene Ziele, keine Verselbständigung von sich institutionalisierenden Teilen der Bewegung als Selbst-Zweck. 2. Verhinderung der Instrumentalisierung von Menschen für Zwecke anderer, Schaffung von Strukturen für die Schaffung und Aufrechterhaltung intersubjektiver Beziehungen. Demgegenüber fordert Bergstedt (2000): „Mein Ziel ist, Verhältnisse zu schaffen, die Gleichberechtigung schaffen, bei denen die Menschen auch authentisch sein können und nicht in dieser beklemmenden Atmosphäre des „Ich darf niemandem zu nahe treten“ agieren. Das ist zu erreichen u.a. durch: - Dezentralisierung weg vom Plenum Offene, sich ständig veränderte Strukturen Platz für Streit und kreative Prozesse Autonomie für Menschen und Gruppen“. Selbstorganisationen bedeutet eine Ausweitung individueller Wirkungsmöglichkeiten auf Basis kollektiver Prozesse, die die individuelle Reichweite weit übersteigt. Die Selbstentfaltung des Einzelnen im kollektiven Rahmen ist die Voraussetzung für selbstorgansierte Prozesse. Dabei stellt sich selbstverständlich die Frage, wie die Selbstorganisationen entfaltet und koordiniert werden können, ohne wieder Herrschaftsformen auszubilden? Die Antwort lautet: Selbstorganisationen beruhen vor allem auf der Kraft der von den Einzelnen ausgehenden Aktivitäten unter Voraussetzung entsprechender Rahmenbedingungen. Das bedeutet: keine Vorschriften für konkretes Tun, aber Kriterien für das individuelle Handeln und Vernetzungen. Heutzutage ist Herrschaft nicht mehr offensichtlich: sie versteckt sich in den scheinbar normalen und natürlichen Alltagszwängen. Dies hat zu Folge, dass es in den kapitalistischen Ländern, auch in Krisensituationen, bei steigender Arbeitslosigkeit und Verelendung großer Teile der Bevölkerung, selten zu spontanen Protestaktionen oder Befreiungsschlägen kommt. Außerdem: politische Bewegungen werden schnell überheblich, im Sinne „für die anderen denken und entscheiden zu wollen“. Man will die angebliche „Interesse der Mehrheit“ durchsetzen, in Wirklichkeit handelt man nach partialen Interessen. Gegen die bisherige Unterordnung unter herrschaftliche Vorgaben in Form des Wert-Verwertungszwanges im Namen der „Rentabilität“ und gegen die Instrumentalisierung von Menschen, ist die Eigenaktivität der verschiedenen Individuen als Träger der Bewegungen und Umwälzungen notwendig. Wie aber soll das konkret aussehen? Eine Möglichkeit ist der völlige oder teilweise Ausstieg aus Verwertungszusammenhängen und die Etablierung neuer Regeln des Austauschs. Es geht um die „Entkoppelung eines sozialen Raums 45 emanzipatorischer Kooperation von Warentausch, abstrakter Leistungsverrechnung“ (Kurz 1997). Geldbeziehung und Marx hat schon vor mehr als hundert Jahre das Problem der Mehrarbeit deutlich beschrieben: „Der Diebstahl an fremder Lebenszeit, worauf der jetzige Reichtum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen diese neuentwickelte, durch die große Industrie selbst geschaffene. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört auf und muss aufhören, dass die Arbeitszeit sein Maß ist und daher der Tauschwert (das Maß) des Gebrauchswerts. (…) Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der wenigen für die Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes. Damit bricht sie auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen, und der unmittelbare materielle Produktionsprozess erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit abgestreift“ (Marx 1983/1857, 601). Hier nennt Marx die Möglichkeiten, die über 100 Jahre nach seiner Lebenszeit schließlich vorhanden sind. Sie sind außerdem auch berechtigt, insoweit das Bewusstsein der Menschen für diese neue historische Situation offen ist und indem die Menschen bereit sind diese Befreiung von dem Arbeitszwang als etwas Zukunftweisendes und Sinnvolles zu empfinden. Voraussetzung dabei ist, dass die kapitalistische Wirtschaftsform nicht mehr als Grundlage beibehaltet wird. In der heutigen Situation zeigt die freie Software-Community wie es geht. Die freie Softwareentwicklung ist eine Keimform personale-konkreter Produktivkraftentwicklung im Rahmen der dominanten wertvermittelten gesellschaftlichen Reproduktion. Das Beispiel von „Linux“ zeigt, dass ein freies Computerbetriebssystem geschaffen werden kann, das ohne jegliches Verwertungsinteresse und in weltweiter Kooperation von Tausenden von Menschen, „aus eigenem Betrieb“ entwickelt werden konnte. Es wurde ein Sonderraum geschaffen, wo die Menschen sich zusammenfanden, um die Entfaltung der Software zu ermöglichen, die jedem Menschen zur Verfügung steht. „Linux“ ist zudem ein gutes Beispiel, dass in verwertungsfreien Sonderräumen die völlig neue Organisationsform, die auf Vertrauen und anerkannter Leistung beruht, entwickeln kann. Das Prinzip der Community ist dabei einfach: hier kann jeder ein neues Projekt gründen und die Mitstreiter dafür werben. Es gibt keine Konkurrenz oder übergeordneten Mechanismus, die irgendeine Regeln oder Ziele bestimmen. Das Wichtigste ist eher: Selbstentfaltung, Anerkennung, Spaß und Berücksichtigung der Bedürfnissen des Anderen. Diese personalen, konkreten Vermittlungsformen sind die Voraussetzung für den Erfolg freier Software. Das Resultat ist bemerkenswert: neue Produktivkraftentwicklung „am Rande der Gesellschaft“, anerkannt überlegene Produktqualität und unendliche gegenseitige Hilfsbereitschaft in der freien Software-Community. Geschaffen von freien Entwicklern und nur über das Internet verbunden, stellt sie eine ernsthafte Bedrohung da für die weltgrößten Softwarekonzerne. 46 Das beschriebene Beispiel zeigt, dass bereits heute Ansätze entstehen, die fordern: Sicherung der Grundsicherung über eine Nutzung der jeweils notwendigen Lebensgrundlagen und Produktionsmittel Abbau ökonomischer und anderer Zwänge, die sich nicht aus menschlichen Bedürfnissen ergeben (Verschwendungsproduktion, Profit, Rüstung usw.) Gemeinsame Nutzung vieler Güter statt Privatbesitz Entwicklung alternativer Ökonomieformen, die die Abschaffung der Zwangsstrukturen einschließt, denen sie bisher aufgrund der Wertvergesellschaftung unterworfen sind Entwicklung dezentraler Politik- und direkter Demokratieformen (konkrete Vorschläge in Bergstedt 1999a). Zu betonen ist, dass diese neue Vergesellschaftung, auch wenn sie moderne Technik als Grundlage benutzt, im Grunde intersubjektive Beziehungen zwischen den Menschen voraussetzt. Dabei entstehen neue Regeln, die an der Selbstentfaltung des Menschen und nicht an der Selbstverwertung des Wertes orientiert sind. Der Kampf gegen die kapitalistische Wirtschaft ist hart und die Repression beträchtlich, aber der erste qualitative Schritt ist schon getan. Mit Linux, sozialen Selbstorganisationen und emanzipativen Bewegungen insgesamt, wurde die Grundlage für neue Kommunikations- und Lebensformen gelegt. „Noch unter Bedingungen der subjektlosen Wert-Verwertungsmaschine und der entfremdeten Produktivkraftentwicklung bilden sich Zentren neuer Produktions- und Reproduktionsformen heraus. Diese etablieren sich außerhalb der alten Zusammenhänge, aber unter voller Nutzung der besten materiellen und ideellen Gebrauchswerte, die das alte System hervorgebracht hat. (…) Im Binnenverhältnis setzten sich intersubjektive Beziehungen als Grundlage eines vernünftigen Austausches der lebensnotwendigen Dinge durch – Qualität, Inhalte und Kommunikation ersetzen die „unsichtbare Hand“ der abstrakten Vermittlung über den Markt“ (kritische-informatik.de) Bisher wurden relativ viele gut gemeinte „Utopien“ entwickelt – die Entwürfe „neuer“ Gesellschaftsformen. Die konkrete Utopie intersubjektiver Beziehungen beschreibt Iris Rudolph (1998:78): „Ich möchte eine Welt, in der die Menschen sich nicht gegenseitig benötigen, in der sie einfach durch das, was sie tun und alles lassen, für sich tun und lassen, gleichzeitig auch das Beste für alle anderen tun“. „Fähigkeiten und Bedürfnisse entwickeln sich permanent, das gilt auch für intersubjektive Beziehungen. Die praktischen Erfahrungen in der Kooperation mit anderen, bei der Aktion, beim Streik, bei der Blockade oder beim Flugblatt schreiben bilden eine wichtige Grundlage. Widerstand ist deshalb auch Subjektwerdung wie sie z. B. Peter Weiss im Jahrhundert-Roman „Ästhetik des Widerstands“ (1983) ausführlich beschreibt. Hier haben auch so begrenzte 47 Formen wie Zukunftswerkstätten, das Konzept „New Work“ (nur das tun, was ich wirklich, wirklich tun will) oder Tauschringe, die Fixierung auf Lohnarbeit und Geld aufbrechen, ihren berechtigten Platz. „Soziale Erfindungen“ sind unverzichtbar, doch die Inhalte dürfen dahinter nicht zurückbleiben“ (ebd.) Viele freier Software Kritiker behaupten, dass die freie Software taugt nicht als ein Entwicklungsmodell für eine andere Gesellschaft. Ihre Begründung lautet, dass die Linux-Community ist ein kleiner elitärer Kreis von vorwiegend weißen Männern aus Europa und den USA. Außerdem, die tatsächlichen Kämpfe würden sich nicht im virtuellen, sondern in der realen Welt stattfinden, und deshalb könne Linux einfach nicht als Vorbild emanzipatorischer Kämpfe agieren. Verbreitung, Entwicklung, und Zugänglichkeit von technischen Artefakten oder Medien wie Software, Internet oder Computer können im Kapitalismus niemals frei sein. Schon der Zugang zum Internet, sei für sehr viele Menschen auf dieser Welt verschlossen. Software und technische Vernetzung können unter diesen Bedingungen niemals ein Inbegriff von Freiheit sein, sondern sind Mittel zur Herrschaft sowie Medium und Resultat der ökonomischen Globalisierung des Kapitalismus. Meretz und Co. sprechen von der “freien” Softwareproduktion als Keimform einer anderen Gesellschaft. Vor allem auch aus dem Grund, da sie in der Art und Weise, wie hier produziert wird, eine Antizipation zukünftiger Verhältnisse des Postkapitalismus sehen. Es handle sich um eine globale, dezentralisierte, vernetzte, kollektive Form der Selbstbestimmung, bei der die Prosumenten (gleichzeitig Produzenten und Konsumenten) auch noch Spaß an ihrer Tätigkeit haben. (siehe z. B. Ribolits 1995, Fuchs 2000a, 2000b, 2001; Parker/Slaughter 1988, Rifkin 1995). Letztendlich ist die Aufhebung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nur die Basis der Entwicklung einer “neuen Richtung des technischen Fortschritts … [und] einer neuen theoretischen und praktischen Idee der Vernunft” (Marcuse 1967, Der eindimensionale Mensch). Die gesellschaftliche Basis des Postkapitalismus, die sich aus einem historischen Bifurkationspunkt durch die politische Selbstorganisation emanzipatorischer Subjekte als realisierte Alternative der gesellschaftlichen Entwicklung ergibt, ist eben nur Basis und nicht fertige Form. Allerdings zeigen die Erhebungen (Gensicke/Picot 2006), dass das bürgerliche Engagement überwiegend von Bürgern mit höherem Bildungsstand und gesicherten Einkommen getragen wird. Es offenbart sich der Verdacht, dass die gesellschaftliche Partizipation nicht allen sozialen Gruppen zugänglich ist. Die zweite Vermutung wäre dann, dass soziale Beziehungen nicht für alle Menschen einen tragenden Wert haben. 5.2 Pierre Bourdieus Sozialkapital 48 Pierre Bourdieu (1983) hatte ein kritisches Verständnis vom Sozialkapital, als den Zugang zu Informationen und Netzwerken. Ihm zufolge, diene das Sozialkapital vor allem der Selbstreproduktion gesellschaftlicher Milieus bzw. Gruppen, also der Inklusion oder der Exklusion. Er stellt Sozialkapital neben ökonomisches Kapital (Geld) und kulturelles Kapital (Bildung). Bourdieu geht davon aus, dass letztlich alle drei Formen des Kapitals in eine jeweils andere überführbar sind: wer Geld hat, hat besseren Zugang zu Bildung und Netzwerken, Sozialkapital verhilft als „Vitamin B“ zu mehr Geld, Engagement und Netzwerken, gebildete Menschen haben es einfacher an Geld zu kommen und haben erweiterte Zugänge zu Netzwerken. Das heißt: Die Verfügbarkeit und die Qualität des sozialen Kapitals ist von sozialstrukturellen Ungleichheiten abhängig. Das soziale Kapital steht im Zusammenhang mit derzeitigen und potentiellen Ressourcen, die auf soziale Beziehungen zurückzuführen sind. Darunter sind Anerkennung, Wissen und Verbindungen, die man im Rahmen von sozialen Beziehungen erhalten kann. Das Kapital, über das Eltern verfügen, wird in der Bildung ihrer Kinder und für den Aufbau von sozialen Beziehungen investiert. So werden maßgeblich die Chancen erhöht, dass die Kinder ebenfalls einen hohen sozioökonomischen Status in der Gesellschaft erlangen: „Kein materielles Erbe, das nicht auch gleichzeitig kulturelles Erbe ist: die Funktion des Familienbesitzes (…) trägt er praktisch zu deren moralisch-geistiger Reproduktion bei, d.h. zur Weitergabe von Werten, Tugenden und Kompetenzen, welche die legitime Zugehörigkeit zu den bürgerlichen Dynastien begründen“ (Bourdieu 1993: Die feinen Unterschiede, 136, 137). Anders gesagt: die Kapitalformen und die Klassenzugehörigkeit der Eltern sind entscheidend für die Habitusentwicklung des Kindes. Durch den Habitus des Heranwachsenden reproduziert sich die Sozialstruktur. Die Klassengliederung ist Bourdieu zufolge in kapitalistischen Gesellschaften auf das Kapitalvolumen und die beiden Kapitalformen – das ökonomische und das kulturelle Kapital, zurückzuführen. Innerhalb der Klassenstruktur trifft man auf zwei Fraktionen: auf die herrschenden Herrschenden, die ihre Klassenpartizipation zumeist primär ökonomisch begründen, und die beherrschten Herrschenden, deren Klassenpartizipation primär auf kulturellem Kapital basiert. In der Mittelklasse ist ein ähnlicher Sachverhalt zu finden, lediglich ist hier die Mobilität zwischen den Klassen höher. Bourdieu untermauert die Starrheit des Habitus: ist der Klassenhabitus einmal gebildet, so ist es schwer einen anderen herauszubilden, der anderen Klasse zugehören. Meistens bleiben Individuen in den sozialen Milieus, in den sie sozialisiert wurden. So determiniert die Klassenzugehörigkeit den Habitus und die Reproduktion sozialer Ungleichheit in Gesellschaften. 49 In gegenwärtigen Problematisierungen der Bedeutung von Sozialkapital in modernen Gesellschaften rückt die Bourdieus Theorietradition inzwischen häufiger in den Blickpunkt. Denn die zeitdiagnostische Analyse der Gegenwartsgesellschaft lautet: Spaltung, Ausschluss, Prekarität. Die Versprechen auf Chancengleichheit, Wohlstand, gesellschaftliche und politische Teilhabe, die die Nachkriegsgesellschaften prägten, sind längst verflogen. Es scheint, dass das bürgerliche Engagement eher das Zauberwort der Politik oder die Angelegenheit derjenigen ist, die ohnehin in kultureller und ökonomischer Hinsicht privilegiert sind. Exemplarisch dafür stehen Bourdieus Arbeiten über die Eliten Frankreichs in den 60er Jahre: fast identische Königswege im Bildungssystem und eine ähnliche soziale Herkunft, zumeist aus der Bourgeoisie, erhalten die homogene, sich selbst reproduzierende Elite, die über politische Zugehörigkeit hinaus hier einen Klassencharakter annehmen. Das soziale Kapital einer solchen Elite manifestiert sich nicht nur im abgestimmten Ausschluss Gruppenfremder, es trägt auch dazu bei, Transaktionskosten in Staat und Wirtschaft zu senken. Zudem beschreibt Bourdieu in seinen Arbeiten den zynischen Diskurs um die „Volksvertreter“: „Insofern ist diese Studie auch eine fundamentale Kritik an jenen gesellschaftlichen Gruppen, auf die sich Bourdieu seit seinen Studien der sechziger Jahre besonders konzentrierte: die Eliten, die für ihn den eigentlichen Schauplatz der sozialen und symbolischen Auseinandersetzungen darstellen. Denn bei der heutigen Verfassung der Gesellschaftsordnungen läge es prinzipiell in ihren Händen, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit Verteilungsgerechtigkeit zu verbinden und in eine Kultur innen- und außenpolitischer Konfliktführung zu integrieren. Stattdessen ginge man aber, so Bourdieu, sukzessive „von einer staatlichen Politik, die auf eine Beeinflussung der Verteilungsstrukturen aus ist, zu einer Politik über, die nur noch eine Korrektur der Auswirkungen der ungleichen Ressourcenverteilung an ökonomischem und kulturellem Kapital zum Ziel hat, das heißt eine Staatswohltätigkeit für die würdigen Armen (deserving poors) wie zu den guten alten Zeiten religiöser Philanthropie“ (vgl. www.bpb.de). Orientiert man sich an Bourdieus Theorie, dann ist zu fragen, in welchem Ausmaß die Mobilisierung der Kapitalsorten von der sozialstrukturellen Position der Akteure abhängig ist. Dabei müssen die sozialräumlichen Rahmenstrukturen zur Bildung von Kontakten berücksichtigt werden: für welche Bevölkerungsgruppen ist die Mobilisierung welcher Ressourcen jeweils einfacher oder schwerer; welche Rolle spielen sie beim Aufbau von Netzwerken? In der an Bourdieus Gesellschaftstheorie angelehnten Studie von Michael Vester (1995) wird eine profunde Diskussion um die Perspektiven des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland geführt. Dort lassen sich zwei Kernpunkte so zusammenfassen: 50 Erstens: Die sozialen Milieus in Deutschland haben sich nicht vollkommen aufgelöst, im Gegenteil: ihre Anpassungsfähigkeit im Rahmen des sozialen Wandels erwies sich als äußerst stabil, was die Klassenkultur weiterhin aufrechterhält. Auffällig ist vor allem der Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Verhalten der verschiedenen Milieus in ihrem lebensweltlichen Umfeld und ihren gesellschaftspolitischen Grundeinstellungen. Zweitens: die Ergebnisse seiner Studie zeigen, dass sich die Herrschaft der Parteien in ihren klassischen gesellschaftspolitischen Lagern zunehmend verringert. So gesehen gibt es keine Veränderungen in den Milieus, sondern Krisen der politischen Repräsentation, als Folge der wachsenden Distanz zwischen Milieus und Eliten. Die politische Elite findet keinen Anschluss an die Bevölkerung, sie bietet keine Lösung für soziale Desintegration, sondern lediglich Sparkonzepte, die die sozial Benachteiligten nicht ausreichend schützen und reintegrieren können. Das bedeutet: die Eliten sind nicht imstande effektive Methoden für die Herstellung sozialer Gerechtigkeit zu schaffen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen ein ganz widersprüchliches Bild vom sozialen Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft: Neben der gängigen Annahme, dass „in der Hitze von Individualisierungsprozessen das Soziale, der Konsens verdampft, avancieren offensichtlich die wachsenden sozialen Ungleichheiten abermals zu einem fundamentalen Problem der gesellschaftlichen Integration: von der strukturellen Massenarbeitslosigkeit über die wachsende Gefährdung des Lebensstandards der „Mittelschichten“ bis hin zur Konfliktverschärfung zwischen „Einheimischen“ und „Zugewanderten“ oder verschiedenen Klientelen des Wohlfahrtsstaates. Eine Vielzahl anderer, teilweise längst als überwunden geglaubter Ungleichheiten ließen sich hinzufügen“ (Dahrendorf 1992:62). Die Auswirkungen dieses „modernen sozialen Konflikts“, der von Dahrendorf beschrieben wurde, haften auf soziale, wirtschaftliche und politische Beschränkungen bürgerlicher Teilnahme von Menschen an gesellschaftlichem Leben. Aus Bourdieus Sicht ist der Rückzug des Staates in der Zeit der Umverteilung von vorhandenen Ressourcen eine fundamentale Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es bleibt nur zu hoffen, dass der wachsenden Ungleichheit im Bereich des Sozialkapitals mehr Aufmerksamkeit in den Forschungen der sozialen Ungleichheit geschenkt wird. 6. Schlussfolgerung 51 Unsere Warengesellschaft tendiert totalitär zu werden: alles ist unter dem Kapital subsumierbar. In der Zeit der ökonomischen Dauerkrise schreitet die Durchkapitalisierung der Gesellschaft unaufhörlich voran. Das unersättliche Kapital sucht nach weiteren Verwertungssphären. Als technische Daseinsform innerhalb des Kapitalismus reproduzieren sich gesellschaftliche Dichotomien und Herrschaftsverhältnisse in den technischen Artefakten. Im Netz spiegeln sie sich in den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien wieder. Der Zugang zu diesen Technologien steht im Zeitalter der globalen Massenarmut und der globalen Massenarbeitslosigkeit nur in geringem Ausmaß zur Verfügung. Das bedeutet, das Wissen, das sich in den Händen der privilegierten Klassen befindet, wird nur zu einem hohen Preis zur Verfügung gestellt. Die in der Arbeit dargestellte freie Softwareproduktion und die beschriebenen Selbstorganisationen und emanzipatorische Bewegungen stellen keine fertige Form der gesellschaftlichen Alternative dar sondern nur die Basis theoretischer Überlegungen zur postkapitalistischen Gesellschaft. Schon aus dem Grunde, dass Technik und Wissenschaft nicht einfach in ihrer bestehenden Formen übernommen werden können, sie bedürfen nämlich einer qualitativen Veränderung. Was heute möglich ist, ist das Nachdenken und der Diskurs über Alternativen und Formen einer anderen Gesellschaft auf Basis der Kritik des Bestehenden. „Ein alternativer Gesellschaftsentwurf ist dann wahr, wenn er mit den realen Möglichkeiten übereinstimmt, die die bestehende Gesellschaft als Basis bietet und wenn er die bestehende Totalität als falsch erweisen kann, indem er die Aussicht bietet, die Errungenschaften der Zivilisation zu erhalten und zu verbessern, das Wesen der bestehenden Gesellschaft erfasst und der Verwirklichung einer Befriedung des Daseins größere Chance bietet. (…) Der Kapitalismus ist als Ganzes falsch, da er nicht allen Menschen ein glückliches, befriedetes Dasein auf der Basis einer Aufhebung der Entfremdung bietet, sondern auf dichotomisierenden Klassenverhältnissen basiert und sich durch die Existenz dieser reproduziert. (…) Wir können und sollen eine andere Gesellschaft heute gar nicht planen, da es gilt, eine neue Elitenbildung im Emanzipationsprozess zu verhindern. Eine andere Gesellschaft kann nur eine sein, die durch emanzipatorische, soziale Selbstorganisation auf Basis eines kritischen Bewusstseins entsteht, sonst wird sie nicht anders sein, sondern nur eine neue Form des Alten. Der Diskurs über Alternativen macht heute nichtsdestotrotz Sinn, um zu zeigen, dass der Kapitalismus nicht die einzige historische Alternative darstellt“ (in „Streifzüge 1/2001: „Freie“ Softwareproduktion – Antizipation des Postkapitalismus“ von Christian Fuchs“). Ein funktionell grundierter Klassenbegriff stellt heute nach wie vor eine analytische Schlüsselkategorie dar: die Soziologie soll soziale Differenzen und Konflikte nicht nur beschreiben oder beklagen, sondern auch die Möglichkeiten ihrer Veränderung zu erklären beanspruchen. Der Klassenbegriff ermöglicht es, soziale Ungleichheitsverhältnisse mit den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen im weitesten Sinne, also unter der 52 Berücksichtigung der Verhältnisse der „Produktion der Produzenten“ oder der verschiedener Modi kultureller und politischer Produktion, sie in einen wechselseitigen Erklärungszusammenhang zu bringen. Ungeachtet des in der jüngeren Soziologie aufgebauten Widerspruchs zwischen Theorien funktionaler Differenzierung und Theorien sozialer Differenzierung steht es fest, dass eben deshalb, weil die Klassentheorien von Marx und Bourdieu gerade durch eine Verschränkung der Theorien funktionaler und sozialer Differenzierung gekennzeichnet sind, die Reproduktion sozialstruktureller Ungleichheits- und Ausbeutungsbeziehungen über sachlichfunktionale Mechanismen vermittelt wird. Über die ökonomischen Zusammenhänge der dynamischen Reproduktion der Klassenstrukturen hinaus konnten mit Bourdieus Beiträgen zu anderen kulturellen, sozialen und politischen Feldern das Spektrum der Ungleichheitsrahmen ausgeweitert werden. Schließlich hat Bourdieus Analyse der funktionalen Interdependenzen zwischen Ökonomie und Bildungssystem einer utopischen Überwindung der traditionellen Ungleichheitsbeziehungen in der „Wissensgesellschaft“ einen Schlussstrich gezogen und gezeigt, dass die Bildungsexpansion unter kapitalistischen Bedingungen nicht anders als eine Anpassung der Klassenstruktur an veränderte Produktionserfordernisse ist. Die Steigerung und Erweiterung der Bildung in allen gesellschaftlichen Schichten führt nicht automatisch zur Veränderung der soziökonomischen Klassenverhältnisse. Allerdings steigen mit dem Bildungsgrad die emanzipatorischen Möglichkeiten und Entwicklungstendenzen, die Formierung sozialer Kräfte und soziale Bewegungen implizieren, und sich gegen die Reproduktionstendenzen richten. „Auch wenn bei all dem die mit Marx und Bourdieu herausgearbeiteten grundlegenden Logiken dazu führen, dass kapitalistische Gesellschaften immer wieder mit denselben Strukturparadoxien konfrontiert sind, ergeben sich in der Frage, wie die entsprechenden Basisantagonismen und Paradoxien politisch und sozial jeweils ausagiert werden, zahllose Varianzen und Freiheitsspielräume und das heißt immer auch: politische Gestaltungsmöglichkeiten. So erfüllt der von Marx analysierte Staatsschuldmechanismus in jüngerer Zeit sehr zuverlässig seine auch von Bourdieu verzeichneten Grundfunktionen zur Regulation sozialer und politischer Prozessdynamiken und zur Begrenzung politischer Gestaltungsspielräume und die darauf beruhenden Prozessverläufe des periodischen Aus- und Rückbaus der sozialen Teilhaberechte und der politischen Partizipationsmöglichkeiten sowie die periodischen Verschiebungen der Kräfteverhältnisse zwischen Ökonomie und Politik. (…) In Differenz zur jüngeren politischen und soziologischen Sachzwangrhetorik, in der eine konkrete Politik als vermeintlich alternativlose Reaktion auf vermeintlich invariante und dem politischen Handeln entzogene Marktzwänge präsentiert wird, entscheidet sich in dieser Perspektive immer erst in den politischen, ökonomischen und sozialen Beziehungen und Kämpfen, wie das politische, ökonomische und soziale Leben innerhalb des durch die Gesellschaftsformation bestimmten Möglichkeitsraums ausgeformt wird (…)oder ob neue Möglichkeitsräume jenseits der bestehenden 53 Produktionsverhältnisse eröffnet (…) werden“ (Heim 2013:612); (vgl. Kapitel: Heim 2013, 587 – 613). Nun muss noch die eingangs gestellte Frage beantwortet werden, ob Deutschland eine Klassengesellschaft ist. Noch bevor Bourdieus „feinen Unterschiede“ in der Fassung des Klassenbegriffs berücksichtigt werden, kann nach den Materialien, die viele Analytiker der Sozialstruktur (Hradil 1987, Erikson und Goldthorpe 1992, Noll 1993,) gesammelt und ausgewertet haben, der Schluss gezogen werden, dass nach wie vor zwischen der Klassenlage der Einzelnen und ihren sozialen Chancen ein zwingender Zusammenhang besteht. Die Korrelationen zwischen der Position in der Klassenstruktur, der Einkommenshöhe, dem Bildungsgrad, den Arbeitsbedingungen und den Wohn- und Lebensbedingungen, weisen deutlich darauf. Die Autoren kommen zum Ergebnis, dass „soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik nach wie vor vertikal strukturiert ist. Wie die zwischen den hier unterschiedenen Klassenlagen zu beobachtenden Wohlfahrtsdifferenzen dokumentieren, werden die Lebensbedingungen und die Lebensqualität der Bundesbürger auch weiterhin im beachtlichen Maße von ihrer eigenen oder der Stellung des Haushaltsvorstandes im Produktionsprozess und damit verbundenen Belohnungen, Chancen, Risiken und Belastungen bestimmt“ (Noll und Habich 1990:184 f.). Gleichzeitig unterstreichen sie, dass die soziale Ungleichheit nicht nur durch unterschiedliche Klassenlagen generiert ist, sondern es kommen andere, horizontale Faktoren hinzu. Ihnen zufolge geht es weniger darum „ein altes Konzept sozialer Ungleichheit durch ein neues zu ersetzen, sondern dass es kommt darauf an, die Konzepte nicht nur weiterzuentwickeln, sondern vor allem stärker zu integrieren und die Faktoren der vertikalen und der horizontalen Ungleichheit detaillierter als bisher in ihrem Zusammenwirken zu analysieren“ (ebd. 186 f.). Das heißt: das Zufügen von „neuen sozialen Ungleichheiten“ bedeutet nicht die „Entstrukturierung“ der Klassengesellschaft, sondern das Erkennen des dynamischen Charakters der modernen Gesellschaft. Marx und Bourdieus Klassentheorien, miteinander ergänzend verbunden, stellen die theoretische Konzeption der modernen Gesellschaft als Klassengesellschaft: das Festhalten am Klassengegensatz der kapitalistischen Produktionsweise als strukturierendem gesellschaftlichen Verhältnis einerseits, anderseits die Differenzierung homogene Klassenlagen nach der Stellung im Arbeitsprozess und nach der Bildungsausstattung („kulturelles Kapital“), führt zu einem gegliederten Modell, demzufolge die zwei entgegengesetzten, ökonomisch bestimmten Klassen von Kapital und Arbeit auf der „konjunkturellen“ Ebene der realen Kräfte- und Lebensverhältnisse auszudifferenzieren sind in mehreren sozialen Klassen. Sie bilden die Ebene der Gesellschaftsformation ab und können weiter differenziert werden nach den nachgeordneten oder sekundären Faktoren (Bourdieu) wie Region, Geschlecht und Ethnie. Ausgerüstet mit diesem relativ konkreten Modell, das 54 im Wesentlichen ein Model von Klassenlagen ist, können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass die Bundesrepublik nach wie vor eine Klassengesellschaft ist. Literaturverzeichnis Adorno, Theodor W., (1942): Reflexionen zur Klassentheorie. In: Gesammelte Schriften Bd. 8. 1997a, Frankfurt/Main 55 Adorno, Theodor W., (1968): Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. In: Gesammelte Schriften Bd. 8. 1997b, Frankfurt/Main Agnoli, Johannes: Der Staat des Kapitals und weitere Schriften zur Kritik der Politik. In: Gesammelte Schriften Bd. 2. 1995, Freiburg Berger, Peter A./Hitzler, Ronald (Hrsg.): Individualisierungen. Ein Viertel Jahrhundert „jenseits von Stand und Klasse“? 2010, Wiesbaden Bourdieu, Pierre: La distinction: critique sociale du jugement. 1979, Paris Bourdieu, Pierre: Zur Soziologie der symbolischen Formen. 1974, Frankfurt am Main Bourdieu, Pierre: Eingrenzungen – Ausgrenzungen – Entgrenzungen. 1999, Konstanz Bourdieu, Pierre: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. 1998, Frankfurt/Main Bourdieu, Pierre: Sozialer Raum und „Klassen“. 1985, Frankfurt am Main Bourdieu, Pierre: Titel und Stelle: über die Reproduktion sozialer Macht. 1981, Frankfurt am Main Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 1982, Frankfurt am Main Bourdieu, Pierre: Zur Soziologie der symbolischen Formen. 1970, Frankfurt am Main Bourdieu, Pierre: Reflexive Anthropologie. 1996, Frankfurt am Main Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. 1983, Göttingen Bourdieu, Pierre: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tausches. 1990, Wien Bourdieu, Pierre: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik und Kultur 1. 1992, Hamburg: VSA-Verlag, S. 31-47 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 1986, Frankfurt/Main Beck, Ulrich: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten. In: Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. 1983, Göttingen Becker, R. : Dauerhafte Bildungsungleichheiten als unerwartete Folge der Bildungsexpansion? S. 27–62 in: A. Hadjar / R. Becker (Hrsg.): BildungsexpansionErwartete und unerwartete Folgen. 2006, Wiesbaden: Bischoff, Joachin/Herkommer, Sebastian: Von der Klassentheorie zur Ungleichheitsforschung. In: Leisewitz, A./Pikshaus, K. (Hrsg.): Gewerkschaften, Klassentheorie und Subjektfrage. 1990, Frankfurt Boudon, R.: Education, Opportunity, and Social Inequality. 1974, New York 56 Breen, R. / Goldthorpe, J. H.: Explaining Educatio-nal Differentials. Towards A Formal Rational Action Theory. Rationality and Society 9: 275–305. 1997 Bergstedt, J.: Re: JUKss: Wem gehört die Jugendumweltbewegung? Mail in der Mailinglist Emanzipativer Umweltschutz, 10.2.2000. Bergstedt, J., (1999): Aufruf Widerstand gegen die neoliberale Weltordnung am Symbol Expo und überall! In: Internet http://www.thur.de/philo/uvu/uvu25.html. Dahrendorf, Ralf: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. 1957, Stuttgart Dahrendorf, Ralf: Der moderne soziale Konflikt: Essay zur Politik der Freiheit. 1992, Stuttgart Erikson, R./ Goldthorpe, J. : The Constant Flux. 1992, Oxford Fuchs, Christian: Soziale Selbstorganisationen im Informationsgesellschaftlichen Kapitalismus. 2001, Wien Florian, Michael/Hillebrandt, Frank (Hrsg.): Pierre Bourdieu: Neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft. 2006, Wiesbaden Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands: zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. 1996, Opladen Gensicke, Thomas/Picot, Sibylle/Geiss, Sabine: Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999-2004. 2006, Wiesbaden Hradil, Stefan: Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. 1987, Opladen Hradil, Stefan: Soziale Milieus und ihre empirische Untersuchung. In: Glatzer, Wolfgang (Hrsg.): Entwicklungstendenzen der Sozialstruktur. 1992, Frankfurt/Main, New York Herz, Thomas A.: Klassen, Schichten, Mobilität. 1983, Stuttgart Honneth, Axel: Die zerrissene Welt der symbolischen Formen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 36. 1984 Hörz, Herbert: Selbstorganisation sozialer Systeme: Ein Verhaltensmodell zum Freiheitsgewinn. Münster. In: Küppers, Bernd-Olaf (1986): Der Ursprung biologischer Information. Zur Naturphilosophie der Lebensentstehung. 1993, Münster Heim, Tino: Metamorphosen des Kapitals: kapitalistische Vergesellschaftung und Perspektiven einer kritischen Sozialwissenschaft nach Marx, Foucault und Bourdieu. 2013, Bielefeld Korsch, Karl: Karl Marx. 1967, Frankfurt/Main Kreckel, Reinhard: Geschlechtssensibilisierte Soziologie. Können askriptive Merkmale eine vernünftige Gesellschaftstheorie begründen? In: Zapf Wolfgang (Hrsg.): Die Modernisierung moderner Gesellschaften. 1991, Frankfurt/M. – New York. 57 Kreckel, Reinhard: Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit. 1992, Frankfurt/M. – New York. Kurz, R. (1997): Antiökonomie und Antipolitik. In: Krisis, Beiträge zur Kritik der Warengesellschaft 19. 1997, Bad Honnef: Horlemann. Internet: http://www.opentheory.org/keimformen/text.phtml. Luhmann, Niklas: Die soziologische Beobachtung des Rechts. 1986, Frankfurt am Main Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 1997, Frankfurt am Main Luhmann, Niklas: Zum Begriff der sozialen Klasse. In: Niklas Luhmann (Hrsg.): Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee. 1985, Opladen Marcuse, Herbert: Der eindimensionale Mensch: Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. 1976, Neuwied Marcuse, Herbert: Philosophie und kritische Theorie. In: Marcuse, Herbert (1965): Kultur und Gesellschaft I. 1937, Frankfurt/Main Müller, Hans-Peter: Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs über soziale Ungleichheit. 1992, Frankfurt/Main Marx, Karl: Loharbeit und Kapital. In: Marx/Engels Werke Bd. 6. Berlin, 1973 Marx, Karl (1859): Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort. In: Marx/Engels Werke Bd. 13. 1964, Berlin Marx, Karl/Engels, Friedrich (1848): Manifest der Kommunistischen Partei. In: Marx/Engels Werke Bd. 4. 1972, Berlin Marx, Karl (1857): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, in: Marx K., Engels F. (1983): Werke Band 42. 1983, Berlin Meretz, Stefan: LINUX&CO. Freie Software – Ideen für eine andere Gesellschaft. 2000, AG Spak Noll, H./ Habich, R. : Individuelle Wohlfahrt. Vertikale Ungleichheit oder horizontale Disparitäten? In: Berger/ Hradil (Hg.): Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, Soziale Welt. 1990, Göttingen Rudolph, Iris: Umbrüche und ein drittes Kind. 1998, Frankfurt/Main Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 1992, Frankfurt/Main, New York. Simmel, Georg: Philosophie des Geldes. 1977, Berlin Schwinn, Thomas: Soziale Ungleichheit. 2007, Bielefeld Schwan, Alexander: Theorie als Dienstmagd der Praxis: Systemwille und Parteilichkeit, von Marx zu Lenin. 1983, Seewald Vester, Michael: Klassengesellschaft ohne Klassen. In: Berger, A./ Vester, M. (Hrsg.): Alte Ungleichheiten/Neue Spaltungen. 1998, Wiesbaden Vester, Michael: Soziale Milieus in Ostdeutschland: gesellschaftliche Strukturen zwischen Zerfall und Neubildung. 1995, Köln 58 Wahl, Klaus: Die Modernisierungsfalle: Gesellschaft, Selbstbewusstsein und Gewalt. 1989, Frankfurt am Main Wahl, Klaus: Studien über Gewalt in Familien: gesellschaftliche Erfahrung, Selbstbewusstsein, Gewalttätigkeit. 1990, München Weber, Max: Gesammelte politische Schriften. 1988, Tübingen Zapf, Wolfgang: Individualisierung und Sicherheit: Untersuchungen Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland. 1987, München zur Internetquellen www.rote-ruhr-uni.com http://www.soziologie.uni-halle.de/emeriti/kreckel/docs/klassen-97.pdf www.bpb.de 59