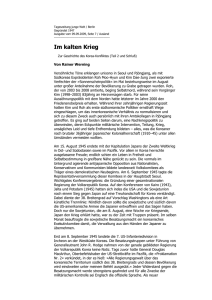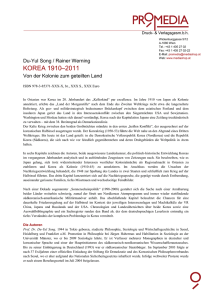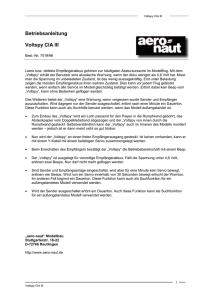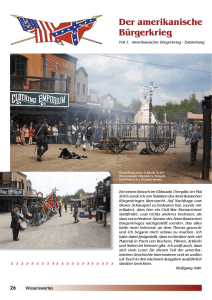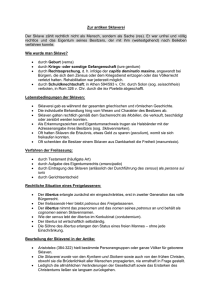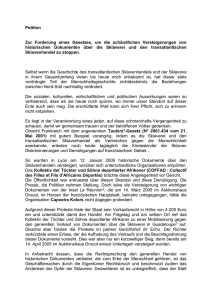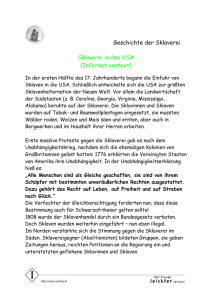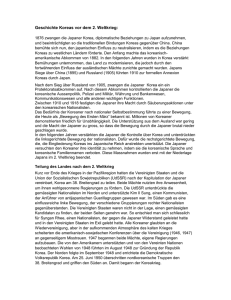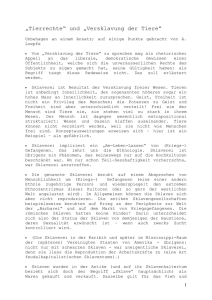News feb 2010 heise tp kor
Werbung
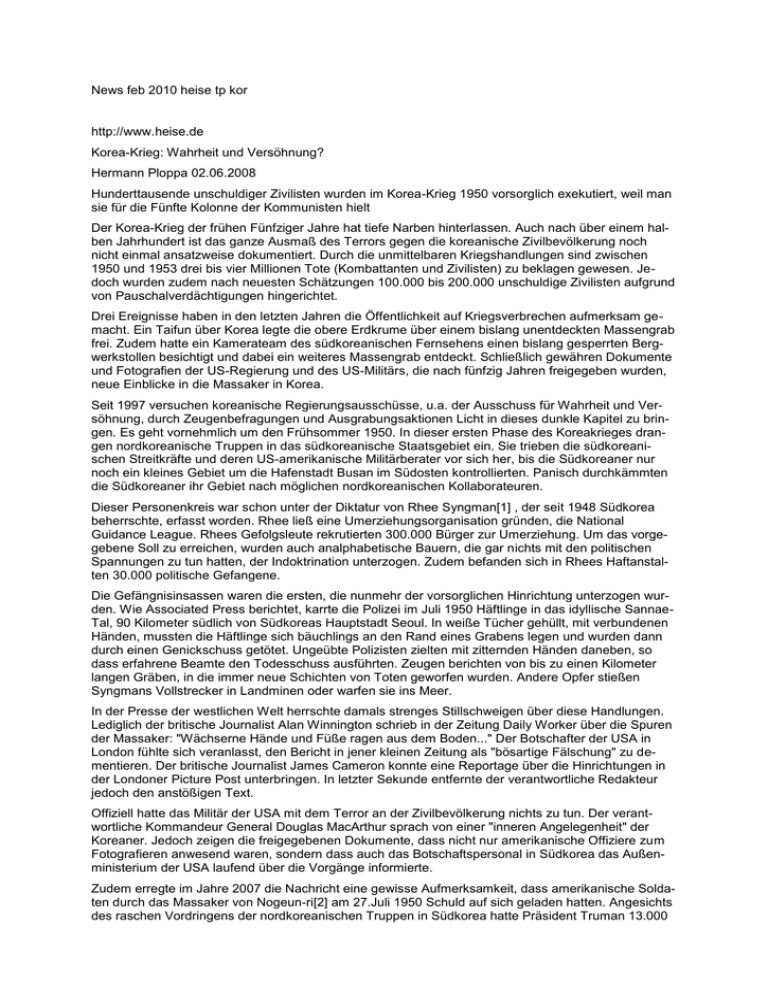
News feb 2010 heise tp kor http://www.heise.de Korea-Krieg: Wahrheit und Versöhnung? Hermann Ploppa 02.06.2008 Hunderttausende unschuldiger Zivilisten wurden im Korea-Krieg 1950 vorsorglich exekutiert, weil man sie für die Fünfte Kolonne der Kommunisten hielt Der Korea-Krieg der frühen Fünfziger Jahre hat tiefe Narben hinterlassen. Auch nach über einem halben Jahrhundert ist das ganze Ausmaß des Terrors gegen die koreanische Zivilbevölkerung noch nicht einmal ansatzweise dokumentiert. Durch die unmittelbaren Kriegshandlungen sind zwischen 1950 und 1953 drei bis vier Millionen Tote (Kombattanten und Zivilisten) zu beklagen gewesen. Jedoch wurden zudem nach neuesten Schätzungen 100.000 bis 200.000 unschuldige Zivilisten aufgrund von Pauschalverdächtigungen hingerichtet. Drei Ereignisse haben in den letzten Jahren die Öffentlichkeit auf Kriegsverbrechen aufmerksam gemacht. Ein Taifun über Korea legte die obere Erdkrume über einem bislang unentdeckten Massengrab frei. Zudem hatte ein Kamerateam des südkoreanischen Fernsehens einen bislang gesperrten Bergwerkstollen besichtigt und dabei ein weiteres Massengrab entdeckt. Schließlich gewähren Dokumente und Fotografien der US-Regierung und des US-Militärs, die nach fünfzig Jahren freigegeben wurden, neue Einblicke in die Massaker in Korea. Seit 1997 versuchen koreanische Regierungsausschüsse, u.a. der Ausschuss für Wahrheit und Versöhnung, durch Zeugenbefragungen und Ausgrabungsaktionen Licht in dieses dunkle Kapitel zu bringen. Es geht vornehmlich um den Frühsommer 1950. In dieser ersten Phase des Koreakrieges drangen nordkoreanische Truppen in das südkoreanische Staatsgebiet ein. Sie trieben die südkoreanischen Streitkräfte und deren US-amerikanische Militärberater vor sich her, bis die Südkoreaner nur noch ein kleines Gebiet um die Hafenstadt Busan im Südosten kontrollierten. Panisch durchkämmten die Südkoreaner ihr Gebiet nach möglichen nordkoreanischen Kollaborateuren. Dieser Personenkreis war schon unter der Diktatur von Rhee Syngman[1] , der seit 1948 Südkorea beherrschte, erfasst worden. Rhee ließ eine Umerziehungsorganisation gründen, die National Guidance League. Rhees Gefolgsleute rekrutierten 300.000 Bürger zur Umerziehung. Um das vorgegebene Soll zu erreichen, wurden auch analphabetische Bauern, die gar nichts mit den politischen Spannungen zu tun hatten, der Indoktrination unterzogen. Zudem befanden sich in Rhees Haftanstalten 30.000 politische Gefangene. Die Gefängnisinsassen waren die ersten, die nunmehr der vorsorglichen Hinrichtung unterzogen wurden. Wie Associated Press berichtet, karrte die Polizei im Juli 1950 Häftlinge in das idyllische SannaeTal, 90 Kilometer südlich von Südkoreas Hauptstadt Seoul. In weiße Tücher gehüllt, mit verbundenen Händen, mussten die Häftlinge sich bäuchlings an den Rand eines Grabens legen und wurden dann durch einen Genickschuss getötet. Ungeübte Polizisten zielten mit zitternden Händen daneben, so dass erfahrene Beamte den Todesschuss ausführten. Zeugen berichten von bis zu einen Kilometer langen Gräben, in die immer neue Schichten von Toten geworfen wurden. Andere Opfer stießen Syngmans Vollstrecker in Landminen oder warfen sie ins Meer. In der Presse der westlichen Welt herrschte damals strenges Stillschweigen über diese Handlungen. Lediglich der britische Journalist Alan Winnington schrieb in der Zeitung Daily Worker über die Spuren der Massaker: "Wächserne Hände und Füße ragen aus dem Boden..." Der Botschafter der USA in London fühlte sich veranlasst, den Bericht in jener kleinen Zeitung als "bösartige Fälschung" zu dementieren. Der britische Journalist James Cameron konnte eine Reportage über die Hinrichtungen in der Londoner Picture Post unterbringen. In letzter Sekunde entfernte der verantwortliche Redakteur jedoch den anstößigen Text. Offiziell hatte das Militär der USA mit dem Terror an der Zivilbevölkerung nichts zu tun. Der verantwortliche Kommandeur General Douglas MacArthur sprach von einer "inneren Angelegenheit" der Koreaner. Jedoch zeigen die freigegebenen Dokumente, dass nicht nur amerikanische Offiziere zum Fotografieren anwesend waren, sondern dass auch das Botschaftspersonal in Südkorea das Außenministerium der USA laufend über die Vorgänge informierte. Zudem erregte im Jahre 2007 die Nachricht eine gewisse Aufmerksamkeit, dass amerikanische Soldaten durch das Massaker von Nogeun-ri[2] am 27.Juli 1950 Schuld auf sich geladen hatten. Angesichts des raschen Vordringens der nordkoreanischen Truppen in Südkorea hatte Präsident Truman 13.000 Besatzungssoldaten aus Japan nach Korea bringen lassen. Diese GIs waren schlecht ausgerüstet und noch schlechter für ihre neue Aufgabe instruiert worden, so dass innerhalb kurzer Zeit auf amerikanischer Seite 3.000 Soldaten fielen oder verwundet wurden. Die Nerven lagen entsprechend blank, als den US-Soldaten einige Hundert koreanische Zivilisten begegneten, die vor den Kriegshandlungen flüchteten. Die GIs pferchten die Flüchtlinge in einen Tunnel, nachdem zuvor bereits US-Flugzeuge aus der Luft auf die Zivilisten geschossen hatten. Die GIs richteten grelle Scheinwerfer auf die Koreaner. Schließlich töteten sie die Eingeschlossenen. Über den Terror an der Zivilbevölkerung herrschte bis vor Kurzem strengstes Stillschweigen. Im Freund-Feind-Denken des Kalten Krieges war es ein Leichtes, die Angehörigen der Opfer zum Schweigen zu bringen. Associated Press zitiert die Zeugenaussage der Tochter eines Opfers, Frau Koh Chung-ryol, vor dem Ausschuss: "Meine Mutter vernichtete alle Fotos von meinem Vater, aus Angst, die Familie könnte in der Öffentlichkeit als links dastehen. Meine Mutter gab sich alle Mühe, alles, was von ihrem Ehemann stammte, loszuwerden. Sie litt unsägliche Qualen." Es gab 1960 eine kurze Tauwetterperiode in Südkorea. In dem Zeitraum zwischen den demokratischen Wahlen vom 29. Juli 1960 bis zum Militärputsch vom 16. Mai 1961 untersuchten Parlamentsabgeordnete die Massaker. Als jedoch der neue Militärmachthaber Park Chung-hee fest im Sattel saß, verschwanden diese Abgeordneten selber in den Gefängnissen. Erst Ende der Achtziger Jahre schlugen sich Demokratisierungstendenzen in der südkoreanischen Politik nieder. In den Neunziger Jahren wurden einige prominente Stützen des alten Regimes vor Gericht gebracht und auch tatsächlich verurteilt. Der Mittelbau und die unteren Segmente des alten Terrorsystems blieben vollkommen unbehelligt. So verharrte die Aufarbeitung der schaurigen Vergangenheit in Südkorea, ganz genau wie in den ebenfalls demokratischen Transitionsprozessen unterzogenen Ländern Südamerikas oder auch in Südafrika, an der Oberfläche des Terrors. Der vorsichtigen Aufarbeitung der Massaker könnte bald wieder ein Ende gesetzt werden Allerdings setzten der damalige Präsident Kim Young-sam und seine Amtsnachfolger Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun seit 1997 verschiedene Untersuchungskommissionen ein. Die Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths soll ungeklärte Todesfälle untersuchen. Die Truth and Reconciliation Commission soll Angehörige der Opfer sowie die noch lebenden Täter befragen. Beide Ausschüsse verfügen indes über wenige Befugnisse. Weder können sie, wie US-Ausschüsse, Zeugen zum Erscheinen zwingen, noch können sie Strafverfolgungsmaßnahmen veranlassen. So hat der Wahrheitsausschuss bislang vier von insgesamt 150 Massengräbern dokumentiert und zwei Massenhinrichtungen in Lagerhäusern rekonstruiert. Zentrale Persönlichkeit in beiden Ausschüssen ist der Historiker Ahn Byong-ook, der an der Katholischen Universität Korea lehrt und im Korea Progressive Academic Council für Frieden und internationale Verständigung wirbt. Er hat das moderate Konzept des "settle the past" entwickelt, also etwa: Beilegung der Spannungen, die aus den Schrecken der Vergangenheit erwachsen sind. Ahn geht es in erster Linie darum, die Würde und Ehre der Opfer und ihrer Angehörigen wiederherzustellen. Zwischen Tätern und den Angehörigen der Opfer sei ein Versöhnungsprozess unerlässlich. Korea habe innerhalb von hundert Jahren einen schockartigen Verwestlichungsschub durchlaufen; die japanische Kolonisierung Koreas zwischen 1910 und 1945 habe schwere Narben hinterlassen. Der grausame Korea-Krieg sei ein unverarbeitetes Trauma. Modernisierung und Umwandlung der autoritären Strukturen in echte Demokratie erfordere eine Milderung der kollektiven Stressphänomene: "Deswegen ist das letztendliche Ziel der Aktivitäten der Untersuchungsausschüsse, die koreanische Gesellschaft von Konflikt und Spaltung zu Versöhnung und Frieden zu führen." Die gemäßigten Ideen des Professor Ahn sind allerdings dem seit Jahresanfang regierenden neuen Präsidenten Lee Myung Bak bereits zu viel. Lee steht an der Spitze der rechten Grand National Party. Es handelt sich um einen Zusammenschluss jener Blockparteien, die unter den Diktatoren Rhee und Park die pseudodemokratische Fassade abgegeben hatten. Präsident Lee möchte folglich die Ausschüsse lieber heute als morgen auflösen. Jedoch ein Gesetz aus der Zeit seines liberalen Amtsvorgängers garantiert den Bestand der Ausschüsse bis zum Jahre 2010. Bak hat bereits angedeutet, dass er die Finanzmittel des Ausschusses zusammenstreichen möchte. Die Zeit drängt also für Ahn und seine Mitstreiter. Denn es ist ausgeschlossen, dass unter den jetzt herrschenden Machtverhältnissen in Regierung und Parlament der Ausschuss nach 2010 weiter bestehen wird. Dann müssen die Ausschüsse ihre notwendigerweise unvollständigen Befunde zu einem Abschlussbericht zusammengeflickt haben. http://www.heise.de In Sex oder Gewalt liegt manchmal eine Art Erlösung Rüdiger Suchsland 09.12.2004 Hart und glasklar: "Samaria", Kim Ki-Duks Schulmädchenreport der anderen Art Vieles in Korea scheint sich von unseren Verhältnissen zu unterscheiden: Es gibt ein anderes Wetter, anderes Licht, das Leben der Landbevölkerung prägt den Alltag, wie die buddhistische Religion; man isst viel Fisch, und die Behausungen vieler Menschen sehen im Vergleich zur unserigen glänzend lackierten Industriemoderne seltsam heruntergekommen aus, ein bisschen altmodisch, aber auch manchmal dreckig und verwahrlost. Und dann sind da noch die Amerikaner. Man vergisst leicht, wie stark die US-Militärpräsenz dort seit dem Koreakrieg der 50er Jahre doch noch ist, auch abseits vom 38. Breitengrad, der das Land seit damals in zwei ungleiche Hälften teilt. Kalter Krieg, geteilte Familien, und im Gefolge spürbare Identitätskrisen – es gibt mehr Verwandtschaften zwischen Deutschen und Koreanern, als es auf den ersten Blick scheint. In den Filmen von Kim Ki-duk ist all dies präsent. Ferne und Nähe der Erfahrungen verbinden sich zu einer seltsamen Gefühlsmischung, die den jungen Regisseur für die Filmszene der Gegenwart besonders attraktiv macht. Jetzt kommt sein neuester Film, "Samaria" ins Kino – eine Passionsgeschichte, mit der Kim bei den Berliner Filmfestspielen den Silbernen Bären gewann. -------------------------------------------------------------------------------"Samaria" ist kein moralischer Film. Aber er setzt die Massstäbe für die Moral neu. Er hinterfragt: was ist überhaupt Moral? Moral ist ja ein Massstab der Gesellschaft. aber niemand kann allen Forderungen der Gesellschaft gerecht werden. Deshalb geschehen viele Dinge, die keineswegs moralisch sind. Kim Ki-duk Unschuld im Ausdruck, Schuld im Tun – verträumt gehen zwei junge Schulmädchen in einem Park spazieren. Verspielt und verführerisch wirkt die eine, scheu und spröde ihre Freundin. Schnell verstehen wir und wundern uns doch nur noch mehr. Denn beide haben ein weiteres, geheimes Leben, von dem nur sie etwas wissen dürfen: Jae-young arbeitet neben der Schule als Prostituierte. Sie scheint daran sogar gewissen Spaß zu haben, bleibt rein und irgendwie unberührt. Ganz anders geht es YeoJin, über die wir mehr erfahren. Sie verachtet die Freier und ist, wenn man so will, die Zuhälterin ihrer besten Freundin, der sie in einer merkwürdigen, unausgesprochenen Liebe verbunden ist. Gemeinsam träumen sie beide von einer Reise nach Paris, vom Weggehen, vom Glück der Freiheit. Jaeyoung ist alles, was für Yeo-Jin zählt. Ihre Mutter ist lange tot, sie lebt allein mit ihrem liebevollen Vater. Als ihre Freundin stirbt, bricht für Yeo-Jin eine Welt zusammen. Trost findet sie nur auf eine Weise, die ihr Vater nicht verstehen kann... Früher hat er lebende Frösche zerteilt, Hunde verprügelt, seine Figuren Angelhaken erst essen, dann sich selbst wieder herausziehen lassen, Blut, Sperma und Urin in größeren Massen vergossen, und mit alldem die Besucher internationaler Festivals gehörig schockiert – ungesehene, einfallsreiche, an Höhepunkte der europäischen Avantgarde anknüpfende Bilder. Seit kurzem nun dreht der koreanische Autorenfilmer Kim Ki-Duk etwas andere Werke: zärtlich-poetische Etüden, ebenso buddhistisch wie französisch angehaucht, mit zarten Satie-Klängen im Hintergrund, aber immer noch wunderschön, voller visueller und erzählerischer Originalität und eigentümlich verstörender Kraft. Kim zeigt eine Welt, die eine Hölle ist, in der es von Anfang an keinen Ausweg gibt, nur Sehnsucht. Und nur in Sex oder Gewalt liegt manchmal eine Art Erlösung, zumindest für Augenblicke. Guerilla-Style und neue Welle in Korea Er ist der dem westlichen Publikum bekannteste Repräsentant des "Korean New Wave", des Aufbruchs, den das südkoreanische Kino im letzten Jahrzehnt erlebt. Seitdem Park Chan-wook nach anderen aufsehenerregenden Filmen ("JSA", "Sympathy for Mr. Vengeance") mit der furiosen Rachestory "Old Boy", einer Art "Kill Bill" auf koreanisch, aber voller sozialer Bezüge, in Cannes den zweitwichtigsten Preis gewann, weiß es jeder: Korea ist das zu Zeit vielleicht interessanteste Filmland, das noch im allgemeinen Aufbruch des asiatischen Kinos hervorsticht. Neben Kim und Park gibt es noch eine Handvoll weiterer hochinteressanter Regisseure, die alle zwischen 30 und 45 Jahre alt sind, und das Kino ihrer Heimat in den nächsten zwei Jahrzehnten prägen werden: Ob Bong Joon-ho, der mit "Memoires of Murder", einer wunderschönen Mischung aus politischer Parabel und Burleske, alle Stereotypen des Serienkillergenres ad absurdum führt, Kang Lone mit seinem Debüt "Looking for Bruce Lee!", einem Mord-Thriller, bei dem die erfolgreiche Überführung des Täters die Kenntnis der Filme der Hongkonger-Kung-Fu-Legende voraussetzt, oder Hung San-soo mit seinen ans französische Autorenkino erinnernden ruhigen Liebesgrotesken "Turning Gate" und "Woman is the Future of Man", oder alle anderen koreanischen Filmemacher, die einem auf den europäischen Festivals der letzten Jahre und manchmal auch im normalen Kinoverleih begegnen und die man hier noch nennen müsste – es sind vor allem visuell bezaubernde Werke, die zugleich in hochintelligenter Weise Geschichte und Gegenwart ihrer Heimat reflektieren. Bei allem in Europa immer noch wirksamen Fremdheitseffekt findet diese neue Generation auch im Westen ein aufgeschlossenes Publikum, das sich von ihren Filmen ganz unmittelbar ansprechen lässt. Oft sind es ganz atemberaubende, virtuose Bilder, mit denen hier Emotionen sichtbar gemacht werden – hochkompliziert und doch von unmittelbarer poetischer Kraft. Auch dieser Boom ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat ökonomische Voraussetzungen: Im wirtschaftlich boomenden Südkorea werden Filmproduktionen durch Kredite zu Sonderkonditionen und Steuererleichterungen begünstigt. Die früher massive Zensur ist eng begrenzt. Viele Filmemacher haben einen Auslandsaufenthalt in Europa hinter sich: Park Chan-wook studierte deutsche Philosophie und nennt – man sieht das seinem Werk an – Nietzsche als Lieblingsphilosophen. Kang Lone studierte in Paris und Kim Ki-duk schlug sich drei Jahre in Montpellier als Touristenmaler durch. -------------------------------------------------------------------------------Ich habe von 1990 bis 1993 in Frankreich und Westeuropa ungefähr zwei Jahre lang wie ein Vagabund gelebt. Das hat mich von vielen Gewohnheiten Koreas befreit. Diese Zeit hat mir die Kraft gegeben, viele Beschränkungen Koreas zu überwinden. Vieles in Korea ist an Macht, Geld, Materialismus gekoppelt. In Europa wurde mir klar, dass der eigene Wille mehr zählt. Erst das hat mir geholfen, zu einem Regisseur zu werden. Ich habe Bilder gemalt, und diese Bilder, die vieles meiner inneren Welt ausdrücken, sind immer noch ein Material für meine Filme. – Kim Ki-duk Kim bleibt in alldem zugleich ein Sonderfall, eine klare Ausnahme. Ein Singulär. Abseits der Filmindustrie, abseits aller Moden und über lange Zeit weit entfernt von den Erwartungshaltungen, die hierzulande gegenüber anspruchsvolleren asiatischen Filmen bestehen, geht der 1960 geborene Regisseur seinen merkwürdigen, sehr persönlichen, künstlerisch beispiellosen Weg. Scheinbar ganz konsequent, unbeirrt und unbeeinflusst, dreht er zur Zeit pro Jahr mehr als einen Spielfilm, unter auch für Korea ungewöhnlichen Bedingungen – kleines Budget, kleines Team, sehr wenig Drehtage – unter denen hierzulande kaum ein Filmhochschüler bereit wäre, seinen Abschlußfilm zu realisieren. Während das durchschnittliche Budget eine koreanischen Films bei zwei bis drei Milllionen US-Dollar liegt, und die Produktionszeit bei drei bis sechs Monaten, benötigte Kim für seinen vorletzten Film "Samaria" nur 400.000 US-Dollar, und 13 Drehtage – von "Guerilla-Style-Filmmaking" spricht sein Produzent. Trotzdem gelingen ihm seltsam verstörende, gerade darin aber auch wieder sehr wahrhaftige, filmisch bestechende Kinowerke. Alpträume aus Gewalt und Sexualität Mitte der 90er Jahre begann er. "Birdcage Inn" war 1998 bei der Berlinale sein erster internationaler Auftritt. Davor waren zwei Filme – "Crocodile" (1996), "Wild Animals" (1997) – entstanden, die nur auf Spezialfestivals einem westlichen Publikum zugänglich waren. Die Verquickung von Sexualität und Gewalt, beide in direkter, mitunter roher Weise auf die Leinwand geworfen, und das existentielle Panorama eines menschlichen Lebens, das unvermeidlich zwischen persönlicher Passionen und unvermeidlicher Korruption hin und her gerissen ist, steht schon hier im Zentrum. Am zwingendsten zeigte das vielleicht "The Isle", der 2000 in Venedig im Wettbewerb lief und zwar keinen Preis gewann, aber zum Skandalerfolg des Festivals wurde und Kim Ki-Duk international zum Durchbruch verhalf. Die Geschichte spielt ausschließlich an einem ruhigen See, rund um ein paar Hausboote. Urlauber kommen zum Angeln und Entspannen her, doch die Herrscherin ist Hee-Jin, eine junge Frau, die nur redet, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Sie lebt ein Doppelleben, einerseits ist sie den Gästen gegen Bares bei den Sorgen des Alltags gefällig, zu denen am Abend auch sexuelle Dienstleistungen gehören, die sie mit der gleichen Sachlichkeit erledigt, mit der sie Stunden zuvor eine warme Suppe brachte. Zugleich taucht sie durch den See und – einer bösen Nixe gleich – unverhofft unter ihren Gästen auf, um sie klammheimlich zu verwunden und unerkannt wieder zu verschwinden. Am Ufer hat diese heimliche Herrin des Sees einen Vogel gefangen, den sie liebevoll füttert; sonst beobachtet sie und schweigt. Eines Tages zieht ein junger Mann in eines der Häuser ein, der von heftigen und gewaltsamen Alpträumen gequält wird. Bald nähern sie sich an, und irgendwann, als es gerade heftig regnet, kommt sie und bleibt. Sie bleibt auch, als er sich sträubt, auch noch, als er – um sie fortzuweisen – Besuch von einer Hure erhält, und selbst dann, nein: erst recht, als er sich durch das Verschlucken von Angelhaken grausam selbst verstümmelt. Sie rettet ihn, operiert ihn ohne Narkose, holt die Haken aus seinem Rachen, füttert ihn. Das alles musste gezeigt werden, weil diese Geschichte einer Amour Fou mit sadomasochistischen Zügen, erst dadurch wirklich wieder zu dem wird, was einmal "fou" hieß: Unbegreiflich, wild, schockierend, abstoßend, und gerade in all dem auch faszinierend – weil man eine Wahrhaftigkeit spürt, begreift, dass es hier nicht darum geht, durch oberflächliche Pro- vokationen von sich reden zu machen, sondern darum, innere Wahrheiten zu zeigen, und Bilder für eine märchenhafte Liebe zu finden, die weder traditioneller Moral, noch den Geboten der Rationalität folgt. Und genau dies – durch zwingende, faszinierende, unvergessliche Bilder und neue Erfahrungen zu bieten, ist es, was man von guter Kunst zuallererst erwarten muss. Und gerade von "den Angelhaken" in "The Isle" reden manche noch nach Jahren. Oder von den Hunden. In "Adress Unknown", der ein Jahr später gleichfalls im Wettbewerb von Venedig lief, werden sie gequält, geschlagen, bei lebendigem Leib geschlachtet. Der Film spielt im Korea der späten 70er und 80er Jahre, erzählt vom brutalen Alltag eines Hundesmetzgers und einer Gruppe von Menschen, die alle irgendwie mit einer Militärkaserne der amerikanischen Besatzungsmacht zu tun haben. An dieser grotesken Parabel auf die desillusionierte südkoreanische Gesellschaft und ihr prekäres Verhältnis zu den USA zeigt sich, dass die existentielle Diagnose bei Kim Ki-Duk immer auch Zustandsbeschreibung einer Gesellschaft ist. Man wird diesem Regisseur, wie auch den meisten anderen Repräsentanten der "Korean New Wave" – etwa "Old Boy"-Regisseur Park Chan-wook – nur gerecht, wenn man die dichte Verflechtung von individueller Vergangenheit und der politischen wie kulturellen Geschichte Koreas berücksichtigt, insbesondere die Nachwirkung der japanischen Besatzung und die Folgen des Koreakriegs, der Teilung des Landes und der nicht immer nur schützende und segensreiche Einfluß der USA. Die Bezüge darauf sind in fast allen Filme Kims direkt, wenn auch unaufdringlich präsent, sie sind für das Verständnis seines Werks wichtiger, als dies vergleichsweise für das Verständnis der Filme der meisten europäischen Filmemacher. Kim zeigt das Korea von heute. Viel Landwirtschaft, die allerdings zusehends von Industrialisierung und Moderne in Mitleidenschaft gezogen wird. Vor allem zeigt er soziale Realität: Die Brutalität auf dem Land. Frauen, die sich prostituieren. Hundemetzger bei der Arbeit. Amerikanische Besatzer, die die koreanische Bevölkerung verachten und ausnutzen. Realismus und Klischee, Geschichte und Mythos Wie in keinem zweiten Film reflektiert der Regisseur in "Adress Unknown", dem einzigen seiner Filme, die in einer klar definierten Vergangenheit spielen, auch Erfahrungen seiner eigenen Kindheit: Als Sohn eines Soldaten und Veteranen des Koreakriegs bezeichnet Kim seine Erziehung als "streng militärisch": Schläge gehörten zur Tagesordnung. Später dann, als er fünf Jahre lang in einer Eliteeinheit der Armee diente, erlebte er Ähnliches. Was die Darstellung von Gewalt in allen Filmen Kim KiDuks so wirkungsvoll und einmalig macht, ist ihre Authentizität. Gewalt bei Kim ist roh, direkt und unverstellt. Sie wird deutlich gezeigt, aber nie genossen. Sie ist ein körperlicher Ausdruck von Erfahrungen der Figuren eine Form von Offenheit und dabei zugleich eine weise des Umgangs mit traumatischen Erlebnissen. "Bad Guy" Dann kam "Bad Guy". Bei der Berlinale fiel der Film durch, in Süd-Korea wurde er 2002 einer der erfolgreichsten des Jahres. Erzählt wird einmal mehr von einer amour fou, der gewaltgeprägten, aber ganz unschuldig-unmittelbaren Liebe eines Zuhälters zu einer Schülerin aus bürgerlichen Verhältnissen, die er zur Prostituierten macht. Auch hier schönt Kim keine einzige der vielen Wunden der zeitgenössischen koreanischen Gesellschaft. Wenn es wieder einmal um Prostitution geht, so ist an Kims Aussage zu erinnern, dass seiner Ansicht nach nahezu alle Beziehungen zwischen Männern und Frauen eine Form der Prostitution darstellen. Auf diese Themen – amour fou, Prostitution, die Frage nach den Maßstäben für Moral, dem Widerspruch zwischen gesellschaftlichen Forderungen und individuellem Bedürfnis und dem, was in einer konkreten Situation Moral heißt – kommt Kim auch in seinen letzten beiden Filmen "Samaria" und "Binjip" zurück. Wir machen unausweichlich viele Fehler. Kim Ki-duk "Samaria", mit dem Kim in Berlin gewann, liegt noch am nächsten dran an Filmen wie "The Isle" oder dem unterschätzten "Adress Unknown". Hart und glasklar erzählt er seine Passionsgeschichte: Ein Tryptichon. Der erste Teil, "Vasumitra", benannt nach einer legendären indischen Prostituierten, die ihre Freier durch die Kraft des Sex in Gläubige verwandelt haben soll, erzählt die Freundschaft der Mädchen Jae-young und Yeo-Jin. Im zweiten Teil, der Samaritergeschichte "Samaria" sucht Yeo-Jin Erlösung, indem sie die – vermeintlichen – Leiden ihrer Freundin auf sich nimmt, und dadurch Wiedergutmachung der Sünde sucht. Sie bedient die alten Freier, doch zahlt sie ihnen ihr Geld zurück. Eines Tages entdeckt sie ihr liebevoller Vater, der von all der Vorgeschichte nichts weiß. Verzweifelt verfolgt er sie und bedrängt die Freier der Tochter. Einen der Ex-Freier treibt der Vater in den Selbstmord, einen anderen bringt er um. Nur eine Variante des Erlösungsmotivs. Ein Eindringling in die Ver- hältnisse bürgerlicher Sicherheit, zu der die Verlogenheit heimlicher Puffbesuche ebenso gehört wie die trügerische Hoffnung auf moralische Reinheit, die Vater und Tochter gemeinsam haben. Der "Intruder" ist eigentlich ein altes Thema des US-Kinos, doch Hollywood steht immer ganz auf Seiten der bedrohten Familien. Kim Ki-Duk hat mehr Verständnis für die andere Seite, macht zugleich deutlich, dass hier in der Gewalt viel Zärtlichkeit liegt, dass einer das zerstört, nach dem er sich heimlich sehnt. Zugleich wird auch unübersehbar, dass die verschiedenen Erwartungen, die Menschen aneinander stellen, immer fehlgehen, immer unangemessen sind, weil sie eigentlich nie den anderen, sondern immer nur einen selber meinen. Das galt schon für Yeo-Jins Verhältnis zu Jae-young. Dieser dritte Teil, der in eine hochemotionale Vater-Tochter-Fahrt aus der Stadt heraus in eine unberührte Berglandschaft mündet, heißt "Sonata", tatsächlich nach dem Autotyp, der hier benutzt wird. Und nun wird die archetypische kraftvolle Tragödie über moralische Missverständnisse, die immer von einer latenten Bedrohung geprägt ist, zum Film über den Wert des Verzeihens. Zutiefst humanes Kino als moralische Anstalt, aber ohne moralischen Zeigefinger, stilistisch elegant, und ganz visuell, mit vielen Anklängen ans französische Kino, und unaufdringlichen Verweisen an die Songs von Serge Gainsbourgh und die Romane Boris Vians, ist diese wahnsinnige Liebesgeschichte ein neuer Ausdruck für die Stärke des koreanischen Kinos. Hier kommt es auf jede Nuance an, werden Zumutung und Tabubruch zur künstlerischen Tugend. Eine Ausnahme bildet auch "Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring" nicht wirklich. Die Geschichte kreist um einen jungen und einen alten Mönch in einem kleinen buddhistischen Kloster inmitten eines waldumsäumten Bergsees. Dasein als ruhiger Kreislauf der Selbstvervollkommnung, ein Lernprozeß der Gelassenheit – doch eine Idylle ist alles nur auf den ersten Blick. Auch hier gibt es kein Leben ohne Schuld und Sühne. Doch indem die Form und die Oberfläche der Bilder weitgehend harmonisch bleiben, bedient Kim zumindest hier ein wenig zu deutlich auch jenes stilisierte Bild, das der Westen von Asien noch immer hat: eine Ästhetik vollendeter Symmetrie, Reduktion des Lebens auf Archetypen, Zusammenfallen der Ordnung der Natur mit der des menschlichen Lebens, Lehrer-SchülerVerhältnisse, die Macht der Emotionen und ihr Scheitern an der vernünftigen Gelassenheit, die Religion und Philosophie favorisieren. In der Verklärung solcher Tugenden, im Vorrang asketischer Reinheit und Ordnung liegt auch eine zweifelhafte Sehnsucht danach, vor dem vermeintlichen Chaos der Moderne in die scheinbare Idylle zu entfliehen, die ihren Oberflächencharme bei aller Brechung hier nie verliert. Eine Sehnsucht, die Geschichte zu verlassen und wieder in Natur und Mythos einzutauchen. Katholische Passionsspiele und Crossover Was Kims Werk eint, ist, dass es sich bei seinen Filmen durchweg um Passionsspiele handelt. Wichtig hierfür ist zweifellos die Tatsache, dass Kim im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute kein Buddhist, sondern katholisch ist. Die Bedeutung der Religion betont er selbst immer wieder in seinem Werk. Im Interview nannte er das "Verzeihen" die Zentralidee seines Kinos: "Das ganze Leben soll ein Verzeihen sein." Viele seiner Figuren sind Geächtete: Zuhälter, Huren, Hundefänger, Behinderte, Verbrecher. "Manche meiner Charaktere sind mir keineswegs sympathisch." Filmästhetisch mündet das in eine Bildsprache, die zunächst sehr still und poetisch wirkt. Kims Kino ist ein Kino der Ruhe. Sparsam ist die Musik, langsam wird geschnitten, langsam bewegt sich, wenn überhaupt die Kamera, oft ruht sie stattdessen auf ihren Gegenständen, die in blassen Farben an alte Fotografien erinnern. Die Bildausschnitte sind dabei so sorgsam gewählt, dass es nie gezwungen wirkt; viel mehr legt sich der Eindruck von Konzentration und Anspannung in den Saal, einer Anspannung die sich entladen muss. Aber nichts ist einfach. Kühl und zurückgenommen sind die Bilder, reduziert die Kameraarbeit. So entsteht eine meditative Ruhe. Manches in diesen Filmen wird Europäern wie ein wildes, maßlos übertriebenes Symbolbild erscheinen – zum Beispiel der Fisch in "The Isle", dem die Filetstücke vom lebendigen Leib geschnitten werden, und der dann zappelnd in den See zurückgeworfen wird. Auch nach Tagen lebt er noch. Dies sei, kann man hören, in Korea gängige Praxis. Immer wieder wird die Ruhe durch Chocs gestört. Kims Filme sind hart. Sie verbergen nichts, zeigen alles. Ungeschönt. Brutal, zugleich auf einer symbolischen Ebene Traktate über Sehen und Blindheit. Immer wieder kommt es zum Crossover mit anderen kulturellen Einflüssen, etwa der indischen in "Samaria". Noch wichtiger ist aber die Bedeutung der französischen Einflüsse für Kims Werk. Es geht die Legende, dass Kim bei seinem längeren Aufenthalt in Frankreich Anfang der 90er Jahre nur dreimal ins Kino ging. Dort habe er "Der Liebhaber", "Die Liebenden von Pont Neuf" und "Das Schweigen der Lämmer" gesehen. Si non e vero... Mancher hat sich hier an Sci-Fi-Romane erinnert gefühlt, in denen aus Partikeln einer alten Kultur eine neue entsteht, "die womöglich alles falsch verstanden hat, aber das ist egal." Man sollte solchen Aussagen aber unbedingt mißtrauen, schon dass es ausgerechnet drei Filme sein sollen, verweist die Anekdote in die Nähe mittelalterlicher Heiligenlegenden. Vielleicht trifft die Beobachtung trotzdem einen Punkt: Denn mit seinen universalen Tragödien, die manche als sadistische Machwerke kritisierten, andere als authentischen Ausdruck einer sozialen Krise ernst nahmen, erweist sich Kim jedenfalls als mitunter überraschend direkter, ja naiver Künstler – allerdings im komplizierteren Sinn des Wortes -, der weder zu typisch westlichen Skrupeln noch zu übertriebender Reflexion neigt. Sein Kino ist romantisch, surrealistisch und erschütternd, dabei rätselhaft in jeder Hinsicht geprägt von einer anderen Einstellung, und genau darum herausfordernd; allemal ist es interessanter als vieles, und möglicherweise auf dem Weg zu wahrer Größe. Man wünscht diesem Regisseur, der in diesem Jahr mit vergleichsweise angepassten, freundlichen Filmen prompt zwei wichtige Preise gewann, dass er sich nicht verbiegen lässt, wieder ganz der berückenden Konsequenz von "The Isle", "Adress Unknown" und "Bad Guy" vertraut, seine besten, weil im letzten Grund überhaupt nicht begreiflichen Werken, vertraut. http://www.heise.de Friedensnobelpreis 2000 Michaela Simon 13.10.2000 Auszeichnung für den Präsidenten Südkoreas Gunnar Berge, Vorsitzender des fünfköpfigen Norwegischen Nobel Komitees, gab heute Mittag bekannt, dass Kim Dae-jung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Kim Der 74jährige ehemalige Dissident wird für seine "sunshine policy" ausgezeichnet, die eine Aussöhnung mit dem befeindeten Bruder Nordkorea sucht. Das diesjährige Spitzentreffen zwischen Südkoreas Präsident Kim Dae Jung und dem nordkoreanischen stalinistischen Machthaber Kim Jong Il gilt als bisher wichtigster Durchbruch in den Anstrengungen um Versöhnung zwischen beiden Koreas. Die Staatschefs unterschrieben ein Abkommen über Schritte zur Wiedervereinigung der etwa 70 Millionen Menschen in Nord-und Südkorea. Nach vier Jahren haben Nord- und Südkorea im August dann tatsächlich das Verbindungsbüro an ihrer gemeinsamen Grenze wieder eröffnet. Ein Zeichen des guten Willens, die Vereinbarungen des Gipfeltreffens umzusetzen. Am Jahrestag der Befreiung Koreas vom japanischen Kolonialismus 1945, durften je 100 Menschen aus Nord- und Südkorea im Rahmen einer Familienzusammenführung in das andere Land reisen, seit 1985 die ersten legalen Grenzgänger. Formal befinden sich Nord und Süd immer noch im Kriegszustand, da nach dem Ende des KoreaKrieges (1950-53) kein Friedensschluss zu Stande kam. Die scharf bewachte Grenze gilt als eine der letzten Fronten des Kalten Krieges. In der Begründung des Komitees heißt es: With great moral strength, Kim Dae Jung has stood out in East Asia as a leading defender of universal human rights against attempts to limit the relevance of those rights in Asia. His commitment in favour of democracy in Burma and against repression in East Timor has been considerable. Through his "sunshine policy", Kim Dae Jung has attempted to overcome more than fifty years of war and hostility between North and South Korea. His visit to North Korea gave impetus to a process which has reduced tension between the two countries. There may now be hope that the cold war will also come to an end in Korea. Kim Dae Jung has worked for South Korea's reconciliation with other neighbouring countries, especially Japan. Kim verbrachte, bevor er Präsident wurde, unter der südkoreanischen Militärdiktatur sechzehn Jahre in Haft, Hausarrest oder Exil. 1973 ließ ihn Militärdiktator Park Chung Hee in Tokio kidnappen, 1980 verurteilte ihn Parks Nachfolger Chun Doo Hwan wegen Umsturzversuchs zum Tode. Der Los Angeles Times gegenüber sagte er im Juni anlässlich des geglückten Nord-Süd KoreaGipfels: When I first explained my sunshine policy, nobody believed that this would in a matter of couple years of time lead to a South-North summit, but it did. And in the procession, not for a single moment had I given up my vision for the future and in that vision, I was confident that North Korea in the end had to come out and join us at the dialogue table. And I pursued this sunshine policy with consistency and against many difficult odds, including the submarine infiltration from the North and even in the exchange of fire in the Western Sea last year. Während sich der Süden der geteilten Halbinsel schon über die Kosten einer möglichen Wiedervereinigung mit dem Norden sorgt (sowohl der Staat als auch große Mischkonzerne wie Hyundai haben die Asienkrise noch nicht bewältigt) stellt sich auch die Frage, ob die Verleihung des Friedensnobelpreises für die Aussöhnung von kapitalistischem Süden und kommunistischem Norden nicht ein wenig voreilig ist. Zur Vergegenwärtigung: 1994 teilten sich der palästinensische Präsident Yasser Arafat und der israelische Premierminister Yitzhak Rabin sowie Außenminister Shimon Peres aus Israel den Preis für Frieden im Mittleren Osten. Karikatur aus "avatar" Aus Korea selbst gab es zur Nominierung Kims auch kritische Stimmen: Posted by Steve kim on August 16, 2000 at 10:26:44: Hi everyone in the world? I am a doctor from Seoul korea, a third year resident in physical medicine and rehabilitation medicine. I am not too sure if there's been any news about demonstration of Korean doctors against goverment who let pharmacist do diagnosis and give out prescription which supposed to be a doctors job. Kim's goverment was very fearful in a way that they kick and swang a 1.5 meter stick at doctors in korea. Nowadays, their act on civilian have become very violent and always ends with blood on the street. i dont' think he deserve to receive a nobel peace prize as long as he let people shed blood on the street. http://www.heise.de What will be the Role Played by Ban Ki-moon? Ronda Hauben 14.02.2007 The Struggle Over Reform at the UN As soon as Ban Ki-moon took office as the 8th Secretary General at the United Nations, his comments sparked a controversy (Symbolpolitik mit der Todesstrafe). His statement about Saddam Hussein's execution that capital punishment was a decision to be made by each nation drew condemnation from those who compared it with previous U.N. statements, while it was supported by John Bolton, the former U.S. Ambassador to the U.N., who praised Ban's statement about capital punishment as the "right instinct." Kofi Annan, Ban's predecessor, had been willing at times to condemn what he deemed violations of the U.N. charter. For example, before the U.S. invasion of Iraq, Annan warned that such "a military action would violate the UN charter." Similarly, during the 2006 Israeli invasion of Lebanon, Annan stated that the Israel's "'disproportionate' use of force and collective punishment of the Lebanese people must stop." This was a means of condemning Israeli actions as illegal. Such actions earned Annan praise for being willing to tell "the truth to the powerful", from Dumisani Kumalo, the South African Ambassador to the UN, speaking on behalf of the Group of 77. These actions, on the other hand, were condemned by Bolton who criticized Annan as the UN's "chief moralizer", whose activities "were not ultimately helpful to the world body." Even before he took office, Ban had said he would be open with the press, promising that he could be "a pretty straight shooter when I need to". Coming to the UN from his former position as the Foreign Minister of South Korea, Ban brought with him a reputation for dodging questions from the press when he deemed that beneficial. This trait led South Korean journalists to nickname him Slippery Eel. Already during his short term in office, there have been several instances when Ban praised the powerful and dodged questions from reporters when asked to explain the basis for his praise. One example occurred after Ban met with the U.S. President George Bush in Washington on January 16, 2007. At the press conference following the meeting, Ban referred to Bush as a "a great leader." When Ban returned to the UN, a reporter asked him why he had used these words to describe Bush. Ban responded: -------------------------------------------------------------------------------In diplomacy, it is appropriate to address any Head of State or Government with due respect and courtesy. I hope you will understand what this diplomatic practice is. Such comments have earned Ban a reputation as someone who "is an enigma to media and diplomats alike" and whose "statements" are as hard to follow as "a Delphic Oracle." Bolton, on the other hand, has expressed his approval for what Ban has done or has freely offered his advice on what to do differently. For example, Bolton characterized as a "courageous decision" Ban's call for the resignations of 60 senior-level officials in the secretariat. Since the contracts of these officials were to expire anyway at the end of February, several reporters wondered why Ban asked for their resignation. When Ban was asked for his response to Bolton's comments, Ban responded that he agreed with some of them. He did not elaborate. One of the first promises of the new Secretary General was that he would carry out reform at the UN. There are different views among the member nations of the U.N. on what reform is needed. For the U.S. government as Bolton explains, the purpose of reform is to make the UN a better tool among others "to implement American foreign policy". For a number of other nations, the purpose of reform is to foster a multilateral process to prevent war and hostilities among nations. (10) Nations which are part of the group known as the G-77 define a reform agenda quite differently from the agenda promoted by the U.S. and what the G-77 describe as "other developed nations from the North." The G-77, originally formed in 1964 when 77 developing nations signed a Joint Declaration at the end of the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), has a reform agenda that focuses on development issues and on promoting the importance of the UN as the preeminent international institution. There are now 130 nations that are part of the G-77. Many of these nations are also part of the Non-Aligned Movement. During Ban's first few weeks in his new position, he has appeared to vacillate between the reform agenda of the G77 and the reform agenda supported by the U.S. and other powerful developed nations. The U.S. wants the U.N. to be run more like a business, with business processes and management goals, Bolton said in a talk he gave at Columbia University in April 2006. Other nations differ. Describing how the U.N. differs from a business organization, in a talk also given at Columbia University, Choi Young-jin, the Ambassador to the UN from South Korea, explained that there are 192 nations belonging to the UN and "every one is on the board of governors." Choi maintained that you can't run an organization with 192 members on the board the same way you can run a business. While a business has a goal of generating profit, "the strongest point of the UN," Choi said, "is its moral authority. The focus of any reform has to be on that moral authority, not on 'efficiencies'." Another characteristic of the differences in the reform agenda of the different nations is the importance with which many nations view the need for a reform of the Security Council. In December 2006 there was a debate in the General Assembly about reform of the Security Council that drew 70 speakers and substantial proposals for changing its composition and working methods. Subsequently at the first meeting of the new year of the Security Council on January 8, 2007, several of the nonpermanent members raised the need for Security Council reform. One nation's representative explained that the issues taken up by the Security Council should be more carefully chosen so they do not to encroach on the mandate of other UN organs. Similarly, he proposed that the Security Council should not fail to act in situations consistent with its mandate, situations that pose a threat to international peace and security, such as in the "Palestine-Israeli issue." Other issues raised during the January 8 meeting included the desirability of involving regional and subregional groups in solving problems when feasible, that diplomatic solutions should be utilized before resorting to sanctions, and that nations like Iran and North Korea should not be denied the right to undertake research and development for the peaceful uses of nuclear energy. United Nations Secretary-General-designate Ban Ki-moon addresses the General Assembly meeting after that body endorsed his appointment as the next Secretary-General, at UN Headquarters in New York. Photo: UN Photo/Paulo Filgueiras This meeting was also Ban's first official meeting with the Security Council. He gave a brief presentation. Though he spoke about UN reform, he didn't mention Security Council reform. Later at a press conference with Ban's spokesperson, a reporter asked if Ban deliberately choose not to mention Security Council reform. The spokesperson responded: -------------------------------------------------------------------------------- I don't think it was deliberate. I think he is certainly interested in the issue -- definitely concerned about the issue. He has talked about it before, but as you know with Security Council reforms there was a proposal made, and now, it is in the hands of the Member States. In general, the mainstream U.S. media provides little coverage of the controversy over reform at the UN. Allegations of U.N. mismanagement, however, are pursued with a vengeance, just as they had been in the "Oil for Food" scandal. More recently articles by Fox News and in the Wall Street Journal alleged that tens of millions of dollars of hard currency had been subverted by the government of North Korea from the United Nations Development Program (UNDP) and used to fund North Korea's nuclear program. Also the press reports charged that the UNDP had kept the scam secret. Fox News asked if Kim Jung Il "subverted the UNDP program" and possibly stole "tens of millions of dollars of hard currency in the process." In their article "United Nations Dictators Program", the WSJ alleged that "the hard currency supplied by the UNDP almost certainly goes into one big pot marked 'Dear Leader' which Kim can use for whatever he wants." These allegations were made without any actual evidence to back them up, but just in time to coincide with the UNDP Executive Board meeting that was to approve the programs for 2007 and on. The result of the articles was to block the approval of the 2007-8 UNDP program in North Korea, and to exert pressure so that the Secretary General recommended an external audit of all UN programs, beginning with the North Korean UNDP program. Headlines alleging North Korean abuse of UN programs quickly spread in the U.S. and international media. Subsequently, the U.N. announced that their audit plans were focused on North Korea. There is to be an external audit of all UN programs in North Korea. The audit is "to be completed by the Board of Auditors within a three-month time frame, as per the Secretary General's proposal of 22 January 2007." Both the U.S. and the Group of 77 supported Ban's candidacy for the position of Secretary-General. Now that he is in the position, he is faced with the ongoing struggle of contending forces over the U.N.'s reform agenda. How he will handle the different pressures is one of the important challenges he and the U.N. face in the coming months and years of his term. http://www.heise.de Die Macht und das Monster Rüdiger Suchsland 29.03.2007 Monsterfilm mit politischer Sprengkraft: "The Host" Der koreanische Film "The Host", in seinem Heimatland der erfolgreichste aller Zeiten, ist ein unterhaltsames Öko-Horror-Thiller-Politsatire-Familiendrama, das stilistisch moderne Elemente mit Stilmitteln der 50er- und 60er Jahre verbindet. Excellent ist dieser vielschichtige Film besonders als PolitSatire, der den in den letzten Jahren neu entstandenen militärisch-sanitären Komplex kritisiert, und die der Nutzung von Gesundheitsfragen zu versteckter Machtpolitik angreift. Auch die Reaktion der Medien gerät deutlich in den Blick. Zuallererst aber ist dies ein ungewöhnlicher, auch ungewöhnlich vergnüglicher Film. Bong Joon-ho's "The Host" beginnt wie ein Katastrophenfilm: Ein Prolog zeigt, wie Wissenschaftler einer US-amerikanischen Militärbasis über hundert Liter hochgiftiges Formaldehyd kurzerhand in den Han-Fluss abgeleiten. Daraufhin bilden sich im Fluss Mutationen. Dann setzt, einige Jahre später, die eigentliche Handlung ein: Man lernt eine nette Familie aus Koreas Hauptstadt Seoul kennen, erlebt Passanten auf einer Ausflugswiese nahe am Fluss. Plötzlich entsteigt ein merkwürdiges Wesen dem Fluss. Es bewegt sich mit Hochgeschwindigkeit fort und sieht aus wie eine absurde Kreuzung aus einer gefräßigen Riesenkaulquappe mit einem Haifischgebiss und dem "Alien" aus Ridley Scotts gleichnamigem Klassiker und sucht offenbar auf der Wiese nach Beute. Wunderbar gekonnt inszeniert der Film die folgende Massenpanik und das allgemeine Chaos auf der öffentlichen Ausflugswiese. Unweigerlich denkt man an die berühmten Strandszenen aus "Der weiße Hai" und trotzdem hat dieser Film mitunter den Witz von "Airplane". Menschen zeigen sich ebenfalls von ihrer unangenehmsten Seite Der Koreaner Bong Joon-ho ist Kennern und Festivalbesuchern als einer der interessantesten Regisseure des koreanischen Gegenwartsfilms bekannt. Doch weder "Barking Dogs" (2000), noch "Memoires of Murder" (2003) kamen ins deutsche Kino – immerhin auf DVD kann man sie ansehen. Der dritte Film des Koreaners – in Korea gilt er mit 13 Millionen Zuschauern und über 60 Millionen USDollar Einspielergebnis als erfolgreichster Film aller Zeiten – ist nun ein cineastisches Phänomen und eine schwer charakterisierbare Mischung verschiedener Genreelemente zu einem Film, der am ehesten ein Monsterthriller ist – und eine ebenso scharfe, wie kühl analysierende politische Satire. Denn ebenso wichtig wie die Jagd auf das fleischfressende Monster und die Rettung eines Schulmädchens, das in der Gewalt des Monsters überIebt hat, ist die Reaktion der Gesellschaft auf sein Auftauchen. Denn im Angesicht der Bedrohung durch die bösartige Kreatur zeigen sich die Menschen ebenfalls von ihrer unangenehmsten Seite. Bong Joon-ho's Film funktioniert als Ensemble von Geschichten, als ein Netz, das seine Punkte verknüpft und sein Gewirr durchkreuzt. Erstaunlich, was Bong hier alles verarbeitet hat, ohne dass sein Film je an Unterhaltungswert verliert: Im Kern erzählt "The Host" von einer dysfunktionalen Familie, die sich verloren hat, und über eine äußere Bedrohung wieder zusammenfindet – nicht ohne Opfer. Diese klassische, hochmoralische Story ist aber von allerlei weiteren Handlungssträngen umrankt: Einer davon ist die soziale Lage. Denn dies ist offensichtlich eine Familie am Rand der Gesellschaft, die vom Wirtschaftsboom in Korea noch nicht übermäßig profitiert hat. In der Not wird sie von den Behörden ignoriert. Natürlich geht es auch um das prekäres USA-Verhältnis Südkoreas und das dortige Benehmen der Amerikaner – so basiert der Ausgangspunkt auf Tatsachen: Im Februar 2000 liess Albert L. McFarland im Militär-Leichenhaus von Yongsan 20 Gallonen Formaldehyd in den Han-Fluss gießen und wurde nach einem mühevollen Verfahren zur Rechenschaft gezogen -, den NeoKolonialismus der USA, die auch im zeitgenössischen Korea noch immer eine überaus unsympathische Rolle spielen, dort eine Art Staat im Staate sind. Auch die USA sind ein "Host" mit Monstertendenzen, jedenfalls aus koreanischer Sicht. Wenn der Film zeigt, wie der Staat seine eigenen Bürger verfolgt, statt das Monster, dann nimmt er aber auch polizeistaatliche und autoritäre Tendenzen ins Visier, die in der koreanischen Gesellschaft auch fast zwei Jahrzehnte nach der Diktatur immer noch präsent und mitprägend sind. Nicht zufällig wird eine der Hauptfiguren als einstiger Anhänger der demokratischen Opposition und Demonstrant der Studentenunruhen der Jahre vor 1988 vorgestellt. Ein Schwenk, der für die Ironie des Regisseurs typisch ist, ist dann, dass ihm das seinerzeit erlernte effektive Bauen und Werfen von Molotowcocktails nun im Kampf mit dem Monster sehr nützlich ist. Natürlich geht es aber auch um Kritik am Korea der Gegenwart: Dies wird als ein Land der allgemeinen Korruption geschildert, als ein Land, in dem Beziehungen – "Der Schwager von dem Mann einer Nichte meines Freundes, der ist auch bei der Polizei", heißt es einmal im Film – alles entscheiden. Korruption und Geldgier prägen die sozialen Verhältnisse. Wie ein Virus erfunden wird Es geht um Pandemien wie die Vogelgrippe – und der Regisseur lässt selbstverständlich aktuelle asiatische Erfahrungen über den Umgang mit SARS einfließen, wenn er zeigt, wie ein Virus geradezu "erfunden" wird, wie die Angst vor "dem Virus" einsetzt, plötzlich alle Menschen Masken vorm Mund haben, angeblich Infizierte in gelbe Plastiksäcke gepackt und der wissenschaftlichen Willkür preisgegeben werden – bis hin zu einer Gehirnoperation. Dann greift die WHO ein und entmachtet das Land – ein realistisches Szenario, seit 1997 während der asiatischen Krise Korea kurzerhand unter Kuratel der Weltbank gestellt wurde. Die Kritik an diesem militärisch-sanitären Komplex und der Nutzung von Gesundheitsfragen zu versteckter Machtpolitik ist einer der prägnantesten der vielen, gut verwobenen Fäden dieses Films. Aber auch allgemeine Öffentlichkeitsmechanismen sind deutlich im Blick, wenn die gesellschaftliche Steuerungskrise und ihre psychologischen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen gezeigt werden und die Reaktion der Medien auf diese Herausbildung von Unsicherheit: das Ausspähen und Vermarkten eines symbolischen Opfers – ausgerechnet eines US-Soldaten – und von symbolischen Infektionsträgern. Stilistisch untergräbt der Film fortwährend sein eigenes Genre. Die die visuelle Textur des Films bestimmenden Einflüsse reichen von japanischen "Godzilla"-Werken bis zum italienischen Neorealismus. Die Kameraarbeit und dynamische, konsequente wie nervöse Inszenierung sind von hoher visuellen Präzision. Auch wenn es unangenehme Momente gibt, und der Regisseur mit Schauer- und Ekeleffekten spielt, ist dies zu keiner Zeit ein Horrorfilm, und bei aller äußerer Ähnlichkeit will dieses Monster auch nie die beklemmende Wirkung und archetypische Kraft des "Alien" oder des "weißen Hai" entfalten. "The Host" ist eine boshafte, hochironische und intelligente Satire über die südkoreani- sche Gegenwartsgesellschaft, der sich ihrer eigenen Verrücktheit bewusst ist, und eine frische zeitgenössische Comedie Humaine, die ihresgleichen sucht – dagegen sehen viele andere Filme überaus alt aus. http://www.heise.de Zwei Jahrhunderte Rückstand im Spionagegeschäft Markus Kompa 11.10.2007 Die schmutzigen Tricks des Allen Dulles (Teil 3/4) In den 50er Jahren versuchte die Regierung Eisenhower, andere Nationen durch verdeckte Operationen zu kontrollieren. Zum Kampf gegen den Kommunismus wurde Dulles ermächtigt, im Ausland Politiker und Militärs zu bestechen, Wahlen zu fälschen, zu verleumdenden Terrorismus zu inszenieren, fremde Staatschefs zu töten, Revolutionen zu steuern und verdeckte Kriege zu führen. Teil 1: Über einen Täuschungskünstler, der die Welt zu seiner Bühne machte Teil 2: Vom OSS zur CIA -------------------------------------------------------------------------------"You have got to have a few martyrs. Some people have to get killed." - CIA-Chef Allen Dulles, 1953, freigegeben 2003 Als erster CIA-Direktor war 1947 Admiral Roscoe Hillenkoetter eingesetzt worden, dessen kurioseste Leistung im Schutz von Staatsgeheimnissen der Luftwaffe bestand. So waren Tests von geheimen Flugzeugen und Spionageballons aufgefallen, welche Beobachter für UFOs hielten. Die geheimnisgefährdende UFO-Forschung überwachte Hillenkötter später persönlich. Covert Actions Allen Dulles trat anfangs lediglich als Berater der CIA auf. Offizieller Leiter der "Abteilung für spezielle Operationen" war ab 1948 OSS-Veteran, Wallstreet-Anwalt und Alkoholiker Frank Wisner. Zuvor hatte Wisner ein Jahr als CIA-Stationschef in Berlin fungiert, wo er gerade einmal einen einzigen Agenten geworben und während der Berlin-Blockade eine militärische Lösung vorgeschlagen hatte. Als Cover für die Kontrolle des CIA-finanzierten "Radio Free Europe (RFE)" rekrutierten Dulles und Wisner amerikanische Honoratioren wie die Herausgeber von Newsweek und der New York Times sowie den Filmproduzenten Cecil B. DeMille. Auch die US-Zeitungen sollten im Sinne der CIA berichten, die im Gegenzug kooperativen Journalisten Informationen zuspielte. Im OSS-Stil wollte Wisner den Kommunismus durch per Fallschirm abgesetzte Agenten zurückdrängen, die Sabotage verüben und Untergrundorganisationen aufbauen sollten. Für die Planung dieser "Covert Actions" waren George Kennan und James Forrestal verantwortlich. Forrestal nahm sich bereits 1949 in der Psychiatrie das Leben, auch Wisner wurde 1956 manisch depressiv und erschoss sich 1965, Kennan wurde Alkoholiker. Fallschirmagenten 2005 wurden bislang geheime Akten freigegeben, welche das volle Ausmaß von Wisners Fallschirmagenten dokumentieren. Wisner rekrutierte in Westeuropa Kriegsflüchtlinge, die er im Schnellverfahren zu Agenten ausbilden ließ und in ihr Heimatland entsandte. Einige sprangen direkt über Moskau mit dem Fallschirm ab, Hunderte über Albanien, Jugoslawien, den Karpaten und der Ukraine. Die meisten der Fallschirmagenten wurden bereits bei der Landung von den sie erwartenden gegnerischen Abwehrdiensten abgefangen, welche die CIA-Trainingslager in Deutschland längst mit eigenen Agenten infiltriert hatten. Die ungebetenen Spione in Stalins Imperium erwartete der Tod. Eine wesentliche Ursache der Fehlschläge waren die Trinkgelage zwischen CIA-Abwehrchef James Jesus Angleton und seinem britischen Amtskollegen Kim Philby gewesen, bei denen Anglelton Details streng geheimer Operationen ausplauderte – die Doppelagent Philby sofort an das KGB weitergab. Die CIA, die über 400 Millionen $ ihres Etats von 587 Millionen $ in Wisners sinnlose und kontraproduktive Covert Actions zu investieren pflegte, war in der Sowjetunion absolut blind. Als die Sowjets bereits 1949 überraschend die erste Atombombe gezündet hatten, glaubte die CIA zunächst an einen Propagandatrick. Zwar hatte die CIA keine Information darüber, ob der Gegner über eine oder über tausend Atombomben verfügte, wohl aber offerierte man dem Präsidenten die beruhigende Nachricht, den Sowjets stünden die zum Transport der tödlichen Fracht erforderlichen Raketensysteme erst 1969 zur Verfügung. Bereits 1957 sollte Sputnik die USA überfliegen. Während sich Wisner vergeblich um fähige Agenten hinter dem "eisernen Vorhang" bemühte, führte er nicht einen einzigen Agenten dort, wo die USA am meisten welche benötigt hätte. Korea Der Koreakrieg traf die CIA 1950 völlig unvorbereitet, weshalb CIA-Chef Hillenkoetter gegen Eisenhowers früheren Stabschef General Walter Bedell Smith ausgetauscht wurde. Wisner rekrutierte Tausende Koreaner und Chinesen, die nach ihrer Schnellausbildung als Geheimagenten über Nordkorea abgesetzt wurden. Nicht einer kehrte lebend zurück. Walter Bedell Smith. Foto: moscow.usembassy.gov Nachdem CIA-gesteuerte Koreaner versehentlich das Schiff des südkoreanischen Präsidenten beschossen, wies auch dieser die CIA umgehend außer Landes. Die Spionageagentur gab hinsichtlich eines möglichen Kriegseintritts Chinas dem Präsidenten Entwarnung. Dieser sah sich plötzlich mit einer überraschend aufgetauchten 300.000 Mann starken chinesischen Streitmacht konfrontiert. Erfolglos bemühte man sich um amerikanische Agenten, die gewillt waren, über China abzuspringen. Man versuchte es schließlich mit Chinesen, die wie ihre in Osteuropa eingesetzten Kollegen ihren Einsatz mit dem Tod bezahlten. Wisners im Schnellverfahren ausgebildeten Geheimkrieger, die vom Militär als Amateure bewertet wurden, stifteten allerhand Schaden, aber keinerlei Nutzen. Wisners Versuch, in Korea ein Spionagenetz aufzubauen, wurde zu einem lukrativen Nebenerwerb für CIAeigene Märchenerzähler vor Ort. Von den tatsächlich geworbenen koreanischen Informanten stellten sich praktisch alle als umgedrehte Doppelagenten heraus. Selbst Bedell Smith war der Ansicht, die CIA solle operative Aufträge dem Militär überlassen und sich stattdessen auf den Nachrichtendienst konzentrieren – bei dem die CIA noch immer keine Ergebnisse vorzuweisen hatte. Doch Wisner hatte eine starke Lobby. Special Plans Lobbyist Allen Dulles, der die Außenpolitik im Council of Foreign Relations beeinflusste, stänkerte in Memoranden an den Präsidenten gegen die seiner Ansicht nach schwache Führung der CIA. Aufgrund des Totalversagens in Korea wurde der Kritiker auf einen eigens geschaffenen Posten in die CIA berufen. Seine als "Special Plans" deklarierte Abteilung kümmerte sich in Wirklichkeit um die Covert Actions. Zwischen dem Befehlsstrukturen favorisierenden General und dem doppelzüngigen Anwalt waren Spannungen vorprogrammiert. Der clevere Anwalt wusste Misserfolge ungleich besser zu verkaufen. Dulles schwadronierte gegenüber Mitgliedern des Kongresses von "CIA-Guerillas" in Korea. Später, als Erfolge ausblieben, seien diese Guerillas wohl in Schwierigkeiten geraten oder umgedreht worden. In Wirklichkeit hatte es nie welche gegeben. Den Phantomarmeen lieferte die CIA Waffen im Wert von 152 Millionen $ und sandte Hunderte von weiteren Fallschirmagenten, die entweder umkamen oder in jahrelange Kriegsgefangenschaft gerieten. Eine schließlich von der CIA gesponserte Armee eines Li Mi hatte schließlich vom Krieg genug und setzte sich ins "goldene Dreieck" ab, um ein Drogenimperium aufzubauen. Glaubt man Dulles' 2003 freigegeben Worten von 1953, so hatte er sich nichts vorzuwerfen und würde jederzeit wieder entsprechend handeln. Organisation Gehlen Genauso wenig wie die CIA-Guerillas in Korea, existierte auch das "Spionagenetz" des deutschen Generals Reinhard Gehlen hinter dem "Eisernen Vorhang". Gehlen hatte seit dem Krieg unter USPatronat den offiziell nicht existierenden deutschen Auslandsgeheimdienst "Organisation Gehlen" aufgebaut, in dem zahlreiche nationalsozialistisch belastete Deutsche eine Bleibe fahnden. Die "Org" gewann ihre Information durch Befragung von Kriegsheimkehrern und heimliche Postöffnungen. Wie Wisner hatte Gehlen zahlreiche nach Deutschland verschlagene Osteuropäer zum Aufbau eines Spionagenetzes gen Osten geschleust, die nicht zuletzt dank hochrangiger Doppelagenten wie Heinz Felfe ebenfalls ins Verderben marschiert waren. Gehlen war ein begnadeter Verschwörungstheoretiker, der zeitlebens fest davon überzeugt gewesen war, dass es keine zehn Jahre bis zur sowjetischen Invasion dauere. Mangels brauchbarer Quellen im Osten sog sich Gehlen die von Dulles nachgefragten Märchen aus den Fingern, was dem Westen ein maßlos übertriebenes Bild der militärischen Leistungsfähigkeit der Sowjetunion beschied. Auch in den folgenden Jahrzehnten sollten sich die Org und ihr Nachfolger, der Bundesnachrichtendienst, als zuverlässige Lieferanten für aufblasbare Desinformation bewähren. Strahlende Propaganda Die Öffentlichkeit zu täuschen war in den 50er Jahren keine große Kunst. Die Regierung verbog sogar die Naturgesetze: Der amerikanischen Öffentlichkeit ließ man etwa durch prominente Wissenschaftsjournalisten einreden, Atombomben hinterließen keine Strahlung und verbreitete in einer Kampagne Optimismus, einen Atomkrieg durch Suchen von Deckung zu überleben, was jedoch gleichzeitig die Hysterie vor einem sowjetischen Angriff schürte. Bei Atombombentests in Nevada fuhren gutgläubige Familien an das Testgelände heran, um Blitz und Druckwelle beim Barbecue zu genießen. Wer die konzertiert in den Medien propagandierte Meinung infrage stellte, wurde als "links" oder "soft on comunism" angesehen. Letzteres war auch Dulles Standardvorwurf, wenn jemand die Notwendigkeit seiner Aktionen hinterfragte. Aufgrund spektakulärer Spionagefälle herrschte in den USA eine Hysterie vor russischen Agenten. Obwohl nicht einmal die CIA irgendwelche Informationen über Stalins Absichten hatte, wussten gute Amerikaner jedoch, wie mit den Kommunisten zu verfahren sei. CIA-Chef Walter Bedell Smith vermochte Wisner und Dulles nicht nur nicht zu kontrollieren, er wusste nicht einmal, was die Beiden in der Welt so alles taten. Er beauftragte schließlich einen General mit einer Untersuchung der hauseigenen Aktivitäten – und war von den Ergebnissen schockiert. So betrieb die CIA in Japan, Deutschland (Oberursel) und am Panamakanal geheime Gefangenenlager und entwickelte menschenverachtende Verhörmethoden. Seit 1950 hatte die CIA bei der Suche nach Wahrheitsdrogen mit LSD an Kriegsgefangenen experimentiert. Westeuropa Seit 1952 rekrutierte Wisner in Westdeutschland frühere Angehörige der Hitler-Jugend für den Aufbau einer geheimen "stay behind" Armee, die sich im Fall eines sowjetischen Angriffs überrollen lassen und hinter den Linien Sabotage und Widerstand hätte organisieren sollen. Etliche versteckte Lager für Waffen im Partisanenkampf wurden angelegt. Die sich nach einer früheren Organisation benennenden "Jungdeutschen" glaubten, von "überwinterten" Nazis geführt zu werden, während in Wirklichkeit die CIA die Fäden zog. Einige liefen aus dem Ruder, indem sie Listen mit zu ermordenden kommunistischen und sozialdemokratischen Politikern führten. Nachdem sie mit der Abarbeitung der Liste begonnen hatten, flogen ganze Netzwerke auf, was einen Skandal auslöste, der jedoch nicht mit der CIA in Verbindung gebracht werden konnte. Die Existenz der Gladio genannten geheimen Einzelkämpfer-Organisation blieb dem Bundestag bis zu den 90er Jahren unbekannt, als in diversen anderen NATO-Staaten Gladio-Einheiten aufflogen. Ostberlin Wisner hatte in Ostberlin das "Komitee freier Juristen" ausfindig gemacht, das Kritik an der kommunistischen Führung übte. Wisner versuchte, die Gruppe zu bewaffnen. Da die Stasi nicht schlief, waren die freien Juristen umgehend alles andere als frei. Als es 1953 in Ostberlin zum Arbeiteraufstand kam, war die CIA hiervon völlig überrascht. Für Pläne, die Dissidenten zu bewaffnen, war es zu spät. Polen Als vielversprechend präsentierte sich die polnische Untergrund-Organisation WIN, die mit der CIA kooperierte und erstklassige Informationen lieferte – so glaubte Dulles wenigstens und lieferte Spezialgerät und finanzielle Mittel in Millionenhöhe. Tatsächlich war WIN eine seit 1947 andauernde Täuschungsoperation des polnischen Geheimdienstes, der auf diese Weise seine Gegner von Anfang an kontrollierte. Die Aktion wurde auf ihrem Höhepunkt in den polnischen Medien propagandistisch enthüllt. Zu allem Überfluss hatte "WIN" die Gelder der CIA an die italienischen Kommunisten weitergeleitet: Die CIA hatte den ideologischen Feind finanziert! Stalin Dulles, der bereits Hitler hatte liquidieren wollen, hatte auch auf Stalin ein Attentat geplant. Der sowjetische Diktator hätte bei einem Besuch in Paris erschossen werden sollen. CIA-Chef Bedell Smith lehnte den Staatsmord ebenso ab wie Dulles Plan, die chinesische Regierung durch einen Flugzeugabschuss zu beseitigen. Regierung Eisenhower Bedell Smith gelang es nie, Wisner und Dulles unter Kontrolle zu bringen. Als Eisenhower 1953 die Präsidentschaftswahlen gewann, machte er seinen wichtigsten außenpolitischen Berater John Foster Dulles zum Außenminister, während Allen Dulles gegen vehementen Protest von Bedell Smith dessen Posten übernahm. Mitbewerber Donovan kam nicht zum Zuge. Dessen zunehmend wunderliche Art wurde später als Geisteskrankheit erkannt, die zu Wahnvorstellungen über in New York einfallende Kommunisten führte. CIA-Chef Dulles Amtsantritt wurde vom Drama um seinen einzigen Sohn Allen Macy Dulles überschattet. Dieser hatte sich bislang vergeblich bei seinem Vater um Anerkennung bemüht und diese nun durch seinen freiwilligen Einsatz in Korea gesucht. Der Spionagechef selbst hatte nie eine Uniform getragen oder wirklich sein Leben für sein Land riskiert. Sein Sohn erlitt in Korea eine schwere Kopfverwundung und bestritt seine restlichen Tage als apathischer Krüppel. Während der spröde John Foster selbst bei seinen eigenen Mitarbeitern unbeliebt war, verstand es Allen mit seinem Charme, Kongressmitglieder und Ausschüsse zu manipulieren. Dulles verschaffte der CIA durch intensive Kontaktpflege mit prominenten Journalisten ein positives Image, obwohl nahezu keine Spionageerfolge vorzuweisen waren. Die zahlreichen Desaster blieben praktischerweise Staatsgeheimnisse. Ebenso wie in den USA zementierte Dulles auch in Westdeutschland den Einfluss der CIA in den Medien. Als verlässlicher Partner wurde insbesondere der Verleger Axel Springer gerühmt. Für einen direkten Draht nach Deutschland sorgte Schwester Eleonor Dulles, die als "Mother of Berlin" berühmt wurde. Die Dulles-Brüder tauschten jede Nacht ihre Erkenntnisse aus und stimmten sich ab. Allen betrachtete sich als Werkzeug seines stets tonangebenden großen Bruders, des fanatischen Antikommunisten und Architekten des Kalten Kriegs – der fortan gelegentlich heiß werden sollte. Da die CIA im Korakrieg noch immer keine Erfolge vorzuweisen hatte, war Dulles nun jedes Mittel hierzu recht. Entgegen den strengen US-Postgesetzten ließ er im New Yorker Flughafen die Briefe kontrollieren. Die benötigten Räume waren so eingerichtet, dass diese bei Auffliegen binnen Stunden ohne Spuren verlassen werden konnten. MK Ultra Sogar Hellseher ließ der Pastorensohn testen. Um Kriegsgefangene und potentielle Doppelagenten auf ihre Ehrlichkeit zu überprüfen, beauftragte Dulles den Militärchemiker Sidney Gottlieb mit der Perfektionierung von Wahrheitsdrogen, mit denen er bereits seit Kriegsende Menschenversuche an Kriegsgefangenen durchgeführt hatte. Dulles wollte jedoch auch wissen, ob durch chemische, psychische und physische Manipulation Gehirnwäsche möglich sei. Der damals populäre Science Fiction-Roman "The Manchurian Candidate", in welchem die Kommunisten Menschen ohne ihr Wissen zu Attentätern ausbildeten, die auf ein bestimmtes Codewort ihre programmierten Mordaufträge ausführten, inspirierte Dulles zu entsprechenden Forschungsaufträgen. Im Rahmen dieses MK Ultra genannten Programms heuerte Dulles den damals prominentesten USZauberkünstler John Mulholland an, der Methoden entwickelte, wie CIA-Agenten ihren Gegner unauffällige Wahrheits-, Betäubungs- oder Morddrogen verabreichen könnten. Dulles kannte wenig Skrupel: Die Drogen wurden nicht nur an Tieren und Kriegsgefangenen getestet, sondern auch an Amerikanern, denen etwa in einem inszenierten Bordell versetzte Drinks verabreicht wurden. Das Programm wurde vom mysteriösen Tod des Militärbiologen Frank Olson überschattet, bei dem ein Taschentuch mit Mulhollands Initialen gefunden wurde. MK Ultra wurde so geheim gehalten, dass weder der Präsident, noch Dulles Amtsnachfolger McCone später hierüber aufgeklärt wurden. Auch Zauberkünstler Mulholland nahm sein Geheimnis mit ins Grab. Iran Im Iran hatte der gewählte Premierminister Mohammad Mossadegh die anglo-britische Erdölgesellschaft verstaatlicht, die einseitig von den iranischen Bodenschätzen profitierte. Als der britische Geheimdienst bei den Vorbereitungen eines Putsches durch General Zahedi aufgefallen war, bat Churchill die finanziell besser ausgestattete CIA um Hilfe, die er unter Verweis auf den britischen Beitrag im Koreakrieg einforderte. Als Allen Dulles dem National Security Council den geplanten CIA-gesteuerten Putsch im Iran schmackhaft machen wollte, tischte er Geschichten über einen bevorstehenden kommunistischen Umsturz auf. Würde der Iran kommunistisch werden, fiele ein Staat nach dem anderen wie umfallende Dominosteine dem Kommunismus anheim. Die iranischen Ölfelder dürften keinesfalls in die Hände der Sowjetunion geraten. In Wirklichkeit war Mossadegh Nationalist. Im Gegenteil hatte er die kommunistische Partei verbieten lassen, zuvor sogar selbst kommunistische Truppen vertrieben. Wohl um mit den USA zu pokern hatte er Verhandlungen mit dem sowjetischen Botschafter begonnen, was Dulles zur Untermauerung seiner Verschwörungstheorie benutzte. Truman glaubte kein Wort und hoffte, Mossadegh durch Geld gefügig machen zu können. Dennoch wurde General Zahedi unterstützt. Kermit Roosevelt, Enkel des Ex-Präsidenten und seit Jahren CIAMann vor Ort, organisierte schließlich gemeinsam mit den Briten in der Operation Ajax terroristische Anschläge u.a. auf islamische Geistliche, die Mossadegh untergeschoben wurden. Als Zahedi mit seinem Putsch losschlagen wollte, war der Plan bereits aufgeflogen und wurde im Rundfunk verkündet. Zudem stellte sich heraus, dass Zahedi nicht einen einzigen Soldaten unter sein Kommando gebracht hatte. Während sich Zahedi in einem CIA-Haus versteckt hielt, übernahm nun die CIA den Aufbau der Revolutionsarmee. In Flugblättern verleumdete man Mossadegh sowohl als Kommunisten als auch als Juden. Die CIA bestach schließlich eine Vielzahl an politisch desinteressierten Iranern, die Mossadegh eine Revolte initiierten, die in einen Putsch mündete, der dreihundert Menschen das Leben kostete. Während des Staatsstreichs hielt sich Dulles in einem Hotel in Rom auf – gemeinsam mit Shah Reza Pahlavi, der seinerzeit aufgrund von Wahlbetrug iranischer Staatschef gewesen und 1949 als Mandant von Sullivan & Cromwell von Dulles in die amerikanische Gesellschaft eingeführt worden war. Pahlavi empfahl sich als künftiger Diktator. CIA-Mann Kermit Roosevelt war noch an einer Reihe ähnlicher Operationen beteiligt, bevor er in die Ölindustrie wechselte. Guatemala Ebenso wie im Iran war an Dulles bevorzugtem Urlaubsort ein ihm nicht genehmer Staatschef gewählt worden. Die Landwirtschaft Guatemalas wie die weiterer Länder der Region war bislang praktisch vollständig von der United Fruit Company (UFCO) kontrolliert worden, welche den Bauern ihr Land abgepresst und einseitig profitierten hatte, sich für die lokale Infrastruktur Guatemalas jedoch nicht verantwortlich fühlte. Im Rahmen einer Bodenreform enteignete Präsident Jacobo Arbenz Guzmán die US-Firma und bot die Rückzahlung des einstigen Kaufpreises an. Die United Fruit Company, zu deren Aktionären etwa der Mafioso Meyer Lansky gehörte, wurde von Sullivan & Cromwell vertreten. Der zum Kanzleichef aufgestiegene John Foster Dulles, selbst Aktionär der UFCO, sowie sein im Verwaltungsrat der UFCO sitzender Bruder, zugleich amtierender CIA-Chef, wollten sich derartiges nicht bieten lassen. Zu den ersten Plänen gehörte Allen Dulles Vorschlag, den Kaffeeexport durch lancierte Gerüchte über einen Pilzbefall zu sabotieren. Die CIA ließ den PR-Spezialisten Edward Bernays Arbenz zum Kommunisten stilisieren:: und bildete "Revolutionskräfte" aus, die nach Guatemala geschmuggelt wurden. Zur psychologischen Kriegsführung benutzte die CIA sowohl die einflussreiche katholische Kirche als auch Gangster und bestach hohe Militärs. Die CIA lancierte 1954 Falschmeldungen über einen Währungsverfall, der zu Panikkäufen führen sollte und vermeldete schließlich die angebliche Kapitulation der Streitkräfte. Ein Millionär stellte der CIA Flugzeuge zur Verfügung, die mit Guatemalas Hoheitszeichen maskiert worden waren. Hiermit sollte eine übergelaufene Luftwaffe simuliert werden. Stimmenimitatoren täuschten falsche Radionachrichten vor, die unter der Bevölkerung Panik auslösen sollten. Die irregeführten Soldaten ergriffen die Flucht – so jedenfalls stellte die CIA ihren coup d'etat dar, der zum Mythos wurde. Sogar Eisenhower gegenüber tischte Dulles das Märchen auf, der Putschist Castillo Armas hätte nur einen einzigen Mann verloren – tatsächlich waren es 43. Der Erfolg der Mission beruhte nicht wirklich auf den gerühmten Täuschungsmanövern, sondern in erster Linie auf militärischer Gewalt und ein Quentchen Glück. "What we wanted to do was a terror campaign" kommentierte CIA-Mann Howard Hunt. Dulles nutzte die Gunst der Stunde, um das noch immer schwache Spionageressort der CIA aufzuwerten, und lancierte ein Märchen, das wieder mal ein Schiff betraf: Ein polnischer Agent hätte die CIA von dem schwedischen Frachter "Alfhem" berichtet, der aus der Tschechoslowakei eine Ladung Waffen nach Guatemala exportiert hatte, die zur ultimativen Bedrohung hochstilisiert wurde. Das Schiff habe während seiner Reise ab Europa unter CIA-Beobachtung gestanden. Entgegen der Darstellung vieler Geschichtsbücher erfuhren die USA in Wirklichkeit erst von dem Schiff, als es die Fracht bereits in Puerto Barrios gelöscht hatte. Dulles instruierte seine Mitarbeiter, zur Wahrung des Ansehens der CIA nachhaltig den eigenen Präsidenten zu belügen. McCarthy vs. Dulles Obwohl die CIA von der allgemeinen Hysterie vor den Kommunisten vital profitierte, wurde ausgerechnet der Verschwörungstheoretiker und Schweralkoholiker Senator Joseph McCarthy für die CIA zu einer ernsthaften Bedrohung: Frustrierte CIA-Leute hatten ihren Dienst quittiert und McCarthy über die Missstände informiert. Der Senator forderte, die CIA nicht von der parlamentarischer Kontrolle auszunehmen und beschuldigte sie, kommunistisch unterwandert zu sein. Im Gegensatz zu den vielen Verleumdungen auf McCarthys berühmter Liste traf diese Anschuldigung tatsächlich zu, so etwa bei den zahlreichen im Ausland rekrutierten Doppelagenten. Dulles, der nichts so sehr befürchtete wie Untersuchungen seiner illegalen Aktivitäten, sabotierte das Verhören seiner Leute, ließ "Joe" in Gesellschaft wissen, dieser werde seine Leute nicht befragen und verwanzte McCarthys Büro. 2004 freigegeben Dokumenten zufolge spielte Dulles McCarthy Kuckuckseier zu und lancierte eine verdeckte Schmutzkampagne. Schließlich intrigierte er erfolgreich bei Vizepräsident Nixon. Dulles hatte die Unantastbarkeit der nun niemandem Rechenschaft schuldigen CIA durchgesetzt, was selbst ihm wohl gesonnene Journalisten deutlich kritisierten. Es sollte zwei Jahrzehnte dauern, bis es zu effizienten parlamentarischen Untersuchungsausschüssen kam – nach Dulles Tod. Chruschtschows Geheimrede Als Stalin 1953 eines offenbar natürlichen Todes starb, hatte Dulles mangels Agenten im Osten nicht die geringste Ahnung, wer nun mit welcher Agenda in Moskau die Macht übernehmen würde. Nachdem schließlich der neue Parteichef Nikita Chruschtschow im Kreml eine geheime Rede gehalten hatte, in welcher er den Stalinismus verurteilte, setzte Dulles alles daran, den Text zu bekommen. Richard Nixon und Nikita Chruschtschow. Foto: archives.gov Da die Russen im Spionagegeschäft zwei Jahrhunderte voraus waren, fehlten noch immer CIAQuellen. Der ungleich besser vernetzten israelischen Geheimdienst half aus. Dulles lancierte die Rede in der Presse, welche den Text vor deren Freigabe durch den Kreml druckte. Zum Erstaunen von Dulles dementierte der Kreml die Rede nicht, rügte aber Ungenauigkeiten. Dulles lancierte daraufhin gefälschte Versionen der Rede, welche Chruschtschow unglaubwürdig machen sollten. Nichts konnte der CIA schlimmeres passieren, als ihr Feindbild zu verlieren. Die von Dulles zur Unzeit veröffentlichte Rede hatte den für die CIA unerwarteten Effekt, dass sich Dissidenten etwa in Polen zu Unruhen ermuntert sahen, die von Anfang an keine Chance hatten und blutig beendet wurden. Chruschtschow betrachtete Dulles langfristig als seinen direkten Gegenspieler und schlug ihm einmal lakonisch vor, man könne sich doch die Spione teilen, dann müsse man sie nur einmal bezahlen. Out of Control Der Air Force Colonel Jim Kellys, Gründungsmitglied der CIA, sandte an Eisenhower einen Bericht über die Zustände in der CIA. So hatte Kellys herausgefunden, dass ein 1948 angeblich von Kommunisten ermordeter CBS-Reporter tatsächlich von rechtsgerichteten Kräften aus dem CIA-Umfeld umgebracht worden war. Nachdem Kellis Eisenhower u.a. vom ganzen Ausmaß des Debakels mit WIN unterrichtet hatte, ließ der Präsident einen General eine Untersuchung durchführen. Viele CIA-Stationschefs hielten Dulles antikommunistischen Feldzug für zu emotional und beklagten die Verhältnisse in der nahezu unkontrollierten Organisation. Dulles gelang es, den vernichtenden Report geheim zu halten, sogar vor Wisner. Parlamentarische Untersuchungskommissionen schüchterte er stets mit "Let's not have another Pearl Harbour" ein – obwohl sein Spionageapparat in Moskau nicht einen einzigen wertvollen Agenten hatte, der nicht sofort aufgeflogen war. Eisenhower selbst sandte drei Vertrauensleute, welche die CIA gründlich untersuchen sollten. Da Dulles nach dem "need to know" Prinzip verfuhr, vermochte er die verdeckten Operationen weitgehend geheim zu halten. Doppelter Boden Dulles benötigte dringend Erfolge und setzte nun zunehmend auf technische Aufklärung. Bereits seit 1949 hatten die Briten in Wien unter der russischen Botschaft einen geheimen Tunnel gegraben ("Operation Silver"), um die Telefonleitungen anzuzapfen. Die westlichen Geheimdienste waren von den gewonnenen Erkenntnissen ebenso beeindruckt wie das KGB, dem der Doppelagent George Blake dieselben umgehend geliefert hatte. In Berlin wollte man einen ähnlichen Coup landen, in dem man gemeinsam mit den Amerikanern einen Tunnel unter einen im Ostsektor befindlichen Telefonknotenpunkt grub. Diese von Dulles genehmigte und von dem Alkoholiker William K. Harvey durchgeführte "Operation Gold" beanspruchte ein Höchstmaß an Tarnung, um die Bauarbeiten zu kaschieren. Die zahlreichen Auswerter eingerechnet, beschäftigte das Projekt 350 Mitarbeiter. Aufgrund des von der Abhörelektronik erwärmten Bodens hätte der über dem Tunnel geschmolzene Schnee beinahe die Aktion enttarnt. Dies wäre jedoch nicht erforderlich gewesen, denn auch diesen Tunnel hatte Blake vor dem ersten Spatenstich verraten. Im Rahmen einer perfekt inszenierten Propaganda-Kampagne wurde der Tunnel nach 11 Monaten 1956 schließlich "zufällig bei Wartungsarbeiten gefunden" und zeitlich geschickt von Chruschtschow der Weltöffentlichkeit präsentiert, wobei der Desinformationsexperte aus taktischen Gründen die britische Beteiligung verschwieg und einzig der CIA diesen klaren Bruch Völkerrechts anlastete. (Das Tunnelbauen konnten die Amerikaner auch Jahrzehnte später nicht lassen.) Darüber, warum das KGB die Abhöraktion so lange gewähren ließ und dabei den Verlust wertvoller Geheimnisse in Kauf nahm, ist viel spekuliert worden. Während oft vermutet wurde, das KGB habe die CIA mit Desinformation gefüttert und aufgrund der Vielzahl an Informationen die Auswertung blockiert, vertreten manche Historiker die Auffassung, man habe den antikommunistischen Verschwörungstheoretikern auf dieses Weise ein realistisches Bild der Sowjetunion aus erster Hand angeboten. Die CIA fand nicht den geringsten Hinweis auf einen sowjetischen Angriffskrieg. Dies hinderte Dulles jedoch nicht, weiterhin deren Kampfkraft und Angriffslustigkeit maßlos zu übertreiben. Von der Furcht vor dem Fulda Gap profitierte vor allem die Rüstungsindustrie. U2 Unter größter Geheimhaltung, insbesondere innerhalb der CIA, ließ Dulles zeitgleich zur Tunnelmission allerhand Fluggeräte für die Luftspionage über der Sowjetunion konstruieren. Bereits seit Kriegsende hatten die USA völkerrechtswidrig systematisch sowjetischen Luftraum überflogen. Schließlich wurde ein Höhenaufklärer namens U2 realisiert, der für die damalige sowjetische Luftabwehr unerreichbar war. In die Existenz der U2 waren im Weißen Haus nur sechs Personen eingeweiht worden. Die USA bestritten die Überflüge und taten sowjetische Beschwerden als Feindpropaganda ab. Chruschtschow bot den USA spöttisch an, ihnen soviel Luftbilder wie sie wollten zur Verfügung zu stellen. Ebenso wie der Spionagetunnel brachte die Luftauswertung keine Erkenntnisse über einen drohenden Angriffskrieg. Im Gegenteil hatten die Russen als Kriegsbeute Schienenstränge aus Ostdeutschland herausgerissen und nach Sibirien verfrachtet. Im Falle einer Invasion hätten der schienenbasierten Roten Armee erforderliche Versorgungslinien gefehlt. Japan Kishi Nobusuke (1956) Glück beim Nation-Building widerfuhr der CIA in Japan. Dort gelang es, den japanischen Politiker Kishi Nobusuke aufzubauen. Ausgerechnet der Mann, der die Kriegserklärung an die USA unterzeichnet und wegen Kriegsverbrechen inhaftiert gewesen war, wurde der erfolgreichste japanische CIA-Agent: Kishi bekleidete Ende der 50er Jahre zweimal das Amt des Regierungschefs. Bis 1970 finanzierte die CIA die japanische Regierungspartei. Ungarn Als es 1956 in Ungarn zu Unruhen kam, trat Dulles' Radio Free Europe RFE auf den Plan. Wie erst etliche Jahrzehnte später freigegebene Protokolle beweisen, ermutigte RFE die Aufständischen vor und während der Revolte und verbreitete, der Aufstand werde von 80% der Bevölkerung getragen. RFE erklärte die Handhabung von Molotow-Cocktails und versprach Waffen sowie militärischen Beistand. Tatsächlich aber hatten die USA nicht die Absicht, einzugreifen. Moskau fügte sich in das von den Dulles-Brüdern gezeichnete Bild des machtgierigen Aggressors und beendeten den Aufstand mit Panzern. Das Vertrauen der Ungarn in die CIA-Propaganda kostete über 3.000 Menschen das Leben. In 75 Tage um die Welt 1956 unternahm Dulles mit seiner Frau eine ausgedehnte Weltreise, die als "bekannteste Geheimmission" CIA-Geschichte schrieb. Mit einem CIA-Flieger besuchte er allerhand Länder, wo der mächtige Mann wie ein Staatsoberhaupt empfangen wurde. Waren normale Spione im Allgemeinen eher für Diskretion bekannt, so liebte der verhinderte Außenminister Allen Dulles seine Präsenz in den Medien. Statt die CIA-Zentrale zu tarnen setzte Dulles gegen interne Widerstände sogar Hinweisschilder durch. Seine CIA sollte Glanz und patriotischen Stolz versprühen. Ägypten Der zunächst kooperative Nasser hatte in Ägypten CIA-Bestechungsgelder u.a. in den Bau eines Minaretts investiert, das er gegenüber dem Nil Hilton platzierte. Nachdem Nasser den Suezkanal verstaatlicht hatte, stellte sich der britische Geheimdienst eine Lizenz zum Töten Nassers aus. Dulles wollte Nassers Zigaretten vergiften. Eisenhower hingegen favorisierte eine langfristige Kampagne gegen Nasser, zumal dieser mit der Sowjetunion sprach. Ohne das geringste von der CIA vernommene Anzeichen griff eine britisch-französisch-israelische Allianz Ägypten an. Nicht einmal über die Pläne befreundeter Nationen vermochte Spionageromantiker Dulles seinen verdutzten Präsidenten zu informieren. Syrien In Syrien hatte die CIA 1949 einen Staatschef eingesetzt, dessen sich die Ba'th-Partei und die kommunistischen Partei vier Jahre später entledigten. 2003 bekannt gewordene Dokumente des damaligen britischen Verteidigungsministers belegen detailliert, wie die CIA und das britische SIS 1957 versuchten, Syrien als "Sponsor von Terrorismus" zu diskreditieren, indem sie "national conspiracies" und "strong armed activities" in Jordanien, Libanon und Irak verübten, die einer syrischen Moslemischen Bruderschaft angelastet werden sollten. Der Anschein von Instabilität sollte die Stabilität schwächen. Ein als Diplomat akkreditierter CIA-Mann versuchte, syrische Offiziere zu kaufen. Der auf der Todesliste stehende syrische Geheimdienstchef war der CIA jedoch einen Schritt voraus. Die Offiziere nahmen das Geld freundlich an und präsentierten den Anwerbeversuch im Fernsehen. Irak Auch beim irakischen Staatschef Abd al-Karim Qasim, der 1958 gegen das pro-britische irakische Königshaus geputscht hatte, konnte Dulles nicht ausschließen, dass dieser eines Tages dem Kommunismus huldigen würde. Um ihm diese Versuchung zu ersparen, versuchte er erfolglos, Qasim ein mit Sporen verseuchtes Taschentuch aus der MK Ultra-Giftküche zuzuspielen. Schließlich vergab die CIA den Mordauftrag an externe Fachleute der Ba'th-Partei, die das Vorhaben nach mehreren Anläufen jedoch erst 1963 auszuführen vermochten. Einer der 1958 geworbenen CIAMordagenten sollte es 1979 zum Staatschef bringen, bis ihm die USA seine Position 2003 wieder entrissen. Indonesien Selbst Vizepräsident Nixon hatte gegenüber der CIA konstatiert, dass der indonesische Präsident Sukarno kein Kommunist war – genauso wenig wie Mossadegh oder Abenz. Da Sukarno jedoch gegenüber Moskau und Washington gleichermaßen Neutralität wahren wollte und Indonesien über beachtliche Erdölvorkommen verfügte, erkannte Dulles eine nicht zu tolerable Anfälligkeit für Kommunismus. Im örtlichen Leiter der CIA-Station, einem Kolonialisten und Alkoholiker, fand Dulles wieder einen geeigneten Verschwörungstheoretiker, der die gewünschten Einschätzungen lieferte. Hinzu kam, dass sich die blockfreien Staaten 1955 in einer Konferenz anschickten, miteinander zu kooperieren. Dem National Security Council, der derartigen "Kommunismus" nicht dulden konnte, gab Dulles in 2003 veröffentlichten Dokumenten eine Card Blanche. Obwohl die CIA Sukarnos politischen Gegner finanzierte, gewann Sukarno die folgende Wahl haushoch, während etwa die indonesischen Kommunisten nur geringe Erfolge erzielten. Obwohl der US-Botschafter die CIA darüber informierte, dass das indonesische Militär loyal hinter Sukarno stand, beschlossen die Dulles-Brüder, die "kommunistische Bedrohung" durch den Aufbau einer "Revolutionsarmee" zu beenden. Obwohl die Pläne an die Öffentlichkeit gelangt waren, schmuggelte die CIA 1958 Waffen ein. Sukarnos antikommunistisch eingestellten Offiziere, die zuvor selbst in den USA ausgebildet worden waren und sich als "Söhne Eisenhowers" bezeichnet hatten, entdeckten und bombardierten Eisenhowers CIA-Armee. Ein "Sohn Eisenhowers" erhielt sogar von einem nicht über den Geheimkrieg informierten US-Major auf Anfrage benötigte Landkarten. Da die "Rebellen" dringend militärische Unterstützung benötigten, die Operation von den USA jedoch plausibel abzuleugnen sein musste, sandte Dulles polnische Bomberpiloten, die seit den Albanienmissionen für die CIA flogen. Durch die dann tatsächlich abgeschossenen Piloten wurden die USA auf diese Weise nicht kompromittiert. Entgegen Eisenhowers ausdrücklichem Befehl setzte Dulles dennoch einige US-Kampfpiloten ein, die die Schiffe versenkten. Der amerikanische Pilot Al Pope wurde abgeschossen und stand inklusive seiner geborgenen Einsatzpläne als lebender Zeuge für die Machenschaften der USA zur Verfügung. (Als sich der spätere Diktator Sukarno der Sowjetunion annäherte, sollte die CIA 1967 eine zweite Chance bekommen.) Dulles hatte seinen Chef erneut gründlich blamiert. Ein ähnlich peinlicher Absturz sollte sich bald wiederholen – unter ungleich delikateren Bedingungen. Trotz Kritik konnte Dulles sich und die Zuständigkeit für verdeckte Aktionen halten. Der inzwischen depressiv gewordene Wisner wurde gegen den Leiter des U2-Programms, Richard Bissell, ausgetauscht. Als Außenminister John Foster Dulles 1959 verstarb, schmälerte dies den politischen Einfluss des kleineren Bruders empfindlich. Dieser adaptierte die Rolle des harten Antikommunisten nun erst recht. Kongo Auch im Kongo hatte 1960 ein Politiker geglaubt, ein an Bodenschätzen reiches Land ohne den Bündnispartner USA selbstbestimmt regieren zu dürfen. Patrice Lumumba, der sich ebenfalls nie als Kommunist gesehen hatte, schickte sich an, ein afrikanischer Fidel Castro zu werden, zumal er mit Moskau sprach. Selbst nach einem Staatsstreich unter CIA-Protektion schien der Gestürzte noch mächtig zu sein. Um sicher zu gehen, dass Lumumba nicht dem Kommunismus anheim fiel, schlug Pastorensohn Dulles dem Präsidenten und dem inzwischen eingerichteten Watchdog-Komitee die Liquidierung vor, welche verklausuliert akzeptiert wurde. Dulles wies seinen Giftmischer Sydney Gottlieb aus dem MK Ultra-Programm an, Lumumbas Ermordung vorzubereiten. Der Name der Operation "Wizard" (Zauberer) schien auf Mulholland anzuspielen. Die CIA versuchte erfolglos, diverse mit Kontaktgiften kontaminierte Gegenstände wie Zahncreme, Frühstück, Kondome usw. zu lancieren. Die Tricks erwiesen sich nicht als praxistauglich. Lumumba wurde schließlich von seinen politischen Gegnern im Beisein von CIA-Leuten ermordet und die Leiche in Säure aufgelöst. Dominikanische Republik Der US-freundliche Diktator Rafael Trujillo hatte sich zwar als zuverlässiger CIA-Partner erwiesen, war jedoch wegen massiver Menschenrechtsverstöße und einem Attentat auf den venezolanischen Präsidenten nicht mehr tragbar gewesen. Bevor jemand anderes auf die Idee eines Putsches kommen konnte, besorgte dies die CIA. Daraufhin wurden Waffen zunächst an die US-Botschaft geliefert. Einige hatten jedoch Bedenken, wie die Reaktion bei Bekannt werden amerikanischer Beteiligung ausfallen würde. Bis heute ist unklar, mit wessen Gewehren Trujillo zwei Wochen später sein Ende fand. Sowjetunion Nach Annäherung mit Chruschtschow in Camp David wollte Eisenhower das Klima vor dem bevorstehenden Pariser Friedensgipfel nicht durch weitere Flüge der U2 gefährden. Der Leiter des Programms, Richard Bissell, wollte zunächst auf ausländische Spionagepiloten zurückgreifen. Schließlich ignorierte er einfach das Ansinnen und ließ ohne Wissen von Dulles die U2 sogar Moskau überfliegen. Für den Fall eines Absturzes über Feindgebiet hatten die U2-Piloten den Befehl, sich selbst zu töten. Als Cover-Story sollte die U2 als wissenschaftliches Forschungsflugzeug der NASA ausgegeben werden. Als 1960 eine U2 vermisst wurde, versicherte Dulles dem Präsidenten, der Pilot könne aus dieser Höhe einen Absturz unmöglich überlebt haben. Eisenhower reiste Tage später zum Friedensgipfel nach Paris, wo er das angebliche Spionageflugzeug ableugnete. Die Blamage war perfekt, als der abgeschossene Pilot Gary Powers lebend nebst geborgenen Einsatzplänen präsentiert wurde. Chruschtschow ließ den Gipfel platzen. Militärisch-Industrieller Komplex Die Erkenntnisse von Dulles Spionageagentur über die Sowjetunion hielten sich in überschaubaren Grenzen. So schätzte die CIA 1960 die Anzahl der auf die USA gerichteten sowjetischen Atomraketen auf 500 Stück. Tatsächlich waren es vier. Im Januar 1961 hielt jemand im amerikanischen Fernsehen eine merkwürdige Rede. Er warnte die Nation vor einem militärisch-industriellen Komplex und einem unheilvollen Anwachsen unbefugter Macht, welche die demokratischen Prozesse gefährde. Der Redner war nicht etwa ein kommunistischer Verschwörungstheoretiker – er war der scheidende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. http://www.heise.de 2020 soll in jedem Haushalt Koreas mindestens ein Roboter sein Florian Rötzer 04.11.2005 Korea will mit der Robotik weltweit an die Spitze kommen und setzt auf intelligente, aber preisgünstige Netzwerkroboter Südkorea will mit großem Elan zu einem der Länder werden, die in der Entwicklung von Hightech ganz vorne stehen. Schon jetzt hat das Land die höchste Internetdichte. 12 von 15 Millionen Haushalte haben einen Breitbandzugang. Mit der neuen Stadt Songdo City, einer "ubiquitous city" für 65.000 Bewohner, die bis 2014 fertig gestellt sein soll, soll die Vernetzung und Computerisierung mitsamt einer umfassenden Verwendung von RFID-Chips so weit wie möglich vorangetrieben werden. Bedenken wegen des Schwindens der Privatstphäre hat man hier sehr viel weniger als im Westen. Nicht nur in der Biotechnologie, was beispielsweise das Klonen und die Forschung mit Stammzellen anbelangt, ist Südkorea vorne dran, sondern mit aller Macht will man auch in der Robotertechnologie an der Spitze stehen. Hier wird ein großer Markt erwartet, wenn Roboter in die alltägliche Lebenswelt eindringen. Südkorea ist wie auch Japan ein Roboter freundliches Land, das zumindest bislang wenig Probleme mit dem künstlichen Leben hat. Gerade hatte in Südkorea wieder einmal die Roboterolympiade stattgefunden, die hier Mitte der neunziger Jahre von Kim Jong-hwan, Professor am Korea Advanced Institute of Science and Technology, entwickelt wurde (Von Ubibots und Sobots). Ähnlich wie beim RoboCup treten hier Roboter gegeneinander an, um in bestimmten Disziplinen wie Tanzen, Treppen Steigen, Basketball, Boxen, Gewichtheben oder Klettern über Hindernisse die erfolgreichsten Entwicklungen zu zeigen. Gefördert werden sollen vor allem Schüler und Studenten, die ihre neuesten Erfindungen vorführen können, um so das technische Interesse und Innovationen zu fördern. Informations- und Kommunikationsminister stellt die netzwerkbasierten Roboter vor. Bild: MIC Das Informations- und Kommunikationsministerium fördert massiv die Entwicklung von Robotern, beispielsweise auch netzwerkbasierte Roboter, die das gut ausgebaute Breitbandnetz nutzen. Man will den globalen Markt mit relativ billigen Haushaltsrobotern erobern. Um nicht alle Funktionen in den Roboter selbst implementieren zu müssen, was diese teurer und inflexibel machen würde, setzte man auf netzwerkbasierte Roboter, bei denen der größte Teil der Datenverarbeitung über die Anbindung an das Internet, also über Outsourcing an Supercomputer geschieht . Und natürlich werden diese intelligenten Roboter, die abgesehen von der Motorik ihre Kapazitäten und ihre Software on demand über das Breitbandnetzwerk beziehen, wie die geplante Stadt im Rahmen eines Projekts mit dem Namen "ubiquitous robotic companion" (URC) gefördert. Anforderungen an automatisierte IPAM Umgebungen So können Sie die Kosten und Ausfallzeiten in großen IP-Netzwerken mit IPAM reduzieren. Über die Schwachstellen des konventionellen IPAM und die Vorzüge eines automatischen IPAM-Systems. Information Governance: Compliance, eDiscovery und Sicherheit im Enterprise-Umfeld Wie Unternehmen eine ordnungsgemäße Information Governance realisieren und wie sie sich auf die Bereiche Compliance, elektronische Beweissicherung und Datenschutz auswirkt. IBM-Strategie für eine dynamische Infrastruktur Warum dynamische Infrastrukturen Unternehmen erfolgreicher und flexibler machen können. Damit sind sie den geschäftlichen Anforderungen gewachsen. Entwickelt wurden bislang fünf verschiedene Prototypen, die alle mit Rädern ausgestattet sind und nun in 64 Haushalten und zwei Büros einen Test unterzogen werden sollen. Die drei Prototypen zwischen einem Meter und 50 cm Größe sollen kranke und behinderte Menschen unterstützen, manche Haushaltsarbeiten ausführen oder zur Betreuung von Kindern dienen, denen sie beispielsweise etwas vorlesen. Sie sie sind ständig online, können auch teilweise ihre Batterien wieder aufladen und so wichtige Tätigkeiten wie eine Pizza-Bestellung ausführen. Mit zwei weiteren Prototypen soll deren Einsatz bei Post oder Banken erkundet werden. Gefördert werden zudem Roboter, die autonom handeln, sich den Menschen anpassen und in Interaktion mit diesen lernen können (Trennung von Gehirn und Körper). Bis 2015 will man einen URCRoboter mit Selbstbewusstsein entwickelt haben. Allerdings sind netzwerkbasierte Roboter auch besonders riskant. Sie können bei Netzproblemen ausfallen oder in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigt werden, sie können aber auch das Ziel von Viren oder Hackern werden. Die drei Internetroboter für die Privathaushalte sollen, wie der koreanische Informations- und Kommunikationsminister ankündigte, ab Ende des nächsten Jahres mit einem Preis zwischen 1000 und 2000 US-Dollar auf den Markt kommen. Verbunden werden sie mit dem Internet über WLAN sein. Man hoffe, so Minister Chin, dass mit Massenfertigung der Preis noch unter 1000 Dollar sinken werde. Bis 2011 will man drei Millionen von diesen Robotern in Korea verkauft haben. 2020 soll dann jeder Haushalt in Korea mindestens einen Roboter besitzen. "Gestützt auf die Netzwerkroboter", so Chin optimistisch, "kämpfen wir darum, bis 2010 einer der drei weltweit führenden Roboterproduzenten zu werden". Das werde dann nach Chin einen Geldsegen für Korea bringen, um 2015 soll nämlich der Markt für Roboter weltweit jährlich 300 Milliarden Dollar betragen. http://www.heise.de Rock for Kim Jong-il Ernst Corinth 06.12.2006 Nordkorea ruft die Rocker der Welt No Sex, No Drugs, No Rock 'n' Roll – das bestimmte bisher, zumindest offiziell, das Leben der nordkoreanischen Jugend. Doch das soll sich nun ändern. Im März des kommenden Jahres soll in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein Musikfestival veranstaltet werden unter dem Namen "Rock for Peace", obwohl vermutlich "Rock for Kim Jong-il" besser, weil ehrlicher wäre. Eingeladen dazu sind alle Rockgruppen dieser Welt, die allerdings die Reisekosten selber tragen müssen. Und die bei ihren Auftritten darauf achten müssen, dass ihre Liedtexte nicht gegen bestimmte Vorgaben verstoßen. Unerwünscht sind Texte, die sich positiv äußern über Sex, Gewalt, Drogen, den Krieg, den Kolonialismus, den Imperialismus, den Rassismus. Und natürlich darf in den Liedern weder Nordkorea oder gar der Sozialismus irgendwie kritisiert werden. Aber gegen Atombomben darf offenbar musikalisch demonstriert werden. Kurzum: No Sex, No Drugs, But Rock 'n' Roll – eine völlig verrückte Idee! Jean-Baptiste Kim. Foto: Voce of Korea Veranstalter dieses Festivals, bei dem zum ersten Mal in Nordkorea westliche Pop- und Rockgruppen auftreten würden, sind die Betreiber der englischen Seite Voice of Korea – allen voran der in London lebende Jean-Baptiste Kim, ein Franzose, der in Südkorea geboren wurde. Schon seit längerem versucht der Journalist und ehemalige Korrespondent der nordkoreanischen Tagezeitung Rodong Sinmun mit der Netzseite "Voice of Korea" und verschiedenen Aktionen das miserable Image Nordkoreas in Europa ein wenig aufzupolieren. Und dazu gehört eben auch eine solch spektakuläre Veranstaltung wie das geplante Rockfestival mit einer Musik, die bisher in Nordkorea als dekadent bezeichnet wurde. Mit Dekadenz soll sich ja der selbsternannte Führer des Landes Kim Jong-il, der ein luxuriöses Leben führen soll, sowieso bestens auskennen. Aber Rockmusiker sind ja hart im Nehmen. Und so sollen sich nach Angaben von Jean-Baptiste Kim bereits 54 Gruppen aus 20 Ländern bei ihm gemeldet haben. Und klammheimlich hoffen die Veranstalter sogar auf Auftritte von Stars wie Eric Clapton oder Lynyrd Skynyrd. Nicht dabei sein wird bei dem viertägigen Musikspektakel allerdings der ziemlich verrockt frisierte Kim Jong-il – aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Er werde aber das Konzert am Fernseher verfolgen – vermutlich mit einer Flasche edlen französischen Rotweins. http://www.monde-diplomatique.de/pm/2004/12/10/a0034.text 10.12.2004 Le Monde diplomatique DER VERNICHTUNGSFELDZUG DER US AIR FORCE Napalm über Nordkorea WÄHREND in den Augen von US-Präsident Bush Nordkorea mit seinem Atomwaffenprogramm zur "Achse des Bösen" gehört, hat sich Amerika wie selbstverständlich die Rolle des unschuldigen Riesen zu Eigen gemacht. Dabei waren es gerade die Vereinigten Staaten, die seit den 1940er-Jahren in Nordostasien immer wieder Massenvernichtungswaffen eingesetzt haben. In welchem Ausmaß die US Air Force Nordkorea zerstört hat, zeigt ein Blick in die Archive. Von BRUCE CUMINGS * University of Chicago (emer.); zuletzt: "North Korea. Another Country", New York (New Press) 2003. Der von 1950 bis 1953 dauernde Koreakrieg wird oft als der vergessene Krieg bezeichnet, aber man sollte wohl eher von einem unbekannten Krieg sprechen. Als Historiker, der über diesen Krieg geforscht hat, empfinde ich es immer noch als das eindrücklichste Faktum, wie verheerend die Wirkung der Luftangriffe war, mit denen die US Air Force damals Nordkorea überzog. Sie beschränkte sich nicht auf das großflächige Dauerbombardement mit Brandbomben, sondern drohte auch mit dem Einsatz atomarer und chemischer Waffen.(1) Noch in der Endphase des Krieges, von der weder unter Historikern noch in aktuellen Analysen kaum je die Rede ist, wurden die riesigen Staudämme Nordkoreas zerstört. Überhaupt wird der Koreakrieg im Rückblick lediglich als eine begrenzte militärische Auseinandersetzung wahrgenommen. Tatsächlich gleicht seine Durchführung aber dem Luftkrieg 1943-1945, der gegen das kaiserliche Japan geführt wurde – viele US-Befehlshaber im Koreakrieg waren noch dieselben wie im Krieg gegen Japan. Während aber die Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki vom 6. und 9. August 1945 mittlerweile aus ganz verschiedenen Perspektiven untersucht wurden, haben die Brandbombenangriffe auf japanische und koreanische Städte weit weniger Beachtung gefunden. Und noch weniger bekannt ist, dass die USA auch noch nach dem Koreakrieg in Nordostasien auf ihre überlegene Luftwaffe und auf Nuklearwaffen setzten. Damit haben sie die politischen Optionen Nordkoreas definiert und die nationale Sicherheitsstrategie Pjöngjangs beeinflusst. Napalm – eine brennbare gelatinöse Masse, die zu 33 Prozent aus Benzin, zu 21 Prozent aus Benzol und zu 46 Prozent aus Polystyren besteht – wurde schon 1942 an der Harvard-Universität entwickelt. Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Napalmbomben erstmals über japanischen Städten abgeworfen. Erst dreißig Jahre später, während des Vietnamkriegs, wurde Napalm für die Öffentlichkeit zum Begriff – als das Foto des späteren Pulitzerpreisträgers Nick Ut, der bei dem Napalmangriff auf Trang Bang in Nordvietnam vom 8. Juni 1972 dabei gewesen war, um die Welt ging: Die neunjährige, nackte Phan Thi Kim Phuc und andere Kinder laufen weinend auf den Fotografen (und Betrachter) zu. Im Bildhintergrund sieht man das Land in Flammen aufgehen. In Korea wurden viel mehr Napalmbomben abgeworfen als in Vietnam, und ihre Wirkung war verheerender, weil es in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK) mehr Ballungszentren mit einer größeren Bevölkerungsdichte und mehr innerstädtische Industrieanlagen gab als in Nordvietnam. 2003 – auf einer Konferenz mit US-Veteranen – meldete sich ein US-Soldat zu Wort, der beim Kampf um den Changjin-Staudamm ein Auge verloren hatte. Napalm sei bestimmt eine scheußliche Waffe gewesen, aber sie habe "die richtigen Leute" getroffen, so sein nüchterner Kommentar. Natürlich gab es auch Opfer im Friendly Fire, an die sich ein Überlebender erinnert: "Um mich herum hatte das Napalm die Männer verbrannt. Sie wälzten sich im Schnee. Männer, die ich kannte, mit denen ich marschiert war und gekämpft hatte, flehten mich an, sie zu erschießen. Es war grauenhaft. Die verbrannte Haut pellte sich augenblicklich ab, vom Gesicht, von den Armen und Beinen."(2) Im Februar 1951 wurde der New-York-Times-Reporter George Barrett in einem Dorf nördlich von Anyang in Südkorea Zeuge einer Szene, die er später als "makabres Sinnbild für die Totalität des modernen Krieges" bezeichnete: "Im Dorf und auf den Feldern waren die Dorfbewohner getroffen und getötet worden, und alle waren in der Bewegung erstarrt, die sie ausführten, als sie der Napalmangriff traf: Ein Mann stieg gerade auf sein Fahrrad, in einem Waisenhaus spielten fünfzig Jungen und Mädchen, eine Hausfrau, der man merkwürdig wenig ansah, hielt eine aus dem Sears-Roebuck-Katalog herausgerissene verkohlte Seite in der Hand, auf der sie den Artikel Nr. 3 811 294 angekreuzt hatte, eine ,bezaubernde rosa Bettjacke' für 2,98 Dollar." Außenminister Dean Acheson ordnete damals an, derartige Sensationsberichte seien den Zensurbehörden zu melden – um ihre Veröffentlichung zu verhindern.(3) Einer der ersten Befehle zum Niederbrennen von Städten und Dörfern, die ich in den Archiven fand, datiert vom August 1950, als in der Umgebung von Pusan, im äußersten Südosten Koreas, heftig gekämpft wurde. Am 6. August beantragte ein Offizier der US-Armee bei seiner Luftwaffe, "die folgenden Städte auszulöschen: Chongsong, Chinbo und Kusu-dong". Damals wurden auch Langstreckenbomber vom Typ B-29 angefordert, die taktische Ziele angreifen sollten. Am 16. August bombardierten fünf B-29-Geschwader ein Gebiet in Frontnähe, in dem viele Städte und Dörfer lagen, die unter hunderten von Tonnen Napalm in einem Flammenmeer zerstört wurden. Ein weiterer derartiger Angriff folgte am 20. August. Und am 26. August meldete die Luftwaffeneinheit: "Elf Dörfer in Brand gesetzt".(4) Zwar hatten die Piloten Anweisung, ihre Ziele nur auf Sicht anzufliegen, damit keine Zivilisten getroffen werden, aber häufig bombardierten sie größere Bevölkerungszentren nur mit Hilfe von Radarbildern, oder sie warfen riesige Mengen von Napalm auf "Zweitziele" ab, wenn sie ihr Erstziel nicht erreichen konnten. Bei einem großen Luftangriff auf die Industriestadt Hungnam am 31. Juli 1950 wurden 500 Tonnen Sprengstoff durch eine geschlossene Wolkendecke abgeworfen, also nur durch Radar gelenkt. Sie erzeugten eine Flammenwand, die bis zu hundert Meter in die Höhe schoss. Allein am 12. August 1950 warf die US Air Force über Nordkorea eine Bombenlast von 625 Tonnen ab. Ende August waren es pro Tag bereits 800 Tonnen, ein Großteil davon reines Napalm.(5) Zwischen Juni und Ende Oktober 1950 warf die B-29-Bomberflotte über Korea insgesamt 866 914 Gallonen (3 281 270 Liter) Napalm ab. Vertreter der Luftwaffe waren begeistert von den Eigenschaften der relativ neuen Waffe. Man witzelte über die Proteste der kommunistischen Seite, und der Presse servierte man die Lüge vom Präzisionsbombardement. So ließ man auch gern verkünden, dass die Zivilbevölkerung außerdem durch Flugblätter über anfliegende Bomber im Vorfeld informiert werde. Ein wie sinnloses Unterfangen das war, wussten die Piloten.(6) Auf den Kriegseintritt Chinas folgte die Zerstörung der meisten großen und kleineren Städte in Nordkorea. Anfang November 1950 befahl US-Oberbefehlshaber General MacArthur, tausende Quadratki- lometer nordkoreanisches Territorium aus der Luft zu zerstören und dadurch eine Art verbrannte Zone zwischen der chinesischen Grenze und der militärischen Front zu schaffen. Wie der gut informierte britische Militärattaché damals aus MacArthurs Hauptquartier berichtete, ordnete dieser an, "alle Kommunikations- und Versorgungseinrichtungen und alle Fabriken und Städte und Dörfer zu zerstören". Das Bombardement sollte an der Grenze zur Mandschurei beginnen und dann Richtung Süden fortgeführt werden. Nur die Stadt Najin an der sowjetischen Grenze und die Staudämme am YaluFluss wollte man verschonen, um Moskau und Peking nicht zu sehr zu provozieren. Am 8. November 1950 warfen 79 B-29-Bomber über Sinuiju 550 Tonnen Brandbomben ab, die Stadt wurde "ausradiert". Eine Woche später ließ man Napalm auf Hoeryong niederregnen, um die Stadt "restlos niederzubrennen". Bis zum 25. November standen weite Teile der Nordwestregion zwischen dem Yalu und den feindlichen Linien im Süden in Flammen. Wenn es so weitergehe, hieß es in dem britischen Bericht, werde die Region bald zu einer "Wildnis aus verbrannter Erde".(7) Das alles geschah noch vor der großen chinesisch-nordkoreanischen Offensive, mit der die UNStreitkräfte aus dem Norden Koreas gedrängt wurden. Gleich nach Beginn dieser Offensive ließ die US-Luftwaffe am 14. und 15. Dezember 1950 die Hauptstadt Pjöngjang mit 700 Fünfzentnerbomben angreifen. Die Mustang-Kampfflugzeuge hatten nicht nur Napalm geladen, sondern auch 175 Tonnen Sprengbomben mit Verzögerungszündern – sie explodierten erst in dem Moment, als die Menschen versuchten, die Toten aus den Napalmbränden zu bergen. Anfang Januar befahl der Chef der 8. USArmee, Matthew Ridgway, eine neue Angriffswelle auf Pjöngjang zu starten, "mit dem Ziel, die Stadt mit Brandbomben in Schutt und Asche zu legen" – was dann auch nach zwei Luftangriffen geschah. Als sich die US-Streitkräfte hinter den 38. Breitengrad zurückzogen, wurde die Verbrannte-ErdeStrategie fortgesetzt: Uijongbu, Wonju und andere kleine Städte im Süden wurden "abgefackelt", sobald ihnen der Feind näher rückte.(8) Die US-Luftwaffe versuchte auch, die politische Führung Nordkoreas auszuschalten. Kim Il Sung und seine engsten Vertrauten hatten sich während des eisigen Winters 1950/51 in den Tiefbunkern von Kanggye in der Nähe der mandschurischen Grenze regelrecht eingegraben. Als die Amerikaner sich nach der Landung bei Inch-on drei Monate lang vergeblich bemüht hatten, die nordkoreanische Führung aufzuspüren, warfen B-29-Bomber so genannte Tarzanbomben auf Kanggye ab – gewaltige, neu entwickelte 12 000-Pfund-Bomben, die hier erstmals zum Einsatz kamen.(9) Eine noch stärkere Bombe gab es erst wieder 2003 im Irakkrieg: die berühmte "Mutter aller Bomben" mit einem Gewicht von 21 500 Pfund und einer Explosivkraft von 18 000 Pfund TNT.(10) Am 9. Juli 1950, zwei Wochen nach Kriegsbeginn, sandte General MacArthur eine "dringende Botschaft" an General Ridgway, die den Vereinigten Generalstab veranlasste, "zu überlegen, ob MacArthur nicht Atombomben zur Verfügung gestellt werden sollten". Der Operationschef General Charles Bolte wurde aufgefordert, mit MacArthur den Einsatz von Atombomben als "direkte Unterstützung von Bodentruppen" zu erörtern. Bolte ging damals davon aus, dass man zehn bis zwanzig dieser Bomben für den koreanischen Kriegsschauplatz abzweigen könne, ohne die Fähigkeit der USA zu globaler Kriegführung "über Gebühr" zu gefährden. MacArthur machte Bolte zunächst den Vorschlag, Atomwaffen zu taktischen Zwecken einzusetzen, die unter anderem darauf hinausliefen, den Norden Koreas zu besetzen, um bei einer potenziellen Intervention chinesischer und sowjetischer Truppen diesen auf nordkoreanischem Boden den Rückzug abzuschneiden. MacArthur wörtlich: "Korea ist in meinen Augen eine Sackgasse. Die einzigen Straßen, die von der Mandschurei und Wladiwostok nach Korea führen, laufen über viele Tunnel und Brücken. Hier sehe ich eine einmalige Einsatzchance für die Atombombe, denn damit könnte man diese Strecke blockieren; die Reparatur würde sechs Monate dauern. Und meine B-29-Flotte kann sich erholen." Zu diesem Zeitpunkt lehnte der Vereinigte Generalstab den Einsatz der Atombombe jedoch aus drei Gründen ab: Erstens gab es keine Ziele, die für Nuklearwaffen groß genug gewesen wären; zweitens war nicht absehbar, wie die Weltöffentlichkeit darauf reagieren würde – nur fünf Jahre nach Hiroshima; drittens gingen die obersten Militärs davon aus, dass ein Sieg auch mit konventionellen militärischen Mitteln noch zu erreichen sei.(11) Dieses letzte Kalkül stellte sich jedoch als Fehleinschätzung heraus, als im Oktober und November 1950 große chinesische Truppenverbände in den Krieg eingriffen. Als Präsident Truman auf seiner berühmten Pressekonferenz vom 30. November damit drohte, die USA würden womöglich sämtliche Waffen ihres Arsenals zum Einsatz bringen, war klar, was gemeint war.(12) Die Drohung war nicht etwa ein Fauxpas, wie damals weithin angenommen, sie beruhte vielmehr auf einem Plan, der den Einsatz der Atombombe als letzte Eventualität vorsah. Am selben Tag schickte Luftwaffengeneral Stratemeyer an General Hoyt Vandenberg den Befehl, er solle das Strategic Air Command (SAC) anweisen, sich in Bereitschaft zu halten, "unverzüglich Bomben mittleren Kalibers in den Fernen Osten zu entsenden – diese Aufstockung (des Arsenals) sollte auch atomare Waffen einbeziehen". Der Chef des SAC, General Curtis LeMay, hatte allerdings richtig in Erin- nerung, dass der Vereinigte Generalstab zuvor der Ansicht gewesen war, Atomwaffen seien in Korea wahrscheinlich nicht von Nutzen, es sei denn als Teil eines "umfassenden atomaren Feldzugs gegen Rotchina". Sollte sich diese Order nun ändern, weil chinesische Truppen eingegriffen hatten, dann wolle LeMay das Kommando übernehmen: Er teilte Stratemeyer mit, das SAC-Hauptquartier sei das einzige, das über die Erfahrung und technische Ausbildung wie auch über "intime Kenntnisse" hinsichtlich der Trägerwaffen verfüge. Der Mann, der im März 1945 den Abwurf von Feuerbomben auf Tokio befehligt und 1948 die Luftbrücke nach Westberlin organisiert hatte, war jetzt erneut bereit, das Kommando über die Bomberangriffe im Fernen Osten zu übernehmen.(13) Damals sorgte man sich kaum darüber, dass die Russen mit atomaren Waffen zurückschlagen könnten, weil die USA über mindestens 450 Bomben verfügten, die Sowjetunion aber nur 25 Bomben hatte. Am 9. Dezember 1950 erklärte MacArthur, jedem Kommandeur auf dem koreanischen Kriegsschauplatz sei es freigestellt, Atomwaffen einzusetzen. Am 24. Dezember legte er eine Liste von Zielen vor, für die er 26 Atombomben einkalkulierte. Vier weitere wollte er auf die "Invasionstruppen" abwerfen, und noch einmal vier auf "bedrohliche Konzentrationspunkte der feindlichen Luftwaffe". In postum veröffentlichten Interviews behauptete MacArthur, einen Plan ausgearbeitet zu haben, mit dem er den Krieg innerhalb von zehn Tagen gewonnen hätte: "Ich hätte mehr als 30 Atombomben über das gesamte Grenzgebiet zur Mandschurei abgeworfen." Anschließend hätte er am Yalu, dem Grenzfluss zwischen Nordkorea und China, eine halbe Million nationalchinesischer Soldaten – die sich nach ihrer Niederlage 1949 aus dem kommunistischen China nach Taiwan abgesetzt hatten – eingesetzt und dann zwischen dem Japanischen und dem Gelben Meer einen mit radioaktivem Kobalt verseuchten Landgürtel geschaffen. Da Kobalt zwischen 60 und 120 Jahre aktiv bleibt, wäre dann "mindestens 60 Jahre lang keine Invasion über Land nach Südkorea von Norden aus möglich gewesen". MacArthur war überzeugt davon, dass die Russen angesichts dieser extremen Strategie nichts unternommen hätten: "Mein Plan war bombensicher."(14) Kobalt 60 hat eine 320-mal stärkere Radioaktivität als Radium. Eine 400-Tonnen-KobaltWasserstoffbombe könnte alles menschliche und tierische Leben auf der Erde auslöschen. In den zitierten Interviews wirkt MacArthur wie ein kriegsversessener Irrer, aber er ist nicht der Einzige, der diesen Eindruck hinterlässt. Schon vor der Offensive der Chinesen und Nordkoreaner waren die Mitglieder eines Ausschusses des Vereinigten Generalstabs zu der Meinung gekommen, Atombomben könnten der "entscheidende Faktor" sein, um einen chinesischen Einmarsch in Korea zu unterbinden: Mit ihrer Hilfe könne man einen Cordon sanitaire auf mandschurischem Gebiet, unmittelbar nördlich der Grenze zu Korea schaffen. Ein Strahlengürtel als Grenze DER demokratische Kongressabgeordnete Albert Gore, der später entschlossen gegen den Vietnamkrieg opponierte, klagte damals: "In Korea werden amerikanische Männer durch den Fleischwolf gedreht." Um dem Krieg ein Ende zu bereiten, schlug er vor, müsse man "etwas ganz Verheerendes" einsetzen, zum Beispiel den Landgürtel zwischen Nord und Süd verstrahlen, sodass die koreanische Halbinsel für immer in zwei Hälften geteilt sein würde. Und obwohl General Ridgway, nachdem er MacArthur als Kommandeur der US-Truppen in Korea abgelöst hatte, die Idee mit den Kobaltbomben nicht wieder aufgriff, wiederholte er im Mai 1951 die Forderung seines Vorgängers und verlangte jetzt 38 Atombomben. Die wurden allerdings nicht bewilligt. Anfang April 1951, also exakt in den Tagen, als MacArthur von Truman entlassen wurde, standen die USA kurz davor, doch atomare Waffen einzusetzen. Obwohl viele diesbezügliche Informationen noch immer unter Verschluss sind, ist mittlerweile unstrittig, dass der Präsident seinen Oberbefehlshaber in Korea nicht einfach wegen seiner wiederholten Widersetzlichkeit abgeschoben hat, sondern weil er einen verlässlichen Oberbefehlshaber vor Ort haben wollte, falls man den Einsatz von Atomwaffen beschließen sollte. Mit anderen Worten: MacArthur erhielt den Laufpass gerade wegen Trumans nuklearer Politik. Am 10. März 1951 hatte MacArthur eine "atomare Kapazität für einen D-Day" angefordert, um die Lufthoheit über Korea behaupten zu können. Denn inzwischen hatte Peking seine Truppen an der koreanischen Grenze massiv verstärkt, und die Sowjets hatten 200 Bomber auf Luftstützpunkte in der Mandschurei verlegt, die von dort nicht nur Korea, sondern auch die US-Basen in Japan angreifen konnten.(15) Am 16. März schrieb General Vandenberg: "Finletter und Lovett sind wegen der Diskussionen über Atomwaffen alarmiert. Denke, alles ist einsatzbereit." Ende März berichtete Stratemeyer, dass die Bestückungsanlagen für Atombomben in der Luftwaffenbasis Kadena auf Okinawa wieder funktionierten und dass man nur noch auf die eigentliche atomare Ladung warte. Am 8. April befahl der Vereinigte Generalstab einen sofortigen atomaren Vergeltungsschlag gegen die Militärbasen in der Mandschurei für den Fall, dass neue Truppen in großer Zahl in die Kämpfe eingreifen sollten oder dass von dort aus Bomber gegen US-Ziele eingesetzt würden. Am selben Tag begann Gordon Dean, der Leiter der US-Atomenergiekommission, mit den Vorbereitungen für die Auslieferung von neun Mark-IV-Atomkapseln an die Neunte Bombergruppe der US Air Force, die als Träger der Atombomben ausersehen war. Am 6. April 1950 erhielt General Omar Bradley, der damalige Chef des Vereinigten Generalstabs, Trumans Zustimmung, die Mark-IV-Bomben "von der AEC (Atomenergiebehörde) unter die Aufsicht des Militärs" zu verlagern. Zur selben Zeit unterzeichnete der Präsident einen Befehl zum Einsatz der Bomben gegen Ziele in China und in Nordkorea. Die Neunte Bombergruppe der US-Luftwaffe wurde nach Guam verlegt. Doch "in der Konfusion, die nach der Entlassung von General MacArthur entstand", wurde Trumans Befehl nie abgeschickt. Dafür gab es zwei Gründe: Erstens benutzte der Präsident die Krise, um vom Vereinigten Generalstab die Zustimmung zur Absetzung von MacArthur zu erlangen. Und zweitens verhielten sich die Chinesen in diesem Krieg eher zurückhaltend. Deshalb kamen die Bomben nicht zum Einsatz. Doch die neun Mark-IV-Bomben wurden nicht an die AEC zurückgeliefert, sondern blieben nach ihrem Transfer am 11. April unter Obhut der US-Luftwaffe. Die Neunte Bombergruppe blieb zwar in Guam stationiert, wurde aber nicht auf den Stützpunkt Kadena in Okinawa verlegt, wo die Ladevorrichtungen für die Mark IV installiert waren. Im Juni 1951 fasste der Vereinigte Generalstab erneut den Einsatz von Atomwaffen ins Auge, dieses Mal als taktische Gefechtswaffe(16). Bis zum Ende des Koreakrieges 1953 gab es noch viele Vorschläge dieser Art. Robert Oppenheimer, der frühere Leiter des Manhattan-Projekts, war auch an dem "Project Vista" beteiligt, das untersuchen sollte, ob sich atomare Waffen auch für den taktischen Gebrauch eignen. Anfang 1951 wurde ein junger Mann, Samuel Cohen, in geheimer Mission vom USVerteidigungsministerium als Kriegsbeobachter nach Seoul geschickt, das ein zweites Mal von den Alliierten erobert wurde. Seine Aufgabe war es, eine Methode zu entwickeln, mit der man den Feind vernichten kann, ohne die Stadt zu zerstören. Cohen wurde der Vater der Neutronenbombe.(17) Das grässlichste Atomprojekt, das die USA in Korea verfolgten, war vermutlich die Operation Hudson Harbor. Sie gehörte offenbar zu einem größeren Projekt, das auch die Kooperation von Pentagon und CIA bei der Untersuchung des "möglichen Einsatzes von neuartigen Waffen" vorsah – ein euphemistischer Ausdruck für das, was heute Massenvernichtungswaffen heißt. Selbst ohne den Einsatz solch "neuartiger Waffen" – dabei war auch Napalm damals noch ziemlich neu – wurde Nordkorea durch diesen Luftkrieg, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen, dem Erdboden gleichgemacht. Die Überlebenden hausten in Höhlen. Drei Jahre lang hatten die Menschen mit der täglichen Angst gelebt, von Napalm verbrannt zu werden. "Es gab einfach kein Entrinnen", erzählte mir ein Nordkoreaner dreißig Jahre später. Am 20. Juni 1953 meldete die New York Times in einer Schlagzeile die Hinrichtung von Julius und Ethel Rosenberg(18) im New Yorker Gefängnis Sing Sing – in seiner Urteilsverkündung hatte der Richter das Ehepaar auch mittelbar für den Tod von 50 000 amerikanischen Soldaten im Koreakrieg verantwortlich gemacht. Die kleiner gedruckten Kriegsberichte vom Tage enthielten die Mitteilung der US-Luftwaffe, dass ihre Flugzeuge die Staudämme von Kusong und Toksan in Nordkorea bombardiert hatten, und wie nebenbei die Meldung, dass der nordkoreanische Rundfunk "große Schäden" an den beiden Wasserreservoiren zugegeben habe. Zu diesem Zeitpunkt war die Landwirtschaft der einzige Wirtschaftsbereich, der in Korea noch einigermaßen funktionierte. Die Angriffe auf die Staudämme erfolgten im Frühjahr 1953 – kurz nachdem die Bauern die mühsame Arbeit des Reiseinpflanzens hinter sich gebracht hatten. Viele Dörfer versanken in der Flutwelle oder wurden "flussabwärts mitgerissen", und selbst Pjöngjang, das 27 Meilen südlich des einen Dammes liegt, stand halb unter Wasser. In der offiziellen Geschichte der US Air Force kann man nachlesen, dass die Flut, die durch den Zusammenbruch der Staumauer des Reservoirs von Toksan ausgelöst wurde, sechs Kilometer Bahngleise, fünf Brücken, zwei Meilen Straße und fünf Quadratmeilen Reisfelder zerstörte. In 200 000 Arbeitstagen wurde das Reservoir nach dem Krieg wiederhergestellt. Auch der 1932 errichtete Damm am Pujon-Fluss, der mit seiner Staukapazität von 670 Millionen Kubikmetern nicht nur ein 200.000-Kilowatt-Kraftwerk antrieb, sondern auch die Reisfelder unterhalb der Staumauer mit Wasser versorgte, wurde getroffen.(19) Über die Zahl der Bauern, die bei den Angriffen auf diese und andere Dämme ihr Leben verloren, gibt es keine offiziellen Zahlen. Man unterstellte allerdings, dass sich diese Bauern "loyal" zum Feind verhielten und "den kommunistischen Streitkräften direkte Hilfe leisteten". Ihr Zerstörungswerk lehrte die US-Luftwaffe: "Dem Feind wurde exemplarisch die Totalität des Krieges demonstriert, der sich auf die gesamte Wirtschaft und sämtliche Menschen einer Nation erstreckt."(20) Im Verlauf des Koreakriegs "richtete die US-Luftwaffe schreckliche Zerstörungen in ganz Nordkorea an", resümiert Conrad Crane. "Die Bilanz der Bombenschäden, die den Waffenstillstandsverhandlun- gen zugrunde lag, besagt, dass 18 der 22 größten Städte zumindest zur Hälfte zerstört worden waren."(21) So wurden beispielsweise die beiden großen Industriestädte Hamhung und Hungnam zu etwa 80 Prozent zerstört, Sinajnu zu 100 Prozent und Pjöngjang zu 75 Prozent. Ein britischer Reporter, der eines von tausenden zerstörten Dörfern besucht hatte, fand nur noch "einen niedrigen, ausgedehnten Wall von violetter Asche" vor. Und General William Dean, der nach der Schlacht von Taejon im Juli 1950 in nordkoreanische Gefangenschaft geraten war, berichtete später, die meisten Städte und Dörfer im Norden seien "Ruinen oder verschneite, leere Flächen" gewesen. Nahezu jeder Koreaner, dem er damals begegnet sei, habe Angehörige durch Bombenangriffe verloren.(22) Selbst Winston Churchill war erschüttert und erklärte gegenüber Washington, dass sich am Ende des Zweiten Weltkriegs, als das Napalm als Waffe erfunden wurde, niemand vorgestellt hat, dass man damit kurze Zeit später die Zivilbevölkerung eines ganzen Landes "überschütten" würde.(23) So sah er aus, der "begrenzte Krieg" in Korea. Als Nachruf auf diesen entfesselten Luftkrieg sei noch die Schilderung seines Erfinders, General Curtis LeMay, zitiert. Über den Beginn des Krieges sagte er 1966 in einem Interview: "Wir schoben beim Pentagon sozusagen eine Mitteilung unter der Tür durch, die in etwa lautete: ,Lasst uns doch […] fünf der größten Städte in Nordkorea niederbrennen – sie sind nicht besonders groß -, und damit dürfte die Angelegenheit dann beendet sein.' Nun, als Antwort kam das empörte Geschrei von vier, fünf Leuten: ,Ihr werdet eine Menge Nichtkombattanten töten', und: ,Nein, das ist zu schrecklich.' Doch dann haben wir innerhalb von etwa drei Jahren jede Stadt in Nordkorea und auch in Südkorea niedergebrannt. […] Tja, über einen Zeitraum von drei Jahren kann man das offenbar goutieren, aber ein paar Menschen zu töten, damit das gar nicht erst passiert, das können viele Leute eben nicht verkraften."(24) deutsch von Niels Kadritzke Fußnoten: (1) Siehe Stephen Endicott, Edward Hagerman, "Der Koreakrieg als Testfeld für die biologische Kriegführung", in "Le Monde diplomatique, Juli 1999. (2) Siehe Clair Blair Jr., "The Forgotten War: America in Korea 1950-1953", Random House Inc. 1989, S. 515. (3) National Archives, Aktenbestand 995 000, Karton 6 175. Barretts Bericht datiert vom 8. Februar 1951, Achesons Brief an die US-Botschaft in Pusan vom 17. Februar 1951. (4) National Archives, RG338, KMAG file, box 5 418, KMAG journal, Einträge vom 6., 16., 20. und 26. August 1950. (5) "New York Times vom 31. Juli, 2. Aug. und 1. Sept. 1950. (6) "Air War in Korea", in "Air University Quarterly Review 4, no. 2 (1950), S. 19-40; "Precision Bombing", in "Air University Quarterly Review no. 4 (1951), S. 58-65. (7) Siehe MacArthur Archives, RG6, box 1; Stratemeyer an MacArthur, 8. November 1950; zu den englischen Quellen: Public Record Office (London), FO 317, piece no. 84072, Bouchier to Chiefs of Staff, 6. November 1950; piece no. 84073, 25. November 1959. (8) Bruce Cumings, "The Origins of the Korean War", Vol. 2, Princeton Universitiy Press, 1990, S. 753 f. (9) Truman Presidential Library, PSF, CIA file, box 248, Report vom 15. Dezember 1950. (10) Siehe die Titelgeschichte "Why America Scares the World" in "Newsweek vom 24. März 2003. (11) Ausführlich hierzu, mit Dokumenten aus vormals geheimen Archiven: Cumings (Anm. 8), S. 747753. (12) "New York Times, 30. Nov. und 1. Dez. 1950. (13) Hoyt Vandenberg Papers, box 86, Schreiben von Stratemeyer an Vandenberg vom 30. November 1950; Schreiben von LeMay an Vandenberg vom 2. Dezember 1950. (14) Cumings (Anm. 8), S. 750. Die Interviews, die Bob Considine und Jim Lucas 1954 mit MacArthur führten, wurden in der "New York Times vom 9. April 1964 veröffentlicht. (15) Eine Verlegung von Luftstreitkräften in diesem Umfang wird durch Dokumente, die nach dem Zerfall der Sowjetunion freigegeben wurden, nicht bestätigt. Allerdings steht fest, dass die USGeheimdienste davon ausgingen, dass diese Verlegung stattgefunden hatte – vielleicht aufgrund einer Desinformation seitens der Chinesen. (16) Damit ist nicht der Einsatz "taktischer Atomwaffen" gemeint, die es 1951 noch nicht gab, sondern der Einsatz der Mark IV im Rahmen eines bestimmten Kampfgeschehens, so wie im August 1950 B29-Bomber mit schweren konventionellen Bomben in die Bodenkämpfe eingegriffen hatten. (17) Siehe Fred Kaplan, "The Wizards of Armageddon", New York (Simon & Schuster) 1983, S. 220. Über Oppenheimer und das Projekt Vista siehe auch Cumings (Anm. 8), S. 751 f., und David C. Elliot, "Project Vista and Nuclear Weapons in Europe", in: "International Security 2 no. 1 (Summer 1986), S. 163-183. (18) Die Rosenbergs wurden als "Hochverräter" verurteilt. Man warf ihnen die Weitergabe geheimer Informationen über die Atombombe vor. Siehe Schofield Coryell, "Warum mussten die Rosenbergs sterben?", In:( )"Le Monde diplomatique,( )Mai 1996. (19) Hermann Lautensach, "Korea: A Geography based on the Author's Travels and Literature", Berlin (Springer) 1945 (1988), S. 202. (20) "The Attack on the Irrigation Dams in North Korea", in "Air University Quarterly 6, no. 4, 1953, S. 40-51. (21) Conrad Crane, "American Airpower Strategie in Korea 1950-1953", University Press of Kansas 2000, S. 168 f. (22) Ebd. (23) Jon Halliday und Bruce Cumings, "Korea: The Unknown War", New York (Pantheon Books) 1988. S. 166. (24) John Foster Dulles Papers, Oral History Curtis LeMay, 28. April 1966. http://www.heise.de Hamburg – internationale Drehscheibe im Atomgeschäft Birgit Gärtner 24.06.2009 Die Atomindustrie handelt weltweit mit radioaktiven Stoffen, die größtenteils durch und über die Hansestadt transportiert werden Hamburg hat viel Grün: Grünflächen, Grünspan, Grüngürtel, Grünglas, Grünanlagen und Grüne in der Regierung. Die gelten gemeinhin als Garant für Umweltschutz. Doch seitdem die grüne Kernkompetenz Regierungsfähigkeit-egal-mit-wem-und-zu-welchen-Bedingungen heißt, nehmen sie es mit dem Umweltschutz nicht mehr so genau. So konnte sich Hamburg unter Stillschweigen der Grünen zum Umschlagplatz für den internationalen Atomhandel entwickeln. Ein weltweit boomendes Geschäft, das in Hamburg unter dem schwarz-grünen Senat so richtig in Schwung kam. Das ergab eine Anfrage der Bürgerschaftsfraktion Die Linke an den Hamburger Senat. Demnach findet durch und über die Hansestadt durchschnittlich alle zwei Tage ein Atomtransport statt. Die seien ein nicht abzuschätzendes Risiko für Mensch und Umwelt, warnen Experten wie der Physiker Fritz Storim von der Messstelle Arbeits- und Umweltschutz (MAUS e.V.) Bremen. Die Castoren sind hierzulande wohl die berühmtesten Atomtransporte, aber bei weitem nicht die einzigen. Nur über die anderen ist nicht so viel bekannt. MAUS beschäftigt sich schon länger mit dieser Frage, und kam darauf, dass es nahe liegend sei, dass solche Transporte u. a. über den Hamburger Hafen abgewickelt werden. Deshalb stellte die Bürgerschaftsfraktion der Linken in Zusammenarbeit mit MAUS am 5. Mai 2009 eine große Anfrage an den Hamburger Senat, um Informationen über Art und Umfang möglicher Atomtransporte zu bekommen. Dieser Tage kam die Antwort des Senats, die in der Tat erstaunliche Erkenntnisse zu Tage förderte: Durchschnittlich alle zwei Tage werden über die Hansestadt radioaktive Stoffe per Bahn, LKW oder Schiff quasi in alle Welt verbracht. Mehr als 400 Atomtransporte fanden in den letzten fünf Jahren in und über Hamburg statt, davon 61 in diesem Jahr bis Anfang Mai. Das ist eine Zunahme von 55% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2008. Weltweit wird mit Rohstoffen wie Uranerz, hoch toxischen chemischen Verbindungen wie Uranhexalfluorid, abgebrannten Brennstäben sowie anderen Produkten im Zusammenhang mit der Nutzung der Atomtechnologie gehandelt. Internationale Drehscheibe für diesen florierenden Atomhandel ist Hamburg. Die Transporte werden vom schwarz-grüne Senat abgesegnet: Innen-, Sozial- und Umweltbehörde werden vorab darüber informiert. -------------------------------------------------------------------------------- Radioaktive Stoffe werden auf allen Verkehrswegen transportiert. Das Atomrecht unterscheidet zwischen (spaltbaren) Kernbrennstoffen und (nicht spaltbaren) sonstigen radioaktiven Stoffen. Bei den Transporten von Kernbrennstoffen handelt es sich überwiegend um Sendungen von unbestrahlten Vorprodukten zur Brennelemente-Herstellung wie angereichertes Uranhexafluorid (UF6) und Urandioxid (UO2) in Form von Pellets oder Pulver, sowie um Brennstäbe und unbestrahlte Brennelemente. Den größten Anteil an Transporten radioaktiver Stoffe haben sonstige radioaktive Stoffe für medizinische Zecke, die mit begrenztem Aktivitätsinventar überwiegend auf der Straße transportiert werden. Die Transportaufkommen sonstiger radioaktiver Stoffe bei Seetransporten besteht in erheblichem Umfang aus Sendungen entleerter Transportbehälter mit Restkontamination, natürlichem Uran, nicht angereichertem Uranhexafluorid, radioaktiven Abfällen und Reststoffen. Transporte bestrahlter Brennelemente und hochradioaktiver Abfälle werden fast ausschließlich im Eisenbahnverkehr durchgeführt. Antwort des Senats vom 2. Juni 2009 Transportiert wird u. a. Uranerz, das als Rohstoff u. a. in Australien, Kanada, Namibia und Russland gewonnen wird. Es wird benötigt für die Herstellung von Brennstäben für Atomkraftwerke (AKW). Genauso wie Uranhexalfluorid, das in Atomfabriken, auch in der BRD, produziert wird. Das Uranerz kommt per Schiff aus Kanada oder Namibia in Hamburg an, wird dort verladen und z. B. per Bahn nach Frankreich geschickt – hunderte Kilometer durchs Binnenland. Uranhexafluorid wird von Hamburg aus nach Argentinien oder in die USA verschifft, oder per Bahn nach Schweden transportiert. Es kommt z. T. per Schiff aus Korea und den USA im Hamburger Hafen an und wird per Schiff weiter verschickt, aber zum Teil auch durch die Republik gefahren. Das Verwirrende daran ist, dass Uranhexafluorid sowohl aus Korea und den USA nach Hamburg kommt, als auch von Hamburg aus nach Korea und in die USA verschifft wird. Darauf kann Fritz Storim sich keinen Reim machen. Über die genauen Routen der Transporte schweigt der Senat sich aus. Aus Sicherheitsgründen, um die Bevölkerung nicht unnötig zu beunruhigen. Denn "Unfälle mit gefährlichen Gütern können sich jederzeit und nahezu an jedem Ort der Stadt ereignen", heißt es in der Antwort des Senats. Aber Hamburg ist natürlich vorbereitet, im Ernstfall werden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen: Warnung der Bevölkerung, Absperrung des gefährdeten Bereichs, gegebenenfalls medizinische Versorgung sowie Betreuung der betroffenen Personen. Das klingt nach einem guten Plan, da sich radioaktive Stoffe ja bekanntlich prima eingrenzen und betreuen lassen. -------------------------------------------------------------------------------Unfälle mit gefährlichen Gütern können sich jederzeit und nahezu an jedem Ort der Stadt ereignen. Aus diesem Grund müssen konkrete Schutzmaßnahmen jeweils der Lage entsprechend eingeleitet werden. Dazu zählen unter anderem die Warnung der Bevölkerung, die Absperrung des gefährdeten Bereichs und gegebenenfalls die medizinische Versorgung sowie die Betreuung der betroffenen Personen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Die Maßnahmen werden der jeweiligen Lage entsprechend angepasst. Aus der Antwort des Senats Die auftretenden Strahlendosen von abgebrannten Brennelementen können MAUS zufolge zur Zeit nicht in annähernd ausreichender Genauigkeit erfasst werden. Aber sie seien sehr hoch aufgrund der biologischen Wirkung der Neutronenstrahlung, erläuterte Fritz Storim gegenüber Telepolis. Bei der Freisetzung von Uranhexafluorid bildeten sich durch die Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit giftige Fluorverbindungen, die schwere Verletzungen der Atemwege verursachen. Je nach Witterungsbedingungen könnten bis in ca. 600 m Entfernung von Unfallort tödliche Konzentrationen auftreten, so Storim. "Es ist nicht schwer, sich auszumalen, was das für eine Millionenstadt wie Hamburg bedeuten würde." MAUS fordert daher den sofortigen Stopp aller Atomtransporte. Städte wie Lübeck und Emden haben 1987 vorgemacht, dass das durchaus machbar ist. Die CDU-Oberbürgermeistern Roth von Frankfurt am Main erreichte 1997 durch Verhandlungen mit der Bahn, dass keine Castor-Transporte durch das Frankfurter Stadtgebiet durchgeführt werden. Für einen Stopp muss indes bekannt sein, was wo und wie transportiert wird. Deshalb regt MAUS an, dass auch in anderen Bundesländern Anfragen bezüglich möglicher Atomtransporte gestellt werden. http://www.heise.de Kampf gegen die Glücksspiele im Internet Florian Rötzer 20.03.2000 Die koreanische Regierung geht gegen virtuelle Kasinos vor und will die Bürger durch Filter vor Glücksspielen schützen Während Australien von Glücksspielen im Internet durch staatliche Kontrollen und Maßnahmen, wie spielsüchtige Bürger des Landes von den virtuellen Tischen ferngehalten und die Einsätze der Spieler begrenzt werden könnten, profitieren will, da ausländische Nutzer diesen Restriktionen nicht unterliegen, aber von der Kontrolle profitieren würden, geht Korea, wo das Internet gerade boomt und jetzt mehr als 10 Millionen Menschen einen Internetzugang haben, entschlossen gegen Glücksspiele vor. Das Informationsministerium will, wie die Korea Times gestern meldete, zusammen mit der Polizei, den Zollbehören und den Internetprovidern, der in letzter Zeit aufblühenden Lust an Glücksspielen im Internet einen Dämpfer versetzen. Zwar wurde bislang noch keine Website mit Glücksspielen unter einer koreanischen Domain entdeckt, aber Gefahr droht von den vom Ministerium erkundeten 600 Websites auf ausländischen Servern, vornehmlich in jenen Ländern, in denen es keinerlei Regelungen für das Glücksspiel gibt. Hier können die Koreaner unter Umgehung der Gesetze spielen. Das Ministerium beschloss zu handeln, nachdem es von koreanischen Internetfirmen erfahren hatte, dass manche der Angestellten während der Arbeitszeit an Glücksspielen teilnehmen. Online-Glücksspiele werden als gefährlich erachtet, weil sie schnell eine Sucht auslösen können und überdies die virtuellen Kasinos jeder Zeit zugänglich sind. Angeblich seien die Websites für Glücksspiele nur schwer zu entdecken, da die Benutzer erst einmal spezielle Programme herunterladen und dann mit Kreditkarten zahlen. Ein Sprecher des Informationsministerium gab bekannt, dass man nicht nur illegale virtuelle Kasinos, die in Korea betrieben werden, schließen wolle, sondern auch die Internetprovider auffordern werde, Filter zu installieren, "um die Nebenwirkungen der Digitalisierung zu bekämpfen". Die Internetprovider blockieren ab heute die 10 bekannten Spielseiten in koreanischer Sprache, die sich auf ausländischen Servern befinden. Zugegeben wird allerdings auch vom Ministerium, dass eine Blockierung aller entsprechenden Websites nahezu unmöglich sei. Überdies sei es "praktisch" nicht zu bewerkstelligen, alle gespeicherten Transaktionen mit Kreditkarten zu überprüfen, da diese als normale Zahlungen verbucht würden. Gleichwohl sollen nicht nur die heimischen Betreiber von virtuellen Kasinos, sondern auch Gewohnheitsspieler bestraft werden, die man mit einer Überprüfung von verdächtig hohen Überweisungen an ausländische Websites erwischen will. Geplant ist die Aufstellung einer Sondereinheit für Online-Glücksspiele, eine Medienkampagne zur Aufklärung über die Gefährlichkeit von Glücksspielen und eine Empfehlung an alle öffentlichen Institutionen, Filter einzubauen. Langfristig sollen öffentliche Institutionen wie Schulen, Behörden, Bibliotheken oder Internetcafes dazu rechtlich gezwungen sein. Wollen also die einen Filter für ihre Bürger, um sie vor einer Kritik am Staat wie in China, Vietnam oder Burma oder vor Pornografie wie in Australien zu bewahren, so die anderen, um sie vor Glücksspielen zu schützen, während die deutsche Phonoindustrie die Bürger von Deutschland daran hindern will, auf Websites zugreifen zu können, von denen man Musikdateien unter Verletzung des Copyright herunterladen kann. Andere schlagen vor, Filter einzuführen, um die Menschen nicht auf rassistische Websites zugreifen zu lassen. Die große Filteroffensive ist jedenfalls allerorten am Laufen ... http://www.heise.de Es gibt kein Ost und West im Cyberspace? Frank Hartmann 08.11.2000 Ein Bericht vom "Asia-Europe Forum on Culture in the Cyber Age" in Korea Welches Gesicht hat Asien? Indifferent richtet der westliche Blick sich auf das unergründliche Reich der Zeichen, und orientiert am Ideal des reibungsfreien Kulturaustausches, erwartet sich der Besucher, hinter der Maske des freundlichen Entgegenkommens immer nur auf Wohlwollen zu stoßen. Dem leichten, gesunden Essen (sushi4all) sind wir ja zugeneigt, als dankbare Konsumenten freuen wir uns über billige Hardware und Autos zum Discont-Preis. Für eine spirituelle Auffrischung der westlichen Dekadenz ist mit Zen, Feng Shui und Yoga ebenfalls bestens gesorgt. "Kyongju World Culture Expo2000" Umgekehrt zeigt der Westen dem Osten, was wahre Kultur ist und wo es politisch langgehen soll. Das Internet ist gut – in unserer Vorstellung eine offene Technologie, die auf eine geschlossene Gesell- schaft trifft. Dass mit den abstrakten Codierungen des Cyberspace die Kolonialisierung Afrikas und Asiens sich noch mal auf symbolischer Ebene wiederholt, kommt den liberalen Geistern westlicher Metropolen nicht in den Sinn. Interessiert wird in Fernost die derzeitige Rekonstruktion der europäischen Identität verfolgt. Europa, das ist die alte Kolonialmacht, aber auch ein wichtiger Absatzmarkt. Neben dem wirtschaftlichen Interesse kristallisiert sich derzeit ein weiterer Grund heraus, Kooperationen einzugehen: Asiaten wie Europäer wollen möglicherweise ihre kulturellen Unterschiede leben, und gemeinsam lässt sich die Frage stellen, ob die amerikanisch dominierte "Cyberkultur" dafür überhaupt noch Raum lässt. Die Entwicklung der europäisch-asiatischen Beziehungen hänge davon ab, ob die "digitale Kluft" zwischen beiden Kulturen überwunden werden kann. Diesen Worten ließ der koreanische Präsident DaeJung Kim in seiner Eröffnungsrede des ASEM-Gipfels in Seoul Ende Oktober die Ankündigung eines "Trans-Eurasia Information Networks" folgen. Die Weichen zum Ausbau von Ecommerce und anderen Bereichen der Wissensindustrie wurden im Beschluss eines neuen Kooperations-Rahmenprogramms definitiv gestellt. Ob die Ressourcen auch zum Knüpfen der kulturellen Cyber-Bande genutzt werden, bleibt vorerst offen. Sichere E-Mails für alle Ansprüche im Unternehmen In diesem Whitepaper stellt Cisco die Leistungsfähigkeit seiner E-Mail-Security Lösungen für Unternehmen dar und präsentiert für alle Ansprüche ein passendes Produkt. An offenen Netzwerken führt kein Weg vorbei Wachsende Bandbreitenanforderungen, die Konvergenz von Daten und Sprache im Netz und die zunehmende Mobilität von Benutzern sind einige der wichtigsten Treiber für Veränderungen in der Netzwerkinfrastruktur. Empfehlungen zum Ausbau und zur Optimierung von e-Commerce-Plattformen In dieser Studie erhalten Sie Antworten auf wichtige Fragen rund um das Thema E-CommerceErfahrungen. Etwa wie sich der ROI durch automatisierte Produktempfehlungen steigern lässt und anderes mehr. Südkorea ist ein höchst interessantes Land, gespalten zwischen kulturellem Traditionalismus und einem industriellen Hyper-Modernismus, der von den postmodernen Allüren des "Westens" noch verschont geblieben ist. Der überall sichtbare Reichtum des Landes gründet auf Industrieproduktion: Schiffswerften, Autohersteller, Elektronik. In diesem Rahmen meint Kultur immer noch Konvention, Identitätsstiftung, und Kunsthandwerk bis hin zum Folklore-Kitsch. Ausnahmen wie Nam-June Paik, der die Eröffnungszeremonie des ASEM-Gipfels visuell gestaltete, bestätigen die Regel: dem koreanischen Alltag bedeutet der berühmteste Künstler des Landes ebenso wenig wie der Nobelpreis des Präsidenten für die innenpolitische Opposition, die darin Anzeichen eines Verlusts an kollektiven Werten bemängelt. "Dance Dance Revolution" Mit der Frage nach den traditionellen Werten beschäftigt man sich vor allem dann, wenn es um die Entwicklung von Zukunftsperspektiven geht. In den Beiträgen des "Asia-Europe Forum on Culture in the CyberAge" wurde ziemlich deutlich, dass westliche Vorgaben – symbolisch: Interface und Codierung gründen bekanntlich auf ASCII, einem "American Standard" – nicht notwendig kompatibel sind mit der asiatischen Praxis. Und obwohl die Differenzen zwischen Funktionären und Experten, die in der traditionsreichen koreanischen Königsstadt Kyongju zusammentrafen, unübersichtlich waren, kam man zu einer gemeinsamen formalen Erklärung, die Informations- und Meinungsfreiheit sowie Bürgerrechte auf symbolischer Ebene bekräftigte. Tradition, aber auch das Diktat der Wirtschaftsentwicklung sorgten in vielen Staaten, von Malaysia über Singapur bis Taiwan und Korea dafür, dass die individuellen Freiheiten unterdrückt wurden und der Staat in nahezu alle Aspekte des Privatlebens eingreift. Es verwundert also kaum, dass Zensur und Kontrolle in einer politischen Ideologie, die Macht mit einem Informationsmonopol verbindet, mit großer Gelassenheit praktiziert wird. Gleichzeitig werden neue Technologien mit aller Vehemenz propagiert: Singapur, jüngst aber auch Südkorea melden Internet-Zugang für gut über 40 Prozent ihrer Bevölkerung, Breitband und ADSL sind gängig. Keine Werbung, kein Plakat ohne Web-Adresse, sogar die Polizei wirbt in Korea online. Den Alltag asiatischer Werte muss man erlebt haben, um zu verstehen, dass es nicht immer Zynismus ist, wenn Themen wie Privacy oder Zensur hier keine unmittelbare Priorität besitzen. Eine kommunitaristische Lebenswelt, in der eine funktionierende Sozialordnung hoch geschätzt wird, verträgt sich schwer mit dem ausgeprägten Individualismus westlicher Prägung. Im Sinn einer funktionierenden Kollektivität ist in Asien immer "Führung" angesagt, doch nicht als faschistische Leitidee, sondern als Weltbild und als Lebensstil. Unbedingter Respekt für Autorität und Familie sorgt zusammen mit harter Arbeitsmoral und einem eher frugalen Lebensstil dafür, dass das Bruttosozialprodukt stimmt. Der ökonomische Erfolg ist es dann, der die Ideologie legitimiert, die kommunalen Werte über die persönlichen Interessen zu stellen. In einer Diskussion der "asiatischen Werte" taucht immer wieder die Tugendlehre des Konfuzianismus auf, um diese Führung auch im Zusammenhang der Entwicklung einer globalen Cyberkultur zu gewährleisten. Wie verschieden auch immer diese Werte interpretiert werden, die Tendenz einer Zähmung oder Kultivierung des schon als kapitalistischer Auswuchs eines dekadenten Westens empfundenen Internet-Chaos ist unübersehbar. Wenn in symbolischen Zensurakten etwa Singapur hunderte Internet-Seiten sperrt, dann weiß man gleichzeitig wie limitiert solche Aktionen sind. Ganz im Gegensatz zu China, wie es scheint, wo eine veraltete Ideologie des politischen Medienmonopols aufrechterhalten wird. Das Problem ist, dass eine Diskussion kultureller Werte und dazu passender Inhalte von den politischen Kontrollmechanismen ablenkt, in denen neue Medientechnologien eine wesentliche Rolle spielen. Immer wieder geht es um Tradition und die Kompatibilität von Kulturerbe mit den neuen, technologisch induzierten Formen. Übersehen wird, dass Kultur im Cyberspace nicht das einzige Thema ist, "emergente" Formen neuer Technokultur werden schlichtweg nicht thematisiert. Bei allem Respekt erwies sich doch der Besuch der "Kyongju World Culture Expo2000" als ermüdende Ansammlung kultureller Klischees, einschließlich der unvermeidlichen Volkstanzgruppen aus aller Welt. Die Kids jedoch interessierten sich wesentlich für eine Halle direkt neben jener der Völkerfreundschaft: D.D.R. – was keineswegs für eine obskure politische Nostalgie steht, sondern für "Dance Dance Revolution". Das sind Tanzautomaten, bei denen die Spieler zu brachial krachenden Poprhythmen auf Cursorähnlichen Bodenfelder im in der Videosequenz vorgegebenen Takt hüpfen müssen. Am meisten Spaß macht den Kids aber auch das im Kollektiv. http://www.heise.de (Formatierung mit Hyperlinks: Lücken) China und das Währungsdumping Christoph Stein 13.09.2007 Auf Druck der USA hat der IWF seine seit dreißig Jahren bestehende Praxis zur Überwachung der Währungspolitiken seiner Mitgliedsländer verschärft Das Krachen im Gebälk der US-Immobilen-Banken hat es etwas übertönt: Die USA haben in ihrem bisher fruchtlosen Kampf für eine Aufwertung der chinesischen Währung den Internationalen Währungsfond in Stellung gebracht und auch der neue französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy reiht sich ein in die Front gegen das chinesische Währungsdumping. Die deutsche Regierung hält sich dagegen in dieser Frage auffällig zurück. Auf Druck der USA hat der IWF seine seit dreißig Jahren bestehende Praxis zur Überwachung der Währungspolitiken seiner Mitgliedsländer "modernisiert", d. h. verschärft. Die neue Entscheidung des IWF-Exekutivdirektoriums führt den "neuen Begriff der außenwirtschaftlichen Stabilität" ein, spricht von "Wechselkurs-Manipulation" zu Erlangung "unfairer Wettbewerbsvorteile" und kündigt eine "bilaterale Überwachung" in vertraulicher Abstimmung mit dem verdächtigen Mitgliedland an. Als Drohung im Hintergrund vermeldet der IFW zudem "die Hoffnung einiger Direktoren" auf eine "multilaterale Überwachung" zu einem späteren Zeitpunkt, d.h. eine weitergehende Verschärfung der Überwachungspraxis. Einen Monat später, auf der Pressekonferenz mit Angela Merkel in Toulouse, blies Sarkozy ins selbe Horn, unverkennbar in Richtung China: "Was möchte Frankreich? In Frankreich möchte man, dass dem Währungsdumping ein Ende gesetzt wird. Dieses Währungsdumping führt dazu, dass die Welt nach Kriterien geführt wird, die nicht richtig sind." Und an Deutschland gewandt fügte er hinzu: "Deutschland hat noch den Vorsitz in der G8, und es ist richtig, dass dieses Thema bei der G8 wieder auf der Tagesordnung steht." Angela Merkel hielt sich bedeckt, beschwor die Unabhängigkeit der europäischen Zentralbank und sprach sich gegen "interventionistische Korrekturen" aus. Auch auf den G8-Internetseiten der Bundesregierung findet sich zum Thema Währungsdumping nichts. Die Differenzen waren offensichtlich. Sar- kozy fasste die Situation in die Worte: "Denn wir sagen uns ehrlich und ganz offen, wie die Dinge sind, ohne um den heißen Brei herumzureden", was in der Sprache der Diplomatie wohl heißt: Es hat ordentlich gekracht. Ein währungspolitischer Atomschlag? Der britische Telegraph schrieb am 10/08/2007 von einer "nuclear option" der chinesische Regierung. ( China könnte Dollar-Reserven als "politische Waffe" nutzen). Sie drohe mit dem Umtausch ihrer Währungsreserven in Höhe von 1.330 Milliarden US-Dollar in EURO, sollten die USA weiter Druck auf China in Währungfragen ausüben. Xia Bin, Chef der Finanzabteilung des Development Research Centre, einem chinesischen Regierungsinstitut, bemerkte, dass die chinesische Regierung ihre Devisenreserven als "bargaining chip" bei Gesprächen mit den USA nutzen sollte und He Fan, ein Mitglied der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften erklärte, China könne sich gezwungen sehen, seine Dollarreserven zu verkaufen, sollte die chinesische Währung aufwerten, was zu einer massiven Abwertung des Dollar führen würde. China nutze häufig Wissenschaftler aus offiziellen Institutionen, um Änderungen des Regierungskurses anzukündigen, erklärt der Telegraph die Bedeutung dieser Stimmen. China droht also über diplomatische Kanäle mit dem Ruin der US-Währung. Seit Jahren kocht in den USA die Debatte um unfaire Handelspraktiken der chinesischen Regierung. Von der China Currency Coalition, einem Aktionsbündnis aus Gewerkschaften, Unternehmerverbänden und ihren Thinktanks, wird die Unterbewertung der chinesischen Währung für die Schieflage in der Zahlungsbilanz der USA und den Verlust von 3 Millionen Arbeitsplätzen in der US-Industrie verantwortlich gemacht. Auch der US-Senat wurde Ende Juli aktiv und gab der Regierung mit dem Currency Exchange Rate Oversight Reform Act of 2007 neue Mittel an die Hand um gegen die chinesische Währungsmanipulation aktiv zu werden. Das US-Finanzministerium bemühte sich dagegen sogleich wieder um eine Glättung der Wogen. Die US-Regierung befindet sich in einem Dilemma. China ist der wichtigste Handelspartner der USA und verfügt mit seinen immensen Dollarreserven über effektive Macht, auf der anderen Seite kochen die Emotionen über unfaire Handelspraktiken hoch. Entsprechend wechseln die Statements zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Im Dezember 2006 sprach der FED-Chef Ben Bernanke vor der Chinese Academy of Social Sciences davon, dass die Unterbewertung des Renminbi wie eine Exportsubvention wirkt, auf der anderen Seite folgen sofort Beschwichtigungen. Der Weg über den IWF verspricht einen Ausweg aus der Zwickmühle. Das chinesische Währungsdumping war sowohl im amerikanischen Vorwahlkampf als auch im französischen Präsidentenwahlkampf Thema, die deutsche Politik dagegen umschifft es auffällig. Angela Merkel mied es offenbar bei ihren Besuch in China, die Meldungen sprachen jedenfalls einzig von Menschenrechtsfragen, Hackerangriffen und verbesserter Umweltpolitik die sie anmahnte, Probleme, die die Chinesen offenbar nicht sehr beeindrucken. Von Unhöflichkeiten oder gar offenen Drohungen, wie sie der Telegraph zu berichten weiß, hörte man jedenfalls nichts. Preisniveaus Warum reagiert China so allergisch auf den Vorwurf des Währungsdumping und warum die auffällige deutsche Zurückhaltung? Seitdem die USA das Weltwährungssystem von Bretton Woods Anfang der 1970er Jahre in Trümmer legten, herrscht währungspolitische Anarchie. Und wie jede Anarchie war auch diese einzig für die Starken gut, also bis zum Zusammenbruch des Sozialismus Ende der 1980er Jahre für die USA und ihre engen Verbündeten in Europa und Asien. Allfällige Probleme zwischen den westlichen Industriestaaten konnte man einfach und wirkungsvoll im exklusiven Club der G8-Treffen oder bei mehr oder weniger informellen Konferenzen regeln. So etwa auf der Plaza Konferenz 1985, auf der die Wechselkurse der G8-Staaten neu geordnet wurden. Ansonsten sorgten IWF und Weltbank dafür, dass die Währungen vieler Rohstoffländer niedrig bewertet blieben und die meisten Rohstoffe damit billig. Aufsteiger, wie die asiatischen Tigerstaaten, sorgten zwar eine Zeitlang für einige Aufregung, wurden aber nach kurzer Zeit im Club integriert. Seit der wirtschaftspolitischen Öffnung Chinas und der Abkehr Indiens von der Politik der Importsubstituierung ist es mit dieser Idylle, die manche Kritiker auch Neokolonialismus nannten, vorbei. Statt Neokolonialismus haben wir Globalisierung. Was hat sich geändert? Was machen Indien und insbesondere China heute anders, als die asiatischen Tigerstaaten vor zwanzig Jahren? Der auffälligste Unterschied ist eine andere Währungspolitik. Die Währungen der Tigerstaaten werteten schon nach relativ kurzer Zeit kräftig auf, die Chinesen halten ihre Währung niedrig. (Bild vergrößern) Die Grafik zeigt die Entwicklung des Preisniveaus von 5 asiatischen Staaten von 1950 bis 2004. Gemessen wird es nach dem Konzept der Kaufkraftparitäten (Purchasing Power Parity, im folgenden PPP), d.h. durch den Vergleich der Preise eines durchschnittlichen Warenkorbes in der jeweiligen Landeswährung mit dem Preis eines äquivalenten Warenkorbes in den USA, geteilt durch den offiziellen Umtauschkurs zum US-Dollar. Ein Preisniveau von 1,00 bedeutet also, dass der Umtauschkurs der Währung zum US-Dollar die Lebenshaltungskosten äquivalent abbildet, eine PPP von fast 2,00, wie bei Japan Mitte der1990er Jahre, dass die Landeswährung stark überbewertet ist, eine PPP von etwa 0,25, wie bei China und Indien, dass der Umtauschkurs das Preisniveau im Verhältnis 1:4 nach unten verzerrt abbildet. Oder, anders formuliert: Einem Monatslohn in China von $200, wie er häufig in TV-Berichten aus China erwähnt wird, entspricht eine Kaufkraft von $800 in den USA, bzw. ein Jahreslohn von$10.000, also etwa dem US-Mindestlohn. China ist kein "Niedriglohnland", wie es durchgängig in den deutschen Medien genannt wird, sondern ein "Niedrigwährungsland". Wie China begannen auch Japan und die asiatischen Tiger, Taiwan und Korea ihre Karriere als Niedrigwährungsländer. Seit Mitte der 1970er Jahre ist Japan ein Hochwährungsland und auch Taiwan und Korea sind mit einer PPP von etwa 0,75 seit 20 Jahren keine ausgesprochen billigen Länder mehr (die Abwertungen im Zuge der Asienkrise Ende der 1990er Jahre waren nicht nachhaltig). Ein mit Taiwan und Korea vergleichbares Bild zeigen die mittelosteuropäischen EU-Neumitglieder. (MOE) (Bild vergrößern) Wie die Grafik zeigt, ging Deutschland mit einem, im Vergleich zu den Niederlanden und Frankreich sehr hohem Preisniveau in den EURO. Die DM war im Vergleich zu den westeuropäischen Währungen überbewertet. Das deutsche PPP stieg nach der Wiedervereinigung stark an, eine Bewegung die sich nach 1993 noch beschleunigte, Folge der Geldpolitik des damaligen Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer (Bundesbankpräsident von 1993 bis 1999). Wie sein Kanzler Helmut Kohl war Tietmeyer stolz wie Bolle auf eine "starke D-Mark". Die bitteren Folgen dieser währungspolitischen Eitelkeit durfte Deutschland in den Krisenjahren nach 2000 auskosten. Auf den Wirtschaftsseiten der deutschen Presse tauchte wiederholt das Gespenst der Deflation auf und tatsächlich haben sinkende Reallöhne und eine äußerst niedrige Inflationsrate zu einer Anpassung des deutschen Preisniveaus an die westlichen Nachbarn geführt. Heute haben die Niederlande und Frankreich wieder ein höheres Preisniveau als Deutschland, wie auch schon vor der Präsidentschaft Tietmeyers. Von dieser Seite droht der Konjunktur in Deutschland keine Gefahr mehr. Der gemeinsame Anstieg der PPPs von Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien und Portugal in der Grafik zeigt die Aufwertung des EURO gegenüber dem US-Dollar seit 2000. Das Dogma der "starken DM" und seine Folgen erklärt teilweise die Zurückhaltung der deutschen Politik in Währungsfragen. Es wäre der deutschen Bevölkerung nur schwer zu vermitteln, worin die Vorteile bestanden, wenn es einer fünfjährigen Depression bedurfte, um das zu hohe Preisniveau wieder an die westeuropäischen Nachbarn anzupassen. Da ist es allemal besser, man umgeht das heikle Thema ganz, jedenfalls für die CDU. Zum anderen könnte die Erkenntnis aufkommen, die schnelle Einführung der DM in der ehemaligen DDR, ohne entsprechende kompensierende Erleichterungen etwa in Steuer- und Abgabenfragen könnte eine riesige Dummheit gewesen sein. Zum dritten könnte bei einer intensiven Diskussion um ein chinesisches Währungsdumping die Idee aufkommen, auch die Preis- und Lohnkonkurrenz der MOE-Staaten könnte ähnliche Gründe haben. Bei dem angespannten Verhältnis etwa zu Polen eine gefährliche Debatte. Die Angst vor der latentern Ausländerfeindlichkeit erklärt also die Zurückhaltung der Linken. Um die Frage gleich zu beantworten: Bei den Währungen der MOE-Staaten gab und gibt es keine Manipulation. Auch die populistischen und medienwirksamen deutschen Ökonomen meiden das Thema. Sie beklagen die angeblich zu hohen deutschen Löhne und beschwören, wie Hans-Werner Sinn einen "Faktorpreisausgleich", d.h. eine internatione Anpassung der Löhne (natürlich auf dem niedrigsten Level) ohne zu beachten, daß auch die Wechselkurse zu diesen Faktoren gehören. Bei den Währungen der MOE-Staaten gab und gibt es keine Manipulation. 1990 starteten die MOE Staaten Polen, Ungarn und Bulgarien ihr neues Dasein als kapitalistische Staaten mit einem Preisniveau, das vergleichbar war mit China. Dies war jedoch keine Folge eines Währungsdumpings, sondern Ausdruck der maroden Wirtschaft am Ende des Sozialismus. Dank kräftiger Auslandsinvestition gerieten sie jedoch schnell unter Aufwertungsdruck. Die folgende Grafik zeigt diesen Vorgang in einer etwas anderen Darstellung. (Bild vergrößern) Wir sehen die Entwicklung der Preisniveaus der MOE im Vergleich zu Spanien und Portugal, die Zeitlinie stellt die Jahre seit dem Beitritt zur EU dar. (Das Jahr 1 in der Grafik ist also das Beitrittsjahr des jeweiligen Landes.) Wir sehen eine bemerkenswerte Bewegung. Mit der Ausnahme von Bulgarien bewegen sich die PPPs aller osteuropäischen Beitrittsländer in einem Korridor zwischen dem spanischen und dem portugiesischen PPP nach deren Beitritt zur EU 1986. Sollte dieser Trend anhalten, wären die Preise der MOE in etwa 5 Jahren auf einem Niveau, das sich zwischen dem von Spanien und Portugal heute bewegt. Die Zeiten der extremen "Niedriglohn"-Konkurrenz innerhalb der EU wären vorbei. Die Produktionsverlagerungen Richtung Osten sind selber der Grund, weshalb sich die Politik des Outsourcing schon in wenigen Jahren nicht mehr lohnen wird. Das niedrige Preisniveau und die gut ausgebildete Facharbeiterschaft lockten schnell Auslandsinvestitionen an, nicht nur die deutschen Konzerne verlagern ihre arbeitsintensive Produktion in die MOE Staaten, damit steigt die wirtschaftliche Leistungskraft. Und mit ihr steigt das Preisniveau. China ist anders Umso drängender wird die Frage: Wenn Auslandsinvestitionen zu einen steigenden Preisniveau führen, wieso funktioniert dies überall, außer bei China? Wieso kann China der Aufwertung seiner Währung trotz Boom seit 20 Jahren Widerstand leisten, ja seine PPP eher noch weiter nach unten drücken? Die US-amerikanische Erklärung: durch Währungsmanipulation. Die Chinesische Nationalbank kauft seit Jahren im großen Stil US-Anleihen auf, überschwemmt die Finanzmärkte mit Renmimbi und hält den Kurs niedrig. Als Folge hält China stetig wachsende Devisenbestände von z.Z. über 1300 Milliarden US-Dollar. Jedoch, dies ist nur die eine Hälfte der Antwort. Nach dem ökonomischen Lehrbuch sollte auch das chinesische Preisniveau zusammen mit dem Zustrom von Auslandsinvestitionen und der steigenden Produktivität ansteigen, der Druck der Fundamentaldaten sollte stärker sein als Manipulationen auf den Finanzmärkten. Dies war der Fall bei den asiatischen Tigerstaaten, bei denen die Abwertungen während der Asienkrise nur kurzzeitig auf das Preisniveau durchschlugen. Im Fall von China ist dies aber offenkundig nicht der Fall. Um die Frage noch zu verschärfen, zeigt die folgende Grafik die Entwicklung der chinesischen und der polnischen Durchschnittslöhne. (Bild vergrößern) Die Entwicklung läuft fast parallel. In beiden Ländern steigen die Durchschnittslöhne kräftig, in Polen vielleicht etwas stärker als in China, jedoch kann dies die unterschiedliche Entwicklung der PPP nicht erklären. Der Unterschied ist einer der Dimension. China hat 1,3 Milliarden Menschen, etwa ein Fünftel der Menschheit. Die Bewegungen auf den Weltmärkten kann das Preisniveau dieses Schwergewichtes nicht einfach so anlupfen, wenn es die eigene Regierung nicht will. Außerdem ist China auf dem Gebiet der Konsummärkte weitgehend Selbstversorger. Überall sonst steigt mit wachsenden Realeinkommen auch die Nachfrage nach Importgütern. Die chinesische Landwirtschaft dagegen kann seine Bevölkerung weitgehend selbst versorgen und auch die höherwertigen Konsumgüter stellt das Land selbst her. Autos, Handys und sonstige Elektronik, aber auch Kleidung und Möbel und die dafür notwendigen Vorprodukte werden im eigenen Land produziert. Importiert werden eigentlich nur Rohstoffe und (noch) Werkzeugmaschinen und andere Ausrüstungsgüter. Das Preisniveau der Konsumgüter kann sich daher von den Weltmarktpreisen weitgehend abkoppeln. Vom steigenden Konsum geht kein Druck auf die Währung aus. Warum will die chinesische Regierung keine Anpassung des Wechselkurses? Dies hat etwas mit den Kollateralschaden der oben schon erwähnten Plaza-Konferenz, benannt nach dem Tagungsort, dem New Yorker Plaza Hotel, zu tun. Damals beschlossen die G8-Staaten in einer informellen Konferenz ihre Währungen gegenüber dem damals stark überbewerteten Dollar aufzuwerten. In der Folge setzte der Yen zu einem beispiellosen Höhenflug an, bis zu einem PPP fast an der Marke 2.0, wie man in der Grafik oben sehen konnte. In China gilt dies als Hauptgrund für die japanische Depressionskrise in den 1990er Jahren. Seitdem haben Aufwertungen einen schlechten Ruf. Ein Urteil das man nachvollziehen kann, bedenkt man die Folgen der überbewerteten DM für Deutschland in den Jahren nach der EURO-Einführung. Das Risiko einer Wirtschaftskrise als Folge einer Aufwertung wiegt für die chinesische Regierung offenbar schwerer, als der Ärger mit den USA. Solange dies so ist, fahren die USA und China in Währungsfragen wie zwei Schnellzuglokomotiven aufeinander zu. So gesehen ist es nachvollziehbar, dass sich die Bundesregierung aus diesem Streit heraushält. Offenbar hat die Kanzlerin aus dem Irakdesaster gelernt, dass es sich nicht empfehlenswert ist, jede Eskalation der US-Politik mitzumachen. Eine Position, die jedenfalls solange funktioniert, wie Deutschland seine Werkzeugmaschinen (noch) profitabel nach China exportieren kann. In dem Augenblick, in dem China auch hier Selbstversorger wird und stattdessen qualitativ hochwertige Autos zu Dumpingpreisen auf den Containerschiffen aus China Richtung Deutschland reisen, wird es für die Bundesregierung schwierig werden, das Thema "Währungsdumping" weiterhin zu ignorieren. http://www.heise.de Von asiatischen Evas und Robotern als Zeitarbeitern Florian Rötzer 30.11.2006 Die weiblichen Roboter werden nach Schönheitsidealen kreiiert, in Japan werden die ersten Roboter von einer Zeitarbeitsfirma vermietet In Asien liebt man Roboter, besonders wenn sie möglichst menschenähnlich sind. Man scheint fasziniert zu sein, auch wenig besorgt, dass sie den Menschen überholen und ersetzen könnten, was die Europäer doch eher beunruhigt. Daher werden hier eher Arbeitsmaschinen entwickelt, während asiatische Techniker Roboter schätzen, die möglich realistisch wie Menschen aussehen und sich so verhalten. Die koreanische Eva Eine der letzten Fortschritte in dieser Hinsicht war die Roboterin – oder soll man eher sagen: Roboterfrau oder –weibchen? – EveR-1 oder Eve Robot 1. Die neue Eva, Version 1.0 bzw. 2.0, aus Korea ist, was die Ähnlichkeit von Gesicht und Körper betrifft, tatsächlich gut gelungen. Man muss wohl selbst erfahren, wie künstlich sie noch wirkt, wenn sie spricht und sich bewegt, bzw. der Roboter, der äußerlich als Frau auftritt, aber natürlich keine ist. Nach einem Video zu urteilen, wirkt alles noch sehr starr und ungelenk, auch wenn schon große Fortschritte geleistet wurden. Wenig verwunderlich ist, dass von den Wissenschaftlern des Korean Institute for Industrial Technology (KITECH) eine 20-jährige junge, 1,60 m große Frau dargestellt wurde, deren Gesicht nach den Vorbildern von zwei Stars gebildet und deren Körper dem einer Sängerin nachgebaut wurde. Vielleicht auch für die Gestaltung weiterer Evas haben sich nun die Wissenschaftler Kim Soo-jung und Chung Chan-subdie 171 koreanischen Schönheitsköniginnen – Miss Korea – seit 1977 genauer angeschaut, um zu erkennen, wie und ob sich das Schönheitsideal gewandelt hat. Tatsächlich wollen sie herausgefunden haben, dass – am deutlichsten seit 2000 – die jüngsten Schönen eine höhere Stirn und ein kleineres Kinn haben. Das zeige eine wachsende Präferenz für jüngere Frauen, da das Verhältnis von Stirn zu Kinn Ausdruck des Alters sei. Auch rundere Gesichter und vollere Lippen würden nun besser ankommen. Der Psychologe Kim Soo-jung weist darauf hin, dass deswegen viele junge Frauen sich kosmetischer Chirurgie unterziehen, um volle Lippen und längere Gesichter zu erhalten. Die vollen Lippen hat man bei der Robot-Eva vielleicht noch nicht als so wichtig erachtet, obwohl die Ausrichtung auf den Massengeschmack durchaus vorhanden war. Roboter lassen sich denn auch leichter variierenden Schönheitsidealen anpassen. Man muss jetzt nur noch darauf warten, welche Reaktionen es hervorruft, wenn immer mehr Menschen und Roboter nach Plan "schön" gemacht werden. Vielleicht sind die nächsten Models und Popstars ja auch bereits die Roboter mit ihren perfekten Körpern. Allerdings hat die koreanische Eva mit einer weichen Haut aus Silikon noch eine erhebliche Behinderung. Sie muss sitzen und kann höchstens aufstehen, aber nicht gehen. Dafür aber drückt sie durch Gesichtsmimik Gefühle aus. Mit ihren 15 Videokameras soll sie den Ausdruck ihres menschlichen Gegenübers deuten und diesem jeweils auch ihr Gesicht und ihr Augen zuwenden können. Mit einem Wortschatz von 400 Wörtern kann sie auch ein wenig Konversation betreiben und beispielsweise bei Ereignissen wie Messen oder anderen Ereignissen vorgeführt werden. Nun soll Eva aber zu einer Schauspielerin heranreifen, die gehen und sogar tanzen soll. Damit kommen die Gynaikoiden und Androiden zu sich, die zumindest bislang vornehmlich den Zweck erfüllen, Unterhalter zu sein. Bis 2010 soll Eva nicht nur tanzen und singen können, sondern auch intelligenter werden. Bislang hatten die koreanischen Robotikwissenschaftler die schöne Roboterfrau offenbar auch aus ästhetischen Gründen lieber nur sitzen lassen. Um gehen zu können, hätte sie dicke Beine benötigt, um all die Module und Motoren unterzubringen, sagt Baeg Moon-hong. "Dicke Beine sind für Humanoide in Ordnung, aber wir müssen alles in die dünnen Beine der Androiden packen, da diese wie wirkliche Menschen aus Fleisch und Blut aussehen sollen." Problematisch sei es auch, lange haltende Akkus in den kleinen Körper einzubauen. Die sitzenden Evas ließen sich noch über ein Stromkabel mit Energie versorgen. Damit können sie dünn wie Models sein. Die japanische Eva Die Japaner waren allerdings schneller die Koreaner und hatten schon vorher einen ersten weiblichen Androiden vorgestellt, der ebenfalls nur sitzen kann. Repliee Q1 wurde auch nach einer wirklichen Person gestaltet. Auch hier war öffentlicher Erfolg offenbar maßgeblich, auch wenn man kein Model nachbildete, sondern eine bekannte Nachrichtensprecherin. Der Robotikforscher Hiroshi Ishiguro von Osaka University ist der Überzeugung, dass man in nicht allzu ferner Zukunft bereits Roboter bauen kann, die Menschen täuschen können, so dass diese glauben, sie hätten auch einen Menschen vor sich. Jetzt würde die Illusion einige Sekunden lang anhalten können. Dabei kommt es aber nicht nur auf das Aussehen, sondern sehr stark auch auf das Verhalten und die Interaktion mit den Menschen an. Würde das hinreichend komplex und interessant sein, dann würden die Menschen auch schnell vergessen, dass sie es mit einem Roboter zu tun haben. Der schöne Körper als Haut und das Innere des Roboters: Repliee R1 von Hiroshi Ishiguro Bislang gibt es Roboter, die für bestimmte Arbeiten in der Industrie oder im Haushalt eingesetzt werden, Roboter, die mehr oder weniger intelligent und ausgefeilt sind, und als Spielzeug, aber auch als Entwicklungsplattform dienen, oder meist teure Vorführobjekte, deren Einsatz nur sehr begrenzt ist. Die 3 Millionen US-Dollar teure koreanische Eva ist beispielsweise mit dem Problem konfrontiert, dass sich bislang noch keine Versicherer für sie finden lässt. Solubot, die Firma, die EveR vermarktet, würde sie gerne öfter auftreten lassen. EveR-2, die zweite Version, die auch singen kann, konnte beispielsweise während der RoboWorld 2006 nicht auftreten, weil die Elektronik für den Hals ausfiel. Ein Versicherungssprecher sagte, dass Roboter keine Lebensversicherungen erhalten können, aber auch keine anderen Versicherungen, weil es keine Daten gebe, um ihren Versicherungswert und die Prämien zu berechnen. Die Japaner haben nun einen weiteren Schritt gemacht. Sie bieten – vermutlich versicherte – 225.000 US-Dollar teure Roboter zum Mieten gegen einen Stundenlohn als Helfer an. Die von dem Unternehmen Tmsuk hergestellten Ubiko-Roboter – für for "ubiquitous computing" oder "ubiquitous company" – werden bereits in Krankenhäusern eingesetzt. Dort begrüßen sie Besucher, beantworten Fragen und begleiten sie mitunter zu ihren Zielen. Dabei können sie auch Gepäck tragen. Allerdings muss man mache Fragen eintippen, um eine Antwort zu erhalten. Ubiko, der Mietroboter Angeboten werden die 113 Zentimeter großen Roboter, die auf Rädern fahren und keine Androiden sind, sondern funktionell, wenn auch ähnlich wie ein Lebewesen nach dem Kindchenschema mir großem Kopf, einem großen Auge und zwei Katzenohren gestaltet sind, beispielsweise für Schulen, Geschäfte, Flughäfen oder Bahnhöfe, aber auch für Veranstaltungen oder Feste. Sie können einfache Fragen verstehen und darauf antworten, so dass sie beispielsweise Auskunft geben oder als Führer dienen könnten, aber dann wohl auch eher als Attraktion oder amüsantes Spielzeug zu Werbezwecken dienen. Obgleich die Roboter angeblich Menschen in manchen Hinsichten ersetzen sollen, liegt der Stundenlohn noch eher in Prominentenhöhe mit 445 US-Dollar. Ob man daher, wie eine Sprecherin von der Leiharbeitsfirma Ubiquitous Exchange, die die Roboter zum Verleih anbieten, sagte, einen Ubiko in Schulen einsetzen wird, ist doch fraglich. Es sei denn, die Schulen werden für Lehrer immer gefährlicher, so dass sie erst einmal zum Testen einen Roboter vorschicken, um zu sehen, ob sie es wagen können, das Klassenzimmer oder die Schule zu betreten. In Schulen könnten sie, wie die Sprecherin meinte, "die Stimmung in einem Klassenraum prüfen und Schülern zur Beruhigung dienen, weil sie Rüpeleien unter ihnen verhindern können". Dazu freilich bräuchte man eigentlich keinen sprechenden und mobilen Roboter, mit Kameras und Mikrofonen ließen sich die Klassenzimmer auch überwachen, wenn man schon keine Lehrer hat. Mag sein, dass die Präsenz eines Roboters als menschlicher Stellvertreter mehr beeindruckt als bloß eine Videokamera an der Wand. Die Sprecherin der Zeitarbeitsfirma meint, dass Roboter große Vorteile haben: "Man muss ihnen nur Elektrizität geben, dann kann ein Roboter viele Stunden arbeiten, er kann auch sich wiederholende Arbeit machen – und man muss sich nicht um Arbeitsgesetze Sorgen machen." Zudem seien sie in manchen Hinsichten bereits besser als Menschen. Repliee R1 von Hiroshi Ishiguro Noch sind die "Aliens" oder die eher tierischen Lebewesen gleichenden Roboter billiger. Mit ihnen lässt sich womöglich auch leichter eine Beziehung herstellen, da die Menschen sich vermutlich eher diesen Kreaturen überlegen fühlen. Andererseits sind die Androiden der Zukunft uns ähnlicher und deswegen zunächst vertrauter, aber zugleich befremdlicher und bedrohlicher, da wir von ihnen getäuscht werden und die Skepsis dann auch auf andere Menschen übergreift. Die Androiden halten uns einen Spiegel vor. Man darf gespannt sein, was wir darin erblicken werden. Aber die Menschen werden nicht nur immer älter, sondern auch die Jüngeren immer weniger, dafür die Singles mehr. Vielleicht hält man sich dann ja auch lieber ein Roboterkind. Falls man nicht mehr will, muss man ja nur den Stecker ziehen oder den Akku rausholen oder man formiert die Festplatte neue und beginnt noch mal von vorne, wenn es nicht schon die nächste Version auf dem Markt gibt, die etwas schicker aussieht und mehr verspricht. Bilder !!!! www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24060/1.html http://www.heise.de Macht Fernsehen blöd und der Computer schlau? Rolf Sachsse 07.02.2002 Die PISA-Studie und die Medien Aufruhr in Klassenzimmern und auf den Fluren der Unterrichtsministerien, heftiges Rumoren am Stammtisch und in Elternbeiräten, nackte Angst bei SchulleiterInnen und in der Verwaltung: Seit am 4. Dezember 2001 die ersten Ergebnisse des OECD-Projekts PISA (Program for International Student Assessment) publiziert wurden, ist die schulische Welt Deutschlands noch mehr in Unordnung als bislang angenommen. Zwei Wochen nach den per Internet verbreiteten Ergebnisberichten waren alle Unterlagen als Buch[1] verfügbar, was zwar am Gesamtbild nichts änderte, aber die Details deutlicher werden ließ. Obendrein ist das jetzt Publizierte nur ein Vorbericht aus den international erhobenen Daten. Die eingehenderen deutschen Zusatz-Fragebögen werden noch ausgewertet; deren Ergebnisse werden für den Winter 2002/03 erwartet. Dann heißt es wohl nicht mehr wie in einem deutschen Intelligenzblatt Die Schule brennt, dann ist die Schule wohl bereits abgebrannt. Zunächst ein Mal ist das liebevoll gehegte Bild vom Volk der Deutschen als dem der Dichter und Denker weitgehend zerstört. Die Leistungen in den drei Kernfächern, die die Studie untersuchte – Reading, Mathematical, Scientific Literacy, nur unzureichend mit Lese-, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fertigkeiten zu übersetzen -, sind nicht nur unterdurchschnittlich, sondern teilweise katastrophal und werden nur noch von Schwellenländern wie Brasilien und Lettland unterboten. Als Glück im Unglück ist anzusehen, dass der Schwerpunkt der ersten Untersuchung – drei werden es bis 2006 insgesamt sein – das Lesen und nicht die Mathematik war; das Ergebnis wäre noch schlechter ausgefallen. Prinzipiell erschütternd sind nicht allein die unterdurchschnittlichen Leistungen, d.h., die Tatsache, dass nur etwa 30% deutscher SchülerInnen die Leistung erbringen, die in Ländern wie Korea, Japan und Finnland von mehr als der Hälfte abgeliefert werden. Als wesentlich schlimmer zu beurteilen sind die extremen Streuungen, mit der diese Unterdurchschnittlichkeit beobachtet wurde – deutsche SchülerInnen sind in ihrem Leistungsspektrum absolut unberechenbar, unvorhersehbar und dauerhaft unzuverlässig. Solange es sich um politische Inhalte und ästhetische Kategorien handelte, wäre dies ja ein subversiv großer Vorteil; dann kämen gerade die unerwarteten Arbeiten aus diesem Land. So aber heißt das Ergebnis, dass deutsche Manpower eine Größe ist, die in Zukunft vernachlässigt werden kann – und das bei einem Land, das bislang fast nichts Anderes exportiert hat, von etwas Feinmechanik und Optik abgesehen. Selbstverständlich: die Häme folgte auf dem Fuße. Kaum ein Blatt unterließ es, neben der Schelte schnelle Ideen zur Verbesserung der Situation fallen zu lassen, von der verbesserten Lehrerausbildung über kleinere Klassen zum Fremdsprachenunterricht im Kindergarten. Nach der Diagnose folgte die Schuldzuweisung: Eltern beschuldigen Kinder und Lehrer, diese die Eltern und die Schulbehörden, jene wiederum die Eltern und Politiker, und von dort heißt es, dass an allem nur die Verbeamtung der Lehrer schuld sei. Da alle Schreibenden und Lesenden wissen, dass derlei Schulden nur noch als Münze zirkulieren wie die alte DM, wurde weiter gesucht, und alsbald waren die Schuldigen gefunden: die Medien, vor allem das Fernsehen verblöden die Kinder. Die schnellen Bosse der deutschen Wirtschaft wussten es als Erste, und die unteren Chargen beten es nun als LeserbriefschreiberInnen in der Lokalpresse nach. Deutsche Kinder haben einen zu hohen Fernsehkonsum, setzen sich gewaltverherrlichenden Spielen zu lange aus, sind zu wenig bereit, sich mit einem guten Buch in die Lese-Ecke zu verziehen. Das letzte Argument ist als klassischer Fallrückzieher mit dem Effekt des Eigentors zu bezeichnen: Selbst didaktische Rahmenpläne sortieren das Lesen unter die schwierigen Tätigkeiten ein – und von Reading Societies hat hier zu Lande noch niemand je gehört, ein paar Universitäten ausgenommen. Dass ein deutscher Manager seine Reden mit Zitaten aus Literatur und Geisteswissenschaft würzt, gehört ebenso zu den Seltenheiten wie Politiker als Verfertiger stilistisch gekonnter Essays. Glücklicher Weise sind wenigstens die meisten Volkshochschulen inzwischen mit Kursen zur Alphabetisierung ausgestattet; eine notwendige Minimalvoraussetzung, die in diesem Kontext schon ein wenig gruseln lässt. Nur zögernd wurden Computer und Internet an Schulen eingeführt Die PISA-ForscherInnen wären ihr Geld nicht wert, wenn sie sich von den Voraussetzungen wie Ergebnissen her nicht mit dem Thema Medien auseinander gesetzt hätten. Sie orientierten sich an der Studie Klaus Hurrelmanns zum Video-Gewalt-Konsum aus dem Jahr 1993, die in ihrer Analyse bis heute unübertroffen geblieben ist: Nur exzessiver Konsum allerschwerster Gewaltdarstellung hat direkte Auswirkungen auf das soziale Verhalten, alles Andere manifestiert sich als Mix aus sozialen, psychischen und ökonomischen Ursachen heraus. Die PISA-Leute haben auch die angebliche Ungewohntheit der Multiple-Choice-Klausur und die ebenso angebliche Unlust deutscher SchülerInnen, an Übungen wie PISA mitzumachen, durch Begleitstudien im Vorfeld ausgeschlossen. Aus der gemeinsamen Betrachtung beider Aspekte ergibt sich für die Rolle der Medien im allgemeinen, funktional auf Erwerb von Fertigkeiten ausgerichteten Erziehungsprozess ein differenziertes Bild. Die Nutzung von Computern und Internet im schulischen Unterricht hat in Deutschland ungebührlich lang auf sich warten lassen.[2] Daran hat nicht allein die früher von mir unterstellte Unlust deutscher PädagogInnen zur Einführung dieser Instrumente in ihre tägliche Arbeit Schuld, sondern sicher auch das Beharren eines Distributionssystems von Schulbüchern und Lehrmaterialien auf gedrucktem Papier – und wer ein deutsches Mathematik-, Physik- oder Chemie-Lehrbuch anschaut, wird schnell gewahr, dass allgemeine Lesekompetenz in diesen Werken nicht gefördert wird. Nicht einmal der so oft gescholtenen Wirtschaft ist hier ein Vorwurf zu machen. Hervorragende Software, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird wie etwa das Verkehrsleit-Lernspiel Mobility von DaimlerChrysler, ist nur in geringen Stückzahlen abgerufen worden und wäre völlig unbekannt geblieben, wenn es nicht seinen Weg auf einige Free- und Shareware-CDs gefunden hätte. Ähnliches gilt für eine Reihe von perfekt produzierten Angeboten im Bereich Politik und Zeitgeschichte aus den verschiedenen Länder- oder Bundeszentralen für politische Bildung, die nur in geringen Stückzahlen abgerufen werden. Klar, es hat lang gedauert, bis jede Schule ihren Computer-Raum hatte, ihre Netzwerke konfiguriert, ihre Internetanschlüsse gelegt und finanziert hatte; und fünf Jahre nach der ersten Begeisterung fehlen die Mittel für Aufrüstungen, Verbesserungen, Reparaturen. Hier macht sich im internationalen Vergleich sicher eine weitere Umverteilung der Kosten extrem negativ bemerkbar: Mit dem ewigen Geschrei nach Senkung der Lohnnebenkosten nimmt die deutsche Industrie den Kommunen und Ländern die finanziellen Grundlagen für ein brauchbares Bildungssystem weg, während in den hochgelob- ten Ländern Japan, Korea und – sowieso – den USA das Schulgeld (samt Beförderung und Verpflegung der Kinder) ein fester Bestandteil eines jeden Arbeitsvertrages ist. In zunehmendem Maße gilt dasselbe für Finnland und Großbritannien, für Spanien und seit neuem teilweise auch für die Niederlande, mit jeweils leicht anderen Schwerpunktsetzungen in der Ausführung – etwa der kostenlosen staatlichen Beförderung von SchülerInnen und StudentInnen in den Niederlanden mit Patenschaftsverträgen von Firmen für Schulen. Dergleichen Modelle lassen sich mit ein wenig Phantasie in vielen Variationen erstellen. In Japan und Korea wiederum haben die extremen Grundstückskosten viele Familien die Konsumenten-Flucht nach vorn antreten lassen; hier sind Laptops schon seit den mittleren 90er Jahren fester Bestandteil eines jeden Kinderlebens. Das Geld, das in den genannten Ländern jeder einzelnen Schule für mediale Arbeitsmittel zur Verfügung steht, kann deutschen Rektoren die Tränen in die Augen treiben – vor Wut wie Scham. Im Humboldtschen Bildungsideal waren Medien nicht vorgesehen Doch das ökonomische Argument erklärt nur ein allgemein schlechtes Abschneiden, nicht die extreme Streuung der Ergebnisse. Die mögen einerseits auf den noch nicht abgeschlossenen Prozess im Hinblick darauf, ein Einwandererland zu sein, verweisen – und das ist zu Recht in fast allen Berichten zur PISA-Studie thematisiert worden – , sind aber andererseits Ausdruck eines grundsätzlichen Problems im Humboldtschen Bildungsideal, das jede Medialität des Lernens leugnet. Mit der Säkularisierung parallel zur Französischen Revolution ging ein tiefgreifender Bildersturm einher, der sich nicht auf das Abreißen und Ausplündern großer Klöster und ihrer Kirchen – von Cluny bis Ottobeuren – beschränkte, sondern die kritische Vernunft als bildlos instrumentalisierte. Nichts sollte mehr als Spur übrig bleiben, wenn große Denker ihre Ideen spannen; der reine Gedanken in einem schmucklosen Buch, das war das Ideal der Romantiker und Idealisten. Da waren schon Sokrates und Phaedrus weiter gewesen, denn sie hatten sich zum Diskurs umsichtig ein schönes Plätzchen in den Ölhainen und Weinhängen Attikas gesucht. Doch Kant und Schopenhauer, Fichte und Hegel kamen daher wie weiland die protestantischen Wanderprediger, das Pamphlet war formal ihr Ideal, der Anzug verschlissen, die Frisur wirr, der Habitus weltfremd. Die Medien, bildlich wie akustisch, waren jedoch für's Volk und wurden von ihm durch Kaufkraft eingefordert: Panorama, Manege, Zoo, Jahrmarkt, Photographie, Stereoskop, illustrierte Wochenblätter, Grammophon und schließlich Film zollten und forderten ihren Tribut an ästhetischen Überschüssen, an Allegorie, Groteske, Ornament und Symbol. Zu deren Distribution entwickelte sich aus handwerklichen Anfängen eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, aus den Intentionen philanthropischer Volksbildung wurden Infotainment, Disneyland und schließlich die Quizshow mit verteiltem Wissen per Multiple-Choice-Abfrage. Wobei Letztere bereits wieder die PISA-Situation darstellt, also die Lust am Wissen besonders gut hätte vorführen müssen. Schief gelaufen – im Sinne der Absätze an den Schuhen wie der Paragraphen in schulischen Curricula – ist innerhalb dieser Entwicklung allerdings ein spezifisch deutsches Problem: der mangelnde Ausgleich zwischen Ideologie und Pragmatik. Und der zeigt sich überdeutlich im Umgang mit Bildern als Teil von Bildung. Bilder zum Lernen unter den Bedingungen der einer Aufmerksamkeits- und Wissensökonomie Wer die Unterrichtsmaterialien amerikanischer und skandinavischer Kindergärten kennt, hat den Unterschied zur deutschen Praxis gleich vor Augen. Keine Angst vor Plastik, keine Bange vor komplexen Aufgaben, starke Farbigkeit – nicht nur das anthroposophische Orange – und schnelle Beglückung durch Erfolg kennzeichnen Vorschulspielzeuge dieser Länder. Ein fester Tagesablauf, der auch die elterliche Verantwortung zu rechtzeitiger Kinderablieferung und gut terminierter Abholung einschließt, mit bedarfsgerecht eingeplanten Essenszeiten führt die Kinder unmerklich in situative Bedingungen einer Aufmerksamkeits- und Wissensökonomie ein. In diese Regelung fallen auch klar definierte Zeiten von gemeinsamem Medienkonsum und individueller Medienaktivität, die in dieser Form von den Kindern als deutlich getrennt erlebt werden. Nur setzt ein solcher Umgang mit Medien auch technische Kompetenz voraus, die hierzulande kaum erwartet werden kann und darf. Wesentlicher Faktor japanischer und amerikanischer Vorschulerziehung – die hier nur als paradigmatisch für mediale Verhaltensformen herangezogen werden, nicht etwa aus einer unreflektierten Begeisterung heraus (derlei Unterstellungen prägen deutsche Bildungsdebatten ja schon seit Jahrzehnten und sind im PISA-Umfeld nur noch schärfer geworden) – ist die Trennung von Lesen und Schreiben. Alle kognitionstheoretischen Überlegungen der letzten Jahrzehnte gehen dahin, dass frühe Leseübungen einer bildhaften, ikonischen Einprägung von Worten entsprechen; in der deutschen Ganzheitsmethode war dies ja auch Grundlage gewesen, nur von den ErzieherInnen in der Praxis derart heftig hintertrieben worden, dass die Methode insgesamt in Verruf geriet. Bei der PISA-Studie haben sich gerade jene Länder in der Literacy-Qualifikation bewährt, die vor rund zehn Jahren – auf Grund der Inkompatibilität ihrer Schriften zum westlichen Englisch als lingua franca – neue Leseformen eingeführt haben: Korea und Japan. Das Beispiel lässt sich in alle (vor- und) schulischen Wissensgebiete übersetzen: Wo Bilder sind, helfen sie schneller und direkter memorieren, verlangen aber eine andere Struktur der Vor- und Aufbereitung. Es gibt derzeit keine schnelleren und weiter reichenden Bildermedien als das Fernsehen und das Internet, die sich in dieser Hinsicht bislang auch noch perfekt ergänzen und in Bälde wohl zusammenfallen. Das Fernsehen liefert die Bilder frei Haus, und nicht nur Durs Grünbein wundert sich darüber, dass Paul Virilio seit dem 11. September 2001 kein Fernsehen mehr sehen mag.[3] Die Initiative zum Bildersehen wird natürlich geübt, von der Fokussierung der Mutter über die Drehung des Bildes zum aufrechten Gang bis zu den medialen Einflüssen, die heute selbstverständliche Bestandteile der kindlichen Umwelt sind. Dieser Aufweckung durch Bilder folgt die Bearbeitung, zunächst die Verschiebung in die Raster der verschiedenen Speicher namens Gedächtnis und dabei die Harmonisierung des Einzelnen zum Ganzen. An dieser Stelle setzt Lernen ein, strukturiert – über das mittelalterliche Trivium von Grammatik, Rhetorik und Dialektik – das Gesehene und macht aus der oder dem naiv Erfahrenden eine oder einen reflektierten Erwachsenen. Insofern stimmt das PISA-Ergebnis – und doch nicht. Schule setzt zu spät ein und ist grundsätzlich unbildlich. Das Trivium ist eben nicht trivial; die LehrerInnen sind im Umgang mit Bildern schlecht erzogen – also nicht ausgebildet – und miserabel motiviert. Über das 'Guck hin' ist eine sprachliche Reflexion auf das Gesehene nicht zu leisten; und wer sich einmal die im Netz angebotenen Essentials zum Lesen und Schreiben entsprechender Grundschuldidaktiker anschaut, muss wieder feststellen, dass der Umgang mit Bildern peinlichst vermieden wird. Für Didaktiker und Pädagogen scheinen Bilder nur Metaphern zu sein, lange nach dem Spracherwerb zu bearbeiten, möglichst nur in schriftlicher Form. Damit kann im Internet ebenso wenig operiert werden wie vor dem Fernsehbildschirm und sind Missverständnisse geradezu vorprogrammiert. Für die deutsche Industrie passt auch dieses Bild wieder: In Zeiten größerer Streikandrohungen ist bildhaftes Handeln sehr gefragt: "Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will" als gegenseitiges Zitat. Nur: Von wem der Satz stammt, haben Alle vergessen. Auch ein PISA-Problem? http://www.heise.de World Wide Dead – Selbstmordhilfe aus dem Netz Michaela Simon 23.12.2000 Südkoreanische "Suicide Sites" verkaufen den Tod "Wir trafen uns auf einer Selbstmordwebsite.", sagte der 26 jährige Student gegenüber der Polizei. Eigentlich wollte er den Tod seiner zwei Bekannten – ebenfalls Studenten – nur anonym melden, doch sein Anruf wurde zurückverfolgt. Szene aus Futurama Nach Berichten der Korea Times und des Korea Herald ist dies der erste Selbstmord in Korea, der unter dem Einfluss einer Website zustande kam. "Wir alle redeten nur über Selbstmord, die beiden taten es.", sagte der Gesinnungsgenosse, der dabei war, als die beiden Opfer in einem Motelzimmer in Kangnung Gift tranken. In der körperlosen Anonymität des Netzes können Todeswünsche sicherlich ungenierter artikuliert werden als anderswo. Dem Korea Herald zufolge gibt es zwischen 300 und 500 südkoreanische Selbstmordseiten, wie viele von der Durchführung abraten und wie viele schmerzfreie Möglichkeiten oder aktive 'Hilfe' andienen, das wollen die Ermittlungsbehörden nun herausfinden. Das kündigte der 'cyber crime investigation squad' der Seoul Metropolitan Agency an, zusätzlich plane man eine vergleichende Studie mit Japans Behörden zum Thema Massenselbstmord und Selbstmordhilfe. Es sei eine Grenzlinie zu ziehen, nach deren Überschreitung ein Verbot der Websites und eine Strafe angemessen sei. "Ich habe ihn getötet, weil er mich darum gebeten hat.", sagte der 19jährige, der sein Opfer ebenfalls auf einer "Suicide Site" kennen gelernt hatte. Nach einem – alles andere als virtuellen – Stich in den Bauch ließ er seinen Auftraggeber auf einem Parkplatz in Seoul liegen. Für seinen Tod, er wollte ihn, weil seine Freundin gestorben war, hatte der Junge seinem Mörder umgerechnet etwa tausend Dollar bezahlt. Etwa zehn e-Mail-Anfragen nach einem "suicide contract" seien über die "Suicide Site" an ihn gelangt, so der Jugendliche, der überzeugt ist, den Lebensmüden zu "helfen". Die beiden Studenten im Motelzimmer seien ursprünglich auch Kunden von ihm gewesen. Bei seinem Versuch den einen zu erwürgen, sei es jedoch zu einem Kampf gekommen worauf er die "Hilfeleistung" abgebrochen habe. Es habe auch mit anderen Kandidaten schon mehrere solcher abgebrochenen Versuche gegeben. Südkorea stellt einen der am schnellsten wachsenden Internetmärkte der Welt. Von 47 Millionen Menschen nutzt etwa ein Drittel das Internet. http://www.heise.de Japan sehen – und dann sterben? Michaela Simon 13.12.2005 Tour de Force durch die japanische Sexindustrie: "Tokio" von Mo Hayder und "Wenn es Nacht wird in Tokio" von Don Lee Mädchen kommt nach Tokio. Mädchen wird Hostess in Sexclub. Mädchen trifft Jungen. Mädchen überlebt – oder auch nicht. Ein guter Plot? Vielleicht der Plot des nächsten Jahrzehnts. Japan ist Tomorrowland und die japanische Nacht der perfekte Ort für junge westliche Frauen, die ihre Identität finden oder verlieren wollen. So geschehen in "Tokio" und "Wenn es Nacht wird in Tokio". Zwei Bücher, die trotz der vielen Gemeinsamkeiten nicht viel gemein haben. Mo Hayders "Tokio" ist ein Paukenschlag. Hayder, "einer der strahlendsten Sterne britischer Spannungsliteratur" (Publishers Weekly), hat sich seit ihrem letzten Erfolg von Nekrophilie zum Kannibalismus vorgearbeitet. Einmal mehr treffen wir die Bestie Mensch in all ihrer erdrückenden und drastischen Schrecklichkeit. Menschenopfer, Gedärme, Perversion – und Unwissenheit. Die Engländerin Grey ist nach einer Jugend im Irrenhaus und einigen anderen furchtbaren Vorkommnissen aus geheimnisvollen Gründen besessen von den Kriegsverbrechen japanischer Soldaten in Nanking 1937. Auf Umwegen über die japanische Sexindustrie gelingt es ihr in Tokio, ihre private Hölle auszuloten. "Die Vergangenheit ist wie eine Bombe, und wenn man ihre Splitter erst einmal in sich trägt, werden sie ihren Weg auch an die Oberfläche finden" schreibt Hayder. Diese blutigen Splitter präsentiert sie mit einer gewissen Eleganz. Und doch hat man am Schluss das Gefühl, mit einem Holzhammer geschlagen worden zu sein. Das Massaker im chinesischen Nanking spielt in der Psychologie der Heldin eine schwer nachvollziehbare Rolle und bekommt einen merkwürdigen Indiziencharakter. In dieser zutiefst privatistischen Welt ist das Verbrechen weniger ein Feind als ein Komplize. Hayder, die, wie ihre Heldin Grey, selbst einmal als Hostess in Tokio gearbeitet hat, ist eben eine echte Bestsellerautorin. Und Don Lee, dessen in der Bibliothek angelesene Sexmilieuschilderungen lebendiger und genauer sind, ist eben ein echter Autor. Lees Roman, der im Original "Country of Origin" heißt, ist eine witzige und manchmal auch furchtbar traurige Situationsbeschreibung, der Krimi-Plot lediglich Beigabe. Lee hält die Bälle flach, schreibt einfach und cool, wie in einem klassischen Agentenkrimi. Man fühlt sich wohl mit diesem Autor, dem man anmerkt, dass er seine Figuren liebt. Sie alle machen im Laufe des Buches eine Entwicklung durch. Es sind Menschen wie Tom Hurley, ein unaufrichtiger, prinzipienloser Botschaftsangestellter, halb Weißer, halb Koreaner, der sich in die Frau eines japanisch-amerikanischen CIA-Agenten verliebt. Tom denkt eigentlich nur ans Vögeln, soll aber ein verschwundenes Mädchen suchen und trifft dabei auf unseren Helden: Kenzo Ota. Der schrullige japanische Kriminalassistent ist geschieden, hat ohne Erfolg einen Witzkurs besucht und wagt es nicht, mit seinen Kollegen um die Häuser zu gehen, weil er keinen Alkohol verträgt. Ota ist aus all diesen Gründen im Großraumbüro der Polizei einer der madogiwazoku. Die so genannten Fensterleute sitzen ihres jämmerlichen Status wegen am Fenster und sind schmählich abgeschnitten von den anderen und deren wichtigen Fällen. Für Ota ist das Verschwinden der jungen Frau afroamerikanisch-asiatischer Herkunft, ein wichtiger Fall, weil es sein einziger ist. Das verschwundene Mädchen heißt Lisa Countryman und sie wird in Tokio finden, was sie gesucht hat – und was sie nicht gesucht hat. Wie auch in seiner Erzählsammlung "Yellow", ist Lees Sujet die Suche nach Identität in multiethnischen Gesellschaften. Lee selbst ist Korea-Amerikaner, in seinen Jugendjahren als Sohn eines Angestellten des State Departments in Tokio und Seoul aufgewachsen. "Können wir ausnahmsweise einmal nicht über Rassismus sprechen?" fragt in "Country of Origin" eine Amerikanerin polnischer Abstammung die Kollegen in der Tokioter Botschaft. Und natürlich kontert ihr Liebhaber sofort mit einem Polenwitz. Don Lee würde diese Frage mit der Geschichte beantworten, wie er in einem Buchladen einen jungen Mann traf, der auch Amerikaner koreanischer Herkunft war und der ihn fragte 'ich will Schriftsteller werden. Muss ich darüber schreiben, wie es ist, Korea-Amerikaner zu sein?'. -------------------------------------------------------------------------------Meine Antwort war: Nein, das musst du nicht, weil ich es für dich tue. Meine Generation muss sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, damit die nächste Generation es nicht mehr nötig hat und einfach nur Geschichten erzählen kann. http://www.heise.de sehr guter Artikel über Kino/Japan Tomorrowland Rüdiger Suchsland 18.01.2004 Vom Exotismus zur Utopie – die neue Japanmode, nicht nur im Kino Eine gute Mischung: Zen-Philosophie, Samurai-Kampftechnik, viel grüner Tee und noch mehr Spaziergänge an frischer Luft sind nötig, damit ein traumatisierte Amerikaner wieder zu sich findet. Edward Zwicks Film "Last Samurai" (seit 8.1. im Kino) beschreibt einen ungewöhnlichen Lernprozess – für das Hollywood-Mainstream-Kino kommt er sogar einer kleinen Sensation gleich: Denn Tom Cruise alias Nathan Algren, ein US-Offizier, der in den Indianerkriegen zum selbstmordgefährdeten Trinker wurde, ist in diesem Film ein Held, der kaum etwas besser weiß, der nicht unglücklichen Wilden den "american way of (better) life" lehrt, sondern selber stellvertretend für sein Publikum etwas lernt – nämlich Neugier auf und Achtung vor einer fremden, zunächst schwer verständlichen Kultur. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten des "war against terror", in denen auch Hollywood von der BushAdministration in die patriotische Pflicht genommen wird. Am Ende des Films ist Cruise ein echter Samurai geworden, der leidlich Japanisch spricht und viele Werte des alten Japan verinnerlicht hat. Nach Amerika wird er nicht zurückkehren, er verachtet seine Landsleute, die in diesem Film vor allem als korrupte Händler und Imperialisten gezeigt werden, und seine Verwandlung nur ratlos kommentieren: "Why do you hate your people so much?" Zumindest was die erwähnte Diät angeht, ist Cruise/Algren durchaus repräsentativ für viele seiner heutigen Landsleute und ganz allgemein eine Menge Menschen in der westlichen Moderne. Asien im Allgemeinen und Japan im Besonderen sind chic wie selten: Der Gang zum Sushi-Restaurant an der Ecke ist ebenso eine Selbstverständlichkeit wie Essen mit Stäbchen, das regelmäßige Training in Kendo oder anderen japanischen Kampfsportarten, aber auch die Übung in Zen-Meditation. Viele Kids in westeuropäischen Metropolen haben Donald Duck und Asterix längst mit Manga-Büchern vertauscht, ihre Eltern räkeln sich derweil auf ihrem Futon und lesen den neusten Murakami-Roman, blättern zur Abwechslung in einem Bildband des Pop-Architekten Yoshio Taniguchi oder sie schnippeln einfach geduldig am Bonsai auf der Fensterbank. Dazu läuft – pling-plang-plong -Reiki, altjapanische Klangschalenmusik zur Beruhigung. Längst ist – von der Tütennudelsuppe bis zum YamamotoBademantel – japanischer Lifestyle in unseren Alltag integriert. Doch nun, das lässt sich unter anderem am Kino ablesen, scheint sich endlich auch die Wahrnehmung Japans zu ändern – vom mit exotistischer Neugier skeptisch-fasziniert beäugten Fremden wird Japan zur neuen Utopie, zur besseren Variante der vertrauten Moderne. Tokio Story Zeitgleich mit "Last Samurai" startete jetzt noch ein anderer Film: "Lost in Translation", das gefeierte zweite Werk von Sofia Coppola, der Tochter des großen New-Hollywood-Helden Francis Ford Coppola, erzählt in zarten, hochsensiblen Bildern die scheinbar abgegriffene Geschichte vom alten Mann und dem Mädchen noch einmal ganz neu und ungewöhnlich. Zu den vielen Besonderheiten dieses Films gehört, dass seine zwei Hauptfiguren in einem Luxushotel in Tokio gestrandet sind. Während der Nächte, in denen sie vor lauter Jet Lag und Melancholie nicht schlafen können, erkunden sie ein hypermodernes Tokio, das in seiner chaotisch-undurchschaubaren und doch faszinierenden Gestalt zum Spiegel ihrer inneren Desorientierung wird. Ein "Reich der Zeichen", wie es einst schon der französische Semiologe Roland Barthes ebenso beschwor, wie überhaupt erst erfand. Dabei lehnt sich Coppola auch stilistisch an ihren Schauplatz an: Die Bilder des Films sind hell, pastellfarben, irgendwie verträumt, fragmentarisch und dabei tiefemotional. Zumindest in ihrem Oberflächenantlitz erinnern sie damit an japanisches Kino. Wie die Figuren driftet auch die Kamera durch die Nacht, unterstützt von präzis gewählter Elektropop-Musik, die alles in Trance zu tauchen scheint. Als ob die Bilder schlafwandeln würden. In japanisches Kino verliebt hat sich offensichtlich auch Quentin Tarantino. Erst vor wenigen Wochen kam "Kill Bill No.1" ins Kino, der zweite Teil folgt im März. Hierin schickt der Kritikerdarling Uma Thurman als einsame Rächerin in ein Zauberreich, das aus den Posen und Zeichen, Tagträumen und Stilen des asiatischen, vor allem des japanischen Kinos zusammengesetzt ist. "Gelbe Gefahr" Keine Frage: Japan ist auch im Hollywood der Gegenwart offensichtlich ganz groß in Mode. Woher kommt dieses plötzliche Interesse? Und was bedeutet es? Dass man sich im Westen für Asien interessiert, ist an und für sich gar nichts Neues. So zahlreich wie regelmäßig sind seit den ersten Reiseberichten aus Japan Mitte des 18.Jahrhunderts die Wellenbewegungen in denen das Land regelmäßig für eine gute Dekade lang Mode wurde. Doch lange Zeit blieb solches Interesse vor allem durch "Orientalismus" (Edward Said) bestimmt: Japan wurde primär als etwas sehr Fremdes, sehr Anderes angesehen, eine unverständliche, irgendwie auch unheimliche Region, die ein wenig zurückgeblieben schien, und im Zweifel auch ziemlich bedrohlich – eine "gelbe Gefahr." Der zweite Weltkrieg mit Japans imperialen Träumen, der brutalen Kolonialherrschaft in den eroberten Territorien, das Bündnis mit den faschistischen Achsenmächten und schließlich der Überfall auf Pearl Harbour gaben solchen Vorstellungen zusätzliche Nahrung. Auch im Kino war das nicht anders. Noch in den späten 80ern sorgten ein Hollywoodfilm für Furore: In "Black Rain" ließ Ridley Scott Michael Douglas als US-Polizist durch ein dunkles undurchschaubares Tokio taumeln. Manche warfen dem Film Rassismus in der Darstellung der Japaner vor. Doch "Black Rain" – der Titel bezieht sich übrigens auf den Ascheregen nach dem Atombombenabwurf von Hiroshima – ist schon doppelbödig: Bei der Douglas-Figur handelt es sich um einer frustrierten Zyniker, einen "schlechten Polizisten", der durch die Begegnung mit einem japanischen Kollegen wieder Selbstachtung bekommt, und ein "guter Polizist" wird. Nebenbei führt diese Lektion in japanischer Lebensart auch zu einem besseren Verständnis für Japan und seine Menschen – und zu einer Ahnung von Schuldgefühl für amerikanische Kriegstaten, etwa die beiden Atombombenabwürfe 1945. Doch auch in solchen Filmen bleibt Japan immer noch "das Andere", der ehemalige Feind. Japan fungiert hier, wie sogar noch in "Last Samurai" als disziplinierter und spiritueller Gegenpol zu einem chaotischen Amerika, als die von Tradition, Hierarchien und aristokratischen Werten geprägte Alternative zu einer demokratischen, von "Kontingenz und Ironie" (Richard Rorty) dominierten, "transzendental obdachlosen" Moderne. Ignoranz & Flexibilität Was dagegen heute am zeitgenössischen Japan fasziniert, ist genau diese kontingente, ironische, westliche Moderne, die im "Reich der aufgehenden Sonne" sich noch weitaus rasanter und ungebändigter zu entfalten scheint. Wenn man irgendwo das Diktum Rimbaud'scher Poesie – "Il faut etre absoluement moderne" – ernst nimmt und in den Lebensalltag übersetzt, dann hier: In Japan kann man einer Freiheit begegnen, die aus Unübersichtlichkeit und Unordnung entsteht. Und man ahnt, dass Desintegration und Dekadenz auch eine Chance für individuelle Befreiung werden können. Dass Japan trotzdem – auch – eine rigide Disziplinargesellschaft ist, soll dabei gar nicht bestritten werden. Bestritten werden soll, dass dies die westlichen Gesellschaften weniger sind. Sie sind es nur anders, und wir westlichen Beobachter sind unsere Formen von Disziplinierung und Kontrolle derart gewohnt, dass wir sie kaum noch wahrnehmen – und die japanischen um so mehr. Einzigartig ist die Mischung aus Ignoranz und Flexibilität, mit der dieses Land auf seinen kulturellen Traditionen besteht, und sie trotzdem geschmeidig noch mit den radikalsten Schüben technischer oder sozialer Modernisierung zu versöhnen versteht. In manchem wirkt Japan hier wie eine verschärfte Variante der USA – und ist doch zugleich unübersehbar auch ein kultureller Gegenentwurf zum dominierenden Amerikanismus, dessen gerade zur Zeit manch einer überdrüssig ist. Und nur ein völlig fremder Ort, der gleichzeitig so modern und uns so ähnlich ist, erlaubt noch den schamlos-neugierigen Blick auf das Fremde. Hinzu kommt derzeit noch eine weitere, kürzlich neuentdeckte Verwandtschaft: Die Wirtschaftskrise, die der Westen gerade erlebt, kennt Japan schon seit Ende der 80er Jahre – und ist längst gewohnt, was man im Westen gerade mühsam zu lernen beginnt: Gut mit der Krise zu leben. Die immense Produktivität Japans, die Phantasie seiner Erfinder, wird durch Börsenstagnation und politischen Reformstau ebenso wenig eingeschränkt wie die Kraft der japanischen Ästhetik. Vielleicht kann man heute auch gerade das von Japan lernen. Nach wie vor steht Japan für Hypermodernismus in jeder denkbaren Form, für das beste Industriedesign der Welt und wild-faszinierenden Stilmix. Man kann dies ebenso in der schrillen Warenwelt von Kinderlabels wie "Hello Kitty", wiederfinden, wie in der phänomenal-futuristischen japanischen Architektur, in den Offensiven der "Tamagotchi", "Pokemon" und "Digimon"-Spiele, in Anime-Filmen wie schon vor Jahren "Ghost in the Shell", zuletzt "Chihiro im Zauberreich" – mit dem vor zwei Jahren erstmals ein Anime mit der Berlinale ein A-Filmfestival gewann -, oder den märchenhaften Filmen Takeshi Kitanos, an japanischem Werbedesign und Kommunikationstechnik, an schrillem Nippon-Dudelpop, den Kitsch-Universen des ganz normalen, für unsereins trotzdem unvorstellbaren Wahnsinns japanischer TV-Sender und der Neonkulisse der Großstädte. Wer – und sei es nur virtuell – nach Japan reist, fährt nach "Tomorrowland" (William Gibson). Diese Erfahrung machten auch Coppola und Tarantino und sie verarbeiten sie in ihren Filmen. Vielleicht müssen die Filmemacher und wir alle aber trotzdem bald umdenken. Denn mehr und mehr macht ein anderes, lange vernachlässigtes Land von sich reden: China. Schon heute gilt Shanghai, nicht mehr Tokio, als die Hauptstadt der gegenwärtigen Dekade. Und genaugenommen entdeckt das Kino neben Japan allmählich auch den übrigen fernen Osten neu. So hat kein Film für Hollywoods Hinwendung weg von Old Europe, hin zum pazifischen Westen mehr getan, als die schwebenden Martial-Arts-Kämpfer in "Tiger & Dragon" – vom Chino-Amerikaner Ang Lee. Im Osten geht die Sonne auf. http://www.heise.de Email: die neue Schneckenpost Florian Rötzer 03.12.2004 In Südkorea benutzen die jungen Menschen nach einer Umfrage kaum mehr Email, weil sie zu langsam ist Mit der Email als Kommunikationsform geht es zu Ende, sagen koreanische Wissenschaftler. Grund dafür ist aber nicht die Überschwemmung mit Spam-Mails, die die elektronsichen Briefkästen zumüllen, sondern die Ungeduld der nachwachsenden digitalen Generation. Email hatte einst den normalen Brief als "snail mail" (Schneckenpost) abgelöst. Nun gilt sie selbst als solche. Will man der Professorin Lee Okhwa glauben, die Computerbildung an der Universität Chungbuk lehrt, dann ersetzen Instant Messenger, SMS und Mini-Homepages, von denen es in Korea bereits über 6 Millionen geben soll, die Kommunikation über Email. Zumindest in Korea, wo Email als altes Kommunikationsmittel gilt. So sagt ein Student, dass er Email nur benutzt, wenn er mit älteren Menschen zu tun hat. Eine junge Frau meint, sie benutze ihren EmailAccount nur noch für den Empfang von Handy- und Kreditkartenrechnungen. Nach einer Umfrage von Lee Okhwa unter 2.000 Schülern und Studenten hätten zwei Drittel gesagt, dass sie selten oder gar nicht Email benutzen. Interessant daran sind die Begründungen, die die Wissenschaftlerin herausgefunden hat. Bei Emails sei man sich nicht gleich sicher, ob diese den Empfänger erreicht hätten, zudem würden Antworten nicht gleich kommen. Aber gewünscht wird nicht nur unterbrechungslose Echtzeit-Kommnikation als solche, sie ist auch deswegen notwendig, weil die jungen Menschen Kommunikation als Spiel verstehen. Längere Unterbrechungen sind dann natürlich fade, wenn Zug auf Zug erfolgen soll. Dazu würde auch passen, dass Email eher als eine Art der Arbeit oder als Machen von Hausarbeiten verstanden wird. Der homo ludens scheint sich also mit dem Computer und dem Internet durchzusetzen, allerdings war wohl der Computer mit seinen interaktiven Möglichkeiten immer schon weniger Maschine als Spielzeug. -------------------------------------------------------------------------------Die neue Generation hasst Langeweile und Warten. Sie neigt dazu, ihren Gefühlen sofort Ausdruck zu verleihen. Der Niedergang der Email ist eine natürliche Folge von solchen Eigenschaften der neuen Generation. - Lee Okhwa Die Umfrage scheint von Statistiken bestätigt zu werden. So steigt die Zahl der verschickten SMS stetig an. Allein die SK Telecom, der größte koreanische Telekommunikationsprovider, meldet, dass in diesem Oktober 2.7 Milliarden SMS verschickt wurden – 40 Prozent mehr als im selben Monat vor einem Jahr. CyWorld, Anbieter von Mini-Homepages, berichtet, dass die Pageviews im selben Zeitraum um das 26-Fache von 650 Millionen auf 17 Milliarden zugenommen haben. Gleichzeitig sind die Pageviews bei dem größten Email-Anbieter um 20 Prozent zurück gegangen. http://www.heise.de Zweibeinige Roboter und Rettungsroboter Hans-Arthur Marsiske 31.03.2005 Höhepunkte der diesjährigen RoboCup German Open vom 8. bis 10. April in Paderborn Im vergangenen Jahr war die Stimmung bei den offenen deutschen Meisterschaften im Roboterfußball eher verhalten gewesen. Die Mehrzahl der Teams kam bereits zum vierten Mal ins Heinz-NixdorfMuseumsforum in Paderborn. Man kannte sich, kannte die Räumlichkeiten, packte routiniert die Kickmaschinen aus und ließ sie weitgehend unaufgeregt aufeinander los. Das soll diesmal anders werden. Humanoider Roboter der Darmstadt Dribblers vom Institut für Informatik, Fachgebiet Simulation und Systemoptimierung, der Technische Universität Darmstadt (Prof. Dr. Oskar von Stryk) Zwar finden auch die fünften RoboCup German Open wieder am gleichen Ort statt, da das größte Computermuseum der Welt von den technischen Voraussetzungen her praktisch konkurrenzlos ist. Die Raumaufteilung hat sich jedoch grundlegend geändert. Unten im Auditorium ist es für die Liga der mittelgroßen Roboter zu eng geworden. Das mittlerweile 8 mal 12 Meter große Spielfeld wird jetzt im dritten Stock aufgebaut. Dort soll auch das Trümmerfeld errichtet werden, in dem die Rettungsroboter zeigen sollen, was sie drauf haben. Der Wettbewerb der Rescue Robot League findet zum ersten Mal im Rahmen der German Open statt. Im Unterschied zu den Fußball-Ligen dürfen die Roboter hierbei ferngesteuert werden. Das Ziel ist es, mithilfe der Roboter möglichst schnell einen möglichst genauen Überblick über ein Katastrophengebiet zu gewinnen. Bewertet wird die Gesamtleistung mit einem komplizierten Punktesystem, in das unter anderem die Zahl der lokalisierten Überlebenden, die Erstellung genauer Umgebungskarten, aber auch der durch den Roboter eventuell angerichtete zusätzliche Schaden einfließen. Das Design der Roboter in dieser Liga ist sehr vielfältig, bei den RoboCup-Weltmeisterschaften kamen hier auch schon Schlangenroboter zum Einsatz. Robo-Erectus vom Advanced Robotics and Intelligent Control Centre am Singapore Polytechnic Ebenfalls neu bei den German Open sind humanoide Roboter. Zwar gibt es noch keinen Wettbewerb in dieser Kategorie, aber immerhin Demonstrationsspiele. Teams von den Universitäten Freiburg und Osnabrück haben hier etwas vorbereitet, was selbst bei Weltmeisterschaften noch nicht zu sehen war. Die Zweibeiner werden ihre Kickfertigkeiten im Auditorium unter Beweis stellen, wo auch vierbeinigen Aibos und die kleinen, schnellen, von einer zentralen Kamera gesteuerten Roboter ihr Turnier ausfechten. Daneben, auf der Wechselausstellungsfläche, wo bislang das zweite Feld der Middle Size League aufgebaut wurde, werden diesmal die Juniorenteams ihren Platz haben. 111 Schülerteams mit insgesamt 260 Mitgliedern haben sich angemeldet, um in den drei Kategorien Fußball, Tanz und Rettungsszenarien zu zeigen, wie gut sie ihre Roboter zusammengebaut und programmiert haben. In den Seniorenteams werden etwa 60 Teams mit 700 Teilnehmern aus 12 Ländern erwartet. Erstmals dabei ist ein Team aus Kanada. Im Foyer des Heinz-Nixdorf-Museumsforums gibt es schließlich noch eine Neuerung: Hier werden die Fußballroboter der FIRA ihr Können demonstrieren. Die FIRA ist neben der RoboCup Federation eine weitere internationale Organisation, die das Fußballspiel als einheitliche Testumgebung für autonome, kooperierende Roboter etabliert hat. Sie ist sogar die ältere von den beiden und hat ihre Wurzeln in Korea, während der RoboCup maßgeblich von Japan aus initiiert wurde. Hinsichtlich der Regeln sind die Unterschiede zwischen ihnen nicht allzu groß, allerdings ist dem RoboCup mit der klaren Zielsetzung, bis zum Jahr 2050 mit humanoiden Robotern den menschlichen Fußballweltmeister schlagen zu wollen, eine stärkere Fokussierung gelungen. Dennoch ist schwer einzusehen, warum die Informatiker, Mechatroniker und Ingenieure ihre Kräfte in zwei konkurrierenden Verbänden verzetteln sollen, die ihre Existenz im wesentlichen wohl Rivalitäten zwischen Korea und Japan verdanken. Bei den nationalen Roboterfußball-Meisterschaften in China ist es längst üblich, RoboCup und FIRA gleichzeitig am selben Ort zu veranstalten. Dass jetzt auch in Deutschland eine Annäherung erfolgt, ist ein gutes Zeichen und lässt hoffen, dass beide Verbände über kurz oder lang zu einem verschmelzen könnten. Auf jeden Fall lassen all diese Neuerungen auch spannende German Open erwarten. Es wird voraussichtlich das letzte große Roboterfußballturnier in Deutschland sein – bis dann am 13. Juni 2006 in Bremen die 10. RoboCup-Weltmeisterschaft eröffnet wird. Hans-Arthur Marsiske hat zusammen mit Hans-Dieter Burkhard, Professor für Künstliche Intelligenz an der Humboldt-Universität Berlin, das Telepolis-Buch Endspiel 2050. Wie Roboter Fußball spielen lernen geschrieben, das den Stand der Künstlichen Intelligenz und der Roboterforschung anhand des Roboterfußballs vorstellt und diskutiert. http://www.heise.de Die Geschichte eines neuen japanischen Geldscheins Krystian Woznicki 21.08.2004 Seiner Zeit voraus wurde 2000 ein neuer 2000 Yen-Schein zum g8-Gipfeltreffen in Okinawa eingeführt, den aber die Menschen und die Geldautomaten nicht annehmen 2000 wurde erstmals seit 42 Jahren in Japan wieder ein neuer Geldschein eingeführt. Um das neue Jahrhundert zu feiern und um der neuen Ära ein Symbol zu setzen. Doch nach vier Jahren ist der neue Geldschein noch immer eine Neuigkeit, wie die Japan Times bilanziert, um rhetorisch zu fragen: "How often do you come across a 2,000 yen bank note?" Seit Jahren wird Okinawa zum heimlichen Zentrum eines sich öffnenden Japans stilisiert. Das Inselreich eignet sich dazu besonders gut, weil es schon seit Hunderten von Jahren als kulturelle und ethnische Schnittstelle gegolten hat. Wurde diese Eigenschaft vor mehr als 100 Jahren während der Phase des Nation-Building beim Streben nach Homogenität und Reinheit als identitätsstiftendendes Kriterium zwecks Abgrenzung instrumentalisiert, gilt sie nun als Katalysator eines neues neuen Japanbildes. Im Zuge dieser Umwertung nimmt auch Okinawas geografische Koordinaten im argumentatorischen Werkzeugkasten der japanischen Okinawa-Utopisten einen wichtigen Stellenwert ein. Okinawa sei nahezu exakt im Zentrum einer besonders interessanten Lage, wie viele finden: Japan liegt im Norden, China im Westen, Südasien im Süden, der Südpazifik im Südosten und Nordamerika im Osten. Auch der ökonomischen Perspektive sieht die Lage von Okinawa attraktiv aus, denn das Inselreich liegt im toten Zentrum von drei wichtigen ökonomischen Zonen: der "South China Economic Zone" (zu der China, Taiwan und Hongkong gehören), der "Enlargerd Asia Economic Zone" (die ganz Indochina einschließt) und der "Northeast Asia Economic Zone" von Japan und Korea. Vor diesem Hintergrund wird Okinawa, wie keiner anderen Region das Potenzial zugesprochen, diese drei Zonen miteinander zu vereinigen und sich im Zuge dessen selbst weiter zu entwickeln. Dass dies eine nicht unbegründete Hoffnung ist, darauf hatte bereits 1992 Gouverneur Masahide Ota verwiesen. Vor der Annektierung durch Japan im Jahre 1879 habe Okinawa viereinhalb Jahrhunderte lang eine wichtige Rolle in der asiatischen Wirtschaft gespielt: -------------------------------------------------------------------------------Das kleine Königreich agierte als das Zentrum von Handel mit Luxusgütern, die von südasiatischen Märkten in die Häfen von China, Korea und Japan geschifft worden sind. Die Faszination an Okinawas kultureller Disposition, sowie seiner geopolitischen und wirtschaftlichen Lage, gebiert zahlreiche Bilder. Wurde es 1903 während der 5. Industrie Expo in Osaka noch als Negativ-Beispiel für Rückständigkeit herangeführt, wird Okinawa jetzt als "Silicon Valley von Asien" gehandelt, das ein Zentrum des regionalen Telekommunikationsmarktes sein sollte. Es gilt als neues Hongkong, das als japanische Präfektur eine wichtige Rolle "in trailblazing new paths for Japan's future" spielen könnte; als "Asian Hollywood" , was sich auch der Gründer der "Okinawa Actors School" vorstellen kann, der als Teil seines Plans Arbeitsplätze für seine Studenten zu schaffen, in Okinawa ein Unterhaltungszentrum wie Hollywood zu erschaffen plant. Diese Projektionen finden bezeichnenderweise ihren vorläufigen Höhepunkt während einer Veranstaltung, die von Helmut Schmidt, einem ihrer Gründer, mittlerweile als großer TV-Zirkus abgetan wird: dem G-8-Gipfeltreffen, das im Jahre 2000 auf Okinawa stattfand. Bereits im Vorfeld war nicht nur die japanische Medienlandschaft in heller Aufregung über das bevorstehende Großereignis – wochenlang verging kein Tag, an dem nicht auf den Titelseiten davon berichtet wurde. Auch die japanische Zentralregierung in Tokio war darum bemüht, eine angemessene Atmosphäre zu schaffen. Zunächst brachte die japanische Regierung mit der 2000-Yen-Note einen neuen Geldschein in Umlauf, den ein Symbol von Okinawa schmückt: das Tor des alten Palasts der Ryukyus, wie die Inseln bis zu ihrer Annektierung durch Japan hießen. Nur drei Tage vor dem Gipfel beugte sich die japanische Regierung schließlich dem Druck der USA, die Telefonverbindungsgebühren für ausländische Konkurrenten zu senken, um damit auf dem zweitgrößten Telekommunikationsmarkt der Welt eine neue Deregulierungswelle anzustoßen, von der vor allem europäische und US-Telekom-Firmen profi- tieren sollten. Während dieses "japanische Gipfelgeschenk" (Kunz) an Brisanz gewann, weil sich Japan auf dem Treffen im Umkehrschluss für milliardenschwere "IT-Entwicklungshilfe" in u.a. Asien einsetzte, erwies sich auch die 2000-Yen-Note als symbolischer Vorstoß, ein neues Japan-Bild zu inthronisieren: Bei dem G-8-Treffen wollte man als Vertreter Asiens wahrgenommen werden. Vier Jahre später scheint dieser Vorstoß zumindest hinsichtlich des symbolischen Kapitals der Banknote seinen Sinn verfehlt zu haben. Von den mehr als 480 Millionen 2000-Yen Geldscheinen, die in Umlauf gebracht worden sind, sei so gut wie nichts zu sehen, wie die Japan Times berichtet. Die Banknoten seien unbeliebt. Jeder, der sie in die Hände bekomme, versucht sie schnellstmöglich wieder loszuwerden. Angeblich zirkuliere ein großer Teil im Niemandsland der japanischen Wirtschaft: "Most of the 2,000 yen bills in circulation are probably traveling back and forth between banks and retailers as consumers don't want to hang on to them due to their inconvenience.", wie ein Regierungsbeamter zitiert wird. Dabei hatte sich die neue Banknote nicht nur durch ein neues nationales Symbol, sondern auch durch avancierte Fälschungssicherheiten ausgezeichnet. Ironischerweise ist ihr dieser technologische Vorsprung zum Verhängnis geworden. Das durch und durch automatisierte Japan – alles kann man in "vending machines" erstehen: von 2 Liter Bierdosen bis zum Rüstzeug für Bahnhofsduschen – hatte zu Beginn des neuen Jahrhunderts offenbar vergessen, seine urbanen Hardwareparks zu erneuern. Die alten Maschinen können noch immer nichts mit den neuen Banknoten anfangen. http://www.heise.de Hauptsache Karneval Helmut Lorscheid 09.01.2010 Wie die Bonner mit ihrem Bauskandal umgehen Im Bauskandal um das World Conference Center Bonn (WCCB) hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin sowie weitere für das Projekt auf städtischer Seite verantwortlichen Personen ausgedehnt. Doch statt die Aufklärung abzuwarten, will Bonns neuer Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch die WCCB-Projektgesellschaft schnellstmöglich in städtische Obhut übernehmen. Der Bonner Stadtrat verhandelt über solche Themen hinter verschlossenen Türen. Ein vermeintlicher Weltkonzern investiert in Bonn Nahezu unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit spielt sich in der Bundes- und UNO-Stadt Bonn im Zusammenhang mit der Erweiterung des ehemaligen Plenarsaalgebäudes des Deutschen Bundestages zum "World Conference Center Bonn" (WCCB) ein Bauskandal ab, der durchaus dem entspricht, was man von Berlin gewöhnt ist (Wem gehört das Bonner Prestigezentrum?). Während man aber in der Hauptstadt anlässlich solcher Skandale mit vergleichbarem Umfang immerhin einen Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus einsetzt, bemühen sich im Bonner Stadtparlament nur die Grünen ernsthaft um Aufklärung. Seit Bonn keine Haupt- sondern nur noch Bundesstadt ist, lassen sich dort fast unbemerkt Steuermillionen verblasen. Weil sich angeblich sonst kein Investor fand, feierten die Bonner Kommunalpolitiker und die führende Regionalzeitung "Bonner Generalanzeiger" einen weltgewandten und vermeintlich finanzstarken koreanischen Investor, die Firma SMI Hyundai. Deren Chef Man Ki Kim verstand es, Macht, Einfluss und Reichtum zu suggerieren. Gerne kokettierte er mit seinem Firmennamen Hyundai und erweckte den Eindruck, hinter ihm stünde die gleichnamige koreanische Autofirma sowie das koreanische Bauunternehmen Hyundai Construction. Die örtliche Presse nahm dies gerne auf. So ließ der "General Anzeiger" im März 2006 Ha-Sung Chung, einen der Geschäftsführer der Firma SMI Hyundai, spannende Geschichten aus der großen fremden Welt internationaler Investoren erzählen. Und so erfuhren die Leser, wie so ein "weltweit operierender Konzern, der bereits mehrere Milliarden Dollar in Großprojekte – unter anderem in das World Trade Center in Seoul und in Häfen in Saudi-Arabien – investiert hat," gerade auf Bonn kommt. -------------------------------------------------------------------------------Bei SMI Hyundai arbeiten drei Teams, die sich mit neuen Projekten befassen. Das "Adler-Team" sucht weltweit nach geeigneten Standorten und führt eine erste Analyse durch. Das Ergebnis wird an das "Löwen-Team" weitergegeben, das "die Jagd nach dem Projekt aufnimmt" und eine konkrete Prüfung des Standorts vornimmt, wobei im "Fall Bonn' sogar eine eigene Software entwickelt wurde. Bei einem positiven Votum ist das "Tiger-Team" an der Reihe; es muss das Projekt für SMI Hyundai an Land ziehen. "In allen Phasen können wir stets auf die 20.000 Mitarbeiter von Hyundai Engineering and Construction zurückgreifen; darunter sind hochqualifizierte Experten für Kongress-, Hotel- und Messebau", sagt der promovierte Jurist und fügt hinzu: "Das gilt jetzt auch für die Planungs- und Bauphase für das UNCC." - General Anzeiger UNCC steht für die "UN Conference Center GmbH", die als Bauherr für ein Hotel und weitere Neubauten für das WCCB diente. Anders als von interessierter Seite im Jahr 2006 verbreitet, gab es sehr wohl Alternativen zum koreanischen Investor Kim und dessen Pleitefirma SMI Hyundai. Doch die wurden gezielt ausgebootet, so berichten damalige Verhandlungspartner der Stadt im Gespräch mit Telepolis. Dabei hätten der zunächst als Berater der Stadt tätige Unternehmensberater Michael Thielbeer und der, von der damaligen Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann zum Projektleiter berufene ehemalige Oberstadtdirektor Arno H. eng zusammengearbeitet und Man Ki Kim als alleinigen Investor für das 140 Millionen Projekt favorisiert. Zunächst war Man Ki Kim für seine Firma SMI Hyundai lediglich Teil einer Investorengruppe unter Leitung von Dr. Kals, Aachen, zu der auch eine Tochterfirma des Leverkusener Chemie-Riesen Bayer AG gehörte. Thielbeer und Ex-Oberstadtdirektor H. hätten, so berichten damalige Verhandlungspartner der Stadt Bonn dem Telepolis-Autor, Gesprächstermine mit der Kals-Gruppe vorverlegt – aber nur Man Ki Kim über diese Terminvorverlegung informiert. Die übrigen Gesprächspartner kamen folglich zu spät nach Bonn. Die Gespräche waren beendet. Ein ebenso einfacher wie schäbiger, aber wirksamer Trick, wenn man eine Gruppe von Verhandlungspartnern aufspalten will. Thielbeer verfasste als Berater der Stadt Bonn ein für den weiteren Verlauf entscheidendes Gutachten, in dem es heißt: "…da aus meiner Sicht von allen bisher in Rede stehenden Investoren und auch im Vergleich mit der bestehenden Situation mit Gegenbauer, SMI Hyundai das größte Marketingpotential hat und dies zumindest in Ansätzen auch aufgezeigt hat". Thielbeer kam zu dem Schluss: -------------------------------------------------------------------------------…aus meiner Sicht ist der Businessplan vom Ergebnis sehr positiv zu beurteilen und in sich stimmiger als die Pläne der GEAG (…) .dies sind aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte auf Basis der Unterlagen von SMI Hyundai. Für Fragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. - Michael Thielbeer Thielbeer setzte sich durch, die städtischen Projektleiter prüften offenbar sehr wohlwollend. Nach getaner Arbeit wechselte der Berater der Stadt zu SMI Hyundai – wie es heißt, mit ausdrücklicher Zustimmung seiner bisherigen Auftraggeberin, der damaligen Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann (SPD). Mittlerweile hat die Bonner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ausgeweitet. Nach Man Ki Kim wird mit internationalem Haftbefehl gefahndet, sein Architekt Hong und sein Anwalt und Geschäftspartner Chung saßen zeitweise in U-Haft und haben dort der Staatsanwaltschaft zufolge "umfassend ausgesagt". Gegen die auf Seiten der Stadt für das Projekt verantwortlichen Arno H., Eva Maria Z. sowie die damalige Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann wird wegen "Verdacht der Untreue in einem besonders schweren Fall" ermittelt. Alle drei sollen frühzeitig gewusst haben, dass der Herr Kim aus Korea alles andere als solvent war und keinesfalls in der Lage war, ein Projekt wie das WCCB zu schultern. Dass die Projektbeauftragten keinen Alarm schlugen und die Stadt im Gegenteil dazu brachten, sich gegenüber der Sparkasse Köln/Bonn zur Haftung zu verpflichten, werten die Ermittler nun als Untreue im besonders schweren Fall. Denn damit, so der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Fred Apostel, hätten sie das Vermögen der Stadt in große Gefahr gebracht. Dem Bonner General Anzeiger zufolge "geht es bisher um die Haftung für mehr als 100 Millionen Euro". Der früheren Oberbürgermeisterin wirft die Staatsanwaltschaft vor, dass sie in Kenntnis der schwierigen Finanzlage Kims zu seinen Gunsten Absprachen mit der Sparkasse getroffen habe. Hauptsache, der Karneval ist gesichert In Bonn gelten besondere Prioritäten. Die Durchführung zentraler Veranstaltungen, nämlich die Proklamation "von Prinz und Bonna" also den Leitfiguren des Bonner Karnevals am 8. Januar 2010, schien gefährdet, wenn das insolvente World Conference Center Bonn (WCCB) zum 31. Dezember 2009 die von ihm mitverwaltete Beethovenhalle schließen müsste. Folglich war schnelles Handeln gefordert. Um die ganze Dramatik dieser Bedrohung zu unterstreichen, erschienen zum öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am 21. Dezember 09 führende Repräsentanten der Bonner Karnevalsvereine, darunter sogar der Festausschusspräsident Horst Bachmann. Sie wurden vom neuen Bonner Oberbürger- meister Jürgen Nimptsch namentlich begrüßt und gleich beruhigt. Alle dem Rat zur Entscheidung in der – natürlich nicht öffentlichen Sitzung – vorliegenden Anträge dienten der Sicherung der bereits geplanten Karnevalsveranstaltungen, darunter auch die Prinzenproklamation. Auch eine weitere lustige Veranstaltung soll im WCCB stattfinden – der nächste Parteitag der vom Bonner Guido Westerwelle angeführten FDP. Ginge es nach dem Willen der Bonner Verwaltung, hätten die Ratsmitglieder – natürlich nach Beratung in nicht-öffentlicher Sitzung, die insolvente WCCB-Betreibergesellschaft mit all den damit verbundenen nicht abwägbaren Risiken in städtisches Eigentum überführt und dafür mal eben 5,9 Millionen Euro bewilligt. Diesem Vorschlag des SPD-Oberbürgermeisters und seiner, von CDU-Mitgliedern dominierten Stadtverwaltung widersprach die seit der letzten Kommunalwahl in Bonn herrschende Koalition aus CDU und Grünen. Besonders den Grünen, die als einzige in großem Umfang von ihrem Recht auf Akteneinsicht Gebrauch machten, stehen auch in der Koalition mit der CDU für eine lückenlose Aufklärung des Millionenskandals. Schließlich einigte sich eine breite Mehrheit der Stadtverordneten auf einen Kompromiss, dem zufolge die Stadt vorläufig die WCCB-Betreibergesellschaft nicht übernimmt, sondern in der Verantwortung des Insolvenzverwalters belässt und bis Ende Februar städtische Zuschüsse bis zu einer Höhe von 800.000 Euro bereit stellt, um den Veranstaltungsbetrieb bis Ende Februar 2010 aufrecht zu erhalten. Damit sind auch die Karnevalsveranstaltungen gesichert. Das macht die Bonner glücklich. Von der Hofberichterstattung zur Aufklärung Wer als Journalist etwas über den WCCB-Skandal erfahren will, sollte zunächst den General Anzeiger lesen. Denn das früher der Stadtverwaltung gegenüber eher lammfromme Bonner Monopolblatt veröffentlichte eine mittlerweile 23 Folgen umfassenden, je Folge oft zwei Zeitungsseiten lange Fortsetzungsstory unter dem Titel World Conference Center Bonn, Die Millionenfalle. In den Jahren zuvor hatte der General Anzeiger im Wesentlichen das brav niedergeschrieben, was die damalige Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann (SPD), ihr Sprecher oder vermeintlich weltweit erfolgreiche Geschäftsleute den Lokaljournalisten erzählten. Da wurde die Firma des mittlerweile weltweit gesuchten Man Ki Kim in einem Kommentar des General Anzeigers schon mal zu einem "Glücksfall für Bonn". Recherche gehörte bis zur WCCB-Geschichte nicht zu den Stärken des Bonner General Anzeigers. Bereitwillig verbreite die Zeitung auch, "dass die Finanzierung auf soliden Füßen stehe. Das hätten "auch Gutachter der Sparkasse Köln/Bonn festgestellt. Die Beteiligung des hiesigen Geldinstituts am UNCC freue Ha-Sung Chung, der seit zehn Jahren weltweit für die Hyundai-Gruppe arbeitet, besonders: "Wir haben viel von der Sparkasse gelernt, da sie den Markt sehr gut kennt; die Zusammenarbeit findet auf einem hohen Niveau statt." Es dauerte rund drei Jahre, bis der Chef der so glücklichmachenden Firma SMI Hyundai, Man Ki Kim, mit internationalem Haftbefehl gesucht und sein Partner Chung von der Bonner Staatsanwaltschaft in U-Haft benommen wurde. Im Oktober 2009 berichtete der gleiche General Anzeiger-Autor: Ha-Sung Chung muss ins Gefängnis. Wie investigativer Journalismus im General Anzeiger Einzug fand, lässt sich recht einfach nachvollziehen. Ein Insider, dem Anschein nach aus der Bonner Stadtverwaltung, hatte einen Aktenordner spannender Unterlagen zusammen gestellt und zeitgleich an verschiedene Redaktionen geschickt – darunter auch den General Anzeiger. Die Redaktion befand sich im Zugzwang, wissend, dass auch andere Redaktionen in der Region über das gleiche Material verfügten, blieb ihr gar keine andere Möglichkeit, als es zu veröffentlichen. Wegen ihrer Serie über "Die Millionenfalle" war die Zeitung an vielen Kiosken oftmals ausverkauft. Alles geheim Zwar hatte Bonns neuer Oberbürgermeister in seiner ersten Rede vor dem Bonner Stadtrat am 29.10. 2009 angesichts der 100.000 Nichtwähler (fast mehr als die doppelt soviel wie die Zahl seiner 52.000 Wähler) bei der Kommunalwahl am 30. August 2009 Willy Brandt zitiert und gesagt: "Wir müssen wieder 'mehr Demokratie wagen'. In der gleichen Rede sagte OB Nimptsch: "Dort wo Distanzen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik vorhanden sind, müssen wir diese gemeinsam abbauen..." Das WCCB-Desaster wurde während des Kommunalwahlkampfs bekannt und war erkennbar einer der Gründe, warum Bonner Wählerinnen ihre Stimme nicht abgaben. Dennoch setzt OB Nimptsch in der Aufarbeitung dieses Skandals die Geheimniskrämerei seiner Vorgängerin fort. Die entscheidenden Stadtratssitzungen finden weiterhin hinter verschlossenen Türen statt. Wesentliche Informationen, auch für diesen Artikel, musste sich der Autor aus vertraulichen Quellen besorgen. Auch das Ergebnis eines Berichts des städtischen Untersuchungsberichts, aus dem der General Anzeiger zitierte, war selbstverständlich nicht für die "demokratische Öffentlichkeit" bestimmt. Denn das was dort steht, trägt wohlmöglich zur "Politikverdrossenheit" bei: -------------------------------------------------------------------------------Das SGB (Anm. d. Autors: Städtisches Gebäude Management) berichtet: Bei einem Prüfungstermin bei Young-Ho Hongs Baufirma SMI Hyundai Europe GmbH (Berlin), inzwischen insolvent, im Juli 2009 "wurde festgestellt, dass die durch die örtlichen Bauleiter aufgeführten Begründungen und Preisprüfungen nicht in allen Fällen eindeutig und nachvollziehbar waren". Das erklärt vermutlich – nur jede fünfte Rechnung wurde auf Plausibilität geprüft – eine Millionen-Baukostenerhöhung, die das SGB einen kontinuierlichen Prozess" nennt. Solche Informationen finden sich nicht auf der Homepage der Stadt, die schulmeisterhaft versucht, der Aufklärungsarbeit der Presse, mittels Halb- und Desinformation zu begegnen. Die Stadt Bonn beantwortet nicht einmal die Frage, wie viele Rechtsanwälte mittlerweile im Zusammenhang mit dem WCCB-Skandal für die Stadt tätig sind. Auch unter Bezugnahme auf das Informationsfreiheitsgesetz gibt es keine Auskünfte zum Gesamtkomplex WCCB. Vertraulich bleibt auch, ob es zutrifft, dass die von der Stadtverwaltung angeheuerten Berater von Pricewaterhouse Coopers (PwC) tatsächlich 500 Euro pro Stunde kassieren. Die Begründungen der Ablehnungen variieren. Eine der gerne verwendeten Ausreden verweist auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die noch nicht abgeschlossen seien und die man nicht durch eine Auskunft gefährden wolle – oder man verweist auf "vorliegende Hinderungsgründe unter dem Aspekt des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen". Als der Telepolis-Autor Einblick nehmen wollte in die "Einschätzung Wirtschaftlichkeitsberechnung SMI Hyundai" des Dr. jur. Michael Thielbeer sah des Rechtsamt der Stadt Bonn, "insbesondere mit Blick auf Herrn Dr. Thielbeer solche Hinderungsgründe (Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse)." Wie heißt es doch im rheinischen Karneval: "Jute Fründe stohn zusamme." http://www.heise.de Game over Florian Rötzer 08.07.2003 Die thailändische Regierung will zum Schutz der Jugend Online-Spiele und Internetcafes während der Nacht sperren Nach einer Umfrage bei den amerikanischen Studenten hat mittlerweile jeder einmal Computerspiele gespielt, für die meisten ist es ein regelmäßiges Freizeitvergnügen, das sie schätzen, auch wenn es auf Kosten des Studiums gehen kann. Auch Vereinsamung finde darüber nicht statt. Alles bestens also? Nicht für die thailändische Regierung. Die hat ab 15. Juli eine Nachtsperre für Online-Spiele verhängt. Erst einmal scheint die Maßnahme zeitlich beschränkt zu sein. Vom 15. Juli bis 30. September soll der Zugang zu Online-Spielen auch auf Servern im Ausland zwischen 22 Uhr Abends und 6 Uhr Morgens gesperrt werden. Dafür müssen die Internetprovider sorgen. Die Internetcafes trifft es besonders hart, die während dieser Zeit ganz zusperren müssen. Nach dem Informations- und Kommunikationsminister Sura-pong Suebwonglee werden die thailändischen Games-Provider mit den ausländischen Spieleherstellern in Kontakt treten, um die Lizenzverträge zu verändern und die Restriktionen dauerhaft zu verlängern. Der Minister sorgt sich vor allem darum, dass die Kinder und Jugendlichen ihren notwendigen Schlaf erhalten sollen: "Sie sollen nicht zu diesen Stunden während der Schulzeit oder der Ferien, an Wochentagen oder am Wochenende spielen." Diese Maßnahme wird allerdings erst der Beginn sein, denn das Ministerium plant eine ganze Reihe weiterer gesetzlicher Vorschriften für Online-Spiele. Es wird daran gedacht, dass alle zwei Stunden ein Spiel zwangsweise abgebrochen wird oder dass Ausweise verlangt werden, um unanständiges Verhalten oder Geschäftemacherei zu verhindern, da manche auch das Spielen als Job betreiben. Der Minister hatte sich schon einmal mit Verantwortlichen von Asia Soft getroffen, die Ragnarok Online, das populärste Spiel aus Korea in Thailand, anbieten. 600.000 Thailänder haben sich bei dem an sich harmlosen, Online-Spiel registriert, täglich seien 200.000 Spieler hier aktiv und würden stundenlang spielen. Vergleichbar mit China (800.000 Menschen gleichzeitig bei einem Online-Spiel) oder Korea krempeln Online-Spiele, die einen lukrativen Markt darstellen, die Lebensgewohnheiten vor allem der Jugendlichen um. Die Firma hat offenbar angeboten, ein System für das Rollenspiel zu entwickeln, um außergewöhnliche Tausch- und Geldgeschäfte – das virtuelle Geld heißt "zeny" – feststel- len zu können. Das virtuelle Geld könne nämlich dazu führen, dass um wirkliches Geld gespielt wird und so das Rollenspiel zum Glücksspiel wird. Die Androhung, die Online-Spiele Nachts zu unterbrechen, hat offenbar schon die Ragnarok-Spieler erzürnt. Dabei waren nicht nur Kinder, denn viele scheinen sich beschwert zu haben, dass sie tagsüber arbeiten müssten und erst spät Nachts Zeit zum Spielen hätten. Der Jugendschutz verhindert nach der geplanten Maßnahme auch die Erwachsenen in Thailand am Spielen http://www.heise.de Erkaufter Frieden – Skandal in Seoul Brigitte Zarzer 17.02.2003 Vor dem legendären Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea im Juni 2000 flossen 200 Millionen Dollar nach Pjöngjang Während das Augenmerk der Weltöffentlichkeit am vergangenen Freitag ganz auf den Blix-Bericht gerichtet war, spielte sich in Südkorea ein nationales Drama ab. Kim Dae Jung, Friedensnobelpreisträger und Präsident des Landes, musste sich bei seinem Volk entschuldigen. Der Grund: Wie erst jetzt bekannt wurde, waren kurz vor dem Friedensgipfel 200 Millionen US-Dollar in den Norden geflossen. In einer Pressekonferenz bat Kim Dae Jung um Verzeihung für diese – im Geheimen abgewickelte – "Finanzhilfe" an Nordkorea. Wie die südkoreanische Nachrichtenagenturen berichten, überwies die Hyundai-Konzern-Tochter "Hyundai Merchant Marine" (HMM) eine Woche vor dem Friedens-Summit vom 15. Juni 2000 die stattliche Summe von 200 Millionen US-Dollar an die Regierung in Pjöngjang. Offensichtlich war der legendäre Handschlag zwischen dem Kim im Süden und jenem Kim im Norden erst durch diese Zahlung möglich geworden. Der Deal wurde vom südkoreanischen Geheimdienst NIS (National Intelligence Service) unterstützt. Kim Dae Jung (kurz "DJ") bekannte sich zu seiner Verantwortung für diese Aktion. Er hätte im "Interesse des Friedens und im nationalen Interesse" gehandelt, so der Präsident in seinem Statement. Auch Hyundai kündigte indes an, seine Version der Vorgänge in absehbarer Zeit der Öffentlichkeit präsentieren zu wollen. Ob nun von Kim Dae Jung oder von dem Konzern selbst Initiator dieser fragwürdigen Aktion war oder ob es um den Support des Hyundai-Konzerns, der in Nordkorea einen wichtigen Absatzmarktsmarkt sah, lässt sich nach heutigem Wissensstand schwer einschätzen. Fakt ist, dass Hyundai just in dieser Zeit unter starkem Druck von innen und außen stand. Wie die Financial Times Deutschland am 13. 6. 2000 berichtete – also zwei Tage vor dem Gipfeltreffen in Pjöngjang – wollte die südkoreanische Regierung mit Hilfe politisch gesteuerter Kreditvergaben Unternehmensreformen erzwingen. Dass Kim Dae Jung damals überhaupt Geldmittel zu vergeben hatte, verdankte er im Wesentlichen internationaler Hilfe. Noch im Dezember 1997 musste Seoul die Nothilfe des Internationalen Währungsfonds in der Rekordhöhe von 57 Milliarden US-Dollar beantragen. Zwei Jahre später allerdings konnte Kim D.J. bereits eine erstaunliche Bilanz vorweisen. Nichts desto trotz wird sich der südkoreanische Präsident über kurz oder lang auch Fragen der Weltöffentlichkeit stellen müssen. Denn wo floss das Geld tatsächlich hin? Dass die Regierung in Pjöngjang die Bevölkerung hungern lässt, dafür aber vor allem in die Aufrüstung investiert, ist ein offenes Geheimnis. Nach Angaben Kim D.J.s wurde als Gegenleistung mit Pjöngjang vereinbart, dass Hyundai sieben Hauptprojekte in Nord-Korea abwickeln kann. Darunter wären der Ausbau der Eisenbahn und Telekommunikationsprojekte gefallen. Doch wer überwachte, dass die Gelder de facto in Form von Gegenaufträge an Hyundai zurückflossen? Wer kann garantieren, dass sie nicht für die AtomAufrüstung verwendet wurden? Fazit: Die südkoreanische Politik wird sich wohl noch längere Zeit mit der Aufklärung dieses MillionenDeals beschäftigen müssen. Ungeachtet des innenpolitischen Skandals wurde am vergangenen Freitag die Süd- und Nordkorea die erste Landverbindung seit dem Korea-Krieg (1950-53) offiziell eröffnet. Und während auf die "Sonnenscheinpolitik" von Kim Dae Jung ein dunkler Schatten fiel, treibt sein Gegenspieler in Nordkorea, Kim II, sein eigenes Spiel mit der Weltöffentlichkeit. Ebenfalls am Freitag verurteilte Pjöngjang die Anrufung des Weltsicherheitsrates im Konflikt um das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Staates. In einem Bericht der amtlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA wurde zugleich die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) am Freitag als "Amerikas Schoßhund" beschimpft. – Nach dem Irak scheint der nächste Krisenherd bereits ausgemacht. http://www.heise.de Die große grüne Mauer Andrea Naica-Loebell 07.06.2005 Maßnahmen gegen die windige Republikflucht der chinesischen Erde Jedes Frühjahr zwischen Januar und März kommt der "gelbe Drachen", wie die Chinesen die Saison der heftigen Sandstürme poetisch nennen. Der Himmel verdunkelt sich, die Luft färbt sich gelb und rot, und die Sandkörner im Wind machen es schwierig, etwas zu sehen oder zu atmen. Die Einwohner von Peking verkriechen sich wie alle in Nordchina in dieser Zeit in ihre Häuser und versuchen, die Fenster möglichst gut abzudichten. Aber die Sandstürme sind nicht nur unangenehm, sie führen zu wachsenden Wüstengebieten und sind ein riesiges Problem für die ganze Region. Die Volksrepublik China hat deswegen das größte ökologische Programm gestartet, das es weltweit gibt. Sandstürme entstehen in Trockengebieten, speziell in Wüsten und die starken Winde tragen eine große Menge feiner Partikel so hoch in die Atmosphäre, dass die Auswirkungen auch sehr weit entfernte Gebiete betreffen können. Die Sahara-Stürme beeinflussen auch das Wetter in Deutschland, Staub aus der afrikanischen Wüste erreicht uns bis zu zehn Mal im Jahr und bedeckt dann als feine Schicht nicht nur die Autos. Es ist bekannt, dass der feine Mineralsand aus den Wüsten bis zu 10.000 Kilometern durch die Luft reisen kann, von China aus erreicht er so weit entfernte Gebiete wie Alaska oder Grönland. Die Partikel tragen zur Wolkenbildung bei und werfen einen Teil der Sonnenstrahlung zurück. Ob Sandstürme in der Atmosphäre eine Abkühlung oder eine Aufheizung bewirken, erforscht unter anderen auch eine Wissenschaftlergruppe mit Unterstützung der Deutsche Forschungsgemeinschaft (Einfluss der Sahara-Sandstürme auf das globale Klima). Sandsturm in China 2001 (Bild: UNCCD) Besonders heftige Sandstürme toben Jahr für Jahr in China. Millionen Tonnen trockenen Bodens lösen sich vom Untergrund und werden aus der inneren Mongolei und dem Nordwesten Chinas in die Luft geschleudert und von Winden mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Stundenkilometern in andere Gebiete geblasen. Wie das Wissenschaftsmagazin New Scientist in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, intensiviert die Volksrepublik in jüngster Zeit ihre Bemühungen, das Phänomen einzudämmen – auch auf Betreiben der mitbetroffenen Nachbarländer. In Korea und Japan führten die aus China heranstürmenden Sandmassen immer wieder zu braunem Regen, verstopften Flüssen und Algenwildwuchs in Seen. Flughäfen müssen ihren Betrieb vorübergehend einstellen und der volkswirtschaftliche Schaden ist beachtlich. China hat 1978 das so genannte Große Grüne Mauer-Projekt initiiert, das offiziell The North Shelterbelt Development Program heißt. Ziel ist es, vor allem durch Aufforstung der Ausbreitung der Wüsten entgegen zu wirken. Es hat schon immer Sandstürme gegeben, aber die intensive Bewirtschaftung des Bodens, das Abholzen der Wälder und die zu intensive Ausbeutung der Wasserreserven ermöglichen dem Wind heute, große Mengen des locker gewordenen Bodens mitzunehmen und eine wachsende Wüste zurück zu lassen. Edward Derbyshire, Honorarprofessor an der Gansu Academy of Sciences erklärt: -------------------------------------------------------------------------------Dieser Prozess läuft seit mindestens 2,6 Millionen Jahren, wahrscheinlich schon sehr viel länger. Aber was in den letzten Jahrzehnten passiert, ist, dass die Menschheit sozusagen ihren Fuß hineingesetzt und den natürlichen Prozess beschleunigt hat. Die Volksrepublik hat für ihre Grüne Mauer bereits mehr als 3 Milliarden Dollar ausgegeben, 24 Millionen Hektar Wald wurden bereits gepflanzt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 eine Fläche von 4 Millionen Quadratkilometern mit Bäumen zu versehen, die besonders unempfindlich gegen Trockenheit sind. Das Waldgebiet in Norchina soll sich insgesamt verdreifachen. Großer Sandsturm über dem Nordosten Chinas 2004, aufgenommen vom Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) an Bord des Terra-Atelliten (Bild: Jesse Allen/NASA Earth Observatory) Das Programm begeistert aber nicht alle Experten. Ob die Bäume wirklich überall ein passendes Mittel sind, darüber wird international diskutiert. Speziell in bereits wüstenartigen Regionen pumpen die Projekte zur Aufforstung beachtliche Wassermengen aus dem Boden, um die Jungpflanzen zu bewäs- sern. Und das, obwohl in dem Gebiet im Zweifelsfall nie zuvor Bäume standen und sowieso schon Wassermangel herrscht (Megatrend China: Wasserengpass). Viele der Bäume verlieren zudem ihre Blätter und sind oft gerade in der Trockenzeit kahl, wenn die Sandstürme toben. Glatte Baumstämme bremsen aber die Wirkung des Windes kaum aus. Ebenfalls umstritten sind zusätzliche Maßnahmen der Regierung wie das Anpflanzen von Gras oder anderen Bodendeckern, die ebenfalls viel Wasser benötigen. Oder das Verlegen von Strohmatten sowie den Einsatz von chemischem Kleber, der den Boden festigen soll, in der nördlichen Provinz Ningxia. Menschenrechtsgruppen protestieren zudem gegen die Umsiedlung bzw. Zwangsansiedlung von 3.000 Nomaden-Familien in der Inneren Mongolei, die ihre Ziegen-Herden zukünftig in der direkten Umgebung der für sie erbauten Dörfern weiden lassen sollen. Kritik gegen die Effektivität aller dieser Maßnahmen wurde immer lauter. Das führte schließlich zur Gründung eines internationalen Projekts, das von der Asian Development Bank, den Vereinten Nationen und der Global Environment Facilty unterstützt wird. Beteiligt sind neben China die Mongolei, Japan und Korea. Stärker als bisher sollen die jeweils lokalen Gegebenheiten einbezogen und daran angepasste Mittel eingesetzt werden. Bevor die Wirkungen der Maßnahmen sich zeigen, dauert es sicherlich ein Jahrzehnt. Solange müssen die Chinesen sich weiter jedes Frühjahr in ihren Häusern verkriechen, wenn der gelbe Drache kommt. http://www.heise.de Im Auge des E-Sports Olaf Meyer 28.11.2005 Bis hin zum Finale in Singapur setzte die diesjährige World-Cyber-Games-Saison erneut Maßstäbe – mit einer scheinbar weiter nach oben offenen Zukunft Die Statistik der World Cyber Games (WCG) beeindruckt in ihrem fünften Jahr mittlerweile mehr denn je. Weltweit beteiligten sich seit dem Saison-Start im März rund 1,2 Millionen Spielerinnen und Spieler aus 80 Nationen. Zirka 1 Million Euro wurden an Preisgeldern und Sachpreisen ausgereicht, ermöglicht durch namhafte Sponsoren vor allem aus dem Elektronik-Bereich. Offizielle Spiele der WCG 2005 waren Need for Speed: Underground 2, FIFA Football 2005, Warcraft 3: The Frozen Throne, Starcraft: Broodwar, Dawn of War je im PC-Einzelspielermodus, dazu Counterstrike: Source im Fünf gegen Fünf sowie die Xbox-Einzel-Disziplin Dead or Alive Ultimate sowie Halo 2 im Duo gegeneinander. Counterstrike-Wettbewerb. Bild: worldcybergames.com Deutschsprachige Printmedien begleiteten auch diese WCG-Saison zumeist emotionslos zurückhaltend und mitunter versteckt in Spezial-Rubriken. Der unmittelbar nach den WCG-Finaltagen erschienene Spiegel griff eine – spätestens nach dem damaligen tödlichen Amoklauf am Erfurter GutenbergGymnasium (Aufmerksamkeitsterror) – immer wieder kontrovers diskutierte Problematik auf. Die TNSInfratest-Frage "Halten Sie ein Verbot von gewalttätigen Computer- und Videospielen wie 'Counterstrike' zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für sinnvoll?" beantworteten nicht weniger als 83 Prozent der Befragten mit "Ja". Einer der Mitorganisatoren der WCG, Thomas von Treichel, bezeichnete fast zeitgleich im Deutschlandradio Kultur ein beispielsweise im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD gefordertes Verbot von so genannten Killerspielen dagegen für "wirkungslos" und prognostizierte dahingehend "keine größeren Auswirkungen" ("Unsere Forderung ist nicht populistisch"). Die Frage, ob die bundesdeutsche Fußball-Nationalmannschaft real besser kicken würde, wenn das FIFA-Football-Game zum offiziellen Trainingsprogramm gehören würde, ist in diesem Zusammenhang schon öfter mehr oder weniger sinnhaft persifliert worden. Need-for-Speed-Spieler. Bild: worldcybergames.com Dabei sind die gut 180.000 registrierten WCG-Spielerinnen und -Spieler aus der Bundesrepublik Deutschland ja eine nicht gerade zu vernachlässigende Größe. Wer beispielsweise einmal die Games Convention in den Leipziger Messehallen (Großereignis der Spaßgesellschaft) besucht hat, weiß um die ständig wachsende Begeisterung für Gaming und E-Sport. Zudem kann an den WCG theoretisch jeder teilnehmen, der sich registrieren lässt und hernach über nationale Liga-Ausscheide dann vielleicht sogar auch noch die Qualifikation ins jeweilige Final-Nationalteam schafft. In der Szene vorherrschend sind allerdings mittlerweile durchaus bekannte Einzelspielerpersönlichkeiten und mehr oder weniger schon länger miteinander eingespielte Clans mit futuristisch anmutenden Namensgebungen. Wie beim Profi-Fußball auf dem grünen Rasen gibt es, dann in einschlägigen Communities teils heftig kommentierte, Clan-Wechsel, -Auflösungen und –Neugründungen. Kolportiert werden eben so auch Gerüchte um angebliche Ablösesummen und Transferzahlungen in der GameClan-Szene. Hauptsächliche Grundlage für die Erfolge beim E-Sport ist allerdings unbestritten ausdauerndes Training, darüber sollte sich niemand mit einer wie auch immer gearteten Daddel-Romantik täuschen lassen. Dawn of War-Spieler. Bild: worldcybergames.com Zum diesjährigen Finale der vom Veranstalter der WCG gern so bezeichneten "Olympischen Spiele der PC- und Videospieler" trafen sich über 700 Gamer aus 67 Ländern vom 16. bis 20. November unter dem Motto: "Beyond the Game" im süd-ostasiatischen Singapur. Die rund 1.000 Vor- und Endrunden-Spiele in den acht Game-Bereichen wurden in einer auf 18 Grad Celsius abgekühlten Hallenumgebung unter der Leitung von 47 Schiedsrichtern an 600 Monitoren um ein Gesamt-FinalPreisgeld von seriös geschätzten 450.000 US-Dollar ausgetragen. Dabei schlugen sich einzelne Prämierungen für Games-Winner – mit beispielsweise 50.000 US-Dollar bei Counter-Strike: Source sowie 20.000 US-Dollar bei FIFA Soccer 2005, Need for Speed: Underground 2 und Dawn of War – mit nicht gerade unerquicklichen Summen aufs jeweilige Konto nieder. Die Spiele in Singapur konnten natürlich live im Internet verfolgt werden. Nach den koreanischen Seoul (2001 und 2003) sowie Daejeon (2002) und dem US-amerikanischen San Francisco (2004) fiel die Wahl auf Singapur als Finalort für die WCG 2005 nicht unbedingt zufällig: E-Sports hat außerhalb Europas längst einen lukrativen Status erreicht. So soll der vorjährige Starcraft-Weltmeister Ji-Hoon Seo alias XellOs[yG] aus Korea jährlich mehr als 50.000 US-Dollar allein als Profi-PC-Spieler verdienen. Dafür sind allerdings Trainingszeiten von 12 Stunden täglich nicht unüblich, aber PC-Games vor mehreren 10.000 Zuschauern auch keine Seltenheit. Zum finanziellen Vergleich sei erwähnt, dass beispielsweise bei den nicht gerade unbedeutenden WCG 2005 – Samsung Euro Championship auf der CeBIT unter 300 Teilnehmern um ein Gesamtpreisgeld von rund 150.000 Euro gespielt wurde. Das Auge des E-Sports scheint nach wie vor eher östlich glänzend zu sein. Siegerehrung für FIFA 2005, in der Mitte Dennis 'Styla' Schellhase. Bild: wcg-europe.org Wenige Monate vor der schon jetzt zum Mega-Hype stilisierten Fußball-Weltmeisterschaft in den bundesdeutschen Stadien ist – allerdings weit weniger beachtet – zumindest der Cyber-WM-Titel ins Land geholt worden. Neben weiteren beachtlichen Ergebnissen aus deutscher Sicht gewann Dennis Schellhase alias styla in Singapur herausragend Gold beim FIFA Soccer 2005 und wiederholte damit seinen Erfolg aus dem Jahr 2003. Insgesamt belegte das deutsche Game-Team mit seinen 23 Cyberathleten den vierten Platz in der Nationenwertung, hinter den USA, Korea und Brasilien. Das Finale der WCG 2006 findet erstmals in Europa statt, Austragungsort wird dann das italienische Monza sein. The games go on. http Formen von Unfreiheit Reinhard Jellen 25.12.2009 Interview mit dem Althistoriker Egon Flaig über alte und neue Sklaverei Gleichwohl der Sklave seit der Antike als eine Art sprachbegabtes Werkzeug definiert wird und ausschließlich für seinen Herren zu schaffen scheint, vollzieht sich die Begriffsbestimmung der Sklaverei in der Sphäre des Rechts und nicht in der Arbeit selbst. Die Sklaven sind weniger unter eine bestimmte Art der Tätigkeit und also unter eine Klasse oder Schicht subsummierbar als unter einen Status der totalen Rechtslosigkeit. Diese Erniedrigung wird vom Sklaven so stark empfunden, dass er zum Teil oder ganz die Sicht des Herren über seine eigene Minderwertigkeit adaptiert und deswegen Selbstentfremdung impliziert. So nimmt es kaum Wunder dass geschichtlich Sklavenaufstände eher eine Ausnahme als die Regel sind. Dabei ist die Sklaverei, wie Professor Egon Flaig, der Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte an der Universität Rostock mit seiner neuesten Publikation "Weltgeschichte der Sklaverei" zeigt, noch längst kein überwundenes historisches Phänomen. Herr Professor Flaig – was sind die Allgemeinmerkmale von Sklaverei? Egon Flaig: Ordnet man die Typen von persönlicher Unfreiheit auf einer Skala an, dann befindet sich die Sklaverei als Extrem an jenem Ende, wo die Unfreiheit quasi total ist. Doch der extreme Typ ist nicht unbedingt der schlimmste. Die schlimmsten Formen von Unfreiheit bemessen sich am Grad des Leidens der Betroffenen. Das Leiden in den Lagersystemen des 20. Jahrhunderts dürfte – für eine hohe Quote der Insassen – bei weitem jenes übertroffen haben, dem Sklaven in den meisten "Branchen" ausgesetzt waren. Daher ist Zwangsprostitution in der Regel schlimmer als Sklaverei. Es ist also kein Wunder, dass manche darüber empört sind, wenn Wissenschaftler streng unterscheiden und Zwangsprostitution nicht zur Sklaverei rechnen. Aber eine historische Soziologie der Unfreiheit darf nicht vom Ausmaß des Leidens ausgehen, sondern von den objektiven sozialen Verhältnissen. "In der Sklaverei ist der Mensch keine rechtliche Person" Sklaverei ist eine Institution. Zwangsprostitution ist keine. Wenn eine Prostituierte entflieht und sich ins Polizeipräsidium rettet, dann wird die Polizei keinesfalls die Prostituierte in Ketten legen und sie ihrem Peiniger zurückbringen. Im Gegenteil: Sie wird den Peiniger jagen. In der Sklaverei ist es genau umgekehrt. Damit komme ich zu Ihrer Frage. Zwar ist auch die Leibeigenschaft eine Institution gewesen und an manchen Stellen der Erde auch geblieben. Aber die Unfreiheit ist hier keine extreme: Der Leibeigene hat eine Familie im rechtlichen Sinne, seine Kinder gehören ihm; er hat anerkanntes Eigentum und er gilt als Person mit Rechten. In der Sklaverei hingegen ist der Mensch keine rechtliche Person mehr. Sowohl das muslimische als auch das römische Recht bezeichnen den Sklaven als einen "rechtlich Toten". Er hat überhaupt keine Rechte (abgesehen von Schutzbestimmungen – die sein Leben oder die Feiertagsarbeit betreffen – und das sind keine "Rechte"), keine Familie; seine Kinder gehören nicht ihm, seine Ehe ist immer nur eine Pseudo-Ehe, die der Herr jederzeit auseinanderreißen kann, kein Eigentum (wird ihm Besitz überlassen, dann bleibt dieser immer im Eigentum des Herrn). Er ist verfügbar und verkaufbar. Die deutliche Unterscheidung im Artikel 4 der Menschenrechte hat einen guten Sinn: Wenn die Sklaverei zurückkehrt (nämlich als institutionalisierte Unfreiheit wieder möglich wird), dann sind alle anderen Formen von Unfreiheit nicht mehr zu verhindern. "Abolition war der Kulturbruch schlechthin" Die Konsequenz ist klar: Es ist unsinnig, jegliches Verhältnis von Unfreiheit als Sklaverei zu bezeichnen, sosehr uns die Betroffenen auch leid tun mögen; und es ist amnestische Barbarei (Vergessensbarbarei), so zu tun, als habe die Abschaffung der Sklaverei nicht stattgefunden. Weder historisch noch soziologisch trifft es zu, dass die Sklaverei sich in "neuen Formen" fortsetze, will sagen: Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, Arbeitsemigration usw. Wer das behauptet, weiß nicht, wovon er redet. Erst wenn man die diversen Formen von Unfreiheit in der Geschichte der letzten 3000 Jahre berücksichtigt, wird überhaupt erkennbar, was für ein ungeheurer Einschnitt im 19. Jahrhundert global erfolgte. Die Abolition war ein "Kulturbruch", ich würde sagen: Der Kulturbruch schlechthin. Mit enormem militärischen und politischem Einsatz unterdrückten zwei, drei Kolonialmächte die institutionalisierte Unfreiheit in ihrer extremen Form und brachten sie beinahe gänzlich zum Verschwinden. Nur in Teilen der islamischen Welt hat sie sich gehalten. "Wir sprechen mit den Vokabeln der Abolitionisten" Es ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit, dass vor allem die Briten, aber auch die Franzosen und schließlich auch die Amerikaner und sogar die Deutschen und Holländer im Laufe von 60-90 Jahren die Sklaverei weltweit unterdrückten. Die anderen Formen von Unfreiheit und auch die neuen sind überhaupt nur bekämpfbar, weil die Sklaverei selber – fast überall – verboten ist. Wäre dem nicht so, hätten wir keine Chance, die anderen Formen der Unfreiheit zu bekämpfen. Noch mehr: Wir würden gar nicht erkennen, dass die anderen Formen ein Problem sind. Wenn Sklaverei existiert, dann verschieben sich fundamental und weitreichend alle Begriffe von zwischenmenschlicher Gerechtigkeit. Warum sind wir denn empört über Zwangsprostitution, Schuldknechtschaft, Kinderverkauf? All das sind soziale Praktiken, für die sich immer Rechtfertigungen finden lassen – nämlich aus "kultureller Besonderheit". Was gibt uns also das Recht, uns empört zu zeigen? Das ist überhaupt nicht natürlich. Das ist kulturell bedingt; daher historisch erworben. Einzig und allein die moralischen Maßstäbe der Abolitionisten des 19. Jahrhundert geben uns das Recht zur Empörung. Wir sprechen mit ihren Vokabeln, wir denken in ihren Begriffen – auch wenn es uns nicht bewusst ist. Aber das war einmal sehr bewusst. Denn alle Verdinglichung ist – wie Adorno sagt – ein Vergessen. Welche Formen von Sklaverei existieren noch in der Gegenwart und wo? Egon Flaig: Der Artikel 4 der Menschenrechte unterscheidet zwischen Sklaverei und "sklavereiähnlichen Verhältnissen". Zu Recht. Unter den vielfältigen Typen von persönlicher Unfreiheit ist die Sklaverei die extremste. Die anderen Formen sind deutlich von ihm zu sondern. Ich zähle die am weitesten verbreiteten Formen auf: Schuldknechtschaft – eventuell über mehrere Generationen – existiert in mehreren Regionen Südostasiens, des Vorderen Orients und vor allem in Indien. Zwangsarbeit, gedeckt durch Pseudoverträge, gibt es einigen arabischen Ländern; sie hat in Brasilien in großem Umfang existiert, scheint indes unter der Regierung Lula am Verschwinden zu sein. Verschwunden sind die Lagersysteme der Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Zwangsprostitution nimmt wieder zu, auch in Westeuropa. Zwangsheirat betrifft wahrscheinlich mehrere hunderttausend muslimische Frauen in Deutschland. Frauen, die ohne und wider ihren Willen verheiratet werden, befinden sich lebenslänglich in Unfreiheit. Wer das leugnet steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und pfeift auf die Menschenrechte. Alle diese Ehen sind nach Artikel 4 der Menschenrechte null und nichtig. Die Bundesrepublik Deutschland macht sich täglich mitschuldig, indem sie diese Form der Unfreiheit auf ihrem Territorium duldet und sogar noch durch Sozialhilfe alimentiert. Formen von Leibeigenschaft existieren in einigen Ländern Südostasiens, in Indien und im Vorderen Orient. Die Praxis des Kinderverkaufs, wahrscheinlich seit Jahrtausenden fortdauernd, vor allem in Südostasien, erzeugt unablässig sklavenähnliche Verhältnisse, die sehr schwer zu kontrollieren und noch schwerer zu bekämpfen sind (stellen Sie sich einmal vor, man würde ganze Regionen von Thailand oder Birma, – oder auch von Nordafrika -, unter internationale Kontrolle stellen!). Eigentliche Sklaverei existiert in Mauretanien, im Jemen und im Sudan. In manchen Städten Europas, insbesondere in London, wird eine besondere Form "verborgener" Sklaverei eingeschleust, überwiegend von reichen vorderasiatischen, in der Regel muslimischen Familien, die ihre – oft südostasiatischen – Dienstboten in extremer Unfreiheit halten. Auch in der Bundesrepublik gibt es z.B. für Hartz IV-Empfänger Tätigkeiten, die sie annehmen müssen, um Leistungen beziehen zu können. Kann man das als einen sklavenähnlicher Zustand bezeichnen? Egon Flaig: Ich muss mich sehr wundern über diese Frage. In welcher Welt leben wir? Welche Annnahmen oder Vorurteile sind nötig, um eine solche Frage überhaupt stellen zu können? Ich werde antworten auf zwei Ebenen: Zunächst gehe ich ein auf die sozialen Pflichten; dann gehe ich ein auf die Frage der Vergleichbarkeit differenter historischer Situationen. "Rechte implizieren Pflichten, andernfalls werden sie zu Privilegien" Zum ersten. Meine Gegenfrage lautet: Warum soll die arbeitende Bevölkerung überhaupt die Hartz-IVEmpfänger mit ihren Beiträgen versorgen? Ist es normal, dass die Arbeitenden für die NichtArbeitenden aufkommen sollen? Und zwar auch dann, wenn diese Nicht-Arbeitenden die Chance haben zu arbeiten, sich aber weigern, die angebotene Arbeit anzunehmen? Aufrechtzuerhalten ist ein solcher Zustand ohnehin nicht – er würde jede Gesellschaft in den Ruin treiben. Zwar halte ich daran fest, dass es ein Recht auf Arbeit geben muss. Aber es gibt kein Recht auf die von mir gewünschte Arbeit. Die Zeiten sind längst vorbei, in denen wir noch träumen konnten, jeder könne den Beruf ausüben, der ihm behagt. Es hat nie eine Gesellschaft gegeben, die einen solchen paradiesischen Zustand garantierte – und es wird niemals eine solche geben – das liegt im Begriff der Gesellschaft selber. "Der Vergleich des arbeitsunwilligen Hartz-IV-Empfängers mit dem Sklaven ist legitim und heilsam" Wenn ein Nicht-Arbeitender sich weigert, eine Arbeit anzunehmen, weil sie ihm "nicht passt", aber gleichzeitig fordert, dass die Arbeitenden für ihn aufkommen, dann tut er ein Doppeltes: Erstens wird er zum Ausbeuter – er lebt auf Kosten anderer – ähnlich wie ein Sklavenhalter; zweitens gibt er die Verantwortung für seine soziale Existenz ab und bürdet sie der Gesellschaft auf. Gerechtigkeit verlangt, dass jeder für sein Brot und seine Wohnung auch eine Gegenleistung zu erbringen hat; diese besteht in einer Gesellschaft vor allem aus seiner Arbeit – sofern er nicht physisch oder geistig behindert ist. Rechte implizieren Pflichten, andernfalls werden sie zu Privilegien. Wer das nicht akzeptiert, beansprucht für sich das Recht, von anderen versorgt zu werden – im Klartext: dass andere für ihn arbeiten. Ein solcher Anspruch entspringt entweder der Mentalität eines Kleinkindes oder derjenigen eines Kriminellen – oder soll ich hinzufügen: Derjenigen eines Sklavenhalters? Der Sozialstaat ist eine enorme historische Errungenschaft, und wir sind gehalten, ihn zu verteidigen. Darum müssen wir ihn auch vor Missbrauch schützen. Vor allem müssen wir verhindern, dass er sich in eine Versorgungsanstalt verwandelt, welche die Verantwortungslosigkeit fördert – mit fatalen Konsequenzen für die individuellen Fähigkeiten und die sozialen Kompetenzen der Fürsorge-Empfänger. Das Ende wäre eine sozioenergetische Entropie: Ein signifikanter Teil der Staatsbürger würde in alimentierter Unmündigkeit gehalten. Der Vergleich des arbeitsunwilligen Hartz-IV-Empfängers mit dem Sklaven ist legitim und heilsam. Durch Vergleiche lernen wir unterscheiden, durch Unterscheiden kommen wir zu Erkenntnissen. Damit der Vergleich methodisch korrekt sei, frage ich nun Sie: Wurde je Hartz-IV Empfängern – als solchen – der Pass entzogen, die Staatsbürgerschaft aberkannt und wurden sie in den Zustand der völligen Rechtlosigkeit versetzt? Wo wurde ihr Vermögen eingezogen? Wo wurden ihre Ehen aufgelöst und sämtliche Verwandschaftsverhältnisse annulliert? Wo wurden ihnen die Kinder weggenommen und verkauft? Und angenommen, man inhaftierte sämtliche arbeitsunwilligen Hartz-IV-Empfänger, wären sie dann Sklaven? Sogar Gefängnis-Insassen haben Rechte, auf die sie sich berufen können; sie sind Rechtspersonen, obwohl sie für eine bestimmte Zeit bestimmte Rechte nicht ausüben können. Können Sie mir die Hartz-IV-Empfänger zeigen, die man in Kolonnen die Straßen entlang treibt, unterm Peitschenknallen von Aufsehern? Können Sie mir sagen, wo man sie öffentlich auf den Plätzen aufstellt, um sie – vor aller Augen – zu peitschen, ihnen ein Brandmal auf die Stirn zu drücken, ihnen Gliedmaßen abzuschneiden, oder sie zu Tode zu foltern? "Kinderarbeit in der Frühzeit der Industrialisierung für die damaligen Eltern nicht unbedingt ein Skandal" Warum diese hundsgemeinen Fragen? Weil mir daran liegt, dass wir in unseren Köpfen nicht Müll haben, sondern Begriffe. Müll im Kopf reicht vollkommen, um sich zu entrüsten und um mal ordentlich auf die Pauke zu hauen. Müll im Kopf taugt leider nicht, um uns über soziale Verhältnisse rational zu verständigen. Dazu bedarf es klarer Begriffe. Und – leider muss ich das sagen – eines Minimums an historischem Wissen. Wer von Sklaverei nichts weiß, kann sich auch nicht gegen sie engagieren. Was sind die Unterschiede zwischen Sklaverei und Zwangs- oder Kinderarbeit, Vertragsknechtschaft oder erzwungener Prostitution? Egon Flaig: Vorsicht! Es geht um Formen von Unfreiheit! Kinderarbeit ist an sich keine Form von Unfreiheit. Mehrere tausend Jahre lang blieben die allermeisten Familienbetriebe – ob bäuerlich oder handwerklich – auf die Mitarbeit der Kinder angewiesen. Diese Kinder waren Mitglieder ihrer Familie; sie waren – insofern sie z. B. nicht die Zeit hatten eine Schule zu besuchen – benachteiligt. Aber sie waren persönlich frei, unterstanden lediglich der väterlichen, mütterlichen oder sonstigen verwandtschaftlichen Autorität. Als Erwachsene waren sie so frei wie andere auch. Problematisch wird es, wenn Kinder außerhalb der Familie arbeiten. Nehmen wir die berüchtigte Kinderarbeit in der Frühzeit der Industrialisierung. Für uns ein Skandal. Für die damaligen Eltern nicht unbedingt: Genauso wie ihre Kinder ihnen in der Schusterei geholfen hatten (solange sie noch selbständige Handwerker waren), so arbeiteten sie nun halt in derselben Fabrik, in der auch Vater und Mutter arbeiteten. Aber selbstverständlich ist das soziale Verhältnis ein völlig anderes. Trotzdem fehlt das Moment der persönlichen Unfreiheit. Die Kinder können den Arbeitgeber wechseln. Der Arbeitgeber ist eben kein Herr: Er verfügt über die Arbeitskraft, aber er verfügt nicht über den arbeitenden Menschen. "Wer glaubt, die Menschenrechte seien eine westliche Erfindung, kann gegen Sklaverei nichts tun" Nehmen wir den gar nicht so seltenen marginalen Fall: Nicht einmal der Arbeitszwang für herumstreunende, kriminelle und aufgegriffene Kinder (in den "Arbeitshäusern") machte aus ihnen Sklaven. Denn sie behielten ihren Status als britische Bürger, den sie mit der Volljährigkeit antraten; sie behielten ihre Verwandtschaftsverhältnisse, ihren Namen, ihr Eigentum. Sie unterstanden keinem "Herrn", sondern einer Behörde (ob kommunal, kirchlich oder sonst wie karitativ ist nebensächlich), die legalerweise nur in definierten Grenzen über die "Insassen" verfügen konnte. Die Einschränkung ihrer Freiheit war sehr sektoriell und vorübergehend – ein Sonderfall von zeitweiliger Unfreiheit. Damit kommen wir zu den Fällen, die Sie mit Ihrer Frage wahrscheinlich anzielen: Kinder, die nicht im familiären Rahmen arbeiten und die nicht als "Arbeiter" behandelt werden, denen also verwehrt wird, das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Die meisten Fälle – wahrscheinlich viele Millionen – finden sich in Indien. Sehr häufig ist eine Form von Schuldknechtschaft (Kinder arbeiten die Schulden ihrer Eltern ab). Diese Form von Unfreiheit ist durch den Artikel 4 verboten, es ist ein "sklavenähnlicher" Zustand. Bezeichnenderweise unternehmen die lokalen Behörden nichts oder wenig – d.h. sie behandeln dieses Verhältnis als eine traditionale soziale Institution. Kaum nähern sich jedoch eine westliche Kamera und zwei Reporter, kommt Panik auf. Das heißt: Die Behörden wissen sehr wohl, dass das Verhältnis illegal ist; und der "Arbeitgeber" wenn man den Herrn über die Schuldknechte mal so nennen will, weiß es auch. Diese Situation indes, wo die Behörden verlogen handeln und der "Herr" regelmäßig die Sache "verbergen" muss, liefert die Chance, um durch permanenten Druck, die "Arbeitgeber"-"Herren" zu zwingen, ja sie zu kriminalisieren, bis dieser Missstand aufhört. Machen wir uns nichts vor: Wer die Menschenrechte ablehnt, kommt an dieser Stelle nicht weiter. Wer glaubt, die Menschenrechte seien eine westliche Erfindung – eine böse zumal, um die sogenannte dritte Welt unter imperialistischer, moralischer Hegemonie zu halten, wer das glaubt, kann gegen Sklaverei nichts tun. Daher die Hilflosigkeit der sogenannten Linken in der Darfur-Frage und im südsudanesischen Bürgerkrieg. Die Hunderttausende, die dort versklavt wurden, dürfen eigentlich nicht befreit werden. Denn Sklaverei kann ja gar kein Verbrechen sein, wenn die Kultur vor Ort sie praktiziert. Sklaverei ist in der Tat nur ein Verbrechen, wenn man den Standpunkt der westlichen Abolitionisten – und daher der Menschenrechte – einnimmt. Zwangsarbeit? Auch hier: Vorsicht. Sie ist per se keine Sklaverei. Sie kann aber zur Sklaverei führen. Zur Zwangsarbeit verurteilte Sträflinge sind an sich keine Sklaven. Verbeispielen wir das Problem an Hand der Galeerensträflinge (Venedigs oder Genuas oder welcher mittelmeerischen Stadt der frühen Neuzeit auch immer). Wenn der verurteilte Sträfling nach 5 – 10 Jahren nicht mehr Galeere rudern muss, wird man ihm a) seinen Bürgerstatus belassen, b) sein Eigentum belassen, c) seine Familienbande nicht annullieren, d) seine Vormundschaft über seine Kinder gelten lassen, e) sein Testament rechtskräftig anerkennen, f) er muss zwar Galeere rudern, (und erleidet gegebenenfalls Körperstrafen) aber er ist nicht verfügbar, er kann nicht verkauft oder vermietet werden. Ein solcher Sträfling ist offensichtlich eine Rechtsperson. Intrusive Sklaverei Doch in China und Russland lief es über Jahrhunderte anders: Der (lebenslänglich) Verurteilte verlor seinen Namen, seine Ehe wurde annulliert, seine Familienbande für nichtig erklärt; das heißt, diese Sträflinge hörten auf, als Rechtspersonen zu existieren. Obwohl sie eigentlich Staatssklaven waren und über sie nicht privat verfügt werden durfte, konnten die Kaiser gar nicht verhindern, dass solche Menschen andauernd vermietet und zu privaten Zwecken benutzt wurden, ja sogar verkauft wurden. Das ist logisch. Ihre extreme Rechtlosigkeit begünstigte diese Verwendung. Orlando Patterson spricht hier von "intrusiver Sklaverei" – zu Recht. Vielleicht ist der aussagekräftigste Unterschied zwischen den Gulag-Systemen und den KZ-Systemen des 20. Jahrhunderts einerseits und der Staatssklaverei des alten Russland und China anderseits genau hier zu finden: Im Lager behält der Staat die Verfügung über den völlig entrechteten Häftling und verhindert, dass private "Zweckentfremdungen" stattfinden. "In Europa ist die Zwangsprostituierte keine Sklavin, im Jemen ist die Zwangsprostituierte eine Sklavin" Vertragsknechtschaft ist eine harte Form von Unfreiheit aber leichter zu bekämpfen als Schuldknechtschaft. Denn die Betroffenen sind nicht auf Grund des Vertrages in Knechtschaft. Mit dem Vertrag wurden sie in eine Gegend gelockt, wo sie fremd, abgeschnitten und ohne Freunde und Familie sind, wo ihnen die Behörden nicht helfen (oder nicht helfen wollen). Der Arbeitgeber hält sich aber nicht an den Vertrag, sondern behandelt nun den Vertragsarbeiter so, als sei dieser sein Häftling. In Brasilien hat es weniger Jahre bedurft – aber eines starken Engagements von Presse und freien Gewerkschaften und eines spektakulären Regierungswechsels -, um die Behörden zu zwingen, vor Ort zu kontrollieren, ob die Verträge eingehalten werden. Und natürlich stellte sich dann schnell heraus, dass die Arbeitgeber entweder illegale Verträge ausgestellt hatten oder die Verträge gar nicht einhielten. Schuldknechtschaft zu beseitigen ist viel schwieriger. Denn der Gläubiger ist – nach Ansicht der lokalen Behörden – im Recht, der Schuldner im Unrecht. Ist Zwangsprostitution Sklaverei? Das hängt davon ab, ob Sklaverei als soziale Institution existiert oder nicht. Anders gesagt: In Europa ist die Zwangsprostituierte keine Sklavin, obwohl sie eine der schlimmsten Formen von Unfreiheit erleidet. Im Jemen ist die Zwangsprostituierte eine Sklavin, ganz einfach, weil man Sklavinnen zur Prostitution hält. Der Unterschied ist – vom sozialen Verhältnis aus gesehen – riesig. Können Sie für unsere Leser den historischen Werdegang der Sklaverei kurz skizzieren? Egon Flaig: Es gibt keinen "historischen Werdegang". Denn Sklaverei hat es in allen Hochkulturen gegeben, und in einer stattlichen Anzahl sogenannter "primitiver Kulturen". Sie speist sich aus zwei Quellen: a) aus dem Import von gewaltsam versklavten Menschen, in der Regel Gefangene von Kriegen und Überfällen; Orlando Patterson nennt das "intrusive Sklaverei" (der Sklave ist ein Fremder), b) aus der eigenen Bevölkerung, nämlich durch soziales "Herausfallen" – Kinderverkauf, Kindesaussetzung, Verkauf von verschuldeten Menschen, gerichtliche Verurteilung; Patterson nennt dies "extrusive Sklaverei" (der Versklavte wird in diesem Falle zum "Fremden" gemacht). Extrusive Sklaverei herrschte in Ostasien, v. a. China, Korea, und in Russland; intrusive herrschte vor allem in Afrika, in den präkolumbianischen Hochkulturen, bei Griechen und Römern bis zur Kaiserzeit, in der gesamten islamischen Welt und in der amerikanischen (Brasilien, Karibik, Süden der USA) Sklaverei. "Eine 'antiimperialistische' Ideologie hat bewirkt, dass eine ganze Generation von Nichtwissern herangewachsen ist" Sie extrapolieren in ihrem Buch die islamische Sklaverei. Relativieren sie damit nicht die christliche Sklaverei, die Sklaverei in den europäischen Kolonien und die amerikanische Sklaverei? Egon Flaig: Man extrapoliert, um eine Lücke zwischen zwei mathematischen Werten zu schließen. Ich extrapoliere nichts. Sondern ich tue das, was Historiker bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts machten, falls sie sich mit Sklaverei in globalem Maßstab beschäftigten: Sie bezogen das größte sklavistische System selbstverständlich in ihre Überlegungen ein. Unsere französischen und teilweise die amerikanischen Kollegen tun das immer noch. Die Deutschen hatten nur kurzen Kontakt mit Sklaverei in Afrika; das Thema interessiert in Deutschland eigentlich nur wenige. Das heißt, die Deutschen sind in dieser Hinsicht unterinformiert. Wenn sich jemand damit beschäftigt, dann sind es Althistoriker oder aber Historiker, die eigentlich "Geschichte des Kolonialismus" betreiben – wobei unter "Kolonialismus" immer bloß der sogenannte europäische verstanden wird. Unter diesen Bedingungen ist freilich eine Lücke vorhanden, nämlich eine Wissenslücke – und die ist riesig. Eine "antiimperialistische" Ideologie hat bewirkt, dass eine ganze Generation von Nichtwissern herangewachsen ist, die vor historischen Tatsachen völlig ratlos steht. In diesem Fall hilft Hegels Wort "umso schlimmer für die Tatsachen!" – ignorieren wir sie einfach. "Mein Handwerk verlangt, dass ich relativiere" Ob ich die christliche Sklaverei relativiere? Die Frage ist doppelt seltsam. Erstens konnte ich eine "christliche" Sklaverei nicht ausmachen: Keine christliche Kirche hat je ein umfassendes Sklavengesetz erlassen – ganz im Gegensatz zum Sklavenrecht der Muslime, welches auf Fatwas beruht, also auf religiösen Gutachten. Sie meinen wohl "transatlantische" Sklaverei, also Sklaverei – praktiziert von christlichen Mächten? Dann müssten Sie Ihre Frage an diejenigen Historiker richten, die sich mit der transatlantischen Sklaverei beschäftigen! Etwa so: "Relativieren Sie nicht die islamische Sklaverei, wenn Sie sich mit einem System beschäftigen, das – abgesehen von Brasilien – etwa 250 Jahre bestand, während das islamische 1300 Jahre dauerte?" Zweitens. Wenn Sie fragen: Relativieren Sie? Dann kann die Antwort nur lauten: "Ja selbstverständlich!" Mein Handwerk verlangt, dass ich relativiere. Ohne Relativieren kein wissenschaftliches Arbeiten. Relativieren heißt: ich muss alles in Beziehung setzen. Denn nichts hienieden ist absolut (wir könnten es mal versuchen: Sie nennen mir etwas "Absolutes" – und ich zeige Ihnen, dass auch das Absolute immer in Relation steht, also relativ ist). Wenn ich nicht die unterschiedlichsten Phänomene miteinander in Beziehung setzte, könnte ich keine Verhältnisse zwischen ihnen entdecken. Und wenn ich nicht unentwegt vergliche, könnte ich gar keine Differenzen wahrnehmen. Ich muss also tun, was Orlando Patterson oder Claude Meillassoux, die Meister des politisch-anthropologischen Erforschens der Sklaverei, so brillant vorgemacht haben: Die einzelnen Sklaverei-Typen miteinander vergleichen, die historischen Sklaverei-Systeme so genau als möglich in Komponenten zerlegen, die untereinander vergleichbar sind. Sie verwenden das Wort "Relativieren" so, als hieße es "Verharmlosen". Worte haben präzise Bedeutungen. Wenn wir zur Bierflasche "Waschmaschine" sagen, dann zerstören wir die Basis unserer Kommunikation – und wir zerstören die Basis unserer Intelligenz. Denn Intelligenz bemisst sich an der Fähigkeit, Differenzen wahrzunehmen und sie zu verbegrifflichen. Relativieren hat überhaupt nichts zu tun mit "leugnen" oder "verharmlosen". Das Gegenteil ist richtig. Wenn ich Lagersysteme miteinander vergleiche, dann relativiere ich das Funktionieren. Das scheint eine kühle Operation zu sein, die sich an "objektiven" Gegebenheiten orientiert. Ganz richtig. Aber gerade deswegen begreife ich das sub- jektiv erfahrene Leiden besser. Warum besser? Weil ich nicht kurzschließe – wie das Mitleid es tut (und Mitleid ist eine ungemein wichtige Gabe des Menschen) -, sondern Erfahrungen von den Situationen her konstruiere. Ich kann sie ja bloß konstruieren. Machen kann ich sie ja nicht. Und ich muss doch dafür dankbar sein, dass ich sie nicht machen muss. Teil 2 des Interviews: Sklaverei stirbt niemals von selbst ab Siehe "Sklaverei stirbt niemals von selbst ab" Reinhard Jellen 26.12.2009 Zweiter Teil des Gesprächs mit Egon Flaig über sein Buch "Weltgeschichte der Sklaverei" Der Sklave Peter aus Baton Rouge, Louisiana. Aufnahme vom 2 April 1863 (Rücken mit Narben wie Gewächsen grauslich) Herr Professor Flaig – Sie schreiben in ihrem Buch, dass die islamische Sklaverei seit dem 19. Jahrhundert beschönigt worden sei. Wie das und wie hat die islamische Sklaverei tatsächlich ausgesehen? Egon Flaig: Warum wurde die islamische Sklaverei im 19. Jahrhundert beschönigt? Erstens, weil im 19. Jahrhundert der nordafrikanischen Piraterie endgültig das Handwerk gelegt wurde. Das verdanken wir den Amerikanern, die zwischen 1795 und 1815 zweimal Krieg gegen die Piraten-Emirate des Maghreb führten, um diese Praxis des Versklavens zu unterbinden. Dank gebührt auch den Engländern, die 1819 Algier bombardierten, und nicht zuletzt den Franzosen, die 1830 endlich Algier eroberten. Nach dem Ende der maghrebinischen Piraterie war Europa zum erstenmal sicher vor den Versklavungsaktionen der Muslime. Und genau als die Gefahr nachließ, begann die Romantisierung – z. B. in den Opern. Das ist typisch für die europäische Kultur: Alle anderen Kulturen werten das Fremde rigoros ab; die Europäer kennen die Abwertung auch, aber sie haben auch eine lange Tradition des Verklärens und Romantisierens. Die europäische Kultur ist selbstkritisch wie keine andere: Sie kritisiert das Eigene und konfrontiert es mit einem Fremden, das zum Ideal stilisiert wird. Zweitens weil die Abolitionisten in ihrem Kampf gegen die Sklaverei zu jedem Mittel griffen, um die europäische Sklaverei als besonders übel erscheinen zu lassen, folglich als ein Übel, das man sofort beseitigen müsse. Dem Abolitionismus verdankt die Menschheit eine ihrer größten Revolutionen. Aber leider auch eine legendenhafte Verharmlosung der Sklaverei, sofern sie nicht europäisch war. Je erfolgreicher die Kolonialmächte in Afrika dem Versklaven ein Ende setzten – ein Prozess, der von cirka 1850 bis etwa 1920 dauerte -, desto weniger konnten Reisende Erfahrungen mit der islamischen Sklaverei machen. So konnten sich die Mythen halten, die hernach im sogenannten antikolonialen Kampf so wichtig wurden. Die europäische Arbeiterbewegung stand teilweise der Kolonialpolitik ihrer Länder ablehnend gegenüber und benötigte die Mythen; afrikanische Intellektuelle, die in Europa studierten oder verkehrten, übernahmen diese verharmlosenden Bilder der nicht-europäischen Sklaverei. Sie konnten sich dann ein gutes Gewissen einreden – trotz des schreienden Dementis all jener, die sich noch sehr genau erinnerten -, um sich damit zu beruhigen, ihre Sklaverei sei "milder" – ja eigentlich gar keine "richtige" Sklaverei gewesen. Mythen halten sich, weil man sie braucht. Afrikanische Sklavereiforscher wie etwa Ibrahim Thioub wissen davon ein Lied zu singen. Was ist nun richtig? Die islamische Sklaverei unterscheidet sich nicht von anderen Arten der Sklaverei. Die Unterschiede zwischen den Verwendungsweisen von Sklaven sind viel größer als die Unterschiede zwischen den sklavistischen Kulturen. Plantagensklaverei in Marokko oder im Irak unterschied sich kaum von derjenigen in Brasilien, der Karibik oder dem Süden der USA. Minensklaverei – es ist die schlimmste und tödlichste Form – unterschied sich nicht signifikant, ob es sich um die Salzminen im südlichen Marokko handelte, die Kupferminen in der Zentralsahara oder um die römischen Silberminen oder um die brasilianischen Goldminen. Haussklaverei – egal ob in Rom, in Brasilien oder in Kairo oder Damaskus – brachte in der Regel hohe Chancen wegen der Nähe zum Herrn. Die islamischen Sklavengesetze gleichen in vieler Hinsicht den römischen, wahrscheinlich ist ein Großteil direkt aus dem Römischen Recht entnommen; denn die Muslime eroberten von 638-725 den größten Teil des Imperium Romanum. Besonderheiten bleiben: Die muslimische Sklaverei beruhte auf ständiger Zufuhr von außen. Orlando Patterson nennt sie daher die "intrusive" Sklaverei par excellence. Da der Zustrom über viele Jahrhunderte beträchtlich war, konnte die islamische Gesellschaft es sich leisten, eine hohe Quote von Sklaven ständig freizulassen (natürlich nur solche, die zum Islam übergetreten waren). Mit dieser hohen Freilassungsrate ähnelt die islamische Sklaverei der römischen. Und umgekehrt: Eben diese hohe Rate an Freilassungen verlangte nach ständiger Zufuhr von versklavten Menschen. Diese Zufuhr hatte fatale Auswirkungen auf die militärisch und politisch unterlegene Umwelt des islamischen sklavistischen Systems. Entweder, man musste große Mengen kaufen, oder man musste regelmäßig Krieg führen, um Sklaven zu erbeuten. Letzteres fügte sich sehr gut mit der Pflicht zum Djihad, also mit der Pflicht, gegen Ungläubige so lange Krieg zu führen, bis diese alle unterworfen sind. Ersteres hieß, andere die Kriege in den "Lieferzonen" führen zu lassen. In Europa besorgten das die Wikinger und zeitweise die Ungarn. Mamlukie und die Eunuchie Was unterscheidet die islamische Sklaverei von den anderen Arten? Egon Flaig: Hinsichtlich der ökonomischen und sozialen Verwendung von Sklaven findet sich kein Unterschied. Das hat Clarence-Smith aufgezeigt. Es gibt nicht den Typus "islamische Sklaverei", genauso wenig wie es die "afrikanische" oder "römische" Sklaverei als besonderen Typ gibt. Die Typen der Sklaverei sind demnach nicht von den Kulturen bestimmt, in denen Sklaverei gepflegt wird. Nichtsdestotrotz gibt es zwei Verwendungsweisen, die nur in der islamischen Kultur auftreten, nämlich die Mamlukie und die Eunuchie. Mamlukie: Seit dem 9. Jahrhundert gehen islamische Herrscher dazu über, ihre Kernarmeen aus Sklaven zu rekrutieren. Dafür haben sie zwei Gründe: Erstens sind Soldaten, die schon als Kinder selektiert, trainiert und indoktriniert werden, die besten Soldaten überhaupt. Die Mamluken waren über viele Jahrhunderte die besten Truppen der ganzen Welt, wenn man die Mongolen ausnimmt. Zweitens sind diese entwurzelten, familienlosen, radikal vereinsamten jungen Menschen ihrem Herrn total ergeben. Die islamischen Herrscher brauchten aber gerade ein solches militärisches Instrument, um sich unabhängig zu machen von den arabischen Stämmen, von den städtischen Eliten und von den religiösen Autoritäten. Daher entstand in der islamischen Welt ein weltgeschichtliches Unikat: Ein Staat, der überhaupt nichts mit den Untertanen zu tun hat, ohne die geringste Partizipation. Ein Staat, in dem die Macht von Sklaven ausgeübt wird, die im Dienste eines Herrn stehen, der selber immer der Sohn einer Sklavin ist. Diese Despotie ist ein Anti-Staat, wenn man europäische oder ostasiatische Maßstäbe anlegt. Und die Mamlukie erforderte einen beträchtlichen menschlichen Nachschub. Mamluken waren weiße Sklaven, überwiegend Slawen und Türken; schwarzafrikanische Militärsklaven verwandten insbesondere die Sultane Marokkos und das Moghulreich in Indien. Eunuchie: Die islamischen Herrscher ließen ihre Verwaltung von Menschen betreiben, die kastriert waren und daher keine Aussicht auf eigene Nachkommen oder eine eigene Familie hatten. Treuere Verwaltungsbeamte sind nicht vorstellbar. Auch der chinesische Kaiser verfügte in der Hauptstadt über mehrere tausend Eunuchen, die als Beamte fungierten. Freilich waren in China die Eunuchen Freiwillige, in der islamischen Welt waren es Sklaven. Nicht nur die Herrscher der islamischen Welt brauchten stets große Stäbe an Eunuchen, auch reiche Kaufleute, Verwaltungsbeamte usw. benutzten dieses bequeme Mittel, sich absolut loyale Vertraute zu beschaffen, denen man die schwierigsten politischen oder kommerziellen Geschäfte anvertraute. Sieht man von der Eunuchie und der Mamlukie ab – also von der politischen Funktion -, dann ist die islamische Sklaverei von anderen Sklavereien nicht oder kaum zu unterscheiden. "Nomaden sind überall ideale Versklaver" Welchen Einfluss hatte die islamische Sklaverei auf die Entwicklung des afrikanischen Kontinents? Egon Flaig: Afrika wurde innerhalb von 300 Jahren zur größten Lieferzone des Globus. Als die Muslime im 7. Jahrhundert Nordafrika eroberten, begnügten sie sich nicht mit den großen reichen Provinzen des Imperium Romanum (Ägypten, Cyrenaica, Tunesien, Algerien, Nord-Marokko), sondern sie drangen über die Wüste bis zum Tschad-See vor. Bis zum 10. Jahrhundert waren alle Wüstenstämme islamisiert; und damit wurden die Wüstenwege sicher. Und nun begannen die riesigen Karawanen in schöner Regelmäßigkeit ihre Reisen: Manufakturwaren und Salz und Pferde durch die Sahara in den Süden, dafür gingen Gold und Sklaven in den Maghreb, nach Libyen und Ägypten. Am südlichen Rand der Sahara entstanden Emirate und Sultanate, vom Senegal bis Äthiopien, die auf 6000 km Länge unentwegt Kriege führten, um ihre hoffnungslos unterlegenen Nachbarn zu versklaven. "Sklavistische "Lieferstaaten"" Zwar sind Nomaden überall ideale Versklaver. Aus der eurasischen Graslandsteppe – von der Mandschurei bis nach Ungarn – brachen in schöner Regelmäßigkeit die vernichtenden Invasionen weit überlegener Reiterheere über den Gürtel von Hochkulturen ein. Die ackerbauenden Hochkulturen – Korea, China, Indien, Persien, das Imperium Romanum, 1241 auch die mitteleuropäischen Monarchien – litten unter diesen Invasionen, die jedes Mal große Menschenverluste bedeuteten. Doch nun liefen die Nomaden des Sahel den Tartaren, Türken, Turkmenen, Kasachen und Mongolen den Rang ab. Denn sie hatten im Süden nur wenige hochorganisierte Hochkulturen, sondern überwiegend wehrlose Völker, die den Reiterangriffen ausgeliefert waren. Ein unablässiger Strom von Sklaven ging durch die Sahara. Mit weit höheren Verlusten als auf den transatlantischen Sklavenschiffen. Die Todesrate bei der Wüstenüberquerung lag etwa doppelt so hoch (30 Prozent). Schlimm für den afrikanischen Kontinent war, dass sklavistische "Lieferstaaten" entstanden – das Königreich Mali, die Sultanate Bornu und Kanem, ebenso Dharfur und viele andere. Diese benötigten zusätzliche Sklaven innerhalb der eigenen Gesellschaft – nicht nur für die Arbeit auf Plantagen und in den Minen, sondern auch weil die Sultane sich gegenüber den nomadischen Stämmen verselbständigten, und eine Kriegsmaschinerie von Militärsklaven unterhielten (aber hier waren es schwarze – die Vorform der modernen Kindersoldaten). Solche Staatsgebilde können gar nicht freiwillig mit dem Versklaven aufhören. Sie beginnen irgendwann sogar sich gegenseitig zu vernichten um die Jagdgebiete auszuweiten. Diese Selbstzerstörung in der Lieferzone begann schon im 16. Jahrhundert – also völlig unbeeinflusst von den Europäern, die als Käufer an den Küsten erst später auftauchten. Die enormen kulturellen Zerstörungen über Jahrhunderte veränderte den subsaharischen Teil des Kontinents vollständig. Es entstanden nicht-moslemische Kriegerstaaten (Dahomey, Ashante), die in Küstennähe dasselbe taten wie die Sultanate und Emirate im Sahel. Die Versklavungskriege wurden vielleicht noch weiter angeheizt, als die Portugiesen ab etwa 1470 ebenfalls Sklaven kauften. Mit Sicherheit wurden sie angeheizt, als seit 1630/1650 Engländer, Franzosen und Holländer an der Küste Westafrikas ebenfalls Sklaven kauften, in immer größerem Ausmaß. Aber die Europäer hätten keine Sklaven kaufen können, wenn südlich der Sahara nicht ständige Versklavungskriege stattgefunden hätten. Atomisierung, Bindingslosigkeit, Verlust des Selbstbilds Sie schreiben, dass der Zustand der Sklaverei für den Sklaven selbst massive Auswirkungen auch auf sein Selbstbild hat. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Egon Flaig: Claude Meillassoux hat es auf die Formel gebracht: Entsozialisierung: die versklavten Menschen werden herausgerissen aus ihren sozialen Schutzräumen, ihrer Heimat, ihrer Religion, ihrer Kultur, ihrer Sprache; die langen Deportationen – über Ozeane, Gebirge oder Wüsten – rauben ihnen jede Hoffnung auf Heimkehr, machen sie gefügig für ein Leben in der Fremde. Entsexualisierung: Frauen verlieren ihre Mutterfunktion, werden reduziert auf ihre Funktion, Arbeitskraft zu sein, lebenslang; Männer verlieren analog ihre Vaterfunktion. Entzivilisierung: Sie können sich die neue Kultur nur noch mühsam aneignen, haben dazu kaum Zeit und nur unzureichende Gelegenheit; sprechen sie die Sprache ihrer Herrn schlecht, dann missverstehen sie die Befehle, drohen Strafen und Erniedrigungen, die bezwecken, sie allmählich den Tieren anzuähneln. Die Grunderfahrung von Sklaven ist meist diese: Atomisierung: d.h. jeder Sklave hat ein Einzelschicksal; daher sind Sklaven fast nie eine soziale Klasse gewesen (wo sie es wurden, da entstanden brandgefährliche Situationen für das System); sie können kaum Freundschaften aufbauen, betrachten sich überwiegend als Konkurrenten (was verständlich ist: Bei derart knappen Ressourcen droht überall Konkurrenz). Familienlosigkeit: Pseudo-Ehen werden vom Herrn nach Bedarf aufgelöst, die Kinder nach Belieben verkauft; diese währende Situation bringt den psychischen Haushalt völlig durcheinander. Verlust des Selbstvertrauens: Immer droht die körperliche Gewalt; die sexuelle Verfügbarkeit (auch von männlichen Sklaven) bricht die eigene Würde. Und wenn die Selbstachtung unter eine bestimmte Schwelle sinkt, nimmt sich der Sklave als minderwertiges Wesen war. Menschen, die nur gehemmt initiativ sind, werden stets von ihrer Umwelt als minderwertig, mindestens aber als "gestört" wahrgenommen. Dieses Bild von Sklaven existiert in allen sklavistischen Gesellschaften – ohne Ausnahme. Es ist die Basis des Rassismus. Denn Rassismus hat nichts zu tun mit "Fremdheit", sondern mit "Minderwertigkeit". Und zwar ohne alle Hautfarbendifferenz. Fatal ist, dass die Betroffenen selber dieses Bild übernehmen. "Indem der Sklave seine Lage akzeptiert, verändert sich sein gesamtes Wertesystem" Mit welchen Mitteln fördert man die resignative Haltung der Sklaven oder motiviert ihn zu seiner Tätigkeit? Egon Flaig: Bringt man einen Sklaven so weit, dass er die Hoffnung aufgibt, sich selbsttätig befreien zu können, dann fügt er sich in seine Lage; er hofft dann höchstens noch auf einen Umschwung des Schicksals. Indem er seine Lage akzeptiert, verändert sich sein gesamtes Wertesystem. Es hängt nun von vielen Faktoren ab, wie er sich orientiert und ob er innerhalb seiner Lage Vergünstigungen erreichen will. Zerstört man die Selbstachtung eines Sklaven – hier spielen Gewalt und sexuelle Gewalt eine wichtige Rolle – , dann tendiert die resignative Haltung dazu, alle Lebensbereiche zu ergreifen. Solche Menschen werden initiativlos. Das heißt aber, für Tätigkeiten mit relativer Eigenverantwortung sind sie nicht mehr zu gebrauchen. Fügsame Sklaven – nicht vollkommen resignierte – können entgegen dem, was wir bei Hume und Marx lesen, zu hohen Leistungen imstande sein. Entscheidend ist, sie zu motivieren. Motivieren kann man aber nur Menschen, die ein Ziel vor Augen haben, eventuell es mit einer glühenden Hingabe verfolgen. Das kann die Beförderung in höhere Funktionen sein. Doch in vielen sklavistischen Systemen war die Aussicht darauf, vom Herrn freigelassen zu werden, der allerstärkste Anreiz. Je sehnsüchtiger Sklaven dem Tag der Freilassung entgegenlebten, desto treuer und engagierter erfüllten sie die Aufgaben. Und: Sie versuchten so gut sie konnten, die Werte der Herrenkultur zu übernehmen. Sie orientierten sich an derselben, weil sie sich vorbereiteten auf den Zustand "danach", in Freiheit. Daher entstanden "Sklavenkulturen" bei hohen Freilassungsraten nur mühsam. Seltsamerweise kann ein ähnliches Verhalten sogar dort auftreten, wo fast gar keine Hoffnung auf Freilassung besteht – wie etwa im amerikanischen Süden. Hier, wo Sklaven einen höheren materiellen Lebensstandard hatten als die Arbeiter vieler europäischer Großstädte, spielten die zusätzlichen Vergünstigungen eine Rolle. Z.B. ein eigenes Häuschen, ein größeres Gärtchen, und vor allem: Eine Pseudo-Familie! D. h. die Aussicht, mit einer Frau, von der man hoffte nicht getrennt zu werden, Kinder zu haben und sie aufziehen zu dürfen im Wissen, dass man von ihnen zumindest so lange nicht getrennt wird, wie die Plantage nicht verkauft wird. Sklavenkultur und Herrenkultur Auch diese Sklaven (Punkt 4) arbeiten stark motiviert. Trotzdem besteht zu Punkt 3 ein gravierender Unterschied: Die völlige Aussichtslosigkeit jemals frei zu werden, verändert die Menschen von Grund auf, denn sie orientieren sich überhaupt nicht an der Herrenkultur. Sie entwickeln eine "Sklavenkultur" und werden von den Herrn darin sogar noch bestärkt. Denn die "Sklavenkultur" macht den Sklaven noch fremder als er ohnehin schon ist. Werden solche Menschen schlagartig kollektiv in Freiheit gesetzt, haben sie die allergrößten Probleme, sich an die neue Situation anzupassen. Das sollten wir in Erinnerung behalten, wenn wir die Geschichte der karibischen Länder nach 1831 und 1848 ansehen oder die Situation der Schwarzen im Süden der USA nach der Emanzipation. "Sklavenaufstände führten nicht zur Abschaffung der Sklaverei" Wenn der große Jean Bodin 1570 also fordert, die Sklaverei überall und bedingungslos abzuschaffen, gleichzeitig aber verlangt, man solle die Sklaven erst freilassen, sobald sie ein Handwerk gelernt haben, dann war er weitsichtiger als viele Abolitionisten des 19. Jahrhunderts. Denn er hatte erfasst, dass die Schwierigkeiten für diese Menschen genau in dem Augenblick auftauchen, in dem sie den Wechsel in die Freiheit schaffen sollen. Was sind die Bedingungen für Sklavenaufstände? Egon Flaig: Zunächst müssen wir einen Irrtum ausräumen: Sklavenaufstände führten nicht zur Abschaffung der Sklaverei. Bei fast allen Sklavenaufständen errichteten die Aufständischen – wenn sie über ein zureichendes Gebiet zu herrschen begannen – ihrerseits wieder ein sklavistisches System. Die Abschaffung der Sklaverei erfolgte durch die politische und militärische Macht der westeuropäischen Staaten. Nun zu den Aufständen selbst: Sie sind die extreme Form des Widerstandes, insofern sie mit gewaltsamem Kampf die Freiheit anzielen. Wer ist dazu überhaupt imstande? Menschen, die in Sklaverei aufwachsen, machen normalerweise keine Aufstände. Sklaven, die ihre Situation nicht mehr ertragen, versuchen – wenn sie nicht resigniert zu sterben trachten – meist zu fliehen. Sklavenaufstände sind seltene Phänomene in der Geschichte. Überall, wo Aufstände stattfanden, wurden diese geführt von "Kernen", die fast immer aus frisch versklavten Sklaven bestanden. Deren Selbstbewusstsein musste noch stark genug sein, um mit Mut und Opferbereitschaft ein kollektives Wagnis einzugehen. Häufig waren diese Kerne Angehörige einer einzigen Ethnie oder aber von Ethnien, die sich sprachlich und kulturell nahe standen. Die kulturelle Nähe war wichtig, damit sich überhaupt Vertrauen bilden konnte. Ohne ein starkes Vertrauen zueinander war ein derartiges Wagnis sinnlos. Die Organisationskerne entstammten nie aus den untersten und elendsten Schichten der Sklaven, sondern aus jenen, die mehr Bewegungsspielraum und oft auch eine höhere Bildung innehatten. Sklavenaufstände haben dort die besten Chancen, wo die Herren politisch gespalten sind, oder wo Teile der Herren sogar mit den politischen Zielen der Sklaven sympathisieren – das ist beim zweitgrößten Sklavenaufstand der Weltgeschichte passiert, auf Haiti 1790. "Sklaverei stirbt niemals von selbst ab" Dieser Sklavenaufstand war der erste erfolgreiche überhaupt. Dieser Erfolg lag nicht zuletzt daran, dass die Aufständischen darauf verzichteten, ihre Feinde zu versklaven; stattdessen ließen sie prinzipiell keine Sklaverei mehr zu – sie verwirklichten die Ideale der Französischen Revolution. Der größte und längste Sklavenaufstand der Weltgeschichte, 869-883 im Irak, wurde organisiert von mehreren Kernen – religiösen Herätikern, sozial Unzufriedenen und ostafrikanischen Sklaven. Er konnte sich sehr lange halten, weil er sich schnell staatlich organsierte. Er brach zusammen – nach islamischen Quellen betrug die Anzahl der Toten zwischen 500.000 und 2 Millionen – wahrscheinlich aus zwei Gründen: Einerseits verfügte das Kalifat in Bagdad über die größte Militärmaschine der Erde, anderseits dachten die Aufständischen gar nicht daran, alle Sklaven zu befreien, sondern sie errichteten ihrerseits wiederum ein sklavistisches System. "Wenn die Sklaverei immer großflächiger geduldet wird, dann ist es unter Bedingungen der Globalisierung nicht möglich, sie von den westlichen Ländern fernzuhalten" Wird die Sklaverei ihrer Einschätzung nach in absehbarer Zeit absterben oder werden wir eine Renaissance der Sklaverei erleben? Egon Flaig: Sklaverei stirbt niemals von selbst ab. Die Sklaverei muss man töten. Dort wo Sklaverei existiert, im Jemen, Mauretanien und im Sudan, wird die Sklaverei nicht "absterben". Wir haben vergessen, dass die Briten in Afrika intervenieren mussten – seit 1807 -, um den ständigen Versklavungskriegen ein Ende zu bereiten. Die Blockade der westafrikanischen Küste von 1807-1867 kostete Großbritannien stattliche Summen. Diesen Gefallen, einfach abzusterben, hat die Sklaverei uns nirgendwo getan. Auch in Ostasien nicht. Dass China schon im 18. Jh. sklavenfrei war, ebenso wie Japan, hängt daran, dass die Kaiser immer wieder das System der Strafsklaverei reformierten, bis die Sträflinge rechtlich und praktisch keine Sklaven mehr waren. Aber das sind massive staatliche Eingriffe; die kann man nicht "absterben" nennen. Verhindern lässt sich die Sklaverei nur, wenn funktionierende Staaten sich an die internationalen Konventionen halten oder zu halten bestrebt sind. Das ist ersichtlicherweise immer weniger der Fall. Was im Sudan passiert und was die somalische Piraterie uns vorführt, ist die Auferstehung der vorkolonialen Muster. Diese werden nun virulent. Wir werden die Rückkehr von Versklavungskriegen dort kaum verhindern können, wo die Staaten zusammenbrechen, also in großen Teilen Afrikas, in Teilen der muslimischen Welt. Im Gegenteil, wir erleben die Renaissance der Warlords und der Militärsklaven in Gestalt der Kindersoldaten. Täuschen wir uns nicht: Wenn die Sklaverei immer großflächiger geduldet wird, dann ist es unter Bedingungen der Globalisierung nicht möglich, sie von den westlichen Ländern fernzuhalten. Kommt sie, wird es vergeblich sein, die anderen Formen der Unfreiheit bekämpfen zu wollen. Anders gesagt: Wenn Sklaverei in Europa wieder möglich wird, dann ist der Kampf gegen die Zwangsprostitution so unnütz wie das Ziehen an einem Hampelmann. Letztlich gibt es nur 3 Möglichkeiten: Entweder: Die Abschaffung der Sklaverei wird eine permanente polizeiliche Aufgabe der UN – mit dauernden Interventionen, vielleicht mit der Errichtung von Protektoraten (genau so hatte der Kolonialismus in Afrika begonnen). Oder: Die Sklaverei dehnt sich aus und nistet sich in den westlichen Gesellschaften ein – zunächst in multikulturalistisch begünstigten Parallelgesellschaften, um danach pervasiv zu werden. In Europa werden dann sklavenhaltende Gesellschaften entstehen, was es auf dem Kontinent nördlich der Alpen etwa 1100 Jahre nicht mehr gegeben hat. Oder: Die sklavenfreien Gebiete der Welt – der Westen und Ostasien – schirmen sich drastisch ab gegen Migrationen, die im Gepäck die Sklaverei gratis mitschleppen. Es könnte sein, dass die Lösung 3 langfristig die geringsten humanen und politischen Kosten mit sich bringt. Aber die Sklaverei ist nicht bloß eine Gefahr von "außen". Bei weitergehender Verelendung in Europa könnte sie auch von "innen" – also extrusiv entstehen. Wie das? Weil wir die Freiheit haben, unsere Freiheit zu zerstören. Deutlicher: Die Vertragsfreiheit jedes einzelnen Bürgers und jeder Bürgerin kann zu perversen Resultaten führen. Erinnern wir uns? Kannibalismus in Deutschland, vertraglich vereinbart zwischen zwei freien Menschen? Wenn wir zusehen, wie jemand sich vertragsmäßig mit freiem Willen von einem Vertragspartner aufessen lässt, dann werden wir eines Tages zusehen, wie irgendjemand von uns sich in die Sklaverei verkauft. Er hat in voller Freiheit seine Freiheit verkauft. Das ist die Paradoxie des Ultraliberalismus. Rousseau hat gegen diese Paradoxie schwer angearbeitet. Sobald der erste das tut, und wir ebenso ratlos dreinblicken wie vor dem Kannibalen von Rothenburg – ohne die feste Entschlossenheit zu handeln -, werden wir uns die Augen reiben, angesichts der sozialen Prozesse, die damit ausgelöst werden. "Verelendung" ist also ein politisches Problem. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Sie ist primär nicht ein ökonomisches Phänomen, sondern ein kulturelles. Das betrifft weit weniger den (fehlenden) Euro in der Tasche, als vielmehr die Werte im Kopf. Artikel-URL: www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31713/1.html Das gehört zu kor esports www.wcg.com/6th/main.asp http://www.heise.de/tp/r4/artikel/16/16559/1.html Bilder! Triumphbogen gegen Völkerschlachtdenkmal Wolfgang Kleinwächter 23.01.2004 Welche Kulisse braucht das Medienspektakel Olympia, das zudem mit dem Internet konfrontiert wird? Am "Picadilly Circus" in London präsentiert seit Jahren die "New Shakespeare Company" William Skakespeares gesammelte Werke in 108 Minuten. Die "jüngste Geschichte der Olympischen Spiele in drei Stunden" konnte man am Wochenende bei einem internationalen Symposium erleben. Wissenschaftler aus Montreal (1976), Moskau (1980), Los Angeles (1984), Seoul (1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000) und Athen (2004) waren nach Leipzig gereist und analysierten mit 60 Experten aus 15 Ländern, wie sich durch Olympia das globale Image und die lokale Wirtschaft ihrer Städte gewandelt haben. Olympische Spiele werden von Milliarden von Menschen verfolgt. Kein Ereignis garantiert einer Stadt mehr internationale Aufmerksamkeit. Und spätestens seit in Mexico City 1968 erstmalig Satelliten eine Fernseh-Live-Übertragung der Sportwettkämpfe rund um den Globus möglich machten, sind die Spiele zum gigantischsten Medienspektakel der Welt und zur Triebkraft für die Entwicklung innovativer Kommunikationstechnologien und Mediendienste geworden. Von einer "dreckigen Hafenstadt" zur "Kulturmetropole" Wenn die Sportler nach dem Verlöschen der olympischen Flamme wieder nach Hause zurückkehren, bleibt dem Gastgeber in der Regel eine neue weltweite Wahrnehmung und eine exzellente Infrastruktur. Barcelona gelang es z.B. durch eine geschickte Medienstrategie, Sport mit Kunst zu verbinden und sich als Stadt von Miro, Picasso und Gaudi zu präsentieren. Fast unmerklich wandelte sich so das globale Image der Katalanenmetropole. Aus der dreckigen Hafenstadt der 50er Jahre wurde die europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2000 München Einen ähnlichen Langzeiteffekt erlebte München. Die Spiele 1972 fielen mit dem Beginn der sogenannten "Informationsrevolution" zusammen. München brachte den flächendeckenden Durchbruch des Farbfernsehens. Nie zuvor wurden so viele Satellitenfernsehübertragungen realisiert. Und nie zuvor berichteten mehr Journalisten von den Spielen, die trotz der Terroranschläge das Bild einer "Weltstadt mit Herz" um den Globus trugen. Olympia pushte in München frühzeitig den Strukturwandel von der Industrie- zur Informationswirtschaft und bahnte den Weg zur heutigen Medienmetropole. Ein Forschungsprojekt zum Thema "Olympic Cities and the Media: Images, Infrastructure and Innovation", das von der Sports & Media Section der Internationalen Gesellschaft für Medien und Kommunikationsforschung (IAMCR), einer Unterorganisation der UNESCO, in Kooperation mit den Universitäten in Leipzig und Halle koordiniert wird, will jetzt durch eine vergleichende Analyse herausfinden, welche langfristigen Wirkungen die Veranstaltung von Sommerspielen auf das globale Image und die lokale Wirtschaft einer Olympiastadt haben und welche kommunikationstechnologischen Innovationsschübe durch das Medienspektakel ausgelöst werden. Bei dem Leipziger Olympiasymposium waren nun erste Berichte aus allen Olympiastädten seit München 1972 zu hören. Von Montreal (1976) nach Athen (2004) Während die Münchener Bilanz weitgehend positiv ausfällt, präsentierte David Whitson vom Department of Political Science der University of Alberta mit den Montreal-Spielen so etwas wie ein Gegenbeispiel. Finanziell gesehen war Montreal ein Desaster. Noch heute zahlen die Bürger die Schulden ab. Montreal versuchte sich damals, der Welt primär als "Quebec", das "französische Kanada", zu präsentieren. Das aber gelang nur zur Hälfte und hatte wirtschaftlich eher negative Konsequenzen. Abziehendes amerikanisches Kapital vergrößerten Montreals Finanzprobleme nach den Spielen. Der Versuch, durch den Bau des Stadions in einem unterentwickelten Vorort eine nachhaltige Entwicklung auszulösen, schlug fehl. Erst jüngst ist Montreals Baseball Team wieder in die Innenstadt zurückgekehrt. Und das Image der Stadt leidet noch immer unter dem damals nicht fertig gewordenen Stadion. Montreal Yassen Sassurski, Dekan der journalistischen Fakultät der Lomonossow Universität Moskau, wusste von den 80er Spielen ähnlich Zwiespältiges zu berichten. Die "Öffnung" Moskaus wurde konterkariert durch die staatlichen Anstrengungen, die Kontakte der jungen Moskowiter mit den trotz Boykott angereisten ausländischen Besuchern unter Kontrolle zu halten Der imageschädigende Versuch war doppelt kontraproduktiv. Der "Rote Platz" wurde zum Ost-West-Treffpunkt und, so Sassurski, der Prozess Richtung Glasnost und Perestroika, der fünf Jahre später im Kreml begann, wurde durch die Olympischen Spiele nicht unwesentlich beschleunigt. Ohne Olympia hätte Moskau aber auch nicht sein Ostankino TV Zentrum. Und während ein Großteil der Sportanlagen verfallen sind, dient das damalige Olympische Medienzentrum heute den russischen Präsidenten als Platz für ihre internationalen Pressekonferenzen. Moskau Los Angeles 1984 war total anders, so Joseph Manguno von CNN. Das Finanzloch von Montreal hatte damals alle Mitbewerber aussteigen lassen. Der in Moskau neu ins Amt gekommenen IOC Präsident Samaranch akzeptierte, um den letzten Kandidaten bei der Stange zu halten, den nicht problemlosen Deal, die Spiele erstmalig in die Hand eines privaten Konsortiums zu geben. Das war der eigentliche Beginn der Kommerzialisierung der Spiele. Samaranch erkannte dabei die Möglichkeiten einer globalen totalen Fernsehvermarktung und baute das neue Geschäftsmodell der vom IOC veranstalteten Spiele auf. Davon profitierte als erste Stadt Seoul. Den Koreaner zogen zusätzlich Nutzen aus dem sich abzeichnenden Ende des Kalten Krieges, der zum ersten mal seit Tokio 1964 Olympische Spiele ohne politische Attacken (1968 in Mexico "Black Panther", 1972 in München "Schwarzer September", 1976 in Montreal "Afrika Boykott", 1980 in Moskau "Westboykott" und 1984 in Los Angeles "Ostboykott") ermöglichte. Seoul und damit auch ganz Korea gelang es, sich den Medien und damit der Welt durch Präsentation einer Mixtur von Kulturgeschichte und Hightech ein völlig neues globales Image zu geben. Statt "Entwicklungsland mit Diktator" begann man Korea als aufstrebenden wirtschaftlicher Tiger mit einer stärker werdenden demokratischen Bewegung wahrzunehmen. Jae Won Lee, Kommunikationsprofessor von der Cleveland University, der 1988 in Seoul im Pressenzentrum als rechte Hand von Koreas IOC Mitglied Kim gearbeitet hatte, beschrieb in Leipzig eindrücklich, welchen entscheidenden Anteil die 88er Spiele an den nachfolgenden Demokratisierungsprozessen hatten. Seoul stieg durch die Spiele in die Reihe der "großen Weltstädte" auf. Los Angeles Die oben bereits erwähnte Erfolgsgeschichte der 92er Spiele – Samaranch brachte Olympia in seine Heimatstadt – bestätigte Chris Kennet vom "Olympic Study Center" der Universität Barcelona. Das "kulturelle Image Design", hinter den sich am Anfang ganz Katalonien und später ganz Spanien stellte, hat wesentlichen Anteil, dass sich z.B. die Zahl der Barcelona-Besucher zwischen 1990 und 2000 fast verdreifacht hat, wobei zwei Drittel des Zuwachses von ausländischen Touristen kam, die die TVOlympiabilder von "La Rambla", "Monjuc" oder der "Sagrada Familia" noch im Kopf hatten. Atlanta 1996 wiederum war zunächst die One-Man-Show des Geschäftsmannes Billy Paine, der ein profitables "Geschäftsmodell" kreierte, dessen Versprechungen für das IOC so reizvoll waren, dass Samaranch damals alle Einwände wegbügelte. Athen, das die Spiele zum 100. Olympia-Geburtstag haben wollte, aber keinen "Business Case" präsentierte, zog den Kürzeren. Die "Akropolis" verlor gegen "Coca Cola". Das Atlanta-Organisationskomitee versuchte, die Stadt medial als die "Wiege der Bürgerrechtsbewegung" des "neuen Südens" der USA zu verkaufen, eine nachhaltige Entwicklung hat Olympia in der Stadt aber nicht ausgelöst. Die meisten Sportanlagen wurden "zurückgebaut". In der Erinnerung haften geblieben ist vor allem das "Atlanta Bombing". Und einzig und allein der "Cientential Park" wird von den Besuchern und Bürgern noch heute als Spazierplatz gerne genutzt. Seoul Ganz anders hingegen Sydney. Helen Wilson von der Southern Cross University sieht die Inszenierung der Kulisse von Sydney – Opera House, Kleiderbügel, Bondi Beach – als ein wesentlicher Imagebildner. Sydney war schon vor den Spielen schön, die Olympiade hat aber dieses bis dahin vorwiegend in der südlichen Hemisphäre angesiedelte Wissen um den Globus getragen. Olympia hätte das Problem "Aborigines" weltweit thematisiert. Und dann war Sydney, allen voran "Darling Harbour", natürlich die bis dato größte olympische Freiluftparty. Nie zuvor wurden in dieser Dimension die Wettkämpfe in den Stadien auf öffentliche städtische Plätze übertragen. Und nie zuvor verschwand die Grenze zwischen Live im Stadion und Live auf der Großbildleinwand. 2004, so Roy Panagiotopouplou von der Universität Athen, wird Olympia "back home" sei. Sie beklagte, dass die Medien im Vorfeld ein falsches Image der Stadt zeigen. Bauverspätung und Verkehrsprobleme seien mediale Mythen, die Wirklichkeit sähe anders aus. Man rechnet allein mit rund 20.000 akkreditierten und nicht akkreditierten Journalisten und sei gut gewappnet. Zwar seien die Athener wegen der jahrelangen Bauarbeiten ermüdet, aber 82 Prozent der griechischen Bevölkerung finden die Olympiade für ihr Land sehr wichtig oder wichtig. Barcelona Jede Olympiade ist einzigartig. Der Vergleich aber macht Entwicklungstendenzen deutlich und zeigt Problemfelder auf, mit denen alle Gastgeber ungeachtet ihrer Einzigartigkeit zu ringen haben. Nachfolgende Gastgeberstädte können dabei manches lernen aus den Erfolgen und Misserfolgen ihrer Vorgänger. Das reicht von der Kommunikations- und Investitionsstrategie bis zum Umgang mit Zehntausenden von Journalisten und Hunderttausenden von Touristen. Und sie können auch lernen, wie man mit unvermeidbaren weltpolitischen Umständen – vom "Kalten Krieg" bis zum "Kampf gegen den Terrorismus" – kreativ umgehen kann. Herausforderung Internet Ein immer wiederkehrender Punkt ist, dass die Olympiaden kommunikationstechnischen Innovationen zum Durchbruch verhelfen. Athen wird erstmals einen die ganze Stadt abdeckenden drahtlosen Kommunikationsdienst – Wireless Olympic Work (WOW) – sehen, mit denen jedermann mittels mobiler Endgeräte Zugang zu der offiziellen Olympiadatenbank hat. Die langfristigen Folgen der Medienkonvergenz und insbesondere die Rolle des Internet für die mediale Präsentation und Vermarktung der Olympischen Spiele, standen auch bei der Leipziger Diskussion im Mittelpunkt. 1992 lag die Zahl der Internetnutzer in der Welt noch erheblich unter einer Million. Im Jahr 2012 wird es 1.5 Milliarden Internet Nutzer weltweit geben. Die Medien verschmelzen weiter. Das Internet verheiratet sich mit der mobilen Kommunikation. Und mit Breitband und UMTS wird sich die Vielfalt von digitalen Audio- und Videodiensten kaum noch überschauen lassen. Damit wird mittelfristig natürlich das auf der Vermarktung der Fernsehrechte basierende olympische Geschäftsmodell herausgefordert. Läuft das auf einen Konstellation hinaus, bei der, ähnlich wie beim Musikgeschäft, eine P2P-Kommunikation der Nutzer einer etablierten Musikindustrie das Fürchten lehrt? Atlanta "Die Leute wollen professionelle Bilder haben", sagte in Leipzig Rod Ackermann, internationaler Sportkorrespondent der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) mit Sitz in Paris und New York, "da kann ein Handy-Reporter, der von der Tribüne aus den Zehn-Sekunden-Clip des 100-Meter-Laufs ins Netz stellt, nicht mit konkurrieren." Das ist sicher richtig. Aber, auch das wurde auf dem Symposium deutlich, unter den professionellen Journalisten gibt es eine zunehmenden Zweiteilung. Auf der einen Seite finden sich die Rechteinhaber, die privilegierten Zugang zu den besten Tribünenplätzen und zur "mixed zone" haben und de facto einer Art "embedded journalist" des IOC sind, und auf der anderen Seite befinden sich die "non-accredited journalists" und "free lancer", die die "andere story" suchen oder einfach kreativ das kopieren, bearbeiten, mixen oder weiterleiten, was andere produzieren oder einfach in digitaler Form verfügbar ist. "Creative Second Hand Journalism", zielgerichtet abgestellt auf spezielle Nutzergruppen als komplementärer Dienst zu den etablierten Angeboten der Platzhirsche? Welche Kommunikationsmöglichkeiten mit welchen Konsequenzen die technische Revolution im kommenden Jahrzehnt hervorbringen wird, ist schwer abschätzbar. Sicher scheint aber, das im Kampf um die "Eyeballs" das klassische Fernsehen Federn lassen wird. Fernsehen wird für lange noch das vorrangige Sportmedium bleiben, aber ein sich verschärfender Wettbewerb mit den neuen Medien nagt an der Wertigkeit der TV-Exklusivrechte. Damit ist zwangsläufig das einst von Samaranch erfundene Finanzierungsmodell der Olympischen Spiele herausgefordert. Das IOC hat strenge restriktive Regelungen für eine Internetberichterstattung aus Athen erlassen. Man kann gespannt sein, wie das funktioniert. Langfristig aber ist Kontrolle und Einschränkung keine Strategie. IOC-Präsident Jacques Rogge hat dieses Problem längst erkannt und höchstpersönlich den Vorsitz der "IOC Internet Rights Commission" übernommen. Spätestens nach Athen wird man sich den Kopf konkret zerbrechen müssen. Sydney Eine mögliche Reduktion von TV-Einnahmen – ein Problem, mit dem auch FIFA, UEFA oder der deutsche Fußball ringen – muss mit einer Doppelstrategie kompensiert werden, die sowohl die Erschließung neuer Einnahmequellen über die neuen Medien als auch die "Verbilligung der Spiele" einschließt, so Rod Ackermann, der für die NZZ seit München 1972 über alle Olympischen Spiele berichtet hat. Aus "groß" mach "klein"? Noch ist es nicht so weit und NBC hat sich erst kürzlich eine Milliarden-Option für 2010 und 2012 gesichert. Für ihr Geld wollen die Fernsehmacher aber immer spektakulärere Kulissen, um sportliche Konflikte wie einst "Carmen vs. Carmen" dramatisieren zu können. "Triathlon & Sydney Oper", "Marathon & Akropolis", das schaut sich gut an und lässt sich verkaufen. Was heißt das für 2012? Steht im Juli 2005 in Singapur bei der Vergabe der Sommerspiele dann auch "Sacre Coeur" gegen "Bachs Thomaskirche" zur Wahl? Beach-Volleyball vorm Eiffelturm gegen Jagdspringen vor Canalettos Dresden Kulisse? Der Pariser "Triumphbogen", der an Napoleons Siege erinnert, gegen das Leipziger "Völkerschlachtdenkmal", das Napoleons Niederlage symbolisiert? Kann man große Kulisse auch etwas billiger haben? In seinem "Faust" nennt Johann Wolfgang Goethe Leipzig ein "Klein-Paris". Wenn es IOC Präsident Jacques Rogge ernst meint mit seiner Absicht, angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen und kommunikationstechnologischen Rahmenbedingungen den Kurs seines Vorgängers Samaranch zu verlassen und umzusteuern, öffnet sich für die Stadt an der Pleiße möglicherweise ein "Window of Opportunity". http://www.heise.de Die Roboter kommen ... Florian Rötzer 22.10.2000 ... aber die vom jährlichen Bericht World Robotics schon länger erwartete explosive Zunahme der Dienstleistungsroboter lässt noch auf sich warten Jedes Jahr veröffentlichen die United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) in Zusammenarbeit mit der International Federation of Robotics (FR) einen Bericht über den Stand und die Zukunft der Robotik. Waren früher nur die Industrieroboter interessant, so hat sich der Bericht mittlerweile an die Trends angepasst und nennt sich "World Robotics 2000". Der Boom der Roboter, so das wohl begrüßte Ergebnis des Berichts, hält weiter an. Noch sind weltweit die Roboter noch keineswegs dabei, im Hinblick auf hre Zahl die Menschen zu übertreffen, geschweige denn in ihrer Intelligenz. Gerade einmal 742500 Roboter soll es in der Industrie weltweit geben. Noch dominieren auch die in der Industrie eingesetzten Roboter gegenüber den Dienstleistungsrobotern. Gleichwohl setzt man in diesem Bericht wie schon in den letzten beiden darauf, dass die Zahl der Heimroboter jetzt doch endlich bald explosionsartig ansteigen werde. Stets wird der Durchbruch demnächst vermeldet, also spricht man auch im diesjährigen Jahr davon, nur dass der prophezeite Aufstieg der Heimroboter, von denen man beispielsweise letztes Jahr angekündigt hatte, sie würden bald so verbreitet wie Handys sein, sich eher zögerlich zeige: "Still hesitant but expected to take off." Ende 1999 seien an die 6000 Dienstleistungsroboter weltweit im Einsatz gewesen, davon 50 Prozent Heim- roboter, 14 Prozent Unterwasserroboter und 12 Prozent Roboter, die in der Medizin Verwendung finden. Putzroboter machen 6 Prozent aus. Sollten Putzroboter wirklich noch in diesem Jahr zu vernünftigen Preisen auf den Markt kommen, würde der Verkauf explodieren. Bis zu einer Viertelmillion Putzroboter könnte es dann zusätzlich zu den 50000 Dienstrobotern bis zum Jahr 2003 geben. Auch die erwarteten Roboter, die für alte und behinderte Menschen sorgen, hätten noch nicht den Weg zum Markt gefunden, seien aber ein zentraler Bereich für Dienstleistungsroboter. Der schnellen Verbreitung stehe hauptsächlich der Preis im Weg, aber auch die Kunden sind schuld, denn sie wüssten "nicht immer die Leistungskraft und Verlässlichkeit sowie die möglichen Kostenersparnisse" einzuschätzen. Gleich wohl ist man wie jedes Jahr weiterhin optimistisch: "Der weitverbreitete Gebrauch von PCs und Handys sowie die Herstellung von 'intelligenten Küchen' und 'intelligenten Häusern', in dem unterschiedliche Geräte mit PCs und Handys verbunden sind und von diesen gesteuert werden, wird die Einführung von Heimrobotern stark unterstützen." Dafür fällt die Volkszählung der in der Produktion eingesetzten Roboter offenbar zufriedenstellender aus. Die Roboterzählung ist natürlich nur eine Schätzung. Man geht davon aus, dass seit Ende der 60er Jahre, als die ersten Industrieroboter auf den Markt kamen, an die 1100000 Roboter aller Typen verkauft wurden, die natürlich teilweise mit einer durchschnittlichen Lebensdauer zwischen 12 und 16 Jahren bereits verschrottet wurden. Über 742000 soll derzeit weltweit geben, am meisten noch immer in Japan mit 400000, gefolgt von den USA (155000) und Deutschland (81000). Von 1998 bis 1999 sei die Zahl der neu verkauften Industrieroboter um 15 Prozent angewachsen auf über 80000 Stück, wozu vornehmlich die USA (+ 38 Prozent) und die EU (+16 Prozent) beigetragen haben. In Korea sind es gleich um 70 Prozent mehr geworden, allerdings hatte hier ebenso wie in Japan die Wirtschaftskrise erst 1998 zu einem fast ebenso gewaltigen Rückgang geführt, der jetzt wieder langsam wett gemacht wird. Der Boom hat im ersten Halbjahr 2000 weiter mit 12 Prozent im Plus angehalten, die Europäer sind hier noch mit + 14 Prozent dabei, in den USA ließ sich eine Abnahme um 9 Prozent feststellen. Absolut ist die Zahl der Industrieroboter aber nur 3 Prozent gestiegen. Man kann natürlich auch, wie man die Zahl der Patente, der Internetanschlüsse, der Computer oder der Bandbreite pro Kopf der Bevölkerung als Entwicklungsstandard benutzt, auch die der Roboter pro Angestellten ansetzen. In der Produktion steigt der Anteil der Roboter langsam, aber stetig, vornehmlich in der Autoindustrie, in der Japan schon ein Roboter auf 6 Angestellte kommt, in Italien 1:13 oder in Deutschland 1:16. Auch insgesamt ist Japan noch das führende Roboterland: 280 Industrieroboter kommen hier auf 10000 Arbeiter, in Singapur sind 148, in Korea 116 und in Deutschland an vierter Stelle 102. Der Bericht geht davon aus, dass die Investition in Industrieroboter auch weiterhin interessant bleibt, denn die Kosten seien radikal gesunken. Ein durchschnittlicher Roboter, der 1999 verkauft worden ist, habe mit derselben Leistung nur noch ein Fünftel des Preises gekostet, den man 1990 hätte zahlen müssen. Mit dem Kostenrückgang ist gleichzeitig eine Leistungssteigerung einhergegangen: Innerhalb von 10 Jahren habe die Geschwindigkeit oder die Tragelast um das 100fache, die Rechenkapazität gar um das 200fache zugenommen. Für 2003 geht man davon aus, dass es dann weltweit 892000 Industrieroboter geben wird. Da ist man also schon vorsichtiger geworden, denn im letzten Jahr ging man noch davon aus, dass es bis zum Jahr 2002 fast eine Million Industrieroboter geben werde. Zum wachsenden Einsatz von Roboter trage der Arbeitskräftemangel bei, aber auch die Notwendigkeit, dass die Montage in der Industrie mit einer hohen und konstanten Qualität durchgeführt werden müsse, was oft nur Roboter leisten könnten. Und ein Argument für den Einsatz von Robotern, das seit langem ins Feld geführt wird, darf hier natürlich auch nicht fehlen: "Wer ist wirklich daran interessiert, beispielsweise die schweren und immer wiederkehrenden Hebearbeiten auszuführen, die beim Hantieren mit Getränkekisten vorkommen?" fragt Jan Karlsson von der UN/ECE. "Hier sind Roboter am besten, weil sie Arbeitsbedingungen verbessern. Es gibt noch viele weitere derartige Arbeitsplätze, die robotisiert werden sollten." http://www.heise.de Vom Kult der Soldatengräber Peter Bürger 01.09.2009 Ein Beitrag über das Vietnam-Kriegskino zum Antikriegstag 2009 "Flaggen", so erläutert Elias Canetti, "sind sichtbar gemachter Wind". Während die Politiker auch unser Land immer tiefer in den Sumpf des Afghanistan-Krieges hineinstoßen und beharrlich den Willen der Bevölkerungsmehrheit missachten, beglückt man uns mit einer Neuausgabe des "Eisernen Kreu- zes", einer zentralen Heldengedenkstätte in Berlin und vielfältiger Militärbespaßung im deutschen Staatsfernsehen. Traumatisierte Soldaten, die die Wahrheit über den Krieg am Hindukusch erzählen könnten, kommen nicht zu Wort. "Afghanistan", so wünschte einst der US-Geheimdienst, sollte zum "Vietnam für die Sowjetunion" werden. Heute drängt sich der Vietnam-Vergleich noch immer auf, besonders was die vielen Kriegslügen und immer neuen Kriegsgründe anbelangt. Vielleicht liegt auch hier ein Ansatz für die Friedensbewegung. Mein Buch zu den Düsseldorfer Vietnam-Kriegskino-Wochen mit dem Titel "Napalm am Morgen" (2004) ist jetzt kostenlos im Internet zugänglich. Nachfolgend ein Kapitel zum Thema "Soldatengräber". "Gardens of Stone" (1987) von Francis Ford Coppola: "Unser Geschäft ist der Tod!" Im März 1969 erreicht die Zahl der US-amerikanischen Stationierungen in Südvietnam mit 543.000 Mann ihren Höchststand. 300 bis 400 Särge toter Soldaten kommen zu dieser Zeit wöchentlich an den Flughäfen der USA an. Die logistischen Leistungen der US-Army im Vietnamkrieg sind auch an dieser Stelle unübertroffen. Das Identifizierungssystem soll dafür sorgen, dass keinen der eigenen Männer ein anonymes Schicksal ereilt. Erstmals ist es vorgesehen, trotz der riesigen Entfernung jeden toten US-Soldaten zurück in die Heimat zu fliegen und den Angehörigen einen Abschied – vor verschlossenen Särgen – zu ermöglichen. Alle Bilder: TriStar Pictures Die Armee der Vereinigten Staaten ist jedoch nicht nur die modernste Armee der Welt, sondern zugleich äußerst traditionsbewusst. Sie steckt beispielsweise "Soldaten in Arrest, die beim Einholen der Flagge vom Fahnenmast die geweihten Stars und Stripes mit dem Staub des Erdbodens in Berührung bringen." (Hilmar Hoffmann) Wie man innerhalb dieses Traditionsgefüges in den Vereinigten Staaten mit dem unaufhörlichen Sterben junger US-Soldaten umgeht, zeigt Coppolas Film "Gardens of Stone". Der "Steinerne Garten", das ist der Soldatenfriedhof in Arlington. Das unübersehbare Gräberfeld und vor allem die täglichen Beerdigungszeremonien für gefallene US-Soldaten sind Angelegenheit einer elitären Ehrengarde, an deren Spitze vor allem verdiente Veteranen stehen. Gegen Ende der sechziger Jahre finden im "Steinernen Garten" am Tag bis zu zwanzig "Absenkungen" statt. Das Traditionsritual für die gefallenen Vietnamkämpfer wird auch unter Fließbandbedingungen streng eingehalten. Bis zum Erbrechen wird uns das Nekrophile der patriotischen Totenweihe samt Marschmusik, Trompetensolo und Nationalflagge vorgeführt. Vor jedem einzelnen Steindenkmal haben die untergeordneten Ehrengardisten an Feiertagen die "Stars and Stripes" im Kleinformat aufzustellen. Doch die Flagge auf den noch nicht abgesenkten Särgen wird von den Messdienern der hinteren militärischen Ränge längst ganz pietätslos kommentiert: "Asche zu Asche und Staub zu Staub, ab in die Erde und drüber das Laub!" In die Ehrengarde, zu deren Aufgaben dieses so oft gegebene Schauspiel gehört, kommt auch der junge Jackie Willow. Er ist, wie wir später erfahren, sein "ganzes Leben lang" – schon als "kleiner Junge" – Soldat, eifert dem Vater als großes Vorbild nach und arbeitet zielstrebig auf den Offiziersrang zu. Ihm bereitet das bloße Präsentieren keine Befriedigung. Er möchte nach Vietnam, und offenbar können auch die pausenlosen Beerdigungszeremonien seine vaterländische Bereitschaft nicht schmälern. Zwei führende Veteranen, Sergeant Hazard und der farbige Sergeant Major Nelson, kümmern sich als Mentoren um Wilson. Sie sind seit der Zeit des Korea-Krieges enge Freunde seines Vaters, womit ganz nebenbei die gemischtrassige und lebenslang anhaltende Männergemeinschaft im US-Militär historisch erwiesen wäre. An der Seite dieser militärischen Ersatzväter lernt der Zögling aus gutem Hause nicht nur den Ehrenkodex, sondern auch, wie man sich zum Ende einer Sauftour bei einer Schlägerei tapfer hält. Besonders Sergeant Hazard hat aus militär-strategischer Sicht eine kritische Haltung zum Vietnamkrieg, die er nicht verbirgt. Dass so viele in Südostasien sterben, während er Ehrendienste versieht, damit kann er sich nicht abfinden. Er würde lieber junge Soldaten ausbilden oder in Vietnam mitkämpfen. Ihm ist es letztlich egal, wer in Vietnam oder Washington regiert, aber die US-Army – seine Familie, die interessiert ihn: "Meine Firma ist eine Familienfirma. Wenn du nicht alle Kinder retten kannst bei einem Brand, rettest du so viele wie du kannst und weinst später." Sergeant Hazzard lebt getrennt von seiner Frau, denn zwei "Familien" sind für einen so überzeugten Militär dauerhaft kaum zu halten. Er verliebt sich in die Journalistin Samanha, um die er erfolgreich wirbt. Samanha schreibt für die Washington Post und gehört zur Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg: "Für Hazzard ist dieser Krieg nur ein militärischer Fehler. Für mich ist er ein Völkermord!" Als Hazzard später einen angetrunkenen Anwalt aus Samanhas Anti-Vietnamkrieg-Bewegung nach dreisten "Provokationen" krankenhausreif zusammenschlägt, ist sie allerdings bemerkenswert nachsichtig. Der gebrochene Kiefer des politischen Mitstreiters ist schnell vergessen. Samanha macht bei dieser Gelegenheit sogar ihre erste deutliche Liebeserklärung gegenüber Hazzard. Parallel zu dieser Romanze gelingt es Jackie Willow, seine Jugendliebe Rachel wieder zu gewinnen. (Rachels Vater, den die eigene Tochter als "Dreckskerl" charakterisiert, ist ein hoher Militär in der Forschungsabteilung des Pentagons: "Dieser Krieg ist ein wahrer Segen für unsere Forschungsabteilung!") Im Kreise seiner Mentoren und der Ehrengarde kann Jackie seine Hochzeit feiern. Als er 1969 nach absolviertem Offizierskurs Hazzard und Major Nelson seinen bevorstehenden Vietnameinsatz mitteilt, erfährt er anstelle der bisherigen Warnungen durchaus Ermutigung. Die beiden sind – in Vertretung des inzwischen verstorbenen Vaters – offenbar stolz auf ihren Ersatzsohn. Indessen wird Rachel, die junge Ehefrau, sehr bald die Schatten des Krieges erfahren: "Die Männer kommen zurück nach Hause, gebrochen und gefühlskalt." Willows letzter Brief zeugt davon, dass das Massensterben seiner Schutzbefohlenen seinen vormals felsenfesten "Glauben an die Army" erschüttert hat: "Was soll ich ihren Frauen sagen?" Die Eingangszene des Films ist die Schlussszene. Sie spielt im Steinernen Garten. Jackies Ehefrau Rachel zuckt, wie die Kameraführung jetzt zeigt, bei jedem Schuss der Ehrensalven am Grab zusammen. Sie erhält als Witwe das zum Paket zusammengelegte Sargtuch überreicht: "Im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Nehmen Sie diese Flagge als Anerkennung für die treuen Dienste des Verstorbenen." Copollas "Gardens of Stone" nach dem gleichnamigen Roman von Nicholas Proffitt ist kein programmatischer Film gegen Krieg und Militarismus, sondern ein neopatriotischer "zwiespältiger Trauermarsch" (Stefan Reinecke) oder so etwas wie ein "Pro-Militär-Antikriegsfilm" (Produzent Michael Levy). Erschreckende Dokumentarszenen von der Front und ein TV-Bericht über den berüchtigten Kopfschuss, mit dem der südvietnamesische Polizeichef in Saigon 1968 einen gefangenen "Vietcong" exekutierte, werden kurz eingeblendet. Doch die ganze Idylle der Nationalgarde, der Ehrenkodex und das Traditionszeremoniell bleiben unbefleckt vom Blutrausch der Dschungelkämpfer. Letztlich geht es ausschließlich um das familiäre Gesicht der so genannten Heimatfront in den USA und um die historisch verankerte Identität des militärischen Männerbundes. Es wird nur ganz am Rande reflektiert, was Sergeant Hazard als Visitenkarte der US-Truppen in Vietnam benennt: "Das Töten ist unser Geschäft, und das Geschäft läuft gut!" Kriegsverbrechen sind kein Thema. Im Mittelpunkt der Kritik stehen die hohen Opferzahlen der US-Army, wenn es gegenüber der Protestbewegung heißt: "Diese Zivilisten werden nie verstehen, dass niemand diesen Krieg so hasst wie die, die ihn führen müssen!" Vor dem Begräbnis seines Zöglings Willow legt Sergeant Hazzard seine kostbarste Ehrenmedaille auf den Sarg. Nun möchte er um jeden Preis auch nach Vietnam, um jungen US-Soldaten beim Überleben zu helfen. Dabei erfährt er großes Verständnis von seiner "pazifistischen" Geliebten Samanha, die gerade jetzt seinem Heiratsantrag zustimmt und zuvor kundtut: "Ich will nicht, dass du irgendwo hingehst. Aber das ist deine Entscheidung, nicht meine. Meine Einstellung zu diesem Krieg ist immer noch dieselbe. Ich tue alles, was ich kann, um diesen Krieg zu beenden. Ich demonstriere und ich schreibe Artikel und ich nerve Kongressabgeordnete. Wenn du glaubst, dass das ein Messer in deinem Rücken ist, dann musst du es sagen. Du hast deine Aufgabe zu erfüllen und ich meine." Mit dieser harmonischen, arbeitsteiligen Eheschließung zwischen Militär und Protestbewegung ist eine echte politische Kontroverse endgültig ausgeschlossen. Es stellt sich für die Zuschauer nicht mehr die Frage: Was wäre denn gewesen, wenn nicht nur Samanha, sondern ebenso die beiden Mentoren dem Drang des jungen Willow, unbedingt am verbrecherischen Vietnamkrieg teilzunehmen, auch in moralischer Hinsicht widersprochen hätten? Mit diesem Film hat Coppola seinen Ruf sehr beschädigt und den allzu kritischen Kritikern von "Apocalypse Now" eine späte Rechtfertigung geliefert. Er "ergreift offen Partei für das US-amerikanische Militär, das ihm Unterstützung bei den Dreharbeiten gewährte. Kriegsgegner werden als lächerliche, betrunkene Figuren dargestellt, bei deren Provokationen man gar nicht anders kann, als mit Faustschlägen zu antworten. Insofern bleibt seine Botschaft, dass die Zerrissenheit der Nation nur mit Idealismus und Liebe überwunden werden kann, ohne Gehalt, da er auf eine politische Analyse und Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Konflikte zu dieser Zeit vollkommen verzichtet." (Gebhard Hölzl/Matthias Peip) Das kritische Paradigma des Films erweist sich –ganz unfreiwillig – in seiner breiten Inszenierung des US-Patriotismus im Militär, dessen Symbole und Fetische detailgetreu als Requisiten eines absurden Totenkultes ins Bild gerückt werden. "Gardens of Stone" (Der steinerne Garten), USA 1987, Regie: Francis Ford Coppola, Drehbuch: Ronald Bass (nach dem gleichnamigen Roman von Nicholas Proffitt). http://www.heise.de Psychopathen, Psychiater und Psychonauten Hans Schmid 08.08.2009 Teil 1: "Besondere Verhörmethoden" im Kalten Krieg Barack Obamas Plan, sich lieber dem Morgen als dem Gestern zu widmen, scheint nicht aufzugehen. Der US-Justizminister erwägt, einen Sonderermittler einzusetzen, der Foltervorwürfe gegen CIA-Leute überprüfen soll. Senatoren fordern eine Untersuchungskommission zu Bushs und Cheneys Geheimprogrammen im Anti-Terror-Kampf. Sollte wirklich entschlossen aufgeklärt werden, könnte sich herausstellen, dass das Gestern bereits das Morgen war. Huren an die Front Nein, sagt der Zeuge John Gittinger, die roten Vorhänge habe er nie gesehen. Er könne sich auch nicht mehr genau erinnern. Das alles sei lange her, und er habe kaum Zeit zur Vorbereitung gehabt. Ja doch, bei den Tests sei LSD zum Einsatz gekommen, auch über Cannabis habe man diskutiert, aber direkte Informationen habe er so gut wie keine. Er sei nur ein kleiner Psychologe gewesen. Und überhaupt: -------------------------------------------------------------------------------Das ist jetzt der Teil, über den zu reden mir schwerfällt, und es tut mir leid, dass ich dazu gezwungen bin. In Verbindung mit der Arbeit, die wir machten, brauchten wir Informationen über sexuelle Gewohnheiten. Morgan Hall beschaffte mir Informantinnen, mit denen ich über die sexuellen Gewohnheiten sprechen konnte, für die ich mich interessierte. Während eines gewissen Zeitraums wurde das konspirative Haus, soweit es mich betraf, nur für diese besondere Art von Befragung genutzt. Es ist das Jahr 1977. Der Auftritt John Gittingers vor dem für die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste zuständigen Unterausschuss des US-Senats sorgt für Heiterkeit. Senator Ted Kennedy zieht dem mit Erinnerungslücken kämpfenden Zeugen folgenden Sachverhalt aus der Nase: Von 1955 bis 1965 unterhielt die CIA in San Francisco ein von einem Agenten mit dem Decknamen "Morgan Hall" geleitetes Bordell, in dem den Freiern ohne deren Wissen LSD und andere bewusstseinsverändernde Substanzen verabreicht wurden. Das geschah im Rahmen eines Feldversuchs zur Erforschung und Erprobung "besonderer Verhörmethoden". Viel gelacht wurde auch, als Gittingers Kollege David Rhodes von einem zweiten konspirativen Haus berichtete, das außerhalb von San Francisco lag und für Experimente genutzt wurde, bei denen man mehr Ruhe und Abgeschiedenheit brauchte. Die CIA hatte einen Chemiker der Stanford University mit einem großzügig dotierten Forschungsauftrag ausgestattet. Im Gegenzug lieferte dieser Herr regelmäßig Substanzen, mit denen die Feinde der freien Welt schikaniert und zermürbt werden sollten: Stinkbomben, Juck- und Niespulver, zu Durchfall führende Tropfen. Ausprobiert wurde das alles an den angelockten Freiern. Im Hof wurde mit einer Wurfmaschine experimentiert, die einen übel riechenden Gegenstand 30 Meter weit schleudern konnte. Besonders stolz war man auf eine LSD-Sprühdose. Rhodes und ein weiterer CIA-Psychologe zogen eine Woche lang durch die Bars von San Francisco, um Männer zu einer Party einzuladen. Aber das Wetter war gegen sie. Am Tag der Party war es so warm, dass die Geheimagenten Türen und Fenster nicht lange genug geschlossen halten konnten. Deshalb hing zu wenig LSD in der Luft. Um das Experiment doch noch zum Erfolg zu führen, so Rhodes vor dem Ausschuss, habe sich Gittinger für einen Selbstversuch im Klo eingeschlossen. High sei er allerdings auch nicht geworden. Wenigstens bescherte Rhodes' Aussage der Washington Post eine schöne Schlagzeile: "The Gang That Couldn't Spray Straight". In der Öffentlichkeit entstand so der Eindruck, als habe sich hier ein Haufen von Stümpern zusammengefunden, um auf Kosten des Steuerzahlers mit Scherzartikeln herumzuspielen. Dabei gab es eigentlich nichts zu lachen. Diese Experimente waren Teil von MKULTRA, dem geheimsten aller amerikanischen Geheimprojekte im Kalten Krieg. Eine unbekannte Zahl von Versuchspersonen trug bleibende Schäden davon, einige wurden vermutlich sogar umgebracht. Und wie so viele beginnt auch diese Geschichte im Dritten Reich. Agent Sharkey (James Cagney) und verschärfte Verhörmethoden im Gestapo-Hauptquartier(aus dem Film "13 Rue Madeleine") Nach eigenen Regeln 1946 inszenierte Henry Hathaway mit behördlicher Unterstützung einen halbdokumentarischen Film über die Arbeit einer vier Jahre zuvor gegründeten (und 1945 wieder aufgelösten) Einrichtung, von der die meisten Zuschauer bis dahin gar nichts wussten: des Office of Strategic Services (OSS), der Vorläuferorganisation der Central Intelligence Agency (CIA). Der Titel, 13 Rue Madeleine, ist zugleich die Adresse des Gestapo-Hauptquartiers im besetzten Le Havre und suggeriert, dass der OSS nur ins Leben gerufen wurde, weil die anderen angefangen hatten. Das erfahren wir auch durch die Stimme eines Erzählers: Nach dem Angriff auf Pearl Harbor und angesichts der vielen deutschen und japanischen Agenten im Land habe der Präsident erkannt, dass auch die USA einen Geheimdienst brauchten. Diese Begründung hörte man später immer wieder: Wir müssen unangenehme, mitunter verfassungswidrige Dinge tun, weil der Feind das auch so macht (oder es machen würde, wenn er könnte). Die erste Viertelstunde des Films ist der Auswahl und Ausbildung der OSS-Rekruten gewidmet. Dabei schleicht sich gleich ein deutscher Agent mit ein. Vordergründig geht es im Rest des Films um deutsche Raketen und die Invasion in der Normandie. Aber im Grunde wird nur der Krieg der Agenten behandelt. Dabei bekommt man rasch das Gefühl, dass OSS und Gestapo sich selbst genug sind, den Rest der Welt eigentlich nicht brauchen (ein Eindruck, der sich auch bei vielen Aktivitäten der real existierenden Geheimdienste einstellt). Am Ende unterziehen die Deutschen den US-Geheimagenten Bob Sharkey (James Cagney) einem – wie man heute sagen würde – "verschärften Verhör" (foltern tun nur die anderen, und später dann Jack Bauer). Sharkey wird geprügelt und ausgepeitscht. Diese mittelalterlich anmutenden Methoden stehen in scharfem Gegensatz zum Anfang, wo man erfährt, dass Sharkey ein "Gelehrter" ist und die Eliteuniversitäten aufgezählt werden, an denen die OSS-Rekruten studiert haben. Auch Sharkeys Gegenspieler von der Gestapo ist ein gebildeter Mensch. Man ahnt, dass solche Leute nicht auf die Methoden der Inquisition beschränkt sind. "Die Army und die Navy", schreiben Corey Ford und Alastair MacBain in Cloak and Dagger (1946), einer "geheimen Geschichte des OSS", "kämpften wie Gentlemen und Soldaten; die Mitglieder des OSS bekämpften den Feind mit seinen eigenen Waffen und nach seinen eigenen Regeln." Aber was heißt das jetzt? "Cloak and Dagger". Das Preisschild verdeckt ein Hakenkreuz (Bild vergrößern) Kräutergarten im KZ 1936 verkündete Reichsärzteführer Wagner die "Neue Deutsche Heilkunde". Die Schulmedizin, so Wagner, werde man zurückdrängen und lieber auf die Heilkraft der Kräuter vertrauen. Rudolf Höß zufolge war es der Wille der Partei, "das deutsche Volk von gesundheitsschädigenden fremden Gewürzen und künstlichen Medikamenten abzubringen und auf den Gebrauch natürlicher Heilkräuter [...] umzustellen". Als ehemaliger Blockführer in Dachau und als Lagerleiter von Auschwitz kannte er sich aus. Jedes KZ hatte seinen Kräutergarten. Im Dachauer Moos wurden in Sklavenarbeit 20 Hektar Moorland nutzbar gemacht. Die hier angebauten Gewürze deckten fast den gesamten Bedarf der Wehrmacht und der SS. Die Häftlinge wurden nicht nur als kostenlose Arbeitskräfte missbraucht, sondern auch als menschliche Versuchskaninchen. Das war ein einträgliches Geschäft. Für etwa 700 Reichsmark konnten deutsche Pharmaunternehmen einen Menschen kaufen, an dem sie ihre Medikamente ausprobieren durften. Die Gesundheit der Probanden spielte dabei keine Rolle. Auch die SS und die Gestapo erteilten Forschungsaufträge an die KZ-Ärzte. Ihr Interesse galt der Suche nach einer bei Verhören einsetzbaren Wahrheitsdroge und nach einem Aufputschmittel für Soldaten und Rüstungsarbeiter. Bei schrecklichen Menschenversuchen, die nur in einem KZ möglich waren, wurde mit Meskalin, Barbituraten und Morphinderivaten experimentiert. In Auschwitz führte Dr. Bruno Weber Gehirnwäsche-Versuche an Widerstandskämpfern durch. In Buchenwald und Sachsenhausen wurden Studien betrieben, bei denen Probanden täglich bis zu 100 Tabletten der "Endsieg-Droge" Pervitin schlucken mussten (ein Amphetamin). In Dachau forschte, Werner Pieper zufolge (Nazis on Speed), Dr. Kurt Plötner in leitender Funktion für Volk und Vaterland. 1944 stieg er vom SS-Internisten zum Abteilungsleiter des "Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung" auf. 1945 tauchte er unter, um einige Jahre als der unauffällige "Herr Schmidt" zu verbringen. 1954 wurde er, nun wieder als Dr. Plötner, von der medizinischen Fakultät der Universität Freiburg zum außerordentlichen Professor ernannt, obwohl man dort seine Vorgeschichte kennen musste. Wir Deutsche haben also keinen Grund, uns über die Amerikaner zu mokieren, die kaum Berührungsängste kannten, wenn es darum ging, NS-Wissenschaftler zu Kalten Kriegern umzuschulen. Der Geheimdienst erfindet den Joint Das OSS nahm 1942 die Suche nach der Wahrheitsdroge auf. Unklar ist dabei, ob die Amerikaner von den Experimenten der Deutschen erfahren hatten oder selbst auf die Idee kamen. Während die KZÄrzte Meskalin bevorzugten, entschloss sich das OSS im Frühjahr 1943 zu einer Versuchsreihe mit Marihuana. Aus Sicherheitsgründen wurde das Unternehmen dem Manhattan Project angegliedert. Die Entwicklung der Atombombe war das geheimste und am besten abgeschirmte Projekt, das es damals gab. Weil die geheime Welt oft absurd ist, meldeten die Leiter des Manhattan Project zwölf ihrer Mitarbeiter als die ersten Freiwilligen. Die Probanden schluckten das Marihuana als flüssiges Konzentrat und übergaben sich. Kaum eine Wirkung zeigte das Inhalieren von Marihuana-Dämpfen. Dann erfand der Geheimdienst etwas, das man in der realen Welt längst kannte: den Joint. Der erste Feldversuch begann am 27. Mai 1943 in New York. "Wild Bill" Donovan, der Chef des OSS, hatte sich von der Armee Captain George White ausgeliehen, von Beruf Agent des Federal Bureau of Narcotics, der Drogenpolizei. White, der den Decknamen "Morgan Hall" erhielt, kannte August Del Gracio, einen zur Bande von Lucky Luciano gehörenden Mafioso. Bei einem Treffen bot er ihm mit einem Marihuanaextrakt versetzte Zigaretten an. Del Gracio wurde gleich sehr redselig, wobei nicht klar ist, ob das die Wirkung der Zigaretten war oder ob der Gangster generell den Mund nicht halten konnte. Bei einem zweiten Treffen hatte White die Zigaretten mit so viel Marihuana versetzt, dass Del Gracio ohnmächtig wurde. Der Versuch galt trotzdem als Erfolg. Hier wird schon ein Muster deutlich: der US-Geheimdienst wählte am liebsten Versuchspersonen aus, von denen nicht zu befürchten war, dass sie die Sache öffentlich machen würden, falls sie herausfinden sollten, was mit ihnen geschehen war; Leute, bei denen man immer sagen konnte, dass sie es schon irgendwie verdient hätten, falls etwas schiefgehen sollte. White und ein weiterer Agent fuhren nun nach Atlanta, Memphis und New Orleans, wo sie in Armeekasernen ihre Zigaretten an einem guten Dutzend Soldaten ausprobierten, die verdächtigt wurden, Kommunisten zu sein. Weil White gern Arbeit und Vergnügen verband, machten sie unterwegs einige Selbstversuche. Viele dieser Operationen aus den Anfangsjahren von OSS und CIA erinnern an einen aus dem Ruder gelaufenen Kindergeburtstag, oder an die Streiche pubertierender Jugendlicher. Der zweite Agent hat John Marks (Autor von The Search for the "Manchurian Candidate) erzählt, dass er und White nach einem der Verhöre in New Orleans bekifft auf ihren Hotelbetten lagen, von wo aus White mit einer 22er Automatik seine Initialen in den Stuck an der Zimmerdecke schoss. Auf den 16.000 Seiten aus OSS- und CIA-Beständen, deren Freigabe John Marks in den 1970ern erstritt, sind alle Namen und auch sonst noch größere Passagen geschwärzt. Vieles von dem, was mit "Agent Hall" zu tun hat, lässt sich rekonstruieren, weil George White von der ganzen Heimlichtuerei nichts hielt. Whites Witwe schenkte seine privaten Papiere dem Foothills College in Los Altos (Kalifornien), wo man sie jetzt einsehen und viele Klarnamen lesen kann. Daraus zu schließen, dass irgendwann doch alles ans Licht kommt, wäre vermutlich naiv. 1973 wurden in den Archiven der CIA die wissenschaftlichen Aufzeichnungen über die jahrzehntelangen Experimente zur Bewusstseinskontrolle vernichtet. Dafür, dass die vielen Versuche zum Programmieren von Menschen letztlich erfolglos blieben, hat man nur das Wort diverser CIA-Bosse. Nachprüfen kann man es nicht. Gewinne und Verluste Nach Whites Vergnügungsreise durch die Südstaaten scheinen die Experimente eingestellt worden zu sein, weil man beim OSS nicht wirklich glaubte, dass ein Joint einen Verdächtigen dazu bringen würde, anderen seine Geheimnisse zu verraten. Aber was war mit Hypnose? Konnte ein Hypnotiseur andere Leute zu seinen willenlosen Werkzeugen machen, so wie Dr. Caligari den Somnambulen nachts losschickt, um Morde zu begehen und die Jungfrau Jane zu verschleppen? Stanley Lovell, Leiter der OSS-Abteilung für Forschung und Entwicklung, arbeitete folgenden Plan aus: Einem deutschen Kriegsgefangenen wird unter Hypnose der Hass auf die Nazis und außerdem der Gedanke einprogrammiert, Adolf Hitler umbringen zu müssen. Der programmierte Attentäter wird dann zurück nach Deutschland geschickt, wo er wie unter Zwang den Führer tötet. Die meisten der von Lovell befragten Psychiater und Psychologen hielten das für unmöglich. Allerdings gab es da noch George Estabrooks, den Leiter des Psychologischen Instituts der Colgate University. Estabrooks war überzeugt vom militärischen Potential der Hypnose und meldete sich seit den frühen 1930ern immer wieder mit phantasievollen Vorschlägen bei der Army. Er ging gern in HypnoseShows und machte Versuche mit seinen Studenten. Der experimentelle Beweis, dass eine hypnotisierte Person auch ein Verbrechen begehen würde, war ihm jedoch zu riskant. Wenn die Regierung die Verantwortung übernehmen würde, so Estabrooks, wäre das dagegen kein Problem: Alle ‚Unfälle', die vielleicht im Lauf der Experimente passieren werden, verbucht man einfach unter Gewinne und Verluste; das ist eine Lappalie verglichen mit der enormen Verschwendung von Menschenleben, die ein fester Bestandteil des Krieges ist. Das OSS lehnte schließlich ab. Der enttäuschte Professor verlegte sich auf die Publizistik. Er sah es als seine Pflicht an, die Amerikaner vor den Gefahren einer Unterwanderung mittels Hypnose zu war- nen. Sein bekanntestes Werk ist der gemeinsam mit Richard Lockridge verfasste Roman Death in the Mind (1945): Der Kapitän eines amerikanischen U-Boots schießt auf eines der eigenen Schiffe. Auch anderes Personal der Alliierten macht plötzlich Dinge, die man so nicht erwarten würde. Geheimagent Johnny Evans findet heraus, dass sie unter hypnotischer Kontrolle der Nazis stehen. Sogar die schöne Agentin, die er liebt, ist betroffen. Dann wird sie auch noch gefoltert. Johnny beschließt, die Nazis mit ihren eigenen Waffen zu schlagen ... Operation Paperclip Als am 9. Dezember 1946 in Nürnberg der Prozess gegen 20 KZ-Ärzte begann, saßen Agenten im Publikum, die hofften, mehr über die Experimente zu erfahren. Es kam aber nichts zur Sprache, was nicht bereits in den in Dachau und in anderen Lagern beschlagnahmten Akten dokumentiert war. Einer Theorie nach sollten die Agenten darauf achten, dass vor Gericht nichts über die als top secret eingestuften Experimente verraten wurde. Denn auch der Feind – das waren jetzt die Russen – hörte mit. Beim Nürnberger Ärzteprozess gab der 1. amerikanische Militärgerichtshof eine Erklärung über "zulässige medizinische Versuche" ab. Der "Nürnberger Ärztekodex" nennt 10 Punkte, die unbedingt befolgt werden müssen: die Versuchsperson muss zugestimmt haben, es darf kein vorhersehbarer Schaden drohen etc. Danach konnte sich eigentlich niemand mehr darauf herausreden, nicht gewusst zu haben, was erlaubt ist und was nicht. Gleich nach dem Sieg über die Deutschen wurden führende NS-Wissenschaftler, die den Amerikanern ins Netz gegangen waren, nach Schloss Kranzberg bei Frankfurt gebracht und dort verhört. Im Sommer 1945 lief die Operation Paperclip an. Nach Angaben von Regierungsbehörden wurden in den nächsten Jahren einige hundert deutsche Forscher in die USA gebracht und zumeist sehr schnell eingebürgert; unabhängigen Schätzungen zufolge waren es mehr als 5000. Offiziell kamen für die Operation nur solche Wissenschaftler in Frage, die keine Kriegsverbrechen begangen hatten. Tatsächlich spielte aber lediglich die rein fachliche Qualifikation eine Rolle. Der bekannteste der "Paperclip Boys" war Wernher von Braun, der Vater des US-Raumfahrtprogramms (mehr dazu in The Paperclip Conspiracy von Tom Bower und in Mondsüchtig von Reiner Eisfeld). In der paranoiden Welt des Kalten Kriegs war die entscheidende Frage, wer dabei behilflich sein konnte, einen Vorteil gegenüber der anderen Seite zu erringen. Der Rest war zweitrangig. So fanden sich bald nicht nur die Luftfahrtpioniere um von Braun in den USA wieder, die mit Sklavenarbeitern aus dem KZ Dora für Hitler die V- und die V2-Rakete gebaut hatten, sondern auch SS-Ärzte und andere Experten für chemische und biologische Kriegsführung. Einige von ihnen setzten in amerikanischen Laboratorien die Gehirnwäsche-Experimente fort, die sie im Dritten Reich begonnen hatten. Am besten traf es Dr. Friedrich Hoffmann, einer der führenden deutschen Giftgasexperten. Weil das Chemical Corps der US-Armee mehr über Tabun und Senfgas wissen wollte, machte er Versuche mit Hunden, Katzen, Mäusen und US-Soldaten, die sich "freiwillig" gemeldet hatten. Später reiste er im Auftrag der CIA quer durch die Welt, um an den exotischsten Orten nach in der Natur vorkommenden Hallizunogenen zu suchen. Der weniger weltgewandte Dr. Karl Tauböck war eher ein Mann für das Labor. Er hatte in einem früheren Leben im Auftrag der Gestapo mit halluzinogenen Extrakten der in den KZs angebauten Heilpflanzen geforscht und diese unter anderem an Wehrmachts-Offizieren getestet, die im Verdacht standen, ein Attentat auf Hitler zu planen. Hypnose für Anfänger Dr. Hoffmann, der Indiana Jones der Hallizunogene, hatte seine Reisetätigkeit einem Kollegen aus der Schweiz zu verdanken. Albert Hofmann stellte am 16. November 1938 in einem Labor des Pharmakonzerns Sandoz LSD her. Fast fünf Jahre später, am 16. April 1943, kam er versehentlich mit der Substanz in Berührung, die über die Haut oder über die Atemwege in seinen Blutkreislauf gelangte. Hofmann erlebte den ersten LSD-Trip der Geschichte (mehr dazu in seinem Buch LSD – Mein Sorgenkind). 1947 erschien in einer Schweizer Fachzeitschrift ein Aufsatz über die Wirkung der Droge. Die soeben gegründete CIA scheint das zunächst nicht mitbekommen zu haben. Dort war man sehr mit sich selbst beschäftigt. Wie bei solchen Neugründungen üblich, stritten die Abteilungen um Geld, Personal und Zuständigkeiten. Wer keine wissenschaftliche Ausbildung hatte, beschäftigte sich sowieso lieber mit der Populärkultur. Estabrooks' Death in the Mind hatte sich gut verkauft und erlebte 1947 eine Neuauflage. Im November 1949 lief Otto Premingers Film Whirlpool an. Gene Tierney spielt darin die mit einem Psychiater verheiratete Kleptomanin Ann, die scheinbar Hilfe beim Hypnotiseur David Korvo (José Ferrer) findet. Tatsächlich bringt Korvo Ann unter seine Kontrolle, worauf sie in Trance in das Patientenarchiv ihres Mannes einbricht. "Whirlpool" (Bild vergrößern) Der CIA-Mann Morse Allen war von den offenkundigen Möglichkeiten der Hypnose so begeistert, dass er alles las, was er zum Thema finden konnte. 1951 fuhr er nach New York, um bei einem bekannten Bühnen-Hypnotiseur einen 4-tägigen Einführungskurs zu besuchen. Der Magier war ein Angeber. Zurück in Washington, berichtete Allen seinen Vorgesetzten, dass sein Lehrmeister pro Woche durchschnittlich fünf Mal Sex mit durch Hypnose willig gemachten Frauen habe. Dann begann er – mit Genehmigung von oben – mit eigenen Experimenten. Nach Büroschluss hypnotisierte er junge Sekretärinnen und brachte sie dazu, geheime Akten zu stehlen und an Fremde weiterzugeben. Zumindest Allen war davon überzeugt, dass er dazu in der Lage war, den jungen Damen seinen Willen aufzuzwingen. Aber den Anstoß, die schon länger geplanten Programme zur Verhaltens- und Bewusstseinskontrolle endlich konkret anzugehen, gab kein Roman und kein Film, sondern der im Februar 1949 stattfindende Schauprozess gegen József Kardinal Mindszenty. Der Primas von Ungarn wirkte wie ein Zombie und gestand mit glasigem Blick Verbrechen, die er nicht begangen hatte. Bei der CIA glaubte man, dass die Russen den Kardinal durch Drogen und Hypnose zu ihrem willenlosen Werkzeug gemacht hatten. Im Sommer 1949 reiste der Chef der Abteilung für Scientific Intelligence nach Europa. Um besser beurteilen zu können, was die Russen gemacht hatten, wendete er bei Flüchtlingen aus dem Osten und von dort zurückgekehrten Kriegsgefangenen "besondere Verhörmethoden" an (Drogen und Hypnose). Wieder daheim, empfahl er, ein Team nach Europa zu schicken. Zu weiteren Experimenten. Projekt BLUEBIRD Bei der CIA verfestigten sich allmählich die bürokratischen Strukturen, und der Chef der Sicherheitsabteilung, die Penetrationsversuche des Feindes abwehren sollte, schlug vor, alle Aktivitäten auf dem Gebiet der Hypnose und sonstiger Manipulationen des menschlichen Bewusstseins zusammenzufassen, am besten unter seiner Führung. Am 20. April 1950 genehmigte der Direktor das Projekt mit dem Codenamen BLUEBIRD und dessen verdeckte Finanzierung. BLUEBIRD war so geheim, dass sogar innerhalb der Agency möglichst wenig darüber bekannt werden sollte. Die Verantwortlichen behaupteten später, das Projekt sei rein defensiv ausgerichtet gewesen; man habe die Techniken der Kommunisten erkunden müssen, um das eigene Personal schützen zu können. Ganz wie in 13 Rue Madeleine, wo die angehenden Agenten lernen, wie man den Verhörtechniken der Gestapo möglichst lange widersteht. Die Realität ähnelte aber eher dem Spionageroman von Estabrooks. Da hält Johnny Evans ein flammendes Plädoyer dafür, es den Bösen (in diesem Fall den Nazis) heimzuzahlen und sie nun selbst zu hypnotisieren. Bei der CIA sah man das ganz genauso. Also machte man jetzt das, was man der Gegenseite vorhielt. Wie vom Chef der Scientific Intelligence angeregt, wurden 3-köpfige Verhörteams gebildet: ein Psychiater; ein Lügendetektor-Experte mit Hypnose-Ausbildung; ein Techniker. Im Juli 1950, einen Monat nach Beginn des Koreakriegs, reiste ein solches Team in geheimer Mission nach Tokio. An zwei Probanden – vermutlich als Doppelagenten verdächtigte Personen – probierten sie mehrere Kombinationen von Sodiumamytal (Beruhigungsmittel) und Benzedrin (Stimulans) aus, an zwei weiteren Personen auch noch das Aufputschmittel Picrotoxin. Außerdem versuchten sie, bei den vier Probanden einen Gedächtnisverlust herbeizuführen. Im September erschien in der Zeitung News (Miami) ein Artikel von Edward Hunter. Überschrift: "Gehirnwäsche-Taktik zwingt die Chinesen, Kommunisten zu werden". Es war die erste nachweisbare Verwendung des Begriffs "Gehirnwäsche" in gedruckter Form. Das Wort machte im Kalten Krieg schnell Karriere. Hunter war übrigens ein als Journalist getarnter CIA-Agent. Im Oktober war wieder ein Verhörteam auf Reisen. Diesmal wurden an 25 Versuchspersonen (offenbar nordkoreanische Kriegsgefangene) "weiterentwickelte" Verhörmethoden erprobt. Einzelheiten sind nicht dokumentiert. Bald danach stieg Morse Allen zum Chef von BLUEBIRD auf. Allen gehörte zur Abteilung für Sicherheit und Gegenspionage. Die CIA hatte ihn im Gebrauch des Lügendetektors unterwiesen. Wissenschaftlich ausgebildet war er nicht. Allerdings würde er bald zur Fortbildung nach New York reisen, zum Hypnosekurs beim Bühnenmagier. Der erste Plan, den er in seiner neuen Funktion ausarbeitete, betraf die Anschaffung einer Maschine, mit der in einem Krankenhaus in Richmond experimentiert wurde. Am Kopf des Probanden wurden Elektroden angebracht, dann versetzte ihn die Maschine in einen hypnoseähnlichen Tiefschlaf. "Obwohl das Gerät nicht dafür geeignet ist, es bei unseren eigenen Leuten einzusetzen, weil zumindest theoretisch die Gefahr eines temporären Hirnschadens besteht", heißt es in einem von Allens Memos, "wäre es möglicherweise in bestimmten Bereichen von Wert, die mit dem Verhören von Kriegsgefangenen zu tun haben, oder auch bei der Anwendung bei Personen, die für die Agency von Interesse sind." Zum Stückpreis von 250 Dollar wäre die "Elektro-Schlafmaschine" ein echtes Schnäppchen gewesen. Weil sie aber eigent- lich nicht funktionierte, oder jedenfalls nicht in der gewünschten Weise, verzichtete man auf das Geschäft. Blumenkohl im Hirn Lustig ist die Geschichte nur, wenn man die armen Patienten in diesem Krankenhaus in Richmond vergisst. Es geht auch noch gruseliger. Ende 1951 tauschte sich Allen mit einem Psychiater aus, der schon seit einiger Zeit als Berater für die CIA arbeitete und eine erfolgreiche Privatpraxis betrieb. Dieser Herr hatte seinen Patienten Elektroschocks verabreicht und bemerkt, dass danach ein vorübergehender Gedächtnisverlust auftrat; bei Abklingen der Benommenheit habe er neue Informationen aus seinen Patienten herausgeholt. Seine Elektroschock-Maschine der Marke Reiter, so der Doktor, sei überhaupt für vieles gut. Bei richtiger Einstellung der Stromstärke verursache sie furchtbare Schmerzen, was man dazu verwenden könne, Leute zum Sprechen zu bringen. Allens Antwort ist für ihn typisch. Er wollte wissen, ob der Psychiater in der Phase der Benommenheit versucht habe, mittels Hypnose die Kontrolle über seine Patienten zu erlangen. Nein, antwortete der Doktor, aber er werde es demnächst ausprobieren. Außerdem berichtete er, dass man einen Menschen durch kontinuierliche Elektroschocks zum "Gemüse" machen könne; nach zwei Wochen sei das nicht mehr nachzuweisen. John Marks hat in den freigegebenen Akten ein Memo von Allen gefunden, in dem dieser darauf hinweist, dass man jetzt tragbare, batteriebetriebene Elektroschock-Geräte kaufen könne. Der Leiter von BLUEBIRD hatte aber doch Bedenken, oder wenigstens rechnete er damit, dass andere welche haben könnten: -------------------------------------------------------------------------------Die Einwände würden natürlich die Verwendung von Elektroschocks betreffen, wenn das Endresultat die Schaffung eines "Gemüses" wäre. Ich glaube, dass diese Techniken nur im äußersten Notfall in Betracht gezogen werden sollten; eine Neutralisierung durch Haft und/oder Entfernung aus dem Gebiet wäre viel angemessener und bestimmt auch sicherer. Erhalten ist eine Empfehlung, dem Psychiater Forschungsgelder in Höhe von 100.000 Dollar zu bewilligen, "um Elektroschock- und hypnotische Techniken zu entwickeln". Die Forschungen eines privat praktizierenden Arztes zur Entwicklung von "neurochirurgischen Techniken" (wahrscheinlich Lobotomie) sollten ebenfalls mit 100.000 Dollar gefördert werden. In beiden Fällen lässt sich nicht mehr feststellen, ob die Gelder wirklich ausgezahlt wurden. Die Namen der Forscher sind unkenntlich gemacht. Identifiziert ist dagegen Dr. Paul Hoch, Leiter des New York State Psychiatric Institute, von dem Sätze wie dieser überliefert sind: "Es ist möglich, dass eine bestimmte Schädigung des Gehirns von therapeutischem Wert ist." Hoch glaubte, seinen Patienten mit einer Kombinationstherapie aus Lobotomie und persönlichkeitsverändernden Drogen helfen zu können. Der CIA war er als Berater verbunden. Seiner Meinung nach konnte man mit LSD und Meskalin eine zeitlich begrenzte Modell-Psychose hervorrufen, anhand derer sich die Krankheit besser erforschen ließe. Für Geheimdienste war das interessant, weil sich daraus Möglichkeiten der Gehirnwäsche ergaben. Das musste näher untersucht werden. Das Geld dafür kam vom Chemical Corps der Army. Hoch stellte die Probanden zur Verfügung, deren Einwilligung erschien ihm verzichtbar. Harold Blauer, früher Profi-Tennisspieler und inzwischen Tennislehrer, litt nach der Scheidung von seiner Frau an Depressionen. Im Dezember 1952 begann er in Hochs Institut eine psychotherapeutische Behandlung. In deren Verlauf spritzte ihm Dr. James Cattell insgesamt fünfmal Meskalin in wechselnden Dosen. Weder Blauer noch Cattell hatten eine Ahnung, worum es sich bei der Flüssigkeit handelte. "Wir wussten nicht", sagte Dr. Cattell später Ermittlern der Armee, "ob es Hundepisse war oder was sonst, was wir ihm da gaben." Das war Dr. Hochs Variante einer Doppelblindstudie. Schließlich arbeitete er nach streng wissenschaftlichen Methoden. Die am 8. Januar 1953 von 9.53 Uhr bis 9.55 Uhr verabreichte Dosis führte bei Blauer zu einem Kreislaufkollaps und zu Herzversagen. Dr. Cattell protokollierte alles genau mit: von Blauers "Protest gegen die Injektion" (9.53 Uhr) über die "komplette Versteifung des Körpers" (10.01 Uhr), den "Tremor der unteren Extremitäten" (10.09 Uhr), die "schnarchende Atmung" (10.10 Uhr) und das "vereinzelte Aufbäumen" (11.05 Uhr) bis zu Harold Blauers Tod um 12.15 Uhr. Fair Play Solche menschenverachtenden Experimente sind durch nichts zu entschuldigen. Man kann aber versuchen zu verstehen, wie es zu ihnen kam. Manch ein Psychiater glaubte wirklich, seinen Patienten helfen zu können, indem er ihnen Elektroschocks gab und ein Stück von ihrem Gehirn entfernte. Die Forschungsgelder kamen nicht direkt von der Armee oder der CIA, sondern von honorig wirkenden Stiftungen. Wer also nicht wissen wollte, mit wessen Geld er experimentierte und wofür, konnte es verdrängen, und einige hatten wohl wirklich keine Ahnung. Andererseits gab es bei Bedarf eine staatliche Institution, die die Verantwortung übernahm oder dies zumindest suggerierte. Und nicht zuletzt arbeiteten viele Agenten für die CIA, die im Krieg schreckliche Dinge gesehen hatten und genau zu wissen glaubten, wozu die Gegenseite (erst die Nazis, dann die Kommunisten) fähig war. Den Geist, in dem die Menschenversuche stattfanden, fängt eine geheime Studie ein, die in den frühen 1930ern vom damaligen Präsidenten Herbert Hoover in Auftrag gegeben worden war und die erst in den 1950ern ihre volle Wirkung entfaltete. Die Studie kommt zu folgendem Ergebnis: Es ist jetzt klar, dass wir es mit einem unerbittlichen Feind zu tun haben, dessen erklärtes Ziel die Weltherrschaft ist, egal mit welchen Mitteln und zu welchen Kosten. Bei einem solchen Spiel gibt es keine Regeln. Bisher akzeptable und schon lange bestehende amerikanische Vorstellungen von "fair play" müssen überdacht werden. Wir müssen wirkungsvolle Dienste für Spionage und Gegenspionage entwickeln und wir müssen lernen, unsere Feinde durch Methoden zu unterwandern, zu sabotieren und zu vernichten, die klüger, raffinierter und wirkungsvoller sind als die, die gegen uns eingesetzt werden. Soweit es sich rekonstruieren lässt, scheint es 1952 eine Radikalisierung im geheimen Krieg gegen den Kommunismus gegeben zu haben. Das war das Jahr, in dem die chinesische Regierung eine Propagandaoffensive startete. Zu ihr gehörte die Veröffentlichung von aufgezeichneten Aussagen über Korea abgeschossener US-Piloten, die diverse Verbrechen "gestanden", darunter auch den Einsatz von chemischen und biologischen Kampfstoffen. Bis zum Ende des Koreakriegs legten 70 Prozent der in China gefangen gehaltenen 7190 US-Soldaten entweder solche "Geständnisse" ab oder unterschrieben eine Petition, in der ein Ende des amerikanischen Engagements in Asien gefordert wurde. Noch beunruhigender war jedoch, dass viele der Soldaten nach ihrer Heimkehr an den Geständnissen festhielten, statt sie zurückzunehmen, sich sogar pro-kommunistisch äußerten. Nach Ansicht der Meinungsführer in den USA konnte das nur eines heißen: sie waren Opfer einer Gehirnwäsche geworden. Die Armee und die Marine zeigten sich bei der späteren Aktenvernichtung viel zögerlicher als die CIA. Deshalb kann man heute noch eine Vorstellung davon gewinnen, wie es war, wenn aufrechte Amerikaner mit allen Mitteln gegen Kommunisten kämpften. Im August 1952 flogen einige Personen im Auftrag der Navy von Washington nach Frankfurt, wo sie sich mit Vertretern der CIA trafen, die für das supergeheime Projekt arbeiteten, das seit einem Jahr nicht mehr BLUEBIRD, sondern ARTISCHOCKE hieß. Bei den Streitkräften betrieb man seit 1947 ein ganz ähnliches, auf die Entwicklung einer Wahrheitsdroge abzielendes Projekt namens CHATTER. Seit 1951 wurde es von Commander Samuel Thompson geleitet, dem Chef der psychiatrischen Forschungsabteilung am Medical Research Institute der Navy. Um ihm zu verdeutlichen, worum es ging, hatte der Nachrichtendienst der Marine Dr. Thompson bei seiner Bestellung als Chef von CHATTER folgende Frage gestellt, mit der sich so ähnlich auch Jack Bauer (24) einmal im Jahr konfrontiert sieht: -------------------------------------------------------------------------------Gesetzt den Fall, dass jemand in einer unserer Städte eine Atombombe versteckt hat und wir zwölf Stunden Zeit haben, von einer Person herauszufinden, wo sie ist. Was könnten wir tun, um die Person zum Reden zu bringen? Operation CASTIGATE Thompson flog mit einem Mann nach Frankfurt, der behauptete, die Antwort zu kennen: Dr. G. Richard Wendt, Leiter des psychologischen Instituts der University of Rochester. Wendt testete seit einigen Jahren Drogen zur Bekämpfung von Seekrankheit und Müdigkeit bei Piloten. Ende 1950 hatte ihm die Marine 300.000 Dollar für ein Forschungsprojekt bewilligt, bei dem er herausfinden sollte, ob sich aus Barbituraten, Amphetaminen, Alkohol, Heroin und was ihm sonst noch unterkam die Wahrheitsdroge gewinnen ließ. Wendt hatte immer genug studentische Versuchskaninchen, denen er pro Stunde einen Dollar zahlte. Als verantwortungsbewusster Universitätslehrer nahm er nur Probanden über 21, und jede Substanz probierte er zuerst an sich selber aus. Über Heroin notierte er, dass es einen "gewissen, aber geringen Wert für Verhöre" habe, und das auch nur, wenn es "über einen langen Zeitraum" verabreicht werde. Bei seinen Selbstversuchen wurde dieser Zeitraum immer länger. Im Sommer 1952 meldete Wendt der Marine, dass er die Wahrheitsdroge gefunden habe. Über die chemische Zusammensetzung wollte er nichts sagen. Aus Sicherheitsgründen. Wenn Wendt Pharmakologe gewesen wäre, hätte er gewusst, dass man seine Wunderdroge, eine Kombination aus einem Schlaf- und einem Aufputschmittel, als Dexamyl in der Apotheke kaufen konnte (als "Goofball" wurde es später eine beliebte Partydroge). Für einen Feldversuch unter operativen Bedingungen stellte Morse Allen, der Leiter von ARTISCHOCKE, die Probanden zur Verfügung: Russen, die unter Spionageverdacht in Camp King festgehalten wurden, dem Europa-Hauptquartier des Geheimdiensts der USArmee in Oberursel. Ein erstes Treffen fand im Frankfurter Hauptquartier der CIA statt, das damals im ehemaligen Verwaltungsgebäude der IG Farben untergebracht war. Für die CIA, in deren Welt sich dauernd Fiktion und Wirklichkeit vermischen, war das die passende Unterkunft. Das Gebäude hatte der Architekt Hans Poelzig entworfen, von dem auch die Bauten in Der Golem, wie er in die Welt kam stammen und der in Edgar G. Ulmers Film The Black Cat in der Gestalt von Boris Karloff (als "Hjalmar Poelzig") okkultistische Menschenversuche in einem auf einem Schlachtfeld errichteten BauhausSchloss veranstaltet. Die Amerikaner hatten im Taunus einige abgelegene, früher von Nazibonzen und SS-Größen bewohnte Villen requiriert. Egmont R. Koch und Michael Wech haben bei ihren Recherchen zum ARDDokumentarfilm Deckname Artischocke und zum Buch gleichen Titels herausgefunden, dass die Operation CASTIGATE ("geißeln") höchstwahrscheinlich im "Haus Waldhof" bei Kronberg durchgeführt wurde. Wendt hatte seine Geliebte mitgebracht, die ihm assistierte. Er experimentierte am liebsten ohne Ärzte, weil solche Bedenkenträger nur die Freiheit der Forschung einschränkten. Thompson hielt das für unethisch. Also wurde ein Mediziner zugezogen. Nach Lage der Dinge müsste das Dr. Blome gewesen sein, der Lagerarzt von Camp King. Prof. Dr. Kurt Blome, Verfasser des Buches Arzt im Kampf (1942), war früher stellvertretender Reichsärzteführer und Mitglied im Reichsforschungsrat gewesen. Er hatte die Menschenversuche in Dachau abgesegnet und dafür gesorgt, dass Dr. Sigmund Rascher mit einer Schrift über seine sadistischen, von der Luftwaffe in Auftrag gegebenen Experimente, bei denen etwa 100 KZ-Häftlinge ums Leben kamen, habilitieren konnte. Piloten waren für die Nazis besonders wertvoll. Es war wichtig zu wissen, wie lange so ein Pilot überleben konnte, wenn er abstürzte und ins Meer fiel. Deshalb mussten Kriegsgefangene im kalten Wasser treiben. Rascher notierte die Körpertemperatur und probierte aus, wie man die Erstarrten am besten wieder auftaute. Um herauszufinden, ob nackte Frauen bei den männlichen Probanden zu einer beschleunigten Erwärmung führten, wurden vier Zwangsprostituierte nach Dachau gebracht. Da die Versuche in ein Überlebenstraining für Piloten münden sollten, kann man nicht ganz ausschließen, dass auch mit dem Ertrinken experimentiert wurde. Wenn man heute liest, wie die CIA gegen den Terror kämpft, kann einem ganz schlecht werden. Itsy Bitsy Teeny-Weeny Yellow Polka Dot Bikini Wendt mischte dem ersten Probanden in wechselnden Dosierungen seine Wirkstoffe ins Essen und in die Getränke, und wenn er es für richtig hielt, gab er noch Tetrahydrokannabinol dazu. Das war der Marihuanaextrakt, mit dem schon George White für das OSS experimentiert hatte. Der Russe legte kein Geständnis ab. Trotzdem wollte der Professor später nicht von einem Misserfolg sprechen. Immerhin wisse er jetzt, dass diese hartgesottenen Spione von ganz anderem Kaliber als seine Studenten seien. Spätestens am Abend des ersten Tages mussten die anderen wissen, dass Wendt ein Scharlatan war. Doch die Versuche dauerten noch tagelang an, weil zwischendurch Zeit für die von Allen so geliebten Experimente mit der Narko-Hypnose blieb. Da die Russen schon mal da waren, wollte man die Gelegenheit nutzen. Einer von ihnen bekam Natrium-Pentothal verabreicht, wurde mit Benzedrin am Einschlafen gehindert und verwechselte einen Agenten mit seiner Frau Eva, der er die Namen angeblicher Kontaktleute verriet. Weil ARTISCHOCKE-Leiter Allen nach diesem HypnoseTriumph wieder bester Dinge war, durfte Wendt seine Wunderdrogen in den folgenden Tagen an vier weiteren Menschen ausprobieren. "One, Two, Three" (Bild vergrößern) In Billy Wilders One, Two, Three versuchen die Russen, Horst Buchholz durch dauerndes Abspielen des Schlagers "Itsy Bitsy Teeny-Weeny Yellow Polka Dot Bikini" zu einem Geständnis zu zwingen. In "Haus Waldhof" gab es etwas Ähnliches. Wendt setzte sich an ein Klavier und spielte eine halbe Stunde lang die immer gleiche Melodie. Allerdings tat er das, um seine Landsleute zu quälen, von denen er enttäuscht war. Dann kippte er einer Versuchsperson alle mitgebrachten Substanzen auf einmal ins Bier. Die Opfer in dieser Farce hätten sterben können. Vielleicht wurde Schlimmeres nur dadurch verhindert, dass überraschend Frau Wendt in Frankfurt auftauchte. Als sie drohte, wegen der Affäre ihres Gatten von einem Kirchturm zu springen, brach Allen die Versuchsreihe ab. Für CHATTER war es ein schwerer Schlag, dass der wichtigste Forschungsbeauftragte als Dilettant entlarvt worden war. 1953 wurde das Projekt eingestellt. Die Marine gab auch in Zukunft Geld für die Verhaltensforschung aus, und die Armee investierte große Summen in die Entwicklung von chemi- schen Substanzen, mit denen der Feind massenhaft kampfunfähig gemacht werden sollte. Aber die Führungsrolle auf dem Gebiet der Gehirnwäsche hatte von nun an die CIA inne. Mad Scientists, Agenten und Psychopathen Von dem Wendt-Fiasko darf man sich nicht täuschen lassen. In den 1950ern arbeiteten hunderte von Spitzenforschern für die geheimen Programme zur Verhaltens- und Bewusstseinskontrolle. Für zahlreiche Wissenschaftler waren ARTISCHOCKE und danach MKULTRA wie ein Gottesgeschenk. Sie wurden großzügig alimentiert, der Verwaltungsaufwand war gering, und meistens konnten sie – das sieht man an Professor Wendt – tun und lassen, was sie für richtig hielten, ohne sich dauernd bei irgendwelchen Bürokraten rechtfertigen zu müssen. Vieles, was uns jetzt als abstrus, menschenverachtend oder verrückt erscheint, galt damals als wegweisend. Die Leute, die diese Versuche anstellten, waren in der Regel keine Scharlatane, sondern hoch angesehene Experten, die Stars ihrer Zunft. Oft wusste die CIA schon über Dinge Bescheid, über die in der allgemein zugänglichen Fachliteratur erst 10 oder 15 Jahre später berichtet wurde. Und weil die Agency am liebsten mit Professoren der Elite-Universitäten zusammenarbeitete, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass deren Studenten, also die Führungskräfte von morgen, an irgendeinem Gehirnwäsche-Experiment teilnahmen. Ob man es will oder nicht: die CIA gehörte zur Avantgarde der wissenschaftlichen und damit auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Rede ist hier nicht von den spektakulären Aktionen, für die der Geheimdienst in diversen Verschwörungstheorien verantwortlich gemacht wird. Es geht um das, was in einem geheimen Projekt ausgetüftelt wurde und heute unseren Alltag beeinflusst. Das begann bereits im Zweiten Weltkrieg. Bill Donovan, der Chef des OSS, heuerte Henry Murray als eine Art Personalchef seiner Behörde an. Murray war Autor des Standardwerks Explorations of Personality (1938), Psychologie-Professor in Harvard und eine Koryphäe auf dem Gebiet der Persönlichkeitsbestimmung. Sein Auftrag: Entwicklung eines Testprogramms für potentielle OSS-Rekruten. Solche Persönlichkeitstests sieht man am Anfang von 13 Rue Madeleine, wo sie über Anstellung und späteres Einsatzgebiet entscheiden. Agent Sharkey findet anhand der Testbögen sogar heraus, welcher von den Rekruten der Nazi-Spion ist. Murray und seinem Team blieb nicht viel Zeit. Nach 15 Tagen mussten sie bereits die ersten angehenden Geheimagenten auf ihre Eignung testen. Der Projektleiter war – je nach Sichtweise – ein Zyniker oder ein Realist. Zitat Murray: -------------------------------------------------------------------------------Das Spionieren zieht Verrückte an. Psychopathen, also Leute, die ihr Leben damit zubringen, Geschichten zu erfinden, können sich auf dem Gebiet so richtig austoben. Also machte Murray es sich zur Aufgabe, die allzu Verrückten genauso auszusortieren wie diejenigen, die nicht überzeugend lügen konnten. Murrays Persönlichkeitstests wurden beim OSS zur festen Einrichtung. Ihnen wurden alle Agenten unterzogen, zuerst die Ausländer und dann die Amerikaner. Sie waren der erste systematisch durchgeführte Versuch, die Persönlichkeit eines Menschen zu bestimmen, um sein zukünftiges Verhalten (und seine beruflichen Leistungen) vorhersagen zu können. Timothy Leary, LSD-Guru und selbst Entwickler eines Persönlichkeitstests (kurz: "der Leary"), schreibt dazu in Flashbacks, seiner Autobiographie: Auf eine unausgesprochene, kaum sichtbare Weise veränderten die Wehrpsychologie zwischen 1941 und 1946 und vor allem die Personalauswahlmethoden des OSS und später der CIA unsere Vorstellungen über die Natur des Menschen. 13 Millionen junge Leute wurden getestet, dabei gefilmt und das Material ausgewertet. Die jungen Leute wurden auf komplizierte Fertigkeiten gedrillt, sie wurden in ihrem Verhalten verändert, reduziert und dann mit psychologischen Techniken wieder in ihr ursprüngliches Verhalten zurückversetzt. Die Folgen waren offensichtlich. In Zukunft würden Kriege, aber ebenso auch der Frieden durch unsere Kenntnisse über das menschliche Gehirn entschieden werden. In solchen Kenntnissen liegt in Zukunft der Schlüssel für das Überleben der Menschheit. Psychologie wurde die Wissenschaft von der Handhabbarkeit des Menschen. Was damit gemeint ist, ahnt jeder Angestellte mit einem Arbeitgeber, der ihn schon einmal in den Genuss von "persönlichkeitsbildenden Maßnahmen" kommen ließ. Vom anderen Ende aus erfahren es die Arbeitslosen, die von der Arbeitsagentur an einen privaten Jobvermittler weitergereicht werden, der ein paar Psycho-Bücher gelesen hat, Arbeitslosigkeit als Persönlichkeitsstörung "behandelt" und sich an die Veränderung von unerwünschten Merkmalen macht, damit der Kunde besser in die Reihe passt. Angefangen hat das mit Bill Donovan und Henry Murray vom OSS – nur mit dem Unterschied, dass Murray eine fundierte psychologische Ausbildung hatte, der Arbeitsberater aber nicht. Humanökologie Noch ein Beispiel für avantgardistische Geheimdienstarbeit gefällig? Wie wäre es mit Harold Wolff, Professor für Neurologie und Psychiatrie an der medizinischen Fakultät der Universität Cornell. Er pflegte einen interdisziplinären und – wie man heute sagen würde – ganzheitlichen Ansatz, was von vielen Kollegen noch belächelt wurde. Bei der CIA fand er offene Ohren. Wolffs Lieblingswort war "Ökologie", was in den frühen 1950ern auch nicht jedem etwas sagte. Ausgehend von dem, was er in seiner neurologischen Praxis erlebte, glaubte Wolff, dass ein Leiden wie die Migräne bei Menschen auftritt, die nicht in Harmonie mit ihrer Umgebung leben. Zur Wiederherstellung des verlorenen Gleichgewichts musste man mit Hilfe von Psychologie, Medizin, Soziologie und Anthropologie möglichst viel über einen Patienten und dessen Umwelt in Erfahrung bringen. Nur durch das Studium eines Menschen in Bezug zu seiner gesamten Umgebung konnte man dessen Denken und Handeln verstehen (und dann, was für die CIA besonders interessant war, dieses Denken und Handeln auch beeinflussen, im Idealfall sogar bestimmen). Das Ganze bezeichnete er als "Humanökologie". In einem Brief an die CIA bemühte Wolff einen gewagten Vergleich: "Das Problem, mit dem sich der Arzt konfrontiert sieht, ist dem Problem ganz ähnlich, mit dem sich der kommunistische Verhörspezialist konfrontiert sieht." Beide, der Arzt und der Vernehmungsbeamte, versuchten das "Problem" (Kopfschmerzen oder eine andere ideologische Ausrichtung) zu lösen, indem sie ihr Gegenüber in eine harmonische Beziehung zu ihrer Umwelt brachten. Wolff hatte keine Bedenken dagegen, sich die nötige humanökologische Forschung von der CIA finanzieren zu lassen, weil er davon überzeugt war, dass jede neue Befragungstechnik automatisch seinen Patienten zugute kommen würde. Die Universitätsleitung fand das scheinbar auch und billigte die Zusammenarbeit. 1954 gründete Wolff die "Gesellschaft zur Erforschung der Humanökologie". Daraus wurde eine Tarnorganisation, die CIA-Geld an Wissenschaftler verteilte. Der umtriebige, vielseitig vernetzte und umfangreich publizierende Wolff trug viel zur Popularisierung des Wortes bei, das er so mochte: "Ökologie". +++ Wohltätige Gehirnwäsche Hans Schmid 09.08.2009 Psychopathen, Psychiater und Psychonauten, Teil 2 Teil 1: "Besondere Verhörmethoden" im Kalten Krieg Am 3. April 1953 schlug Richard Helms, Chef der Planungsabteilung der CIA, dem Direktor die Einrichtung eines Programms zum "verdeckten Einsatz von biologischen und chemischen Materialien" vor, das schon eine Weile am Laufen war. Im Antrag betonte Helms wieder einmal, dass Angriff die beste Verteidigung sei: LigatusPrivate Krankenkasse 59€ TOP – Testsieger Private Krankenkasse ab nur 59,- Euro! Für Selbständige u. Freiberufler Mehr Balance ... für Ihr Geld: Kombinieren Sie eine stabile Basis und Wachstumschancen so, wie es zu Ihnen passt 50% sparen! 8 Wo. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung + 4 GB-USB-Stick + Test endet automatisch Abgesehen vom offensiven Potential [...] verschafft uns die Entwicklung von umfassenden Fähigkeiten auf diesem Gebiet ein fundiertes Wissen des theoretischen Potentials des Gegners und versetzt uns dadurch in die Lage, uns gegen einen Feind zu verteidigen, der sich beim Einsatz dieser Techniken möglicherweise nicht dieselbe Zurückhaltung auferlegen wird wie wir. Einfacher gesagt: Weil die Kommunisten irgendwann irgendetwas erfinden und dann vielleicht einsetzen könnten, mussten die Amerikaner das theoretisch Erfindbare schon vorher erfinden. Und einsetzen. Das aber mit der gebotenen Zurückhaltung, die relativ zum Verhalten des Feindes war. Und der Feind kannte leider gar keine Zurückhaltung. Projekt MKULTRA Am 13. April 1953 genehmigte Direktor Allen Dulles das Programm mit dem Namen MKULTRA. Das war der Tag, an dem das Pentagon bekanntgab, dass amerikanische Kriegsgefangene in Korea, die sich der Repatriierung widersetzten, von nun an als Deserteure betrachtet und bei sich bietender Gelegenheit erschossen würden. Zunächst mit 300.000 Dollar ausgestattet, war das Projekt den üblichen Abrechnungspflichten enthoben. Forschungsaufträge konnten ohne schriftliche Vereinbarung vergeben werden. Der Buchhaltung gegenüber genügte eine von Willis Gibbons oder Sidney Gottlieb unter- schriebene Zahlungsanweisung. Gibbons war der Chef des "Mitarbeiterstabs für technische Dienstleistungen" (Technical Services Staff/TSS). Das "MK" zeigte Eingeweihten an, dass das Projekt beim TSS angesiedelt war. "ULTRA" war vielleicht eine sentimentale Reminiszenz an die "gute alte Zeit" des Zweiten Weltkriegs, die viele CIA-Leute stark geprägt hatte; im Rahmen des ULTRA-Programms hatten Dechiffrierexperten versucht, deutsche Militärcodes zu entschlüsseln. Jetzt sollte das menschliche Hirn geknackt werden. Drogenexperiment in einem MKULTRA-Lehrfilm (Bild vergrößern) Der "Technische Dienst" machte das, was Q in den James-Bond-Filmen macht: er stellte falsche Bärte, Perücken und Miniaturkameras in einer Streichholzschachtel zur Verfügung. Aber innerhalb des TSS gab es eine Chemie-Abteilung, die so geheim war, dass die meisten anderen davon gar nichts wussten. Die Chemical Division leitete ab 1951 Sidney Gottlieb, ein Protegé von Richard Helms, damals Chef des "Directorate of Operations", besser bekannt als "dirty tricks department". Mit jeder neuen Stufe, die Helms auf dem Weg zum Direktorenposten nahm, wurde Gottlieb ein bisschen wichtiger. Auch Gottlieb interessierte sich für Hypnose, war aber kein Aficionado wie Morse Allen, sein Gehirnwäsche-Konkurrent vom Sicherheitsdienst. Gottlieb hatte eine Schwäche für LSD. Die Kunde von der Droge aus dem Sandoz-Labor brachte Dr. Otto Kauders nach Amerika, ein Arzt aus Wien. In der Hoffnung, Geldgeber für eigene Forschungsarbeiten zu finden, machte Kauders 1949 bei einer Konferenz am Boston Psychopathic Hospital (das heutige Massachusetts Mental Health Center) mit. Dort erzählte er vom LSD und davon, dass eine winzige Dosis Albert Hofmann vorübergehend verrückt gemacht habe. Das Krankenhaus war eng mit der medizinischen Fakultät von Harvard verbunden, wo Henry Murray nicht der einzige war, der Geld vom Geheimdienst bekam. So erreichte die Nachricht die CIA. Robert Hyde, Psychiater am Boston Psychopathic, ließ sich von Sandoz ein paar Proben schicken und ging mit 100 Mikrogramm auf den ersten dokumentierten LSD-Trip in Amerika. Das war der Beginn einer äußerst umfangreichen Forschungstätigkeit. LSD-Studien wurden bei amerikanischen Wissenschaftlern auch deshalb so beliebt, weil es ungewöhnlich einfach war, Fördermittel zu bekommen. Dahinter steckte sehr oft die CIA (Hyde erhielt ab 1952 40.000 Dollar pro Jahr). Lass dich testen Gottlieb protegierte seinerseits den seit 1950 bei der CIA angestellten Psychologen John Gittinger, der nach Mitteln und Wegen suchte, wie man andere Leute manipulieren konnte und dabei sein Personality Assessment System (PAS) entwickelte. Gittinger glaubte, ein wissenschaftliches System zur Vorhersage von zukünftigem Verhalten entwickeln zu können. Grundlage war eine von ihm modifizierte Form des von David Wechsler entwickelten Intelligenztests. Im Laufe der Jahre sammelten sich in seiner Datenbank 29.000 Wechsler-Tests an, die er und sein Team auswerteten. Gittinger galt in CIAKreisen als Genie. Weil bei der Agency Kontroll-Fetischisten das Sagen hatten, wurden bei Geheimoperationen dauernd Persönlichkeiten bestimmt und Verhaltendweisen prognostiziert. Während der Kubakrise wurde Gittinger vom Weißen Haus angefordert. Dort wurden verschiedene Szenarien entworfen, und Gittinger sollte sagen, wie sich Nikita Chruschtschow jeweils verhalten würde. Das PAS hatte den Fehler, dass nur Gittinger selbst richtig damit umgehen konnte. Die von ihm erzielten Resultate scheinen aber so verblüffend gewesen zu sein, dass die CIA Hunderttausende von Dollars in Forschungsprogramme anderer Wissenschaftler steckte, die ebenfalls an der Entwicklung von Tests arbeiteten, mit denen der IQ, die Persönlichkeit, das Verhalten oder was auch immer bestimmt werden sollte. Die Vorläufer vieler heutiger Eignungs- und Persönlichkeitstests, angewandt von Universitäten über Personalabteilungen bis zu Scientology, wurden von der CIA finanziert. Das heißt nicht, dass uns ohne Gittinger & Co. die ganze Testerei erspart geblieben wäre. Wenn sich etwas durchsetzt oder nicht, hat das noch mit anderen Faktoren als mit Fördergeldern zu tun. Geheimdienste spiegeln die Gesellschaft wieder, aus der sie kommen. In Gittingers Datenbank landeten auch die Informationen, die Dr. Harris Isbell regelmäßig zur Verfügung stellte. Das von ihm geleitete Addiction Research Center war in einer Suchtklinik in Lexington, Kentucky untergebracht, wo es eine geschlossene Abteilung für straffällig gewordene Drogenabhängige gab. Isbell schickte die Daten von Heroinsüchtigen, mit deren Hilfe Gittinger herauszufinden hoffte, wer besonders anfällig für Drogen ist. Seinen Etat besserte er auch dadurch auf, dass er für die CIA neue Substanzen, die schnell ausprobiert werden sollten, an die Gefangenen verabreichte. Wer mitmachte, erhielt wahlweise eine Strafverkürzung oder die Droge seiner Wahl. Die meisten der "Freiwilligen" entschieden sich für die Droge, nach der sie süchtig waren. Um zu testen, was Menschen alles aushalten können, schickte Isbell sieben seiner Patienten auf einen 77 Tage andauernden LSD-Trip. Zu bedauern war dabei, Isbells Meinung nach, nur er selbst. Er beklagte sich darüber, dass die Opfer seiner Versuche zunehmend verängstigt auf die Ärzte reagier- ten und nicht so offen über ihre Erfahrungen sprachen, wie er und seine Mitarbeiter sich das wünschten. Bei "Patienten dieses Typs", schrieb er resigniert, müsse man wohl mit einem solch uneinsichtigen und unkooperativen Verhalten rechnen. Mit wenigen Ausnahmen waren die Probanden alle schwarz. Anomales Verhalten Mit Leuten wie Isbell arbeitete die CIA besonders gern zusammen, weil sie selbst die Probanden für die Experimente einbrachten. Dr. Harold Abramson, Professor der Columbia University und am New Yorker Mt. Sinai Hospital tätig, war auf Allergieforschung und Immunologie spezialisiert und interessierte sich – mehr privat – für das menschliche Gehirn. 1953 bat er die CIA um Geld. In seinem Antrag heißt es, er wolle Krankenhauspatienten, "die aus psychiatrischer Sicht im Grunde normal sind [...] ohne deren Wissen und zu psychotherapeutischen Zwecken Drogen in verschiedenen Dosen" verabreichen. Dafür erhielt er 85.000 Dollar. Erhalten ist ein Schriftstück, in dem Gottlieb auflistet, auf welchen Gebieten er sich Informationen über "für Operationen zweckdienliches Material" von ihm erhofft: -------------------------------------------------------------------------------a. Stören der Gedächtnisleistung b. Diskreditieren durch anomales Verhalten c. Verändern der Sexualgewohnheiten d. Entlocken von Informationen e. Beeinflussbarkeit f. Schaffen von Abhängigkeit Die Gelder für Abramson und Kollegen flossen auch deshalb so reichlich, weil der militärische Nachrichtendienst 1951 meldete, dass die Russen bei Sandoz LSD für 50 Millionen Trips gekauft hätten. 1953 warnte dieselbe Quelle sogar vor 10 kg LSD (100 Millionen Trips), die Sandoz auf den freien Markt werfen wolle. Ein CIA-Dokument von 1975 kann erklären, wie es zu den alarmierenden Meldungen kam; dem Schriftstück zufolge hatte der US-Militärattaché in der Schweiz ein Milligramm mit einem Kilogramm verwechselt. So wurden aus 100 Trips 100 Millionen. Die Massenproduktion von LSD wurde erst möglich, nachdem es gelungen war, das in einem Getreidepilz enthaltene Ergotamin, den Ausgangsstoff für die Lysergsäure, künstlich und in großen Mengen herzustellen. Auf den Markt kam LSD schließlich unter dem Produktnamen Delysid. Auf dem Beipackzettel stand u.a.: -------------------------------------------------------------------------------Indem der Psychiater selbst Delysid einnimmt, wird er in die Lage versetzt, eine Einsicht in die Welt der Ideen und Wahrnehmungen psychiatrischer Patienten zu gewinnen. Wenn man "Psychiater" durch "CIA" und "Patient" durch "feindlicher Agent" ersetzt, weiß man über MKULTRA schon eine ganze Menge. Zur medizinischen Behandlung gehörte allerdings, dass der Patient nur mit dessen Wissen LSD erhielt, nach sorgfältiger Vorbereitung und im Beisein des behandelnden Psychiaters, der ihn durch den Trip geleitete. Der CIA kam es gerade darauf an, dass das Opfer nicht wusste, wie ihm geschah. Gottlieb engagierte deshalb John Mulholland, einen der bedeutendsten Bühnenzauberer des 20. Jahrhunderts, Autor des Klassikers The Art of Illusion und Herausgeber des Fachblatts The Sphinx. Mulholland schrieb für die CIA ein von ihm selbst illustriertes Handbuch, dem der Agent entnehmen konnte, wie man andere täuschte und ihnen z.B. LSD in den Cocktail oder den Kaffee schmuggelte. Titel: Some Operational Applications of the Art of Deception. Im Gegensatz zu Morse Allens Polizei- und Schlägertruppe von der Sicherheitsabteilung besaßen Gottliebs Leute einen Hochschulabschluss und meistens einen Doktortitel. Sie sahen sich als Wissenschaftler und hatten noch den alten Forschergeist. Die Bereitschaft zum Selbstversuch gehörte zwingend mit dazu. In den frühen 1950ern kippten sich die TSS-Mitarbeiter gegenseitig LSD ins Glas. Wenn man liest, was John Marks und andere inzwischen herausgefunden haben, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Filme, die man bisher für überdrehte Komödien hielt, tatsächlich Dokumentarberichte über den Arbeitsalltag der CIA sind. "Monkey Business" (Bild vergrößern) Fenstersturz In Monkey Business von Howard Hawks arbeitet Cary Grant an der Herstellung eines Verjüngungsmittels, was zu viel Tohuwabohu führt, weil schließlich der Versuchsaffe das Mittel erfindet und ins Trinkwasser schüttet. Wenn man sich statt des Verjüngungsmittels eine Wahrheitsdroge denkt, könnte man auch in der CIA-Abteilung für technische Dienstleistungen oder in einem der von der Agency finanzierten Forschungsinstitute sein. Wenn doch einmal etwas über die Geheimversuche an die Öffentlichkeit drang, konnte das unvoreingenommene Publikum kaum glauben, was da im Kampf gegen den Kommunismus veranstaltet wurde. Und diejenigen, die den Geheimdienst für eine Ansammlung von lächerlichen Stümpern hielten, fühlten sich in ihrer Meinung bestätigt. So verschafften die komödiantischen Aspekte der geheimen Tests eine zusätzliche Sicherheit. Während aber im Film der Nebenbuhler von Cary Grant einen Irokesenschnitt erhält, gab es in der Realität spätestens 1953 den ersten Toten. CIA-Geld (200.000 Dollar pro Jahr) ging auch an die Special Operations Division (SOD) des Army Chemical Corps in Fort Detrick. Dort wurde erforscht, wie man andere vergiften und mit Krankheiten infizieren konnte. Gerechtfertigt wurde das so wie immer: um das eigene Volk schützen zu können, musste man genau wissen, was der Feind womöglich einsetzen würde. SOD- und TSS-Leute trafen sich halbjährlich zu einem gemeinsamen Brainstorming. Im November 1953 spendierte Gottlieb bei einem dieser Treffen eine Flasche Cointreau, mit LSD versetzt. Am Ende der Tagung wirkte Dr. Frank Olson sehr verwirrt. Seiner Frau erschien er deprimiert und verängstigt. Bald danach fiel er unter mysteriösen Umständen irgendwo zwischen dem 9. und 13. Stock (die Angaben differieren) aus dem Fenster eines Hotels. Im Film The Good Shepherd, der in groben Zügen die Geschichte von OSS und CIA von der Gründung bis zum Desaster in der Schweinebucht erzählt, wird darauf angespielt, wenn ein russischer Überläufer nach Waterboarding und einer Dosis LSD aus dem Fenster springt. Eine interne CIA-Untersuchung gelangte zu dem Ergebnis, dass Gottliebs LSD-Experiment zu dem Sprung aus dem Fenster geführt habe; Olson sei vorher schon depressiv und/oder paranoid gewesen. Aus Sicht der CIA war das durchaus schlüssig. Die hauseigenen Experten waren der Meinung, dass die Wirkung von LSD von der Persönlichkeit des Probanden abhing (und bereits vorhandene Merkmale verstärkte) sowie von den Umständen, unter denen es eingenommen wurde. Zehn Jahre später nannte man das Set und Setting. Da die CIA dies schon 1953 wusste, waren die Versuche umso verantwortungsloser. Gottlieb kam mit einer leichten Rüge davon. Admiral Luis deFlorez, Chef der Forschungsabteilung, riet in einem Memo für CIA-Direktor Dulles von Disziplinarmaßnahmen ab, weil diese "den Initiativgeist und den Enthusiasmus, die bei unserer Arbeit so wichtig sind" einschränken würden. Anfang 1955 war Gottlieb so weit rehabilitiert, dass er und seine MKULTRA-Leute die meisten Aufgaben von ARTISCHOCKE übernehmen konnten (die beiden Geheimprojekte liefen offenbar eine Weile lang nebeneinander her). Aber der zu den Akten gelegte Olson-Fall hatte eine Langzeitwirkung, von der damals niemand etwas ahnte. Waterboarding in "The Good Shepherd (Bild vergrößern) MKULTRA fliegt auf 1972 beschloss Richard Nixon, den inzwischen zum CIA-Direktor aufgestiegenen Jesse Helms in die Wüste zu schicken. Die Gründe sollen mit Watergate zu tun gehabt haben und bleiben weiter ungeklärt. Bevor Helms seinen Stuhl räumte, segnete er noch die große Aktenvernichtung ab. Im Januar 1973 ließ Gottlieb alles zerstören, was mit MKULTRA zu tun hatte. Jedenfalls war das der Plan. James Schlesinger, der neue Direktor, kam von außen und tat etwas für Agency-Verhältnisse Unerhörtes: er wies alle CIA-Angehörigen an, ihn über Aktionen zu informieren, die eventuell illegal gewesen waren. Im CIA-Jargon sind das die "Familienjuwelen". Einige dieser Pretiosen spielte jemand Seymour Hersh von der New York Times zu. Im Dezember 1974 begann Hersh mit einer Reihe von Artikeln über Bespitzelungen unter den Präsidenten Johnson und Nixon. Der Skandal war enorm. Gerald Ford, der Nachfolger des über Watergate gestürzten Nixon, setzte zur Schadensbegrenzung eine von Vizepräsident Nelson Rockefeller geleitete Untersuchungskommission ein. Im Abschlussbericht war von einem Mann die Rede, der unter LSDEinfluss aus dem Fenster gesprungen war. Das klang sensationell und sorgte für ein gewaltiges Rauschen im Blätterwald. Noch mehr Sprengkraft hatten zwei Sätze, die gut im Bericht versteckt waren: Das Drogenprogramm war Teil eines viel größeren CIA-Programms zur Erforschung möglicher Mittel zur Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Andere Studien erkundeten die Auswirkungen von Bestrahlung, Elektroschock, Psychologie, Psychiatrie, Soziologie und Substanzen zum Schikanieren und Zermürben. Das interessierte John Marks, Autor eines Buches, das die Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit hatte zensieren lassen (The CIA and the Cult of Intelligence). Im Rahmen des Freedom of Information Act beantragte er Einsicht in die Dokumente über die Versuche zur Verhaltenskontrolle. 1977 informierten CIA-Angehörige Marks' Anwälte, dass sie sieben Kisten mit Rechnungen, finanziellen Aufstellungen usw. gefunden hatten. Offenbar waren sie falsch archiviert worden und so der Vernichtung entgangen. Der Fund der Akten führte schließlich zu einem Untersuchungsausschuss des Senats. In den Wochen vor den Anhörungen im Senat begann die CIA mit der taktischen Freigabe von Akten. 8000 mal mehr und mal weniger geschwärzte Seiten waren zu viele, um sie noch gründlich durchzuarbeiten und zu kontextualisieren. Das Ausschussmitglied Edward Kennedy konzentrierte sich auf das, was er und seine Mitarbeiter bereits wussten: die Existenz des LSD-Bordells in San Francisco. John Marks ist darüber sehr erbost. Er glaubt, dass man viel mehr hätte herausfinden können, wenn den Politikern die Unterhaltung des Publikums und ihr eigener Auftritt weniger wichtig gewesen wären. Das ist oft ein Problem. Bei den meisten CIA-Operationen gibt es auch was zu lachen. Wenn man sich davon ablenken lässt, steht das der Aufklärung im Weg. 1994 ließ Eric Olson den Leichnam seines Vaters Frank exhumieren. Ein Gerichtsmediziner fand Spuren eines Schlages mit einem stumpfen Gegenstand und glaubte an Mord. Der Mordtheorie neigen auch Egmont R. Koch und Michael Wech zu, die Autoren von Deckname Artischocke (Film und Buch). Sie vermuten, dass Frank Olson den Einsatz bakteriologischer Kampfstoffe über Nordkorea oder tödlich verlaufene, in Deutschland durchgeführte Folterexperimente öffentlich machen wollte und deshalb zum Schweigen gebracht wurde. In The Good Shepherd gibt es auch dazu die entsprechende Szene: ein Killerkommando wirft einen als Sicherheitsrisiko geltenden Agenten zum Ertrinken in die Themse. Eric Olson ist überzeugt davon, dass sein Vater ermordet wurde. Er betreibt eine Website, die eine gute Anlaufstelle für alle ist, die mehr über MKULTRA, BLUEBIRD und ARTISCHOCKE wissen wollen: frankolsonproject.org. Operation Midnight Climax Aus Sicht der Technischen Abteilung war es gut und schön (und im Fall Olson auch mal schlecht), wenn man sich gegenseitig LSD ins Glas kippte, aber größere Feldversuche konnte so etwas nicht ersetzen. Beim Aktenstudium stieß Gottlieb auf George White alias Morgan Hall und die alten Marihuana-Versuche des OSS. White, inzwischen wieder bei der Drogenpolizei, wurde als "Berater" ausgeliehen. Im New Yorker Greenwich Village mietete die CIA 1953 zwei nebeneinander liegende Wohnungen an, richtete sie pompös ein und stattete sie mit auf einer Seite durchsichtigen Spiegeln, Mikrofonen und Kameras aus. White lud Leute aus der Halbwelt ein, bewirtete sie auf Kosten der CIA und verabreichte ihnen heimlich LSD. Ein Arzt war nicht dabei. 1955 wurde White bei der Drogenpolizei befördert und nach San Francisco versetzt. Das "Subproject # 3" von MKUltra inklusive der Möbel nahm er mit. Auf dem Telegraph Hill mietete er eine Wohnung mit Aussicht auf die Bucht. White kaufte mit CIA-Geld rote Vorhänge, Toulouse-Lautrec-Poster und Photos von gefesselten Frauen in Netzstrümpfen, die er an die Wand hängte. Das war seine Vorstellung von einem Luxusbordell. Damit die CIA mithören konnte, was dort geschah, wurde die neueste Überwachungstechnik installiert und ausprobiert. White besorgte die Prostituierten. Bezahlt wurden sie mit kleinen Gefälligkeiten (White hatte beste Verbindungen zur Polizei von San Francisco) und mit Bargeld. Das LSD und andere Drogen brachte John Gittinger mit. Gittinger war immer auf der Suche nach Persönlichkeitsmerkmalen, die von der Norm abwichen und die helfen konnten, potentielle Spione und Überläufer zu identifizieren. Tests an Sexualverbrechern hatten ergeben, dass Leute mit schwer kontrollierbaren Trieben andere Verhaltensmuster aufweisen als der Normalbürger. Deshalb schickte Gottlieb seinen Starpsychologen nach San Francisco. Gittinger sah den Probanden beim Geschlechtsverkehr zu und befragte Normabweichler: Schwule, Lesben, Prostituierte. Die "Operation Midnight Climax" galt als so erfolgreich, dass auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge eine ebenfalls von White geleitete Filiale eingerichtet wurde. Auch in New York eröffnete die CIA zu Versuchszwecken ein Bordell. Die Häuser wurden 1965 (San Francisco) bzw. 1966 (New York) geschlossen. Die Agenten fanden heraus, dass ein Freier vor dem Orgasmus kaum Staatsgeheimnisse ausplaudert, nachher aber womöglich schon, wenn ihm die Prostituierte sagt, wie gut er war und dass sie sich gern noch mit ihm unterhalten würde. Weitere Ergebnisse der Experimente wurden nie bekannt. Vielleicht liegt aber in irgendeinem Archiv die CIA-Version des Hite Report. Das ist gar nicht mehr so lustig, wenn man an die kürzlich in der Washington Post veröffentlichten Details zu den "verschärften Verhörmethoden" der CIA denkt. Dem Bericht nach gab es Empfehlungen, Terrorverdächtige mit nackten Frauen zu umgeben. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser Ratschlag auch auf Gittingers Untersuchungen in San Francisco zurückgeht. Dr. Cameron empfiehlt Alfred W. McCoy fasst in A Question of Torture die wichtigsten Empfehlungen eines Verhör- und Folterhandbuchs der CIA von 1963 zusammen, das seine Existenz den MKULTRA-Experimenten verdankt. 1983 wurde es für einen Einsatz in Honduras nur unwesentlich modifiziert. Seither scheint nicht mehr viel Neues hinzugekommen zu sein. Womöglich müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass es die Methoden im "Kampf gegen den Terror", über die wir uns empören, weil sie einer Demokratie unwürdig sind, schon viel länger gibt, als wir glauben wollen, sie demnach nicht nur mit Bush, Cheney und Rumsfeld zu identifizieren sind. Sprechen wir also von dem Mann, dem Naomi Klein in The Shock Doctrine ein eigenes Kapitel widmet ("Das Folterlabor"): Dr. Ewen Cameron. Ewen Cameron (Bild vergrößern) Der Psychiater Ewen Cameron überprüfte bei den Nürnberger Prozessen Rudolf Hess auf seinen Geisteszustand. Das von ihm an der McGill University in Montreal gegründete Allan Memorial Institute war ein renommiertes Forschungszentrum. Cameron war 1952/53 Präsident der American Psychiatric Association und später Präsident der World Psychiatric Association. Wer sich bei ihm in Behandlung begab, ging davon aus, es mit einer der ganz großen Koryphäen seines Berufsstandes zu tun zu haben. Optimisten glauben, dass er seine Experimente nur durchführen konnte, weil er einen so hervorragenden Ruf genoss, man ihn andernfalls als kriminellen Schwachsinnigen unschädlich gemacht hätte. Professor Cameron erhielt 1957 erstmals (und dann alljährlich bis 1964) Forschungsgelder von der Gesellschaft für Humanökologie, einer Tarnorganisation der CIA. Camerons Ansatz: Der Verstand der Patientin (meistens behandelte er Frauen, die Probleme mit ihren Männern hatten) musste in einen Zustand der tabula rasa versetzt ("Entprägen") und dann durch psychich driving (psychisches Antreiben) neu erschaffen werden. Üblicher Ablauf des "Entprägens": Die Behandlung begann mit einer 15- bis 30-tägigen "Schlaftherapie". Bei manchen Patientinnen dauerte sie bis zu 65 Tagen. Ein Mitarbeiter Camerons weckte die Patientin dreimal täglich und verabreichte ihr einen Medikamentencocktail, der aus einer Kombination von 100 mg. Thorazin, 100 mg. Nembutal, 100 mg. Seconal, 150 mg. Veronal und 10 mg. Phenergan bestand. Ein anderer Mitarbeiter weckte die Patientin zwei- oder dreimal täglich und gab ihr Elektroschocks. In psychiatrischen Kliniken damals üblich war ein Stromstoß von 110 Volt, einen Sekundenbruchteil lang, einmal täglich oder einmal jeden zweiten Tag. Camerons Patientinnen erhielten 150 Volt. Zuerst eine Sekunde lang. Dann folgten fünf bis neun weitere Schocks. Diese "Behandlung" war 20- bis 40-mal so intensiv wie in anderen Krankenhäusern. Wenn alles nach Wunsch verlief, führte das "Entprägen" zu einer totalen Amnesie. In den Jahren 1958 und 1959 "entprägte" Cameron mindestens 53 Patientinnen und Patienten. Gottlieb wollte gerne wissen, ob er danach neue Verhaltensmuster einprogrammieren, eine kontrollierte Veränderung der Persönlichkeit erreichen könne. Das geschehe durch das "psychische Antreiben", so Cameron. Dabei wurden die Patienten mit der immer gleichen Botschaft bombardiert. Nachdem er seine Opfer befragt hatte, besprach Cameron Bänder mit für die Patienten emotional aufgeladenen Texten. Sein Mitarbeiter Leonard Rubenstein installierte unter den Kopfkissen der Probanden einen Lautsprecher und konstruierte ein Abspielgerät mit Endlosschleifen, mit dem gleichzeitig 8 betäubte Patienten mit der für sie bestimmten Nachricht beschallt werden konnten. Das geschah mehrere Wochen lang, 16 Stunden täglich. Psychologische Zermürbung Zuerst hörten die Patienten negative Botschaften ("Du bist eine Heulsuse und konntest dich nie gegen deine Eltern durchsetzen."). Bei besonders widerstandsfähigen Probanden verstärkte Rubenstein den Effekt, indem er ihnen am Ende jeder Schleife einen Stromstoß versetzte. Wenn Cameron der Meinung war, dass das "negative Antreiben" ausreichte, folgten zwei bis fünf Wochen des "positiven Antreibens" ("Du willst deine Mutter dazu bringen, dass sie dich nicht mehr herumkommandiert. Fange zuerst bei den kleinen Dingen an, dich durchzusetzen, und bald wirst du in der Lage sein, ihr in Augenhöhe gegenüberzutreten."). Cameron machte auch Gehirnwäsche-Experimente, bei denen er alle bekannten Methoden kombinierte, von LSD bis zum extremen Reizentzug. Mit CIA-Geld ließ er schalldichte Isolationsräume bauen, manche kaum größer als eine Kiste. Eine 52-jährige Patientin in der Menopause steckte er 35 Tage in diese Kiste, nachdem er sie zuvor mit seinen anderen Techniken "behandelt" hatte. Trotzdem schlug die Behandlung nicht an. Aktennotiz Camerons: -------------------------------------------------------------------------------Obwohl die Patientin sowohl durch fortgesetzten Reizentzug (35 Tage) als auch durch wiederholtes Entprägen vorbereitet wurde, und obwohl sie 101 Tage positives Antreiben erhielt, wurden keine positiven Resultate erzielt. Aus Sicht der CIA stellten sich die Dinge so dar (Memorandum): -------------------------------------------------------------------------------Das Geheimprogramm prüfte und erforschte zahlreiche ungewöhnliche Befragungstechniken, einschließlich psychologischer Zermürbung und solcher Dinge wie "vollständige Isolation" und auch des Einsatzes "von Drogen und Chemikalien". Was Dr. Camerons Behandlung für die Patienten bedeutete, kann man in A Father, a Son and the CIA von Harvey Weinstein und In the Sleep Room von Anne Collins nachlesen. Viele erholten sich ihr Leben lang nicht mehr davon. Um seine Methode der "wohltätigen Gehirnwäsche" zu propagieren, gab Cameron gern auch den bunten Blättern Interviews. 1955 erzählte er den Lesern von Weekend, dass er sich mit "denselben Problemen wie die professionellen Gehirnwäscher" konfrontiert sehe; seine an Neurosen leidenden Patienten "tendierten wie die Gefangenen der Kommunisten dazu, zu widerstehen", weshalb sie "gebrochen" werden müssten. Dazu gab es das Photo einer Frau mit Kopfhörern, die – so der Begleittext – immer wieder ihr zuvor abgelegtes "Geständnis" hören müsse. Psychologe Gittinger sagte 1977, es sei ein schlimmer Fehler gewesen, Cameron mit Forschungsgeldern auszustatten. Gittingers Chefs waren offenbar anderer Meinung. Am vielversprechendsten an Camerons Methoden fanden die Folterer den extremen Reizentzug, gefolgt von der totalen Reizüberlastung. Der Historiker Alfred A. McCoy meint dazu: -------------------------------------------------------------------------------Um die bizarren Exzesse bereinigt, bildeten Dr. Camerons Experimente [...] die wissenschaftliche Grundlage der zweistufigen psychologischen Foltermethodik der CIA. "The Manchurian Candidate" (Bild vergrößern) The Manchurian Candidate Ende 1953 gab CIA-Direktor Allen Dulles bei Harold Wolff (dem Erfinder der Humanökologie) und seinem Kollegen Laurence Hinkle eine Studie über die chinesischen Gehirnwäsche-Techniken in Auftrag. 1956 war die Studie fertig. Wolff und Hinkle kamen zu dem Ergebnis, dass weder die Chinesen noch die Russen über geheimnisvolle Wunderdrogen oder sonstige esoterische Mittel zur Bewusstseinsveränderung verfügten. Ihnen zufolge gab es Programme zur politischen Umerziehung, die auf hergebrachten Verhörmethoden der Polizei aufbauten, auf massivem psychologischem Druck und dem Ausnutzen menschlicher Schwächen, auf Isolation und Reizentzug. Man kann diese Studie auch als Handlungsanweisung an Dr. Cameron lesen. Die CIA hatte sich längst zu einer Behörde entwickelt, die so schwerfällig war wie andere Behörden auch. Es dauerte also, bis man anfing, sich von der alten Lieblingsidee zu trennen, die Kommunisten könnten Menschen programmieren wie pawlowsche Hunde. Dann erschien Richard Condons The Manchurian Candidate (1959). In dem Roman geht es um einen Amerikaner, der im Koreakrieg gefangen genommen und in einem Gehirnwäsche-Zentrum in der Mandschurei als Attentäter programmiert wird; zurück in den USA, soll er im Sinne von Russen und Chinesen in den Präsidentschaftswahlkampf eingreifen. 1962 kam John Frankenheimers Verfilmung in die amerikanischen Kinos. Das hatte Auswirkungen auf die Testprogramme der CIA. Gittinger 1977 vor dem Senatsausschuss: -------------------------------------------------------------------------------Ich kann Ihnen dazu sagen, dass in den Jahren 1961, 1962 auf für mich überzeugende Weise bewiesen war, dass die sogenannte Gehirnwäsche, also ein esoterisches Verfahren, bei dem Drogen oder bewusstseinsverändernde Zustände und so fort benutzt werden, nicht existierte. Allerdings warf uns der Film The Manchurian Candidate weit zurück, weil er etwas Unmögliches plausibel erscheinen ließ. Verstehen Sie, was ich meine? Aber in den Jahren 1962, 1963 waren wir allgemein der Überzeugung, dass Gehirnwäsche im Großen und Ganzen ein Prozess ist, der mit dem Isolieren eines Menschen zu tun hat, mit der Verweigerung von Kontakten und damit, dass man ihn durch lange Verhöre großen Belastungen aussetzt, und dass man auf diesem Wege eine Bewusstseinsveränderung erreichen kann, ohne zu irgendwelchen esoterischen Mitteln greifen zu müssen. Weil den Film-Kommunisten gelang, wovon viele bei der CIA träumten (der programmierte Attentäter), ging alles, was die eigenen Experten für sinnlos befunden hatten, vorerst weiter. In der geheimen Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion schwer zu ziehen sind, konnte das auch gar nicht anders sein. Die CIA behauptet, dass MKULTRA 1963 beendet und auch nicht unter anderem Namen fortgeführt wurde. Gittingers Aussage lässt sich unschwer entnehmen, dass das nicht stimmt (das Projekt hieß ab 1963 MKSEARCH). Dem wurde nicht weiter nachgegangen. Über den Fortgang der Experimente weiß man wenig. Bekannt ist, dass Implantate im Gehirn getestet werden sollten. In Jonathan Demmes Remake von The Manchurian Candidate lässt eine Fondsgesellschaft mit dieser Methode den Attentäter programmieren. Die US-Geheimdienste vereiteln den Plan der Kapitalisten. Demme knüpft damit an The Silence of the Lambs an und verbessert wieder einmal das Image der Agenten. Mit der Realität hat das leider wenig zu tun. "The Manchurian Candidate" (Remake) (Bild vergrößern) Zusammen mit seinem Förderer Richard Helms schied 1973 auch Sid Gottlieb bei der CIA aus. Eine seiner letzten Amtshandlungen war die Einstellung von MKSEARCH. Als "abschließenden Kommentar" hielt er in einem Memo fest, das Projekt habe es der CIA ermöglicht, bei der chemischen und biologischen Verhaltenskontrolle immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es sei aber auch festzustellen, dass dieses Forschungsgebiet für die gegenwärtig laufenden Operationen immer mehr an Bedeutung verloren habe, denn: Auf der wissenschaftlichen Seite ist sehr klar geworden, dass die Wirkung dieser Materialien und Techniken auf individuelle Menschen und unter spezifischen Umständen zu wenig vorhersagbar ist, um operationell nützlich zu sein. Das Bedrückende ist, dass Gottlieb hier nur von den Gehirnwäsche-Versuchen zum Programmieren von Menschen spricht. Für die Folterer war bei diesen Experimenten immer etwas dabei. Epilog: Girl with the kaleidoscope eyes 1959 geschah etwas, das für Gottlieb sehr beunruhigend gewesen sein muss: Cary Grant erzählte in einem Interview, dass er unter Aufsicht seines Psychiaters regelmäßig LSD einnehme. Die Droge helfe ihm bei der Überwindung von Kindheitstraumata (und bei Potenzproblemen, wie er später noch einräumte). Dadurch erfuhren die Filmfans von der Existenz eines Mittels, das die CIA lieber für sich behalten hätte. Ebenfalls 1959 erhielt Timothy Leary, ein Experte auf dem Gebiet der Verhaltensforschung, einen Ruf nach Harvard. Ironischerweise hatte der Mann, dessen Namen wir wie keinen anderen mit der Propagierung von Acid-Trips verbinden, bis dahin keinerlei Erfahrung mit Psychedelika. Er wurde nun Professor an einer Universität, deren Studenten seit Jahren die Versuchskaninchen bei von der CIA oder der Armee finanzierten LSD-Experimenten waren. 1977 gab der damalige CIA-Direktor zu, dass im Rahmen von MKULTRA 44 Universitäten, 15 Firmen und staatliche Forschungseinrichtungen, 12 Krankenhäuser und 3 Gefängnisse Geld erhalten hatten. So viele waren es also mindestens. Es gibt kaum eine Eliteuniversität, die nicht mitmachte. Angehende Computerpioniere nahmen genauso an psychedelischen, von der CIA bezuschussten Programmen teil wie Theodore Kaczynski, der spätere Unabomber. In den letzten Jahren hat das zu allerlei Theorien geführt (siehe dazu What the Dormouse said von John Markoff und Das Netz von Lutz Dammbeck). Leary probierte im Mexikourlaub Magic Mushrooms aus. In Flashbacks schreibt er dazu: -------------------------------------------------------------------------------Es war vor allem anderen und ganz ohne Frage die tiefste religiöse Erfahrung meines Lebens. Ich entdeckte, dass die Schönheit, die Offenbarung, die Sinnlichkeit, das historische Gewebe der Vergangenheit, Gott, der Teufel – dass all das im Inneren meines Körpers angesiedelt war, und außerhalb meines Verstandes. Wieder in Harvard, besprach er mit Kollegen, was nun zu tun sei. Leary: -------------------------------------------------------------------------------Bei diesen Sitzungen entstand der Plan zu einer Pilotstudie, bei der die Probanden wie Astronauten behandelt werden sollten; sie sollten sorgfältig vorbereitet und kurz über alle verfügbaren Fakten unterrichtet werden. Dann erwartete man, dass sie sozusagen mit ihrem eigenen Raumschiff losflogen, ihre Beobachtungen machten und der Bodenkontrolle berichten würden. Unsere Probanden waren keine passiven Patienten, sondern heldenhafte Forscher. So entstand 1960 ein Forschungsprogramm, das als "Harvard Psychedelic Project" in die Geschichte einging. In Harvard traf Leary auch auf den Vater der OSS-Persönlichkeitstests, Henry Murray, der das Projekt nach Kräften unterstützte. Die Sandoz-Niederlassung in New Jersey versorgte ihn großzügig mit LSD und Psilocybin, dem von Albert Hofmann synthetisierten Wirkstoff in den Magic Mushrooms. Wer forschte oder so tat als ob, bekam damals Probepackungen vom Pharmakonzern, der sich Hinweise auf Anwendungs- und Vermarktungsmöglichkeiten versprach. An Learys experimentellen Lehrveranstaltungen nahm auch die Frau eines hochrangigen CIA-Agenten teil. In Flashbacks schreibt er, dass sie ihm eine Warnung überbracht habe: Die CIA habe nichts gegen seine Forschungen, solange er sie in aller Stille betreibe und sie nicht außer Kontrolle gerieten. Verschwiegenheit und Kontrolle waren der CIA immer besonders wichtig. Bei Leary geriet die Agency da an den Falschen. General Turgidson bedauert 1961 organisierte das Medical Center der University of California in San Francisco ein Symposion zum Thema "Mind Control". Für eine Sensation sorgte der Vortrag von Professor Holger Hydén von der Universität Göteborg über "Biochemische Aspekte der Gehirntätigkeit". Der Professor führte aus, dass es denkbar sei, chemische Mittel zur Veränderung des Bewusstseins ins Leitungswasser zu geben. Für einen Polizeistaat eröffne das ungeahnte Propagandamöglichkeiten. Damit beschrieb er eine Lieblingsidee amerikanischer Generäle: chemische Substanzen im Trinkwasser des Feindes, der so massenhaft manipuliert wurde. Sterling Hayden in "Dr. Strangelove" (Bild vergrößern) Leary glaubte inzwischen, dass der Konsum von psychedelischen Drogen wie LSD eine geistige Wende einleiten werde. Aber wie brachte man die Leute dazu, Psychonauten zu werden? Im Frühjahr 1962 veröffentlichte er einen Artikel im Journal of Atomic Scientists. Darin warnte er vor einem möglichen Plan der Russen, LSD in die Wasserversorgung der großen amerikanischen Städte zu kippen. Als präventive Maßnahme im Rahmen der Landesverteidigung schlug er vor, selbst LSD ins Trinkwasser zu geben, weil man dann wisse, worauf man sich einzustellen habe. Diesen Artikel muss General Jack D. Ripper gelesen haben, Kommandant der Burpleson Airbase. Er hat jetzt die Erklärung für seine Erektions- und Ejakulationsstörungen: durch chemische Substanzen im Trinkwasser wurden seine Körpersäfte vergiftet. Um dem ein Ende zu machen, löst er den Dritten Weltkrieg aus. Bei der Krisensitzung muss General Buck Turgidson (George C. Scott) zugeben, dass im Fall von General Ripper die Persönlichkeitstests, die so etwas ausschließen sollten, versagt haben. Das war nicht vorgesehen. Ripper wird übrigens von Sterling Hayden gespielt, der im Krieg an geheimen OSS-Operationen teilnahm. Stanley Kubrick und Terry Southern sollen informelle Kontakte zur CIA gehabt haben, als sie das Drehbuch für Dr. Strangelove schrieben. Der Legende nach war Sidney Gottlieb das Vorbild für die Titelfigur. Das könnte sogar stimmen. Dr. Strangelove (Peter Sellers) ist gehbehindert (Gottlieb hatte einen verwachsenen Fuß und zog ein Bein nach), früher hat er den Nazis gedient (Operation Paperclip), und sein Name könnte eine Anspielung auf Gittingers Forschungen zu seltsamen Formen der Erotik in San Francisco sein. Das wäre genau die Art, wie Kubrick mehrere Themenbereiche in einer Figur verdichtete. "Dr. Strangelove" (Bild vergrößern) Fröhliche Witzbolde 1960 schrieb sich Ken Kesey an der Stanford University für einen Creative Writing-Studiengang ein. Im nahegelegenen Militärkrankenhaus wurden Experimente mit "psychotomimetischen Drogen" durchgeführt. Freiwillige erhielten 75 Dollar pro Tag, wenn sie sich als Versuchskaninchen zur Verfügung stellten. Kesey meldete sich und bekam LSD verabreicht. Bald darauf hatte er in der Klinik einen Job als Pfleger. Er machte Nachtdienst in der psychiatrischen Abteilung. Dort gab es jede Menge Psychedelika, die Kesey an seine Freunde verteilte. Seine Erfahrungen in der Psychiatrie verarbeitete er im Roman One Flew Over the Cuckoo's Nest (1962). Mit dem damit verdienten Geld kaufte er sich ein Haus in La Honda, 50 Meilen südlich von San Francisco. Das Haus wurde schnell zu einem Anziehungspunkt für Leute, die an psychedelischen Drogen interessiert waren. Kesey: -------------------------------------------------------------------------------Die ersten Drogentrips waren für die meisten von uns unsere Schneckenhäuser zertrümmernde Torturen, nach denen wir blinzelnd und bis zu den Knien in den zerbrochenen Schalen unserer LuftschlossPersönlichkeiten standen. Plötzlich wurden Leute vor einander nackt ausgezogen, und siehe da: wir waren schön. Nackt und hilflos und empfindlich wie eine Schlange, nachdem sie sich gehäutet hat, aber viel menschlicher als dieser in einer glänzenden Rüstung steckende Albtraum, der vorher beim Rührt euch! quietschend und scheppernd herumgestanden hatte. Wir waren voller Leben, und das Leben waren wir. Kesey kaufte einen alten Schulbus und fuhr mit seiner LSD-Truppe, den Merry Pranksters, durchs Land. Die Band der Pranksters, The Warlocks, nannte sich später The Grateful Dead. Unterwegs wurden LSD-Happenings gefeiert. Motto: "Can you take the acid test?" Dabei gingen oft mehrere hundert Leute gemeinsam auf einen LSD-Trip. Kesey zufolge wollte man "die durch Konditionierung erzeugten Reaktionen der Leute" herausfinden und Schluss machen mit dem "konditionierten Robotertum". Das war das genaue Gegenteil von dem, was sich die CIA erträumte. "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (Bild vergrößern) Bald danach scharte Charles Manson im Haight-Ashbury-Distrikt in San Franciso die ersten Mitglieder seiner Family um sich. Auch er kaufte einen alten Schulbus, auch bei ihm gab es psychedelische Drogen, und in San Francisco betrieb die Agency ihr LSD-Bordell. Verschwörungstheoretiker wie Carol Greene (Der Fall Charles Manson: Mörder aus der Retorte) erkennen darin ein Muster. Für sie war die gesamte Hippiebewegung ein gigantischer Feldversuch der CIA. Uneinigkeit herrscht nur darüber, ob der Mord an Sharon Tate, der sich am 9. August zum 40. Mal jährt, ein Betriebsunfall oder Teil des Plans war. Ich schließe mich lieber John Marks an, der in The Search for the "Manchurian Candidate" schreibt: Die Tatsache bleibt bestehen, dass LSD einer der Katalysatoren der traumatischen Umwälzungen der 1960er war. Niemand konnte die Welt der Psychedelika betreten, ohne zuerst, ohne es zu wissen, durch von der Agency geöffnete Türen zu gehen. Es sollte die größte Ironie überhaupt werden, dass die gewaltige Suche der CIA nach Waffen unter den Drogen – angetrieben von der Hoffnung, dass Spione so wie Dr. Frankenstein das Leben mit Hilfe von Genialität und Maschinen kontrollieren könnten – damit enden würde, dass der Geheimdienst dabei behilflich war, die herumschweifenden, unkontrollierbaren Geister der Counterculture zu schaffen. Das lässt doch irgendwie auch wieder hoffen. http://www.heise.de Outsourcing des Krieges Florian Rötzer 03.09.2009 In Afghanistan sind erstmals mehr Mitarbeiter von Privatfirmen als US-Soldaten für das Pentagon tätig Die verkorksten Wahlen und das Erstarken der Taliban lassen für Afghanistan derzeit nichts Gutes hoffen. Zwar sei der Opiummarkt eingebrochen und wirke sich der Druck der westlichen Truppen auf die Drogenstrukturen aus, was auch die Finanzierung der Taliban einschränken könnte, dafür sollen nun einige Taliban-Gruppen zu Drogenkartellen wie in Kolumbien werden, wie Antonio Maria Costa, Direktor der UN-Drogenbehörde, befürchtet. Wie so oft verschmelzen terroristische oder aufständische Strukturen mit kriminellen. Die bewaffneten Gruppen in Kolumbien haben mit Politik kaum mehr etwas zu tun, sie versuchen auf finanziellen Interessen, ihr Territorium und ihren einträglichen Markt zu kontrollieren. Das Drogengeld in Afghanistan fließt nicht teilweise nur den Taliban zu, es macht den gesamten Staat auch korrupt, was wahrscheinlich die größere Bedrohung für das Ziel ist, einen einigermaßen stabilen, demokratisch legitimierten und rechtlich intakten Staatsapparat zu etablieren, wie dies die westlichen Staaten anstreben und dafür seit 9 Jahren ihre Truppen im Land kämpfen lassen. Die Aussichten haben sich in der Zeit eher verschlechtert, die Unterstützung von Präsident Karsai, dem nun nicht nur Korruption, sondern auch Wahlfälschung vorgeworfen wird, hat dabei neben falschen Strategien eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Nachdem das Pentagon bereits im Irak sich immer mehr auf Söldner und Angestellte von privaten Sicherheitsunternehmen gestützt hatte, findet dasselbe auch in Afghanistan statt, obgleich die Privatisierung der militärischen Missionen zu schweren Skandalen geführt hat, u.a. bei der Misshandlung von Häftlingen in Abu Ghraib. Das Sicherheitsunternehmen Xe, das früher Blackwater hieß, stand dabei im Zentrum, allerdings dauerte es Jahre, bis die schießwütigen Söldner, die vermutlich die Gewalt im Irak mit geschürt haben, aber für die irakische Gerichtsbarkeit immun waren, mit Konsequenzen rechnen mussten. Vor kurzem wurde bekannt, dass die CIA sogar Blackwater in ein heimliches Programm einbezogen hatte, um al-Qaida-Mitglieder im Irak zu jagen und zu töten. Blackwater-Gründer Erik Prince wird sogar vorgeworfen, Mitarbeiter ermordet zu haben, die über die dunklen Praktiken seines Unternehmens aussagen wollten. Ansonsten sollen er und sein Unternehmen in Waffenschmuggel, Prostitution, Betrug, Steuerhinterziehung und anderen kriminellen Aktionen verwickelt sein. Erst als eine Gruppe von Söldnern 17 irakische Zivilisten ermordeten, wurden diese vor Gericht gestellt und kündigte die USRegierung an, die Zusammenarbeit mit Blackwater einzustellen. Allerdings beschäftigt trotz der Ankündigung auch das US-Außenministerium unter Clinton im Irak noch Blackwater-Personal, um Botschaftsangehörige im Land mit Hubschraubern zu transportieren. Weiterhin fließen als Millionen an amerikanischen Steuergeldern in das umstrittene Unternehmen. Zwischen 2005 und 2008 soll Blackwater mindestens 1,2 Milliarden Dollar vom Pentagon erhalten haben. In Afghanistan werden bereits mehr private Sicherheitsdienstleister (contractors) als Soldaten vom Pentagon eingesetzt, heißt es nun in einem Bericht des Congressional Research Service. Sie machen 57 Prozent des Personals aus, das vom Pentagon in Afghanistan stationiert wird, oder sogar 65 Prozent, wenn man die letzten beiden Jahre betrachtet. Das ist der bislang höchste Anteil von privaten Sicherheitsdienstleistern und markiert den deutlichen Trend zur Privatisierung und Kommerzialisierung oder zum Outsourcing des Krieges. Seit 2003 bis Mitte 2008 hat das Pentagon mindestens 106 Milliarden US-Dollar an private Sicherheitsfirmen für ihre Dienste im Irak und in Afghanistan gezahlt. Allerdings profitieren vom Outsourcing auch die Afghanen, denn der Großteil der privat Angestellten (75%) sind Einheimische, die angesichts der großen Arbeitslosigkeit auf der Seite der Amerikaner als Köche, Wachpersonal, Fahrer, Bauarbeiter oder Übersetzer Geld verdienen, während die Taliban ebenfalls mit Geld ihre Kämpfer und Mitarbeiter rekrutieren. Im Outsourcing gleichen sich mithin beide Seiten. Schon im Korea-Krieg war ein Drittel des vom Pentagon bezahlten Personals Mitarbeiter von privaten Firmen. Dabei handelte es sich vor allem um logistische Leistungen, zunehmend aber drangen Private auch in zuvor militärische Aufgabengebiete ein. Im Balkan und im Irak stieg der Anteil auf fast die Hälfte an, in Afghanistan sind die regulären Soldaten bereits in der Minderheit. Die Gefahr wächst mit der Privatisierung, so der Bericht, dass die militärische Präsenz der USA nicht mehr so streng kontrollierbar ist wie dies bei regulären Truppen der Fall ist. Wie im Irak stützt sich auch in Afghanistan das Außenministerium auf private Sicherheitsdienstleister. So wirft beispielsweise das Project On Government Oversight (POGO) dem Außenministerium vor, die Sicherheit der Botschaft der Firma ArmorGroup übertragen zu haben, aber deren Leistung nicht zu überprüfen. Hier soll es erhebliche Disziplinprobleme und Unterwerfungsrituale von Untergebenen geben, die dazu führen, dass ein dauernder Personalwechsel stattfindet, wodurch die Sicherheit der Botschaft gefährdet sei. http://www.heise.de Langes Pauken verbessert die Leistungen nicht unbedingt Südkoreanische Schüler lernen doppelt so lange wie die finnischen, die aber die besseren Leistungen bringen. In Südkorea scheint es die fleißigsten Schüler zu geben. In den Pisa-Tests lagen die südkoreanischen Schüler bei der Lesekompetenz und der Mathematik zwar mit an der Spitze, bei Naturwissenschaften schnitten sie überdurchschnittlich ab. Besser sind freilich etwa die finnischen Schüler, die aber weniger Zeit für das Lernen verbrauchen. Junge Südkoreaner im Alter zwischen 15 und 24 Jahren sollen, berichtet die Korea Times, in der Woche fast 50 Stunden mit Lernen verbringen, fast 16 Stunden mehr als ihre Altersgenossen im Durchschnitt der OECD Länder, die dafür 34 Stunden aufwenden. Das sind täglich 7 Stunden und 50 Minuten, im OECD-Durchschnitt sind es etwa 5 Stunden. Allerdings verbringen auch die Finnen mit täglich 6 Stunden und 6 Minuten mehr Zeit mit dem Lernen als der Durchschnitt. Die japanischen Schüler wenden 5 Stunden und 21 Minuten, deutsche und US-amerikanische hingegen nur die durchschnittlichen 5 Stunden auf. Bei den 15-jährigen Schülern, die für PISA-I getestet wurden, wird der Unterschied noch frappanter. Während die finnischen Schüler täglich 4 Stunden 22 Minuten lernten, büffelten die südkoreanischen das Doppelte – und blieben dennoch hinter den Finnen. Das lange Büffeln der Südkoreaner verbessert also nicht unbedingt die Leistungen, es hat auch direkte Nachteile. So schlafen die südkoreanischen Schüler über eine Stunde weniger in der Nacht als die britischen, finnischen oder amerikanischen. Und sie betreiben täglich gerade mal 13 Minuten Sport. Florian Rötzer 08.08.2009 http://www.heise.de Positionierung bei der Stammzellen-Forschung Südkorea will in den nächsten viel Geld in die Forschung stecken, um weltweit mit an der Spitze zu stehen. Südkorea sieht sich in der Stammzellenforschung von den USA und Japan abgehängt. Nach dem Schock, als Hwang Woo-suk von der Nationalen Universität in Seoul kurzzeitig zum weltweiten Pionier durch angeblich erstmals geklonte menschliche embryonalen Stammzellen wurde und er sich 2005 als Betrüger erwies, war die Forschung eher mit Vorsicht beäugt und bis zum April dieses Jahres ein Verbot für die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen verhängt worden. Das soll aber wieder anders werden, berichtet Korea Times. In Japan werde 10 Mal mehr Geld in die Forschung in diesem Jahr investiert, in den USA 30 Mal mehr als in Südkorea. Hier wurden 2009 32 Millionen Dollar an Staatsgeldern in die Stammzellenforschung gesteckt. Jetzt sollen die Investitionen bis 2015 verdreifacht werden, um südkoreanische Forschungslabors und Biotechfirmen zu stärken und von bereits vorhandenen Patenten zu profitieren. Bis 2015 sollen, man ist nicht unbescheiden, 5 südkoreanischen Forschungslabore zu den weltweiten Top Ten der Stammzellenforschung gehören. Überdies will man eine nationale Stammzellenbank aufbauen, um Forschung und Medizin mit geprüften Stammzellen zu versorgen. Ein Schwerpunkt soll die Entwicklung von Techniken zur Erzeugung von indusztierten pluripotenten Stammzellen (iPS) werden. Und gefördert wird auch die Entwicklung von Medikamenten mit Stammzellen. Um wieder Glaubwürdigkeit nach dem Betrug zu erlangen, sollen die ethischen Standards der Forschung strenger werden. Florian Rötzer01.08.2009 http://www.heise.de Die Disneyfizierung Nordkoreas Krystian Woznicki 26.09.2003 Kapriolen zwischen einer Politik der Abschottung und Bedrohung sowie der Öffnung und Verhandlungen Die gebauten Utopien unserer Zeit zeugen in den meisten Fällen vom Scheitern der Zivilisation. Auch das megalomanische Pjöngjang ist dafür ein Paradebeispiel: Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die nordkoreanische Hauptstadt, stellvertretend für den von Misswirtschaft, diversen gesellschaftlichen Verfallserscheinungen und Hungersnöten geplagten Staat, in sich zusammenbricht. Himmelsstürmender Utopismus in Pjöngjang Während das kommunistische Nordkorea, das vor dem Afghanistan- und Irak-Krieg noch das am meisten unterstützte Land der Welt war, um sein Überleben kämpft, finden zahlreiche Annäherungsversuche statt. Es ist von Kooperation die Rede und von Öffnung. Im Zuge einer vermeintlich neuen Politik wurde in Nordkorea sogar ein Institut für Joint Ventures eingerichtet. Die Sun Shine-Policy des Südens hat im Zuge dessen zahlreiche Projekte hervorgebracht, die nicht nur den größenwahnsinnigutopistischen Charakter des zum Scheitern Verurteilten tragen, sondern in einer für die Geschichte der Utopien besonderen Kulisse entstehen: Es ist der permanente Kriegszustand, der ihren Charakter entscheidend prägt. Permanenter Kriegszustand Beobachter weisen immer wieder darauf hin, dass in Nordkorea allein die Rüstungsindustrie Fortschritte gemacht hat und zum tragenden Sektor der nordkoreanischen Wirtschaft avanciert ist. Doch ist auch Südkorea inzwischen ein hochgerüstetes Land. Mit US-amerikanischer Unterstützung konnte eine moderne und starke Armee aufgebaut werden. Zusätzlich sind 37.000 amerikanische Soldaten an der Grenze zum Norden stationiert, wo sie in regelmäßigen Abständen Kriegsspiele durchführen. Pierre Rigoulot, einer der führenden europäischen Fernost-Experten, notiert: -------------------------------------------------------------------------------Südkorea verhält sich wie ein Land im Kriegszustand: Die Kommunistische Partei ist verboten, die nationalen Werte stehen hoch im Kurs, der Militärdienst ist mit zweieinhalb Jahren lang und schwer, weil das Land gut ausgebildete Soldaten benötigt, die Geheimdienste sind auf der Hut. Die unterschiedlichen autoritären Regimes, die das Land bis 1986 regierten, haben die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten häufig mit der Nähe des Feindes begründet, dessen Truppen und Raketen sich nur 40 Kilometer vom Herzen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul entfernt befanden und immer noch befinden. Üben für das Straßenkamptheater: Südkoreanische Riot-Polizei Wenn heutzutage immer wieder von Studentenunruhen zu lesen ist, wird die Aufmerksamkeit der westlichen Beobachter immer am meisten von der Art gefesselt, wie solche Demonstrationen ausgetragen und von den Ordnungskräften behandelt werden. Die Zusammenstöße mit der Polizei, die sich bei diesen Massenaufläufen zwangsläufig ergeben, folgen einer ganz bestimmten Choreographie, an die sich beide Seiten zu halten scheinen. Der Journalist Jonathan Watts spricht von einem "ungeschriebenen Regelbuch der Eskalation": Zunächst werden die Protestierenden mit einem Riegel von Polizeifrauen konfrontiert, die, mit Lippenstift geschminkt, eine zarte Kordon-Schnur in den Händen halten. Was daraufhin folgt, ist ein vorsichtiges territoriales Geben und Nehmen, ein sanftes Ziehen und Drücken, begleitet von leisem Singen. Nur wenn Steine und Petroleumbomben geworfen werden, kommt die Riot Police zum Einsatz. Utopie Joint Venture Unter diesen Umständen, in denen Krieg und Fiktion wie selbstverständlich miteinander verschmelzen, werden Räume in Nordkorea erschlossen. In November 1998 etwa konnte der südkoreanische Industriekonzern Hyundai die nordkoreanische Regierung davon überzeugen, Kreuzfahrten im Südosten Nordkoreas zu organisieren. So wurden unter korporativer Führung südkoreanische Touristen in das vom Militär hermetisch abgeriegelte Gebiet rund um den Kumgang (den Diamantenberg) verfrachtet, wo sie von nordkoreanischen Reisebegleitern in Empfang genommen wurden, die ihnen eiserne Disziplin und bedingungslosen Gehorsam abforderten. Nordkorea als militärischer Abenteuerspielplatz (Standbild aus dem Bond-Film "Die Another Day") Wer auf die nordkoreanischen Reisebegleiter nicht hören wollte, wurde bestraft: Geldstrafen wurden gegen Touristen verhängt, weil sie ein Stück Papier auf den Boden fallen gelassen, weil sie sich ein paar Meter von den vorgeschriebenen Wegen entfernt, weil sie auf den Boden gespuckt oder weil sie ihre Schuhe an kleinen Wasserläufen gesäubert haben. Eine Besucherin soll sogar wegen einer regierungskritischen Bemerkung für zwei oder drei Tage verhaftet worden sein. Pierre Rigoulot notiert: -------------------------------------------------------------------------------In dem Vertrag war festgelegt worden, dass Hyundai monatlich 12 Millionen Dollar an Nordkorea zahlen sollte, wobei der Konzern davon ausging, dass das Unternehmen rentabel sein würde. Als Hyundai innerhalb eines Jahres riesige Summen verloren hatte, wollte der Konzern das Experiment beenden. Ein Abbruch der Kreuzfahrten konnte nur dank der Unterstützung der südkoreanischen Steuerzahler vermieden werden, die von der Regierung in Seoul freundlich in die Pflicht genommen wurden, weil sie fand, dass dieses Unternehmen ihren Zielen zu gute kam. Zu den ebenso Aufsehen erregenden wie folgenlosen Zeichen einer neuen Öffnungspolitik gehört auch, südkoreanischen Motorradfahrern Zugang zum besagten Kumgang zu ermöglichen. Einer der Vorsitzenden der Vereinigung der südkoreanischen Motorradfahrer erklärte daraufhin feierlich, dass die "Freiheit der Motorradfahrer Symbol der Freiheit des Landes" sei. Auch in diesem Fall waren ahnsehnliche Summen im Spiel. Die Vereinigung zahlte für das Recht, einen von der Armee komplett abgesperrten Parcours befahren zu dürfen. Little Hongkong Zuletzt machte das Vorhaben von sich reden, eine neue Sonderzone in Nordkorea zu etablieren. Nachdem das Rajin-Sonbong-Projekt als gescheitert zu den Akten gelegt werden kann, heißt die neue Hoffnung Sinuiju, eine Stadt an der Grenze zu China, die Nordkoreas Testlabor für die Globalisierung werden soll. Joseph Steinberg von der Dong-eui University nannte es mal etwas zynisch ein "fairy-tale island of prosperity in a desert of incompetence". Die nordkoreanische Regierung pflegt hingegen in hoffnungs- vollen Tönen von einem eigenen Hongkong zu sprechen. Die Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) hatte immerhin positive Prognosen abgegeben: -------------------------------------------------------------------------------Over the next two to three years, investments into the North Korean city will largely come from Chinese and overseas Chinese entrepreneurs, rather than Western firms. Western companies' investments in Sinuiju are expected to shift into full swing four to five years later, when improvements in infrastructures and business environment become more visible and the city's economic structure stabilizes. Bad-Boy-Image Nordkoreas als Icon aus dem geopolitischen Bilderbuch der Werbung Nach dem bewährten Motto "Ein Land – zwei Systeme" soll Sinuiju eine Sonderwirtschaftszone werden, ein internationales Zentrum für Finanzen, Handel, IT-Industrie, moderne Wissenschaft, Unterhaltung und Tourismus. Um das zu realisieren, erhält die Stadt bis zum 31. Dezember 2052 eine weitgehend autonome Regierung – mit Wahlen und einem gesetzgebenden Rat. Eigene Reisepässe werden ausgestellt und eine eigene Währung. Auch eine eigene Fahne soll es geben: mit Pfingstrose auf blauem Grund, was nicht zufällig an Hongkong erinnert. Chinesisch, Koreanisch und Englisch sollen die offiziellen Sprachen werden. Ein chinesischer Kaufmann mit niederländischem und nordkoreanischem Pass und Wohnsitz in China wurde als Gouverneur von Sinuiju berufen: Der schwerreiche Orchideenhändler Yang Bing, ein Entrepreneur mit Ruf, nicht zuletzt bekannt dafür, in der Nähe der nordostchinesischen Stadt Shenyang ein 34 Hektar großes "Holland-Dorf" mit Grachtenhäusern, einer Kopie des Amsterdamer Bahnhofs und Windmühle errichtet zu haben. Doch standen von Anbeginn Probleme im Weg: Weil es nur wenige Kilometer entfernt ist von Seoul, bevorzugt Südkorea Gaesong gegenüber Sinuiju und will lieber dort den kapitalistischen Traum auf kommunistischen Boden wahr werden lassen. China wiederum empfindet Sinuiju als unnötige Konkurrenz, während der Westen die Glaubwürdigkeit des nordkoreanischen way of business anzweifelt. Die Föderation Amerikanischer Wissenschaftler gibt derweil zu Bedenken, dass im Sinuiju Chemical Fiber Complex chemische Waffen hergestellt werden, darüber hinaus, dass noch andere militärische Fabriken im Industriebezirk von Sinuiju angesiedelt sind. Politik der Öffnung Yang Bing wurde in der Zwischenzeit wegen Korruption verhaftet und die Ende August 2002 so ruhmreich beschlossenen Pläne, etwa die Eisenbahnlinie Sinuiju-Pjöngjang-Seoul bis Ende desselben Jahres fertig zu stellen, sind nicht umgesetzt worden. Wie Pierre Rigoulot augenzwinkernd festhält: "Selbst verständlich hatte Südkorea zugesagt, die nötigen 330 Milliarden Wong (275 Millionen Euro) zu übernehmen." Bild 5: Auch Nordkoreas Sozialdesaster ist mittlerweile Bestandteil des popkulturellen Zeichenarsenals (Diesel-Werbung) Und so bleibt eine Randnotiz aus einer Pressemitteilung des World Economic Forum bezeichnend für den theatralisch-comichaften Charakter der nordkoreanischen Öffnungspolitik: -------------------------------------------------------------------------------The Mongolia Prime Minister said that when he was Head of Parliament he was invited to North Korea and was told he might meet the President in Pyongyang. He asked what would be an appropriate gift and was told, perhaps a leather coat. "What size?" he asked. "That's classified information," he was told. Since then the President had been photographed receiving a number of emissaries. "We now know what size he is," he pointed out. Während Kim Jong-Il zur Pop-Ikone avanciert, unter den trendbewussten Jugendlichen Seouls das Sonnenbrillenmodell des nordkoreanischen Diktators sogar ein richtiger Verkaufsschlager geworden ist und die nordkoreanischen Restaurants der Hauptstadt des Südens einen nie gekannten Gästeansturm erleben, bleibt es, um abermals mit Rigoulot zu sprechen, "Ziel der Führung in Pjöngjang, das Überleben des eigenen Regimes zu sichern. Dazu wechselt es zwischen einer Politik der Abschottung und Bedrohung einerseits und der Öffnung und Verhandlungen andererseits." Pierre Rigoulot: Nordkorea. Steinzeitkommunismus und Atomwaffen – Anatomie einer Krise. KiWi 2003. 128 Seiten. Euro (D) 6,90 | sFr 12,40 | Euro (A) 7,10 http://www.heise.de Die Idiotisierung der Finanzmärkte Artur P. Schmidt 04.03.2009 Heute sind viele Banken nur noch Leichenschauhäuser Das Bündeln von Konsumentenkrediten und Häuserhypotheken war der eigentliche Exportschlager der USA zu Beginn des 21. Jahrhunderts, welcher verbunden mit einer geringen Sparquote und einem ausufernden Konsum gleichzeitig mit dem Niedergang der amerikanischen Produktionsindustrie verbunden war. Seit dem Amtsantritt der Bush-/Cheney-Regierung wurden 27 Billionen USD an toxischen Bündelungs-Produkten zur Finanzierung des maroden US-Imperiums verkauft, ein Betrag, der nahezu doppelt so groß ist wie das amerikanische Bruttosozialprodukt von etwa 14 Billionen USD. Der Erfolg der amerikanischen Banken im Bereich der Securitisierung spornte viele Banken weltweit an, dem Weg der amerikanischen Schuldendruckmaschine zu folgen und eine McDonaldisierung der Finanzmärkte einzuleiten. Bis zum Herbst 2008 waren die Ergebnisse der Securitisierung der Wall Street verheerend, da weltweit etwa 700 Milliarden USD (Stand Oktober 2008) an Bankverlusten (40 % davon außerhalb der USA) angefallen waren. Der Erfolg der Securitisierung der Finanzmärkte basierte, darauf wie es Joseph Stiglitz ausführte, dass jede Minute ein neuer Trottel als Käufer gefunden wurde. Mit dem Prozess der Globalisierung wurde die Idiotisierung der Finanzmärkte internationalisiert. Dabei stießen die amerikanischen Exportschlager auf einen ertragreichen Nährboden, da die Idioten weltweit wie Pilze aus diesem herausschossen. Vor allem europäische Banken wollten so sein wie ihre großen Brüder jenseits des großen Teiches. So stieg die Securitisierung neuer Finanzprodukte von 2000 bis 2007 gemäß dem European Securitization Forum nahezu um den Faktor 6 von 78 Milliarden Euro auf 454 Milliarden Euro an, ein Wachstum, das jedem Krebsgeschwür – so stellte sich das Finanzsystem später auch heraus – alle Ehre gemacht hätte. Dabei waren die Securitisierungs-Champions in Europa die Engländer mit einem Anteil von 36 %, die Spanier mit 14 %, die Niederländer mit 11 % und die Italiener mit fast 9 % am europäischen Securitisierungs-Bestandsvolumen. Deutsche Banken haben trotz aller Skandale hier wesentlich solider gewirtschaftet, da hier der Anteil nur bei knapp 6 % liegt. Isländische Banken schossen weltweit den Vogel ab, indem sie erstmals ein ganzes Land in einen Hedgefonds verwandelten. Sie borgten sich 228 Milliarden US-Dollar, um damit vorwiegend securisierte Produkte zu kaufen. Kein Wunder, dass die drei größten Banken sofort verstaatlicht werden mussten und das Land kurz vor dem Staatsbankrott stand. Jetzt werden die Isländer wohl dem internationalen Finanzpoker den Rücken zukehren und sich dem Fischen widmen. Das Schattenbankensystem der Securitisierung, welches auch die weltweite Kreditkartennutzung in ungeahnte Höhen getrieben hat, basierte auf dem Prinzip, Geld weltweit möglichst billig zu machen, um Risken unsichtbar werden zu lassen. Von Sao Paulo bis Korea entstand ein weltweiter Kreditkarten- und Schuldenkult, bei dem alles, sogar Luxusautos und Häuser, vollständig auf Pump finanziert wurde. Diese Gelddruckmaschine führte zu Rekordgewinnen und Riesenboni bei Banken, die zu einem noch nie da gewesenen Leichtsinn im Bereich des Risiko-Managements führten. Eine fatale Fehleinschätzung, da der Krug nur so lange zum Brunnen gehen kann, bis er bricht. Wie krank muss ein System sein, welches im Herbst 2008 noch 70 Milliarden USD an Boni bezahlt, also etwa 10 % des amerikanischen Rettungspaketes, während US-Banken reihenweise untergehen oder unter die Fittiche des Staates fliehen. Setzt man die Zahlungen ins Verhältnis zu dem Wertverlust, den die Aktien vieler Banken seit Jahresbeginn zu verzeichnen haben, so sollten Banker ihre Bonizahlungen von Hunderten von Milliarden an USD der letzten Jahre auf Heller und Pfennig zurückbezahlen, denn wer so wirtschaftet, hat keine zusätzlichen Gehälter verdient. Manager wie der Lehman-Ceo Richard Fuld, haben sich sogar dann noch zusätzliche Boni gesichert, als das Unternehmen schon pleite war. Eine wahrhaft einzigartige Dreistigkeit, die ihresgleichen sucht und nur noch als Finanz-Kannibalismus bezeichnet werden kann. Anstatt sein Unternehmen Kaufinteressenten aus Südkorea oder China zu einem für die Aktionäre noch erträglichen Preis zu verkaufen, ließ er das Unternehmen in Rekordzeit untergehen. In einer nicht mehr zu überbietenden Dekadenz haben Boni-Hascher das Weltfinanzsystem an den Abgrund geführt. Das Gelddrucksystem für die Managerkaste macht deutlich, dass wir keine Manager mehr brauchen, sondern wieder vermehrt Unternehmer, die die Finanzmärkte nicht als Kriegsschauplatz betrachten, denn sonst wird es für immer mehr Firmen einen Stalingrad-Effekt geben. Viele Banken sind aktuell nur noch finanzielle Leichenschauhäuser, die immer mehr Schulden in Form von verstümmelten Finanzderivaten hervorbringen. Dass Stan O'Neil, der Merrill Lynch an den Rand des Untergangs geführt hat, auch noch 161 Millionen US-Dollar einstreichen konnte, zeigt den voll- ständigen Verfall der Sitten an der Wallstreet. Wenn dann auch noch die Bank of America den übernommenen Brokern von Merrill Lynch bis zu 100 Prozent des jährlich generierten Einkommens als Bonus garantiert, um sie davon abzuhalten, die Firma zu verlassen, dann zeigt sich, dass staatliche Hilfen für Banken der grundlegend falsche Weg sind, weil hier nach dem Gießkannenprinzip auf Kosten der Steuerzahler das bestehende System fortgeschrieben wird. Solange der Umsatz durch Staatshilfe gehalten werden kann, spielen die Kundeninteressen bei den Banken keine Rolle. Die Bereicherungsmentalität der Banken wird sich so lange nicht ändern, bis sie für ihre Fehler bluten müssen – und dies wird nicht der Fall sein, wenn sie am Tropf der Steuerzahlers hängen. Wer als Banker nur sein eigenes Geld zählt, übersieht gerne, dass in den Bilanzen der Banken Milliardenbeträge fehlen, denn dafür hat man ja schließlich auch keine Zeit mehr, wenn man sich dank der Millionen-Boni-Bonanza bereits auf den Ruhestand im Luxus vorbereitet. Doch anstatt diesem sollten sich die Verantwortlichen besser auf ein Einzelzimmer in einem Gefängnis vorbereiten, denn Milliarden-Bankrotte der geschehenen Größenordnungen müssten eigentlich langjährige Haftstrafen für die Beteiligten zur Folge haben. Vielleicht finden die geldgierigen Wachstumsapologeten dort eine Identität, die sich wieder auf menschliche Werte besinnt. Und den Bürgern muss man zurufen, die Geldrevolution beginnt jetzt, wenn das Geld von den Großbanken abgehoben wird. Denn eines ist sicher, ein Mittelabzug im großen Stil ist die ultimative Geheimwaffe, die jede Bank der Welt in die Knie zwingt. http://www.heise.de Südkorea: Rechtsregierung unter Druck Raoul Rigault 28.01.2009 Heftige Kritik an Law & Order-Politik in Südkorea nach sechs Toten bei Häuserräumung. Rücktritt von Innenminister und Polizeichef gefordert Der brutale Polizeieinsatz, bei dem am 20.Januar in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul fünf Hausbesetzer und ein Polizist verbrannten, beherrscht bis heute die innenpolitische Debatte und setzt die ohnehin angeschlagene Rechtsregierung von Präsident Lee Myung-bak weiter unter Druck. Nachdem offizielle Stellen zunächst den 40 Besetzern des fünfstöckigen Bürogebäudes im zentralen Stadtteil Yongsan die Schuld an dem Feuer gaben, das angeblich durch Molotow-Cocktails ausgelöst wurde, stellen Zeugenaussagen, Polizeifunkmitschnitte und Indizien die offizielle Version immer mehr in Frage. Die regierende Grand National Party (GNP) hat inzwischen eine Untersuchung angeordnet und die Ernennung des verantwortlichen Polizeichefs Kim Seok-ki zum Leiter der National Police Agency auf unbestimmte Zeit verschoben. Zugleich steigt der Druck von Bürgerrechtsgruppen und Opposition. Nach Ansicht des führenden englischsprachigen Tageszeitung "Korea Herald" hätte die Tragödie vermieden werden können, "wenn die Polizei etwas mehr Vorsicht hätte walten lassen". Es stelle sich die Frage, warum die Räumung, ohne den geringsten Versuch von Verhandlungen bereits 25 Stunden nach der Besetzung des ehemaligen Bürogebäudes stattfand und dazu eine Anti-Terror-Einheit eingesetzt wurde, obwohl es sich nur um einen Fall von Hausfriedensbruch handelte. Nach Ansicht des mit "Washington Post" und "New York Times" verbundenen Blattes sei die "undurchdachte Polizeiaktion nur durch Übereifer zu erklären. Es sei durchaus kein Zufall, dass sie einen Tag nach der Nominierung des Seouler Polizeipräsidenten Kim Seok-ki zum nationalen Polizeichef erfolgte, dessen Beförderung allgemein als "Belohnung für die erfolgreiche Niederschlagung massiver Straßenproteste im letzten Jahr" betrachtet werde. Für weiteres Aufsehen sorgte die Veröffentlichung eines Mitschnittes des Funkverkehrs während der Räumung durch zwei Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Partei am 23.Januar. Daraus geht eindeutig hervor, dass entgegen den Behauptungen von offizieller Seite neben den mehr als 1.000 Polizisten auch ca. 150 Wachleute von Leiharbeitsfirmen eingesetzt wurden, die die Polizei mit Vorschlaghammern und Schilden ausstattete. Laut Zeugenaussagen zündeten diese alte Autoreifen an, um durch die Rauchentwicklung die kleine Gruppe von Besetzern, die sich in einem selbst gebauten Turm auf dem Dach verschanzt hatte, zur Aufgabe zu zwingen. Die auf dem Dach befindlichen Molotow-Cocktails seien durch die nächtliche Feuchtigkeit ohnehin unbrauchbar gewesen. Beleg für die Brutalität der Anti-Terror-Einheit ist die unstrittige Tatsache, dass diese einen der Stützpfeiler des zehn Meter hohen Turms fällte, um diesen zum Einsturz zu bringen. Allein das hätte zu Todesopfern führen können. Beileibe kein Einzelfall: Be- reits im Mai und Oktober letzten Jahres waren solche Spezialeinssatzkommandos mit brutaler Gewalt gegen Gewerkschafter und friedliche Demonstranten vorgegangen. Die linke Tageszeitung Hankyoreh Sinmun fragte sich denn auch in einem Leitartikel vom 24.Januar mit Blick auf die staatlichen Rechtfertigungen: "Wenn eine Aktion, die fünf Bürgern und einem Polizisten das Leben kostet, ein 'einwandfreier Vollzug öffentlicher Pflichten' ist, stellt sich die Frage, was für diese Administration wohl ein 'nicht einwandfreier Vollzug öffentlicher Pflichten' wäre." Der mit 400.000 verkauften Exemplaren fünftgrößten Zeitung des Landes zufolge habe man es hier mit einer "verzerrten und selbstgerechten Staatsgewalt" zu tun, "bei der man nur erklären muss, dass man 'Recht und Ordnung' durchsetzt, um einem Einsatz von Gewalt zu legitimieren, der Grundrechte und Leben der Bürger verletzt." Aller öffentlichen Kritik zum Trotz konzentriert sich die Staatsanwaltschaft bislang indes mehr auf die Verfolgung von Besetzern und Demonstranten. Gegen sechs von ihnen wurden Haftbefehle erlassen, wobei es sich je zur Hälfte um Bewohner des Sanierungsgebietes und um Aktivisten der sie unterstützenden Föderation gegen Häuserabriss (Jun Chul Yun) handelt, die nun auch selbst als "terrorverdächtig" ins Visier der Behörden gerät. Jun Chul Yun wurde im Juni 1994 gegründet und umfasst Gruppen in den Großstädten Seoul, Busan, Ulsan, der Provinz Gyeonggi sowie anderen Teilen des Landes und ist seit langem für ihre engagierte Basisarbeit gegen Immobilienspekulation und neoliberalen Stadtumbau bekannt. Im Stadtteil Yongsan war sie die einzige Organisation, die sich um die Information und Organisation der knapp eintausend Betroffenen bemühte, die sich gegen Willkür, kurze Räumungsfristen und viel zu geringe Entschädigungen wenden. Politische Parteien oder andere Bürgergruppen haben das Thema Stadtentwicklung bislang sträflich vernachlässigt, wie auch der stellvertretende Bezirksvorsitzende der linken Democratic Labour Party (DLP), Nam Gi-mun, zugab. Nicht nur Vertreter der mitte-linken Demokratischen Partei, sondern selbst ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, der anonym bleiben wollte, bezweifelten derweil gegenüber "Hankyoreh", das es angesichts der aktuellen Regierungspolitik zu rechtlichen Konsequenzen gegen Ordnungshüter komme. Justizminister Kim Kyung-han hatte im März 2008 öffentlich erklärt, dass Polizeibeamte bei Gesetzesverstößen in Ausübung ihres Amtes Immunität genössen. Außerdem sind bei der Restrukturierung erhebliche ökonomische Interessen im Spiel. Mit POSCO und Samsung C&T sind zwei Großkonzerne an den Bauprojekten in Yongsan beteiligt. Staatspräsident Lee Myung-bak (ein ehemaliger Hyundai-Chefmanager und Ex-Bürgermeister von Seoul) gilt ohnehin als größter Förderer solcher Projekte. Auf einer Pressekonferenz nach dem blutigen Einsatz scheute er nicht einmal vor der Behauptung zurück, Südkoreas Wachstum werde um einen Prozentpunkt höher liegen, wenn Recht und Ordnung durchgesetzt würden. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres war der Ende Dezember 2007 als "Macher" und "Retter" gewählte Lee allerdings mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 3,4% konfrontiert. Der stärkste Rückgang seit der Asienkrise 1997/98. Auch seine Hoffnung, die Empörung über die sechs Toten könnte durch die Feiertage des Mondfestes abklingen, wird sich wohl nicht erfüllen. Für den 31.Januar hat ein Bündnis von 40 Organisationen, zu einer Protestdemonstration im Zentrum von Seoul aufgerufen. In der südlich gelegenen Hafenstadt Bursan schloss sich eine Allianz von 29 Gruppen und Verbänden den Forderungen nach unabhängigen Ermittlungen sowie einem Rücktritt der Polizeiführung an. http://www.heise.de Die Raketen Nordkoreas und die Politik der Nachbarn Wolfgang Pomrehn 11.07.2006 Japan fühlt sich von den Raketentests bedroht, in den USA spricht man von einer Provokation, China, Russland und Südkorea sind vor allem wegen der neuerlichen Spannungen besorgt, aber die von Japan und anderen Staaten geforderten Sanktionen werden aller Voraussicht nicht verhängt werden Während die USA im Irak immer tiefer in einen Krieg verstrickt wird, den sie nicht mehr gewinnen können, hat Nordkorea die Gunst der Stunde für eine kleine Provokation genutzt. Letzte Woche feuerte es sechs Rodong-Raketen ab, eigene Weiterentwicklungen der sowjetischen Scud-Raketen, die man einst von Ägypten erworben hatte. Die Rakete – 600 könnten sich in nordkoreanischen Arsenalen befinden – soll eine Reichweite von maximal 2000 Kilometer haben. Am letzten Mittwoch gingen sie jedoch nach einigen 100 Kilometern im Meer zwischen Japan und Russland nieder. Wenige Tage zuvor hatte die Regierung in Beijing (Peking), Nordkoreas einziger Verbündeter, noch versucht, den Nachbar von der Aktion abzuhalten. Doch vergeblich. Neben den sechs Mittelstreckenraketen wurde auch eine Taepodong-2-Rakete abgefeuert, die eine Reichweite von bis zu 6.700 Kilometer haben soll, womit sie vermutlich auch Alaska und Hawaii erreichen könnte. Allerdings explodierte die Testrakete am Mittwoch bereits kurz nach ihrem Start. Bild: Asia Times Untermalt hat die Regierung in Pjöngjang die Raketentests mit allerlei nationalistischen Kraftsprüchen, aber eigentliches Ziel ist es, die USA an den Verhandlungstisch zu zwingen. Seit Jahren verlangt Pjöngjang bilaterale Gespräche mit Washington, die von diesem genauso hartnäckig verweigert werden. Das nordkoreanische Ziel sind ein Friedensvertrag und eine Nichtangriffserklärung. Auch 53 Jahre nach dem Ende des Korea-Kriegs gibt es noch immer nicht mehr als einen Waffenstillstand. Insgeheim erhofft man sich im Rahmen entsprechender Verhandlungen wohl auch materielle Zugeständnisse als Gegenleistung zum Beispiel für einen Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen. Davon abgesehen kann man die Raketentests auch als eine Art Verkaufsdemonstration werten. 1,5 Milliarden USDollar nimmt das Land jährlich durch den Export dieser Waffen ein. In letzter Zeit war der Iran ein guter Kunde, in früheren Jahren standen aber auch verschiedene US-Verbündete in der muslimischen Welt auf der Abnehmerliste. Japan hatte am Freitag, zwei Tage nach den Raketentests, Sanktionen gegen den Delinquenten verlangt und eine entsprechenden Resolutionsentwurf dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben Unterstützung signalisiert, doch von den anderen beiden VetoMächten, Russland und China, kommt Einspruch. Zum Glück muss man sagen, denn betroffen wäre natürlich vor allem die Bevölkerung des Landes, die dringend auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen ist. Mitte der 1990er Jahre war es in dem ostasiatischen Land zu einer schweren Hungersnot gekommen, nach dem die Wirtschaftsbeziehungen zu den ehemaligen Ostblockstaaten zusammengebrochen und Naturkatastrophen hinzugekommen waren. Unabhängige Beobachter, die in den 1990er Jahren Nahrungsmitteltransporte nach Nordkorea organisierten, berichten gegenüber Telepolis, dass seinerzeit zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung gestorben sein könnten, was etwa zwei bis vier Millionen Hungertoten entspräche. Auch heute noch ist ein Teil der Bevölkerung von Nahrungsmittelspenden aus dem Ausland abhängig. Unter etwaige Sanktionen könnten zum Beispiel auch eine halbe Million Tonnen Reis fallen, die Südkorea in den Norden schicken will. Fürs erste hat die Regierung in Seoul die Hilfslieferungen gestoppt. Betroffen sind davon auch 100.000 Tonnen Düngemittel. Russland und China, beides Nachbarn Nordkoreas, haben statt der Sanktionen eine Verurteilung des nordkoreanischen Vorgehens vorgeschlagen. In China hatte man sich besonders besorgt gezeigt und alle Beteiligten aufgefordert, die Spannungen nicht noch weiter zu erhöhen. China will eine Eskalation vermeiden Oberflächlich scheint der Grund für Chinas Opposition gegen Sanktionen klar: Formell sind die Volksrepublik und Nordkorea enge Verbündeter. Schließlich hat man einst im Koreakrieg 1950 bis 53 gemeinsam gegen die US geführten UN-Truppen gekämpft. Zwei Millionen Menschen starben seinerzeit in diesem mit viel Erbitterung gekämpften Krieg, darunter hunderttausende chinesischer Freiwilliger. Doch diese Zeiten sind längst passé, und in Beijing lässt man sich weitaus weniger von tatsächlichen oder vermeintlichen ideologischen Gemeinsamkeiten leiten, als jene im Westen meinen, die – Freund wie Feind – gerne darauf verweisen, dass die Volksrepublik von einer Kommunistischen Partei regiert wird. Pragmatismus ist angesagt, und der hat längst zu einer weit fortgeschrittenen Annäherung mit dem einstigen Erzfeind im Süden der koreanischen Halbinsel geführt. Für Südkorea ist China heute der wichtigste Wirtschaftspartner, was sich nicht nur darin ausdrückt, dass Seouls Exportwirtschaft erheblich vom chinesischen Dauerboom profitiert. Südkoreanische Unternehmen haben inzwischen etliche Milliarden US-Dollar in der Volksrepublik investiert, und zwar keineswegs hauptsächlich in arbeitsintensive Produktionsstätten mit veralteter Technologie (derlei lässt man sich in China schon set langem nicht mehr andrehen), sondern vor allem in HightechBetriebe und selbst in Entwicklungslabore. Chinas Konzerne gehen ihrerseits beim Nachbarn, wie übrigens auch in Europa und Nordamerika, auf Jagd nach gestrauchelten Unternehmen. Ziel der Deals ist meist die Übernahme von Know-how und Patenten, aber auch Vertriebsnetze und eingeführte Markennamen sind von Interesse. Bereits im Jahre 2004 kaufte zum Beispiel Chinas aufstrebender Automobilhersteller Shanghai Automotive Industry Corporation für 531 Millionen US-Dollar einen 48,9Prozent-Anteil am südkoreanischen Autobauer Sangyong Motors. Auch kulturell ist Südkorea (wieder) ganz im Bann des großen Nachbarn: Chinesisch hat Englisch vom Platz Nummer eins der Fremdsprachen verdrängt. Im Jahre 2003 studierten rund 35.300 südkoreanischer Studenten in der Volksrepublik und inzwischen dürfte diese Zahl bereits über 50.000 liegen. Taepodong-2-Rakete In Beijing hat man also denkbar wenig Interesse daran, sich einseitig auf die Seite Pjöngjangs zu schlagen. Die Politik der chinesischen Führung ist vielmehr davon bestimmt, eine Eskalation zu vermeiden. Entsprechend hatte man Pjöngjang im Vorfeld des Raketenstarts ausdrücklich versucht, davon abzuhalten. Die Tests sind somit unter anderem auch eine Brüskierung des Bündnispartners. Beijing fürchtet nicht nur einen militärischen Konflikt vor der eigenen Haustür, in den es womöglich hineingezogen werden könnte, der aber auf jeden Fall seine Wirtschaft schwer beschädigen würde. Nordkoreas Aufrüstung ist auch für die USA der willkommene Vorwand, ihre Pläne für ein Raketenabwehrschild voranzutreiben, das nicht nur für Interkontinentalraketen, und damit für das eigene Territorium, sondern auch für Mittelstreckenraketen entwickelt wird. Letzteres wird auch Chinas Nachbarn von den USA angedient, und in Beijing hat man allen Grund zu der Annahme, dass sich diese Politik vor allem gegen die Volksrepublik richtet. Raketenabwehrsysteme – wenn sie denn irgendwann einmal funktionieren sollten – sehen zwar auf den ersten Blick defensiv aus, aber sie ermöglichen es den so geschützten Staaten, aggressiver zu agieren, weil sie vor Vergeltung geschützt sind. Aus diesem Grund hatten sich die USA und die Sowjetunion einst zu Zeiten des kalten Krieges auf einen Stopp der Entwicklung in diesem Bereich geeinigt, um das Wettrüsten nicht noch mehr anzuheizen. Die USA haben diese Verträge allerdings zwischenzeitlich aufgekündigt. Die chinesische Führung hat also allen Grund, sauer auf die Militaristen in Pjöngjang zu sein. Dennoch hat man ein starkes Interesse an einer Stabilisierung des dortigen Regimes. Ein Zusammenbruch der staatlichen Macht beim Nachbarn wäre sicherlich auch in China nicht ohne Folgen. Und zwar nicht so sehr, weil er Oppositionelle in der Volksrepublik inspirieren könnte, sondern vielmehr wegen der sozialen Konsequenzen. Millionen hungernder Menschen könnten versuchen, nach China zu gelangen. Wirtschaftliche Verfelchtungen Die Volksrepublik hat daher 2002 ihre bis dahin fast sprichwörtliche außenpolitische Zurückhaltung aufgegeben, die für die Beijinger Führung charakteristisch war, seit Deng Xiaoping 1978 nach Maos Tod und der Entmachtung der Parteilinken die Reformpolitik eingeleitet hatte. Nun ergriff man die Initiative und lud zu Sechs-Parteiengesprächen ein, um die Krise zu lösen, die durch das Atomprogramm Nordkoreas ausgelöst worden war und durch den Austausch immer neuer Drohungen zwischen Washington und Pjöngjang weiter angeheizt wurde. Russland, Japan, die beiden Koreas und die USA folgten der chinesischen Einladung. In mehreren Runden hat man seitdem mit wechselndem Erfolg zusammen gesessen. Beim letzten Treffen im Spätsommer 2005 einigte man sich immerhin darauf, dass die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei gemacht werden soll. Pjöngjang hat sich in einer Erklärung am Donnerstag, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, ausdrücklich zu diesem Ziel bekannt, kann allerdings auf die erdrückende Militärmacht der USA verweisen, die in Südkorea und auf den nahen japanischen Stützpunkten (vor allem auf Okinawa) stationiert ist. Nordkoreas Raketenarsenal Gleichzeitig zur diplomatischen Offensive wirbt China in Nordkorea für ökonomische Reformen. Der neue "geliebte Führer" Kim Jong Il, der vor einigen Jahren seinen Vater Kim Il Sung beerbte, besuchte in den vergangenen Jahren mehrfach die Boom-Zentren der Volksrepublik, um sich über den Erfolg der marktwirtschaftlichen Reformen zu informieren. Als Ergebnis beginnt man auch in Nordkorea, mit der Marktwirtschaft zu experimentieren. An der Grenze zu China im Norden soll eine ökonomische Sonderzone eingerichtet werden, in der nordkoreanische Arbeiter für den Weltmarkt produzieren werden. Frühere Pläne aus dem Jahr 2002 waren gescheitert, nach dem der für die Wirtschaftszone vorgesehene chinesische Leiter in der Volksrepublik wegen Korruption verhaftet worden war. In Süden, an der Grenze zu Südkorea, ist man daher mit ähnlichen Plänen schon weiter. In der Grenzstadt Kaesong arbeiten derzeit 6.500 nordkoreanische Arbeiter für 15 Firmen aus dem Süden. Bis nächstes Jahr sollen es 300 Unternehmen aus dem Süden werden, die die billigen Löhne im Norden ausnutzen. Aber auch das ist erst die erste Ausbauphase. Bis 2012 plant man die Ansiedlung von 2000 Unternehmen des ehemaligen Erzfeindes, für die dann 350.000 nordkoreansiche Arbeiter beschäftigt werden. Natürlich ohne das Recht, sich in unabhängigen Gewerkschaften zu organisieren. Ihre Kollegen im Süden hatten sich dieses Recht einst unter einer Militärdiktatur erstritten, die sie schließlich auch zu Fall brachten. Für Südkoreas Konzerne sind die Aussichten auf Produktionsstätten im Norden daher außerordentlich verlockend. Entsprechend tut sich inzwischen ein tiefer Riss in der Elite des Landes auf. Während die konservative Rechte unbedingt am Bündnis mit den USA festhalten will und ganz auf eine harte Linie gegenüber dem Norden setzt, will die gegenwärtige Regierung an der schrittweisen Annäherung fest- halten, die im Jahre 2000 eingeleitet wurde. Auch wenn Präsident Roh Moo-hyun ansonsten eher unpopulär ist, hat er in dieser Frage doch die Mehrheit der Südkoreaner hinter sich. In der dortigen Öffentlichkeit ist man nicht allzu sehr über die Drohgebärden des Nordens besorgt. Mehr Empörung lösten da schon die Drohungen des japanischen Premierministers Junichiro Koizumi aus, der einen Tag vor den Raketentests Südkorea gewarnt hatte, in der Nachbarschaft der Doktobzw. Takeshima- Inseln Untersuchungen durchzuführen. Die Inselgruppe ist zwischen den beiden Ländern umstritten und der Streit bestens geeignet, die ohnehin schon belasteten koreanischjapanischen Beziehungen weiter zu verschlechtern. Korea ist fast 50 Jahre lang japanische Kolonie gewesen und hat die japanischen Kolonial- und Kriegsverbrechen noch lange nicht vergessen. In jüngster Zeit hat Koizumi zusätzlich durch jährliche Besuche im Yasukuni-Schrein, in dem auch hochrangiger Kriegsverbrecher gedacht wird, Salz in die Wunden gerieben. Seoul wird daher kaum die japanische Forderung nach Sanktionen unterstützen. Wahrscheinlicher ist, dass Südkoreas Bündnis mit den USA brüchiger wird, während Washington und Tokio enger zusammenrücken. Gut möglich, dass das der Hauptzweck der nordkoreanischen Übung war. http://www.heise.de Klug, freundlich und persönlich Keisuke Oki 18.03.1998 MExA – ein Agent für uns alle Die Agententechnologie wurde angesichts einer Reihe von Faktoren, vor allem wegen ökonomischen Bedürfnissen, zu einem der heißesten Bereich der Computertechnologie. Computerwissenschaftler, die Alchemisten der Gegenwart, stellen kein Gold, sondern Programme her, die in der digitalen Umwelt "leben". Die Agententechnologie wird sich im nächsten Jahrzehnt mit größerer Geschwindigkeit entwickeln. Wir haben ein Bedürfnis nach Agenten, um Aufgaben in unserem Alltagsleben zu bearbeiten. Wer werden Agenten benutzen, um Zeitpläne zu überprüfen, Telefonanrufe zu beantworten, Email zu empfangen und zu senden, für uns interessante Informationen zu sammeln, Aktienkurse zu beobachten, unsere Wohnungen zu sichern etc. Mit anderen Worten, wir werden von unseren Agenten als unseren Sekretären, Boten und Sicherheitskräften abhängig. Daher müssen die Agenten klug sein. Ihr Intellekt muß angesichts unserer Bedürfnisse größer werden. Computerwissenschaft ist die Alchemie des modernen Zeitalters. Das macht sie für die neugierigen Köpfe junger Menschen so anziehend. Der "Warenfetisch", ein wesentlicher Begriff für die "Entfremdung" in der marxistischen Philosophie, wird möglicherweise in der künftigen Gesellschaft nicht anders werden. Marx sagte, daß der Preis an sich nichts anderes sei als der Wertausdruck des Geldes. In den 70er Jahren büßte das internationale Währungssystem seine Konvertibilität mit dem Gold ein. Seitdem hatte unser Papiergeld nur noch einen Wert, der lediglich durch wechselseitige Vereinbarungen garantiert wird. In den 90er Jahren verliert das Geld noch weitere seiner materiellen Verankerungen. "Elektronisches Geld" ersetzt das herkömmliche Geld. Werte werden in digitalen Daten ausgedrückt. Die Manipulation digitaler Daten mittels der Computer wurde zu einem elementaren Bestandteil der Wertbildung. Der alte Spruch "Zeit ist Geld" muß jetzt zu "Verarbeitungsgeschwindigkeit ist Geld" verbessert werden. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Computer wird zum wichtigsten Bestandteil der Wertbildung. Agenten werden im Gegensatz zum "Top-down-Ansatz" der Künstlichen Intelligenzen "bottom-up" entwickelt. Lernfähigkeit ist für sie ein wichtiger Vorgang. Die bislang auf geschäftliche Aufgaben angewendete KI läßt bei uns den Eindruck der Inflexibilität entstehen. Sie zeigen Intelligenz für gegebene Aufgaben, aber sie sind für neue Situationen nicht geeignet. Die meisten KI-Programme haben ein Expertensystem zur Grundlage, das das Wissen von Medizinern, Rechtsanwälten, Ingenieuren usw. zu speichern sucht. KI wurde in Elektrizitätswerken, in Krankenhäusern oder bei Transportsystemen eingesetzt. Zahlreiche Vorfälle haben uns bewußt gemacht, daß Expertensysteme nicht immer vertrauenswürdig sind. Das ist ein Science-Fiction-Thema, das wir auch im Film "Jurassic Parc" bemerken, in dem die Probleme mit einem Computersystem beginnen, das die Zahl der Dinosaurierer im Park zu gering veranschlagt. Die Geschichte handelt von unseren Ängsten gegenüber Computersystemen. Zuviele Experten glauben, daß ihr Sachverstand fehlerlos sei. Sie liegen falsch. Im Computer oder in den Netzen arbeiten bereits Agentenprogramme. Jeder Agent hat bestimmte Aufgaben und Verhaltensweisen. Auf dem Desktop sehen wir Agenten für das Betriebssystem und für Anwendungen. Im Internet gibt es Suchagenten für das Web, Agenten zum Filtern oder Zurückholen von Informationen oder zum Benachrichtigen, es gibt Service-Agenten und mobile Agenten. In den Intranets gibt es Agenten, die gemeinsam arbeiten, um etwas individuell zu gestalten, die Prozesse automatisieren, Datenbanken verwalten und als Broker für Ressourcen dienen. MExA – Mind Extension Agent -------------------------------------------------------------------------------Wenn ich Sie begrüße, dann ordne ich uns beide in die Klasse von Lebewesen ein, die einen Geist besitzen. Daniel C. Dennett MExA heißt der Agent, den ich gerade entwickle. Er soll dem Menschen, der einen Geist besitzt, dienen. Es ein Agent, der Sprache erkennt, die Gehirnwellen liest, Sprechen kann, nach Informationen sucht und lernt. Die Spracherkennung ist gegenwärtig auf englisch beschränkt. Seine Aufgabe ist jetzt, die Benutzer kulturell zu unterhalten. Er sucht für seine Benutzer nach Programmen und Informationen im Internet (oder einem Intranet) und wird durch eine Mensch-Maschine-Interaktion gesteuert, die Hirnwellen und Sprache benutzt. Aber ich erwarte wirklich, daß MExA den Graben zwischen Mensch und Maschine zu überbrücken hilft. Die von uns alltäglich benutzten Computer sind nicht sehr benutzerfreundlich. Sie wollen sicherlich nicht mit uns Freundschaft schließen. Wir beziehen sie nicht in die Klasse derjenigen ein, die einen Geist besitzen, wobei natürlich die Definition dessen, der einen Geist besitzt, individuell verschieden ist. -------------------------------------------------------------------------------"Wir verließen Houston in der Morgendämmerung und fuhren die Straße entlang, nur ich und mein Truck." Seltsam. Wenn dieser Kerl denkt, sein Truck sei eine solch wertvolle Begleitung, daß er unter dem Schirm des "Wir" einen Unterschlupf benötigt, dann muß er ziemlich einsam sein oder sein Truck muß so individuell gestaltet sein, daß er von allen Robotikwissenschaftlern neidvoll betrachtet wird. "Wir, nur ich und mein Hund" verwirrt uns im Gegensatz keineswegs, während man "Wir, nur ich und meine Auster" kaum ernst nehmen kann. Wir sind, mit anderen Worten, ziemlich sicher, daß Hunde einen Geist besitzen, und wir zweifeln daran, daß dies auch für Austern gilt. Daniel Dennett Es ist komisch, wie Dennett sagt, wenn der Fahrer sein geistloses Fahrzeug als einen würdigen Begleiter betrachtet. Wir sprechen Hunden einen Geist zu, aber nicht Austern. "Manche denken, daß ein zehn Wochen alter Fötus einen Geist besitzt, manche glauben, es sei offensichtlich, daß dies nicht der Fall ist." (Dennett) Aber wie ist das bei Computern? Einige stellen sich bestimmt ihren Computer als einen kooperativen Kollegen vor, doch die meisten sehen ihn als Maschine. Wir sind keinswegs kurz davor, einen Computer wie HAL aus "A Space Odyssee" zu schaffen. Marvin Minsky sagt von der "Botschaft HALs": Ich bin noch immer ein Realist. Wenn wir hart und geschickt arbeiten, dann können wir etwas Ähnliches wie HAL in einen Zeitraum von vier oder von vierhundert Jahren haben. Ich nehme an, daß wir glücklich wären, wenn dies uns bis zum Jahre 2001 gelänge." MExA ist kein HAL. Er hat keine Intelligenz und reagiert nur auf die Stimme und die Hirnwellen des Benutzers. Man sollte aber festhalten, daß selbst HAL sich selbst als eine geistlose Nachahmung des menschlichen Verhaltens beschrieb. Aber MExA kann die Stimme und die Hirnwellenmuster des Benutzers speichern, so daß künftige Versionen diese Daten heranziehen könnten, um mit einem Menschen zu kommunizieren. Warum soll MExA Hirnwellen benutzen? EEGs werden als Inputdaten verwendet, um den "Geist" eines Menschen zu erforschen. Andere Inputdaten wären ereignisbezogene Gehirnpotentiale (ERP), Elektromyogramme (EMG zum Erfassen der Muskelaktivität), Pupillometrie zum Aufzeichnen der Veränderungen der Größe der Pupille, Elektrooculographie (EOG zur Aufzeichnung der Augenbewegungen), EDA zum Aufzeichnen der elektrischen Spannung an der Oberfläche der Haut, Herzaktivität, Blutdurchfluß und Blutdruck. Überdies lassen sich Atmung, Sauerstoffverbrauch, Speichelfluß, Hauttemperatur und Verdauungstätigkeit erfassen. Neben der Stimmerkennung sollte man in Zukunft auch an die Gesichtserkennung denken. Die Analysen und Messungen dieser Körpersignale sind Inputs, die von der Computertechnologie verarbeitet werden. Solche Daten werden in Bereichen wie der Psychophysiologie herangezogen. Aber es gibt auch kulturelle Gründe, sie zu benutzen. Die technologischen Entwicklungen, die von Computeringenieuren stammen, sind nicht immer auf kulturelles Bewußtsein ausgerichtet! Der Unicode, der vor allem von Computertechnikern in westlichen Ländern entwickelt wurde, muß für nicht-westliche Kulturen nicht unbedingt geeignet sein, wenn er deren Sprachgebrauch beschränkt. Menschen in China, Japan, Korea und Taiwan verwenden chinesische Zeichen und solche, die in Japan und Korea entstanden sind. Die Regierung Taiwans hat formal etwa 50000 Zeichen anerkannt. Die meisten westlichen Länder haben Alphabete mit weit weniger Zeichen. Wenn man diese Unterschiede übersieht, wird Unicode unbewußt dahin tendieren, die kulturellen Eigenheiten in der realen Welt in der Absicht zu vereinfachen, um die Verarbeitung von digitalen Texten zu vereinfachen. Selbst die Gebrauchsweisen von "Ja" und "Nein" können sich in verschiedenen Kulturen unterscheiden. Ein englischer Muttersprachler, der gefragt wird: "Mögen Sie keine Äpfel?", könnte antworten: "Nein, ich mag keine Äpfel." Aber in anderen Sprachen wie in der japanischen könnte die Antwort lauten: "Ja, ich mag keine Äpfel." Die existierende Computertechnologie ist weit davon entfernt, eine sprachliche Kommunikation zwischen Maschine und Mensch zu ermöglichen. Wenn wir uns verstehen wollen, dann müssen die Computer die Intelligenzleiter noch höher hinaufklettern. Und wenn sie diese Fähigkeiten erwerben, dann könnte die Verwendung von körperlichen Inputdaten den Maschinen dabei helfen, ihre geheimnisvollen organischen Partner zu verstehen. Ein technischer Archetyp von MExA wurde zuerst für "News_agent(x)" (1997) realisiert, der während der ISEA97 in Chicago vorgeführt wurde. News_agent(x) war meine erste Arbeit aus einer Serie von agentenbasierten interaktiven Kunstwerken. Die Ausführungen über die Grundlagen des Agenten wurden für die ISEA97 geschrieben. News_agent(x) Wertpapiermärkte, Kriege, Machtkämpfe, Umweltprobleme, Morde und andere Ereignisse – immer versuchen wir herauszufinden, was hinter den Schlagzeilen der Fernsehnachrichten steht oder was man zwischen den Zeilen von Zeitschriftenartikeln lesen muß. Man stellt leicht fest, daß es viele kausale Beziehungen gibt, die sich unter der Oberfläche der täglichen Nachrichten befinden. All die kleinen Ursachen interagieren miteinander, um schließlich zu einem sozialen Phänomen zu werden. Abendnachrichten im Fernsehen können als Familienbande fungieren, indem sie eine Zeitspanne bieten, um gemeinsame Themen mit anderen Familienmitglieder zu haben.Aber 24-StundenProgramme wie CNN oder BBC Satellite können uns zu Nachrichtensüchtigen werden lassen. Wir können kaum mehr aufhören, die Nachrichten zu verfolgen. Sie bringen ebenso wie Musik- oder Sportsender dramatische Spektakel in unsere Heime. Nachrichten scheinen unsere Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen und Einstellungen im Alltagsleben zu beenflussen. Jede menschliche Aktivität reflektiert die mechanischen, materialistischen Elemente, die die Welt ausmachen. Das ist die traditionelle soziologische Perspektive, aber sie wird umgekehrt. Wir sollten jetzt beginnen, die Gesellschaft durch die Methoden der Biologie zu deuten. Die soziale Struktur sollte eher als biologisches System denn als materielles System gesehen werden. Wenn man diese Sichtweise auf Nachrichten bezieht, dann beruht die Reflexion unserer sozialen Struktur für alle unsere Aktivitäten auf biologischen Gründen, weil die Aktivitäten der einzelnen im Kontext biologischer Regeln verstanden werden kann. Die neuesten Theorien in der Finanzanalyse, aber auch in anderen Bereichen leitet sich weitgehend von biologischen Entdeckungen ab. Theorie, die sich auf "komplexen Theorien" begründen, sind dafür ein gutes Beispiel. Die darwinistische Konkurrenz wird auch auf solche Theorien angewendet. Für die ISEA habe ich einen geschlossenen Informationskreislauf, ein virtuell erzeugtes "Nachrichtenprogramm" entwickelt, das aus Fernsehbildern, Zeitungsartikeln und Berichten vom Finanzmarkt besteht. Ein Maß für die "Erwünschtheit", das die Nachrichteninhalte kategorisiert, entsteht aus den Gehirnwellen der Benutzer. Die Daten der Gehirnwellen verweisen in diesem Fall auf das Unbewußte der Benutzer. Zwischen den Reaktionen der Menschen und den Nachrichtenfaktoren befindet sich ein Agent, der den Geisteszustand der Benutzer aufzeigt. Es gibt vier Stufen der "Erwünschtheit" in Reaktion auf Nachrichten: sehr erwünscht, erwünscht, neutral und unerwünscht. Je nach dem Grad der "Erwünschtheit", der durch die Hirnwellen angezeigt wird, ändert der Agent die Nachrichten und Berichte vom Finanzmarkt ab, die er aufruft. Je stärker die Benutzer etwas erwünschen, desto stärker "wächst" der Agent wie ein biologisches Lebewesen. Wenn er auf eine bestimmte Größe gewachsen ist, beginnt er sich fortzupflanzen. Der Agent hat eine bestimmte Lebenszeit, so daß er innerhalb einer gewissen Zeit heranwachsen muß, sonst kann er keine Nachkommen haben. Das Ergebnis dieses ganzes Prozesses kann ein Output wie eine Kurve in einem Finanzbericht sein. Die Zuschauer können verschiedene Arten von Nachrichten sehen und herausfinden, wie ihr Geist sich auf die Nachrichtenfaktoren bezieht, während ein Computer gleichzeitig herausfindet, wie das Gehirn der Zuschauer sich verhält. News_agent(x) funktionierte als Teil einer Installation während der ISEA97 nur lokal. Als künstlerische Installation stellte sie, auch wenn sie noch nicht abgeschlossen ist, meine Gedanken über den Mensch und die Maschine, die Information und die Kultur dar. MExA (Mind Extension Agent) besitzt alle Funktionen des News_agent(x) und kann Informationen aus dem Netz holen. Beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung unterscheidet er sich nicht von den gewöhnlichen Software-Agenten, die man auf seinem Desktop oder auf Internetseiten sehen kann. Aber er entwickelt sich noch. Als intelligentes Agentenprogramm wird es lernen und auch mit anderen Agenten kommunizieren. News_agent(x) ist ein Interface-Agent, der interessenorientiert Nachrichten in Übereinstimmung mit den Hirnwellen der Benutzer auswählt. Im Unterschied dazu ist MExA ein Unterhaltungsagent mit einer zusätzlichen Ausrichtung auf die Weiterentwicklung der Kommunikation zwischen dem Menschen, der einen Geist besitzt, und der geistlosen Maschine. In Zukunft werden vielleicht Experimente mithilfe von MExA Überschneidungen mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen wie der Psychophysiologie, Biologie, Psychologie, Ökologie, Anthropologie, Philosophie oder Medizin entwickeln. Aus dem Englischen übersetzt von Florian Rötzer http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de http://www.heise.de