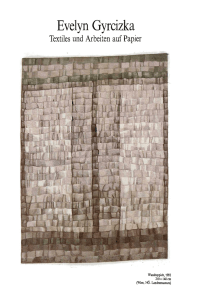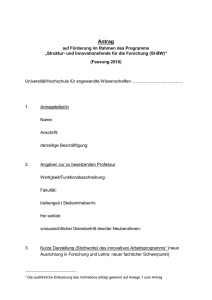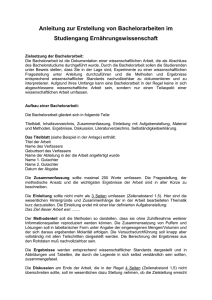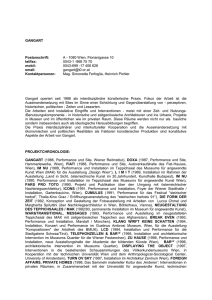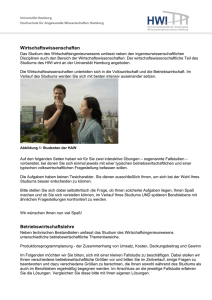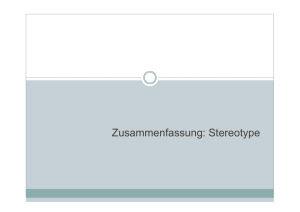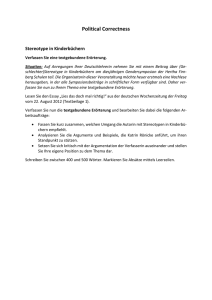Original Downloaden
Werbung

Bachelorarbeit im Studiengang Kommunikation JO Journalismus / Organisationskommunikation 2013 Bilder des Andern Die Deutschschweiz aus Sicht des «L’Hebdo» Vorgelegt im August 2013 am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Departement Angewandte Linguistik ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Diplomandin: Lea Hartmann Dorfstrasse 10, 4805 Brittnau [email protected] 076 460 01 91 Betreuerin: Sibylla Laemmel Bachelorarbeit Lea Hartmann Erklärung Lea Hartmann versichert hiermit, dass die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst wurde und dass sämtliche Quellen im Text oder im Anhang nachgewiesen sind (siehe Quellenverzeichnisse). Bei Veröffentlichungen von oder aus der Bachelorarbeit sorgt die Autorin dafür, dass immer klar ist, dass es sich um eine Bachelorarbeit handelt, die von einer Studierenden am IAM verfasst wurde. Ein Hinweis wie «eine am IAM durchgeführte Studie» genügt nicht. Brittnau, 24. Juli 2013 Lea Hartmann Bachelorarbeit Lea Hartmann Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ...................................................................................................................... 1 1.1 Forschungsleitendes Interesse und Ziele ............................................................ 2 1.2 Relevanz und Eingrenzung.................................................................................. 2 1.3 Das Verhältnis zwischen Deutsch und Welsch .................................................... 3 2. Theoretische Grundlagen ............................................................................................ 5 2.1 Stereotype ........................................................................................................... 5 2.2 Soziale Identität ................................................................................................... 6 2.3 Medienwissenschaftlicher Kontext ....................................................................... 7 3. Forschungsfragen und Hypothesen ........................................................................... 8 3.1 Herleitung ............................................................................................................ 9 4. Methodik........................................................................................................................ 9 4.1 Inhaltsanalyse ................................................................................................... 10 4.1.1 Sample ........................................................................................................ 11 4.2 Textanalyse ....................................................................................................... 12 5. Auswertung................................................................................................................. 13 5.1 Charakterisierung und Konnotation ................................................................... 13 5.2 Verhältnis Deutschschweiz/Romandie ............................................................... 15 5.3 Themen ............................................................................................................. 17 5.4 Akteure .............................................................................................................. 18 6. Interpretation .............................................................................................................. 19 6.1 Diskussion der Ergebnisse ................................................................................ 19 6.1.1 Diskussion der Fragestellung 1 ................................................................... 19 6.1.2 Diskussion der Fragestellung 2 ................................................................... 20 6.1.3 Diskussion der Fragestellung 3 ................................................................... 21 6.1.4 Diskussion der Fragestellung 4 ................................................................... 21 6.2 Beantwortung der Leitfrage ............................................................................... 22 7. Fazit ............................................................................................................................. 23 7.1 Kritische Betrachtung der Methodik ................................................................... 23 7.2 Kritische Betrachtung der Ergebnisse ................................................................ 24 7.3 Weitergehende Forschungsansätze .................................................................. 25 7.4 Persönliche Reflexion ........................................................................................ 25 8. Quellenverzeichnisse ................................................................................................. 27 8.1 Literaturverzeichnis ........................................................................................... 27 8.2 Weitere Internet-Quellen.................................................................................... 28 8.3 Zitierte Artikel aus «L’Hebdo» ............................................................................ 28 8.4 Materialien ......................................................................................................... 29 8.5 Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... 29 ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 1 1. Einleitung Sie werden als «bon vivants» bezeichnet, einem Gläschen Weisswein nie abgeneigt, faul und unpünktlich, dafür lebenslustig und voller Charme: Klischees über die französischsprachigen Bewohner der Schweiz sind zahlreich und jeder Schweizerin und jedem Schweizer bekannt. Im Rahmen der Bachelorarbeit soll die Perspektive jedoch für einmal gewechselt werden: Wie sehen Romands die Deutschschweiz? Ist ihr Bild über die Deutschschweiz ebenso von Stereotypen geprägt wie das Deutschschweizer Bild der Romands scheint? Wie werden die Deutschschweiz und das Verhältnis Deutschschweiz/Romandie nebst Stereotypen charakterisiert? Welche Akteure kommen zu Wort und wie werden diese dargestellt? Diese und weitere Fragen werden anhand einer Inhalts- und Textanalyse der medialen Berichterstattung der welschen Wochenzeitung «L’Hebdo» untersucht. Durch die Analyse des medial vermittelten Bildes der Deutschschweiz wird ein Gebiet bearbeitet, welches bisher nur punktuell untersucht wurde. Studien, die sich mit der Repräsentation und Beschreibung der verschiedenen Landesteile in Schweizer Medien befassen, betreffen ausschliesslich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da dieser aufgrund seines Programmauftrags zur Förderung des Verständnisses, des Zusammenhalts und des Austauschs der Sprachregionen verpflichtet ist (vgl. Art. 24 Abs. 1 lit. a RTVG). So hat Corboud Fumagalli (1996) festgestellt, dass gerade einmal 5% der «Tagesschau»-Beiträge (bzw. des «Téléjournal» und «Telegiornale») einen jeweils anderen Landesteil thematisieren. Diesen Anteil hat Wuerth (1999) in seiner Dissertation daraufhin qualitativ untersucht. Seit 2008 werden ausserdem jährlich die Radioprogramme der SRG durch die Publicom AG im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation hinsichtlich ihrer Integrationsleistung untersucht (vgl. Grossenbacher / Forsberg / Hüppin 2012: 3 f.). Mit «L’Hebdo» wird in der vorliegenden Arbeit kein durch einen gesetzlichen Leistungsauftrag zur Integration verpflichtetes Medium, sondern ein privatwirtschaftlich finanziertes Pressprodukt analysiert. Weshalb hierzu «L’Hebdo» ausgewählt wurde, wird in Kapitel 1.2 erläutert. Einleitende Bemerkungen zur Beziehung zwischen Deutschschweiz und Romandie folgen (Kapitel 1.3). In Kapitel 2 werden anschliessend theoretische Grundlagen dargelegt, in Kapitel 3 Fragestellungen und Hypothesen formuliert. Auf die Beschreibung der Methodik in Kapitel 4 folgt eine detaillierte Auswertung der durchgeführten Inhalts- und Textanalyse (Kapitel 5) sowie die Interpretation der Ergebnisse (Kapitel 6). Abschliessend werden in Kapitel 7 Methodik und Ergebnisse kritisch betrachtet, weitergehende Forschungsansätze skizziert sowie ein persönliches Fazit gezogen. Was den Umgang mit Bezeichnungen für den französischsprachigen Landesteil bzw. dessen Bewohner betrifft, so werden die Begriffe «Westschweiz», «französische Schweiz», ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 2 «Romandie» sowie die Adjektive «welsch» und «französischsprachig» in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet. 1.1 Forschungsleitendes Interesse und Ziele Das Interesse für diese Forschungsarbeit lag in den persönlichen Erfahrungen mit und im Interesse für den anderen Landesteil. Ausserdem bestand die Motivation, zur Förderung der eigenen Sprachkompetenz eine Analyse von französischen Texten durchzuführen und dabei die welsche Medienlandschaft exemplarisch etwas besser kennenzulernen. Durch die eigene journalistische Tätigkeit bei verschiedenen Deutschschweizer Medien ist aufgefallen, dass eine Berichterstattung über den «Röstigraben» hinweg relativ selten zu erfolgen scheint. Daraus ergibt sich die umgekehrte Frage, ob und wie welsche Medien über die Deutschschweiz berichten. Anhand der exemplarischen Inhalts- und Textanalyse der Berichterstattung des «Hebdo» soll dies umfassend untersucht werden. Ausserdem soll diese Arbeit einen kleinen Beitrag zum besseren Verständnis des anderen Landesteils sowie zum Dialog zwischen Romandie und Deutschschweiz leisten. 1.2 Relevanz und Eingrenzung Dass Medien Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben, gilt als unbestritten. Gleichzeitig werden Medien vielfach als «Spiegel der Gesellschaft» oder gar als ihr «Abbild» bezeichnet. Ob und in welchen Fällen dies tatsächlich zutrifft, soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Vielmehr zeigen diese Aussagen, welche gesellschaftliche Relevanz Medien grundsätzlich zugesprochen wird. Im Hinblick darauf kann angenommen werden, dass durch die exemplarische Analyse der Medienberichterstattung des «Hebdo» indirekt nicht nur Erkenntnisse über das Deutschschweiz-Bild des Magazins, sondern stellvertretend auch – zumindest ansatzweise – Erkenntnisse über das Deutschschweiz-Bild der Romands gewonnen werden können. Eine Untersuchung der medialen Berichterstattung in Bezug auf das Verhältnis von deutscher und französischer Schweiz macht ausserdem Sinn, da der «Röstigraben» «nicht nur, aber auch ein Medienphänomen» ist (Büchi 2000: 285). Medien haben mitgeholfen, «die Sprachregionen zu «homogenisieren» sowie «einerseits ein «Deutschschweizer Wir-Gefühl, andererseits ein welsches Bewusstsein zu wecken» (vgl. ebd.). Da aus Gründen beschränkter zeitlicher Ressourcen eine umfassende Analyse des gesamten oder eines repräsentativen Ausschnitts der französischsprachigen Medienlandschaft der Schweiz nicht möglich war, beschränkt sich die Untersuchung auf die Berichterstattung des «Hebdo». Das französischsprachige Newsmagazin eignet sich für eine exemplarische Analyse, da es regelmässig über die Deutschschweiz und verschiedene Deutschschweizer Exponenten berichtet (vgl. Anhang «E-Mail-Korrespondenz Jeannet»). Zwei Korrespondenten in Bern sind ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 3 nebst der Bundeshaus-Berichterstattung für die Deutschschweiz zuständig, ausserdem deckt eine weitere Korrespondentin in Biel das Deutschschweizer Geschehen ab. Der Posten in Zürich war zum Zeitpunkt der Anfrage vakant (vgl. ebd.). Laut NZZ-Korrespondent Christophe Büchi wurde das Magazin nach seiner Gründung 1981 «als Stimme der Romandie schlechthin» betrachtet (Büchi 2000: 262). Wie der aktuelle Chefredaktor Alain Jeannet auf Anfrage schreibt, gilt dieses Selbstverständnis noch heute: «Comme publication supra régionale, nous nous considérons comme la (ou une) voix de la Suisse romande. Il faut rappeler que L'Hebdo est né quelques années après la création du canton du Jura, dans une époque de prise de conscience renouvelée d'une identité romande» (vgl. Anhang «E-Mail-Korrespondenz Jeannet»). Jeannet bezeichnet das Magazin weiter als «plate-forme de débat pour la Suisse romande». (vgl. ebd.). Als Wochenzeitschrift kann sich «L’Hebdo» ausserdem aufgrund ihres Publikationsrhythmus vertiefter und umfangreicher mit Themen abseits der Tagesaktualität befassen. Relevant ist «L’Hebdo» aber auch, da das Magazin ein fester Bestandteil der welschen Medienlandschaft ist. Mit einer Auflage von rund 45'000 Exemplaren und 207'000 Lesern ist «L’Hebdo» nach eigenen Angaben das meistgelesene Magazin der Westschweiz (Ringier 2013). «L’Hebdo» dient folglich als ideale Grundlage für eine vertiefte Analyse, da das Magazin einerseits regelmässig und umfangreich über die Deutschschweiz berichtet und andererseits in der Romandie durch seine Reichweite und sein Selbstverständnis als meinungsrelevantes Medium betrachtet werden kann. Nebst der Konzentration auf ein Medium mussten auch die zu untersuchenden Aspekte beschränkt werden. So wird das Bild der Schweiz nur auf der textlichen und sprachlichen Ebene untersucht – auf eine Analyse des verwendeten Bildmaterials wird verzichtet. Ausserdem basiert die Inhaltsanalyse auf einem rein deskriptiven Ansatz, diagnostische (absenderbezogene) sowie prognostische (empfängerbezogene) Schlussfolgerungen sind daher nicht möglich. Hierzu wären zusätzliche Untersuchungen mit anderem Forschungsdesign nötig (vgl. Kapitel 7.3). 1.3 Das Verhältnis zwischen Deutsch und Welsch Bevor das Deutschschweiz-Bild untersucht wird, welches «L’Hebdo» vermittelt, soll zum Einstieg ein Blick auf die Beziehung zwischen deutsch- und französischsprachigen Schweizern geworfen werden. Christophe Büchi, langjähriger Romandie-Korrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung», bezeichnet das Verhältnis als «Nicht-Beziehung» (Büchi 2000: 16). Viele Schweizerinnen und Schweizer würden die anderen Landesteile kaum kennen, konstatiert er. Und dennoch – oder gerade deshalb – bestehen zahlreiche Stereotype über die andere Sprachregion. Während den Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ein «Tüchtigkeitsund Gründlichkeitswahn» zugesprochen wird (von der Weid / Bernhard / Jeanneret 2002: 66), ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 4 sagen die Romands von sich selbst, «sie arbeiten eher, um zu leben, während die Alemannen mehr lebten, um zu arbeiten» (ebd.). Doch nicht nur in der wahrgenommenen Mentalität, auch in Politik und Wirtschaft unterscheiden sich Deutschschweiz und Romandie (vgl. Büchi 2000: 15). So ist anzunehmen, dass der heute etablierte Begriff «Röstigraben» auf einer politischen Divergenz gründet. In Auseinandersetzungen um den Gotthardvertrag Anfang 20. Jahrhundert warfen die Deutschschweizer den Romands vor, «einen ‹Graben› zwischen den Landesteilen aufzuwerfen» (ebd.: 205). Während des Ersten Weltkriegs wurden die Begriffe «Kluft» und «Graben» schliesslich zu Alltagsbegriffen (vgl. ebd.: 210). Woher der Zusatz «Rösti» kommt, der in den 70er-Jahren erstmals als Metapher für die Unterschiede zwischen der deutsch- und französischen Sprachregion auftauchte (vgl. ebd.: 258), bleibt unklar. Noch heute treten politische Divergenzen zwischen Deutsch- und Westschweiz regelmässig bei nationalen Abstimmungen zu Tage. Besonders Fragen der Europapolitik spalten die Schweiz, beispielsweise bei den Abstimmungen über den Beitritt zum Völkerbund 1920 sowie zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Jahr 1992. In beiden Abstimmungen hat sich das Stimmverhalten zwischen Deutschschweiz und Romandie stark unterschieden (vgl. ebd.: 219 f.). Die tendenziell eher europhile Romandie (vgl. von der Weid / Bernhard / Jeanneret 2002: 31) stimmte in beiden Abstimmungen für einen Beitritt, während die Deutschschweiz 1992 noch geteilter Meinung war und 1992 dann eine klar ablehnende Haltung einnahm (vgl. Büchi 2000: 219 f.). Weiter besteht ein wirtschaftliches Gefälle zwischen den Schweizer Regionen; die Deutschschweiz wird meist als wirtschaftlich dominant betrachtet (vgl. ebd: 30). Ein Indiz dafür ist die Tatsache, dass die attraktivsten Wirtschaftsstandorte der Schweiz mehrheitlich in der Deutschschweiz liegen. Laut einem Ranking des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» liegen Zürich, Zug und Luzern auf den ersten Plätzen, die erste französischsprachige Stadt folgt mit Genf auf Rang sieben (vgl. Bilanz 2012). Eine wirtschaftliche Divergenz wird ausserdem an den Arbeitsmarktzahlen sichtbar. So betrug die Arbeitslosenquote 2012 in der Deutschschweiz durchschnittlich 2.4 Prozent, in der Romandie und im Tessin 4.2 Prozent (vgl. Staatssekretariat für Wirtschaft 2012: 7). Politisch und wirtschaftlich ist es schliesslich meist die Deutschschweiz, die sich durchsetzt. Dies ist durch ihre Majoritätsposition zu begründen. Wie die Bevölkerungsstatistik zeigt, sprechen 64 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung als Hauptsprache Deutsch, 20 Prozent Französisch (Bundesamt für Statistik 2005: 7). In der Schweizer Bundesverwaltung verstärkt sich dieses Ungleichgewicht: Nach einer aktuellen Untersuchung des «Hebdo» sind 84 Prozent der 199 einflussreichsten Beamten Deutschschweizer, nur 14 Prozent sprechen Französisch (Guillaume 2013: 22). Angesichts dieser minoritären Position der Romandie formuliert Büchi ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 5 überspitzt: «Die welsche Schweiz fürchtet, immer mehr zur Kolonie der deutschen Schweiz [...] zu werden» (2000: 15). 2. Theoretische Grundlagen Die Charakterisierung und Thematisierung des Anderen, beispielsweise einer bestimmten ethnischen, religiösen oder kulturellen Gruppe, ist ein Forschungsgebiet insbesondere der Sozialpsychologie. Sie befasst sich dabei in erster Linie mit der Theorie der sozialen Identität sowie der Stereotypenforschung. In den folgenden Unterkapiteln wird der Begriff des Stereotyps definiert und erläutert, ausserdem wird ein kurzer Überblick über das sozialpsychologische Konzept der sozialen Identität, insbesondere im Hinblick auf die soziale Kategorisierung, geboten. Abschliessend werden die psychologischen Phänomene im medienwissenschaftlichen Kontext verortet. 2.1 Stereotype Stereotype werden definiert als «sozial geteilte mentale Repräsentationen, deren Bedeutsamkeit darauf beruht, dass innerhalb eines Kulturraumes ein Konsens bezüglich der Eigenschaften besteht, die für eine Gruppe charakteristisch sind» (Freytag / Fiedler 2007: 72). Stereotype sind folglich bestimmte sozial geteilte Vorstellungen über Gruppen und ihre Mitglieder. Diese Gruppen werden durch ein bestimmtes Merkmal definiert, welches sie von einer anderen Gruppe unterscheidet, sei dies beispielsweise die Nationalität, die Sprache, der Beruf, das Geschlecht, eine körperliche Eigenschaft (z.B. Haarfarbe oder Körpermasse) oder eine politische, soziale oder religiöse Einstellung (vgl. Hinton 2000: 7). Besonders weit verbreitet sind nationale bzw. ethnische Stereotype, weshalb sie auch das wohl meistuntersuchte Gebiet innerhalb der Stereotypenforschung darstellen (vgl. Hahn 2002: 18). Dabei wird zwischen Auto- und Heterostereotyp unterschieden: Ersteres meint das Selbstbild einer Gruppe, Letzteres das Fremdbild (vgl. ebd.: 28). Obwohl der Begriff des Stereotyps oftmals synonym zu den Begriffen Vorurteil und des Klischee verwendet wird, bestehen zwischen diesen sozialpsychologischen Phänomenen Unterschiede. Klischees lassen sich als «Einzelelemente stereotyper Vorstellungen» betrachten (Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 10). Vorurteile sind im Gegensatz zu Stereotypen emotionale Bewertungen (vgl. Appel 2008: 316). Sie sind immer negativ geprägt und beziehen sich nicht nur auf Gruppen, sondern auch auf Individuen (vgl. Herzog 2006: 329). Stereotype hingegen können positiv oder negativ konnotiert sein (vgl. Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 12). Der Begriff des Stereotyps stammt ursprünglich aus dem Druckwesen und bezeichnet ein Verfahren, «bei dem fest zusammengefügte Druckplatten bestimmte Textteile immer wieder reproduzieren konnten» (Herzog 2006: 329). Erstmals in wissenschaftlichem Zusammenhang ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 6 verwendet wurde der Begriff von Journalist und Medienkritiker Walter Lippmann. Er sprach von Stereotypen als «Bilder von der Welt», also als kollektive Vorstellungen, die in den Köpfen der Menschen vorhanden sind (vgl. Lippmann 1964: 27 f.). Stereotype funktionieren dabei nach dem Prinzip der Verallgemeinerung bzw. der «Übergeneralisierung» (vgl. Hinton 2000: 11): Bestimmte Eigenschaften werden allen Mitgliedern einer bestimmten Gruppe zugesprochen. Dadurch reduzieren Stereotype Komplexität (vgl. Herzog 2006: 329). «Denn die reale Umgebung ist insgesamt zu gross, zu komplex und auch zu fliessend, um direkt erfasst zu werden» (Lippmann 1964: 18). Stereotype erfüllen somit eine zentrale «Wahrnehmungs- und Orientierungsfunktion» (Thomas / Chang 2007: 213). Eine weitere Funktion von Stereotypen ist ausserdem, die Vorzüge der eigenen Gruppe zu betonen und damit ein positives Selbstbild zu erzeugen (vgl. Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 16). Deshalb weisen Stereotype tendenziell eher negative Konnotationen auf (siehe dazu auch Kapitel 2.2). Stereotype entstehen und existieren unabhängig von persönlichen Erfahrungen. Sie werden über Generationen weitergegeben (vgl. Herzog 2006: 329) Laut Ehrlich sind sie Bestandteil des «sozialen Erbes einer Gesellschaft» und folglich relativ stabil (vgl. (Ehrlich 1979: 47). Diese Stabilität weise darauf hin, dass «weder kognitive Prozesse noch zugrundeliegende Aspekte der Wahrnehmung oder der Persönlichkeit allein» für Stereotype verantwortlich gemacht werden können (ebd.: 31). Oder wie es Lippmann beschreibt: «Meist schauen wir nicht zuerst und definieren dann, wir definieren erst und schauen dann» (1964: 63). Dennoch heisst das nicht, dass zwangsläufig alle Mitglieder einer Gruppe dieselben stereotypen Vorstellungen über eine andere Gruppe teilen. Mitberücksichtigt werden müssen auch «Faktoren wie Bildungsniveau, kulturelle Nähe oder Alter bei der Bildung und Aufrechterhaltung von Stereotypen» (Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 13). 2.2 Soziale Identität In engem Zusammenhang mit der Theorie der Stereotypisierung steht das Konzept der sozialen Identität, welches von den Sozialpsychologen Henri Tajfel und John C. Turner in den 1970erJahren etabliert wurde. Soziale Identität meint einen Teil des Selbstbildes von Individuen, das aus dem Wissen ihrer Zugehörigkeit zu einer oder mehreren sozialen Gruppen resultiert (vgl. Tajfel 1978: 63). Die sogenannte soziale Kategorisierung («social categorization») ist folglich zentral für die Identität von Menschen. Sie ist «a system of orientation which helps to create and define the individual’s place in society» (ebd.). Ausserdem stellt sie, wie Stereotype, ein Mittel zur Komplexitätsreduktion dar: «Categorization is also a simplification and the simplification is required because of the limitation of human cognition (Hinton 2000: 55). Dabei spielen verschiedene Gesetzmässigkeiten in den Prozess der sozialen Kategorisierung hinein. Einerseits besteht aufgrund des steten Bedürfnisses nach einem positiven Selbstbild die Tendenz, die eigene Gruppe («ingroup») positiver wahrzunehmen und darzustellen als die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 7 anderen Gruppen, zu welcher der Betrachter nicht gehört («outgroups»). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die sogenannten «outgroups» und deren Mitglieder im Verhältnis zur «ingroup» tendenziell eher negativ wahrgenommen werden («Sie sind weniger gut/schlau/fleissig als wir», vgl. ebd.: 24). Hinton spricht dabei von «ingroup favouritism» und «outgroup discrimination» (ebd.: 112), Phänomene, welche in Dutzenden von sozialpsychologischen Experimenten nachgewiesen werden konnten (z.B. Tajfel / Billig / Bundy 1971 oder Turner 1975). Nebst dem «ingroup favouritism» (bzw. der «outgroup discrimination») kann ein zweites Phänomen der sozialen Identität bzw. der sozialen Kategorisierung identifiziert werden. Es beschreibt die Tendenz, Unterschiede zwischen der «ingroup» und der «outgroup» zu betonen, während Differenzen zwischen den Mitgliedern innerhalb der Gruppen unterbewertet werden: «(...) the cognitive process of categorization emphasizes the difference between groups, so ingroup members can view outgroup members as more different than they really are: they are not like us. Furthermore, with differences within groups underestimated, ingroup members can see the outgroup members as more similar than they really are: they are all the same» (Hinton 2000: 114). «Outgroups» werden aus Sicht der «ingroup» also verallgemeinernd («Alle sind gleich») wahrgenommen. Ausserdem werden durch die Kategorisierung Individuen eher stereotyp betrachtet. Ehrlich schreibt dazu: «Der Prozess der Einordnung eines sozialen Objekts in eine soziale Kategorie hat zur Folge, dass seine individuellen Unterschiede vermindert, seine kategorialen Merkmale jedoch hervorgehoben werden» (Ehrlich 1979: 51). 2.3 Medienwissenschaftlicher Kontext Stereotype sind nicht abhängig von persönlichen Erfahrungen (vgl. Herzog 2006: 329), sondern basieren häufig auf Sekundärerfahrungen; die Informationen über eine bestimmte Gruppe stammen also meist aus zweiter Hand (vgl. Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 17). Daher spielen Medien als Verbreiter und Übermittler von Stereotypen eine zentrale Rolle. Sie «halten Stereotype verfügbar, sie tradieren in einer Gesellschaft vorhandene Stereotype durch die explizite Darstellung» (Appel 2008: 324). Weiter können Medien die «kognitive Zugänglichkeit stereotyper Informationen und Beispiele» erhöhen (vgl. ebd.). Es ist somit anzunehmen, «dass Massenmedien unser Welt- und Menschenbild nachhaltig prägen» (Thomas / Chang 2007: 218). Wie Herzog schreibt, finden sich nationale, regionale sowie insbesondere auch geschlechterspezifische Stereotype in Informations- wie Unterhaltungsangeboten (vgl. Herzog 2006: 330). Medien greifen dabei auf Stereotype und soziale Kategorisierungen zurück, weil sie auf Mittel der Komplexitätsreduktion angewiesen sind. Medien haben die Aufgabe, komplexe ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 8 gesellschaftliche Phänomene und Prozesse zu vereinfachen und zu verallgemeinern, um sie einem breiten Publikum verständlich darlegen zu können (vgl. Wuerth 1999: 82). Stereotype müssen in Medien jedoch nicht immer explizit genannt werden (z.B. «Alle Deutschschweizer sind pünktlich»). Bereits durch die Selektion von Inhalten werden implizite Stereotypisierungsprozesse in Gang gesetzt. Schiffer (2005) hat dies anhand der deutschen Berichterstattung über den Islam untersucht. Ihr Fazit: Durch das Auswählen bestimmter Meldungen und Fakten entstehen Stereotype, «die pars pro toto für die ganze Wahrheit gehalten werden» (Schiffer 2005). Ergänzend könnte man nebst der Selektion bestimmter Inhalte auch die Selektion bestimmter Akteure und Eigenschaftszuschreibungen nennen, welche das Bild einer Person oder Personengruppe durch die regelmässige Darstellung prägen und stereotypisieren. Oftmals wird sich ein Journalist gar nicht bewusst sein, dass die Eigenschaften, die er einer Person oder Personengruppe in einem Bericht zuschreibt, auf Stereotypen beruhen. Schliesslich verfügen Journalisten wie alle Menschen über stereotype Vorstellungen, die sie und ihre Arbeit (unbewusst) prägen. 3. Forschungsfragen und Hypothesen Die übergreifende Leitfrage der vorliegenden Untersuchung lautete: LF: Wie sieht das Bild aus, das «L’Hebdo» in seiner Berichterstattung von der Deutschschweiz und ihren Bewohnern zeichnet? Dazu wurden, ausgehend von den im Kapitel 3 dargelegten theoretischen Überlegungen, folgende Forschungsfragen und Hypothesen formuliert: F1: Wie wird die Deutschschweiz und wie werden die Deutschschweizerinnen und Deutschweizer in den untersuchten Artikeln konnotiert und explizit charakterisiert? F2: Wie wird das Verhältnis zwischen Romandie und Deutschschweiz in den untersuchten Artikeln explizit charakterisiert? F3: Auf welche Themengebiete fokussieren die Artikel über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer? F4: Welche Akteure kommen in den untersuchten Artikeln über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer zu Wort bzw. stehen im Zentrum des Artikels? H1.1: Explizite Stereotype werden selten angesprochen. H1.2: Die Deutschschweiz sowie die Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer werden eher negativ oder neutral konnotiert. H2: Es wird eher die Verschiedenheit betont als die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Sprachregionen. H3: In den Artikeln über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer geht es primär um politische und wirtschaftliche Themen. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann H4.1: 9 In den Artikeln über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer kommen mehr Akteure aus der Romandie zu Wort als solche aus der Deutschschweiz. H4.2: Steht eine Person oder Personengruppe in Vordergrund eines Artikels, ist sie in einer Mehrheit der untersuchten Artikel den Themenbereichen Politik und Wirtschaft zuzuordnen. 3.1 Herleitung Die Hypothesen 1.1, 1.2 und 2 leiten sich aus theoretischen Erkenntnissen ab, welche im vorangehenden Kapitel erläutert wurden. H1.1 geht von der Annahme aus, dass nicht primär explizite Stereotype, sondern eher implizite Stereotypisierungsprozesse die mediale Berichterstattung über die «outgroup» prägen (vgl. Kapitel 2.3). Damit sind unter anderem die Selektion von Themen und Akteuren sowie die Auswahl der in der Berichterstattung erwähnten Eigenschaften und Charakterzüge von Individuen der «outgroup» gemeint, die schliesslich das Bild der Rezipienten über die andere Gruppe prägen. Diese Aspekte sollen denn auch durch die Forschungsfragen 3 und 4 analysiert werden. Die Hypothesen 3 und 4.3 beziehen sich auf die thematische Orientierung des «L’Hebdo». Die Zeitschrift bezeichnet sich selbst als «Newsmagazin», das sich «primär an Führungskräfte und Unternehmer richtet» (Ringier 2013). Politische wie auch wirtschaftliche Themen sollten somit einen relevanten Teil der Berichterstattung darstellen. Weiter können H3 und H4.3 dadurch begründet werden, dass Politik wie auch Wirtschaft Gebiete darstellen, auf denen die deutschund französischsprachige Schweiz starke Unterschiede aufweisen (siehe Kapitel 1.3). Da Medien laut Nachrichtenwerttheorie (vgl. u.a. Lippmann 1964 und Warren 1944) in ihrer Berichterstattung ausserdem bevorzugt Konflikte ansprechen („Konflikt“ als ein sog. «Nachrichtenwert»), scheint es plausibel, dass im «L’Hebdo» vermehrt differenzbetonende und folglich oftmals konflikthaltige Themen aus Politik und Wirtschaft angesprochen werden. Die Hypothese 4.1 wurde aufgrund praktischer Kenntnis der Medienwelt formuliert. So ziehen es Journalisten aus Gründen der Einfachheit und des besseren Verständnisses meist vor, Akteure aus derselben Sprachregion zu kontaktieren, statt den Schritt über die Sprachgrenze zu wagen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, soll eine systematische Analyse der Texte zeigen, wie sie in dieser Arbeit vorgenommen wird. 4. Methodik Um die Forschungsfragen zu beantworten sowie die Hypothesen zu überprüfen, wurden quantitative und qualitative Methoden kombiniert. An eine quantitativ orientierte Inhaltsanalyse anknüpfend wurde eine qualitativ orientierte Textanalyse von ausgewählten Artikeln durchgeführt. Dadurch wurde gewährleistet, dass einerseits messbare, numerische Ergebnisse ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 10 gewonnen werden können, andererseits genügend Raum für die offene, vertiefte Analyse von Artikeln besteht – unabhängig von Variablen und Kategorienausprägungen. So soll eine möglichst valide Untersuchung garantiert werden. Dieses Vorgehen wurde anlehnend an die Methodik eines Nationalfonds-Forschungsprojekts zu einem vergleichbaren Thema konzipiert, bei dem ebenfalls quantitative und qualitative Analysen zur Untersuchung von Stereotypen und Wahrnehmungen verbunden und «zu einer Gesamtperspektive» kombiniert wurden (vgl. Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 82). 4.1 Inhaltsanalyse Als primäre Untersuchungsmethode wurde die in den empirischen Sozialwissenschaften bewährte Methode der deskriptiven Inhaltsanalyse gewählt. Eine Inhaltsanalyse dient der «systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen» (Früh 2011: 27). Die Methode ist geeignet für die vorliegende Arbeit, da sie zulässt, eine relativ grosse Menge von Artikeln systematisch nach bestimmten Gesichtspunkten zu untersuchen. Laut Früh reduziert eine Inhaltsanalyse Komplexität, indem «Textmengen hinsichtlich theoretisch interessierender Merkmale klassifizierend beschrieben» werden (ebd.: 42). Das Ergebnis sind folglich numerische, statistisch auswertbare Daten. Die Inhaltsanalyse basierte auf einem umfangreichen Codebuch, das als Auswertungsraster für die Analyse der Artikel diente (siehe Anhang Forschungsfragen und Hypothesen in «Codebuch/Codieranleitung»). Dafür sind insgesamt 57 Variablen mit entsprechenden Merkmalsausprägungen operationalisiert worden (siehe Anhang «Operationalisierung»). Nebst kategorialen Variablen wurden dabei bewusst auch Variablen verwendet, die keine Ausprägungen vorgeben, sondern die Eingabe von Wörtern, Text- und Satzpassagen aus den analysierten Artikeln erlauben. Dies erhöhte zwar die Komplexität einer anschliessenden Auswertung, da die codierten Inhalte nachträglich systematisiert werden mussten, ermöglichte jedoch eine dem Text gegenüber offenere Analyse, welche nicht durch vorgegebene Kategorien eingeschränkt war. Ein Teil der Inhaltsanalyse widmete sich der Untersuchung expliziter Stereotype in den Artikeln. Um eine möglichst hohe Intersubjektivität in der Auswahl der Stereotype über die Deutschschweiz bzw. die DeutschschweizerInnen zu erhalten, sind im Vorfeld der Inhaltsanalyse zwei Westschweiz-Korrespondenten zu in der Romandie vorhandenen Stereotypen über die Deutschschweiz und ihre Bewohnerinnen und Bewohner befragt worden. Ausserdem wurden Literatur und Artikel zur «Röstigraben»-Thematik konsultiert. Die dadurch gewonnene Sammlung an Stereotypen wurde anschliessend für die Inhaltsanalyse kategorisiert (siehe Anhang «Explizite Stereotype der Deutschschweiz»). ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 11 Die Analyse expliziter Stereotype bildete jedoch nur einen relativ kleinen Teil der gesamten Inhaltsanalyse. Weiter wurden Variablen in das Codebuch integriert, die auch eine Untersuchung von impliziten Stereotypisierungsprozessen in der Berichterstattung ermöglichen. Damit ist im vorliegenden Zusammenhang gemeint, dass die Analyse einer grösseren Menge an Artikeln erlaubt, über einzelne Texte hinausgehende Tendenzen zu erkennen, welche die Berichterstattung über die Deutschschweiz prägen und so möglicherweise zu einem stereotypen Bild der Deutschschweiz führen (vgl. Kapitel 2.3). Es wurden deshalb Fragestellungen, Hypothesen und entsprechende Variablen formuliert, welche sich auf die Untersuchung der Selektion von Themen, Akteuren und Eigenschaftszuschreibungen konzentrieren. Für die inhaltsanalytische Untersuchung Letzterer wurde auf ein Raster des USamerikanischen Soziologen Howard Ehrlich (1979) zurückgegriffen, welches ursprünglich entwickelt wurde, um ethnische und rassistische Stereotype zu analysieren. Das Raster klassifiziert häufig verwendete Adjektive in 14 Gruppen und wurde bereits für vergleichbare Analysen von nationalen Stereotypen in Presseerzeugnissen verwendet (vgl. z.B. Arend / Lamprecht / Stamm 1999). Für die vorliegende Analyse wurde es leicht modifiziert (siehe Anhang «Klassifizierung von Eigenschaftszuschreibungen») und sollte dazu dienen, die Eigenschaftszuschreibungen an Personen, die in einem untersuchten Artikel im Zentrum stehen (z.B. «XY est une personne très organisée» oder «YZ est conservateur»), systematisch zu sammeln und zu analysieren. Eine möglichst hohe (Inter-)Reliabilität der Inhaltsanalyse wurde durch die strikte Offenlegung des methodischen Vorgehens, insbesondere des Codebuchs sowie der möglichst exakt formulierten Codierregeln, versucht zu erreichen. Was die Objektivität der Untersuchung betrifft, so ist festzuhalten, dass bewusst gewisse subjektive Variablen in das Codebuch integriert wurden. Denn eine möglichst objektive Analyse, beschränkt beispielsweise auf das Auszählen von in den Artikeln genannten Schlüsselbegriffen, hätte zwangsläufig eine geringere analytische Tiefe mit sich gebracht. Da im vorliegenden Fall jedoch eine detaillierte, nicht nur die Textoberfläche betreffende Analyse höher gewichtet wurde als eine möglichst hohe Objektivität der Untersuchung, wurden einzelne subjektive Variablen bewusst zugelassen. Diese wurden im Codebuch jedoch explizit als solche deklariert. Ausserdem fokussierte die anschliessende Textanalyse auf diese Variablen, um exemplarisch und angelehnt am Text Begründungen für subjektive Einschätzungen zu liefern. 4.1.1 Sample Als Sample (Auswahleinheit) der Inhaltsanalyse wurden alle Artikel berücksichtigt, die zwischen dem 1.1.2010 und dem 31.12.2012 im «L’Hebdo» publiziert wurden und das Stichwort «Suisse alémanique», «alémanique» oder einen bedeutungsähnlichen Begriff beinhalten. Dazu wurde folgender Suchstring festgelegt: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 12 «suisse alémanique» OR «suisse allemand» OR «suisse allemande» OR «suisse allemands» OR «suisse allemandes» OR «alémanique» OR «alémaniques» Mit diesem Suchstring konnten in der Schweizer Mediendatenbank SMD 509 Artikel herausgefiltert werden. Aus pragmatischen Gründen wurde dieses Sample jedoch künstlich auf 200 Artikel verkleinert, indem eine Zufallsauswahl getroffen wurde. Pro Jahr (2010, 2011 und 2012) wurden, aufsteigend nach Datum sortiert, alle Artikel mit den Ziffern 1 bis 5 laufend durchnumeriert. Anschliessend wurden jeweils die Artikel mit den Nummern 1 und 3 ausgewählt, was zu einer Auswahl von 205 Artikel führte. Darunter befanden sich neun Leserbriefe, welche nicht in die Inhaltsanalyse miteinbezogen wurden, da sie keine redaktionellen Beiträge darstellen. Deshalb wurden diese aussortiert und durch vier zufällig ausgewählte Artikel (der letzte des Jahres 2010, der zweitletzte des Jahres 2011 sowie die zwei letzten des Jahres 2012) ersetzt, sodass die gewünschte Sample-Grösse von 200 Artikeln erreicht wurde. Jeder dieser 200 Artikel bildete eine Untersuchungseinheit, wurde also als Ganzes einer Codierung unterzogen. Bestand ein Artikel aus mehreren Elementen wie einem Lauftext, einem Kurzinterview und einer Umfrage, wurde nur dann der ganze Komplex analysiert, wenn die Deutschschweiz bzw. ein Deutschschweizer oder eine Deutschschweizerin in allen Teilen thematisiert wurde. Ging es jedoch nur in einem Element um die Deutschschweiz oder eine Deutschschweizer Person, wurde nur dieses Element als Untersuchungseinheit betrachtet. Die Kontexteinheit wurde deckungsgleich zur Untersuchungseinheit definiert. 4.2 Textanalyse Als Ergänzung zur quantitativ orientierten Inhaltsanalyse wurde in einem zweiten Schritt eine qualitative Analyse von 15 ausgewählten Artikeln durchgeführt. Denn «a content analysis summarizes rather than reports all details concerning a message set» (Neuendorf 2002: 15). Eine Textanalyse ermöglichte hingegen, Artikel detaillierter und vertiefter zu analysieren – auf sprachlicher und inhaltlicher Ebene. Die zu analysierenden Artikel wurden subjektiv ausgewählt, als Hauptkriterium galt das persönlich beurteilte Potential für eine tiefergreifende Analyse. Trotz Offenheit der Methode wurde die Textanalyse systematisch und anhand bestimmter Leitfragen durchgeführt (siehe Anhang «Vorlage Textanalyse»). Diese basierten, um die Konsistenz der Untersuchung zu gewährleisten, grösstenteils auf Variablen der Inhaltsanalyse, ermöglichten durch das Fehlen vorgegebener Kategorien jedoch die freie Formulierung von Auffälligkeiten. Die durch die Textanalyse gewonnenen Erkenntnisse dienten dazu, gewisse Resultate der Inhaltsanalyse exemplarisch aufzeigen und vertiefen zu können. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 13 5. Auswertung Insgesamt wurde in 133 der 200 Artikel der Stellenwert der Deutschschweiz bzw. eines Vertreters oder einer Vertreterin der Deutschschweiz als zentral oder relevant eingestuft (67%). Diese Artikel wurden eingehend analysiert und bilden die Basis für die vorliegende Auswertung. Weiter stand in 26 Artikeln eine Person oder Personengruppe aus der Deutschschweiz im Zentrum. Dieses Teilsample wurde für die Analyse der personenspezifischen Fragestellungen und Hypothesen verwendet. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Inhalts- und Textanalyse gegliedert nach Forschungsfragen und Hypothesen dargestellt. Die beiden methodischen Zugänge werden dabei kombiniert, indem die durch die Inhaltsanalyse gewonnenen quantitativen Daten teilweise mit qualitativen Ergebnissen der Textanalyse illustriert werden. Auswertungen aller Variablen sowie die einzelnen Textanalysen finden sich im Anhang. 5.1 Charakterisierung und Konnotation F1: Wie wird die Deutschschweiz und wie werden die Deutschschweizerinnen und Deutschweizer in den untersuchten Artikeln konnotiert und explizit charakterisiert? H1.1: Explizite Stereotype werden selten angesprochen. H1.2: Die Deutschschweiz sowie die Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer werden eher negativ oder neutral konnotiert. Hypothese 1.1 hat sich in der Nennung expliziter Stereotypen vorliegenden Eigenschaften der Solidität (fleissig, arbeitsam etc.) ökon. Eigenschaften (sparsam, geizig etc.) neg. Beziehungseigenschaften (unnahbar, verschlossen,… zeitl. Eigenschaften (pünktlich) pol. Eigenschaften (konservativ, euroskeptisch… 0 Anzahl Artikel mit Nennung(en) Untersuchung als zutreffend erwiesen. In 96 % der Artikel wird kein Stereotyp genannt. Kommt ein Stereotyp zur Sprache, so ist es meist ein «Stereotyp der Solidität» (z.B. Deutschschweizer sind arbeitsam, 2 4 6 8 10 Anzahl Nennungen insgesamt Abb. 1 Nennung expliziter Stereotypen (n Artikel = 133, Mehrfachnennungen möglich). fleissig, ambitioniert, vgl. Abb. 1 sowie für eine vollständige Auflistung Anhang «Nennung von Stereotypen»). Abgesehen von der Erwähnung von Stereotypen wird die Deutschschweiz in 14 % der Artikel weiter charakterisiert (siehe Anhang «Weitere Charakterisierung DCH»). Meist betreffen diese Charakterisierungen Besonderheiten des Deutschschweizer Kulturschaffens (z.B. Beliebtheit von Dokumentarfilmen oder Personalpolitik von Theatern), des Alltagslebens (z.B. bevorzugte ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 14 Matratzenhärte, Form des Urinierens) oder der Medien (z.B. Umgang mit Prominenten), womit häufig Unterschiede zum Usus in der Romandie betont werden. Betrachtet man die Charakterisierung der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, so fällt auf, dass diese mit Abstand am meisten mit stereotypen («typisch deutschschweizerischen») Attributen umschrieben werden, insbesondere mit Eigenschaften der Solidität wie Fleiss, Pragmatismus und Ehrgeiz (vgl. Abb. 2, für eine vollständige Aufzählung siehe Anhang «Charakterisierungen DeutschschweizerInnen»). So wird Hildegard Fässler in einem Artikel mit einer Charakterisierung von Nationalratskollege Philipp Müller zitiert: «Très compétent, très indépendant, très travailleur» (Bellini 2012: 31). Charakterisierung DeutschschweizerInnen pos. Beziehungseigenschaften neg. Beziehungseigenschaften pos. moralische Eigenschaften neg. moralische Eigenschaften pos. intellektuelle Eigenschaften neg. intellektuelle Eigenschaften Eigenschaften der Solidität Eigenschaften der Unsolidität pos. politische Eigenschaften neg. politische Eigenschaften ökonomische Eigenschaften emotionale Eigenschaften andere Eigenschaften 0 5 10 Anzahl Artikel mit Nennung(en) 15 20 25 30 Anzahl Nennungen insgesamt Abb. 2 Charakterisierungen der DeutschschschweizerInnen, die im Zentrum von Artikeln stehen (n Artikel = 26, Mehrfachnennungen möglich). Positive moralische Eigenschaften wie Bescheidenheit, Respekt, Unabhängigkeit und Authentizität am zweithäufigsten zur Beschreibung von Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern genannt, gefolgt von positiv intellektuellen Eigenschaften wie Kompetenz und Neugier. Wie die Textanalyse zeigt, wird in einem Artikel ausserdem implizit durch Storytelling das zeitbezogene Stereotyp «Deutschschweizer sind pünktlich» – im vorliegenden Fall überpünktlich – angesprochen. So beginnt der Text folgendermassen: «Il n’est que 19 h 25 mais on attaque déjà le point pour 19 h 55. Pour qui connaît la lenteur des Konnotation Deutschschweiz 13% Konnotation DeutschschweizerInnen eher/stark positiv eher positiv 15% 15% eher/stark negativ neutral/ausgewogen/kein 72% e AngabeWissenschaften ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Abb. 4 Konnotation der Deutschschweiz (n = 133). 12% 0% stark positiv 46% eher negativ stark negativ IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft 27% neutral/ausgewogen Abb. 3 Konnotation der DeutschschweizerInnen (n = 26). Bachelorarbeit Lea Hartmann 15 réunions associatives ou législatives, avancer plus vite que l’ordre du jour tient du miracle» (Rumley 2011: 36). Bezüglich Konnotation ist zwischen der Deutschschweiz und Personen aus der Deutschschweiz eine Differenz festzustellen. Die Deutschschweiz wird in der Mehrheit der Fälle neutral, ausgewogen oder gar nicht konnotiert (72 %, vgl. Abb. 3). Die Anzahl Artikel, in welcher die Deutschschweiz positiv konnotiert wird (13 %), ist fast gleich gross wie die Anzahl Artikel mit negativer Konnotation (15 %). Aufgeschlüsselt nach Themenbereichen fällt auf, dass Artikel aus dem Gebiet der Politik häufiger negativ konnotiert werden als der Durchschnitt: 25 % der zum Feld der Politik zugehörigen Artikel sind eher bzw. stark negativ konnotiert (siehe Anhang «Kreuztabellen»). Im Gegensatz dazu sind Artikel aus dem Themenbereich Kultur in der Tendenz positiver konnotiert: 18 % der Artikel aus dem Feld der Kultur sind positiv konnotiert; kein einziger Artikel weist eine negative Konnotation auf. Kommentierende Artikel (Kommentare, Meinungen etc.) sind ausserdem rund dreimal häufiger eher bzw. stark negativ konnotiert als informierende Artikel wie Berichte, Nachrichten und Meldungen (siehe dazu ebenfalls Anhang «Kreuztabellen»). Was Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer betrifft, so beschreiben 73 % der Artikel die Personen aus dem anderen Landesteil eher oder sehr positiv – im Vergleich zu 27 % der Artikel mit negativer Konnotation (vgl. Abb. 4). Die Hypothese 1.2 wird somit nur teilweise bestätigt, betreffend Konnotation der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer sogar klar widerlegt. 5.2 Verhältnis Deutschschweiz/Romandie F2: Wie wird das Verhältnis zwischen Romandie und Deutschschweiz in den untersuchten Artikeln explizit charakterisiert? H2: Es wird eher die Verschiedenheit betont als die Gemeinsamkeit zwischen den beiden Sprachregionen. H2 wird für die vorliegende Analyse bestätigt. In Verhältnis DCH/FCH der Hälfte der Artikel werden eher bzw. stark Unterschiede zwischen den zwei Landesteilen thematisiert, im Vergleich zu 9 % der Artikel, in eher Unterschied 41% 35% denen es eher bzw. stark um Gemeinsamkeiten geht (vgl. Abb. 5). Vier von zehn Artikeln sprechen weder Unterschied stark Unterschied eher Gemeinsamkeit 1% 15% 8% noch stark Gemeinsamkeit keine Angabe/weder noch Gemeinsamkeit an. Ausserdem werden in 21 % Abb. 5 Thematisierung von Unterschieden oder der Artikel die Begriffe «Röstigraben» (bzw. Gemeinsamkeiten (n = 133). «barriere de rösti», «fossé de rösti» etc.) oder «outre-Sarine» genannt. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 16 Artikel, die dem Themenbereich Politik zugehörig sind, betonen am stärksten Unterschiede (60 %), gefolgt von Artikeln aus dem Gebiet der Gesellschaft (51 %, siehe Anhang «Kreuztabellen»). Nur 4 bzw. 7 % der Artikel dieser Themengebiete befassen sich mit Gemeinsamkeiten. Im Vergleich dazu befassen sich Artikel, die dem Gebiet der Kultur zugehörig sind, häufiger mit Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachregionen: In 14 % der Artikel geht es eher um Gemeinsamkeiten; 32 % der Artikel handeln von Unterschieden. Durch die Textanalyse zeigt sich, dass die Verschiedenheit auch auf sprachlicher Ebene betont wird. So werden häufig adversative Konjunktionen und Präpositionen (z.B. «alors que», «au contraire de», «à l’inverse») und komparative Konjunktionen (z.B. «plus que», «moins que») verwendet, um den Gegensatz Deutschschweiz/Romandie darzustellen: «Les médias alémaniques ont taillé dans les postes de correspondants en francophonie, alors que les journalistes romands ne restent nombreux à Zurich» (Rumley 2012: 22). «Au contraire des Romands, les unis alémaniques durcissent leurs conditions d’entrée» (CB 2011: 10). Aspekte des Verhältnisses Deutschschweiz/Romandie (pol.) Ungleichgewicht Trennung/Unterschied Minorität/Majorität Desinteresse DCH an FCH Überlegenheitsgefühl DCH Interesse/Respekt Kooperation/Gemeinsamkeit Kampf/Streit Unkenntnis DCH von FCH Ablehnung/Desinteresse FCH an DCH Unkenntnis gegenseitig Unkenntnis FCH von DCH 0 2 4 6 8 Anzahl Aussagen 10 12 Abb. 6 Angesprochene Aspekte bezüglich Verhältnis Deutschschweiz/Romandie, nachträglich kategorisiert (n = 56). An insgesamt 48 Textstellen wird das Verhältnis zwischen Deutschschweiz und Romandie ausserdem explizit charakterisiert (für eine vollständige Auflistung siehe Anhang «Verhältnis Deutschschweiz/Romandie). Einige Textstellen thematisieren mehrere Aspekte des Verhältnisses, sodass ein Total von 56 Aussagen resultiert. Mit elf Aussagen (20 %) am häufigsten thematisiert wird das (politische) Ungleichgewicht zwischen den zwei Landesteilen (vgl. Abb. 6). Unter diesem Begriff werden Aussagen zusammengefasst, welche von einer Vormachtstellung der Deutschschweiz, einer (politischen) Benachteiligung oder der politischen Unterrepräsentation der Romandie handeln. Ein Beispiel: «Sur la carte du pouvour helvétique, le confetti romand n'existe pas, nous le savons vous et moi. En politique suisse, les mots, les enjeux, les mythes fondateurs et les représentations du monde sont alémaniques» (Tauxe 2011: 62). ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 17 Am zweithäufigsten sind Aussagen, die Unterschiede zwischen den Sprachregionen hervorheben oder die Trennung der Landesteile («zwei Welten») betonen, gefolgt von Aussagen, welche die Minoritäts-/Majoritätsbeziehung zwischen Romandie und Deutschschweiz ansprechen. Insgesamt handeln zehn von zwölf Aspekten von einem von Differenzen und Desinteresse geprägten Verhältnis (in Abb. 6 dunkelrot markiert). Nur bei zwei von zwölf Aspekten (Interesse/Respekt und Kooperation/Gemeinschaft) geht es um ein Verhältnis, welches eher Gemeinsamkeiten bzw. das Interesse am Anderen betont (hellrot markiert). Weiter fällt auf, dass insgesamt dreimal so viele Aussagen Unkenntnis und Desinteresse von Seiten der Deutschschweiz an der Romandie (9) thematisieren als umgekehrt (3). Wie Abb. 6 weiter zeigt, wird das Verhältnis Deutschschweiz/Romandie in drei Äusserungen explizit als Kampf oder Streit charakterisiert. Durch die Textanalyse wird jedoch evident, dass auch an mehreren weiteren Stellen indirekt durch die Verwendung bestimmter Formulierungen Konflikte angesprochen werden. So werden mehrfach Begriffe aus dem Wortfeld Konflikt (Streit, Kampf, Krieg) gebraucht, wenn es um die Beschreibung der Beziehung Deutschschweiz/Romandie geht. Nomen wie «guerre», «combat» oder «dissension» sowie Verben wie «lutter» oder «se battre» finden Verwendung: «Après des années de batailles acharnées» (Logean 2012: 22). «les Alémaniques (...) luttent contre notre modèle» (ebd.). «Depuis des décennies, les Latins se battent pour que les entreprises de leurs cantons obtiennent davantage de commandes de la Confédération» (Guillaume 2012: 22). «Yvan Perrin se bat au sen de son parti pour des projets d’infrastructure romands. Il est rarement écouté par sa centrale à Berne» (Guillaume 2010: 35). In den letzten zwei Textpassagen wird ausserdem eine weitere Auffälligkeit deutlich: In mehreren Artikeln wird nicht unmittelbar die Deutschschweiz als Gegnerin der Romandie dargestellt, sondern Deutschschweizer die Schweizerische Interessen. Bundesbern Eidgenossenschaft wird in den als Vertreterin betreffenden Artikeln von zum übermächtigen Kontrahenten der Romandie, der den westlichen Landesteil ignoriert oder dessen Interessen bewusst übergeht. Entsprechend dazu wird die Romandie als Kämpferin für ihre politischen Interessen dargestellt. 5.3 Themen F3: Auf welche Themengebiete fokussieren die Artikel Hauptthema Artikel über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer? H3: In den Artikeln über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Politik 7% 17% 36% Deutsch- Wirtschaft Gesellschaft 30% 10% Kultur Anderes ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 18 schweizer geht es primär um politische und wirtschaftliche Themen. H3 kann für die vorliegende Analyse teilweise bestätigt Abb. 7 Hauptthema der Artikel (n = 133). werden. Zwar ist eine Mehrzahl der Artikel (36 %, vgl. Abb. 7) dem Themengebiet Politik zuzuordnen, Wirtschaft steht jedoch nur in jedem zehntem Artikel im Vordergrund. Mit 30 % bzw. 17 % wesentlich häufiger vertreten sind Artikel, die den Themenbereichen Gesellschaft oder Kultur angehören. Knapp ein Viertel der Artikel, die dem Themengebiet zitierte Personen: Herkunft Politik zugehörig sind, behandeln zur Hauptsache eine politische Persönlichkeit wie eine Nationalrätin, einen Bundes- oder Regierungsrat (siehe 250 Anhang «Nachträgliche Kategorisierung Unterthema»). An zweiter 200 Stelle stehen Artikel über Abstimmungen, Wahlen und Initiativen. Was den Bereich Gesellschaft betrifft, so geht gefolgt von Themen aus den Bereichen Bildung und Anzahl es in einer Mehrheit der Artikel um mediale Themen, 150 100 Kulturen/Sprachen. Artikel, die dem Feld der Kultur angehören, befassen sich primär mit dem Unterthema Kunst. Texte aus dem Gebiet der Wirtschaft thematisieren 50 schliesslich überwiegend eine Persönlichkeit aus der 0 Wirtschaft (z. B. Unternehmer). 5.4 Akteure F4: Welche Akteure kommen in den untersuchten Artikeln über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer Abb. 8 Feststellbare Herkunft der in den Artikeln zitierten Personen (n Artikel = 133). zu Wort bzw. stehen im Zentrum des Artikels? H4.1: In den Artikeln über die Deutschschweiz sowie über Deutschschweizerinnen Personen: Themengebiet und Deutschschweizer kommen mehr Akteure aus Deutschschweiz. H4.2: 35% 38% Vordergrund eines Artikels, ist sie in einer der Themenbereichen untersuchten Politik und Artikel Wirtschaft Gesellschaft Steht eine Person oder Personengruppe in Mehrheit Politik 4% der Romandie zu Wort als solche aus der 15% 8% Kultur Anderes den Wirtschaft zuzuordnen. In der vorliegenden Untersuchung hat sich H4.1 klar Abb. 9 Themenzugehörigkeit der im Zentrum stehenden DeutschschweizerInnen (n = 26). bestätigt. Wie in Abb. 9 grafisch dargestellt, werden in den 133 analysierten Artikeln insgesamt ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 19 224 Romands indirekt oder direkt zitiert. Mit total 144 Personen werden Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer 35 % seltener zitiert. Wie Abb. 9 zeigt, hat sich H4.2 für die vorliegende Analyse hingegen nicht erhärtet. Die meisten Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer (38 %), die im Zentrum eines Artikels stehen, gehören dem Gebiet der Kultur an (v.a. Künstler, Musiker, Bands, siehe Anhang «Nachträgliche Kategorisierung Funktion»). Erst an zweiter Stelle folgen Vertreter der Politik (z.B. Parlamentarier, Parteipräsidenten); um Vertreter der Wirtschaft (Unternehmer) geht es gar nur in 8 % der Artikel, bei welchen eine Vertreterin oder ein Vertreter der Deutschschweiz im Zentrum steht. Doppelt so viele Artikel (15 %) befassen sich hingegen mit einer Persönlichkeit aus dem Themenbereich Gesellschaft (z.B. Historiker, Sportler). 6. Interpretation 6.1 Diskussion der Ergebnisse Im Folgenden werden die im vorangehenden Kapitel dargelegten Resultate diskutiert, indem sie den vorgängig dargelegten theoriebasierten Überlegungen gegenübergestellt und dabei mögliche Interpretationsansätze formuliert werden. 6.1.1 Diskussion der Fragestellung 1 Wie in H1.1 angenommen, hat die Auswertung gezeigt, dass nur sehr vereinzelt Stereotype in der Berichterstattung über die Deutschschweiz genannt werden (vgl. Kapitel 5.1). Doch wenn auch keine explizite Stereotypisierung stattfindet, so ist dennoch ein impliziter Stereotypisierungsprozess feststellbar (vgl. Kapitel 5.1): Durch die Charakterisierung und Selektion von Vertreterinnen und Vertretern der Deutschschweiz mit «typisch deutschschweizerischen» Eigenschaften der Solidität wird indirekt ein stereotypes Bild des Deutschschweizers/der Deutschschweizerin vermittelt. «L’Hebdo» tradiert Stereotype folglich zwar nicht durch eine explizite Darstellung (vgl. Appel 2008: 324, siehe Kapitel 2.3), dafür jedoch durch implizite Stereotypisierungsvorgänge, die erst durch eine systematische Analyse sichtbar werden und, so ist anzunehmen, das Bild der Deutschschweiz bei den Rezipienten ebenfalls stereotyp prägen. Die Betrachtung der Ergebnisse zu H1.2 zeigt, dass das Bild der Deutschschweiz ausserdem nicht so negativ ist, wie zuvor vermutet wurde (vgl. Kapitel 5.1). Diese Ergebnisse überraschen und widersprechen der Theorie der sozialen Identität, die besagt, dass «outgroups» tendenziell eher negativ konnotiert werden, da dadurch die eigene «ingroup» (hier: die Romandie) in einem besseren Licht erscheint (vgl. Kapitel 2.2). Es findet somit keine explizite «outgroup discrimination» statt. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 20 Das Ergebnis der vorwiegend neutralen bzw. ausgewogenen Berichterstattung über die Deutschschweiz könnte möglicherweise mit dem Anspruch vieler Medien, möglichst neutral bzw. ausgewogen zu berichten und die Wertung der Leserschaft zu überlassen, erklärt werden. Dies gilt selbstverständlich nicht primär für Artikel, die der kommentierenden Textsorte zugehörig sind. So zeigt sich denn auch, dass 50 % der kommentierenden Texte, aber nur 27 % der informierenden Artikel über eine Konnotation verfügen (siehe Anhang «Kreuztabellen»). Was die ausserordentlich positive Konnotation der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer betrifft, kann hingegen keine plausible Erklärung geliefert werden. Insbesondere auch in Anbetracht der Tatsache, dass Medien eher die Tendenz haben, über Negatives zu berichten (siehe Kapitel 3). Hier wären weitergehende Analysen, beispielsweise durch Leitfadeninterviews mit Mitarbeitenden der Redaktion, nötig, um mögliche Erklärungen für die hier gewonnenen Erkenntnisse zu finden. 6.1.2 Diskussion der Fragestellung 2 Im Gegensatz zu H1.2 hat sich bei H2 die Theorie der sozialen Identität klar bestätigt: 50 % der Artikel konzentrieren sich auf Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Romandie (vgl. Kapitel 5.2). Die «ingroup» (Romandie) wird dadurch homogenisiert (vgl. Hinton 2000: 114). Dies zeigt sich auch dadurch, dass die Romandie mehrfach mit dem Personalpronomen «nous» oder dem Possessivpronomen «notre» umschrieben wird, wodurch der Eindruck von Gemeinschaft («Wir-Gefühl») verstärkt wird. Dass der Unterschied Deutschschweiz/Romandie von der Westschweiz so stark artikuliert wird, ist laut Büchi wenig überraschend: «Eine Minderheit definiert sich dadurch, dass sie sich von der Mehrheit abgrenzt. Die Mehrheit dagegen genügt sich selbst. Die Minderheit sagt: ‹Ich bin nicht die Mehrheit.› Die Mehrheit ist einfach» (Büchi 2000: 229). Die Betonung von Unterschieden kann ausserdem durch die Nachrichtenwerttheorie begründet werden. Diese definiert die Thematisierung eines Konfliktes als ein zentrales Selektionskriterium (einen sog. «Nachrichtenfaktor») bei der Auswahl von Nachrichten (vgl. Lippmann 1964 sowie Kapitel 3.1). , Aufgrund dieser Vorliebe für konfliktuelle Themen, so folgert Büchi, unterlägen Medien somit auch der Tendenz, den «Röstigraben» zu thematisieren (vgl. Büchi 2000: 285). Was die weitere Charakterisierung des Verhältnisses zwischen Deutsch und Welsch anbelangt, ist festzustellen, dass das in Kapitel 1.3 erläuterte Ungleichgewicht bzw. das Majoritäts/Minoritätsverhältnis zwischen Deutschschweiz und Romandie – insbesondere in der Politik – in der Berichterstattung des «L’Hebdo» stark thematisiert wird (vgl. Kapitel 5.2). Die laut Büchi herrschenden Minderheitsängste der Romands (vgl. ebd.: 13) werden in der Berichterstattung des «L’Hebdo» deutlich (vgl. Kapitel 5.2). Ausserdem spiegelt sich darin die «Nicht-Beziehung» zwischen Deutsch und Welsch (vgl. ebd.: 16 sowie Kapitel 1.3). Desinteresse und Unkenntnis ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 21 von Seiten der Deutschschweiz werden dabei markant häufiger angesprochen als Desinteresse und Unkenntnis der Romandie an der Deutschschweiz. Büchi schreibt dazu: «Während die Romands fast permanent ihre Beziehung zur Deutschschweiz thematisieren (müssen?), ist dies für die meisten Deutschschweizer kaum ein Thema. [...] Viele Deutschschweizer ‹sehen das Problem nicht›. Und gerade darin liegt ein Teil des Problems» (ebd.: 12). Die eher negative, kritische Thematisierung der Deutschschweiz in Bezug auf das Verhältnis zur Romandie zeigt ausserdem, dass eine «outgroup discrimination» (vgl. Kapitel 2.2) somit zwar nicht durch die Charakterisierung der Deutschschweiz an sich stattfindet, jedoch dann sichtbar wird, wenn das Verhältnis «ingroup»/«outgroup» thematisiert wird. 6.1.3 Diskussion der Fragestellung 3 Bezüglich Themenwahl haben sich die aufgrund der thematischen Ausrichtung des «Hebdo» formulierten Annahmen nur teilweise bestätigt. Obwohl sich das Magazin nach eigenen Angaben «primär an Führungskräfte und Unternehmer richtet» (Ringier 2013, vgl. Kapitel 3.1), geht es nur in wenigen Artikeln über die Deutschschweiz um wirtschaftliche Themen. Dies überrascht insofern, als dass die Wirtschaft ein Gebiet ist, auf dem zwischen den Landesteilen markante Unterschiede bestehen (siehe Kapitel 1.3). Es kann jedoch vermutet werden, dass sich die Romandie trotz Unterschieden nicht so stark als Minorität sieht, wie dies im Bereich der Politik der Fall ist. So wird mehrfach positiv und mit Stolz über die Wirtschaftskraft der Romandie berichtet – trotz Unterschieden zur Deutschschweiz. In der Politik hingegen ist das Verhältnis zur Deutschschweiz deutlich negativer geprägt (vgl. Kapitel 5.1). Durch die Dominanz an Artikeln aus dem Bereich der Politik findet ausserdem indirekt eine Beeinflussung des Bildes der Deutschschweiz statt. Denn durch die bevorzugte Selektion von Artikeln dieses Themas, welches tendenziell eher bzw. stark negativ konnotiert ist (vgl. Kapitel 5.1), wird ein tendenziell negatives Bild der Deutschschweiz geprägt. 6.1.4 Diskussion der Fragestellung 4 Die Vermutung, dass aus Gründen der besseren Verständigung (Journalist/Journalistin und Drittperson sprechen dieselbe Sprache) eher Romands zitiert werden als deutschsprachige Personen, hat sich in der vorliegenden Untersuchung als zutreffend erwiesen (vgl. Kapitel 3.1 und 5.4). Das vermittelte Bild der Deutschschweiz basiert somit überwiegend auf Aussagen von Nicht-Deutschschweizern und wird fremdvermittelt. Angesichts dieses Ergebnisses ist die ausgewogene, oftmals neutrale Konnotation der Deutschschweiz noch erstaunlicher. Denn aufgrund des Konzepts der «outgroup discrimination» (siehe Kapitel 2.2) hätte angenommen werden können, dass Romands den deutschsprachigen Nachbarn eher negativ bewerten. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 22 Ebenfalls überraschend sind die Resultate zu H4.2 (vgl. Kapitel 5.4). In auffallend vielen Artikeln geht es nicht um Politiker und Vertreter der Wirtschaft, sondern um Deutschschweizer Kulturschaffende. Die überwiegend positive Konnotation dieser Personen entspricht dem Ergebnis von H1.2 (vgl. Kapitel 5.1), welches zeigte, dass bei Artikeln zum Thema Kultur im Vergleich zu Artikeln über politische Themen eine eher positive Konnotation festzustellen ist. Dies kann dadurch begründet werden, dass wohl kaum über «schlechte» Künstler und Ausstellungen berichtet wird (vgl. Arend / Lamprecht / Stamm 1999: 88), wohingegen die kritische Beobachtung und Kommentierung der Politik gar als zentrale Aufgabe der Medien betrachtet wird. Durch die Selektion von vornehmlich Deutschschweizer Kulturschaffenden, welche eher positiv konnotiert sind, findet folglich – in ähnlicher Weise wie in Kapitel 6.1.3 geschildert – eine Beeinflussung des Bildes der Deutschschweiz statt: Die Selektion prägt in diesem Fall ein tendenziell positives Bild der Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer. 6.2 Beantwortung der Leitfrage Wie sieht das Bild aus, das «L’Hebdo» in seiner Berichterstattung von der Deutschschweiz und ihren Bewohnern zeichnet? So lautete die übergreifende Leitfrage der vorliegenden Arbeit. Diese wird nun beantwortet, indem Ergebnisse sowie deren Diskussion zusammengefasst werden. Überblickend kann festgehalten werden, dass die Deutschschweiz in der Berichterstattung des «Hebdo» trotz regelmässiger kritischer Berichte meist neutral bzw. ausgewogen bewertet wird. Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer werden gar überwiegend positiv konnotiert (vgl. Kapitel 5.1). Auf die Verwendung von Stereotypen zur Beschreibung der Deutschschweiz verzichtet der «Hebdo» grösstenteils. Nur sehr selten werden explizite Stereotype wie «Deutschschweizer sind fleissig» verwendet Stereotypisierungsprozess (vgl. statt, Kapitel indem 5.1). Vielmehr Deutschschweizerinnen findet und ein impliziter Deutschschweizer auffallend häufig mit «typisch deutschschweizerischen» Attributen wie Pragmatismus, Fleiss und Ehrgeiz charakterisiert werden (vgl. Kapitel 5.1). Ausserdem beeinflussen Themen- und Akteurselektion das Bild der Deutschschweiz: Dadurch, dass mehrheitlich politische Themen, welche häufig negativ konnotiert sind, die Berichterstattung über die Deutschschweiz prägen, wird das wahrgenommene Bild der Deutschschweiz negativ beeinflusst. Was die Selektion von Personen betrifft, welche im Zentrum eines Artikels stehen, ist hingegen das Gegenteil festzustellen: Hier konzentriert sich die Berichterstattung vor allem auf Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer aus dem Feld der Kultur – ein Gebiet, welches eher positiv konnotiert ist. Somit heben sich die beiden auf die Selektion bezogenen Stereotypisierungsprozesse in ihrer Wirkung gegenseitig auf. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 23 Weit weniger neutral bzw. positiv als die Darstellung der Deutschschweiz und ihrer Bewohner wird das Verhältnis der Deutschschweiz zur Romandie im «Hebdo» bewertet. Hier überwiegt eine Haltung, welche die Beziehung Deutschschweiz/Romandie als problematisch und von einem (politischen) Ungleichgewicht geprägt darstellt (vgl. Kapitel 5.2). In diesem Zusammenhang werden Aspekte wie die Vormachtstellung der Deutschschweiz, die Benachteiligung, die politische Unterrepräsentation sowie die Minoritätsstellung der Romandie betont. Die Deutschschweiz wird als desinteressiert und unwissend im Hinblick auf die Romandie charakterisiert, das Verhältnis oft mit Begriffen wie Kampf, Streit oder gar Krieg umschrieben. In Beziehung zur Romandie wird die Deutschschweiz somit bedeutend kritischer dargestellt als bei alleiniger Betrachtung. Die Deutschschweiz wird ausserdem klar von der Romandie abgegrenzt: Nur in neun Artikeln geht es um eine Gemeinsamkeit zwischen französischer und deutscher Schweiz (vgl. Kapitel 5.2). Die Hälfte der Artikel befasst sich mit Unterschieden. Während Artikel zum Thema Kultur etwas häufiger Gemeinsamkeiten thematisieren und tendenziell positiv konnotiert sind, betonen insbesondere Artikel aus dem Themenbereich Politik Unterschiede und weisen eher negative Konnotationen auf. Der «Röstigraben» ist in der Berichterstattung des «Hebdo» folglich – auch wenn er nicht immer explizit erwähnt wird – allgegenwärtig. 7. Fazit Abschliessend wird ein Blick zurückgeworfen: Eine kritische Betrachtung von Methodik und Ergebnissen reflektiert den Analyseprozess, anschliessend werden mögliche weitere Forschungsansätze umrissen. Im Anschluss darauf folgt eine persönliche Reflexion, welche die vorab formulierten Ziele mit dem tatsächlich Erreichten vergleicht. 7.1 Kritische Betrachtung der Methodik «There is no such thing as true objectivity», hält Neuendorf (2002: 11) in ihrem Handbuch für Inhaltsanalysen fest. Dennoch wurde versucht, eine möglichst hohe Objektivität der Untersuchung zu erreichen, indem die Methodik durch eine ausführliche Dokumentation im Anhang offengelegt wird und Codieranweisungen sowie Kategoriendefinitionen formuliert wurden. Nichtsdestotrotz ist die Reliabilität der Untersuchung kritisch zu betrachten. Einerseits aufgrund von Variablen, die subjektive Wertungen miteinschlossen; andererseits aufgrund der Tatsache, dass nur eine Person codierte und somit keine Interreliabilitätstests durchgeführt wurden. Es kann deshalb sein, dass eine Wiederholung der Untersuchung durch andere Personen ein leicht abweichendes Ergebnis zu Tage fördern würde. Dies konnte jedoch aus Gründen beschränkter Ressourcen nicht verhindert werden. Ausserdem wurde zu Beginn bewusst der Entscheid getroffen, inhaltlich tiefergreifende Ergebnisse durch eine teilweise ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 24 subjektive Analyse einer rein objektiven, oberflächlicheren Untersuchung vorzuziehen (vgl. Kapitel 4.1). Was die Validität der Untersuchung betrifft, hat sich die Kombination von quantitativ und qualitativ orientierten Ansätzen bewährt. Die Inhaltsanalyse lieferte statistisch auswertbare Daten, die das Fundament für die Beantwortung der Fragestellungen bildeten. Die Textanalyse ermöglichte, statistische Daten und subjektive Einschätzungen durch konkrete Textstellen und die Identifikation inhaltlicher und sprachlicher Auffälligkeiten zu stützen. Im Hinblick auf eine nächste Textanalyse wäre jedoch zu überlegen, ein etwas systematischeres Untersuchungsdesign zu wählen. Bei der bescheidenen Menge von 15 Artikeln stellte die Auswertung der relativ offen gestalteten Textanalysen zwar noch kein Problem dar, bei einem grösseren Sample wäre eine systematische Auswertung jedoch schwierig. 7.2 Kritische Betrachtung der Ergebnisse Die Ergebnisse der Inhalts- und Textanalyse erwiesen sich als interessant und teilweise überraschend. Es stellte sich jedoch als schwierig heraus, insbesondere diese überraschenden Ergebnisse fundiert einordnen zu können. Oftmals konnten nur Vermutungen angestellt werden; es stellten sich Folgefragen, denen in weiteren Studien nachgegangen werden müsste. Die ursprünglich geplante Sample-Grösse von 100 Artikeln stellte sich ausserdem bereits während des Codierens als zu klein heraus, da bei rund einem Drittel der Artikel nur die ersten sechs Variablen codiert werden konnten. Deshalb wurde entschieden, das Sample zu verdoppeln. Der letzendliche Umfang des Samples erwies sich denn auch grösstenteils als ausreichend für eine analytische Betrachtung. Einzig bei der Untersuchung der Darstellung von Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern war eine Analyse problematisch, da nur 26 Artikel zur detaillierten Analyse zur Verfügung standen. Ein grösseres Sample wäre aufgrund des Umfangs des Codebuchs jedoch nicht realisierbar gewesen. Unabhängig von der Grösse muss angenommen werden, dass die Auswahl des Samples die Resultate teilweise beeinflusst hat. So wurden durch den Suchstring nur Artikel ausgewählt, in welchen die Deutschschweiz explizit angesprochen wird. Texte, die von der Schweiz als Ganzes sprechen, fielen durch das Selektionsraster. Somit wurde bereits durch die Wahl des Suchstrings eine tendenzielle Betonung von Unterschieden vorgenommen. Da jeder Suchstring per definitionem zu einer bestimmten Auswahl führt und folglich die Resultate beeinflusst, ist dies nicht als Defizit der Arbeit zu betrachten; jedoch muss man sich bei der Interpretation der Ergebnisse dieses Einflusses bewusst sein. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 7.3 25 Weitergehende Forschungsansätze Wie bereits erwähnt, lassen sich ausgehend von der vorliegenden Analyse weitere Fragestellungen formulieren, deren Untersuchung spannend wäre. So könnten durch Leitfadeninterviews oder durch eine Analyse der individuellen Deutschschweiz-Bilder (inkl. Stereotype) von Redaktoren des «Hebdo» eventuell Ansätze zur Begründung für die hier gewonnenen Ergebnisse gefunden werden. Weiter könnte die Rezipientenseite mittels einer Wirkungsanalyse untersucht werden: Welchen Einfluss hat die Berichterstattung auf der Deutschschweiz-Bild der Leserschaft? Als vergleichende Analyse wäre ausserdem interessant, das Bild der Romandie, welches der «Hebdo» zeichnet, zu untersuchen. Denn wie während des Codierens auffiel, wird die Deutschschweiz bzw. das Verhältnis Deutschschweiz/Romandie häufig indirekt durch die Beschreibung der Romandie charakterisiert. 7.4 Persönliche Reflexion Knapp ein halbes Jahr wurde für die vorliegende Arbeit recherchiert, Literatur verarbeitet, eine valable Methodik konzipiert, Analysen durchgeführt, ausgewertet sowie zusammengefasst und interpretiert. Das Ergebnis entspricht den Zielsetzungen der Autorin. Das zu Beginn der Arbeit formulierte Ziel, die Berichterstattung des «Hebdo» über die Deutschschweiz umfassend zu analysieren, wurde erreicht. Die latent vorhandene Befürchtung, das Sample könnte auch mit 200 Artikeln zu klein sein, um spannende Tendenzen in der Berichterstattung zu erkennen, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: Es konnten differenzierte Ergebnisse gewonnen werden, mit denen die Autorin nicht rechnete und welche weitere Fragen aufwarfen. Dies stellt jedoch auch eine Schwäche der Arbeit dar. Einige der überraschenden Resultate konnten durch die gewonnen Daten nicht fundiert begründet werden, sondern mussten, als mögliche weitergehende Forschungsansätze formuliert, stehen gelassen werden. Eine Herausforderung bildete ausserdem die französische Sprache. Der Übersetzungsaufwand war grösser, als ursprünglich gedacht. Mühe bereiteten insbesondere umgangssprachliche Formulierungen, Redewendungen oder auch die Tatsache, dass ein Wort meist verschiedene Übersetzungen besitzt, die sich in der Bedeutung – wenn auch meist nur leicht – unterscheiden. Die Überraschung angesichts einiger Ergebnisse spiegelt jedoch auch exemplarisch eine Erkenntnis der vorliegenden Arbeit: Die im «Hebdo» mehrfach angesprochene Unkenntnis der Deutschschweiz von der Romandie besteht wohl tatsächlich. Gleichzeitig hat die Untersuchung einen kleinen Teil dazu beigetragen, dieses Wissensdefizit zu verkleinern – nicht nur bei der Autorin, sondern hoffentlich auch bei all denjenigen, welche diese Arbeit lesen. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 26 IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 27 8. Quellenverzeichnisse 8.1 Literaturverzeichnis Arend, Michal / Lamprecht, Markus / Stamm, Hanspeter (1999): Die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland. Schlussbericht zum Projekt. In: http://www.lsweb.ch/fileadmin/lswebdateien/publikationen/NFP42_voll.pdf (09.04.2013). Appel, Markus (2008): Medienvermittelte Stereotype und Vorurteile. In: Batinic, Bernad (Hg.): Medienpsychologie. Heidelberg. Büchi, Christophe (2000): »Röstigraben» – Das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Schweiz. Geschichte und Perspektiven. Zürich. Corboud Fumagalli, Adrienne (1996): Une Suisse ou trois régions? les journaux télévisés. In: Medienwissenschaft Schweiz, H. 1, S. 11-17. Ehrlich, Howard (1979): Das Vorurteil – Eine sozialpsychologische Bestandesaufnahme der Lehrmeinungen amerikanischer Vorurteilsforschung. München / Basel. Freytag, Peter / Fiedler, Klaus (2007): Soziale Kognition und Urteilsbildung. In: Six, Ulrike et al. (Hg.): Kommunikationspsychologie – Medienpsychologie. Lehrbuch. Weinheim, S. 70-89. Grossenbacher, René / Forsberg, Thomas / Hüppin, Thomas (2012): Analyse der Radioprogramme der SRG SSR 2012. Bericht. In: http://www.publicom.ch/wp-content/ uploads/ber_SRG2012_def.pdf (14.07.2013). Früh, Werner (2011): Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis. Konstanz. Hahn, Hans Henning (2002): Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen. Frankfurt am Main. Herzog, Anja (2006): Stereotype. In: Hans-Bredow-Institut für Medienforschung (Hg.): Medien von A bis Z. Wiesbaden, S. 328-332. Hinton, Perry (2000): Stereotypes, cognition and culture. Hove. Lippmann, Walter (1964): Die öffentliche Meinung. München. Neuendorf, Kimberly A. (2002): The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks / London / Neu Delhi. Tajfel, Henri et al. (1971): Social categorization and intergroup behaviour. In: European Journal of Social Psychology 1, H. 2, S. 149-178. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 28 Tajfel, Henri (1987): Social categorization, social identity and social comparison. In: Tajfel, Henri (Hg.): Differentiation between social groups. Studies in the social psychology of intergroup relations. London, New York, San Francisco, S. 61-76. Thomas, Alexander / Chang, Celine (2007): Interkulturelle Kommunikation. In: Six, Ulrike et al. (Hg.): Kommunikationspsychologie – Medienpsychologie. Lehrbuch. Weinheim, S. 209229. Turner, John C. (1975): Social comparison and social identity: Some prospects for intergroup behaviour. In: European Journal of Social Psychology 5, H. 1, S. 5-34. Von der Weid, Nicolas / Bernhard, Roberto / Jeanneret, François (2002): Bausteine zum Brückenschlag zwischen Deutsch- und Welschschweiz – Eléments pour un trait d'union entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Biel. Warren, Carl (1944): Modern News Reporting. Washington. 8.2 Weitere Internet-Quellen Bilanz (2012): Städte-Ranking 2012: Leuchttürme der Schweiz. In: http://www.bilanz.ch/ luxus/staedte-ranking-2012-leuchttuerme-der-schweiz (06.04.2013). Bundesamt für Statistik (2005): Eidgenössische Volkszählung 2000: Sprachenlandschaft in der Schweiz. In: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/publikationen_ statistik/publikationskatalog.Document.52216.pdf (11.05.2013). Ringier (2013): L’Hebdo. In: http://www.ringier.com/de/produkte/schweiz/zeitschriften/lhebdo (06.04.2013). Staatssekretariat für Wirtschaft (2012): Die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Dezember 2012. In: http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00384/index.html?lang=de&download=NHzLpZe g7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGdH59fmym162epYbg2c_JjKb NoKSn6A-- (06.04.2013). 8.3 Zitierte Artikel aus «L’Hebdo» Bellini, Catherine (2012): L’homme de la dernière chance. In: L’Hebdo Nr. 12 vom 22.03.2012, S. 30-31. CB (2011): Étudiants étrangers. In: L’Hebdo Nr. 34 vom 25.08.2011, S. 10. Guillaume, Michel (2010): Le dernier de classe. In: L’Hebdo Nr. 49 vom 09.12.2010, S. 35. Guillaume, Michel (2012): Commandes de la Confédération: Man spricht Deutsch. In: L’Hebdo Nr. 12 vom 22.03.2012, S. 22-23. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann 29 Guillaume, Michel (2013): Le conseil fédéral écrase les minorités. In: L’Hebdo Nr. 17 vom 25.04.2013, 22. Logean, Sylvie (2012): Soins infirmiers: chacun gardera son système de formation. In: L’Hebdo Nr. 22 vom 31.05.2012, S. 22-23. Rumley, Tasha (2011): Tête verte, pieds libéraux. In: L’Hebdo Nr. 18 vom 05.05.2011, S. 36-40. Rumley, Tasha (2012): La presse alémanique déserte. In: L’Hebdo Nr. 14 vom 05.04.2012, S. 22-23. Tauxe, Chantal (2011): Réformes politiques. In: L’Hebdo Nr. 38 vom 22.09.2011, S. 58-67. 8.4 Materialien Art. 24 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) vom 24.03.2006, SR 784.40. 8.5 Abbildungsverzeichnis Abb. 1 Nennung expliziter Stereotypen (n Artikel = 133, Mehrfachnennungen möglich). .......... 13 Abb. 2 Charakterisierungen der DeutschschschweizerInnen, die im Zentrum von Artikeln stehen (n Artikel = 26, Mehrfachnennungen möglich). ....................................................... 14 Abb. 3 Konnotation der Deutschschweiz (n = 133). .................................................................. 14 Abb. 4 Konnotation der DeutschschweizerInnen (n = 26). ....................................................... 14 Abb. 5 Thematisierung von Unterschieden oder Gemeinsamkeiten (n = 133). .......................... 15 Abb. 6 Angesprochene Aspekte bezüglich Verhältnis Deutschschweiz/Romandie, nachträglich kategorisiert (n = 56). ..................................................................................... 16 Abb. 7 Hauptthema der Artikel (n = 133). .................................................................................. 17 Abb. 8 Feststellbare Herkunft der in den Artikeln zitierten Personen (n Artikel = 133). .............. 18 Abb. 9 Themenzugehörigkeit der im Zentrum stehenden DeutschschweizerInnen (n = 26). .... 18 ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft Bachelorarbeit Lea Hartmann Anhang A9