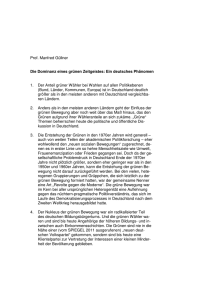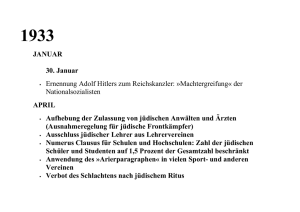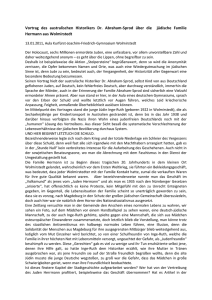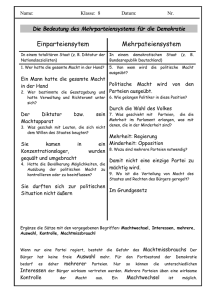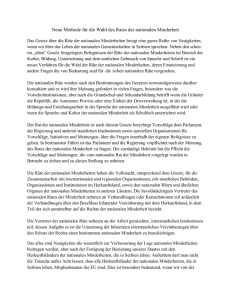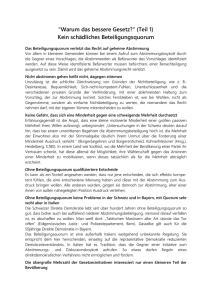Kopftuchdebatte: Die Muslimin Fereshta Ludin darf keine Lehrerin
Werbung
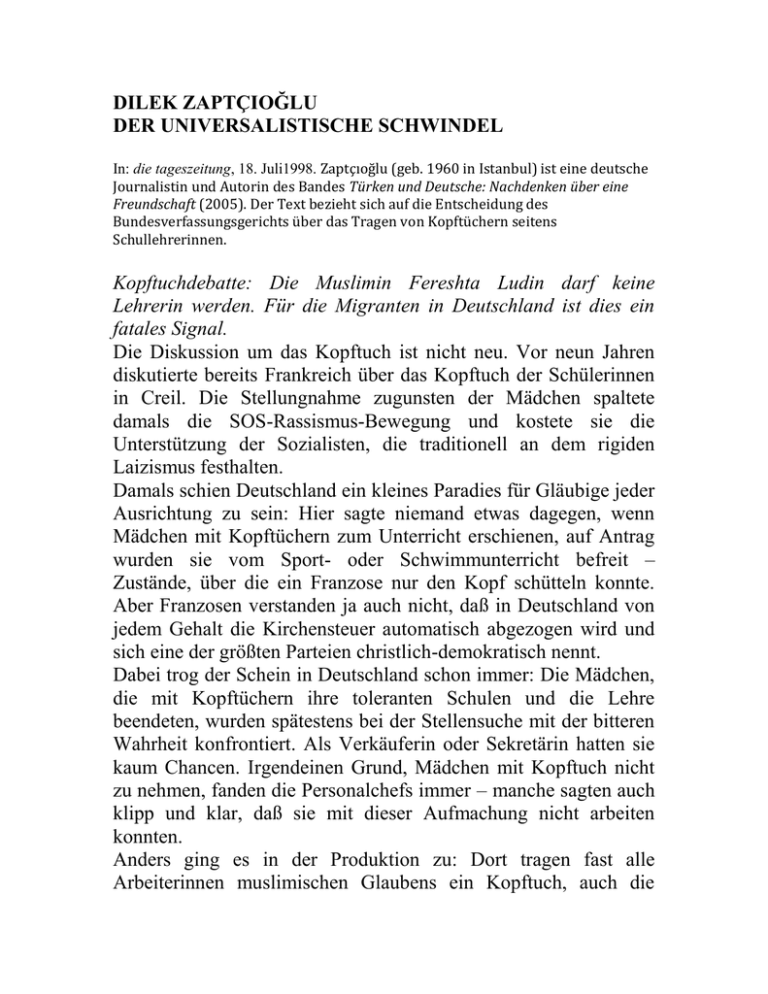
DILEK ZAPTÇIOĞLU DER UNIVERSALISTISCHE SCHWINDEL In: die tageszeitung, 18. Juli1998. Zaptçıoğlu (geb. 1960 in Istanbul) ist eine deutsche Journalistin und Autorin des Bandes Türken und Deutsche: Nachdenken über eine Freundschaft (2005). Der Text bezieht sich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Tragen von Kopftüchern seitens Schullehrerinnen. Kopftuchdebatte: Die Muslimin Fereshta Ludin darf keine Lehrerin werden. Für die Migranten in Deutschland ist dies ein fatales Signal. Die Diskussion um das Kopftuch ist nicht neu. Vor neun Jahren diskutierte bereits Frankreich über das Kopftuch der Schülerinnen in Creil. Die Stellungnahme zugunsten der Mädchen spaltete damals die SOS-Rassismus-Bewegung und kostete sie die Unterstützung der Sozialisten, die traditionell an dem rigiden Laizismus festhalten. Damals schien Deutschland ein kleines Paradies für Gläubige jeder Ausrichtung zu sein: Hier sagte niemand etwas dagegen, wenn Mädchen mit Kopftüchern zum Unterricht erschienen, auf Antrag wurden sie vom Sport- oder Schwimmunterricht befreit – Zustände, über die ein Franzose nur den Kopf schütteln konnte. Aber Franzosen verstanden ja auch nicht, daß in Deutschland von jedem Gehalt die Kirchensteuer automatisch abgezogen wird und sich eine der größten Parteien christlich-demokratisch nennt. Dabei trog der Schein in Deutschland schon immer: Die Mädchen, die mit Kopftüchern ihre toleranten Schulen und die Lehre beendeten, wurden spätestens bei der Stellensuche mit der bitteren Wahrheit konfrontiert. Als Verkäuferin oder Sekretärin hatten sie kaum Chancen. Irgendeinen Grund, Mädchen mit Kopftuch nicht zu nehmen, fanden die Personalchefs immer – manche sagten auch klipp und klar, daß sie mit dieser Aufmachung nicht arbeiten konnten. Anders ging es in der Produktion zu: Dort tragen fast alle Arbeiterinnen muslimischen Glaubens ein Kopftuch, auch die Frauen der Putzkolonnen sind gewöhnlich kopfbedeckt. Das wird von Arbeitgebern nicht nur hingenommen, sondern vielfach ausdrücklich aus hygienischen Gründen begrüßt. Nun gibt es einen Unterschied zwischen der Muslimin, die die Klassenräume blank scheuert, und derjenigen, die an der Tafel steht und über Goethe und Schiller erzählt. Was bei der einen hygienisch und religionsfreiheitlich unbedenklich ist, ist bei der zweiten möglicherweise ein Zeichen für religiösen Fanatismus und dafür, daß sie für diesen Job ungeeignet ist, auch wenn sie vielleicht gar keine religiöse Fanatikerin ist. [...] In der deutschen Schule wird die westliche, historisch auch auf dem Christentum beruhende Kultur und Zivilisation vermittelt – und diese weicht vom Islam per definitionem ab. Kein Unterricht ist von den Werten und Normen befreit, die dieser Teil der Welt für sich geschaffen und als universell gültig erklärt hat und gegen die es in der übrigen Welt in unserer Zeit so große Widerstände gibt. So ist eine Lehrerin mit dem Kreuz um den Hals in deutschen Schulen eine alltägliche Erscheinung, die ins Bild paßt, während eine Lehrerin mit Kopftuch eben fehl am Platz ist. Weil sie islamisch ist. Die Schule ist also nicht weltanschauungsneutral, und die Werte und Normen, die sie vermittelt, haben zwar universellen Anspruch, jedoch nicht diesen Charakter. Wenn Fereshta Ludin, die in BadenWürttemberg nicht Lehrerin werden darf, also eine Muslimin wäre, die ihre Kultur und Zivilisation als einzig gültige und richtige empfindet, würde sie wohl als erstes ablehnen müssen, mit diesen Lehrplänen zu arbeiten. Sie würde versuchen, den Kinder eher ihre eigene Weltsicht beizubringen. Da sie dies an der öffentlichen deutschen Schule nicht kann, würde sie in eine Privatschule gehen oder vielleicht versuchen, eine private islamische Schule zu gründen, deren Klassenräume zu füllen kein Problem sein würde. Aber das alles ist gar nicht ihre Absicht. Fereshta Ludin besteht lediglich darauf, das Kopftuch im Unterricht zu tragen. Eigentlich ist das falsch ausgedrückt, denn es gibt in der Öffentlichkeit für eine gläubige Muslimin überhaupt keinen Platz, an dem sie das Tuch »ablegen« darf. Ob das Tuch nun islamische Vorschrift ist oder nicht, ist dabei weniger interessant. Wenn sie selbst dies als religiöse Vorschrift empfindet, dann ist es eine. Sie will das Kopftuch tragen und den Kindern dasselbe beibringen wie ihre nichtmuslimischen Kolleginnen. Daß sie dies nicht als Widerspruch zu ihrem islamischen Glauben empfindet, müßte jeden Laizisten eigentlich hoch erfreuen. Denn es zeigt, daß Fereshta Ludin ihren Glauben auf den privaten Bereich ihres Gewissens beschränkt und nicht als Politik verstanden wissen will. In der französischen Kopftuchdebatte ging es eindeutig um die traditionell rigide Auffassung vom Laizismus und um die Frage, ob diese Auffassung nun abgemildert und der Zeit angepaßt werden sollte. Es ging darum, daß in französischen Schulen jede Art von religiösen oder weltanschaulichen Zeichen verboten sind – sowohl für Schüler als auch für Lehrer. In Deutschland geht man ja bekanntlich mit solchen Symbolen laxer um, und es gibt Schulen, Lehrer, ja sogar Ministerpräsidenten, die sich weigern, Verfassungsgerichtsurteile über Kreuze in Klassenzimmern anzuwenden. Kurzum: Es geht um das tief in der Seele der Nation verwurzelte Mißtrauen gegen das andere. Es geht um das Mißtrauen jedem »Fremden« gegenüber, vor allem dann, wenn er »uns« am ähnlichsten geworden ist, wenn er sich assimiliert und angepaßt hat – er könnte ja um so gefährlicher sein und uns von innen her schwächen und verraten. So hat das Kopftuch jenseits von scheinbar wertneutralen Diskussionen um Symbole in der Schule einen wichtigen, vielleicht einzigen diskussionswürdigen Aspekt: Wie stellen sich die Deutschen die Zukunft mit den (muslimischen) Migranten vor, wenn sie ihnen ein Assimilationsangebot machen, das sie aber nicht einlösen können oder wollen? Schließt dieses Angebot auch einen Religionswechsel ein, wird es dann wenigstens eingehalten, und spricht das für oder gegen die Lehren, die wir aus der jüngsten Geschichte ziehen dürfen? MICHAEL BRENNER NUR KEINEN EHRENPLATZ In: Süddeutsche Zeitung (2-3. Dezember 2000). Brenner (geb. 1964) lehrt am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Der Text stellt eine Kritik an dem von Bassam Tibi (siehe Beitrag 15 in diesem Kapitel) und Friedrich Merz (siehe dessen Beitrag “Einwanderung und Identität” im siebten Kapitel) vorgeschlagenen gesellschaftspolitischen Ideal einer “deutschen Leitkultur”. Die Rolle der jüdischen Minderheit im Tempel der Leitkultur Meine früheste Begegnung mit dem, was deutsche Leitkultur im Rahmen des christlichen Abendlands bedeutet, reicht dreißig Jahre zurück und datiert von meinem ersten Schultag. Damals wurde ich vertraut mit dem schönen deutschen Brauch, eine prall mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte leeren zu dürfen. Die Frage, die mich an diesem Tag wohl am meisten beschäftigte, war: Schokolade oder Bonbons? Unsere junge Klassenlehrerin in der bayerischen Provinzstadt freilich brachte mich mit einer ganz anderen Frage in Verlegenheit. Gleich in der ersten Stunde stellte sie uns vor die eindeutig formulierte Alternative: »Wer von Euch ist katholisch, wer evangelisch?« Weder das eine noch das andere kam mir allzu bekannt vor, und so konnte ich mich nicht recht zwischen den genannten Optionen entscheiden. Nach Hause zurückgekehrt, lernte ich, dass es außer den genannten Optionen auch noch andere gab und sollte dies bald im jüdischen Religionsunterricht vertieft erfahren. Ich blieb während der nächsten 13 Jahre der einzige jüdische Schüler in meiner Schule, wenngleich ich korrekterweise anmerken sollte, nicht der einzige Jude im Klassenzimmer – der andere hing wie in jeder guten bayerischen Schule selbstverständlich am Kreuz vor unser aller Augen. Während meiner Gymnasialzeit sollten sich bald weitere exotische Abweichungen von der katholisch-protestantischen Mehrheit in meiner Klasse dazugesellen, so etwa ein Muslim, dessen Familie aus dem Iran stammte, ein Neuapostolischer und – gewiss als Exotischster von uns allen – ein Schüler, hinter dessen Namen im Jahresbericht das Kürzel O.B. auftauchte, was nicht etwa hieß, dass sein Vater Oberbürgermeister, sondern, dass er ohne Bekenntnis war. Da mein eigener Religionsunterricht einmal wöchentlich am Nachmittag in der Jüdischen Gemeinde stattfand, spielten wir während der Religionsstunde eine Art multikulturellen Fußball. [...] Synagoge ja, Moschee nein In Bayern hat sich daran bis heute ja trotz ihres eigentlich eindeutigen verfassungsrechtlichen Ausgangs nicht viel geändert. Im liberalen Stadtstaat Bremen ist die Leitkultur als Leitreligion gar in der Landesverfassung verankert. Dort heißt es im Artikel 32: »Die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen mit bekenntnismäßig nicht gebundenem Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage.« Diese Klausel galt einmal zu Recht als besonders fortschrittliche Zusammenfassung des katholischen und protestantischen Religionsunterrichts. Doch müsste man eine solche Passage nicht an die erheblich veränderte Realität anpassen, um auch anderen Religionsgemeinschaften einen entsprechenden Unterricht zu gewähren? Juden waren lange Zeit die einzige nichtchristliche Minderheit in Deutschland. Heute hat sich dies geändert. Zum einen leben Juden in einer faktisch pluralistischen Gesellschaft, sowohl was ethnische Herkunft, aber auch was religiöse Gruppierungen betrifft. Sie sind also nicht die einzige Minderheit, mehr noch, sie sind eine kleine Minderheit selbst unter den Minderheiten. Sie sind, und dies führt uns zur anderen Seite der Medaille, alles andere als eine normale Minderheit. Nach dem Holocaust galt und gilt bis heute eine jüdische Präsenz in Deutschland als nahezu überlebenswichtig für die deutsche Demokratie. Im Ausland wurden Erfolg oder Misserfolg der Demokratie in Deutschland nicht zuletzt daran gemessen, ob sich hier eine, wenn auch noch so kleine, jüdische Gemeinde wieder zu Hause fühlen kann. Das Verlassen der Juden aus Deutschland hätte unabsehbare Folgen – nicht für die Juden, sondern für Deutschland. Es wäre also irreführend, die Behandlung der jüdischen Minderheit in Deutschland heute als repräsentativ für den Umgang mit anderen religiösen und ethnischen Minderheiten anzusehen. Antisemitismus ist glücklicherweise in weiten Kreisen noch immer ein gesellschaftliches Tabu. Äußerungen und Maßnahmen gegen andere religiöse Minderheiten und gegen Ausländer sind dagegen leider salonfähiger. Es gab eine Zeit, da konnten Politiker schöne Worte über ihre jüdischen Mitbürger verlieren und im selben Atemzug vor der Gefahr einer Überfremdung Deutschlands warnen, ohne entschiedenen Protest des Zentralrats der Juden erwarten zu müssen. Mancher von ihnen mag sich heute einen Werner Nachmann zurückwünschen, der als Zentralratsvorsitzender um jeden Preis seinen Platz im Establishment der Gesellschaft suchte und sogar Politikern nach dem Mund redete, die wegen ihrer NS-Vergangenheit zurücktreten mussten. Seit Heinz Galinski und Ignatz Bubis die Geschicke des Zentralrats übernahmen, hat sich das geändert, und die deutlichen Worte von Paul Spiegel während der letzten Wochen haben diese Linie noch deutlicher gemacht. Spiegels Signal war richtig: Politik gegenüber den Juden lässt sich nicht an Sonntagsreden zum 9. November oder der Woche der Brüderlichkeit messen, sondern an der gesellschaftlichen Öffnung gegenüber Minderheiten, Ausländern, »den Anderen«. Um zwei Beispiele zu nennen: Eine Synagoge im Stadtbild kann man sich heute schon vorstellen, aber eine Moschee? Über jüdische Kultur kann man zum Glück heute an deutschen Universitäten gut informiert werden, aber wo kann man fundiertes Wissen über türkische Kultur und Geschichte erwerben? Die Frage, wie sich die jüdische Minderheit in der gegenwärtigen Debatte definiert, hat keine einfache Antwort. Sie könnte es sich leicht machen und auf der Seite der etablierten Gesellschaft Platz nehmen, quasi die unterbrochene Tradition aus der Zeit vor 1933 im Rahmen der vielbeschworenen deutsch-jüdischen Symbiose wieder aufgreifen, sich im Schatten der gern zitierten Einsteins und Rathenaus, Freuds und Zweigs platzieren. Als Zugeständnis wird dann die Idee vom christlichen Abendland auch auf das jüdischchristliche Abendland ausgedehnt. Den Juden wird sozusagen ein Ehrenplatz im nicht sehr geräumigen Tempel der deutschen Leitkultur angeboten. Paul Spiegel ließ nun keinen Zweifel daran, dass er den unbequemeren Weg wählt und sich, wenn es sein muss, gegen diese Art der Etablierung wendet. Die Juden, so der Kern seines berechtigten Protestes gegen die Formel der Leitkultur, haben in einer pluralistischen Gesellschaft grundsätzlich besser gelebt als in einer monolithisch definierten, und sie tun es bis heute – wie jede Minderheit. Die beiden im Ersten Weltkrieg untergegangenen Reiche in der Mitte und im Südosten Europas, das Habsburgerreich und das Osmanische Reich, beherbergten nicht nur sehr große, sondern blühende und sich relativ frei entfaltende jüdische Gemeinden. Das war nicht zuletzt möglich, weil sie sich durch keine Leitkultur definieren lassen konnten und wollten. Unter völlig anderen Voraussetzungen gilt dies heute für die USA, die die moderne Version eines Vielvölkerreichs bieten, indem sie die zahlreichen Immigranten ihre eigenen Kulturen ausleben lassen. Für die Vertreter des europäischen Nationalstaatsgedankens im 19. und 20. Jahrhundert war dies wesentlich schwieriger, weshalb deren Politik meistens zwischen Assimilation und Ausgrenzung schwankte. Doch auch in den beiden großen Staaten Westeuropas, Frankreich und Großbritannien, hat sich aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit und des stärker ausgeprägten laizistischen Elements ihrer Gesellschaften trotz mancher Widerstände längst eine multikulturelle und multireligiöse Szene herausgebildet, von der manche in Deutschland noch träumen und die andere bereits fürchten. Unbestreitbar ist jedenfalls, dass sie hier im Vergleich zu anderen westlichen Gesellschaften erst in Ansätzen existiert. Wir sollten den Initiatoren der Leitkultur-Debatte dankbar sein. Sie haben uns vor Augen geführt, was mancher vorher nicht so deutlich gesehen hatte, dass die deutsche Gesellschaft weiterhin eine sehr stark christlich geprägte, die Diskussion um die Leitkultur daher auch eine Diskussion um die Leitreligion ist. Man mag sich dazu bekennen und diese verteidigen. Man kann sie aber auch in Frage stellen und behaupten, in einer modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts müssen auch die christlichen Religionen stark genug sein, um die symbolische Dominanz im öffentlichen Raum aufzugeben, wie dies in den meisten westlichen Ländern schon lange der Fall ist. Der jüdischen Gemeinschaft kommt hier wegen ihrer besonderen Geschichte und ihres Rechtsstatus eine besondere Aufgabe zu: sie ist zwar eine der kleinsten, aber die in ihrer Symbolkraft sichtbarste Minderheit. Als solche kann sie sich für andere Minderheiten und für eine offene Gesellschaft in besonderer Weise einsetzen. Dass ihre Vertreter dies in letzter Zeit immer öfter tun, hat unter etablierten Politikern für einige Irritationen gesorgt. Dies ist gut so. Denn die Alternative lautet: eine rückwärts gewandte und von Ängsten vor Überfremdung geprägte Gesellschaft oder eine offene Gesellschaft, in der in der Tat viele Leitwerte – seien sie nun Leitkulturen oder Leitreligionen – in ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz in Frage gestellt werden. Als oftmals einzige Minderheit haben die Juden die Funktion gehabt, ihre jeweiligen Gesellschaften ein bisschen bunter und abwechslungsreicher zu gestalten. Dies hat ihnen Anerkennung und Bewunderung von den einen, Misstrauen und Hass von den anderen eingebracht. Heute sind sie – Gott sei Dank – nicht mehr die einzigen in dieser Rolle.