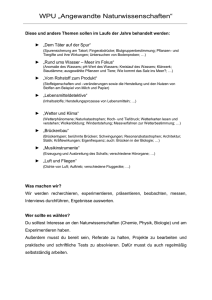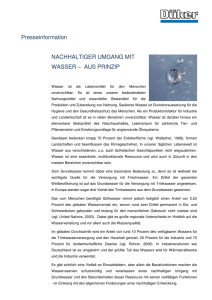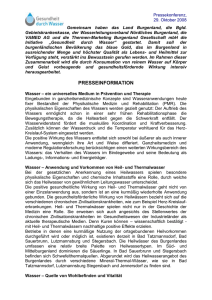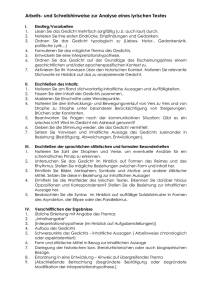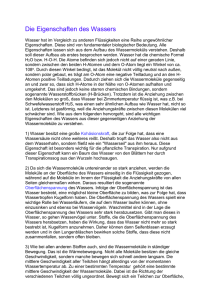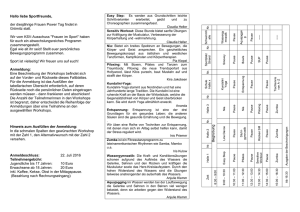Lösungsvorschlag deutsch ideen Schülerband 9 Nordrhein
Werbung

Lösungsvorschlag deutsch ideen Schülerband 9 Nordrhein-Westfalen (978-3-507-42129-5) Seite 106, Aussage 1 In seinem Gedicht „Berlin V“ aus dem Jahr 1910 thematisiert Georg Heym mit der Beschreibung einer menschenleeren Stadt (Berlin) an einem stürmischen Regentag die Lebensfeindlichkeit einer modernen Großstadt. Seite 106, Aufgabe 2 Mögliche Lösung Das Gedicht besteht aus zwei Quartetten / zwei Strophen aus vier Versen. Das Reimschema ist der Kreuzreim (abab cdcd), dem auch die Kadenzen folgen (mwmw wmwm). Als Metrum liegt ein fünfhebiger Jambus vor. Eine Ausnahme bildet das Metrum im Vers „Pfählen, und zeigen weiß den Blättergrund“ (V. 6), bei dem nach der ersten Hebung „Pfäh-“ zwei unbetonte Silbe folgen: „-len“ und „und“. Seite 106, Aufgabe 3 Mögliche Lösung Die Stärke, mit der der Regen unaufhörlich fällt, wird mithilfe der Metapher „Der Regen rauscht in einer Wand.“ (V. 1) bildlich vermittelt. Der Regen fällt so dicht, dass die Wahrnehmung (hier: das Sehen) beeinträchtigt wird und die Einzelheiten der Stadt, etwa die Häuser, nicht mehr erkennbar sind. Im Vergleich der Schirme (evtl. die Kronen der Bäume) mit „großen Ratten“ (V. 5 f.) wird dieser Eindruck der Verfremdung der Wahrnehmung durch den strömenden Regen wieder aufgegriffen: Die Umrisse der Bäume erscheinen durch die Regenwand nur unscharf, sodass die Bäume wie „große Ratten“ (V. 5 f.) wirken. Auch der Bahnhof und sein Eingang werden durch das unwirtliche Wetter verfremdet. Dies wird mithilfe der Metapher „des Bahnhofs Mund“ (V. 8) erreicht, indem der Bahnhofseingang zu einem bedrohlichen, großen Lebewesen verzerrt wird. Seite 106, Aufgabe 4 Mögliche Lösung Zunächst wird der unaufhörlich strömende Regen, der auf den Asphalt der Straße prasselt und sich dort staut, beschrieben (Beobachten, vgl. V. 1–4). Anschließend werden die Straßenbäume im Wind in den Blick genommen. Sie verlieren aufgrund von Regen und Wind ihr wirkliches Aussehen, sodass die Stämme der Pflanzen als Pfähle erscheinen und statt des Grüns der Blätter durch den starken Wind nur die hellen Blattunterseiten zu sehen sind (vgl. V. 5 f.). Sturm und Regen verfremden die Natur und veranschaulichen die Unwirtlichkeit der Stadt Berlin (Nachdenken). Dies führt den Sprecher zu dem Fazit, dass die Schirme vor dem Eingang des Bahnhofs nicht einladend, sondern abstoßend aussehen, nämlich wie große Ratten. Dieses Bild dokumentiert die Lebensfeindlichkeit der Großstadt (Begreifen). 1 Seite 106, Aufgabe 5 Mögliche Lösung Durch den rauschenden Regen, der als eine „weiße Wand“ (V. 1) erscheint, wird zum einen die Unwirtlichkeit der Lebenswelt „Großstadt“, hier Berlin (vgl. Titel), veranschaulicht. Zum anderen spiegelt die Störung der Wahrnehmung durch Regen und Sturm die Unsicherheit der Menschen in der modernen Lebenswelt der Stadt wider. Seite 106, Aufgabe 6 Mögliche Lösung Die Darstellung der Stadt bei strömenden Regen zielt darauf, einerseits die Lebensfeindlichkeit der Großstadt auf der Bildebene zu vermitteln. Dazu dienen Metaphern (vgl. V. 1), Personifikationen (vgl. V. 1, 8) und Vergleiche (vgl. V. 7 f.). Andererseits gelingt es, mit dem Bild der Stadt Berlin im Regen zu verdeutlichen, dass auf Wahrnehmungen (hier: Sehen) kein Verlass ist: Die Regenwand begrenzt die Sicht – hinter die Wand kann nicht geschaut werden (vgl. V. 1). Darüber hinaus bedingen Regen und Sturm eine Verzerrung der Wahrnehmung. So erscheinen Baumkronen oder Schirme wie „große[...] Ratten“ (V. 7) und der Bahnhof wirkt wie ein Monster mit großem Mund (vgl. V. 8). Insgesamt wird die Stadt Berlin im Regen so zu einem Bild für die Verunsicherung des Menschen, der in der Großstadt (Berlin) lebt. Darüber hinaus wird die Unwirt-lichkeit des Lebensraums Stadt für den Menschen auch dadurch dokumentiert, dass Menschen (vielleicht mit Ausnahme des Sprechers, der seine Beobachtungen mitteilt) im Gedicht nicht erwähnt werden. Seite 106, Aufgabe 7 Bezüge zur Poetologie und zum Lebensgefühl Heyms findest du im Text „Georg Heym – Biografie und Poetologie“ (S. 99). In seinem Gedicht greift Heym das Thema der Großstadt auf. Durch die „fantastischgroteske, dämonisierende Bildsprache“ (Z. 23) wird in seinem Gedicht „Berlin V“ die Stadt zu einem bedrohlich wirkenden Lebensraum verwandelt, z. B. indem die Schirme (oder Baumkronen) zum irrationalen Bild „eine[r] Schar von großen Ratten“ (V. 7) werden und der Bahnhofseingang zum „ Mund“ eines Monsters (V. 8) wird. Zugleich wirken die Regenflut sowie die vom Sturm getriebenen Wolken (vgl. V. 2) apokalyptisch (vgl. Z. 32), nahezu wie eine Sintflut, wie ein Regen, der den Weltuntergang bringt. Die Regenströme sind so dicht, dass sie eine „weiße Wand“ (V. 1) bilden, die für den Betrachter undurchschaubar ist. Diese Farbmetapher (vgl. Z. 24) wird zum Bild für die Undurchschaubarkeit der Wirklichkeit. Die Bedeutungslosigkeit der Menschen, ihre Ohnmacht (vgl. Z. 17–20) wird in diesem Gedicht dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Menschen gar nicht erwähnt werden, sondern eine Welt ohne Menschen präsentiert wird. Seite 107, Aufgabe 1 a) Mögliche Interpretation zum Gedicht „Römische Fontäne“ (Paris, 8.7.1906) von Rainer Maria Rilke 2 In seinem Dinggedicht „Römische Fontäne“ (1906) stellt Rainer Maria Rilke das Fließen des Wassers in den Mittelpunkt der Betrachtung des Brunnens, der im Titel genau benannt wird. Es handelt sich um die „Römische Fontäne“ der Villa Borghese in Rom. Ich verstehe das Gedicht als einen Versuch, die unterschiedlichen Zustände des Wassers im Brunnen nachzugestalten, indem der Weg des Wassers genau aufge-zeichnet wird, der Brunnen und sein Aussehen dagegen kaum in den Blick genommen werden. Auf formaler Ebene verdeutlichen das Metrum, ein regelmäßiger fünfhebiger Jambus, und die Enjambements das langsame und stetige Fließen. Worte und Wortgruppen wie „leise redend entgegenschweigend“ (V. 5), „heimlich“ (V. 6), „ohne Heimweh“ (V. 10), „träumerisch“ (V. 11), „lächeln macht“ (V. 14) personifizieren den Prozess des Fließens des Wassers. Daher vermute ich, dass das Gedicht als Bild für das menschliche Leben zu verstehen ist. Mit zwei Quartetten und drei Terzetten ist Rilkes Gedicht ein Sonett. Die Quartette weisen einen Kreuzreim auf, wobei die Reimwörter in beiden Strophen gleich klingen (abab abab). Die Terzette zeigen keine eindeutige Reimfolge auf (cdd ede), sind jedoch durch den strophenübergreifenden Reim verbunden (vgl. V. 10 f., 13). Ein Vers bleibt ohne Reim (vgl. V. 9). Als Metrum ist ein fünfhebiger Jambus festzustellen, die Kadenzen folgen weitgehend dem Reimschema (wmwm wmwm wmm wmw). Eine Ausnahme in diesem regelmäßigen Muster stellt der dritte Vers dar, in dem sich eine zusätzliche Hebung findet: „und aus dem o/be/ren Wasser leis sich neigend“ (V. 3); das dreisilbige Wort „oberen“ besitzt eine Hebung auf „o“, der zwei unbetonte Silben „be-ren“ folgen und den Rhythmus unterbrechen bzw. verzögern. Auf inhaltlicher Ebene illustriert diese Abweichung das zögerliche, langsame Strömen des Wassers, bevor es in die nächste Schale übergeht. Zudem fällt die große Zahl von Enjambements auf. In den Quartetten sind jeweils aufeinanderfolgende Reimpaare miteinander verknüpft (vgl. V.1–2, 3–4, 5–6, 7–8). Bei den Terzetten setzt sich das Muster zunächst fort (vgl. V. 9–10). Der letzte Vers des ersten Terzetts „fließt“ durch ein Enjambement in die nächste Strophe, wobei auch die letzten vier Verse durch Enjambements verbunden sind. Insgesamt erstreckt sich ein komplexer, verschachtelter Satz über alle Strophen. Von dem aus drei Stufen bestehenden Becken erheben sich zwei Stufen aus einer Marmorschale. Das Wasser der oberen Schale fließt in die folgende. (I) Dieser Übergang wird nun (II, III) genau beschrieben, wodurch die Langsamkeit des fließenden Wassers verdeutlicht wird. Diese langsame Bewegung des Wassers wird zu einem Tröpfeln, wenn das Wasser in die unterste Schale läuft (IV). Der Sprecher konzentriert sich bei der Betrachtung des Brunnens nicht so sehr auf dessen Aussehen, von dem man lediglich erfährt, dass „zwei Becken“ (V. 1), die übereinander angeordnet sind, sich aus einem „runden Marmorrand“ (V. 2) erheben, die zweite Schale „schön[...]“ (V. 9) ist und „Moosbehänge[...]“ (V. 12) besitzt. Auch auf die Spiegelung des Wassers in den Schalen (vgl. V. 6 f. und V. 13 f.) wird verwiesen. Viel intensiver versenkt sich der Betrachter in den langsamen Fluss des Wassers von der oberen in die zweite Schale (vgl. V. 3–12). Durch diese genaue Beschreibung des Weges, den das Wasser nimmt, wird die Langsamkeit seiner Bewegung wiedergegeben, sodass der Prozess, der eigentlich nie zur Ruhe kommt, nahezu statisch wirkt. Dennoch wird die Bewegung des Wassers, sein unaufhaltsames Strömen auf formaler Ebene durch Enjambements veranschaulicht. Vor allem der Übergang bzw. das Ineinanderübergehen der Terzette fällt dabei auf. Auf der Ebene der Syntax – das Gedicht besteht aus einem Satz – entspricht die fehlende Zäsur nach den Strophen dem Fließprozess des Wassers. Dieser Bewegungsfluss des Wassers hat eine sanfte, manchmal kommunikative Qualität: Das Wasser „aus dem oberen“ (V. 3) Becken neigt sich „leis“ (V. 3) „zum Wasser, welches unten wartend“ steht (V. 4). An dieser Stelle werden der Wechsel von Geben und Nehmen, Austausch und Miteinander des Wassers auf den unterschiedlichen Schalen des Brunnens veranschaulicht. Die Personifikation des Wassers vermittelt den Eindruck, als kommuniziere das Wasser der verschiedenen Schalen miteinander. Das „leise redend[e]“ Wasser aus der 3 oberen Schale wird vom Wasser der folgenden entgegengenommen. Dieses nimmt das Wasser „[...]schweigend“ (V. 5) an, wobei der Neologismus „entgegenschweigend“ (V. 5) durch den Zusatz „entgegen-“ zugleich ein Element des Miteinanders enthält. Dabei wird der Gegensatz bzw. Übergang von oben (vgl. V. 3) nach „unten“ (V. 4) durch die Gesten „sich neigend“ (V. 3) und „wartend“ (V. 4) – beides Partizipien – aufgegriffen. Dem „leise redenden“ Wasser, das von oben kommt, antwortet das unten wartende Wasser mit einer „heimlichen“ (V. 6) Zeigegeste. Es zeigt in einer Spiegelung im Wasser den „Himmel“ (V. 7) „wie einen unbekannten Gegenstand“ (V. 8). Das Heimliche dieser Geste wird dadurch herausgestellt, dass das, was gezeigt wird (der Himmel), nur versteckt „gleichsam in der hohlen Hand“ (V. 6) präsentiert werden dürfe. Nach dem Übergang des Wassers von der ersten in die nächste Brunnenschale breitet sich das Wasser „ruhig in der schönen Schale“ (V. 9) aus. Erneut wird das Wasser personifiziert. Es verbreitet sich „ohne Heimweh“ (V. 10) und „nur manchmal träumerisch“ (V. 11) lässt es sich an den „Moosbehängen“ (V. 12) nieder. Dieses Bild scheint auf das Leben eines Menschen, der von einer Lebensstufe zur nächsten wechselt, zu verweisen. Gleichzeitig aber bleibt trotz der Personifikation die stoffliche Qualität des nahezu ruhenden und dennoch sich bewegenden, sich „Kreis aus Kreis“ (V. 10) ausbreitenden Wassers erhalten, zumal es „tropfenweis[e]“ (V. 11) auf die „Moosbehänge“ (V. 12) trifft. Erneut wird eine Spiegelung des Wassers in den Blick genommen. Die Spiegelung der mittleren Schale auf der Wasseroberfläche der untersten Schale (vgl. V. 13 f.) wird metaphorisch als „leis[es] (V. 13) „[L]ächeln“ (V. 14) dargestellt, das von der unteren Schale ausgelöst wird (V. 14). Während zunächst der Blick des Betrachters von oben nach unten (vgl. V. 2–4) dem Wasserfluss folgt, richtet er nun, da das Wasser über mehrere Stufen sein Ziel erreicht hat, den Blick „von unten“ (V. 14) nach oben. Das sperrige Bild eines Lächelns „mit Übergängen“ (V. 14) lässt sich dadurch erklären. Auf der Wasseroberfläche der untersten Schale des Brunnens spiegelt sich die darüber liegende, von der das Wasser herabfließt. Die Harmonie, in der die langsame Fließbewegung erfolgt, wird durch die Klanggestalt des Gedichts unterstrichen, die durch Alliterationen (z. B. V. 4 (w), V. 6 (h), V. 9 (s, sch), V. 10 (k), V. 11 (t)) und gleichklingende Laute (vgl. ei, i, a) gekennzeichnet ist. Die Betrachtung des Brunnens konzentriert sich auf den für den Sprecher wesentlichen Aspekt: das langsame Fließen des Wassers, wobei der Übergang von einer in die andere Schale als harmonischer Prozess beschrieben wird. Das Nachdenken über die Beobachtungen führt dazu, dass ein Zusammenspiel des sich von einer zur nächsten Ebene bewegenden Wassers wie ein kommunikativer Austausch in Form von Warten, Reden, Zeigen (vgl. I, II), Lächeln (vgl. IV) erfolgt. Darüber hinaus wird durch die Personifikationen (vgl. V. 4, V. 10 f.) eine Parallele zum menschlichen Leben angedeutet, sodass der Fluss des Wassers von einer Stufe des Brunnens zur nächsten vielleicht als Bild für die Lebensstufen gedeutet werden darf. Der Fluss der Lebenszeit gleicht dem Fluss des Wassers. Die Spiegelungen in der Brunnenschale zeigen dabei den Zusammenhang zwischen den einzelnen Lebensstufen auf. So wird die „Römische Fontäne“ bzw. wird das stetig fließende Wasser zu einem Bild für das menschliche Dasein oder für die Lebenszeit eines Menschen. Dieser symbolische Charakter des Gedichts, das über sich hinausweist, kennzeichnet Rilkes Sonett als Dinggedicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Betrachtung der „Römische[n] Fontäne“ (Titel) durch den Sprecher die Stetigkeit des Fließens des Wassers in den Mittelpunkt rückt, weniger genau wird das Aussehen des Brunnens vermittelt. Dabei wird mithilfe von Personifikationen und Partizipien (vgl. I, II) der Übergang des Wassers von einer Schale in die andere als kommunikativer, harmonischer Prozess dargestellt. Eine wichtige Funktion hat das zweimal aufgegriffene Bild der Wasserspiegelung (vgl. V. 6 ff. und V. 13 f.), da neben der Wasserbewegung, die ganz auf sich selbst bezogen ist, zum einen auf etwas verwiesen wird, was außerhalb des Brunnens liegt, den „Himmel“ (V. 7), und zum anderen eine „Selbstbespiegelung“ (vgl. V. 13 f.) präsentiert wird. Die Ruhe und die Harmonie der 4 Wasserbewegung werden durch klangliche Mittel (vgl. Alliteration, Gleichklang von Lauten) und die zahlreichen Enjambements unterstrichen. Die Tatsache, dass die Bewegung des Wassers von einer Brunnenschale zur nächsten als harmonische Einheit verstanden wird, findet auf syntaktischer Ebene eine Parallele, da der gesamte Vorgang in nur einem Satz dargestellt wird. Die Deutungshypothese kann in dem Punkt bestätigt werden, dass das Gedicht als Bild für das menschliche Leben zu verstehen ist. Es ist ein Bild oder Symbol für das menschliche Dasein selbst oder für die stetig fließende Lebenszeit des Menschen. Damit ist Rilkes Gedicht als Dinggedicht zu bezeichnen. Dieses Gedicht vermittelt ein genaues Bild davon, wie durch das Betrachten der Dinge ihr „Wesen“ erschlossen werden kann, und ist damit ein Beispiel für Rilkes Auffassung von der Bedeutung des Sehens für seine Kunst. Durch die intensive Betrachtung des „Dinges“ – hier des stetig von einer zur anderen Schale fließenden Wassers – sowie dessen genaue Beschreibung wird die „Römische Fontäne“ aus ihrer Alltäglichkeit gelöst. Die Personifikationen, die den Eindruck wecken, das Wasser habe die menschliche Fähigkeit zur Kommunikation bzw. zum Miteinander, dient dazu, das Wesen des Dinges bleibend zu erfassen: Das Wasser der Fontäne wird zum Symbol des menschlichen Daseins (vgl. S. 92). b) Mögliche Interpretation zum Gedicht „Fröhlichkeit“ (1911) von Georg Heym In dem Gedicht „Fröhlichkeit“ (1911) mit den zwei Gruppen Menschen – die eine beobachtet ein Karussell an einem sonnigen Nachmittag, die andere Gruppe besteht aus Arbeitern, die, vom Baugerüst aus, den Takt zum Treiben unten schlägt – wird die moderne Gesellschaft thematisiert. Ich verstehe das Gedicht als ein Bild für die Welt als Jahrmarkt, die vom Kreisen des Karussells erfasst und herumgewirbelt wird. Dabei scheint nicht nur die gesamte Gesellschaft, Jahrmarktbesucher und Arbeiter, sondern auch der Kosmos einbezogen zu sein. Darauf verweisen Hyperbeln wie „tausend Menschen“ (V. 3) oder die verwendeten Pluralformen bei der Beschreibung der Einstiegssituation, dort ist von „großen Karussellen“, die „wie Sonnen flammend in den Nachmittagen“ kreisen, die Rede. Zwar stellt das Adverb „[d]och“ (V. 9) den Unterschied zwischen den Menschen unten und den Arbeitern oben heraus. Andere Gestaltungsmittel, wie Tiervergleiche (vgl. V. 7 f., V. 10), gleichen den aufgezeigten Unterschied zwischen den sozialen Gruppen jedoch wieder aus. Dadurch wird deutlich, dass alles von dem Treiben erfasst und in das Tanzen einbezogen wird. Behaglich sieht eine Menschenmenge an einem sonnigen Nachmittag dem rasanten Kreisen von Karussellen zu, auf dem Tierfiguren installiert sind (I). Dabei geht die Trennschärfe zwischen Betrachtern und Tieren auf dem Karussell langsam verloren (II). Eine Gruppe von Maurern, die sich auf einem Gerüst befinden und von unten nur als kleine Gestalten sichtbar sind, liefern durch das Klopfen mit ihren Maurerkellen die Hintergrundmusik oder einen Kommentar zum Geschehen (III). Das Gedicht umfasst drei Quartette mit umarmendem Reim, wobei sich die mittleren Verspaare der zweiten und dritten Strophe sowie die umarmenden Verse der letzten Strophe mit den äußeren Versen der ersten Strophe reimen (abba cddc adda). Das Reimschema verweist auf eine Verknüpfung auf inhaltlicher Ebene. Das Metrum ist durchgehend ein fünfhebiger Jambus. Bis auf die mittleren Verse der zweiten und dritten Strophe sind die Kadenzen weiblich. Der Gedichttitel „Fröhlichkeit“ weckt die Erwartung, dass die Fröhlichkeit einer Person oder eine fröhliche Situation präsentiert wird. Zunächst scheint diese Erwartung erfüllt zu werden: Eine Szene mit sich im hellen Nachmittagssonnenschein drehenden „großen Karussellen“ 5 (V. 1) wird dargestellt. Die Dynamik der Dreh-bewegung wird durch mehrere sprachliche Elemente vermittelt, nämlich durch die lautmalerischen Verben „rauscht und saust“ (V. 1) sowie durch das Verb „drehen“ (vgl. V. 4) und das Wort „schnelle“ (V. 4), bei dem offen bleibt, ob es sich als Attribut auf die „Rosse“ (V. 4) bezieht oder zum Verb „drehn“ (V. 4) gehört. Auf den ersten Blick wirkt dieser Rummel alltäglich und vertraut. Allerdings bleibt das Gesamtbild durch die Hyperbeln „sperrig“: Nicht nur ein, sondern eine unbestimmte Zahl von „großen Karussellen“ (V. 1), von denen „[e]s rauscht und saust“ (V. 1) „[w]ie Sonnen flammend in den Nachmittagen“ (V. 2), sind zu sehen. Im Vergleich wird bei „Sonnen“ und „Nachmittagen“ (vgl. V. 2) der Plural genutzt. Zudem erkennt man bei genauerer Betrachtung, dass nicht ein Sonnennachmittag beschrieben wird, sondern mithilfe des Vergleichs (vgl. V. 2) Bewegung und Geräusch der Karusselle veranschaulicht werden. Die zunächst alltäglich erscheinende Szene erhält dadurch etwas Irrationales und die Bewegung etwas Unkontrollierbares. Vom Gegenstand der Betrachtung richtet sich nun der Blick des Sprechers auf die Betrachter der Karusselle. Mit der Hyperbel „tausend Leute“ (V. 3) wird die Menschengruppe in der Nähe des Karussells als Masse dargestellt, die „mit Behagen“ (V. 3) die recht unterschiedlichen Tiere, nämlich Kamele, Rosse, Schwäne, Elefanzen [sic] (vgl. V. 4 f.), auf dem Karussell anschauen. Hyperbeln und Pluralformen sowie das Wort „Behagen“ (V. 3) sorgen dafür, dass erneut eine Verunsicherung bezüglich der Einordnung der geschilderten Szenerie entsteht. Die folgenden durch Anaphern mit der reihenden Konjunktion „Und“ eingeleiteten Verse verstärken diese Unsicherheit bezüglich der Einschätzbarkeit der Situation. Sind zuvor die Tiere auf dem Karussell genannt worden (vgl. V. 4 f.), zuletzt die Elefanten, so folgt nun die Bemerkung „Und einer hebt vor Freude schon das Bein“ (V. 6). Aufgrund der syntaktischen Struktur des langen Satzes (vgl. V. 3–8) ist eine eindeutige inhaltliche Zuordnung dieser Aussage nicht möglich. Sowohl ein Bezug zum Wort „Elefanzen“ (V. 5) als auch zum Satz „Und tausend Leute sehen mit Behagen“ (V. 3) erscheint möglich. Somit bleibt in der Schwebe, ob dargestellt wird, dass die Karusselle, von denen es allerdings bereits „rauscht und saust“ (V. 1), (wieder) beginnen sich zu drehen, wie es die Information „Und alle Tiere fangen an zu tanzen“ (V. 8) nahelegt, oder ob die „tausend Leute“ (V. 3) sich hier tierähnlich verhalten, einer von ihnen sogar „vor Freude [...] das Bein“ hebt und „im schwarzen Bauche wie ein Schwein“ (V. 7) grunzt. Diese zweite Lesart würde dann ein Bild von einer Menschenmenge zeichnen, die nicht nur den Tieren auf den Karussellen zusieht, sondern wie die Tiere herum-wirbelt. Gleichzeitig wäre in diesem Falle zu überlegen, ob die Karusselltiere, die Kamele, Rosse, Schwäne und Elefanten, als Karikaturen oder Allegorien für bestimmte Menschentypen oder Gruppen zu werten sind. Die verfremdende Bezeichnung der Elefanten als „Elefanzen“ (V. 5) kann dafür als Beleg dienen. Der mit dem Adverb „[d]och“ (V. 9) neu beginnende Satz signalisiert zunächst einen Bruch. Der Blick des Betrachters schweift nämlich von der Karussellszenerie auf eine Baustelle nach oben, wo Maurer „rund [...] hoch um’s Gerüst“ (V. 10 f.) gehen. Durch den Einschub „im Himmelslicht“ (V. 9), durch die räumliche Höherstellung und die Charakterisierung „ein feuriger Verein“ (V. 11) scheinen diese Arbeiter vom Sprecher aufgewertet zu werden und den „tausend Leuten“ (V. 3) überlegen zu sein. Aber auch die Maurer werden durch den Tiervergleich „wie Läuse klein“ (V. 10) und die Kreisbewegung, die das Adverb „rund“ (V. 10) verdeutlicht, in die Gruppe der tanzenden „Tiere“ (V. 8) eingeordnet. Zum Geschehen unten (und oben) klopfen sie „mit ihren Maurerkellen“ (V. 12) den Takt. Nicht eindeutig zu klären ist, ob damit ein Hinweis auf das Tätigsein der Handwerker im Gegensatz zur Masse unten, die „mit Behagen“ (V. 3) den Karusselltieren zuschaut, gegeben wird. Denn das Klopfen der Maurerkellen kann auch als Protest oder als Hintergrundmusik für das Treiben unten verstanden werden. Nicht nur durch den Bildbereich, sondern auch durch das Reimschema werden beide Szenen, die unten bei den Karussellen und die oben auf dem Gerüst, miteinander verknüpft. So wird zum einen vermittelt, dass die Maurer, auch wenn sie nicht unmittelbar am Geschehen unten teilhaben, doch Teil der sich bewegenden Gesellschaft sind. Auf der 6 Bildebene wird dies zusätzlich dadurch veranschaulicht, dass sie die Kreisbewegung der Karusselle aufnehmen (vgl. V. 10), den Takt zum Tanz der Tiere (vgl. V. 8) schlagen und Anteil am hellen Licht „der Nachmittage“ (V. 2, V. 9) haben. Der Sprecher beobachtet eine Menschenmasse, die Karussellen zuschaut. Diese Beobachtung löst ein Nachdenken darüber aus, wie der Mensch und das menschliche Dasein zu bewerten seien. Dabei bezieht der Sprecher Müßiggänger, die dem Treiben „mit Behagen“ (V. 3) zuschauen, und Maurer, die auf dem Bau arbeiten (vgl. III), in seine Überlegungen ein. Das Nachdenken führt zur Erkenntnis, dass die Gruppe der Maurer, auch wenn sie von der Warte der Müßiggänger aus „wie Läuse klein“ (V. 10) wirken, einbezogen sind, denn auch sie bewegen sich im Kreis und klopfen den Takt zum Geschehen unten. Mit Blick auf den Inhalt und den Titel des Gedichts ist anzunehmen, dass „Fröhlichkeit“ die nachmittägliche Szene insgesamt bestimmt, selbst die rationale Welt der Arbeit ist von den jahrmarktähnlichen Ereignissen erfasst. Die „feurige[n]“ Maurer (vgl. V. 11) vergessen ihre Aufgabe und werden zu Schlagzeugern, die in dem Geschehen den Takt angeben. Diese Verbindung von Unten und Oben durch das helle Licht und die Kreisbewegung führen zu einem Bild, in dem die gesamte Welt in eins zusammengezogen wird, in der jeder von den Ereignissen erfasst und bewegt wird, somit selbst zum Teil eines „Karussell[s]“ (V. 1) wird, von dessen Bewegung alles und jeder erfasst wird. Diese Erkenntnis bestätigt den Eindruck einer unsicheren oder verunsichernden Wirklichkeit in einer modernen Lebenswelt. Aufgrund der Ergebnisse der Analyse lässt sich die Deutungshypothese bestätigen. Mithilfe von Hyperbeln, Tiermetaphern und uneindeutigen Satzverknüpfungen wird das „Tierische“ im Verhalten der Menschen herausgestellt, die Grenzen der Wirklichkeit scheinen sich aufzulösen. Das wird auf der Bildebene durch Mehrdeutigkeiten transportiert, etwa durch die Frage, ob die Karusselle wie flammende Sonnen wirken oder ob das Geschehen an einem sonnigen Nachmittag spielt, sowie die Frage, ob die Betrachter des Karussells sich „tierisch“ benehmen oder die Drehbewegung eines Karussells den Eindruck vermittelt, die Karusselltiere würden tanzen. Letztendlich erfasst die „Fröhlichkeit“ alle: Maurer, die Menschen und die Tiere auf den Karussellen. Diese Uneindeutigkeit spiegelt aber das Bild von einer Lebenswelt wider, die für die Menschen der Moderne nicht gänzlich durchschaubar oder steuerbar ist. Die Welt erscheint irreal, der Unterschied zwischen den Tieren des Karussells und den Menschen verliert an Trennschärfe, sodass ungeklärt bleibt, ob die Tiere eine (bedrohliche) Lebendigkeit gewinnen oder aber die Szenerie um das kreisende Karussell als Bild für die „tierische Natur“ des Menschen zu verstehen ist. Die Eingangsverse, die ein Bild der „großen Karusselle[...]“ (V. 1) beschreiben, die bedrohlich wie „flammende Sonnen“ (V. 2) rauschen und sausen, muten fast apokalyptisch an, sodass die beschriebene Szene nicht allein „Fröhlichkeit“ illustriert, sondern zu einem Bild wird, das eine Menschenmenge zeigt, die von der Dynamik der Zeit überrollt zu werden droht. Zudem wird die Verlässlichkeit der Wirklichkeitswahrnehmung in Frage gestellt. Somit kann das Gedicht „Fröhlichkeit“ von Georg Heym als Dinggedicht bezeichnet werden, denn die Karussellszene wird zum Bild der dynamischen, aber unsicheren gesellschaftlichen Wirklichkeit (vgl. S. 99). 7