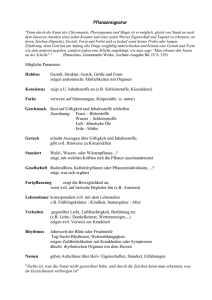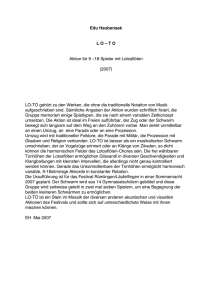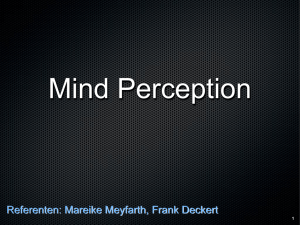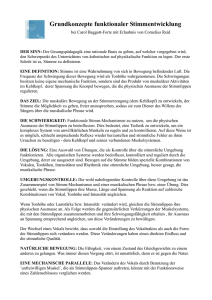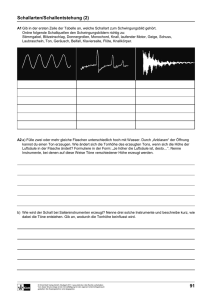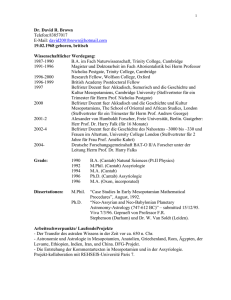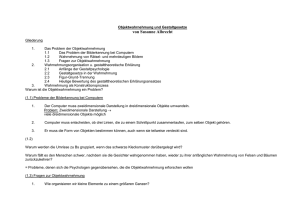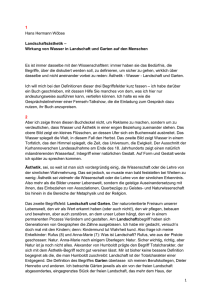Platons Sirenen
Werbung
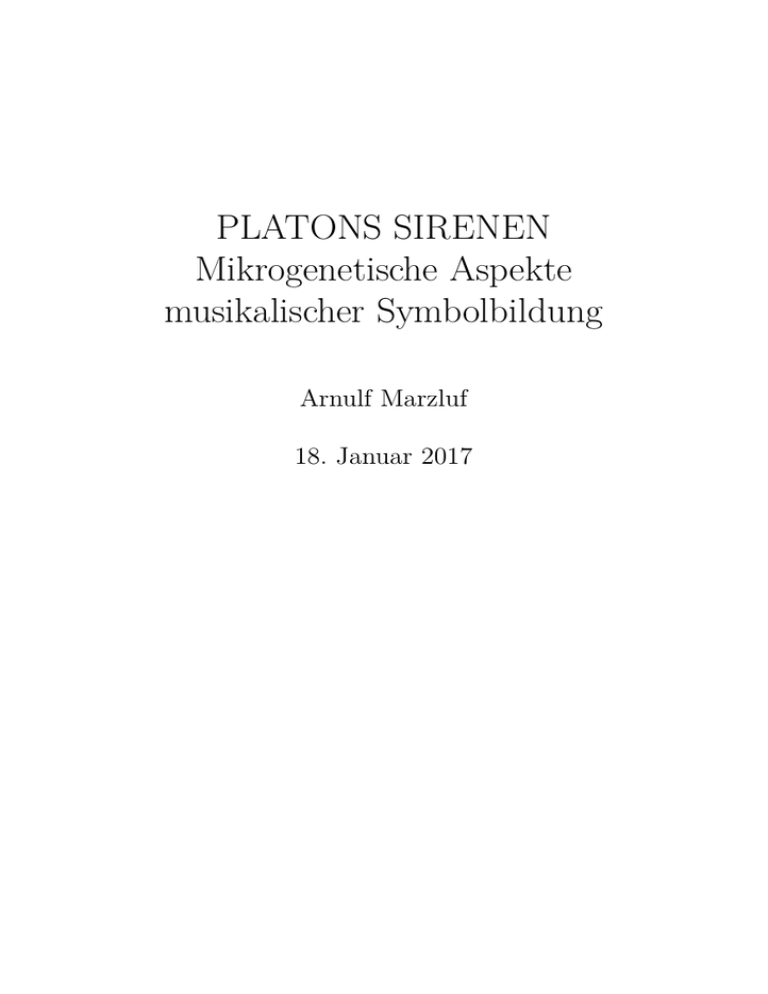
PLATONS SIRENEN Mikrogenetische Aspekte musikalischer Symbolbildung Arnulf Marzluf 18. Januar 2017 Inhaltsverzeichnis 1 Sirenen 2 Mikrogenese 21 3 Gravitationsanalyse und Hörfunktion 38 4 Mikroskalen 49 5 Fühlen 60 6 Geometrie des Intervalls 66 7 Fequenzen als Informationsträger 84 8 Die musikalische Hand 87 9 Symbol als Zeichen subjektiver Entdifferenzierung 10 Kollektiv und Tierschicht 3 110 117 1 Sirenen Platons Politeia endet mit der Erzählung eines Mannes über die Reise seiner Seele ins Jenseits, und was sie dort gesehen hat. Er war im Krieg getötet worden und ins Leben zurückgekehrt. Der Glaube an einen Dualismus von Körper und Seele erlaubt dem Berichterstatter, den Körper gesondert von der ihm zugehörigen Welt zu betrachten und sich allein auf die Seele zu konzentrieren. Der Bericht handelt also nicht von der körperlichen Wahrnehmung des Mannes, sondern von dem, was die Seele gesehen hat. Hier einen Unterschied zu machen, ist deshalb von Bedeutung, weil die Darstellung nicht den Regeln folgen kann, die sich aus einer bewussten Wahrnehmung der Objektivität ergeben. Die Redewendung „was er dort gesehen hat“ (ἐκει ἴδοι) verbindet das deiktische und gern auf die Unterwelt bezogene „dort“ mit einem Sehen, das als Kategorie einer Wahrnehmung zu verstehen ist, die mehr umfasst als das visuelle Vermögen. Sehen oder Sichtbarkeit sind Formen der Präsenz, an der laut Erzählung Seelen teilhaben, deren kollektive Reise zu einer geraden Lichtsäule führt. Nachdem die Wanderer in das Licht eingetreten sind, sehen sie das „Band des Himmels“, das zu dieser geraden Form nicht passt. Dass δεσμός mehr bedeutet als Band, zeigt sich in der doppelten Funktion des Zusammenfassens und des Umlaufens, denn περιφέρω meint eine kreisförmige Bewegung, durch die ein Zusammenhang hergestellt wird. Hier scheinen der Zusammenhalt und die rotierende Bewegung eine Einheit zu bilden, sodass der δεσμός durch die rotierende Bewegung der Spindel zustande kommt, also erst die Aktion den Zusammenhalt begründet. Das ist ein Vorgriff auf die folgende Beschreibung der Spindel, deren Aufgabe vom Handwerk des Spinnens und Webens auf die Kosmologie übertragen wird. Ausgangsmaterial für das Spinnen ist 3 die Wolle, die durch die Spindel in eine Form, den Faden gebracht wird, der wiederum zu einem Gewebe verarbeitet werden kann. Die Wolle ist materies, Rohstoff einer Agrarkultur, deren Leistungen auf Techniken beruht, Rohstoffe einer Bearbeitung zu unterziehen und in Brauchbares zu verwandeln. Platons Handwerkertopos gründet sich auf diese Leistung der Zurüstung und Umwandlung und erscheint ausführlich im Typus des Demiurgen im Weltschöpfungsepos Timaios (29 A). Die Welt ist nur, insofern sie geschaffen wird, eine Kunst-Werk, das den Schöpfer preist. Die ἀνάγκες ἄτρακτον verbindet das Wort für den Zwang mit dem für die Spindel als Verdinglichung der Drehung und Wendung, in denen die Seitenbedeutung der Marter enthalten ist, falls man das lateinische torqueo (tormentum „Dreh- und Marterwerkzeug“) hinzuziehen kann. Mit τρέπω „wenden, drehen, in die Flucht schlagen“ ist eine Umkehr als Handlungsintention angesprochen, die vor allem in der strafenden Marter bewirkt werden soll. In der Spindel der Notwendigkeit ist die Bewegung des Wiedergeburtsverfahrens einbeschrieben, der „todbringende Umlauf für das menschliche Geschlecht“. Mit ἠλακάτη „Spinnrocken“ ist ein Bild für die kosmologische Achse gefunden. Für die Spindel verwendet Platon wenige Zeilen später das Wort σφόνδυλος („Halswirbel, Wirbelknochen“, übertr. „Säulentrommel, Spinnwirtel“); σφόνδυλιος ist der Wirbelknochen als Teil der Wirbelsäule, die mitten durch den aufrecht sich bewegenden Körper geht und ihn trägt. Die Lesart des Wortes als Wirbelknochen stützt eine jüdische Überlieferung, derzufolge die sieben Vokale bzw. Töne und die sieben Halswirbel den sieben Urvätern bis Henoch zugeordnet werden, auf den sich der Name für den obersten Halswirbel bezieht, der im Griechischen „Atlas“ heißt, bei Aischylos: „der Himmel und Erde mit den Schultern stützend...“ (Prometheus 349) – so, wie die Weltachse der stützende Faktor des Alls ist.1 Der griechi1 Eberhard Hommel: Untersuchungen zur Hebräischen Lautlehre. Der Akzent des Hebräischen, Leipzig 1917, S. 129: Der oberste Halswirbel Atlas entspricht dem Planeten Saturn, dem Saturn gehört im sphärenharmonischen System der tiefste Ton (hebräisch der „höchste“ Ton entsprechend dem höchsten Halswirbel.) Siehe auch: Hildebrecht Hommel: Mikrokosmos. Rheinisches Museum für Philologie. Neue Fol- 4 sche Name hängt wohl mit ταλάσσαι „ertragen, erdulden“ zusammen, auch „heben“ im doppelten Sinne von aufheben und halten.2 Was bei Platon noch als Weg der Erkenntnis gilt, die sich in der Umkehr der Blickrichtung ausdrückt, begegnet uns im Mythos als Leiden an kreisender Wiederholung und als Martyrium mit Musik als dessen wesentlichem Bestandteil.3 Das Pentagramm als Zeichen der Himmelsstufen enthält bereits die später ausführlichere Behandlung des Aufstiegs durch die Sphären, der auch zu den Anfängen und der Versammlung der Götter führt. Der Kosmos gerät zur Selbstbeschreibung des Körpers, die für dessen wesentliche Teile abstrakt konstruktive Formen findet, und umgekehrt finden sich in der Beschreibung des Kosmos Funktionseinheiten des Körpers. So heißt der Gaumen in mehreren Kulturen gleichzeitig Himmel, und der Hals wurde wegen seiner sieben Wirbel auch als siebenstufiger Turm bezeichnet.4 Dass der Gaumen für die Vokalisierung entscheidend ist, dürfte für das Bild eines tönenden Himmels verantwortlich sein. Der Schädel symbolisiert den kugelförmigen Kosmos mit dem Pol an der höchsten Stelle, dort, wo die Sonne sich zum Abstieg wendet; die Wirbelsäule ist zugleich die Weltachse und das Rückenmark lichtartig. Die sieben Halswirbel bilden ein Kollektiv wie die Urahnen mit Atlas an der Spitze, in der sich das Fernste mit dem Höchsten vereint. In Ägypten sind die acht Urgötter als eine königliche Person aufgefasst worden. So hat man „ihren (oft als pluralistische Götterbezeichnung determinierten) Namen demgemäß in einen Königsring eingeschlossen“.5 Das Kollektiv ge, 92. Bd., 1. H. (1943), S. 56-89. κύβος ist der Wirbelknochen, der den Raum symbolisiert. (Robert Eisler: Kuba-Kybele, Philologus, Bd. LXVIII, 1909, S. 124 2 Frisk s.a. ἀείρω „in die Höhe heben“, wohl verwandt mit dem gleichlautenden ἀείρω “zusammenbinden, an-, aufhängen“. Dafür steht genauer ἔιρω „zusammenfügen, reihen“. 3 Robert Eisler: Orphisch-Dionysische Mysteriengedanken in der christlichen Antike, 1925 4 Eberhard Hommel: Etruskisch fala(n)dum=lateinisch palatum und ein alter Name des Himmelsgottes; in: Orientalische Studien. Fritz Hommel zum sechzigsten Geburtstag, Leipzig 1917, S. 233 ff. 5 Kurt Sethe: Amun und die Acht Urgötter von Hermopolis, Berlin 1929, S. 44 5 verweist auf den Status eines Entwicklungsprozesses der Individuation, wo das Selbst noch nicht hinreichend kohärent, also fragmentiert ist,6 wie später zu zeigen sein wird Die berühmte etruskische Schale aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. enthält einen Kreis mit 28 (auflösbar in vier mal sieben) Wasserwellen, auf denen acht Delphine schwimmen, ein weiterer Kreis zeigt acht Sirenen und acht ithyphallische Silenen nebeneinander sitzen.7 Vier mal sieben sind gleich sieben mal vier Stufen von sieben Quarten, die wieder den Ausgangston erreichen. Cassio Dio verwendet das Bild eines Heptagramms für die Umlaufzeiten der sieben Himmelskörper (den Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, sowie Sonne und Mond), die den Wochentagen entsprechen. Das Heptagramm ist ein erweitertes Pentagramm (ohne Sonne und Mond) der Babylonier, das als Symbol für „Himmelstufen“ (tubkati) galt.8 Das Pentagramm lässt sich in einem Zug zeichnen, erfüllt also die Voraussetzung für eine symbolisch-geometrische Form von Planetenbahnen, auf denen die Himmelskörper kontinuierlich wandern und immer wieder den gewählten Ausgangspunkt erreichen. Die Bezeichnung Himmelsstufen deutet auf einen Aufstieg durch die Planetensphären hin, der allerdings nach sieben Stationen wieder am Anfang ankommt. Aufgrund der Ekliptik ergeben sich achtförmige Schleifenbildungen, die Eudoxos wegen der Fußfessel für Pferde „Hippopeden“ nannte. Das antike Modell ist ein mentales Konstrukt, in dem objektive Beobachtungen des Himmels überlagert sind von mathematischgeometrischen Modellen und Metaphern, die aus ontogenetisch frühen Konstruktionen der Realität stammen, weshalb die Beschreibungen Platons auch keine objekthaften Vorstellungen ergeben können. Die Wan6 Im Timaios heißt es, die vier Elemente hätten anfangs nur Spuren von sich selbst besessen, die vom Gott zunächst durch Formen und Zahlen gestaltet wurden. 7 Wolfgang Biesterfeld: Der platonische Mythos des Er (Politeiea 614 b - 621 d. Versuch einer Interpretation und Studien zum Problem östlicher Parallelen , 1970, S. 43 8 Johannes Hehn übersetzt tubqu oder tubuqtu mit „Innenraum“ als Gegensatz zu sahatu „Seite, Umfassung“. (Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und im Alten Testament, 1917, S. 7) 6 derer befinden sich denn auch an jenem Jenseitsort in einem Zustand des für Platon typischen metaphorischen Sehens, eines Sehens, in dem Beobachter und Beobachtetes ohne Distanz, d.h. ununterschieden sind. Dieses Sehen gleicht dem Traum, der erst beim Erwachen vom Bewusstsein in die sequenzielle Form einer Erzählung mit einem auktorialen Ich gebracht werden kann. Beim Sehen handelt es hier sich um keine Anschauung eines wachen Bewusstseins, und somit sind auch geometrische Kategorien Euklids, mit deren Hilfe wir die Objektivität beschreiben, nicht anwendbar. Gleichwohl sind die kosmologischen Vorstellungen im „Staat“ eng mit Raumkoordinaten verbunden, die jedoch ontogenetisch eher spät und dem Distanzsinn der visuellen Wahrnehmung und der Orientierung im Raum entnommen sind. In Platons Beschreibung überlagern sich ältere und frühere Orientierungsleistungen. Betont ist die Vertikale in Erwähnung von Stufen und Säulen, oben und unten, rechts und links, eine Orientierung, zu der sich das Kreisen als örtliche Selbstbezogenheit verbindet, während von einer dritten, topologischen Form noch zu reden sein wird. Die Vertikale ist für Selbststeuerung des Ich von so hoher Bedeutung, dass sie immer wieder von Neuem im rituellen Aufstieg und Bauen, d.h. im Erschließen eines orientierbaren Raumes symbolisch befestigt werden muss. Die Anschaulichkeit wird untergraben von inkohärenter Bilderfolge. Mateusz Strózyński kommt deshalb zu dem Schluss, dass in der Erzählung des Pampyliers Er der Raum als Symbol kontemplativer Vergegenwärtigung zu verstehen ist: „First, if space is taken literally in this myth, it leads to contradictions and diffculties in understanding, which can be resolved perhaps only by saying that myths and dreams need not to follow any logic at all. Yet the Myth of Er does follow a logic, if only we understand space as a symbol for contemplative awareness. The image of a journey through this space stands for a philosophical exercise in inner concentration and the contemplation of the divine realm of being. My claim would be that the language of space expresses the fact that cognitive awareness in Plato’s philosophy is experienced as a space in which all objects of cognition are placed. Plato never said literally that the soul is a space, but he clearly suggested it. In the Timaeus Plato pictu- 7 res the world-soul as a sphere and says that God created it as consisting of eight concentric spheres or circles, which move in opposite directions. As we see, it is almost exactly what he says about the universe in the Myth of Er. Later on, in the same dialogue, Plato says that both the universe and the soul are spheres, and that the universe is inside the soul, which contains and embraces it as if from the outside, and they share the same center. Since the soul is immaterial, Plato could not possibly mean here that the soul contains the world in some physical manner as a vessel contains wine. It must have been a way of saying that the whole universe is a unified object in the soul’s awareness, which is based on a contemplative experience in which the world is ’felt’ inside the self. Plato speaks also about an individual soul as a smaller image or even a part of the world-soul. He says that its inner movements, which symbolize its intelligent activity, should be harmonized with the circular movements of the universal soul. It is, however, not clear whether a contemplative experience of widening the soul’s awareness can be expressed in terms of unity between the world-soul and the individual soul, but it seems to be so in the Myth of Er, where by entering the light he participates in the world-soul’s vision (ἰδεῖν κατὰ μέσον φῶς).“9 Das „geradlinige Licht“ entspricht einer Säule. Dass das Licht durch ganzen Himmel und die Erde gespannt sei, evoziert ein neues Bild, das Band. Das Licht sei das „Band des Himmels“, das nun den Umkreis zusammenhalte. Den Begriff verwendeten bereits die Babylonier, vermutlich für den Tierkreis,10 „Band des Himmels und der Erde“ ist der Beiname eines Stufentempels, dessen Stufen die Planetenbahnen darstellen sollen. Das Licht scheint durch Himmel und Erde zu gehen und gleichzeitig den Umkreis beider wie Plankengürtel von Schiffen zu umfassen. Der Vergleich des Lichtes mit einer Säule revoziert die Vorstellung eines gestützten und getragenen Himmelsgewölbes. Das alte Bild der statischen Säule, die Himmel und Erde in der Weltmitte nicht nur 9 Mateusz Strózyński: A symbolic language of space in the myth of Er; in: Symbolae Philologorum Posnaniensium Craecae Et Latinae XVIII, 2008, S. 143 f.) 10 Robert Eisler, Weltenmantel und Himmelszelt, 1910 (2002), S. 99 8 verbindet, sondern auch durchlässig für Auf- und Abstieg ist, wird nun von der rotierenden Spindel verdrängt. Sind mit den Kreisbewegungen Planeten gemeint, käme der Aufstieg einem Weg durch die acht Zonen der Planetenbahnen mit dem Fixsternhimmel als äußerste Grenze gleich. Der Spinnrocken ist Stütze und Drehpunkt (πόλος), die Wirbel bedeuten Planetenbahnen. Auch das Schiff dürfte babylonischer Metaphorik entspringen.11 Die Planetengötter wandern über eine „Aufschüttung des Himmels“, ein paralleler Ausdruck für „Band des Himmels“ als Weg über das himmlische Meer und Hinweis auf den Tierkreis.12 Der Gurt, der die Schiffsplanken zusammenhält, deutet auf eine Metapher der Welt als Schiff und bezieht sich nun im Kontext jüngerer Metaphern auf die Ekliptik. Erde, Mond und Sonne gelten nach altorientalischer Vorstellung als Schiffe, der Himmel stellt ein umgekehrtes Boot dar.13 Philolaos nennt ein fünftes Element nach Feuer, Wasser, Erde, Luft: „der Kugel Lastschiff“ (ὁλκάς). Die dazu passende Vorstellung ist die Bewegung eines Körpers durch Tragen oder Fahren. So wird bei den Ägyptern die Sonne im Schiff gefahren, in der nordischen oder germanischen Mythologie im Sonnenwagen. Bewegung zerfällt in ein Bewegtes und ein Bewegendes, einen Körper, der trägt, und einen, der getragen wird. Diese Beziehung schafft insofern einen Raum, als es sich um ein Enthaltensein handelt, um ein Bewegendes, das das Bewegte enthält, ein vom Tragenden Getragenes, vom Fahrenden Gefahrenes. Was sich bewegt, wird bewegt, so die anthropomorphe Vorstellung der Bewegung von Objekten. Die Selbstbewegung hingegen ist ein animalisches Vermögen, der Gefahrene „fährt“ sich selber, wenn er sich bewegt. Sofern die Planeten Glieder eines Körpers sind, des Kosmos, haben sie Anteil an der Selbstbewegung dieses Körpers, und Körper, die sich dank einer inneren Span11 Eisler, S. 100 Eisler, Weltenmantel, S. 99 13 Eisler, Weltenmantel, S. 725 12 9 nung selbst bewegen, leben.14 So sind die Planeten keine Einzelwesen, sondern bilden eine organisierte Schar. Die Bewegung macht den Bewegten ebenso zum „Inhalt“ wie die Wahrnehmung von Bewegung den Wahrnehmenden. Dieser Relativismus drängt sich bei der Beobachtung der Planetenbewegungen auf, die den Beobachter als „Inhalt“ setzen. Die Erde ist deshalb Mittelpunkt des Weltmodells, weil sie mit dem Ort als Beobachterstandpunkt zusammenfällt und alles andere umfassender Umkreis ist. So handelt es sich bei den im Kreise laufenden Himmelskörpern um Formen der aktiven Umhüllung, deren formale Reduktion auf geometrische Beziehungen eine intelligible Welt erzeugt, die das Ganze durchzieht und umschließt. Die Metaphorik enthält Objekte des umhüllenden Schutzes – das Haus, das Zelt, die Höhle als statische Formen, das Schiff und der Wagen nehmen eine Art von Bewegung auf, die die Planeten reiner und der Anschauung gegenüber angemessener darstellen. Man wird Planetenbahnen unter der Kategorie der Umhüllung zusammenfassen können. Die Stimme ist intentional, weil ihre Grundbedeutung im Sagen oder Verkünden liegt – φημί. Der Laut der Stimme ist bedeutender Laut, insofern er seine Bedeutung aus der Verbindung mit anderen Stimmen gewinnt. Frisk deutet das Verb als Vorgang des Klärens, weshalb das indogermanische bha- „sprechen“ mit dem lautlich identischen altind. bha-ti „leuchten, scheinen“ auf denselben Sinn zielt, nämlich „sagen < erklären, klar machen“. In der Doppelbedeutung von „Laut/laut“ liegt eine ähnliche Kategorie vor, die für eine deutliche Information steht, ohne dass sie auf eine bestimmte Sinneswahrnehmung beschränkt ist. Die symbolische Form der Verkettung dient der Einsicht als einem Orientierungserlebnis, das der Pamphylier angesichts des Himmelsbandes und der Drehungen der Spindel erfährt. Der Raum wird vom Aufstieg ebenso 14 Der Kosmos ist ein Lebewesen oder ein Tier – ζ῀οον (Eva Sachs, Körper, S. 47) wobei das alternative βίος Hinweise auf verschiedene Metaphern gibt. Awest. jya-tu gleich altind. *jiya-tu- „Leben“ entspricht aind. j(i)ya, aw. jya „Sehne“ (des Bogens), βιός „Bogen, Bogensehne“; in βία, βίη ist ein altes zweisilbiges Wurzelnomen bewahrt, das in identisch gleicher Form auch in aind. j(i)ya ’Übergewalt’ aufbewahrt wird“ (Frisk). 10 umrissen wie vom Umkreisen, das sich ein Zentrum schafft. So rücken die acht Stimmen ins Zentrum einer phonetischen Harmonie, die sich im Sprechen ebenso ausdrückt wie im Musizieren, d.h im Hymnus, der in wechselnden Verkettungen der Elemente – der Sprache und der Musik – beides umfasst. Der Hymnus lässt sich somit auch als Umhüllung oder als eine Umkreisung verstehen. Die Bewegung ist deshalb essentiell, weil sie in der Entfaltung von Teilaspekten eines Ganzen erst mit dem letzten Glied der Kette vollendet wird und sich die Bedeutung des Ganzen enthüllt, so, wie eine Rede ihren vollen Sinn erst am Ende offenbart, wobei der Weg dorthin auch symbolisch als Aufstieg gelten kann oder als Erreichen des im Anfang gesetzten Endes oder Zieles. Die Weltseele bildet im Timaios (34 B und 36 E) eine Figur, die mit dem X bezeichnet wird, das den Kreuzungspunkt der Hippopede darstellt. „Indem er aber in seine Mitte eine Seele setzte, ließ er diese das Ganze durchdringen und auch noch von außen her den Körper umgeben und bildete als einen im Kreise sich drehenden Kreis einen alleinigen Himmel, der einsam ist, aber aufgrund seiner Vortrefflichkeit selbst mit sich selbst zusammenkommen kann und keines andern bedarf...“ (34 B) Die in der Lichtsäule Stehenden müssen von Formen umgeben sein, die ineinander kreisend sich in der Harmonie eines δεσμός bewegen. Die von Platon beschriebene Spindel beruht einerseits auf der Anschauung von Himmelskörpern, die immer denselben gekrümmten Bahnen folgen und andererseits auf einer inneren Vorstellung abstrakter Formen, die die Wahrnehmungen der Bewegungen der Himmelskörper überlagern. Der mehrfache Hinweis auf ein Inneres, das zugleich ein Äußeres ist, benennt eine Ununterscheidbarkeit von Innen und Außen, die in den zurücklaufenden Schleifen der Planetenbahnen eine symbolische Form finden könnte. Ein kosmologisches Modell, das den Beobachter mit einbezieht, wie es bei der Wanderung des Pampyliers offenbar der Fall ist, operiert mit einem Mikrokosmosmodell, mit der Verknüpfung der sichtbaren mit der inneren Welt der Vorstellungen und Empfindungen, die sich beide überlagern. „Als nun die ganze Zusammensetzung der Seele dem Schöpfer nach Wunsch gediehen war, da gestaltete er daraus alles Körperliche innerhalb von ihr und brachte dessen Mitte mit ihrer Mitte 11 zusammen und verband beide. Sie aber begann, indem sie von der Mitte aus bis zum äußersten Himmel überall hineinverflochten war und diesen von außen ringsum umschloß und selbst in sich selber kreiste, mit dem göttlichen Anfang eines endlosen und vernunftbegabten Lebens für alle Zeit.“ (36 E) Die Spindel zeigt aus einer bestimmten Perspektive farbige Kreisformen unterschiedlicher Breite. Der Umschwung der Spindel ist so organisiert, dass die inneren Kreise dem äußeren Kreise gegenüber in entgegengesetzter Richtung laufen. Die Schnelligkeit der Kreisbewegungen stehen in bestimmen Relationen oder Proportionen zueinander. Auf den Kreisen sitzen die acht Sirenen, „eine Stimme von sich gebend, jede immer den nämlichen Ton, aus allen achten aber insgesamt klänge dann eine Harmonie“. Dann werden die Moiren aufgeführt, die ihren Hymnus zum Gesang der Sirenen vortragen. Wenn man das Wort ὕμνος nicht nur als Gesang übersetzt, sondern im Sinne einer Lobpreisung, dann besteht die Möglichkeit, dass mit ihr die göttliche Harmonie erst geschaffen wird. Der Gesang zu Ehren der Götter, so Giorgio Agamben, hält sie am Leben und „bringt als wirksamer Ritus die Herrlichkeit erst hervor“.15 Die Stimmen der Sirenen in der Acht sind harmonisch verkettet, weshalb die Moiren sie mit ihrem Gesang lobpreisen. Als Faktoren des Vergangenen, Gegenwärtigen und Zukünftigen bilden sie eine Zeitfolge, jede Moira steht für einen Zeitfaktor und bewegt die Kreise der Spindel, woraus die Herrlichkeit der Harmonie resultiert. Die acht Stimmen deuten weniger auf die heptatonische Skala als auf die Demonstration der Oktave und ihre Teilungen hin, die harmonische Tonproportionen ergeben. Erst diese Abstraktion sichert die Tonhöhen als unterschiedene Einheiten, die in Relation zueinander stehen und nur in dieser Relation ihre formale Identität bewahren. Die Moiren wiederum erschaffen in Sukzession eine geordnete Folge, die als harmonische Struktur wahrgenommen wird, welche wiederum der Herstellung einer geordneten Folge dient. Die Folge gleicht einem Handeln, das sich ergebnisorientiert in der Zeit entfaltet und im Produkt enthalten ist. Einleuchtend ist, was 15 Giorgio Agamben: Herrschaft und Herrlichkeit, 2010, S. 271 12 in eine Handlung übersetzt werden könnte, weil es aus einer Handlung heraus entstanden ist. Sprechen ist eine Form von Handlung auf symbolischer Ebene, doch immer noch motorisch vermittelt, indem Laute vom Muskel- und Vokalapparat erzeugt werden. „Mich, den unvergänglichen Gott, preisen die sieben Buchstaben der Urlaute als den unermüdlichen Urvater alles Seienden. Ich bin die unzerstörbare Leier des Alls, die die Sangesweisen der Drehungen des Himmels ordnete“, zitiert Eusebius einen Hymnus mit sieben Vokalen ägyptischer Priester an Hermes-Thot, eine synkretistische Figur der Spätantike. Εἰρω, das Präsens zu ἡερμοσάμεν „ordnete“, bedeutet eher ein Aneinanderreihen. Man könnte ein Wortspiel mit ἑρμενεύω „deuten, auslegen, übersetzen“, das ebenfalls auf εἰρω zurückgeführt werden kann entsprechend der Nachbarschaft von Sagen und Reihen, lat. sermo.16 Das „Auslegen“ scheint darauf hinzudeuten, dass die Teilaspekte eines Ganzen von der Leier in eine Reihenfolge gebracht werden, so, wie die musikalische Skala aus einem Ganzen hervorgeht, das man den Grundton nennen könnte. Da von sieben Buchstaben der Laute, der Vokale (ἑπτα φωνήεντα) die Rede ist, die als phonetisches Band dienen, handelt es sich beim Ordnen der Stimmen des Alls um Töne, die eine Stufenordnung bilden. Die Folge wird allein durch die sukzessiv sich verändernde Tonhöhe garantiert, für die es eine Erzeugungsregel gibt – die Teilung, d.h. die Obertonreihe in mathematischer Abbildung. Im Philebos (18 B) wird Thot als Erfinder der Gliederung des Lautes (φωνή) in drei Arten unterteilt – φωνήεντα, φθ΄γγος, ἄφονα. Die Vokale bilden aufgrund ihrer unterschiedlichen Helligkeit eine Nähe zu den Tonhöhenunterschieden der musikalischen Skala.17 16 ἕρμα ist die Stütze, die unter die ans Land gezogenen Schiffe gelegt wurde, um sie aufrecht zu halten; daher die übertragende Bedeutung (Herme) von Menschen als Stütze oder Säule. 17 Von den 24 Zeichen des ägyptischen Alphabets sind die vier ersten zur Vokalbezeichnung verwendet worden. Von den übrigen sind acht Sonanten und 12 Konsonanten. „Es verhält sich tatsächlich die Zahl der Vokale zur Zahl der Sonanten, wie die Zahl der größten Teilgruppe, der Konsonanten, zur Buchstabenzahl des ganzen Alphabets„, sodass „die Zahl der Vokale 4 tatsächlich den einheitlichen und vereinheitlichenden δεσμός, das Zahlenband zwischen den drei Teilzahlen 4, 8, 12 darstellt, so 13 Das εἰμί δ΄ ἐγὼ gehört zum Typ der Ich-Prädikation, mit der sich der Ich nennende Gott Aspekte seiner selbst zu erkennen gibt. Ich ist sozusagen die Fassung einer Fülle von Aspekten, die in einer Anzahl von IchPrädikationen einem Kollektiv derselben Zahl mitgeteilt werden kann, sodass der Eindruck entsteht, Ich sei dieser Zahl zutiefst verbunden und bedeute die entdifferenzierte Form des Kollektivs, oder umgekehrt dessen Zusammenfassung, die dadurch geleistet werden kann, dass das Ich die Auflösung der Differenzierung betreibt. So kann dieses Ich in rituellen Formeln und Sagen die überschüssige Zahl (13 oder 4) bedeuten, die Gefahr bringt.18 Die χέλυς spricht als Begründerin der Ordnung des Kosmos, den sie selbst verkörpert. Die Selbsterzeugung eines Gottes in Form von Ich-Prädikationen „Ich bin der...“ ist bereits aus altägyptischen Texten bekannt. Die oft paradoxen Formulierungen kommen durch die Bildung in sich widersprechender Aussagen mit Rätselcharakter zustande.19 In der griechischen Anthologie heißt es zum Beispiel: „Mich sieht kein Sehender, nur wer nicht sieht, erblickt mich. Es spricht kein Sprechender, es läuft kein Laufender. Obwohl ich lüge, sage ich die Wahrheit“.20 Solche Rätselreden, deren paradoxe Logik prälogisch ist, verweisen frühe Denkformen, für die die passende Mathematik – etwa eine Theorie über selbstbezügliche Aussagen – erst mit Kurt Gödel möglich wurde. Der Symbolbereich des Allgemeinen, der die individuelle Anschauung überschreitet und kollektiv strukturiert ist, ist zu Platons Zeiten ein anderer als heute, und somit einem heute unmittelbaren Verstehen unzugänglich. In einer Nebenbedeutung des Wortes ἀνάγκες ἄτρακτον schimmert die Wendung als Änderung einer Richtung durch, der ein Wert – gut oder schlecht – zukommt. Die Wendung geschieht auch im Aufstieg, dem Bilwie nach der platonischen Sprachtheorie wirklich die Vokale den unentbehrlichen δεσμός zwischen den Konsonanten bilden.“ Robert Eisler: Platon und das ägyptische Alphabet. Archiv für Philosophie, 1. Abt. Archiv für Geschichte der Philosophie, XXXIV. Band, S. 1 ff. 18 Georg Hüsing: Studien zu den Schicksalsgestalten. 1. Die vierte Märge, Wien 1934 19 Otto Weinrich: Triskaidekadische Studien, Gießen 1916, S. 59, Anm. 20 Hans-Martin Schenke: Der Same Seths: Hans-Martin Schenkes Kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und Neuem Testament, herausgegeben von Gesine Schenke, 2012, S. 634 14 der wie Stufen oder Sphären entsprechen. Der vorangehende Teil der Geschichte vom Pamphylier beschäftigt sich mit der Bewertung von Handlungen der Verstorbenen und dem „krummen“ – auch schief oder schräg genannten – Weg durch die Planetenbahnen. Im übrigen ist das Leben ein Zustand, der im Vergleich zu dem der Götter im Himmel eher dem Tod gleicht, das eigentliche Leben also anderswo spielt als auf Erden, sodass die Todessehnsucht eine Begleiterscheinung des Strebens nach Veredelung der Seele ist, dem auch Odysseus beim Gesang der Sirenen zu erliegen drohte. Die wilden Seiten der Seele sind durch verschiedene rituelle Maßnahmen zu mildern, zu denen auch die Musik gezählt wird. Schönheit verführt ebenso wie das Gute unter diesem Aspekt zur Todessehnsucht, hinter der sich – nachdrücklich im Christentum – das Streben nach einer anderen Seinsweise verbirgt.21 Der Hymnus der Moiren wird von ihren Händen begleitet, die abwechselnd die Kreise der Spindel in Bewegung versetzen. Das Bild verweist auf die babylonische Ishtar als Hand und ein pythagoreisches Symbolon, wonach die Bären die Hände der Rheia sind – ἄρκτοι ῾Ρέας χεῖρες, denn die „Die Circumpolargestirne der beiden Bären gelten als die Hände, mit denen die am Nabel der Welt stehende Göttin der geringelten Polschlange, die ’Helike’, die Weltachse und damit das All in quirlende Bewegung versetzt“.22 Das zur Polschlange passende Verb εἰλέω führt zu einer Bewegung, der Windung, die komplizierter verläuft als die Umkreisung. Die Windung umhüllt, engt ein. „Überhaupt ist es nicht immer möglich, εἰλέω „drängen“ und εἰλέω „winden“ rein zu scheiden (Frisk). Das Substantiv εἰλέος mit den drei Varianten „Darmverschlingung, Schlupfwinkel, Höhle der Tiere (bes. der Schlangen), ein Weinstock“ zeigt, dass das Wort eine körperlich emotionale Konnotation hat. Zur Sippe gehört das Wälzen, vielleicht auch Quälen (idg.*uel). Pentagramm oder Heptagramm sind Zeichen für einen siebenfachen Schlupfwinkel („Siebenschlucht)“, dem πεντέμυςηος oder ἑπτάμυςηος, aus der nach der Theo21 22 Im Phaidon-Dialog (85 E) wird die Seele mit einer Leier verglichen. Eisler, Kuba-Kybele, S. 181 15 gonie Pherekydes von Syros’ ein Fünfwinkelgeschlecht hervorgeht.23 Dem voran gehen drei Urwesen Zas, Chronos und Chtonie. Mit μυχός wird der innerste Ort, das Innere, das Versteck und die Vorratskammer, der abgelegenste Winkel im Hause bezeichnet, „als supponiertes Verbalnomen, eig. *„das Schlüpfen, das Hineinstecken, Verstecken“ (Frisk); μύω „sich schließen“, bes. von den Lippen.24 und Augen; μύ ist ein mit geschlossenen Lippen hervorgebrachter Laut, mit dem Schmerz ausgedrückt wird. Die Hände der Moiren deuten auf Formen hin, die nur unzulänglich beschrieben werden können. Sollte die Parallele der Spindel zur Polschlange zutreffen, sind in der Spindel Helix und ineinander verschachtelte Hohlräume wie auch immer vereint. Die Hände öffnen einen Raum, in dem sie ich wiederum bewegen. Ein ähnliches Bild der innenraumschaffenen Hände liegt in Ägyptens Töpfergott Chnum vor. Im Mythos der Göttermutter Rheia, der Hand, sind die Finger ihre Kinder, δάκτυλοι, Priester der Kybele, die als Verkörperung des mütterlich einschließenden Raumes – in „κύβος“ verdinglicht – gelten kann; κύβος bezeichnet ebenso den Würfel wie den Wirbelknochen, arabisch ka’ab „Würfel“.25 Man ahnt den Zusammenhang der Finger mit dem Mund, wenn der Finger als Zeiger auf das deutet, was der Mund dann als Begriff bezeichnet. So wird der lat. digitus von dico „zeigen, sagen“ abgeleitet. Λιχανός ist der Zeigefinger als „Lecker“ – ein Hinweis auf den Mund. Ein Wechsel der Beobachterposition von innen und außen dient Platon zuweilen, um einer bestimmten Wahrnehmung Unzugängliches dennoch von einer anderen Position aus „sichtbar“ zu machen. „Another detail of this vision is the three Moiras sitting around the universe in equal intervals on their thrones. Lachesis, Cloto and Atropos have no place to sit unless it be outside the whole universe and their thrones must be imagined to be somehow suspended in space. They cannot possibly be in the world, like the Sirens appear to be, so they must be around the whole 23 Eisler, Weltenmantel, S. 331 Die Ränder der Wirbel der Spindel heißen ebenso wie die Lippen 25 Eisler, Kuba-Kybele, S. 124 ff. 24 16 cosmic sphere. This sphere lies upon the knees of their mother, Ananke, and they surround it. Again, how could Er see all of them at once? His sight must have been larger than the width of the universe, in the frst place. He also must have been outside the universe to have been able to embrace all of this cosmic picture. The three Moiras do not only sit there and watch, they also move the spheres. Cloto who symbolizes the present time touches and moves the outer circle of the fxed stars, Atropos who symbolizes the future touches and moves the inner seven circles, and Lachesis who symbolizes the past moves sometimes these, sometimes others. How can it be that they literally touch these circles? Do they somehow put their hands inside the universe from outside?“ So sind die Moiren größer und kleiner zugleich, genauso wie der Pymphylier, der von innen das Äußere und von außen das Innere schaut. „Looking into or through this light, Er sees that it is the spindle of Ananke, the spindle of the world. What he sees is entirely different from the vision described before. Until now he has just seen the sphere of universe and its axis. These two in normal conditions are impossible to be seen from the same observation point, since one is outside, the other inside.“26 Ein im Phaidros (246e 4 – 247a 2) beschriebener Auszug der Götter, führt sie an die Grenzen (ἄκρος) des Himmels, geht darüber hinaus und so stehen sie auf dem Rücken des Himmels, wo sie der Umschwung mitnimmt und sie sehen, was außerhalb des Himmels ist (ἔξω τοῦ οὐρανοῦ). Die Stimmen der Sirenen entstehen an solchen Übergängen (ἄκρος) zwischen „Räumen“, die zusammen eine Stufenfolge bilden, Symbol eines Aufstiegs, der in die fernste Ferne führt, wo die Perspektive des Beobachters wechselt. Er begegnet einer farblosen, gestaltlosen und unkörperlichen Wesenheit, die nur dem nous zugänglich ist. Mit den Bewegungen der Planetenbahnen und den Kreisformen des Himmels nähert sich der „Beobachter“ bereits einer Sphäre der Abstraktion, die er mit der Überschreitung der Grenze endgültig erreicht. Der Aufstieg ist mit einer Reduktion der Fülle objektiver Wahrnehmung verbunden, die formale Phänomene zeitigt, wie man sie von Kunst und Wissenschaft 26 Mateusz Str’ozy’nski: A symbolic language of space in the myth of Er, S. 133 f.) 17 kennt. Mit der Beschreibung der Himmelsregionen, der Konfiguration von Planeten und Fixsternen, ist eine abstrakte Welt entworfen, die als Übergang zu einer gänzlich unanschaulichen Objektivität dienen kann, deren Wirken der sichtbaren Welt zugrunde liegen soll. Die Aufstieg in derlei Regionen der Abstraktion ist zugleich ein Abstieg in die Anfänge der Weltentstehung, doch dieser Genesis liegt die des Bewusstseins zugrunde, dessen Erlebnisfülle das Ende eines Differenzierungsprozesses kennzeichnet, der mit primitiven Formbildungen beginnt. Vergleicht man den Aufstieg mit einem Weckvorgang, so besteht der gleichzeitige Abstieg im Rückgriff auf frühe abstrakte Stadien der ontogenetischen Entwicklung, die ein waches Bewusstsein und dessen abstrakte Operationen ermöglichen. Die Aktivierung der Wahrnehmung im Erwachen kann als Metapher für den onto- und phylogenetischen Prozess der Bewusstseinsbildung dienen, die den Erwerb handlungs- und wahrnehmungsspezifischer Fähigkeiten mit umfasst. Die rechte Hand (Klotho berührt den äußeren Umkreis) ist mit dem gegenwärtigen Sein (τα ὀντα) „im Gegensatz zum Vergangenen und Zukünftigen“ (Pape, Griechisch-deutsches Wörterbuch) verbunden. Im Timaios (36 C) bezieht sich die äußere Bewegung zur Natur des Selben (ταὐτου φύσεως) und wird rechtsherum geführt. Die Linke ist mit dem Planen und Beabsichtigten (μέλλοντα zu μέλλω „Ich gedenke Etwas zu tun“) verbunden, das noch innerlich ist (Atropos dreht die inneren Kreise, die im Timaios dem „Anderen“ zugehören und links herum führen.) So sind Innen- und Außenwelt durch die Hände vermittelt, die Vermittlung durch Lachesis vertreten, die mit beiden Händen für das Werdende steht, das ins Sein Tretende. Damit sind der äußere und die sieben inneren Kreise, die sich in der gegensätzlichen Richtung zum äußeren Kreis bewegen, zu den Händen in Beziehung gesetzt. Der äußere achte Kreis bewegt sich am schnellsten, die inneren sieben, bewegen sich ihm entgegengesetzt. Zählen die inneren Kreise nicht zum Sein, sondern zur Intention, dann ist der schnellste äußere der „höchste“ Ton (also der tiefste, der Grundton), die sieben anderen Stimmen der Sirenen hier verborgen. Die pythagoreische Teilung der Oktave besagt, dass alle sieben Töne über Teilungen definiert sind. Im Grundton sind die Skalentöne als 18 erste Harmonische der Teiltonreihe enthalten. Man kann annehmen, dass die Wirbel, die „um die Stange“, also die Mitte herum eine zusammenhängende Fläche bilden, hier den Grundton, das Zentrum der Obertonreihe darstellen. Er bildet die Rotationsachse der Stimmen, die im Kreise herumgehen, somit aber auch die Umhüllung der Töne durch die Ecktöne der Oktave. Der Beschreibung des δεσμός als Zeichen der rekursiven Verschränkung von Innen und Außen entsprechend, bilden Sein und Werden, Intervallskala und Melos eine „Seltsame Schleife“. Im Gesang des Hymnos verdichtet sich das Melos zur ewigen Harmonie so, wie die kunstvolle Handlung das Sein, der göttliche Handwerker das Objekt hervorbringt. Die Herstellung der Weltseele durch den Demiurgen, die im Timaios beschrieben wird, gehört genetisch zu einem früheren Stadium als die Jenseitsreise des Pampyliers. Das Handwerksmotiv deutet auf eine Aneignung der Objektivität hin, die noch nicht über die Sinnesorgane Auge und Ohr abläuft, ein Stadium, auf das die Beschreibung von Farben und Tönen der Spindel verweist, auch wenn diese den Handwerkertopos noch in sich birgt. Die von Zwang oder Verlockung angestrebte Wendung ist auf abstrakte Formen und Strategien eines Logos oder Eidos gerichtet. Die Abwendung von der Objektwahrnehmung und der Vielfalt des Seins beruht auf der Attraktion im Inneren ablaufender Prozesse, die in Konstruktionen des Bewusstseins wahrnehmbar werden können. Die bewusst in Gang gesetzten und kunstvoll organisierten Formen des Denkens und der Künste regen innere Prozesse an und werden wiederum von ihnen angeregt. Es handelt sich um die Kombination eines subjektfernen Zustandes und symbolischen Todes des Subjektes mit einem subjektbezogenen Zustand, die beide um einen Pol rotieren, solange die Zustände sich in Balance befinden. Da das Subjekt sich ontogenetisch erst bilden muss, sind frühe Bewegungs- und Erlebnisformen „allgemein“, weil die Besonderung auf Erfahrung beruht, die von einem Selbst als subjektiver Kern getragen wird. Der Begriff der Abstraktionen wird in der Regel so verstanden, dass von der Vielfalt der Wahrnehmung so viele Momente abgezogen werden, bis nur noch Grundrisse übrig bleiben, mit denen die Vielfalt in Kategorien eingeteilt werden kann. Abstraktion funktioniert 19 hier als Reduktion von Vielfalt durch Vergleichen und Feststellen von Ähnlichkeiten der verglichenen Phänomene untereinander. Den gegensätzlichen Weg geht die Wahrnehmung in der gestalttheoretischen Mikrogenese. Die Objektbildung durchläuft einen Prozess, der mit einer pauschalen Figuration beginnt und infolge des Inputs an Informationen durch die Sinnesorgane sukzessive präzisiert wird. Am Ende des Prozesses, der ein Bruchteil einer Sekunde dauert und ständig erneuert wird, steht das erlebte Objekt in der vollen Komplexität einer realen Erscheinung. „Abstrakt“ heißt hier, dass mit einer Redundanz an Informationen begonnen wird, die im Lauf der Objektbildung unter Einfluss der Daten der Sinnesorgane reduziert und angepasst werden. 20 2 Mikrogenese Für Jason W. Brown verläuft der Wahrnehmungsprozess als komprimierte Form phylo- bzw. ontogenetischer Aufbauphasen. „The model of visual perception outlined in this paper departs fundamentally from these prior accounts in that the perception does not begin with the detection of object features at the cortical level, nor is it the result of interaction between two or many components in a computational system. Instead, the perception develops within the phyletic core of the brain, in a direction corresponding to that of forebrain evolution. The perception is not constructed directly out of sensory material. Rather, it is proposed that a series of sensory-perceptual, or physical-mental transforms maintain an unfolding cognitive representation on a course so as to model an external object. Specifically, there is a parallel hierarchy of sensory (physical) levels and perceptual (cognitive) levels distributed over evolutionary brain structure. The sensory levels act to constrain the development of the perceptual levels, while the perceptual levels – wholly cognitive and representational – are the contents which undergo transformation. Levels of sensory constraint appear to be discontinuous or nodal... One can speak of a retino-tectal or thalamo-striate component. In contrast, the perceptual development seems to be a continuum with gradual wave-like unfolding from one phase to the next.“1 Die konkretisierte Objektwahrnehmung verläuft parallel zum Selbstbewusstsein, setzt also einen ontogenetischen Prozess der Subjekt-Objekt-Differenzierung voraus. Eine Aktualisierung früher Entwicklungsstadien, die als Regression bezeichnet wird, ist mit einer Auflösung der Differenzierung, d.h. einem Verlust des Selbstbewusstseins verbunden, das ontologisch den Tod des Subjektes bedeutet. So ist anzunehmen, dass der Tod im Mythos auf die Auflösung der Besonderung hinweist, die stattfindet, wenn der ontoge1 Jason W. Brown: The Life of the Mind, 1988, S. 174 21 netische Prozess „rückwärts“ verläuft und Phänomene aktualisiert, die in ihrer Allgemeinheit als Grundlage von Gesetzmäßigkeiten dienen, unter die Vielheiten mit gemeinsamen Merkmalen subsumiert werden können, im Denkprozess also Kategorien ergeben. Die Regression wird in einer geschwächten Realitätsanpassung sichtbar, die in leichter Form zu Verhaltensfehlern führt und in schweren Fällen mit einer tiefgehenden Persönlichkeitsstörung verbunden ist, deren Symptome als Metaphern von Ereignissen lesbar sind, die die Regression verantworten. So kann ein Wort, mit dem sich aufgrund eines Erlebnisses ein unangenehmes Gefühl verbindet, zum regressiven Aufsuchen einer Wortbildungsstufe führen, auf der ähnliche Wörter eine Gruppe bilden und daraus ein alternatives Wort gewählt werden kann, das allerdings nicht genau zutrifft und nur als Metapher oder Wortspiel verstanden werden kann. In der Äußerung sind nicht nur semantische Regressionen möglich, sondern auch phonetische, sodass ähnlich klingende Wörter metaphorisch verwendet werden können. Der Vorrat an Auswahlmöglichkeiten verringert sich von Stufe zu Stufe des ontogenetischen Prozesses. Das Symptom ist Zeichen eines Verharrens auf einer Stufe, oder es handelt sich um eine Rückkehr zu einer solchen, weil die Realitätsanpassung nicht gelingt und der Rückgriff auf eine stabile Stufe einen Prozess einleiten soll, der eine bessere Anpassung sichert. Dieses Modell der mikrogenetischen Theorie, das im übrigen auch in biologischen Prozessen abläuft, gleicht makrologisch den Wiedergeburtsszyklen des platonischen Mythos.2 Die Regression ist ein Versuch ist, den Prozess noch einmal zu durchlaufen, der zur einmal erreichten kognitiven Höhe führt, die als abstraktes Ziel erhalten bleibt. Silvano Arieti nennt den Prozess „progressive teleologische Regression“. „In my conceptualization, regression – more than being related to a return to earlier stages of fixation, as Freud saw it – means renewed availability of functions belonging to lower levels of 2 In 617 D des Staates heißt es, die Verstorbenen können sich vor dem Eintritt in ein neues Leben aus den Losen der Lachesis bedienen und bíon paradeígmata (Lebensentwürfe) sowie den daimon erwählen – αἱρέω „in die Hand nehmen, ergreifen“. 22 integration. Whereas the content of symptoms may reproduce, in either identical or symbolic fashion, earlier ontogenetic experiences and their derivatives, the forms that the symptoms assume may use even mechanisms that appeared in earlier phylogenetic levels. In the schizophrenic’s psychological structure, an attempt is made to fit a higher content into a lower form.“3 Da es sich bei der Regression oft nur um Teilaspekte handelt, arbeiten unterschiedliche Prozessstufen parallel. „When the highest centers cannot function, either because of organic or psychogenic conditions, a reintegration occurs of the whole nervous system, so that some lower centers take over some of the functions of the higher centers.“4 Die Störung erzeugt parallel arbeitende Systeme, ein Phänomen, das die ontogenetische Entwicklung mitbestimmt. Es wäre dann ein Ereignis während der Evolution anzunehmen, das die Regression verursacht und die Reflexion auf die frühe regressive Stufe zu einer kognitiven Leistung geführt hat, die auf einen Umgang mit einfachen, „abstrakten“ Formen festgelegt ist. Geometrische Formen als „gute Gestalten“ zeugen nach Arieti jedoch von einem sekundären Verarbeitungsprozess, also einer Reflexion auf die durch die Hand spontan erzeugten Zeichnungen, die erst nach dieser Reflexion und Lernvorgängen visuell kontrolliert und erzeugt werden können. In der Ontogenese der Raumvorstellung liegen die ersten Erfahrungen des Kindes in der für die Hände erreichbaren Zone. Die Lage der Objekte im Raum ist für ihre Identifizierung dabei weitgehend irrelevant. Das zeigt sich in Zeichnungen, die auszuführen 3 Silvano Arieti: American Handbook of Psychiatry: Schizophrenia. Psychodynamic Mechanisms and Psychostructural Forms, 1974, ebook 2016, S. 95) 4 Arieti, Loss of Reality, S. 16. „Under the influence of the gestalt school, psychology has been dominated by the idea that objects are apprehended as wholes. This point of view is now gradually recognized as incorrect. It was the result of the fact that perception was studied as it occurs in the secondary process and in a state of full consciousness. The study of early ontogeny and microgeny reveals that objects are first perceived as parts and that only subsequently are they perceived as wholes or gestalts. However, in microgeny partperception is very rapid and remains unconscious, so that we are aware only of whole perception, or of the gestalt, which becomes the dominant one in the early stages of the secondary process.“ (Arieti, Interpretation of Schizophrenia, S. 515). 23 die Kinder später in der Lage sind, wenn die Motorik reif dafür ist. Ihnen gelingen dann Darstellungen von Objekten, die auf die frühen Erfahrungen zurückgehen, wo Raumkoordinaten noch nicht berücksichtigt werden. Jean Piaget kommt in seinen „Untersuchungen über die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde“ zu dem Schluss, dass „in dem Maße, wie der vorgestellte Raum Fortschritte macht, findet eine Art Rückstoß oder Rückstrahlung der Vorstellungstätigkeit auf die Wahrnehmungstätigkeit statt. Sobald das Stadium erreicht ist, in dem die Vorstellung imstande ist, alle Figuren des Raums in Koordinatensystemen unterzubringen (nach den vertikalen und horizontalen Achsen, die die physikalische Erfahrung anregt, sobald sie geometrisch interpretiert ist), reiht die Wahrnehmung ihrerseits die von ihr erreichten Konfigurationen in solche Systeme ein; bisher hatte sie sich mit viel beschränkteren Strukturierungen zufrieden gegeben. Der Erwachsene hat jede Erinnerung an die Etappen verloren, die einer solchen Transaktion vorausgehen.“5 Die räumlichen Relationen sind primitiv und charakterisieren „jenen Teil der Geometrie, der ’Topologie’ genannt wird und dem die Begriffe starre Formen, Entfernungen, Geraden, Winkel usw. ebenso wie projektive Relationen fremd sind... Wenn das Universum der ersten Lebensmonate wirklich... ein Universum ohne permanente Gegenstände ist, so erscheinen und verschwinden die wahrgenommenen Figuren wie bewegliche Bilder und bieten untereinander eine Folge von Formveränderungen, bei denen keine Unterscheidung zwischen Zustandswechsel und Lagewechsel möglich ist.“6 Die Berührungen der Teile untereinander bilden eine topologisch beschreibbare Gestalt. Ihre Auflösung, die in Psychosen sichtbar wird, könnte dazu dienen, eine neue Zusammensetzung zu erwirken. Da Krankheiten nicht selten auch als Heilungsvorgänge zu deuten sind, 5 Jean Piaget, Bärbel Inhelder: Die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde, GW 6, Stuttgart 1975, S. 22 6 Piaget, Entwicklung, S. 28. Siehe auch Barbara Wittmann: Linkische und rechte Spiegelungen. Das Kind, die Zeichnung und die Geometrie, in: Wolfram Pichler und Ralph Ubl (Hg.), Topologie. Falten, Knoten, Netze, Stülpungen in Kunst und Theorie, Wien: Turia + Kant, 2009, S. 149–192 24 könnte die Zerstückelung des Selbstbildes das Symptom und ein Versuch sein, Fehlentwicklungen rückgängig zu machen, indem auf einen früheren Zustand rekurriert wird. Viele Opferriten deuten auf solche Zerstückelungsphantasien hin und sind als Heilungsmethoden einer gestörten symbolischen Ordnung zu interpretieren. Der Umriss steht für eine Organisationsstufe, die die Aggregation von Fragmenten zu einem Ganzen bindet und im Denken Kategorien erzeugt. „This new formation of wholes may give some encouragement to the gestaltists, who may see in it an urge toward a Gestalt. The phenomenon may be called ’primary Gestalt’. Let us remember, however, that this phenomenon is secondary to the primary aggregation and follows mechanisms to those occuring in the formation of the primary categories.“7 Arieti unterscheidet also zwischen der Gestalt auf der Ebene des Primärprozesses von der auf der Ebene des Sekundärprozesses in psychoanalytischer Terminologie. Der Umriss als Gestalt beruht somit bereits auf einer Reflexion auf die „primary aggregation“, ein cluster von zusammenhängenden Ideen, Bildern oder Begriffen, deren Zusammenhang aufgrund von Erfahrungen gebildet werden, in denen Dinge und Momente sich in der Verkettung von Erfahrungsmomenten „berühren“. So ist eine „Schöpfung“ als Gestaltbildung nur als Verkettung von Momenten vorstellbar, personifiziert in einem Kollektiv. Es ist naheliegend, dass im auditiven Wahrnehmungsprozess eine dem visuellen Stadium analoge Aggregation fragmentierter Phänomene vorkommt, auch wenn das visuelle Objekt deutlichere Teilaspekte aufweist, die erst aufeinander bezogen die Identität des Gegenstandes ausmachen, während das Geräusch, der Laut oder Klang nicht abgetastet werden können wie das visuelle Feld. Andererseits gilt für eine undifferenzierte Wahrnehmung eine Fähigkeit, auf die Details des Feldes zugunsten eines pauschalen Eindrucks verzichten zu können, der als Erlebnis einen Kontext bildet. Haften bleibt der Cluster von Aspekten. Auf einer „tieferen“ 7 Silvano Arieti: The Microgeny of Thought and Perception; in: Archives of General Psychiatry, Vol. 6, 1962, S. 466 25 Stufe der Verarbeitung berühren sich somit die Phänomene sozusagen formal.8 Das topologische Denken, das Formen über Nachbarschaften und engere Zusammenhänge aufbaut, geht aus der Körpermotorik hervor und ist ontogenetisch früh, begründet aber auch das Gewicht des Visuellen, das mit der Lichtmetaphorik eine archaische Metaphorik erreicht. Die Wanderer in der Politeia „sehen“ in der Lichtsäule eine Verkettung, das heißt, das Sehen aggregiert die Fragmente der Welterfahrung in einer abstrakten Gestalt und bindet sie. Die Beschreibung steht auf einer Stufe des Denk- und Vorstellungsprozesses, die der Ausbildung eines euklidisch geometrisch beschreibbaren Verhältnisses von Beobachter und Umwelt vorangeht. Die dem zugrundeliegende Geometrie dürfte topologisch sein. Piaget hat gezeigt, dass Modellbildungen von Objekten einer Mathematik gehorchen können, die erheblich später entdeckt wurde als die Modelle entstanden sind. Die Fähigkeit eines Kindes, ein Schiff auf dem Kopf stehend zu zeichnen, obwohl es nie ein solches zu sehen bekam, erfordert ein anderes Konstruktionsprinzip als die Umsetzung der Objektwahrnehmung in ein Bild. Es ist anzunehmen, dass die gestalterischen Leistungen der Steinzeithandwerker ein vergleichbares Stadium der Raumerfahrung erreicht haben und der Gestaltungsprozess im wesentlichen topologisch abläuft. Die Lateralität der Hände übernimmt die Führung, denn vom Produkt gibt es zunächst nur eine vage innere Vorstellung, die von der groben Materie ausgeht und mit jedem Schlag dem Objektziel näher kommt. Der Herstellungsprozess eines Faustkeils verläuft rekursiv, weil jedes Material flexible Handhabung verlangt und jeder Akt auf den vorhergehenden Rücksicht nehmen muss, dessen Gestalt den nächsten Akt prägt. Auf 8 Bei Reizungen der visuellen und auditiven Cortices ergeben sich nach Brown elementare Halluzinationen.„Elementary hallucinations, or cortical phosphenes, consist of flickering lights or luminous scotoma, flames, scintillations and geometric patterns... Comparable phenomea are described on stimulation of the auditory region... Penfield ans Rasmussen (1950) also obtained sounds on stimulation of auditory cortex. These perceptions consisted of tones, bells, cricket-like noises, and ’rushing’ sounds.“ (Brown, Mind, S. 237 f.) 26 welche Weise und wo ein Splitter vom Stein abgeht, bestimmt das Verhalten des nächsten, benachbarten Schlages. Der Prozess verläuft nicht linear, weil das Produkt sich aus dem Zusammenspiel von Teillösungen ergibt, gewisse Teile erst fertig sein müssen, bevor die Arbeit an anderen wieder aufgenommen werden kann. Innerhalb des Handlungsprozesses finden Unterprozesse statt, die unterbrochen und in Abstimmung mit anderen wieder aufgenommen werden. „As with the making of handaxes, it is critical to appreciate that Levallois flakes cannot be successfully removed by a mechanical adherence to a set of rules. Each nodule of stone has unique properties and a unique ’pathway’ through the nodules must be found.“ Nathan Schlanger hat Steine untersucht, die Frühe Menschen vor 250.000 Jahren behauen haben. „Schlanger stresses how the knapper needed to have used both visual and tactile clues from the core, to have constantly monitored its changing shape, and to have continually adjusted his or her plans for how the core should develop.“9 Die Ähnlichkeit mit biologischen Wachstumsprozessen ist auffällig. Der Theorie der Mikrogenese bietet sich die rekursive Verschachtelung dieser Prozesse als Muster für die Objektwahrnehmung an, in der immer auch wesentliche Momente der Ontogenese enthalten sind. Wenn die Hand Töne erzeugt, ist sie Bestandteil einer lauterzeugenden Maschine. Die Hand führt die Klangmaschine und bringt Ordnungsfaktoren mit, die auf dem Wege ihres Entwicklungsprozesses entstanden sind. Die Acht könnte eine solche Ordnung darstellen, zumal sie nicht auf die musikalische Skala allein bezogen ist, sondern dieser vorhergeht. So kann die Acht als Verkettungszeichen für weitere Bereiche in Betracht kommen. Wenn aus der Obertonreihe acht oder fünf Töne ausgewählt und diese in eine Folge gebracht werden sollen, bietet sich die diatonische Skala an. Mit ihr ist eine Folge geschaffen, die auf- oder absteigt, die darin verborgene Dynamik erlaubt Veränderungen durch Permutationen der Tonkombinationen. Die Aktionsmetapher der Hand schränkt die Musik allerdings auf die instrumentale Performance ein. Die Skala liefert bei der Performance die im Instrument festgelegte Konstanz 9 Mithen, S. 135 27 als Grundlage der Permutationen und besteht aus zwei Quarten – συλλαβή ist das Zusammengefasste, λαμβάνω „fassen“. So ist die Tonleiter als Bestandteil eines Systems eine Abstraktion von dem Zusammenspiel von Händen und Instrument. Von dieser Interaktion zwischen Hand und Instrument aus könnte sich die Begrenzung der Skala auf eine „begreifbare Menge“ von Tönen ergeben haben, die der Anzahl der Finger entspricht, die den Klang am Instrument erzeugen wie der Mund die Silben. Die Bewegung erfolgt aus einem dynamischen Kern heraus, dessen Entfaltung ein Mindestmaß an Differenz der Einheiten erfordert, die durch Tonhöhendifferenz und Dauer geleistet wird und Raum wie Zeit simuliert. Die Einteilung der Musik in Rhythmus und Melos kommt dieser Differenz entgegen. Die Behandlung des Instrumentes muss von der Lateralität abhängig sein, d.h. der Grundschlag als einfache Zeiteinteilung obliegt der linken Hand, die den bewusst gesteuerten Operationen weniger zugänglich ist als die rechte Hand, deren Motorik ebenso von der linken Hirnhälfte gesteuert wird wie die phonetische Artikulation. Die Oktave besteht aus gleichartigen Rändern, die den Tonvorrat umschließen, der aus den Obertönen stammt, die sich im Tonvorrat, in der Regel der Skala, quasi spiegeln. Der Grundton bildet eine Symmetrieachse, auf der die Skala verschoben werden kann, die Quinte wird nach unten mit einer Quarte zur Oktave ergänzt, die wiederum aus zwei, des Leittons wegen, gleichartigen Quarten besteht. Imre Hermann hat in Versuchen festgestellt, dass „zwei voneinander entwicklungsgeschichtlich auffallend unterscheidbare Wahltendenzen in der Aufgabelösung zu Worte kommen, und zwar eine entwicklungsgeschichtlich frühere Randwahltendenz bei Kindern (durchschnittlich bis sechs Jahre) und eine entwicklungsgeschichtlich spätere Mittelwahltendenz (über dem sechsten Jahre)... Randwahltendenz bedeutet hier die Bevorzugung der Endstellen, respektive der Endglieder. In der Mittelwahltendenz wird die mittlere Stelle, respektive das Mittelglied – gegenüber der einfachen Wahrscheinlichkeit – bevorzugt. Zur Erklärung der primitiveren Handlungsart nahm ich eine ’unmittelbare Reizstellung’ des primitiven Geistes an, womit gemeint ist, daß hier die Handlung unmittelbar durch den objektiv vorliegenden Reiz, ohne die Einschaltung sogenannter ’höherer’ Gegenstände, 28 ohne ’produktive’ Leistung des Subjektes vonstatten geht.“10 Daraus folgert Hermann, dass das ausübende Organ nicht nur gelenkt werde, sondern selbst lenke und durch seinen Bau und seine Eigenschaften die Art der Handlung mitbestimme. Bevorzugung sei ein alternativer Begriff für Abstraktion, die ebenfalls aus der Bevorzugung eines Teils und der Vernachlässigung eines anderen bestehe. Auch wenn es sich nach Hermann um eine spezielle, „primitive“ Art der Abstraktion handelt, ist aus seiner entwicklungspsychologischen Sicht die Randbevorzugung ein Stadium, das später überlagert wird, jedoch erhalten bleibt und für Rückgriffe zur Verfügung steht, wenn ein Zugang zu unbewussten Prozessen besteht oder sich frühe Anschauungsphasen in Symptomen äußern, wie man sie in geometrisch-optischen Täuschungen oder beim stroboskopischen Sehen von Bewegungen findet.11 Es werden frühe Erfahrungen wiederbelebt und räumliche Formen zu „Trägern lebendiger Kräfte“ gemacht. „Wir beleben sie phantasievoll durch das Hineindenken von Tätigkeiten und Bewegungen, die wir von unserer eigenen Ausübung her kennen und an die wir durch ihren Anblick zwingend erinnert werden.“12 Die optischen Täuschungen beruhen also auf einer Anordnung von Figuren, die frühe Erfahrungen beleben, ins Bewusstsein rücken und die Dingkonstanz lockern. Beim stroboskopischen Sehen treten je nach Größe des 10 Imre Hermann. Die Randbevorzugung als Primärvorgang. Internat. Zeitschr. f. Psychoanalyse, IX, 1923, S. 139 11 Das Symptom verweist auf eine Störung in parallel ablaufenden und aufeinander abgestimmten Prozessen, von denen einer verzögert wird und das verzögerte Stadium sich am Ende zeigt, sodass die Endgestalt eine Abweichung vom Normalzustand aufweist. „To understand the symptom, it is necessary to first consider parcellation and neoteny in relation to errors of development. Serres (1860, cited in Gould) described the neotenous origin of anomalies when certain parts lag behind in development and retain at birth the characteristics of earlier stages. He noted that the anomaly pointed to the stage in development that was unduly prolonged. In other words, a birth defect refers to the retardation of a stage in fetal growth. The thesis of this paper is that an error in cognition points to a brief neoteny, or retardation of microgenetic process that is comparable to the retardation in fetal growth responsible for errors in ontogenetic process.“ (Jason W. Brown: Neuropsychological Foundations of Conscious Experience, 2010, S. 97 12 Hermann, S. 161 29 Zeitintervalls, in dem die Bilder gezeigt werden, nur die Randpartien in Erscheinung wie beim kürzesten Intervall, in die breitere Zwischenphase wird ansatzweise eine Bewegung (ein „Hinüber“) hineinprojiziert, und bei einem ausreichend breiten Zeitintervall gelingt die gewohnte objektive Wahrnehmung. Die griechische ästhetische Theorie der Körperproportionen überlagert den Körper mit einer Ordnung, die der Mathematik entstammt. So werden auch „höhere“ mentale Prozesse als eingebettet in eine ontogenetische Entwicklung interpretierbar, die mit motorischen Einstellungen – also Peripherprozessen – beginnt und von ihnen wesentliche Strukturmerkmale übernimmt. „Gilt nun unser Satz über das biogenetische Grundgesetz, dann muß daraus gefolgert werden, daß die sinnhaltigen latenten Inhalte stets phylo- und ontogenetisch und auch normalpsychologisch sich an Handlungen (als an Peripherprozsse) knüpfen wollen und erst entwicklungsgeschichtlich (auch normalpsychologisch) später werden Binnenprozesse (das was wir ’Denken’ nennen) besetzt. Deswegen gehen ja die Affekte (als entwicklungsgeschichtlich frühere Gebilde) gesetzmäßig mit motorischen ’Handlungen’ (oder deren Reminiszenz) einher; deswegen ist aber nicht einmal das kühlste Denken von motorischen Nebenerscheinungen rein, wenn auch durch die Flüchtigkeit dieser ’Handlungen’ jeder inhaltliche Anteil verwischt wird und eine nunmehr funktionelle ’Mimik des Denkens’ sich entwickelt.“13 Bedeutsam für die Möglichkeit, Emotionen in formalen Prozessen wie den musikalischen darzustellen, ist die frühe Bindung von Affekten und motorischen Akten. Um Erfahrungen aus präverbaler Entwicklungszeit kommunikationsfähig zu machen, bedarf es einer entsprechenden Technik, die zum Beispiel in der Kinderzeichnung wirksam ist und noch nicht der Bewusstseinskontrolle des Erwachsenen unterliegt. Geht man davon aus, dass Musik primär einer Aktion entspringt, dann ist die Affektbindung an die illusionäre Bewegung der Töne erkennbar, und die Dekodierung der Signale verläuft nicht entscheidend anders als bei der Sprache. Hö13 Hermann, Randbevorzugung, S. 166. (Der besseren Lesbarkeit wegen sind die Bindestriche des Originaltextes hier durch Klammern ersetzt worden.) 30 ren bedeutet, den akustischen Symbolbereich sensomotorisch übersetzen, d.h. interpretieren zu können. Die enge Verbindung von Tanz und Musik deutet auf die Durchlässigkeit der Grenzen hin, die die Töne von ihren motorischen Ursprüngen trennen. Das Intervall ist als akustische „Randbevorzugung“ vorstellbar, sodass der einzelne Ton nur in Bezug auf die Obertonreihe seinen Objektstatus erlangt, der einerseits als Höhe und andererseits als Timbre wahrgenommen wird, das den Ton gewissermaßen umhüllt. Der Ton tritt aus dem Klangbild, das unverändert bleibt, in den Vordergrund. Die Wahrnehmung von Ton und Timbre beruht auf einer Entgegensetzung, die ihn aus dem Dingklang herauslöst und für Intervallstrukturen verfügbar macht, Intervalle, die selbst als Außenglieder einer Relation, also Ränder gelten können. Als solche finden sie Anschluss an die Motilität und ihre intentionalen Prozesse, denn Handeln hat ein Ziel, das von den durchlaufenden Stationen eines Prozesses ontogenetisch gefärbt ist. Denken, so Hermann, könne nur mit sinnhaltigen motorischen Entladungen, also der Handlung, gleichgestellt werden, wobei Denken an Binnenprozesse, Handeln an Peripherprozesse gebunden seien. So dienen Peripherprozesse, die an frühe affektive Erfahrungen gebunden sind, eher dem künstlerischen Ausdruck, und paradoxerweise sind es deshalb „abstrakte“ Formen und Gestalten, die dazu tauglich sind. In verschiedenen Zusammenhängen ist deutlich geworden, wie affektive Spannungen hinter abstrakten Formen wie Ornamenten oder geometrischen Gestalten verborgen sein können. Anton Ehrenzweig interpretierte die Neigung der griechischen Kunst zur geometrischen Form als Begrenzung chaotischer Primärprozesse, während die Prozesstheorie Browns die Bindung von einfachen Formen und intensivem Fühlen dem frühen Stadium des Prozesses zuschreibt. Und Leo Navratil beschreibt, wie in psychotischen Regressionen starke Affekte zur Skelettierung von bildlichen Darstellungen der Gegenstände führen und geometrische Formen die Bilder strukturieren. Der Prozess ermöglicht das Einbinden von frühen, unbewussten, affektiv getönten Erfahrungen in die Endgestalt. Hermann argumentiert prozesstheoretisch, wenn er sagt, „daß jeder solcher aktueller Prozeß, 31 sich erst über primitivere geistige Organisationsstufe emporentwickelnd, die höhere Organisationsstufe des zum Bewußtsein gelangenden Endresultats erreicht.“14 Die lange Phase der Entwicklung und Einübung motorischer Kompetenzen erlaubt einerseits eine plastische Anpassung an die Umweltbedingungen, andererseits Einblicke in den Aufbau solcher Kompetenzen und ihren Einfluss auf spätere Handlungs- und Denkvorgänge. Das würde bedeuten, die Neotenie legt biologische Strukturprozesse offen, die den mentalen Weg begleiten und mitprägen, sind am Ende aber auch über den metaphorischen Umweg interpretierbar. Hermann weist auf die Umrisszeichnungen der Höhlenmalerei hin, die man als historisch frühesten Kontakt des Bewusstseins mit seinen phylogenetischen Bildungsvoraussetzungen bezeichnen kann. Die Beleuchtung in den Höhlen dürfte ein Zeichnen aus der Erinnerung heraus begünstigt und die Kontrolle über die Figur weitgehend der ausführenden Hand überlassen haben. Die phonetischen Organe Mund und Kehle bilden die früheste Verbindung von Laut und Motorik, welche auf die Hände übergeht und damit eine sensomotorische Phase einleitet, die zur Geometrie als Darstellungsraum von Tonrelationen führt. Der enge Zusammenhang von Tonrelationen und Musik ist der griechischen, vor allem der pythagoreischen Musiktheorie ein besonderes Anliegen. Im Timaios legt Platon ein besonderes Zeugnis dieses Verhältnisses ab, wenn der Gott die Weltseele in Proportionen aufteilt, die als Reihe den Schwingungsverhältnissen der Tonleiter entsprechen. Der vollendete Körper τέλεον σῶμα bildet den Ausgangspunkt einer geometrischen Teilung. Die Seele wird in die Mitte gesetzt und spannt sich ebenso durch das Ganze wie um den Körper herum. Die dem Körper gegenüber ältere Seele wird nun gestaltet, indem der Gott mischt und teilt, bis die Reihe den Intervallen der Tonleiter entspricht. Der Prozess beginnt mit einer nichtorientierbaren Gestalt, bei der Inneres und Äußeres durch eine seltsame Schleife verbunden ist, und läuft durch eine Erzeugungsfolge von Proportionen. Wenn Platon das Schöpfungsthema schließlich noch einmal aufgreift, geht er zeitlich 14 Hermann, S. 160 32 zurück zu einer „Amme des Werdens“, einer „schwierigen und dunklen Form“.15 Die Hand adaptiert die Reflexe des Mundes, die auf „Greifen“ und Lautproduktion spezialisiert sind, wobei die Hand erst spät mit der Erlernung eigener Klangerzeugung am Instrument beides wieder zusammenführen kann. Die Klangerzeugung des Mundes unterscheidet sich von der der Dinge durch Hohlraumschwingungen mit einem spezifisch humanen Obertonspektrum. Der Vokalapparat erlaubt die Erzeugung von Lauten, die als Teilaspekte eines Klangspektrums bezeichnet werden können. Bei der Erzeugung einer Tonhöhe wird der muskelgesteuerte Apparat in Gang gesetzt. Die Muskulatur ist zunächst weitgehend reflexgesteuert, spätere Lernvorgänge erlauben eine zusätzliche mentale Steuerung – ein Weg von einfachen Lauten oder Schreien bis zur Artikulation. Die unmittelbare Wirkung von Affekten auf die Motorik wird von vermittelnden Instanzen zunehmend gedämpft. Die Lautbildung kann im frühen Entwicklungsstadium wenig vom Ohr kontrolliert werden, sodass Affekte unvermittelt auf den Vokalapparat treffen. Eine spezifische Einstellung der beteiligten Organe bringt den hellen oder dunklen, hohen oder tiefen Laut hervor. Den Ton auf einer Höhe zu halten, bedarf indessen einer kontinuierlichen Anspannung, die die Kontrolle des Gehörs benötigt, so, wie die ausführende Hand das Auge braucht, um gesehene Objekte zu zeichnen. Affektive Spannungen treten zur Tonhöhenspannung hinzu und färben sie. In einem abstrakten diatonischen System müssen die musikalischen Parameter diese Spannungen stellvertretend für das Zusammenspiel von Affekt und Motorik darstellen können. Die knappen Mittel des diatonischen Systems, die ans Alphabet erinnern, entsprechen der Einfachheit von Reflexmechanismen und den Spannungsentladungen. Hermann zählt zu den Rändern Körperöffnungen und Hand- wie Fußflächen, die über eine „unmittelbare Reizeinstellung“ (Hermann) ver15 Mehrfach sucht Platon in einem Späteren das Frühere auf, beginnt mit der vom Demiurgen nach Vorbildern (paradeigmata) erschaffenen Welt und geht kreisend retrospektiv, d.h. stufenweise zu den Elementarformen, um von dort aus zur erlebten Wirklichkeit des Körpers zu kommen. 33 fügen und allesamt auf Berührung betont sensitiv reagieren. Der Vokaltrakt liegt ebenfalls am „Rand“ und ist auf Vibrationen spezialisiert. Die auffällige Lichtmetaphorik in der Musik beruht auf einer kategorialen Allgemeinheit der Wahrnehmung, die zunächst Hören wie Sehen als Vermittlung von Innen und Außen gleichermaßen umfasst, sodass Begriffe für die Empfindungen aus sinnlicher Wahrnehmung des einen Bereiches vom anderen kaum unterschieden werden. Die Sprache zeugt hier von einem mikrogenetischen Stadium sensorischer Undifferenziertheit. Einen Klang mit Lichtbegriffen zu bezeichnen, ihn alternativ zu hoch und tief als hell oder dunkel zu empfinden, beruht auf kategorialer Unschärfe und ist in einer unvollendeten vestibulären Differenzierung begründet. Das Vestibularsystem reagiert auf Gravitation und Beschleunigung – physikalisch wird die Gravitation ebenfalls der Beschleunigung zugerechnet –, ist das älteste Ortungssystem und den auditiven wie visuellen Sinnesorganpaaren vorgelagert. Angesichts der Bedeutung einfacher Formen in frühen Stadien der Objektbildung sind „abstrakte“ Phänomene (ein Umriss z.B. ist kein dinghaftes Objekt) der ontogenetischen Wahrnehmungsbildung Elemente für Weltmodelle. „However, the severity of the symptoms of vestibular dysfunction suggests that there may be a critical dependence of the brain and body upon vestibular input. The most primitive part of the vestibular system – the otoliths that transduce linear acceleration, including linear acceleration by gravity – is estimated to be more than 500 million years old and exists in primitive species such as sea squirts (Smith et al., 2010). These sensory organs evolved to provide information about gravitational vertical, before any other sensory system had developed, and during development the vestibular system is fully functional before the visual or auditory systems. Therefore, it is highly likely that human physiology has developed a special dependence upon the otolithic part of the vestibular system...“16 16 Paul F. Smith and Cynthia L. Darlington: Personality changes in patients with vestibular dysfunction; Frontiers in Human Neuroscience (www.frontiersin.org), Okt. 2013, Vol. 7, Article 678, S. 2 34 Bei der Differenzierung zwischen Hören und Sehen fällt ein Phänomen auf, das Ernst Terhardt sowohl für den visuellen als auch den akustischen Bereich als Kontur bezeichnet. Die Kontur bildet die unterste Stufe der Wahrnehmungsverarbeitung – sowohl visuell als auditiv, wobei die visuelle leichter zu bemerken ist. „Auch im psychologischen beziehungsweise psychophysikalischen Sinne gibt es auf der untersten Stufe der sensorischen Hierarchie diskrete, entscheidungsabhängige Wahrnehmungsmerkmale, nämlich die Konturen. Gestalten werden dadurch definiert, daß ihre Umrisse beziehungsweise strukturellen Details durch Konturen repräsentiert werden, welche sich an bestimmten Stellen innerhalb des Darstellungsraumes, einer Darstellungsfläche oder einer Darstellungslinie befinden... Konturen sind als elementare Wahrnehmungsobjekte aufzufassen... Die auditive Entsprechung der visuellen Konturen ist die sogenannte Spektraltonhöhe.“17 Die Tatsache, dass die Tonwahrnehmung das Ergebnis eines hierarchischen Verarbeitungsprozesses ist, führt Terhardt zu Begriffen wie Spektraltonhöhe und virtuelle Tonhöhe. Das Gehör zerlegt komplexe Schallsignale in elementare Komponenten – die Teiltöne mit ihren Spektraltonhöhen. Um einen Spektralton wahrzunehmen, genügt die Darbietung eines Sinustons. „Anderereits werden im Zuge der hierarchischen Verarbeitung jene Komponenten zu ganzheitlichen Wahrnehmungsobjekten zusammengesetzt,“18 nämlich das, was wir zum Beispiel in der Musik unter Tönen verstehen. Das heißt, dass sämtliche Tonhöhenwahrnehmungen auf Spektralmerkmale zurückgeführt werden können, die die unterste Stufe des auditiven hierarchischen Prozesses bilden, und deshalb mit der visuellen Kontur als unterste Stufe der visuellen Hierarchie verglichen werden kann. So bildet die Spektraltonhöhe einen Punkt auf der Hoch-Tief-Dimension und ist somit diskret. Der Begriff der Hierarchie basiert auf der Vorstellung einer Verarbeitungsstruktur, bei der Schicht für Schicht durchlaufen werden muss. Es handelt sich dabei zwar um einen Prozess, doch dieser lässt sich unterschiedlich interpretieren, einmal als Durchlaufen der Stufen eines 17 18 Ernst Terhardt: Akustische Kommunikation, 1998, S. 23 f. Terhardt S. 311 35 nach statischen Regeln arbeitenden Informationsverarbeitungssystems, das man sich oft modular aufgebaut vorstellt, und einmal als Weg, der von der evolutionären Entwicklung zwar in groben Zügen vorgezeichnet ist, jedoch immer wieder neu gebildet werden muss. Vergleicht man den evolutionären Weg mit einem Lernprozess, so handelt es sich um die Wahl von Möglichkeiten, die auf den jeweiligen Stufen des Prozesses getroffen werden. Hier handelt es sich um die Genese der Wahrnehmung, um ihr Werden. Nur unter diesem Aspekt sind Zugriffe auf frühe Prozessstadien verständlich. „In biologischen sensorischen Systemen beginnt die Informationsverarbeitung in der Tat bereits in den peripheren Einheiten. Im Hinblick auf das Evolutionsprinzip und die außerordentliche Bedeutung optimaler und unverzüglicher Informationsverarbeitung ist sie einleuchtend. Die Tatsache, dass die Stimuli im sensorischen Empfindungsorgan unverzüglich in Nervenimpulse (Aktionspotentiale) umgewandelt werden, erscheint unter diesem Aspekt in einem besonderen Licht... Die möglichst getreue Übertragung des Inputs wird überhaupt nicht angestrebt, weil es vielmehr darauf ankommt, die Bedeutung des Stimulus zu übermitteln. Die im Innenohr stattfindende Reduktion des Ohrsignals auf Aktionspotentiale in zahlreichen Fasern des Hörnerven ist demnach bereits als der erste Abstraktionsschritt aufzufassen – gekennzeichnet durch Kategorisierung (diskrete elektrische Objekte auf diskreten Nervenfasern) und die dabei notwendigen Entscheidungen (Schwellen).“19 Da die Differenzierung aus einer Kategorie heraus erfolgt, die zunächst klangunspezifisch ist, ehe aus den Möglichkeiten der übergeordneten Kategorie der Klang gewählt wird, kann der Hintergrund auch aus etwas anderem bestehen, d.h. es können andere als akustische Wahrnehmungen angesprochen werden. Terhardts Anwendung des Konturbegriffs auf das Hören deutet darauf hin, dass die Kontur sozusagen als Kategorie verstanden werden kann, die Hören und Sehen gleichermaßen umfasst. In der Umrissbildung trennt sich ein Phänomen von seiner Umgebung ab. Die Unterscheidung beruht auf einem 19 Terhardt, S. 23 36 Gliederungsprozess, der von der entwicklungspsychologischen SubjektObjekt-Trennung nicht unabhängig ist. Vor dieser Trennung kann es kein Objekt, also keinen Gegenstand geben, der die letzte Einheit einer kategorialen Kaskade ist. So bezieht sich die Kontur genetisch auf diejenige, die das Körpersubjekt von seiner Umgebung trennt, sodass es sich selbst zur Umgebung wird, die sich ständig mit Emotionen und Vorstellungen füllt. Auch wenn der Wahrnehmungsprozess die Umrisshaftigkeit hinter sich lässt und auf die Fülle des realen Objekts zuläuft, teilen sich die emotionalen Erfahrungen der „Konturphase“ der Objektwahrnehmung mit. Überträgt man dieses Phänomen auf die Musik, dann bietet die Spektraltonhöhe eine Basis für den Zugriff auf frühe Stadien der Subjekt-Objekt-Bildung und ihre emotionalen Bestände. Im Unterscheidungsprozess werden die Laute des eigenen Körpers anders bewertet und besetzt als die aus der Außenwelt. Das setzt eine akustische Grenzziehung voraus, bei der die Spektraltonhöhe wie auch immer dienlich zu sein scheint, schließlich kommt sie in der Umwelt sowenig isoliert vor wie die Konturen der Objekte. Die bereits an abstrakten Formen der Geometrie und der Ornamentik beobachtete affektive Bindung, dürfte ebenso am Signalcharakter der einfachen Schwingungen zu beobachten sein. Die „Abstraktion“ hängt mit den einfachen Funktionsabläufen zusammen, die vor allem in Affekt- und Emotionszuständen zu finden sind, weil die Impulsketten zwischen sensorischem Input und Aktion kurz sind, auf der unteren Stufe der Hierarchie operieren und in einer kurzen Reaktionszeit Bedeutungen der Stimulation in unmittelbare Aktion oder die der Aktion vorhergehenden Vorstellungen übersetzt werden. 37 3 Gravitationsanalyse und Hörfunktion Der Otoneurologe Atanas Kehaiov untersuchte bereits in den 1970er Jahren, welche Effekte ein gezielt gereiztes Vestibularsystem auf die Sinne hat. Es handelte sich um Untersuchungsmethoden, die ursprünglich Raum- und Zeitwahrnehmungen eines Körpers in trägheitslosem Zustand testen sollten. Bei Patienten mit Vestibularstörungen unter der Einwirkung starker Sinnesreize waren Schwindelanfälle mit Veränderungen der Zeitwahrnehmung aufgefallen. Die Untersuchungen nach kalorischer Reizung erbrachten Veränderungen visueller und auditiver Sinnesorgane. Eigentlich ist das Vestibularsystem auf das Gravitationsfeld ausgerichtet, in dem der Körper seine Lage bestimmt. Offenbar sind jedoch noch weitere Systeme betroffen, wie die Versuche Kehaiovs zeigen, höhere Systeme, die von den Analysen des Vestibularsystems profitieren. Da es sich um Beziehungen zwischen dem Gravitationsfeld und dem auf das Feld abgestimmten Vestibularsystem handelt, kam die Physik Einsteins in Betracht, um die Wahrnehmungsdifferenzen vor und nach der Reizung, zwischen einem System in Ruhe und einem gereizten, zu erklären. „The fact that the vestibular provocation (determined by applied acceleration) determines deformation mainly of the long-wave range of the light spectrum give ground to claim, that this peculiarity is due to its duty as gravitation receptor. The red shifting of the light ray, passing through the gravitation field is an already proved fact. We think that human gravitation analyzer (the most differentiated component of which is the vestibular system) has the obligation to perceive an actually changed light ray, passing through a gravitation field. Even the established by us ’increased’ or ’decreased’ mass of the observed colored objects, when the vestibular system is in non inertia state, we are obliged to seek for a interrelation between the described phenomena for the actual space, time, mass, distance, gravitation etc. by the brain mechanism and reflec- 38 tor, to be found in the fine structure of the higher sensoryness (vestibular, auditory, visual). We maintain the attitude for the multimillion increase of the ’insignificant’ of cosmologic aspect effect of acceleration, applied by the vestibular system on the auditory and visual systems.“1 Die Reize simulieren eine Beschleunigung des Körpers im Gravitationsfeld. Da die sich daraus ergebenden physikalischen Effekte jedoch so schwach sind, dass sie im Wahrnehmungssystem „ausgemittelt“ werden müssten, nimmt Kehaiov eine erhebliche Verstärkung durch Hirnstamm und Cortex an. „It is well known that on one receptor cell of the sensory organ (for example the auditory) corresponds thousands and millions of cells, situated in the cerebrum stem and the cortex.“2 Der enge Zusammenhang zwischen dem Organ der Gravitationsanalyse und der Hörfunktion lässt auf Beziehungen zwischen den musikalischen Parametern und der Physik der Raumzeit schließen. An der ontogenetischen Erschließung der Wahrnehmungssysteme ist das Vestibularsystem wesentlich beteiligt. Die nachgeschaltete millionenfache Verstärkung der Signale deutet auf eine Brücke hin, die die Wahrnehmung mit dem Weltmodell der Relativitätstheorie Einsteins verbindet. Mit den Frequenzen sind mehrere musikalische Parameter verbunden, der Ton verweist auf Raum, Zeit, „Farbe“ und Gewicht (Tiefe gleich Schwere), Begriffe, die bis auf die Zeit eher metaphorisch sind. Wenn das Vestibularsystem mit für die Steuerung der Körperhaltung verantwortlich ist, der zunächst den Klammerreflex als primäre Sicherung betrifft, dann ist es auch an der von Piaget beschriebenen Genese der Raum- und Objektwahrnehmung beteiligt. Dass bestimmte Tonqualitäten als hoch oder tief bezeichnet werden, wird am Anteil des Vestibularsystems an dieser Genese liegen. Die vestibuläre Reizung hatte in Kehaiovs Test auch Tonhöhenwahrnehmungsveränderungen ergeben, was darauf hindeutet, dass der Gravitationsrezeptor (Bogengänge und Macula messen beide 1 2 Kehaiov, Vestibular effect, S. 116 Atanas Kehaiov: Vestibular effect on the Auditory Function; in: Balkan Journal of Ototology and Neuro-Otology, Vol. 4, No 2-3. Pro Otology 2004, S. 116 39 Beschleunigungen, wobei die Gravitation als Erdbeschleunigung gilt) Auswirkungen auf das Hören hat – physikalische und psychologische. Während die Information aus der Cochlea hinauf zum Gehirn wandert, sendet das Gehirn Information zurück zur Cochlea und teilt ihr mit, welche Klänge zu verstärken, auf welche zu achten und welche zu ignorieren sind. Das Hörbild entspricht nicht dem physikalischen Objektschall. „There is extensive interconnectivity between the varios brainstem auditory nuclei, including between nuclei on opposite sides of the brainstem. One important function of this bilateral connectivity is to compare the arrival times and other qualities of sounds between the two ears, underlying our ability to spatially locate the sources of sound in the auditory environment. As with the visual system, there is extensive signaling in both directions – that is, neural signals are sent from the cortex to the MGN, from the MGN to the inferior colliculus, and so on, all the way back to the hair cells in the cochlea.“ 3 Die je nach Objekt nacheinander auf das Ohr auftreffenden Schallwellen werden im klassischen System der Physik als Zeitintervall definiert. Da die Frequenzanalyse in jedem Ohr selbständig vollzogen wird, müsste sich ein Eindruck des Halls und der Rauigkeit oder Verstimmung ergeben. Statt dessen entsteht ein Raumeindruck mit Lokalisierungsmöglichkeit der Schallquelle. Oder besser: Aus der lebenswichtigen Bedeutung der Lage der Schallquelle, der Richtung und Entfernung von Beute oder Feind, ergibt sich zwangsläufig ein akustischer Raumeindruck als Epiphänomen mit emotionaler Färbung. Die Zeit, die der Schall braucht, wird in Entfernung und Richtung der Quelle zum Ohr umgerechnet. Intensität und Frequenz geben Hinweise auf die Entfernung, weil langwellige Frequenzen und größere Amplituden längere Strecken zurücklegen können, die unterschiedliche Dämpfung der unterschiedlichen Schallfrequenzen zudem etwas über die Entfernung aussagt. Bei einem sich nähernden oder entfernenden Objekt werden die Amplituden der Frequenzen sich je nach Höhe verändern, 3 David E. Presti: Foundational Concepts in Neuroscience: A Brain-Mind Odyssey (Norton Series on Interpersonal Neurobiology, 2016, Kapitel 15). Der „medial geniculate nucleus“ (MGN) ist Teil des auditorischen Thalamus. 40 der Sound des identifizierten Objekts heller oder dunkler werden. Hohe Frequenzen sind leichter zu orten als tiefe, welche unterhalb einer bestimmten Größe nur noch dumpf und aus einer weitgehend unbestimmten Richtung kommen. Anton Ehrenzweig bringt die Fokussierung mit ins Spiel, die diese Signalanalyse erst rechtfertigt, denn die Unterscheidungsfolge verläuft binär fokussierend. Das Bewusstsein verhält sich zum Vor- und Unbewussten ähnlich wie die fokussierte Wahrnehmung zur Hintergrundumgebung.4 Das bedeutet eine Abhängigkeit der Leistungen, die es mit sich bringt, dass der fokussierte Zustand ohne die Umgebung nicht möglich, damit aber die Umgebung indirekt die Gestaltbildung des Fokus beeinflusst. Daraus ergibt sich eine hohe Symbolkraft der Besonderung. Ihre Abstraktheit ist Ergebnis der Negation, die die Fokussierung erzwingt, andererseits ist davon auszugehen, dass die Umgebung sich zum Fokus verhält wie das harmonische System als Ganzes, das in dem Moment mit aufgerufen wird, wenn eine Tonfolge erklingt. Die Fokussierung auf einen Ton aus dem Spektrum der Obertonreihe steht im Einklang mit dem Bewusstsein als fokussierte Wahrnehmung. Die These, das Vestibularsystem, insbesondere die Funktion der Otolithen, sei Basis der Sinnesorgane, erlaubt die Annahme, dass die Lagebestimmung und Orientierung gebende Gravitation Kern jeglicher Fokusfunktion ist und die mikrogenetische Objektbildung ermöglicht. 5 4 Anton Ehrenzweig: Psycho-Analysis of Artistic Vision and Hearing, 1953, S. 210 und 235 5 Die Kosmosmodelle sind Vorstellungen im Sinne der Mikrogenese, also Stationen der Raumwahrnehmungsbildung, psychologisch Projektionen des Unbewussten. Ist die Physik Einsteins „vestibulär“? Die archaisierenden Tendenzen der Epoche lenken die Aufmerksamkeit auf Strukturen, die der Wahrnehmung als Endgestalt des mikrogenetischen Prozesses fremd sind, und auf eine Selbstwahrnehmung des Prozesses schließen lassen, die eine neue Phase der „rückwärts“ gerichteten Verschiebung bedeutet. Wollte man historische Veränderungen des Bewusstseins als Grund anführen, Möglichkeiten, die ein Wissenschaftler zu nutzen versteht, so wäre Bewusstsein eine differenzierbare Kategorie, zu der auch die Kunst gehörte. Wenn die Raumvorstellung auf einem ontogenetischen Prozess beruht, sind Veränderungen über lange Zeiträume zu erwarten, sodass die verschiedenen Kosmosmodelle der Kulturepo- 41 Das Vestibularsystem, respektive der otolithische Teil, ist sozusagen die prozesstheoretisch frühere, kategorial mächtigere Instanz, die sich in Hören und Sehen ausdifferenziert hat. Der vestibuläre Zustand deckt sich mit der Differenzlosigkeit von Subjekt und Objekt, die entwicklungspsychologisch auf die Dyade zurückgeführt werden kann, ursprünglicher Kern der Wahrnehmung und des Bewusstseins in der reflexionslosen Beziehung auf sich selbst als Selbst im Zustand des Fühlens.6 Die Reflexion hält das Innen-außen-Verhältnis im Gleichgewicht. „While the vestibular system was once recognized mainly for its regulation of eye movement and postural reflexes, increasingly it has become apparent that the cortical representation of vestibular information is important for cognition, emotion and even the sense of self.“7 Belegt ist der Zusammenhang von Emotionen und vestibulären Dysfunktionen, die einerseits Ängste, Phobien und Depressionen hervorrufen können, umgekehrt sind Einflüsse emotionaler Zustände auf das Vestibularsystem beobachtet worden. Störungen im System führen zu gravierenden Beeinträchtigungen der Ich-Identität und weisen die höchste Rate an Depersonalisationssymptomen und Realitätsstörungen auf. Patienten mit Vestibularstörungen berichten von Erfahrungen, auf schwankendem Grund zu chen nicht nur den Stand des Wissens über objektive Zusammenhänge dokumentieren, sondern den jeweiligen Status der Selbstreflexion, in den tiefenpsychologische Prozesse eingebunden sind. Das Eindringen des „Primitiven“ ins Bewusstsein ist mit erleichterten Zugängen zu archaischen mentalen Strukturen und Vorstellungen verbunden, die noch weit von der differenzierten Form der aktuellen Wahrnehmung entfernt ist. Insofern wäre ein Kosmos als Höhle realitätsgerechter, also der Objektivität und ihrer Vorstellungswelt näher als eine gekrümmte Raumzeit, die uns eher über Symbole zugänglich ist. 6 „Feeling is intrinsic, non-relational, uniform and non-decomosable. The account resembles Whitehead’s idea that Feeling is a subatomic process (vibratory strings?) that, through concrescence or microgenesis, actualizes the varied forms of mentality as intimations of the deeper, less-differentiated life or organism. Feeling is a quality that propels evolutionary process from its origin in inanimate nature and noncognitive entities to its manifestation in higher mentality, exhibiting trends in nature that transfer to the human brain as a physical entity.“ (Jason W. Brown, Microgenetic Theory and Process Thought, 2015, S. 67) 7 Smith/Darlington, Personality changes, S. 6 42 gehen, den Körper als fremd und nicht unter Selbstkontrolle oder „ausgesperrt“ zu empfinden. Die vestibulären Effekte auf die Wahrnehmung als emotional zu bezeichnen, dürfte der Reichweite solcher Effekte, die bis zu Depersonalisationsempfindungen reichen, nicht genügen. Zum Beispiel bedroht der Schwindel die Lagestabilität des Körpers fundamental, er wird jedoch beim Tanz oder beim Sport in moderater Form aufgesucht. Der euphorisierende Effekt liegt wohl eher in der Beherrschung im Überschreiten der normalen Bewegungsgrenzen, in der Formstrenge, die den Schwindel bändigt. Solche Grenzüberschreitungen, die oft auf Beschleunigungen und abnormen Bewegungsabläufen beruhen, werden immer formal gebändigt, was die Stimmung „hebt“. Die Nähe zu psychotischen Erscheinungen und Störungen grundlegender Wahrnehmungssysteme lässt es kaum zu, nur von Gefühlen zu sprechen, die eher auf einem stabilen Selbst aufbauen. Die Musik geht über Gefühlskomponenten hinaus, wenn sie Rhythmen nutzt, um auf die Wahrnehmung von Bewegung stabilisierend oder destabilisierend zu wirken. Das Schrittmuster des Taktes kann so gewählt werden, dass die Bewegungsfestigkeit aufgelöst wird; der Dreier ruft Drehformen des Tanzes auf, Beschleunigungen und Verzögerungen sind ebenso die Regel wie schnelle und kurze Schritte. Ähnlich bilden die Intervallfolgen Körperbewegungen ab wie Auf- und Absteigen, Durchmessen weiter Räume, Springen und Fallen; dissoziierend wirkt der Spaltklang oder die Dissonanz. Die Konstruktionen der Musik übernehmen mit solchen Mitteln symbolisch die Aufgaben des vestibulären Systems, eine sichere Umweltrelation herzustellen, greifen indessen tief in die Ontogenese dieser Relation ein und entfalten somit eine existentielle Wirkung. Da es sich um eine Innenaußen-Relation handelt, ist immer das System-Umwelt-Verhältnis lebender Systeme betroffen, deren Grenze ein ontologisches Problem ist, denn die Teilung betrifft ein Ganzes, das sowohl die Subjektivität als auch die Objektivität enthält. Der Ton entsteht an einer solchen Grenze, er bildet die Kontur beider Seiten, an dem auch die Sinnesorgane gebildet worden sind. Die Haut bildet die ursprüngliche Membran, Zellen reagieren auf ein Licht- oder Wärmespektrum ebenso wie auf Druck, der im Ohr zum Schalldruck wird. Unmittelbar wirkt die Gravitation als Druck auf 43 die Rezeptoren der Haut und weiterverarbeitender Systeme. Haarzellen sind Abkömmlinge der Hautzellen, intern als Zilien eingesetzt. Haut ist licht- und wärmeempfindlich, die Anbindung von Lichtsensoren an das Vestibularsystem sorgt für Orientierung zum Licht, das der Gravitation in der Bildung lebender Systeme entgegenwirkt. Die Tonhöhenwahrnehmung ist ein konstruktiver Akt, in dem subjektiv Stadien der Differenzierung durchlaufen werden, angestoßen von den physikalischen Schwingungsverhältnissen des Objekts. Innerhalb der Kategorie „Tonhöhe“ sind die unterschiedlichen Stufen zu unterscheiden, die die Grundlage für Musik bilden. Tonhöhen enthält objektiv jede Klangquelle, oft jedoch sind sie als Einzelphänomene für den Hörer nicht von unmittelbarer Bedeutung oder werden bewusst unterdrückt, weil das Bewusstsein eine bestimmte Information der Klangwahrnehmung bevorzugt – wie beim Sprechen, das eine Botschaft übermittelt, wobei das Bewusstsein sich allein auf die Aussage konzentriert, das Timbre des Sprechens jedoch vernachlässigt. An der Spitze der Hierarchie steht die bewusste Aussage, die mit einer Melodie vergleichbar ist, deren Tonfolge eine Gestalteinheit bildet, in der die Eigenständigkeit der Töne zugunsten des Melos als Ziel der Wahrnehmung verblasst. Das Melos erfüllt einen informationstheoretischen Grundsatz, demzufolge nur Signalveränderungen im Zeitverlauf unterschiedliche Bedeutungen übertragen können – zum Beispiel durch Veränderungen der Frequenzen. Dabei müssen die vergangenen Stadien auf irgend einer Weise beim Empfänger erhalten bleiben, um die besonderen Beziehungen der Momente zu einer Gestalt zu formen. Die Formbildung „vergisst“ den Zeitaspekt und geht in Bedeutung über. Das Gegenstandsgeräusch gewinnt seine Objekthaftigkeit durch das Objekt, das es erzeugt. Seine spezifische Klanggestalt wird durch die Konstruktion des Objektes erzeugt, mit dem sie unmittelbar verbunden ist. Die Tonskala ist von der Klanggestalt des Erzeugungsgegenstandes nicht abhängig, auch wenn sie einen Gegenstand für die Erzeugung benötigt – das Instrument, dessen Eigenschaften so gewählt werden, dass Tonhöhen bevorzugt in Erscheinung treten. Die Skala ist auf unterschiedlichen „Gegenständen“ zu realisieren, und diese Möglichkeit entwertet 44 die Bedeutung der Gegenstände für die Klangerzeugung und überlagert den Gegenstand mit mathematisch beschreibbaren Formen. Die Mathematik ist nun auf den Gegenstand anwendbar, wie Ehrenzweig beobachtet, die Natur ein Objekt, das sich der Berechnung erschließt, und der Sound als Epiphänomen des Gegenstandes bietet sich in Gestalt der Musik als dessen innere Logik an. „The intense preoccupation with abstract form led to another reaction. The Greeks felt, that their aesthetic play with abstract form must also possess a rational meaning and they discovered geometry, the only science in which they excelled. This discovery, more than their art, gave the Greeks their supreme confidence in the power of the spirit. Even since, we not only appreciate geometrical form for its simple beauty, but are possessed by the illusion that this beauty must rest on external laws of nature.“8 Für diese Integration von Gegenstandsklang und Skala steht vor allem Pythagoras. Sein „Alles ist Zahl“ begründet die Maskierung des Komplexen durch das Einfache, und der Sound der Natur ist pythagoreisch. An der Wahrnehmung stabiler Tonhöhen und -abstände als Elemente einer skalenbasierten Musik sind die Frequenzen eines Schalls und ihre Weiterverarbeitung im Innenohr und den angeschlossenen Nervenzellen ebenso beteiligt wie subjektive Formbildungsprozesse, die mit den von außen kommenden physikalischen Ereignissen zusammentreffen und an der auditiven Gestaltung beteiligt sind. Der Umgang mit festen Tonhöhen greift auf frühe Stadien von Formbildungsprozessen zurück, ist jedoch eine späte Erscheinung der Evolution, denn eigentlich sollte das Hören zum Ziel haben, Objekte anhand ihres Schalls zu identifizieren und ihre Bedeutung zu bestimmen. Die auditive Wahrnehmung konzentriert sich auf den Klang von Dingen als Informationsträger und kann ihn als Teilaspekt des Objekts erkennen. Der einzelne Ton oder die musikalische Tonfolge verweist jedoch auf kein Objekt, denn das Instrument dient zunächst nur der Fokussierung einer Frequenz, die als Tonhöhe wahrgenommen wird. Die Fokussierung scheint auf einer Reduktion oder Abstraktion zu beruhen, die mit der Kontur eines gezeichneten 8 Ehrenzweig, Form-Creation, S. 92 45 Gegenstandes zu vergleichen ist. Sie beruht auf einer mentalen Leistung, die entwicklungsgeschichtlich in den Zeitraum der Herstellung von Artefakten fällt. Der Wahrnehmungsprozess beginnt mit Teilaspekten und ersten Unterscheidungen des Objektes von anderen, ähnlichen Objekten, Unterscheidungen, die sich besonders an den Rändern der Objekte vollziehen, sodass die Kontur wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist. So werden Konturen zu Aufbauelementen, mit denen – in klassischer philosophischer Terminologie – ein Weg vom Allgemeinen zum Besonderen beschritten wird. Der Gestaltbegriff ergibt sich aus der Annahme, dass die Objektwahrnehmung nicht auf Zusammensetzung modularer Einheiten beruht, die die Funktion von Bausteinen haben, sondern einen Prozess durchläuft. So untersuchte Heinz Werner die Korrelation zwischen dem einzelnen Ton, seiner Tonhöhenwahrnehmung und Intervallschritten und kam zu dem Schluss, dass die Lage der Intervalltöne in der subjektiven Wahrnehmung von den objektiv gemessenen Frequenzen abweichen kann. Steigende Mikrointervalle wurden in dem Test als größer empfunden als fallende, und die Mikroharmonie veränderte sich bei mehrmaligem Hören, minimale Intervallschritte wurden nach mehrmaligem Vorspielen als Halbtöne wahrgenommen. Daraus kann man schließen: Die Tonhöhen wurden aus psychologischen Gründen verändert, um die Stabilität einer Skalierung zu sichern, die musikalische Wirklichkeit ist. „It would seem that it is the quality of the interval which determines the position of the tones in the microsystem.“9 Der Intervallschritt ist Bestandteil einer melodischen Gestalt, die dem Symbolsystem Musik angehört, in dem in der Regel der kleinste Schritt der Halbton ist. Es sind zweierlei Erinnerungsformen zu berücksichtigen. Die Vergößerung der Mikrointervalle zur Diatonik beruht auf einer auditiven Erinnerung, die kategorial als Musik, als musikalische Form aufgerufen und deutlich werden muss, um als eine ihrer Gestaltformen wahrnehmbar zu werden. In der Wahrnehmung erscheint nicht die physikalische Objek9 Heinz Werner: Musical „Micro-Scales“ and „Micro-Melodies“; in: Journal of Psychology, 1940, S. 152 46 tivität, sondern das nach Gestaltregeln der Diatonik Konstituierte, das die Objektivität überblendet. Das kulturell geprägte Hören verändert den rohen sensorischen Input und die Intervalle durchlaufen eine Distorsion zur Halbtonskala. Die zweite Form der Erinnerung betrifft den Zugriff auf die auditive Abstraktion der Tonhöhenrelationen. Es ist davon auszugehen, dass die einfachen Proportionen der ersten Harmonischen in den Vordergrund der Aufmerksamkeit, also des Bewusstseins treten, während sie in der Frequenzfolge der Obertonreihe, von der sie abstammen, ursprünglich unbewusst bleiben, also – wie Anton Ehrenzweig es mit einem psychoanalytischen Begriff bezeichnet – von der Repression der ganzen Reihe betroffen sind, während in einem gesonderten Verarbeitungsschritt daraus die Harmonischen gebildet werden. Dieser Schritt vergegenständlicht die auditive Wahrnehmung durch Schaffung klarer und konstanter Tonrelationen. Die objektiv definierbare und auf Frequenzen beruhende Höhe der Intervalltöne stimmt mit der subjektiv erfahrenen Tonhöhe nicht zwangsläufig überein. Die Mikrointervalle scheinen in Werners Test als undeutliche, unscharfe Sinneswahrnehmungen aufzutreten, die schließlich nach mehrfacher Wiederholung an eine „gemeinte“ Gestalt der Halbtöne angepasst wird. Der Unterschied von Musik und Geräusch ist wesentlich und nicht fließend, Musik keine nur besondere Form des Geräusches. Auf die Mikrointervalle reagiert das Wahrnehmungssystem nach intensiver Stimulation mit einer Unterscheidung, die die Tongestalten als Objekte eines Musiksystems interpretiert und Abweichungen unterdrückt. Die Mikroharmonik ist weder ganz dem Geräusch, noch ganz der Musik zuzuordnen. Die konstruierte Hörsituation provoziert das Wahrnehmungssystem zu einer Entscheidung zugunsten klar zu erfassender akustischer Strukturen, die als Musik eigentlich umgebungsunabhängig sind. Das Geräusch hingegen lenkt die Aufmerksamkeit auf Situationen, die handlungsrelevant sein können. Die Unterdrückung von physikalischen Erscheinungen hat den Sinn, die Objektgestalt stabil zu halten und zugunsten dieser Stabilität Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden, z. B. Schatten, Farben, perspektivische Verzerrungen, die die Objektkonstanz gefährden, zu unterdrücken. Der Zuwachs an Realitäts- 47 komplexität nimmt paradoxerweise in der Kunst Gestalt an, weil hier diskriminierte Phänomene interessant werden und wieder zugelassen werden, wie beispielsweise starke Helldunkel-Kontraste in der Malerei des Barock. 48 4 Mikroskalen Heinz Werners Versuch mit Mikromelodien und Mikroskalen führt in die Geometrie der Skalierung, weil er das Halbtonintervall um ein Zwölftel reduziert, also um die Spanne, die die Oktave gliedert. Die Nähe zum Geräusch, die die Diskriminierungsschwierigkeit des Gehörs mit sich bringt, wird – durch die Skalierung der Tonskala um ein Zwölftel – konterkariert, wobei der Gestaltcharakter erhalten bleibt und die akustische Wahrnehmung täuscht, die die Mikroform als Störung der musikalischen Gestalt unterdrückt, wie perspektivische Verzerrungen in der optischen Wahrnehmung unterdrückt werden, um die Identität des Gegenstandes zu gewährleisten. Priorität hat die Gestalt, also die Melodie oder die Skala. „The tendency to augment a less differentiated, indefinite interval in the direction of greater difference is obviously the expression of a general tendency known as the ’law of precision’. In further experiments... it was found that augmentation usually ceases when the constant interval has acquired the subjective character of a semi-tone. This may be interpreted in terms of a precision tendency, because a semi-tone is a simple and definite element in the realm of tonal distance.“1 Der Ton findet seinen Platz innerhalb des Systems. In der ersten Version des Textes von 1925 („Über Mikromelodik und Mikroharmonik“) tritt das Entwicklungsgesetz deutlicher in Erscheinung, wenn Werner schreibt: „Das Intervall entwickelt sich aus einer höchst unbestimmten Zweiheit von Tönen. Die zunehmende Bestimmung der Töne vollzieht sich in ganz allgemeiner Entwicklungsgesetzlichkeit. Aus einer sehr komplexen und verschwommenen Tonbeschaffenheit entfalten sich die spezifischen und eindeutigen Tonmerkmale. Ursprünglich hat jeder Ton eine sehr komplexe Klangfarbe, bei der die eigentliche Tonqualität, also das, was etwa 1 Heinz Werner: Musical „Micro-Scales“ and „Micro-Melodies“; in: Journal of Psychology, 1940, S. 151 49 das tiefe und das hohe a gemeinsam haben, noch nicht hervortritt. Statt dessen ist aber etwas anderes eher aufdringlich, nämlich die Helligkeit und die Dumpfheit der Töne.“2 Entwicklungsgeschichtlich scheint die Helligkeit der Töne primärer zu sein und die eigentlichen Tonqualitäten treten erst dann in Erscheinung, wenn die Töne aufeinander bezogen werden und sich in „spezifische Qualitäten“ differenzieren. Früher als das Bewusstsein bestimmter melodischer Intervalle ist auch das Leittonbewusstsein. Das Geräusch oder der Schall durchlaufen eine Analyse, die ähnlich verfährt wie die optische Wahrnehmung. Es trifft eine in der Zeit ablaufende Periode unterschiedlicher Frequenzen auf den Entwicklungsprozess der Hörgestalt. Eine Schwingung muss vollendet sein, um überhaupt eine Tongestalt zu erzeugen. Bei der Wahrnehmung gilt, dass die Schwingung deshalb als Spur quasi erinnert werden muss, was bedeutet, dass die Spur eine Rekonstruktion ist. In die Rekonstruktion fließen sowohl aktuelle Sinnesdaten als auch den Rekonstruktionsprozess bestimmende Erfahrungen als Erinnerungen mit ein. Ziel ist ein klares Erscheinungsbild, das die Musik indessen allein nicht ausmacht, denn die Erfahrungen sind emotional gefärbt, phylo- wie ontogenetisch. Die Kennzeichnung der Klanghelligkeit als primär oder primitiv setzt voraus, dass das klare, gestufte Erscheinungsbild des tonalen Systems nicht nur historisch spät ist, sondern Teil eines mikrogenetischen Prozesses. Ohne diesen Prozess würde es keine Gestalt geben, denn der sensorische Input allein führt zu keiner Form, weil die Unterscheidung eine subjektive Leistung mit Präferenzen in der Wahrnehmung ist. Die Begrenzung eines Objektes kann nicht in diesem selbst liegen. So ist die Schließung einer Gestalt oder das Aufeinanderbezogensein seiner Teile eine fundamentale symbolische Aktion. Aus Ehrenzweigs psychoanalytischer Sicht werden derlei Relationen unbewusst gelenkt, indem all das unterdrückt wird, was der klaren und distinkten Formbildung zuwiderläuft. „There, the conscious hearing 2 Heinz Werner: Über Mikromelodik und Mikroharmonik, Zeitschrift für Psychologie 1926, S. 79 50 picks out, as a rule, only those scale, rhythmical, and harmonic elements which are parts of the scale, rhythmical, and harmonic elements which are parts of the scale, rhythmical and harmonic ’systems’ (prevailing at the time) and fails to discern the scale-free, rhythmically free and harmony-free transitions in between. This technique of listening to the stream of music is reminiscent of our listening to the stream of language... Our memory picks out from the stream of language only the substantive elements in between.“3 Diese Formbildung schlägt sich in der Möglichkeit der Notation nieder, wo die Momente der Gestalt eine klar erkennbare Spur ergeben, in der sie systemisch aufeinander bezogen sind. „Durch das Tonsystem als Totalität wird jeder Teil bestimmt, nämlich jeder Ton und jedes Intervall, wenngleich dieses Tonsystem anfänglich nur fragmentarisch implizit da ist und sich allmählich entfaltet.“4 Der mikrogenetische Weg endet in einer Gestalt, die zwar die vorhergehenden Stationen mit enthält, welche jedoch von ihr maskiert sind. Die Musik geht nicht den Weg der Objekte und Objektvorstellungen, weil sie gewissermaßen vom Weg abweicht und auf Bedeutung zielt, die prozessual konstruiert wird. Sind Melos und Harmonie des diatonischen Systems solche Endgestalten, so dürften in den Kompositionen Momente des Prozesses enthalten sein, die nur als Metaphern gelesen werden können und dem Bewusstsein verborgen bleiben. Ehrenzweig hat gezeigt, wie solche Metaphern aussehen können, die auf unterdrücktes (maskiertes) Material verweisen – z.B. die Dissonanz oder Reibung. Es handelt sich dann auch weniger um diatonisch konstruktive Momente als um komplexes Klangmaterial oder Geräusche, die nicht nur als sekundäre akustische Phänomene der Instrumente wie das Rauschen der Orgel etwa ins Spiel kommen, sondern auch unmittelbar durch das Schlagwerk und reine Rhythmusinstrumente, wozu auch der unspezifische Sound der tiefen Bassgruppen gezählt werden kann. So stellt sich die Musikgeschichte auch als ein anwachsendes Eindringen vorgestalthaften Materials in die diatonische Struktur dar, wobei die Tendenz besteht, es ins System 3 4 Ehrenzweig, S. 84 Werner, S. 81 51 zu integrieren. So erleidet auch das System Veränderungen, z. B. beim Übergang zur temperierten Stimmung oder zur Zwölftonreihe, die beide eine erhebliche Vereinfachung der Systeme und Formbildungen darstellen, nicht zufällig in Analogie zu den Sprechlauten, deren komplexe Soundmuster in der Kommunikation erheblich reduziert werden müssen, sodass sie am Ende in einigen Buchstaben darstellbar sind. Die Entwicklung des Alphabets beruht auf der Filterung von ähnlich klingenden, wiederkehrenden Lautmustern, für die Zeichen als visuelle Stellvertreter eingesetzt wurden. Am lautlich reduzierten griechischen Alphabet zeigt sich immer noch die von Heinz Werner getroffene primäre Unterscheidung zwischen dumpfen und hellen Lauten, die in der Sprache als vokales Spektrum erscheinen. Das visuelle Moment verweist auf eine Unterscheidung, die die Klarheit und Deutlichkeit der Wahrnehmung betrifft: Dunkelheit und Helligkeit bilden Pole der phänomenalen Bestimmbarkeit. Die Identifikation eines Geräusches hängt von der Klarheit, d.h. „Helligkeit“ ab, die es von der Umgebung abhebt, z.B. ein Knacken von Ästen im Wald, das die Anwesenheit eines Tieres signalisiert. Visuelle Wahrnehmung findet im Hellen statt, akustische in einer dem Hellen analogen, d.h klaren Empfindung. Die Abstufung der „Helligkeiten“ ist, so Werner, primitiver und primärer als die Tonqualitäten und Tonfarben. Erst in der Relation tritt das tonale systemische Moment hervor, als finde in der Relation eine Reduktion der komplexen Lautgestalten statt, aus der der Ton hervorgeht. Die Relation kann horizontal als auch vertikal sein, melodisch und harmonisch. Die Unterscheidung betrifft die Helligkeiten ebenso wie die Kohärenzen der von der Umgebung abgesondert erfahrenen Dingklänge. Die Entwertung des Hörens im Hinblick auf natürliche allgemeine Umgebungsgeräusche ist für die Evolution des Menschen und seiner wachsenden Unabhängigkeit von der Umwelt signifikant. Der Spracherwerb ist hingegen auf die phonetischen Dekodierungsmöglichkeiten angewiesen, die die Evolution bereitgestellt hat. Die Dekodierungsschnelligkeit der Sprachlaute ist enorm, wobei die substanziellen Momente des Sprechstroms ins Bewusstsein treten, während die transitiven in den Hintergrund der Aufmerksamkeit rücken. Ebenso dominieren in der hö- 52 her entwickelten Musik die klaren melodischen und harmonischen Elemente, während das Transitorische unterdrückt wird und allenfalls metaphorisch als Ornament erscheint. In den Hintergrund tritt ebenso die Klangfarbe gegenüber der Tonhöhe. Die von Dingen abgegebenen Laute – gläsern, hölzern, metallisch – werden jedoch hauptsächlich durch ihre Klangfarben unterschieden.5 Die klare Identifikation gehorcht der evolutionären Bedeutung von Lauten fürs Überleben einer Spezies. Der Skalenton ist davon entkoppelt, er entfaltet in der Relation von hohen und tiefen Tönen eine eigene Gegenständlichkeit, die zeitlich wie räumlich strukturiert erfahren wird. Harmonische Verschmelzungen können jedoch Differenzierungen unterminieren. Die auf Skalen basierende Struktur ist dann geschwächt. „The artist tends to ignore the meaning of his form experiences as ’things’... The medieval fusion or rather ’confusion’ of several voices is irrational (thing-free)... It confounds the acoustic ’thing’ differentiation which tries to keep apart clearly tone sources in a way which makes them undistinguishable. As John of Salisbury says, ’the ears are almost deprived of their power to distinguish.“6 Stattdessen tritt die Klangfarbe wieder in den Vordergrund, weil sich die hohen Knabenstimmen mit den tiefen Männerstimmen überlagern, und in der Überlagerung wie eine einzelne Stimme klingen, die auch an Plastizität gewinnt. Die akustische Ortung des binauralen Hörens beruht auf dem Zeitintervall, mit dem die Laute das jeweilige Ohr erreichen. Das Zeitintervall wird jedoch unterdrückt und geht in einer Raumwahrnehmung auf. Ehrenzweigs Begriff der Überlagerung besagt nun, dass die Plastizität (Räumlichkeit) der verschmelzenden Stimmen auf der Schwächung der Differenz der Tonhöhen beruht. „The unison singing of a man and a boy would not create harmony because harmony presupposes the mixture of two tones of different pitch within the scale.“7 Das heißt, dass klare Tonhöhe und Raumempfinden bzw. Ortung sich gegenseitig ausschließen. 5 Ehrenzweig, Hearing, S. 90 Ehrenzweig, ebenda 7 Ehrenzweig, Hearing S. 91 6 53 Hören ohne Ortung der Quelle ist biologisch sinnlos, sodass Ortung und Geräuschquelle ursprünglich eine Einheit bilden. Mit dem Abschied vom Zwang zur Ortung der Quelle rückt skalenbasierte Musik mit einer Höhenskala als räumliches Epiphänomen in den Vordergrund. Die Ortung tritt bei der Geräuschwahrnehmung vermutlich erst dann in Erscheinung, wenn die mikrogenetische Endgestalt erreicht und der akustische Vorgang nach außen in den Raum verlegt wurde. Die Paarigkeit der Seh- und Hörorgane führen nicht etwa zu doppelten Konturierungen, sondern werden zur Bestimmung zusätzlicher Informationen über die Umgebung genutzt und fließen in die Gesamtwahrnehmung der Umwelt ein. Nach Ehrenzweig führt die doppelte Konturierung und Bildung unscharfer Ränder zur Plastizität der Objekte, also zur Raumempfindung. Die Auflösung der Konturen schärft den Eindruck eines Kontinuums, das als „lebendig“ empfunden, also emotional gefärbt wird. Das Vibrato der Stimmen und Streichinstrumente, das Schwebungsregister der Orgel tauchen den Ton in eine Art Kontinuum. „It is curious that the provocation of the left labyrinth with labyrinthill patients most frequently leads to a speed-up time perception, while the provocation of the right labyrinth provokes mainly perception of time delay. It is evident that on the background of the sensory function symmetry, an asymmetry is outlined again, as a new qualitative phenomenon of the individual. The elucidation of this phenomenon will contribute to the clarification of the triggerating mechanism for the biological clock’s rhythm. Some of these mechanisms are closely connected with the mental and emotional spheres of man, which appear as the highest manifestations of the individual. Our attention is directed towards the auditory system, but to that part more closely connected to the vestibular system. The constant current of 60-70 impulses per second in rest of the vestibular system (especially its otolith component), representing ’zero’ condition of this system, the lack of sign of fatigue and adaptation, make it possible pretender as leader of the rhythm of the higher sensoriness, 54 especially on the auditory system in the formation of perception of time and on the visual system in the perception of space.“8 Die fürs harmonische System relevante Tonhöhe wird durch das Hervortreten von Klangfarben geschwächt. Klangfarben waren zur Identifikation des Dingklangs bedeutsam, in dessen Komplexität das klare Intervall mit eindeutigen Tonhöhen eingehen und verschwinden würde. Die Betonung der Klangfarbe, die mit dem Objektlaut einhergeht, ist auch für Heinz Werner der Grund für eine unscharfe Tonhöhe. „Vorerst hat insbesondere jeder Ton seine Klangfarbe, jeder Ton steht neben jedem anderen Tone als eine sehr komplexe wie verschwommene Individualität, was eine musikalische Beziehung zwischen den einzelnen Tönen behindert. Am Anfange haben wir es also mit keiner Musik, mit keinem System zu tun.“9 Die Stelle, an der sich der Weg zur Musik vom Geräusch trennt, wäre der Skalenschritt. Mit ihm entfernt sich das Hören von der Objektivität in Analogie zu den geometrisch-symmetrischen Formbildungen, die der Modellbildung der Objektivität nur dienen. „The plastic effect of real things stands in inverse proportion to their welldefined shape.“10 Das heißt, dass die „guten Gestalten“ der Gestalttheorie weniger auf das Endprodukt als – mikrogenetisch – auf ein frühes Prozessstadium zurückzuführen sind. Die Abstraktion steht nicht am Ende, sondern am Beginn der Entwicklung, dient aber dem Bewusstsein, das Prinzip der Differenzierung für die Reduktion zu nutzen, indem der Weg rückwärts zurückgelegt wird. Ist der spärliche Umriss ein Zeichen für Redundanz des Anfangs einer Objektbeschreibung, nimmt das Bewusstsein die komplexe Endgestalt als Ausgangspunkt, von deren Vielfalt Abstand zu nehmen, um zu einfachen Formen wie den geometrischen zu gelangen, die nun der wissensbasierten Modellbildung der Welt dienen. Die Endgestalt enthält wesentlich mehr Daten aus dem sensorischen Input als der Anfang. „The brain acts to minimize the discrepancy between 8 Kehaiov, Vestibular Effect on the Auditory Function Werner, Mikromelodik S. 79 10 Ehrenzweig, Hearing S. 228 9 55 its predictions and the actual sensory input (termed the error signal), and that this occurs at many different levels of processing.11 Wenn man bei der Wahrnehmung Prozesse voraussetzt, in denen Sinnesdaten und innere Muster verrechnet werden, handelt es sich um sowohl physikalische als auch psychologische Gestaltungskomponenten. Der „plastische“ Effekt der Wahrnehmung kommt durch Überlagerung von Eindrücken zustande, die leicht verschoben den Hörer erreichen wie beim binauralen Hören, das einen Raum suggeriert, in dem Lautquellen geortet werden können. Dieser Effekt basiert auf einer Unterdrückung der Zeitintervalls, tritt jedoch generell bei Gestalt-Überlagerungen zutage, aus denen eine dritte, die „plastische“ Gestalt hervorgeht. Im Grunde handelt es sich um eine Raumillusion, die nach Ehrenzweig nicht allein physikalisch zu erklären ist. „In all these cases of ’imperfect synchronization’ a specific plastic quality is achieved by the repression of an inarticulate time interval through ’superimposing’ twilightly divergent rhythms. We see that both in vision and hearing a series of transitions leads from the superimposition of two physiologically determined divergencies in a definite space perception to the superimposition of arbitrary divergencies in the indefinite plastic ’illusions’ of art.“12 Die Unschärfezone, die die Überlagerungen schaffen, liegt auf einer Bruchstelle, die beide Seiten repräsentiert, indem sie eint sowohl als trennt, oder ausschließt im begrenzenden Einschließen, wofür das Symbol der Kreisform ideal ist, weil es auch den Umkreis des Körpers und die Rückbezüglichkeit des Selbst trifft. Die Lichtbrechung ist ein Beispiel für die Zerlegung eines Ganzen in Teile im Medium des Lichtes. Für die Zerlegung des Schalls ins Spektrum von Tonbeziehungen gilt das Gleiche, sodass die Bewegung der Skala zwischen Grundton und Oktave einerseits als Entfaltung und andererseits als Kreisform beschrieben werden kann, in dem die Stationen der Entfaltung eines Ganzen durchlaufen werden. Der auf tonaler Basis konstruierte Raum basiert auf der Verlegung 11 Susan L. Denham, Istvan Winkler: Auditory percetual organization; in: Oxford Handbook of Perceptual Organization, S. 5 12 Hearing S. 234 56 der einstigen Relation von Beobachter und Lautquelle ins symbolische Reich der Intervallstruktur. Überlagerungen führen zurück auf weniger entfaltete Stadien des Wahrnehmungsprozesses und deuten auf Nachbarschaften innerhalb einer noch differenzierungsfähigen Kategorie hin. Sie markieren Stellen, an denen eine Reduktion von Möglichkeiten stattfinden sollte, die nötig sind, um zu einem klaren, das heißt bewusstseinsfähigen Endergebnis zu kommen. „We saw... how the gestalt-free perceptions of the depth mind contained ’too general’ things and images which could be visualized only as a superimposition of several adult concepts into the undifferenciated perception.“13 Die Überlagerung kann ebenso als Freudsche Verdichtung, der Verschmelzung unterschiedlicher Objekte zu einer einzigen Vorstellung und als mikrogenetische Kategorie verstanden werden. So können klangliche Verschmelzungsprozesse Tonhöhenwahrnehmungen in komplexe Klänge auflösen und Objektwahrnehmungen hervortreten lassen, die Ehrenzweig „plastisch“ nennt. Dieser Klanggestaltbildung haftet ein konstruktives Moment an, das auf der Fügung beruht und von der Musik genutzt wird – nachdrücklich in der polyphonen. Das horizontale Moment der Melodie und das vertikale der Harmonie haben gegensätzliche Ursprünge. Die Melodie kann man in ihrem Ursprungsstadium als ornamentale Figur ansehen, die sich zwischen den zentralen konsonanten Stufen der Leiter bewegt. Das Intervall hebt sich hier paradoxerweise fast selbst auf und demonstriert die Einheit in der Differenz, die als schön empfunden wurde. Die Schönheit der Konsonanz beruht jedoch nicht auf der „Ähnlichkeit“ der Töne, denn sie erleichtert nicht ihre Wahrnehmung, sondern erschwert sie. „One is tempted to turn Helmholtz’s theory upside down and describe the psychological function of overtone identity or similarity in musical form not as simplicity and ease perception, but the other way round – as the utter confusion and ambiguity of unconscious thing differentiation, and ambiguity dear to our thing-free irrational depth mind.“14 Ursprünglich wird die Kon13 14 Ehrenzweig, Hearing S. 113 Ehrenzweig, Hearing S. 158 57 sonanz somit eher Ausdruck unbewusster Intentionen gewesen sein, bis es vom Bewusstsein als Mittel musikalischer Konstruktion, also formbildend eingesetzt werden konnte. Dieser Übergang ist nach Ehrenzweig typisch für den künstlerischen Prozess. Die Einheit der Vielheit wird im Altertum bewundert, weil Einheit die andere Seite der Ordnung ist. Diese Bewertung der Einheit oder Ganzheit als schön oder gut wird auffällig betont und lässt auf eine emotionale Bedeutung der Relationen einer Ganzheit schließen, die in der Musik entfaltet wird. Dieser Prozess gleicht dem mikrogenetischen Muster einer schritt- wie stufenweisen Bewegung mit einem sich ständig aktualisierenden Gefühl der Bedeutung. Die Bewegung versetzt die Einheit des Ganzen in eine dem Bewusstsein zugängliche Form des Nacheinanders, dessen Momente sich zur ursprünglichen Ganzheit annäherungsweise zusammenfügen, sodass die Gestalt aus dem Unbewussten auftaucht und wieder dahin zurückkehrt. Dass und wie dies gelingt, obliegt der Leistung des Komponisten, das Ganze in Teile zu zerlegen, in eine sukzessive Ordnung zu bringen, die sich wieder zu einem Ganzen fügt. Um diese Ordnungsfolge bilden zu können, muss das Ganze auf irgend eine Weise präsent sein, um geeignete Beziehungen zwischen den Teilen herzustellen – geeignet heißt, die Konstruktion einer Bedeutung oder eines Gefühls. Um die Zeitenthobenheit des schöpferischen Aktes zu demonstrieren, zitiert Ehrenzweig einen bereits von William James erwähnten Brief, in dem sich Mozart über sein Komponieren auslässt und schreibt, er höre das Stück nicht sukzessiv, sondern „alles auf einmal“. Auch wenn der Brief als Fälschung entlarvt worden ist, scheint Mozarts Arbeitsweise nicht unzutreffend geschildert worden zu sein und würde Ehrenzweigs Vorstellung eines „time-free hearing“ als Voraussetzung des schöpferischen Prozesses erklären. Studien über Mozarts Arbeitsweise zeigen, dass Mozart geistig an einer Komposition arbeitete, während er eine andere niederschrieb.15 Auch Bachs Spiegelfugen dienen Ehrenzweig als Zeugnis für die Zeitenthobenheit unbewusster Inhal15 Ulrich Konrad: Compositional Method; in: The Cambridge Mozart Encyclopedia, 2006, S. 102 58 te. Die Kunst der Fuge zeugt von der Möglichkeit des Komponisten, eine Form zu finden, die dem Bewusstsein erlaubt, der komplexen Ganzheit unbewusster „Inhalte“ zu begegnen, dazu müsse er aber über die Ganzheit bereits verfügen, ehe er sie in Schritte zerlegt. „We cannot imagine how Bach could have written his first melody while paying equal attention to its effect in the ’crab’ or ’mirror’ order.“16 Das Timbre korrespondiert formal dem spektralen Moment des Gefühls, wobei die Tonhöhe Bedingungen des Bewusstseins erfüllt, klar, distinkt und kommunizierbar zu sein. Das Timbre und die Überlagerung von Tonhöhen im Intervall bilden einen emotionalen Hintergrund, der kaum bewusst ist, weil er der Priorität der Tonhöhe wegen in den Hintergrund rückt. Der Zusammenhang von Timbre und Tonhöhe hat Folgen für die Tonhöhe, wenn das Timbre durch zusätzliche Klangkomponenten sich verändert. Das Zusammenspiel von bewussten und unbewussten, direkt wahrnehmbaren und indirekt vermittelten Klanggestalten könnte erklären, wie es gelingt, über das Skalenmaterial und rhythmische Komponenten Konstrukte zu erzeugen, die emotionale Wirkung zeigen. Der Zugang zu den Emotionen läuft über die Möglichkeit eines tonalen Systems, klangliche Metaphern zu schaffen, die aufgrund der Differenzierung des Materials in Tonhöhen und Klangfarben doppelt orientiert sind – nach außen und nach innen. Die Tonhöhen würden nach außen die physikalische Realität und bewusste Wahrnehmung abbilden, nach innen Bedeutung, die emotional vermittelt ist, weil es sich um Erfahrungen handelt, die in Kategorien, symbolische Ordnungen der Erfahrungen, gefasst sind. 16 Ehrenzweig, S. 109 59 5 Fühlen Jason W. Brown unterscheidet Gefühl und Emotion unter Prozesskategorien. „We sense Feeling in activity and passivity, or agency and receptiveness, a dynamic that underlies mentality and is accentuated when its direction is impeded, as in tension, hesitation or anxiety... An emotion is a complex of feeling and idea – conceptual feeling – that is a motiv and object of the self. Feeling is a deeper activity, prior to emotion and idea, out of which emotion and other contents of mind develop. The isolation of actualities from antecedent possibility, the force and specifity of conative drive, the sequence that brings entities into existence, are signatures of Feeling as the engine of evolutionary advance.“1 Fühlen, das anders als „Gefühl“ eher die momentane Empfindung trifft, tritt demnach als Unterbrechung eines Prozesses in Erscheinung, dem das Ziel oder Objekt abhanden gekommen ist, sodass die blanke Intentionalität hervortritt. „If we could eliminate acts, objects or mental contents in a momentary cognition, mental activity would likely be felt as pure feeling with our origin or subjective aim.“2 Fühlen setzt Brown in der Tiefe der evolutionären Entwicklung an, sodass Fühlen wie eine frühe Schicht eines Prozesses anzusehen ist. „Feeling“ spielt eine Schlüsselrolle im komplexer werdenden Aufbau von Organismen. Auf den frühesten Stufen ist Fühlen richtungslos „and best described in the physics of elementary particles. In the gradual shift to vegetation, energy assumes directionality in primitive life forms, or perhaps one could say the life forms channel energy in the direction of becoming and/or growth.“3 Abgesehen von der Ähnlichkeit dieser Spekulation mit klassischer Metaphysik als Beschreibung einer Entfaltung des Absoluten im Beson1 Jason W. Brown: Microgenetic Theory and Process Thought, 2015, S. 66 Brown S. 66 3 Brown, Process Theory S. 70 2 60 deren von Raum und Zeit, führt Brown mit dem Fühlen eine intelligible Kategorie der Orientierung ein, die auch den evolutionären Prozess antreibt. Für Damasio sind Gefühle Wahrnehmungen von Emotionen, die er automatisch, also unbewusst ablaufende Programme für Handlungen nennt. Auch wenn Brown das Fühlen tiefer ansetzt, sehen beide im Fühlen einen Zustand, Perzepte zu haben, die durch Berührung zustande kommen, wie es das Wort nahelegt (Fühlen abgeleitet von IE. *pol-, *pal, *pl. ). „Brain and skin are derived from primitive ectoderm. The neocortex is laminated like the skin, in mental process, as in epidermis, there is a continual replacement of objects that are born, grow and die.“4 Diese Berührung nimmt das Berührte als einheitlichen Komplex ohne Relationen wahr, „an experience of many in one and genetically the first layer of experience“.5 Fühlen begleitet die Wendung nach innen, ist eine Kategorie der Innenperspektive, in der es die Relationen der Daten und Erscheinungen der objektiven Wahrnehmung noch nicht gibt gemäß der Voraussetzung, dass die Konkretion ein Prozess der Differenzierung ist, die in bewusster Erfahrung zum Abschluss kommt. Gefühle zu erzeugen, gelingt somit durch Mittel der Entdifferenzierung, die das wahrnehmende Bewusstsein daran hindern, klare und deutliche Gestaltperzepte zu bilden. Fühlen tritt als Perzeption eines nicht ausdifferenzierten Prozessstadiums auf, der anders nicht wahrgenommen werden kann, weil er unbewusst abläuft und Undifferenziertes nicht bewusstseinsfähig ist. So ist Fühlen eine Erkenntniskategorie des Subjektes, auch wenn – oder gerade weil – das „Objekt“ nur metaphorisch oder vage in Erscheinung tritt. Browns „Feeling“ geht auf einen Symmetriebruch zurück, der der Einheit ein Gefälle, eine Richtung gibt, sodass man dieses Fühlen auch als Streben bezeichnen kann, dem ein Wert innewohnt. Die Erkenntnisfunktion des Fühlens verschmilzt mit der Bewertung oder Wertsetzung. Wahrnehmung ist kein rein technischer Vorgang der Verarbeitung objektiver Signale, sondern intentional. Das Aufsuchen bestimmter Wahrnehmungen, das nicht dem Auffinden eines Objektes dient, 4 5 Brown, Process Theory S. 7 Brown, S. 67 61 wie bei der Nahrungssuche, sondern auf die Wahrnehmung selbst zielt, versetzt die Wahrnehmung in einen herausragenden Status. Sie wird sich selbst zum Ziel, wie es etwa bei der Betrachtung des Naturschönen der Fall ist. Den breitesten Raum der Hypostase der Wahrnehmung nimmt die Kunst ein. Deren Objekthaftigkeit zieht die Wahrnehmung von ihrer biologischen Funktion ab, schwächt die unmittelbare Beziehung zum Objektbereich. Mit einem psychoanalytischen Begriff kann man sagen, dass die Besetzung der Außenwelt zugunsten von Besetzungen der Innenwelt verringert wird. Die sich auf sich selbst beziehende Wahrnehmung macht aus dem Mittel einen Zweck, aus dem Prozess eine Endgestalt, der der Dynamik des Fühlens folgt und im Schwebezustand zwischen Objektivität und Subjektivität verharrt, damit aber beide nicht erreicht. Diese Endgestalt kann keine Gestalt sein, die fest umrissen und selbstidentisch ist, sodass der Begriff des Fühlens mit dem Prozesshaften eher übereinstimmt, zumal dem Fühlen der Zeitaspekt innewohnt. Etwas geschieht im Bewusstsein, ohne dass etwas inhaltlich geschieht. In seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften von 1830 schreibt Hegel (§ 406, Zusatz): „Von dieser meiner Wirklichkeit, von dieser meiner Welt weiß ich aber, insofern ich nur erst fühlende Seele, noch nicht waches, freies Selbstbewußtsein bin, auf ganz unmittelbare, auf ganz abstrakt positive Weise, da ich, wie schon bemerkt, auf diesem Standpunkt die Welt noch nicht von mir abgetrennt, noch nicht als ein Äußerliches gesetzt habe, mein Wissen von derselben somit noch nicht durch den Gegensatz des Subjektiven und Objektiven und durch Aufhebung dieses Gegensatzes vermittelt ist.“ Der Begriff des Fühlens, der für Brown so grundlegend ist, dass er für die Gerichtetheit von Aufbauprozessen zuständig sein soll, tritt auf eine ontogentisch undifferenzierte Stufe zu, die der phylogenetischen vergleichbar ist und die mikrogenetische Endgestalt mit frühen Erfahrungen färbt. „The outcome of a state, such as an object or word, is not a resultant of the preceding series but incorporates earlier segments of that series – value, meaning, belief – as part of what is. An object includes its formative phases.“6 Oder: 6 Brown, Process Thought, S. VI 62 „Processing stages that underlie or are submerged within a performance constitute part of the structure of that performance, just as the stages of development in childhood persist as the ’subconscious’ motives or the experiental context guiding the cognition of the adult.“7 Fühlen wäre ein Vermögen, mit frühen Differenzierungsstadien in Berührung zu kommen. Jason W. Brown beruft sich auf Francis Bradley, der das Fühlen als erste Ebene der Erfahrung bezeichnet und Hegels Position teilt. Wir würden keine reinen Objekte erfahren, schreibt er in dem Kapitel „Our knowledge of Immediate Experience“ (aus „Essays on Truth and Reality“), denn „in my general feeling at any moment there is more than the object before me, and no perception of object will exhaust the sense of a living emotion... We in short have experience in which there is no distinction between my awareness and that of which it is aware. There is an immediate feeling, a knowing and being in one, with which knowledge begins.“8 Die frühen Differenzierungsstadien gehen von einem anfänglich weitgehenden Einheitsgefühl des Kindes mit der Mutter aus und von Wahrnehmungen, die aufgrund der Erfahrungsarmut und einem entsprechend geringen Erinnerungsbestand vermutlich reichlich abstrakt auftreten. Das retinale Bild erscheint früher als die Objektwahrnehmung. Auf diese abstrakte Phase kann später zurückgegriffen werden, wenn geometrische Ordnungsvorstellungen ins Bewusstsein treten und angenehme Gefühle erzeugen. Unser Erinnerungsbild einer „guten Gestalt“, so Ehrenzweig, sei dem retinalen Bild, Basis aller bewussten visuellen Wahrnehmung, eng verbunden. „I submit that the abstract gestalt perception is grafted on our perception as a late-comer which, as so often happens in mental functioning, revives an archaic mode of perception.9 Geometrische Formen entfachen ein Gefühl der Perfektion, die in der Anschauung nicht vorkommt, deshalb etwas Besonderes ist und mit Schönheit verbunden. Dass sich solch ein Fühlen auf die „pan-genitale“ Bedeu7 Brown, Mind, S. 4 f. Damian Ilodigwe: Bradley and the Problematic Status of Metaphysics: In Search of an Adequate Ontology, Cambridge 2005, S. 394 9 Ehrenzweig, Hearing S. 218 8 63 tung linearer Formen zurückführen ließe, fällt in den Rahmen Freudscher Symbolik und ist laut Ehrenzweig auf dreidimensionale Formen der Architektur erweiterbar, die auf die frühkindliche Erfahrung des Kontaktes von Mundhöhle und Brust zurückgehen, wobei sich Raumempfindungen bilden, die vermutlich Ehrenzweigs „plastic feeling“ gleichen, das er auf Überlagerungen (superimposition) und Verschmelzungen (fusion) von Gestalten zurückführt. Die visuelle Wahrnehmung plastischer Objekte steht somit in Verbindung mit den Berührungswahrnehmungen und variablen Empfindungen der Mundhöhle. Die libidinöse Konnotation des Auges und Sehens kommt über die Konstitution plastisch empfundener Objektperzepte zustande. Die orale Situation wird psychoanalytisch nach Zwischenstationen von der phallischen abgelöst, deren Funktion selbst eine Fusion ist. Es ist fraglich, ob das Indifferenzgefühl des Kindes vollständig zutrifft, oder ob nicht auch anfänglich eine gewisse Wahrnehmung der Differenz zu Überlagerungen führt, die beide Zustände bedient, die Einheit und die Verschiedenheit, Voraussetzungen für spätere Selbstwahrnehmung. Die duale Funktion der Sinnesorgane besteht aus einer rezeptiven und einer projektiven Einheit, die zusammen das Perzept bilden. Projektiv sind die Innenwahrnehmungen, die mit den rezeptiven Daten der Sinnesorgane „verrechnet“ werden. Die Verarbeitung entspricht dem komplexen adaptiven System, das die Evolution kennzeichnet. Murray Gell-Mann: „Der Genotyp erfüllt die Kriterien eines Schemas, sodass er die Erfahrung der Vergangenheit in hochverdichteter Form enthält und mutationsbedingter Variation unterliegt. Der Genotyp selbst wird in der Regel nicht unmittelbar durch Erfahrungen geprüft. Er steuert zwar weitgehend die chemischen Abläufe innerhalb des Organismus, aber letztlich hängt das Schicksal jedes Individuums auch von den Umweltbedingungen ab, die nicht von den Genen beeinflußt werden... Der Phänotyp einer Zelle wird durch den Genotyp und all jene – vielleicht zufallsbedingten – externen Bedingungen mit determiniert. Eine solche Entfaltung des Schemas, bei der neue Daten eingespeist werden, um Wirkungen in der realen Welt zu erzielen, ist kennzeichnend für ein komplexes adaptives 64 System.“10 Die Wahrnehmung erzielt ebenso Wirkungen auf das Verhalten und dessen Anpassung an die Umwelt, dürfte also aus einem solchen adaptiven System hervorgegangen sein. Der Theorie entsprechend, wird in der Verarbeitung der Sinnesdaten auf der Wahrnehmungsebene die adaptive Funktion mikrologisch wiederholt. Das betrifft vor allem die entwicklungspsychologischen Auswirkungen der Wahrnehmung. Die Adaption des Organismus an die Umwelt ist mit den Hör- und Sehfunktionen so weit fortgeschritten, dass die (Um-)Welt in der Wahrnehmung sich selbst begegnet, sodass dieses Moment als Ganzes beschrieben werden muss. Von diesem Ganzen aus betrachtet, ist Hören ein Prozess zweier Systeme, die parallel arbeiten und in der Überlagerung eindringend perzeptiver und respondierender innerer Muster die Klanggestalt ergeben. In dieser Überlagerung gibt es eine Art Grenze, die dort verläuft, wo in der Evolution lebende Systeme entstanden sind, die den Umwelten nicht nur gegenübertreten, sondern in der Wahrnehmung dieser Umwelten als deren Selbstbegegnung oder Selbstwahrnehmung bezeichnet werden können. Solche Grenzen sind Ränder, die aus rekursiven Prozessen entstehen. 10 Murray Gell-Mann: Das Quark und der Jaguar. Vom Einfachen zum Komplexen, 1998, S. 118 65 6 Geometrie des Intervalls Eines der evolutionsbiologisch und entwicklungspsychologisch entscheidenden Veränderungen in der Umweltanpassung ist die Erlangung des aufrechten Gangs mit einer erheblichen Bedeutungssteigerung der Vertikale als Achse, um die herum der Gang pendelt. Der Bewegungstyp ist schwankend. Der Winkel als Maß der Abweichung kann als Länge beschrieben werden, weil die Vertikale mit der Horizontalen einen rechten Winkel beschreibt und sich ein rechtwinkliges, pythagoreisches Dreieck ergibt. So werden die Winkel der Pyramidenböschung mit Seked, einer Längenbezeichnung angegeben, die den Rücksprung der Stufe angibt. Die Schräge (Hypotenuse) ist vom sqd abhängig. Mit dem Wort befindet man sich im Begriffsfeld des Bauens, weil sqd neben Neigungswinkel auch „bauen lassen, Schiffer, Ruderer“ bedeutet (Wörterbuch der Altägyptischen Sprache, herausg. von Adolf Erman und Hermann Grapow, Berlin 1982, Bd. V, S. 309), zu qd „bauen, bilden, schaffen, schlafen; Töpfer, Maurer, Umkreis, Wesen und Gestalt“. qd.t, qd, qdd „Schlaf“ (Erman / Grapow, V, S.79). Zum Bereich des Bauens gehört sAq; sqr „schlagen“, das für handwerkliches Arbeiten und für das Musizieren einer Harfe oder Pauke gebraucht wird. Mit sqd verbunden ist sqdj „fahren, gehen“, also Sich-bewegen. qA ist der Urhügel, dessen Bild zeigt einen Bergausschnitt, ein rechtwinkliges Dreieck mit einer gewellten Hypotenuse, die die Böschung darstellen soll. sqA „hoch machen“ knüpft aktivisch an die Höhe des Hügels an. Die Wesenheit oder Gestalt, die mit dem qd verbunden ist, könnte im kA eine Parallele haben, zumal er auf der Töpferscheibe des Chnum geschaffen wird. Es scheint sich um eine der Seele parallele Figur zu handeln, die doppelgängerisch auftritt. Handelt es sich um eine Adorationsgeste, verweisen die Arme in die Höhe. 66 Der Adorationsgeste liegt eine Haltung zugrunde, die entwicklungsbiologisch als Klammerreflex verstanden werden kann. Dieser Reflex wird jeder künftigen Stufe der Körperhaltung vererbt – dem Sitzen, Stehen, Gehen – und im Sichselbstfesthalten psychologische Relevanz erzielt. Aus der ursprünglich körperlichen Kraft der „Selbsthaltung“ wird ein System der Autonomie. Das Erreichen jeder Stufe ist mit dem Gefühl einer Leistung verbunden, die jedoch immer wieder gesichert werden muss. Die körperliche Balance hat ein psychologisches Äquivalent, das sich in unterschiedlichen Situationen mit dem Hochreißen der Arme manifestiert – in der panischen Flucht ebenso wie im Jubel, ein Ziel erreicht zu haben. Die rekursive Stabilisierung wird im doppelgängerischen Charakter der Ka-Figur ausgedrückt. Sie enthält eine Selbstübersteigung in der Notwendigkeit für die Erhöhung des Selbst symbolisch den Raum nach oben zu öffnen. Der aufrechte Gang ist insofern mit einer gravierenden Veränderung der Umweltwahrnehmung verbunden. Die Berghieroglyphe zeugt von der Bedeutung des rechten Winkels als Grundfigur der Orientierung und Bildung einer symbolischen Raum-Zeit-Ordnung. Die Geometrie gibt Regeln an die Hand, sich kontrolliert und präzise zwischen festen Punkten und Grenzen bewegen zu können, die gesetzt werden müssen. Geometrie ist die Lehre von den Bewegungsgesetzen ihrer Einheiten Punkt, Linie, Fläche usw. Der Neigungswinkel ist ursprünglich auf Vertikale und Horizontale bezogen und übernimmt die Bedeutung der Abweichung, des „Linken“, von dem Gefahr droht, den erreichten Status zu verlieren. Geometrie dient der Differenzierung des Undifferenzierten, und der Himmel bietet mit den Sternlichtern bereits Ansätze dafür, weniger das Meer, dessen schwankende Masse die Stabilität des Aufrechten bedroht. Die Intervallstruktur setzt dem undifferenzierten Klang ebenso feste Haltepunkte entgegen wie geometrische Formen dem Raum und der Bewegung von Körpern. Da der Halt im Entwicklungszeitraum des Kindes von außen nach innen verlagert und innen aufgebaut werden muss, bieten sich innere Formen der Strukturbildung an, die jedoch objektivierbar sein müssen, d.h. eine Umweltbeschreibung ermöglichen, wofür die Geometrie infrage kommt. Die Winkelbewegung scheint hier eine Art 67 Kategorie mikrogenetischer Prozesstheorie zu sein für unterschiedliche Präzisierungen der Abweichung vom Lot, die linear und als Rotation beschrieben werden kann – also trigonometrisch, aber auch emotional über die Leistungen der Stabilisierung des Selbst. Über die Längen, also Proportionen, sind Intervallverhältnisse beschreibbar, sodass musikalische Vorstellungen sich mit geometrischen vergleichen lassen. Die bewusste Verwendung von Intervallproportionen beim Bau von Pyramiden lässt auf die Vorstellung einer solchen Analogie schließen. Die Quarte ist geometrisch als Seitenverhältnis des pythagoreischen Dreiecks mit den Seiten 3:4:5 beschreibbar, Proportionen der Messschnur der Knoten der ägyptischen Seilspanner und die einiger Pyramiden.1 Auf das rechtwinklige Dreieck bezogen, ist jedem Winkel eine Proportion zuzuordnen, die aus den dem Rechten gegenüber liegenden Seiten bestehen. Intervalle lassen sich als pythagoreische Dreiecke lesen. Es gibt Winkel, die Intervalle bilden, deren Töne harmonisch klingen, weil sie als ähnlich empfunden werden. Sie „passen zusammen“, weil die Winkelneigung einen hohen Verschmelzungsgrad impliziert. Das arabische Wort für „Konsonant, ähnlich sein“ wird vom arabischen Euklid auch als terminus technicus für „Neigung, Inklination“ gebraucht; es steht aber auch für das Sinken der Sterne, wenn sie wie die Sonne auf- und untergehen. Reinhart Dozy übersetzt das arabische Wort mit „décliner, en parlant des astres“ und „biaiser (schräg laufen)“. Der bewegliche Teil des Astrolabs, das die Bewegung der Himmelskörper in Winkeln anzeigt, wird ebenso genannt wie die Schrägen des Trapezoids, schiefe Ebenen und Flächen.2 Wenn der Winkel vom Lot aus gemessen wird, ist jede Neigung ein Sinken, das metaphorisch für die Gegenrichtung des Aufbaus und der Ordnung steht. Die schiefe Ebene oder Schräge steht ebenfalls für die Dynamik der Auf- und Abwärtsbewegung, Aufstieg und Abstieg, Errichten und Abbauen, Aufwachen und Einschlafen. Es sind gegensätzliche 1 Friedrich Wilhelm Korff: Das musikalische Aufbauprinzip der ägyptischen Pyramiden, Hildesheim 2015, S. 4 2 Hommel: Untersuchungen zur hebräischen Lautlehre, 191, S. 154. R. Dozy Supplément S. 272 f. Die ägyptische Cheops-Pyramide ist nach Korff in sechs trapezförmigen Stümpfen aufgebaut, die von einem Pyramidion gekrönt wird. 68 Bewegungen, die in die Deutung der Bahnen der Himmelskörper eingeflossen sind und zu Sakralbauten mit Bergcharakter wie die Zikkurate motiviert haben, die den Auf- wie Abstieg symbolisieren. Die Stufen heißen tubkati, im Hebräischen wird die Zikkurat mit „Aufschüttung“ übersetzt, die es ermöglicht, den Himmel zu besteigen (Gen. 11,4). Die tubkati sind fünf Stufen, die als Pentagramm in einen Kreis eingeschrieben, d.h. als einheitliche Gestalt dargestellt sind. Die Stufen sind somit auf die Bewegung der Himmelskörper bezogen. Cassio Dio bringt das Heptagramm mit den Umlaufzeiten der Planeten in Verbindung und nutzt für die Zählung die im Kreis eingeschriebenen Strecken. Die häufig auftretende Konnotation von Harmonie und Inklination gründet sich auf einen engen Zusammenhang zwischen Winkeln, Proportionen und Intervallen mit hohem Verschmelzungsgrad. Die Ausrichtung des Körperschemas auf die Vertikale nimmt den Gleichgewichtssinn ungleich stärker als vormals in Anspruch. Die ältesten musikalischen Praktiken zeigen, dass akustische Phänomene eng mit vestibulären korreliert sein können. Perseverierende Muster (Rhythmen) zielen auf bewusstseinsmindernde Zustände, verursachen Trance und Drehschwindel. Rotation unterminiert die Stabilität der aufrechten Stellung. Offenbar liegt eine unbewusste Tendenz von – psychoanalytisch ausgedrückt – Primärprozessen vor, die Entwicklung, die sich ontogenetisch mit dem Laufenlernen und phylogenetisch mit dem aufrechten Gang vollzieht, rückgängig machen zu wollen. Rhythmus und Intervalle mit starkem Verschmelzungscharakter sind auf die Innenwahrnehmung gerichtet und lockern den Außenbezug, der für die Orientierung und Stellung des Körpers im Raum wichtig ist. „The acoustic thing perception, by means of tone colour, also partakes of the ’constancy’ in general thing perception... Now the ’natural’ tone colour of a thing also remains independent from accidentical fluctuations in the composition of inaudible overtone chord.“’3 Dies gilt auch für Instrumente, deren Klangfarbe gleich bleibt, egal ob es höher oder tiefer, lauter oder leiser ertönt. Doch wird in der Musikpraxis diese Stabilität unterminiert, wenn schon die frühe Polyphonie es auf eine Mischung akustisch 3 Anton Ehrenzweig: The Psycho-Analysis of Artistic Vision and Hearing, 1953, S. 155 69 differenzierte Dinge (Klangwerkzeuge) anlegte. Diese Tendenz „towards confusing acoustic things is perhaps also able to interpret the role which the inaudible overtones so manifestly play in evolving the basic musical form elements of melody and harmony“.4 Die Ähnlichkeit leitereigenen Töne zwischen verschiedenen Intrumenten deutet auf eine Reduktion des Einflusses der obertonbestimmten Klangfarbe auf das Klangobjekt hin, dessen akustische Erscheinung geteilt ist in Tonhöhe auf der einen und Instrumentalklangfarbe auf der anderen Seite. Die Klarheit der Tonhöhe entsteht um den Preis der mageren Klangfarbe dieses Tons, die durch „Repression“ (Ehrenzweig) der Obertöne und der Betonung des Grundtons entsteht, der als Skalabestandteil die ersten Obertöne abbildet. „I submitted that the capacity of music for generating ’artificial’ tone colours (through repressing inarticulate tone steps, rhythms, tone intensities, chord tones) could be construed as a secondary ’reification’ process producing new things in answer to the primary destruction of the acoustic things (natural tone colours).“ Die musikalische Struktur ist als Restitution einer gelockerten Bindung an die sinnliche Wahrnehmung der Umwelt zu werten, weil sie im Zuge der Restitution eine Ordnung mit sich bringt, mit der die Verluste an Orientierung ausgeglichen werden. Die Geltung geometrischer Ordnung in den Intervallproportionen bildet in ihrer Regularität ein Bindeglied zur geschwächten Objektbeziehung und Dingkonstanz. Die Ordnung dient der Errichtung einer inneren orthogonalen Instanz. Sie entspricht den Introjekten als Bausteine eines autonomen Selbst, das die Orthogonalität aufrechterhalten muss, indem sie der Richtung von Kraft und Wirkung eine Kraft entgegensetzt. Die Kraft, die der griechischen Geometrie zufolge die Linie aus dem Punkt, die Fläche aus der Linie und den Raum aus der Fläche erzeugt,5 verläuft der Falllinie, also der Spannung des Raums entgegengesetzt. Die geometrische Konstruktion läuft auf die Wiedererrichtung der Dreidimensionalität hinaus, deren naturgegebene Kraft und Wirkung in der ersten und zweiten Dimension er4 5 S. 157 Julius Stenzel: Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, 1956, S. 89 70 halten zu bleiben scheint. Damit sind Punkte und Linien aktiv, wofür die Sprache Hinweise bietet. Die Kathete erhält im Wort noch eine alte Beziehung zur sinnlichen Erfahrung. Sie ist das Herabgesenkte, Herabhängende, auch Senkblei. καθίμι „herablassen, hinuntersenden“; der hintere Wortteil zu ἵεμαι „sich vorwärtsbewegen, sich eilen, begehren“ (Frisk). Solche Bedeutungen zeugen von einer frühen Korrelation geometrischer Vorstellungen und körperlicher Erfahrung, die dann zugunsten einer Systematisierung der Geometrie aufgegeben wurde. Die Bindung der Orientierung an die Vertikale bringt ein emotionales Moment ins Spiel. Für die Geometrie galt bereits die Wirkung einfach wahrzunehmender Objekte auf die Informationsverarbeitung der komplexen Umwelt. Die Geometrie ist ein sichtbares Zeugnis der Dingkonstanz. Sie scheint dem Erhaltungsprinzip der Dingkonstanz ein Moment hinzuzufügen – oder von ihm abgeleitet zu sein, um sie als neue Ordnung zu überlagern. In der Musik wird der Dingklang überlagert von der Ordnung musikalischer Systeme, auf dem Instrument gelten Skalen und Intervallstrukturen, die den Objektklang verändern. Das Objekt tritt uns erst in seinem letzten Stadium der Wahrnehmbarkeit als von emotionalen Bestimmungen rein in Erscheinung. Diese Art von Objekthaftigkeit ist das Ergebnis eines konstruktiven Prozesses und nicht an sich. „The impression of an external relation to objects comes from their outward movement and loss. This splits the object off as something external, leaving its affective tonality behind. The effect is to reinforce the separation of mind and object and support the belief that the world is not ours to create but is out there to observe, react to and experience...“6 Die Trennung von innen und außen sichert die Operationsfähigkeit des Subjektes, ins Objekt fließen dennoch emotionale Momente ein, die Brown auf Vorläuferstadien der Objektbildung zurückführt. „The intensity of feeling for memory, dream, the savoring of the past, the concept of memory as incomplete perception, all conform to the idea that as the memorial be6 Jason W. Brown: Neurosychological Foundations of Conscious Experience, 2010, S. 15 71 comes the perceptual, the affect that accompanies the image distributes as value into objects.“ Was in der Psychoanalyse Projektion bedeutet, ist in der Mikrogenese prozessbedingt. Die Vorstadien der Objektbildung durchlaufen Gefühlswahrnehmungen, die unbewusst ins Objekt einfließen und es färben. Das Musikinstrument bietet offenbar die Möglichkeit, diese Färbung zur Grundlage musikalischer Prozesse zu machen. „Feeling is felt as a pressure behind or directed to the object, not in it. In states of love and fear, emotion concentrates in one object that fill attention rather than being distributed evenly over the field. The process that leads outward from categories to objects accompagnies a specification of drive to desire, to affect ideas, feelings of interest and then outward in the externalization of the object, as value or worth. The qualitative change over successive phases is continuous from activation to determination. Feeling is the vitality and becoming of the object and the mark of its realness.“7 Fühlen ist ein tiefer liegendes Phänomen als Emotion und gewinnt bei Brown den Charakter einer ontologischen Kategorie. Die in den Objektklängen verborgenen Obertonreihen treten als organisierbares Material ins Bewusstsein, sodass es von nun an möglich ist, damit verschiedene Ebenen des Fühlens ansprechen zu können. Dabei sind die polyphonen Klänge den Dingklängen näher als die Skalenintervalle, die aus den Obertonreihen stammen. In beiden Fällen entstehen durch Bildungen von Tonbeziehungen (horizontaler und/oder vertikaler Art) Ausdrucksvaleurs. Die Vertikale ist vom Grad der Verschmelzung der Intervalltöne bestimmt – die Reibung nimmt mit fortschreitender Obertonreihe, ausgehend von Okatve, Quinte, Quarte zu, und färbt jedes Intervall auf eigene Weise, wobei die Mischung sehr komplex werden kann, je nach Verdichtung der polyphonischen Struktur. Der spezifische Ausdruck eines Intervalls wird von dem eines anderen überlagert und es entsteht ein neuer Ausdruck, der nicht als zusammengesetzter wahrgenommen werden kann. Die Vertikale nimmt in der Tonleiter eine andere Form an. Die Stufung kann als Abweichung der Vertikale, also als Schräge gesehen werden, 7 Brown, Experience, S. 15 72 die als Mischung aus Vertikale (Raum) und Horizontale (Zeit) entsteht. Die Spannung der Vertikale als Negation der Schwere geht in die Stufung ein und schafft damit eine auffällige Ordnung der Quantelung eines Kontinuums – musikalisch des Glissando. Die Stufung bringt die Obertöne in eine Ordnung, die in enger Relation zum Kontinuum des Glissandos steht und als Errichtung vom Maßstäben verstanden werden kann.8 Im Compendium musicae bezeichnet Descartes die Tonhöhe mit intensio, dem das griechische epitasis entspricht – „Anspannung, Ausdehnung“. Dem Ton werden damit zwei Qualitäten zugesprochen und die für hohe Töne typische Empfindung des Dünnen und Spitzen mit einer geometrischen Kategorie verbunden, die wiederum für eine physikalische Größe der Spannung steht. Anschaulich zeigt Descartes die Teilung einer Linie in Proportionen, die den ersten Intervallen der Obertonreihe entsprechen, wie die Tonhöhen in Analogie zum Monochord in Strecken ausgedrückt werden können. Die Teilung der Linie erfolgt auf eine Weise, in der der tiefere Ton den höheren in sich enthält, wie es bei der Obertonreihe der Fall ist, wenn mit abnehmender Stärke (Spannung) aus dem ersten der achte, aus dem achten der fünfte und aus dem fünften Ton der vierte hervorgeht usw. „A high pitch requires a stronger breath in singing and a stroke or plucking of strings than a low pitch; this can be tested on strings; the more they are tightend, the higher is their pitch. It can also be proved by the fact that a greater force will divide the air into smaller parts.“9 Dass die Spannung einer Saite mit einer bestimmten Tonhöhe verbunden ist, bedeutet eine wechselseitige Metaphorik der Begriffe. Ein hoher Ton steht für eine hohe Spannung. Jedoch gilt ebenso, dass die Spannung geometrisch durch die Länge einer Linie (Strecke) ausgedrückt werden kann. Die Spannung wird dargestellt durch negati8 Das mit Knoten versehene Seil der ägyptischen Landvermesser ist ein mit Markern versehenes Kontinuum, und auf gleiche Weise dient die Skala der Vermessung des Glissandos – beide Phänomene sind Zeugnisse der Orientierungsleistung. Die musikalischen Dimensionen (Parameter) sind ebenso Kontinua wie die geometrischen. 9 René Descartes: Compendium of Music (Compendium musicae), 1961, S 37. Übersetzt von Walter Robert. Die Teilung der Luft erinnert an die antike Vorstellung von der Schlagzahl der Tonhöhe. 73 ve Faktoren, „also vorzustellen gewissermaßen als eine Einsparung von Saitenlänge...“10 Tonhöhe, Spannung, Strecke fallen unter eine Kategorie, d.h. einen generellen Erlebniskomplex. Auf ihn verweisen ebenso die Seilspanner,11 ein Begriff, den die Ägypter für den Beruf des Erstellens eines rechtwinkligen Dreiecks aus einem Knotenstrick verwendeten, dessen Seiten in einfachem proportionalen Verhältnis stehen. Dass dieses Spannen etymologisch mit „Halten“ verwandt ist (tenere, teino), deutet zudem auf die Kategorie des Festen und Stabilen hin, das dem linearen Verlauf einer bestimmten Tonhöhe zugesprochen werden muss. Da beim Singen etwa die Produktion einer Tonhöhe über ein Steuerungssystem erfolgt, ist die Stabilität aktiv erzeugt und der Ton kein Sein an sich. Die Steuerung stellt rekursiv ständig ein Gleichgewicht her. Die Fixierung einer Saite löst das Problem mechanisch, das Spiel auf der Saite unterliegt wiederum der Steuerung. Es dürfte eine Ableitung dieser Leistung von der Erhaltung des Gleichgewichtes des Körpers unter Einwirkung von Störungen der Umwelt vorliegen, die ständig ausgeglichen werden müssen. Diesem Gleichgewicht dienen mentale Systeme der Selbststeuerung, die mit emotionalen Erfahrungen korreliert sind. So scheint jenes Halten eine Metapher für die Stabilität eines inneren Systems zu sein, das in Aufzeichnungen externer Medien verstetigt wird. Von Tutmosis III (-1500) wird berichtet, er habe das Seil in Richtung des Sonnengottes Amon am Horizont gespannt, womit der Sonnenaufgang gemeint sein wird. Die als Seil dargestellte Beziehung ist auf die Funktion der Himmelskörper für die Astrologie übertragbar, auf eine Subjekt-Objekt-Bindung, die sowohl die räumliche als auch die zeitliche Ferne umfasst und mit Erinnerung korreliert ist. Denn das der Entfernungsmessung dienende Seil ist gedreht oder gesponnen, d.h. es zeigt Spuren der Bewegung. Der mantischen Funktion liegt die Abbildung 10 Johannes Lohmann: Descartes’ „Compendium musicae“ und die Entstehung des neuzeitlichen Bewusstseins; in: Archiv für Musikwissenschaft, 1979, S. 92, Anm. 11 Das Wort Harpedonapten enthält die Silbe dwn (koptisch TWOYN) „ausstrecken, spannen (Bogen, Messstrick), sich erheben, aufstehen, sich erstrecken“ usw. Siehe Erman, Grapow V, S. 431. 74 der Bewegung in der Strecke zugrunde. Das Seil vereint somit die in der „Linie“ verdinglichte Bewegung. Die Bewegung ist als Handlung mit Bedeutung versehen. In der Linie ist die Bedeutung eine Leerstelle, die unterschiedlich besetzt werden kann und zum Zeichen als Zeiger dient. „Wenige Spuren dieser Seilspanner finden sich noch erhalten in der Terminologie der Geometrie. Unser heutiges deutsches Wort kommt vom lateinischen linea dieses von linum = ’Leinen, Flachsseil’. Allein schon im Sumerischen haben wir das Wort, das aber usprünglich ’Seil’ bedeutet.“12 Cantor macht keinen wesentlichen Unterschied zwischen Seilspannern und Seilknüpfern. Gandz verweist auf die Knotenzeichen als Schriftersatz in frühen Kulturen. „Es gab eine Art Knotenschrift, durch die man Zahlen, Rechnungen, geschichtliche Ereignisse, Traditionen, Gesetze und sogar Gedichte und Namenslisten zur Darstellung brachte, oder im Gedächtnisse behielt. Zur besonderen Entwicklung gelangte diese Knotenschrift unter den Incas in Peru in der Form des Quipu... Das Quipu bestand aus einem horizontal gehaltenen Hauptstricke, an dem mehrere andere Seile befestigt waren, die senkrecht herab hingen. Diese vertikalen Seile waren von verschiedener Farbe und Länge, und mit Knoten von verschiedener Größe und Form versehen. Alle diese Seile hatten nun die Aufgabe, bestimmte Zahlen, Worte, Sätze und Ideen zur Darstellung zu bringen.“13 Verfolgt man die Seilspannung bis zur Herstellung des Seils, so betrifft sie nicht nur die mit dem Seil verbundene Geometrie und den kultischen Beruf des Seilspanners, Landvermessers und Baumeisters, der die Maße für den Tempel errechnet, sondern offenbar ebenso die Hersteller der Seile, Schnüre und Fäden. Mit ihnen verlässt man die Linie und tritt dem Kreis gegenüber, der Form der Rotation. Die Spindeln sind das Werkzeug der Herstellung des gefügten Fadens. Das ägyptische ptr „Schnur“ ist ein Lehnwort aus dem Hebräischen, ptl „flechten, drehen“; ptr „deuten, auslegen“; „Seil, Strick“ Snw, und nw.t „Garn, Faden.14 12 Solomon Gandz: Die Harpedonapten oder Seilspanner und Seilknüpfer; in: Quellen und Studien zur Geschichte der Geometrie und Mathematik, 1, 3, 1930, S. 272 13 Gandz, Seilspanner, S. 276 14 Schnur im Idg. *sne- „spinnen“, ai. snāva „Band, Sehne“, ae. snēr „Harfensaite“. 75 Bei den erwähnten Peruanern sind die Quipucamayu zugleich Hüter und der Deuter des Schnüre. Aus der Drehung entsteht die Strecke als Form des Übergangs von einem Punkt zum anderen, unterschiedliche Drehungen, wie sie in Platons Spindel der Notwendigkeit ablaufen. Der Knoten selbst markiert das Seil mit seiner spezifischen Form und kennzeichnet die Fügung, ägyptisch Ts „knoten, verknüpfen“. Gleichzeitig handelt es sich um Begrenzungen innerhalb eines Kontinums, wie es bei den Intervallen und den Stufen innerhalb der Oktave der Fall ist. Definiert sich der Ton als Endpunkt eines Intervalls, wie der Punkt die Strecke teilt und begrenzt, so steht der Ton in Relation zu den anderen Punkten der Teilung der Oktave. Er ist Teil einer Gestalt und nicht isoliert zu betrachten. Der Umstand tritt auch in seiner Obertonreihe zutage, in der der Grundton am stärksten hervortritt und die Töne der Skala in sich enthält. So hat der Knoten Grenzcharakter und teilt die Seiten der Ausdehnung (Strecke, Fläche, Raum) ebenso, wie er sie verbindet, und der Ton hat ebenso Anteil an den Begrenzungen (Tönen) zu seinen beiden Seiten. Ehrenzweigs psychologische Deutung des aufrechten Gangs zugrundegelegt, würde die spezifische, auf das Gleichgewicht abgestimmte Körperspannung nach dem Aufrichten als Ausgangspunkt für sequentielle mentale Leistungen gelten können. Der Gang enthält eine horizontale und vertikale Komponente, beide Komponenten bilden ein Gefüge. Das erzählerische oder prozesshafte Moment des Linearen greift auf emotionale Erfahrungsbestände zurück. So würde die beide Komponenten umfassende Sequenz dem Sich-in-der-Lage-Behaupten entsprechen, wie es Paul Schilder nennt. Der Klammerreflex ist im Gleichgewichtssytem als Entwicklungsursprung enthalten.15 Ist die Spannung Folge der Ausdehnung und der angewandten Kraft, sodass das eine dem anderen zur Metapher werden kann, ist ebenso das Hängen Moment der Kategorie Spannung. Der aufgerichtete Körper hängt an einem imaginären Punkt, an dem der Abwärtszug befestigt ist. Platon hat dies im großen Haken der Spindel der Notwendigkeit symbolisiert. Damit wird ein Zen15 The Relation between clinging and equilibrium; in: International Journal of PsychoAnalysis, 1939, S. 58-63 76 trum der Kraft suggeriert, an dem der Körper hängt, solange er lebt und wacht. Hängen wird zu einer Unterkategorie der Spannung, die auf das Zentrum ausgerichtet ist, von dem aus der Körper seine Gestalt erhält. Eine ähnliche Kategorie bilden die Bänder als Strecken im doppelten Sinne von zurückgelegtem Weg, der Spur und der Spannung, die den Körper durchziehen und im Griechischen mit neuron bezeichnet werden, lat. nervus „Sehne, Muskel, Nerv“, eine Ableitung des Verbs „Spinnen“, Frisk: „Fäden zusammendrehen“ in: νέω „spinnen“. „A more important point is that sucking and clinging and being supported lead to a union and fusion, or, one might say, to a re-union, with the mother’s body, and thus enter directly into the main stream of the libido, as Rotter-Kertész especially has shewn so well.“16 Das Verhältnis von Körperspannung und aufrechtem Gang, das auch abstrakt als Fixierung einer Haltung beschrieben werden kann, hat seine evolutionäre Ursache im Hängen des Jungen am Körper der Mutter, die als stabiler Anker fungiert, an dem das Junge sich mittels Greifreflex anklammert. Das Hängen an der Mutter wird an die stabile aufrechte Haltung vererbt, die um die virtuelle senkrechte Linie der Strecksteife pendelt, indem jede Abweichung von dieser Linie korrigiert werden muss, um die Haltung zu sichern. „Beim Stehen ist das Bein mit einem Stützpfeiler zu vergleichen. Wodurch kommt diese, bei einer zusätzlichen Belastung noch zunehmende Versteifung des Beines zustande?... Hierzu ist die sog. Versteifungsinnervation in Streckstellung erforderlich, bei der sämtliche um das Gelenk gelagerten Muskeln angespannt sind.“17 Man geht davon aus, dass das Stehen zum Beispiel nicht allein durch aktive Muskelbetätigung zustande kommen kann, die schneller zu Ermüdungen führen würde, sondern durch eine versteifte Streckstellung. Die Funktion von Streckreflexen, die vor allem an Tieren untersucht wurden, lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre Bedeutung für den aufrechten Gang. „Sherrington (1907) observed, in 1896, after a transsection through the midbrain 16 17 Schilder, Clinging, S. 60 Frederik J.J. Buytendijk: Allgemeine Theorie der Menschlichen Haltung und Bewegung als Verbindung und Gegenüberstellung von physiologischer und psychologischer Betrachtungsweise, 1956, S. 90 77 between the anterior and the posterior corpora quadrigemina, an increased tonus of the extensor muscle of the neck, the back, the tail, and the legs. All the muscles that secured the erect position of the animal were overinnervated. It is the function of standing that appears in such a way. Richter and Bartmeier (1926) have shown that in the sloth, an animal in which the normal attitude is that of hanging from trees with flexed limbs, decerebrate rigidity is a flexor rigidity. Muscular tension in connection with decerebrate rigidity is a special one. Sherrington discovered the shortening and lengthening reaction of muscle. The muscle adapts itself to any length given to it without change in tension.“18 Der aufrechte Gang kann so mit einer Entwicklungshemmung in Verbindung gebracht werden, wenn die Strecksteife weitgehend erhalten bleibt, Gehen erlernt werden muss und die Hände und Arme für Spezialisierungen und weitreichende Lernprozesse frei werden. Der Steuerungsprozess des aufrechten Gangs verläuft naturgemäß rekursiv, die stabile Haltung orientiert sich am Lot als ständig angepeiltes, virtuelles Ziel, für das Metaphern gebildet werden, die die Funktion verdinglichen. Naheliegend sind architektonische Elemente wie Säulen als tragende Teile eines Baukörpers, wobei das Tragen eine Gegen„Bewegung“ zur Schwerkraft ist, beim Stehen von der Versteifungsinnervation des Muskels in Streckstellung ausgeführt.19 Die Spannung wird einmal als Gegenbewegung zur Schwere erlebt, die in der Höhe abgebildet ist, und einmal als Ausdehnung in der Fläche, wobei die Spannung in der Fläche eher eine Abbildung der Spannung der vertikalen Strecke bedeutet. Die Weite oder Ausdehnung in der Ebene enthält nicht mehr die Spannung der Höhe, deren Abbildung sie ist, ein Verhältnis, das 18 19 Paul Schilder: On Psychosis, 1976, S. 77 Atlas, der die Säulen des Himmels trägt, ist laut Frisk von ταλάσσαι „ertragen, dulden“ abgeleitet („Zusammenbildung von α copulativum und dem in τλῆ-ναι vorliegenden Stamm τλᾶ-....“). Die Gegenbewegung tritt im lateinischen tollo „in die Höhe heben“ (Menge: altlat. tulo, Wurzel tela, tla „tragen, aufheben, wägen“) deutlicher in Erscheinung. Lat. latus (1) „breit, ausgedehnt“ leitet Frisk aus *tla-tos ab, Menge (Griech. Wörterbuch) *stlatos, Wz. stla „ausbreiten“ = Wz. stra in sterno: latus (2) „Seite, Flanke“. Sterno bedeutet eigentlich „hinstreuen, hinstrecken, ausbreiten“, die Beziehung zu Stern, ἄστρον, ist nach Frisk hypothetisch. 78 der Gnomon abbildet, wobei der Schatten die Variable ist. Die Spannung der Strecke deutet auf eine Bewegung hin, die in der Strecke vollendet ist, jedoch in der Strecke als Spur und zurückgelegter Weg noch erhalten, worauf τέλος „Ende, Grenze, Ziel, Vollendung und Erfüllung“ hinweist. Dem Begriff der Spannung liegt eine Vorstellung zugrunde, die von einer dynamischen Wirkung auf eine „Substanz“ ausgeht, die bis zu einem Höhepunkt anwächst und in die Ursprungsstellung der Spannungslosigkeit zurückkehrt. Der Höhepunkt ist zugleich Wendepunkt der Kraft oder Anspannung. Es liegt nahe, diese Bewegung auch kreisförmig zu denken, weil der Anfangspunkt vom Endpunkt nicht unterschieden ist. Der bewusste Umgang mit festen Tonhöhen unterscheidet die Musik von den übrigen akustischen Ereignissen. Man ist versucht, die visuelle Schärfezone, die es erlaubt, Teilaspekte von Objekten anzuvisieren, mit der Fokussierung auf Teilaspekte eines akustischen Phänomens zu vergleichen. Um das Bild eines Objektes zu zeichnen oder zu beschreiben, muss es zuvor so analysiert werden können, dass seine wesentlichen Züge beim Bildaufbau berücksichtigt werden. Die Unterscheidung eines Objektes von seiner Umgebung dürfte einer der wichtigsten Züge sein, weil die Identität des Objektes von dieser Unterscheidung abhängt, in der die Umgebung des Objektes nachrangig bewertet wird. Dieser Teil der Analyse ist primär und lässt sich kaum weiter reduzieren, ohne den Dingcharakter zu schwächen. Fokussierung, Abgrenzung sowie Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung bilden einen einheitlichen Akt. Eine ähnliche Leistung ist von der akustischen Wahrnehmung zu erwarten, die den Laut fokussiert, ihn von der Umgebung trennt und die Umgebungsgeräusche unterdrückt. Die dem Umriss entsprechende Lautgestalt muss ein Formniveau haben, das erste akustische Unterscheidungen erlaubt, zum Beispiel zwischen Klängen und Geräuschen, periodischen und unperiodischen Schwingungen. In Analogie zum biologischen Eliminierungsprozess treten im mikrogenetischen Akt Auswahlmechanismen auf, die in der psychoanalytischen Sicht Anton Ehrenzweigs „repressions“ genannt werden, ein Ausdruck, der auf ein Spannungsgefüge seelischer Prozesse hinweist, weil die im Auswahlprozess einmal verworfenen Möglichkeiten dennoch weiterhin wirksam, dem 79 Bewusstsein jedoch nicht zugänglich sind, weil dies der Ort ist, an dem der Prozess mit einer klaren Objektwahrnehmung oder -Vorstellung endet. Diese Wirksamkeit deckt sich mit Browns Endgestalten, unter deren wahrnehmbarer Außenseite Prozessmomente verborgen enthalten sind und die Wahrnehmung mitbestimmen. Da es nicht nur einlaufende Sinnesdaten sind, die das Objekt modellieren, sondern diese „nur“ als Korrektiv des inneren Prozesses gelten können, ist das Objekt so gebildet, dass es dem Erkennen der Umwelt und der Interaktion mit ihr verlässlich dient. Seine Stabilität verdankt es der Unterdrückung von Momenten, die in dieser Subjekt-Objekt-Relation stören. „It is usually said that overtones ’produce’ the different tone colours of things by their ’fusion’. This discription is not quite exact. The repressed overtones do not produce tone colours by fusion any more than the artificial tone colours of music are produced by the ’fusion’ of the repressed glissando, vibrato, inarticulate rhythmical steps, etc. Rather, acoustic thing perception substitutes the conscious experience of tone colour for the repressed overtones, much in the same way as visual thing perception replaces the thing-free distortions of perspective, etc. by the constant appearance of real things. All these cases contain processes of ’repression’.“20 Eine der ersten auditiven Unterscheidungen dürfte die Isolierung eines Klangs sein, der mit der Umrissgestalt eines Objektes vergleichbar ist, das sich vom Hintergrund unterscheidet. Die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen Laut erzeugt für den Rest der Wahrnehmung einen Hintergrund, dessen Unschärfe dem Dingklang eine plastische Form gibt, eine Lokalisierung im Raum, der die Umgebung des Dingklangs bildet.21 In der Beschränkung des kleinen Kindes auf Konturen des musikalischen Verlaufs scheint sich die pränatale Fähigkeit fortzusetzen, akustisches Material gestalthaft wahrzunehmen und die Gestalt 20 21 Ehrenzweig, S. 153 Ehrenzweig (Hearing S. 209 f.) zitiert die Versuche des Ophtalmologen William H. Bates, der eine Korrelation von Fokus und Peripherie entdeckt hat. „Bates acknowledges the existence of psychological forces opposed to the normal functioning of the central field of vision, such as a tendency to have a more diffuse vision or to dislocate our precise vision away from the focus towards a point in the periphery.“ 80 als ganze wiederzuerkennen. Sie zerlegen und Intervalle, Auf- oder Abwärtsbewegungen unterscheiden zu können, ist Vierjährigen noch nicht möglich.22 Mit der Differenzierung des allgemeinen Höreindrucks in Tonbeziehungen wird die Gleichbehandlung von Dingklang und musikalischem Motiv verlassen, und die systemischen Tonrelationen müssen so isoliert wahrnehmbar sein wie der Dingklang, der sich dem Umgebungsgeräusch gegenüber absetzt. Die Fokussierung auf Tonhöhe und Tonschritte ist eine Repressionsleistung, die auf einem Bewusstsein beruht, bei dem sich eine Differenzierungsleistung entwickelt hat. Mikrogenetisch müsste auf eine ähnliche Technik der Diskriminierung zurückgegriffen werden können, wie sie im Prozessverlauf Anwendung findet, um zu einer scharfen Objektvorstellung und -wahrnehmung zu kommen. Der Schärfe des fokussierten Objekts entspricht ein kohärentes, sich von Innen- und Außenwahrnehmungen unterscheidendes, sich ihnen gegenüber behauptendes Selbst. Das Auftreten einer Sieben- oder Fünftonskala und der Umgang mit Intervallen deutet auf eine schärfere Beobachtung des akustischen Materials hin. Aus dem Klangbild der Objekte treten Tonhöhen in den Vordergrund; Objekte werden bewusst gesucht oder zugerichtet, um einzelne Töne erzeugen zu können, die stabil bleiben und im umgebenden Klangbild in den Vordergrund rücken. Die dafür notwendige Aufmerksamkeit erfordert ein entsprechend geschärftes Bewusstsein, das zu weiteren Fokussierungsleistungen fähig ist. Das parallele Auftreten geometrischer Formkonstrukte lässt auf eine neue Fähigkeit schließen, „Objekte“ zu zerlegen, ohne die Konsistenz des Selbst, das ebenfalls zur Objektivität – wenn auch des Subjekts – gezählt werden muss, zu gefährden. Die Analyseleistung scheint indessen auf frühe Entwicklungsstadien zurückzugreifen. Der Weg des visuellen Objektes zu einer externen Wahrnehmung beginnt mit einer zweidimensionalen Kartierung im oberen Hirnstamm.23 Die Einfachheit der Kartierung ist dem Zeichnen als Abbildung des Raumes auf zwei Dimensionen analog, zumal die Vorstellung 22 23 De la Motte-Haber: Handbuch der Musikpsychologie, 1985, S. 379 Jason W. Brown: The Life of The Mind, 1988, S. 173 ff. 81 als unvollendetes Objekt bezeichnet werden kann und auf dieses hin ausgerichtet ist. Ohne diese Ausrichtung wäre es kaum möglich, eine Zeichnung als Abbildung eines Objektes zu erkennen. Die Zeichnung enthält weit vor der externalisierten Objektvorstellung nur allgemeine Grundzüge, denn „an object resolves not through a process of construction but a suppression af alternative routes.“24 Die dem Bewusstsein kaum zugängliche Wahrnehmung von Obertönen ist die Quelle für das musikalische Material der Skalen und Intervallstrukturen. In der Kunst gelingt es, Zugang zum unterdrückten Material zu finden und ein kohärentes System zu bilden. Ehrenzweig nennt den Zugang „thing-free depth perception“, über die der Künstler verfügt, der „cuts up the coherent thing shapes into segments and recombined them into abstract patterns, like superimposed masses of light and shade, etc. Similarly, the musician’s ’thing-free’ depth perception would tear the single overtones from their context within the overtone chord representing the acoustic thing and rejoin them into thing-free combinations.“25 Die psychoanalytische Theorie verlegt die Zeit der mentalen Entwicklung in Schichten, deren tiefere Lagen virulent sind und unter speziellen Bedingungen berührt werden können. „In the realm of harmonic music... Arnold Schönberg, with his usual depth-psychological intuition, has corrected the current approach of harmonic theory which considers only the articulate consciously heard chords. Just as in a melody the inarticulate glissando- and vibrato-like inflexions are sandwiched between the articulate tone sets (we shall call them ’transitive’ for this reason), so are there ’transitive’ chords sandwiched between the articulate consonances and dissonances of the classical harmonic system.“26 Die Erkenntnis stimmt zu Heinz Werners Charakterisierung des Tons, dass aus einer sehr komplexen und verschwommenen Tonbeschaffenheit sich die spezifischen und eindeutigen Tonmerkmale entfalteten. Ursprünglich habe jeder Ton eine sehr komplexe Klangfarbe, bei der die eigentliche Tonqualität, also 24 Brown, Mind S. 195 Ehrenzweig, S. 158 26 Ehrenzweig, S. 5 25 82 das, was etwa das tiefe und das hohe a gemeinsam haben, noch nicht hervortritt. 27 Die unbewusste Welt der Obertöne enthält keine Unterschiede von Tonfarben, die erst bei der Objektwahrnehmung zustande kommt, bei der der Differenzierungsprozess abgeschlossen ist. Die Fokussierung auf Skalen bedeutet zudem, dass die einzelnen Töne über eine teilweise identische oder ähnliche Mischung von Obertönen verfügen. „Our scale and harmonic system brings about precisely such conditions of overtone ’ambiguitiy’ by combining sounds possessing the same or similar overtones.“28 Die variable „Höhe“ der Tonempfindung bildet die Voraussetzung für Unterscheidungen zwischen den Klangeinheiten, wobei die Unterscheidung der Ecktöne der Intervalle je nach Verschmelzungsgrad variiert. Prozesstheoretisch liegt der Zugang zum Reich der Obertöne dort, wo der Weg nicht zum klingenden Objekt geführt hat, sondern Teilaspekte der Objektbildung bewusst zugänglich werden. Die Differenzierung der Wahrnehmungseinheit des Gegenstandes betrifft den Klang ebenso wie andere Objekte, deren Farben, Helligkeiten usf. Eine gesonderte Wahrnehmung dieser Qualitäten als Vorstellungen setzt die Schwächung der Dingkonstanz voraus, die Objekteinheit löst sich auf und frühere Prozessstadien werden der Wahrnehmung zugänglich. 27 28 Heinz Werner: Über Mikromelodik und Mikroharmonik, S. 79 Ehrenzweig, S. 157 83 7 Fequenzen als Informationsträger Ernst Terhardt vertritt die These, dass Frequenzen am besten dazu taugen, Umweltgeräusche und -laute zu übertragen und über den Zustand der Objekte zu informieren. So ist in der evolutionären Entwicklung der auditiven Wahrnehmung die Frequenzanalyse entstanden, die in der Cochlea des Innenohrs beginnt und kortikal weiterverarbeitet wird. Hören beruht auf einem zeitlich organisierten Mustererkennungsprozess. Eine Kette von Klangereignissen fügen sich zu einer Gestalt. Mit dem Gestaltbegriff verbindet sich die Vorstellung, dass das Teilereignis nur eine Perspektive des gesamten Ereignisses darstellt, das in der Musik quasi entrollt wird. Die Grundlage für die in der Musik so typische Fixierung auf Tonhöhen ist historisch sehr früh erfolgt. „While there cannot be any doubt that music indeed is an invention of man which for thousands of years has been – and still is – in continuous development, there are good reasons for doubting that it is entirely artificial and arbitrary. Instead, the picture emerges that music not only obeys the basic and general principles of sensory acquisition of information but that it even provides an archetype of those principles, i.e. exhibiting the most purely.“1 Der bewusste Umgang mit festen Tonhöhen unterscheidet die Musik von den übrigen akustischen Ereignissen. Man ist versucht, die visuelle Schärfezone, die es erlaubt, Teilaspekte von Objekten anzuvisieren, mit der Fokussierung auf Teilaspekte eines akustischen Phänomens zu vergleichen. Um das Bild eines Objektes zu zeichnen oder zu beschreiben, muss es zuvor so analysiert werden können, dass seine wesentlichen Züge beim Bildaufbau berücksichtigt werden. Die Unterscheidung eines Objektes von seiner Umgebung dürfte einer der wichtigsten Züge sein, weil die Identität des Objektes von dieser Unterscheidung abhängt, in der 1 Ernst Terhardt: Music perception and auditory hierarchy; in: Music and mind machine (Hrsg. Reinhard Steinberg), 1995, S. 82 84 die Umgebung des Objektes nachrangig bewertet wird. Dieser Teil der Analyse ist primär und lässt sich kaum weiter reduzieren, ohne den Dingcharakter zu schwächen. Fokussierung, Abgrenzung sowie VordergrundHintergrund-Unterscheidung bilden einen einheitlichen Akt. Eine ähnliche Leistung ist von der akustischen Wahrnehmung zu erwarten, die den Laut fokussiert, ihn von der Umgebung trennt und die Umgebungsgeräusche unterdrückt. Die dem Umriss entsprechende Lautgestalt muss ein Formniveau haben, das erste akustische Unterscheidungen erlaubt, zum Beispiel zwischen Klängen und Geräuschen, periodischen und unperiodischen Schwingungen. Ein frequenzbasiertes Ereignis wird von Umgebungsgeräuschen und Variablen wie Lautstärke und Schwebungen nicht beeinträchtigt, ist also als Übertragungskanal stabil, was insbesondere Informationsübertragungen dient. Die Bevorzugung der Frequenzen basiert auf der Herabsetzung anderer Parameter in der Hierarchie der Wahrnehmung, ein Vorgang, der nicht physikalisch, sondern psychologisch abläuft. So ist davon auszugehen, dass die Bedeutung eines Intervalls oder einer Intervallfolge nicht auf das bewusst wahrgenommene akustische Phänomen beschränkt ist, nicht auf Noten- und Intervallfolge, sondern diese Bedeutung aus phylo- und ontogenetischen Lernprozessen bezieht. Für die Sprache gilt: Die Bedeutung eines Satzes liegt nicht in seiner logischen Struktur, nicht in seiner Form, sondern sie tritt hinzu: „Logic is not the core of the problem of meaning but a creation of subsurface constructs that follow the laws of paralogical or dreamwork mentation... Meaning is not bound to language but penetrates language from outside. The greater part of the meaning has been traversed before the proposition has been selected. In fact, the greater part of the meaning remains unexpressed even after the proposition has been explained.“ 2 Ebenso überlagert die Bedeutung die musikalischen Formelemente vom Motiv bis zur Satzform. Die Bedeutung eines Motivs wird in Isolation eine andere sein als im Kontext anderer Motive oder größerer Formelemente. So lassen sich aus einer Bedeutung neue Bedeutungen schaffen, wobei die Bedeutung des iso2 J.W. Brown, Mind, S. 91 85 lierten Formteils überlagert, aber nicht vollständig eliminiert wird. Da es sich bei der Musik um einen Prozess handelt, gilt diese Überlagerung für jede folgende Gestalt. Während beim mikrogenetischen Prozess die allgemeine Kategorie am Anfang steht und die Differenzierung im fokussierten Objekt-Ereignis endet, steht in der Musik die allgemeine Kategorie am Schluss, denn es werden Gestalten von Gestalten überlagert, die auf eine kategoriale Großform zulaufen, weil die Gestalten unterschwellig in Erinnerung bleiben. Dazu dienen auch Mittel wie Wiederholungen, Ähnlichkeiten, harmonische Beziehungen und vieles mehr, was zur kompositorischen Technik der jeweiligen Epoche gehört. Mit anwachsender Komplexität der im „Arbeitsgedächtnis“ vorgehaltenen Gestalt treibt die Musik auf ein Ende zu, das die Erfüllung eines Anfangs ist. 86 8 Die musikalische Hand Jean Piaget geht in seiner genetischen Erkenntnistheorie davon aus, dass die Raumvorstellungen des Kindes durch den rekursiven Prozess gebildet werden und sensomotorisch erworbene Erfahrungen im Umgang mit Objekten auf die Wahrnehmung der Objekte selbst Einfluss nehmen, das heißt sie verändern und eine neue Erfahrungsrunde in Gang setzen. Daraus folgt, dass jede Wahrnehmung sensomotorische Erinnerungen erzeugt. Der Lernprozess besteht aus der stufenweisen Eroberung eines Erfahrungsraumes, in dem frühe Erfahrungen aktiv bleiben. So ist auch die Tonraumvorstellung von der manuellen Erzeugung von Tönen und ihrer Wahrnehmung als erzeugte Töne nicht unabhängig. Die Handhabung von Objekten ist in der Regel mit Geräuschen und Klängen verbunden, unter denen solche, bei denen Frequenzen überwiegen, eine Sonderstellung einnehmen, weil sie klar identifizierbar und leicht zu reproduzieren sind. Die auditive Orientierung dürfte eine ähnliche Entwicklung durchmachen wie die sensomotorische überhaupt, weshalb auch hier zunächst von einer Reduktion der Möglichkeiten auszugehen ist, Laute und Geräusche wahrzunehmen und auf sie zu reagieren, indem nur solche kategorisiert werden, die sich im Laufe der Entwicklung als wünschenswert erweisen – Stimmen, Objektklänge. Aus einem nicht identifizierbaren Strom von Klängen und Geräuschen werden einige wiedererkannt und tragen eine Bedeutungsmarkierung, die auf den erfahrenen Kontext verweist. So ist Schmatzen mit der Saugerfahrung verbunden und der Laut positiv besetzt. Die Wiederholung von Lauten setzt eine entsprechende Sensomotorik voraus, die sich vermutlich aus reflexhaften Körperlauten heraus erst bildet.1 Das Schmatzen ist ein Beispiel für eine unwillkür1 Levitan (2006) gives the example of regions in left hemisphere shown to be active in the perception of musical structure that are also active in the perception of sign language. If acoustic noise and silent motion activate the same regions, clearly the 87 liche Aktion, die in einem zweiten Schritt wiederholt und nachgeahmt werden kann, später sogar bewusst und in die Zeichensprache eingeht. So scheint die Aktion beim Aufbau von Wahrnehmungsleistungen auch fürs Hören zuständig zu sein, sodass im Wechsel von Aktion und Rezeption ein rekursiv ablaufender Lernprozess stattfindet. So scheint die Fähigkeit, Tonhöhen und Skalen zu erkennen, auch auf allgemeiner motorischer Artikulationsfähigkeit zu beruhen, da die Aktion beim Aufbau von Wahrnehmungsleistungen mit verantwortlich ist. Das erste Verhältnis von Klangerzeugung und Klangwahrnehmung basiert auf dem Vokaltrakt, in dem bereits eine klangliche Differenzierung zwischen Selbst und Nicht-Selbst stattfindet. Diese ersten sensomotorischen Erfahrungen mit der Erzeugung und Wahrnehmung von Lauten sind eingebettet in taktile und haptische Funktionen der Mundhöhle, deren Erfahrungen an die Hände weitergeleitet werden.2 Das Musikinstrument entwickelt sich in der Wahrnehmung von Klangeigenschaften der Objekte, indem bestimmte Eigenschaften wie Tonhöhen nur an bestimmten Objekten realisiert werden können. Der Eindruck solcher Objekte auf die Wahrnehmung provoziert die Schärfung des Hörens für Obertöne und deren Relationen, sowie für Strukturen, die sich in der Handhabung der Instrumente ausbilden. Eine Kategorie von Objekten von einer anderen anhand der Klangmuster zu unterscheiden, setzt eine neuartige Empfänglichkeit für Differenzierungen des Klangs voraus, die einen interaktiven Prozess voraussetzt. Der aktive Laute bildende Mund geht auf die Laute erzeugende Hand über, ein Vorgang, der auf Diskriminierung des akustischen Materials hinausläuft und eine Art Schärfe der Wahrnehmung hervorruft, die dem optischen Fokussieren gleicht, mit dem Details fixiert werden.3 Für den visuellen Bereich galt, dass der Kontrolle durch experiment is tapping into something more general than the stimuli.“ (Brown, Conscious Experience S. 52 2 An der Mimik des Mundes bei schwierigen manuellen Operationen tritt die frühere Funktion unterstützend wieder auf. 3 Die von der Gestik des Dirigenten in Gang gesetzte Sinfonik verkörpert die Distanz zwischen Hand und Instrument, eine Relation, die den Dirigenten zum omnipotent klangphantasierenden Subjekt macht. Auf der anderen Seite befindet sich der Instru- 88 das Auge beim Zeichnen ein Stadium manueller, sensomotorischer Operationen vorgeht, die sich im topologischen „Raum“ vollziehen. Beim Instrumentalspiel ist das Gehör für die nötige Präzision und Schnelligkeit manueller Ausführung allein nicht ausreichend. Wie bei jeder Aktion, die schnell auf ein Ereignis reagieren muss und zunächst reflexartig grobe Handlungsmuster abruft, gilt auch für das Instrumentalspiel, dass eingeübte Muster tiefer verankert werden müssen, wo Reflexbögen für die nötige Geschwindigkeit sensomotorischer Abläufe sorgen. Da Tonhöhen auf dreidimensionalen Objekten ausgewählt werden, ist die manuelle Treffsicherheit an ein Raumgedächtnis gebunden, das – bei Streichern zum Beispiel – mit winzigen Abständen umgehen muss, die in vielen Fällen wegen des Ausführungstempos nicht korrigierbar sind. Auf der Rezeptionsseite fallen Unschärfen nicht ins Gewicht, soweit sie eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, denn die Wahrnehmung unterdrückt sie, weil sie sich im Skalensystem bewegt. Die Differenzierung von Musik und Tanz ist der erste Schritt zu einer Autonomie der Musik, also der Überführung von körperlichen Bewegungsmustern in musikalische Parameter in Zeit und Raum, Rhythmik und Spannung zwischen Tonhöhen. Der Tanz verweist auf eine frühe Phase auditiver Wahrnehmung, zumal er auf einfache Weise das Vestibularsystem zu reizen und mit der Orientierung zu spielen vermag. Die enge Verbindung von Tanz und Musik vor allem in der Frühzeit des Instrumentalspiels zielt auf die Lockerung der Orientierung und damit auf eine intendierte Unsicherheit der Selbstbegrenzung, um nicht zu sagen Entgrenzung.4 Die gezielt eingesetzte Körperbewegung besteht aus Mustern präziser Provokation des Vestibularsystems. Das Intrumentalspiel ist die Mikroform des Tanzes, mentalmusiker mit extremen motorischen Fähigkeiten, die über das Ohr kontrolliert werden. 4 „The vestibular system may make a unique contribution to the concept of self through information regarding self-motion and self-location that it transmits, albeit indirectly, to areas of the brain such as the temporo-parietal junction (TPJ).“ (Smith/Darlington, Personality changes, S. 1) Siehe auch: Silvio Ionta et al.: Multisensory Mechanisms in Temporo-Parietal Cortex Support Self-Location and First-Person-Perspective; in: Neuron 70, 2011, S. 363-374 89 der rhythmischen Berührung des die Schwerkraft verkörpernden Bodens als Gegenspieler. In der Performance agieren die Tänzer in Resonanz, die Selbstbilder sind aufgehoben in einer Choreographie, in der das jeweilige Selbst aufgehen soll. Das musikalische Zusammenspiel geht von ähnlichen Voraussetzungen aus, die Bewegungen der Tänzer finden ihr Gegenstück in den Händen und Fingern des Instrumentalspielers. Gerhard Kubik zitiert einen Gitarristen aus Malawi: „My fingers dance on the strings of the guitar.“5 Die Trommel wird mit Händen und Fingern bearbeitet, ein taktil differenzierter Vorgang mit vielen Möglichkeiten der Musterbildung, die die innere Bewegung auf die Extremitäten übertragen, beim Tanz auf Hände und Füße. Die Bewegungen der Extremitäten beim Tanzen und Trommeln erwachsen aus genetisch frühen Zappelbewegungen der Extremitäten, die eher den Impulsketten entsprechen, die dem objekt- und zielorientierten, praktischen Handlungsablauf vorhergehen und dem subjektiven Elementarpuls zugrundeliegen mögen, den Kubik bei den Afrikanern entdeckte: „The overall presence of a mental background pulsation consisting of equal-spaced pulse units elapsing ad infinitum and often at enormous speed. These so-called elementary pulses... function as a basic orientation screen. They are two or three times faster than the beat or gross pulse, which is the next level of the reference.“6 Die enge Verbindung zum Körper wird noch dadurch unterstrichen, dass „Performance in the interlocking manner implies that a performer refers his/her pattern to an ’inner beat’ that is different from that of his/her partner, and in addition may be different from that of the dancers.“7 Dieser Elementarpuls wird in früher Jugend oder auch später erlernt und bildet einen inneren Orientierungsrahmen und die Fähigkeit des Einzelnen gegen starke Desorientierungen, die von Akzenten und beatfremdem Phrasieren ausgehen, resistent zu sein. Er ist mit einem Gefühl für ein konstantes Tempo der Performance verbunden, wobei laut Kubik nicht klar ist, ob 5 Gerhard Kubik: Theory of African Music, Vol. I, 1994, S. 37 Kubik, African Music, Vol. I, S. 42 7 Kubik, Vol. I, S. 42 6 90 angeborene oder psychologische Faktoren für die Fähigkeit verantwortlich sind, ein Tempo zu halten. In der religiösen Musik der Yuroba kann der Elementarpuls in schnelle Trommelschläge unterteilt werden, jedoch sind diese Unterteilungen nur temporär und haben für den Musiker keine subjektive Orientierungsfunktion. Die Intention geht deutlich in Richtung Integration, der die individuellen Pulse zugrunde liegen, die von den unterschiedlichen Spielern ausgehen. Im Interlocking gegliederter Pulslinien entsteht ein kollektives Ereignis, aus dem sich Gestalten ergeben können, die objektiv nicht durch das Spiel der Musiker gebildet werden, sondern erst im Hörer entstehen. „We often hear in our recordings of African music rhythms and melodies which no musician has played. Certainly they exist and it is the intention of the composer that we hear them.“8 Kubik führt den psychoakustischen Effekt darauf zurück, dass ähnliche oder gleiche Qualitäten zu Gestalten im gestalttheoretischen Sinne zusammengefasst werden, wie man sie von der – hier jedoch auskomponierten – Klangfarbenmelodie Anton von Weberns kennt. „We can describe the ephemeral, oscillating patterns as a gestalt phenomenon. They are real; they exist and they are the result of musical composers’ intentions, but they are subjective... The „gestalts“ thus arising are not played as such by a single performer in his or her instrument or by a single agent (hand, finger, percussion stick, etc.). As a psychological phenomenon, they are connected with structural characteristics of the perceptual apparatus itself... essentially, the perception of inherent patterns is based on the auditory apparatus’ tendency to associate pitches of the same or adjacent frequencies in the tonal system, thus forming subjective perceptual groups.“ 9 Rhythmische Muster lassen sich durch unterschiedliche Tonhöhen der Schlaginstrumente verdichten. Enger am Dingklang sind die unterschiedlichen langen Holzstäbe der Xylophone, den ursprünglichen Klang des hohlen Holzkörpers verbessert die Trommelhaut, die auch metaphorisch mit der Haut und ihrer taktilen Sensorik, der Berührung, 8 9 Kubik, Vol. I, S. 71 Kubik, Vol. II, S. 111 f. 91 verbunden ist. Die Tonhöhen sind aufgrund der Eigenschwingungen der Idiophone unscharf; Terhardt nennt solche Töne „geringharmonisch komplex“, sodass das Tuning solcher Instrumente stark abhängig ist vom kulturellen Kontext und den auditiven Lernprozessen. Kubik berichtet von Tuning-Ergebnissen eines Lamellophons, dessen tonaler Umfang eine Oktave beträgt. Innerhalb der Okave sind sechs unterschiedliche Tonhöhen, die nur als hoch, mittel und tief bezeichnet werden, also kategorial und nicht skaliert. Die Bezeichnungen werden auch für Trommelsets verwendet, wobei „hoch“ auch „klein“ und „tief“ „groß“ heißen kann. Kubik fand heraus, dass der Musiker, mit dem er zusammen Stimmprozesse probierte, objektiv messbare Abweichungen in verschiedenen Stimmungen hervorbrachte. Sie bewegten sich jedoch innerhalb einer klar begrenzten Toleranz, die für ihn intrakulturell akzeptabel war. Die physikalischen Unterschiede werden subjektiv vom Gehör offenbar zugunsten des kulturell etablierten Systems unterdrückt, was an Heinz Werners gestaltpsychologische Untersuchungen zu Intervallen erinnert. Kubik zieht den Vergleich zur visuellen Wahrnehmung und interkulturellen Studien über Farben. Zwischen Grün und Blau findet keine strenge Differenzierung statt, sondern die Unterscheidungen werden als Abweichungen innerhalb einer Farbe wahrgenommen.10 Die Ekstatik, die selbst noch in Griechenland mit Tanz und Musik erreicht werden sollte, intendiert die weitgehende Preisgabe des Selbst zugunsten einer Ordnung, in der dieses Selbst aufgehoben ist. Die kollektiv ausgeführten Techniken deuten darauf hin, dass die Entgrenzung interaktiv geschah und ein oder mehrere Partner sich an der Konfiguration eines Musters beteiligten, in dem sie aufgehen konnten und ihre Identität im doppelten Sinne aufgehoben war. Diese Figur des Rückgriffs auf subjektive Indifferenz liegt im Ursprung musikalischer Strukturen. Die musizierende und tanzende Gruppe baut jene Strukturen auf, die nach außen als Performance wirken und jene Erfahrungen aufrufen, die ontogenetisch zum Bestand aller Gruppenmitglieder gehören. Das mikro10 Es ist jedoch nicht sicher, ob für alle Farbwahrnehmungen in den Sprachen auch passende Begriffe vorhanden sind. 92 genetische Modell erlaubt, frühe Erfahrungen als Gefühlsmomente der aktuell wahrgenommenen, klanglichen Objektivität mit zu berücksichtigen, die – kategorial konstruiert – an jene Erfahrungen anknüpft, und nur metaphorisch oder symbolisch ins Bewusstsein treten. Die Pulse der Trommler deuten auf reflexhafte Bewegungsmuster früherer Entwicklungsstadien hin, die später jedoch kontrolliert werden können. So sind die Kritzelzeichnungen dem Zappeln vergleichbar, später ist die Motorik unter weitgehender Kontrolle, sodass Gestaltumrisse erkennbar sind. Man würde ein stetiges Pulsieren nicht als Muster bezeichnen, obgleich aus ihm heraus Muster gebildet werden können, indem Pulse nach einer Regel ausgelassen werden. Die durch Anschlagen entstehenden Klänge werden als „geringharmonische komplexe Töne bezeichnet, deren Teiltonfrequenzen erheblich vom harmonischen Schema abweichen“.11 Solche Klangsignale entstehen durch freie Schwingungen von Körpern, es sind „Dingklänge“. Die Frequenzen ergeben keine eindeutige Tonhöhe. Die wahrgenommene Tonhöhe entspricht bei einer von Terhardt untersuchten historischen Kirchenglocke Frequenzen von 343 und 171 Hertz, ist also bereits physikalisch ambivalent. Daraus ergeben sich für die Wahrnehmung Folgen, die generell von dargebotenen Unschärfen und Ambivalenzen bekannt sind. Sie provozieren die Phantasie. Das gilt aber nicht minder für Perkussionsinstrumente und ihren monotonen Grundschlag, der ebenfalls subjektiv dazu tendiert, in Einheiten zusammengefasst zu werden. Damit wird eine Stufe der Ontogenese aktiviert, die die physikalische Objektwahrnehmung überlagert und einen Gestaltungsprozess einleitet, der wiederum die Handlung beeinflusst und sie zur Ausführung eines Musters bewegt. Die Tonhöhenambivalenz angeschlagener Objekte präsentiert sich der Wahrnehmung ebenfalls als Trigger, eine deutliche Gestalt zu bilden und sich für ein Frequenzspektrum zu entscheiden, dem eine eindeutige Tonhöhe zu entnehmen ist.12 Der Übergang zur Formbildung ist ein kreativer Akt: „We shall see that any act of creativeness in the human mind involves the temporary (cycli11 12 Terhardt, akustische Kommunikation, S. 219 Siehe auch Platons schwankende Chora, Tim. 52 B. 93 cal) paralysis of the surface functions and a longer or shorter reactivation of more archaic and less differentiated functions. The form processes conceived on this low undifferentiated level are then – wholly or partly – rearticulated (’translated’) into more differentiated structures which the surface mind can grasp. The artist wrestles with his inarticulate inspiring vision in order to mould it into more articulate forms.“13 Die Möglichkeit, auf frühe Stufen zurückzugreifen, rückt eine Kommunikation in den Blick, die Unterschiede aufhebt im doppelten Hegelschen Sinne. Die Unmöglichkeit dieser doppelten Aufhebung, die Unmöglichkeit der Überlagerung von Gegensätzen, gilt für das Bewusstsein, nicht für das Unbewusste. Eine Auslöschung der Gegensätze ist deshalb nicht in Erwägung zu ziehen, die Aktivierung des frühen Stadiums ist partiell und eine temporäre Phase des Selbst. „The relation of self to non-self (object) that is the foundation on which self-consciousness develops is not a bridge to the other but a penetration to a common ground. There is incomplete revival to the conceptual sources of the other in the core with both lover and beloved, self and other, arising in the same plane of primitive mentality.“14 Diese Entdifferenzierung formuliert Brown zwar im Hinblick auf die Liebe, doch warum sollte sie nicht auch für andere Kategorien der Kommunikation gelten. Die Wiederbelebung eines früheren Bewusstseinsstadiums ist insofern mit einer Überlagerung verbunden, als es sich um Kategorien handelt, deren enthaltene Unterkategorien noch nicht ausdifferenziert sind. Der Begriff der Überlagerung (superimposition) kann als Ausdruck für Zustände gelten, die mehrdeutig sind, wobei Ehrenzweig unterscheidet zwischen der Unschärfe der Mehrdeutigkeit und der Verdichtung, die beispielsweise für Schimären gilt, deren Leib unterschiedlichen Spezies angehört. Jene optischen Phänomene, von denen immer nur eine konkrete Gestalt erkannt werden kann, während die andere in den Hintergrund tritt, beide zusammen jedoch eine Figur mit zwei Perspektiven bilden, wären den Überla13 14 Ehrenzweig, Hearing, S. 18 Jason W. Brown: Love and Other Emotions: On the Process of Feeling, 2012, S. 73 94 gerungen zuzurechnen.15 Psychoanalytisch ausgedrückt, handelt es sich um die „Sprache“ des Unbewussten, mikrogenetisch um die Sichtbarkeit einer im Prozess vorläufigen Kategorie. Die Relation von Selbst und Nicht-Selbst wird über ein „Ereignis“ hergestellt, das mehrdeutig ist wie die Kategorie im hierarchischen Differenzierungsprozess. Das Ereignis wird so konstruiert, dass seine Form den Charakter des Mehrdeutigen bewahrt, wie es beim Symbol oft der Fall ist. Als Aktion kann dieses Ereignis – ebenso wie bei der Vorstellung oder dem Bild – auf eine frühe ontogenetische Stufe von Handlungsleistungen zurückgeführt werden. Solche Ereignisse liegen deshalb auf einer Ebene der schwachen Differenziertheit von Selbst und NichtSelbst. Die Aktion bleibt mehrdeutig, muss jedoch für das Bewusstsein eine Gestalt annehmen. Die Gestalt ist ein neuerlicher Formbildungsprozess, den Anton Ehrenzweig Reification nennt. Die soziale Differenzierung wird ebenfalls in einen Zustand versetzt, der einem gleicht, der vor der Ausbildung eines stabilen Selbst bestanden hat. Die evolutionär fortschrittliche Leistung einer Gemeinschaftsbildung gelingt vor diesem Hintergrund durch „soziale Entdifferenzierung“, die paradoxerweise nur auf der Basis sozialer Differenzierung stattfinden kann, das heißt ontogenetisch interpretiert werden müsste. Der reifere Status wird temporär verlassen und ein Modell (Symbol) gebildet, mit dessen Hilfe er jederzeit kontrolliert wieder aufgesucht werden kann. In primitiven Gesellschaften dienen dazu Riten und Feste, die sich immer auf eine zurückliegende Zeit (in illo tempore) beziehen, die dann mit der Gegenwart verschmilzt, d.h. dass sich zwei Ereignisse des mikrogenetischen Prozesses überlagern. Das Modell triggert die Zustandsveränderung, die Kohärenz der Gruppe wird durch Entdifferenzierung angestoßen, wobei der Vorgang gezielt und rituell streng formal vonstatten geht. 15 „Superimposition can often be transformed into so-called ’condensation’. Condensation occur quite freely in dreams side by side with genuine superimposed vision; they are queer-looking mixtures composed of odd parts taken from different objects, such as the apparition of a winged angel composed of bird and human forms.“ (Ehrenzweig, Hearing, S. 53 95 Die überlagerten Zustände können nicht anders als symbolisch dargestellt werden und senden mehrdeutige Botschaften, die im Empfänger Entscheidungen zugunsten einer Ordnung freisetzen. Die Wahlfreiheit der Entscheidung, die zwangsläufig dadurch gegeben ist, dass nur Symbole gezeigt werden, steht für eine Elastizität des Anpassungsprozesses an eine symbolische Ordnung der Kommunikation, deren Begründung in Festen erneuert wird. Das Fest deutet darauf hin, dass die individuelle Stimulation, die wir von späten Kulturen kennen, nicht genügt, sondern ein stimulierender sozialer Kontext vorhanden sein muss, in dem die Modelle ihre Wirkung entfalten. „My analysis of data from Angola, as well as from other areas of Africa, suggest that music by itself (i.e. the performance or perception of music, applied in isolation) cannot generate or release any psychologically altered states or stimulate therapeutical effects... But if a person has experienced, or is taught by group members to expect, a psychological effect from a certain music and/or dance activity, then they can ’use’ music to reach precisely that altered state of mind they are striving to reach.“16 Die Initiation gilt in der Regel als ein solches Fest, das unter anderem der Erneuerung der Kräfte eines ganzen Stammes dient, weil die symbolische Wiedergeburt die Gruppe an ihren Anfang zurückführt. Die andere Seite der Ordnung ist die Wildnis, in die die Initianden ausgestoßen und mit den Symbolen konfrontiert werden, die die Ordnung, in die sie zurückkehren, repräsentieren. Gerhard Kubik beschreibt eine afrikanische Initiation, mukanda, in die Bewegungsmuster, Tanz, Dramen und musikalische Performance integriert sind. Nach dem symbolischen Tod erlebt der Initiand fern der Mutter einen Entwicklungsprozess im Schnelldurchgang. Der Tanz, heißt es, soll die Erinnerung an die Mutter vergessen lassen; er scheint an die Stelle der Bindung treten zu sollen. Die Körperbewegungen sind im Vergleich zu Alltagsaktionen primitiv, weil reduziert auf formale Muster, die Anfangsstadien (Vorgestalten) von Handlungsmodellen repräsentieren. Die formale Einfachheit, die Muster an sich haben, deuten auf eine Rückkehr zu den ersten Differenzie16 Kubik, African Music, S. 363 f. 96 rungsschritten, die nach dem Impuls, „etwas“ tun zu wollen, auftreten. Stimmt die These von der Entdifferenzierung zugunsten von Kommunikation, müssten solche formalen Strukturen eine soziale Komponente haben. Abgesehen von einer rituellen Unterstützung des Zusammenhalts der Gruppe, dienen Aktionsmuster auch Aufgaben, die nur in der Gruppe zu erledigen sind. Kubik fand heraus, dass „some dance pattern are linked structurally with other patterns of body movement, such as those associated with beating bark cloth or winnowing. These links cross boundaries of age and sex groups, in that a dance pattern of the initiates may appear in a structurally similar form in women’s work, and this may be recognized by the people.“17 Der „Kuhunga“ genannte Tanz bedeutet „Worfeln“, das Bewegungsmuster fällt unter die Spielkategorie des „Als ob“. Man könnte den Tanz als Aktion einer Vorstellung verstehen, die Bestandteil des mikrogenetischen Prozesses ist, der aber erst dann vollendet wird, wenn die intendierte Objektivität, die bewegte Worfel, ebenfalls enthalten ist. Das heißt, es fehlt die letzte Differenzierung, die zwischen Tanz und Worfeln entscheidet. Die beiden Bewegungsmuster sind auch nicht vollkommen identisch. Die Bewegungskategorie der Tanzform „Kuhunga“ ist ambivalent, weil sie gleichzeitig etwas meint, das nicht präsent ist. Der Verschränkung von rhythmischen Mustern liegt ein interaktives Moment zugrunde, eigene Bewegungsmuster mit anderen Mustern zu einem neuen Muster zusammenzufügen, das ebenfalls eine Gestalt hat. „Performance in the interlocking manner implies that a performer refers his/her pattern to an ’inner beat’ that is different from that of his/her partner, and in addition may be different from that of his/her partner, and in addition may be different from hat of the dancers. In some instrumental genres musicians combine strokes which represent for each participant the beat itself... In other cultures a musician may strike what for him represents the beat with only one hand, interlocking it with the beat of his partner, while the other hand is free to play superimposed patterns.“18 17 18 Kubik, African Music, Vol. I, S. 353 Xylophon-Style in Nord-Mozambique. Kubik, S. 42 97 Bei aller Präzision der Pulse, die in Interlocking-Manier eine hohe Geschwindigkeit erreichen, scheint die Tonhöhe eher salopp gehandhabt zu werden. Kubik konnte die exakte Stimmung der pentatonischen Skala der Xylophone von drei Dörfer in Süd-Uganda nicht herausfinden. Die verschiedenen Xylophone hatten nur annähernd diesselbe Skala, wenngleich ihr pentatonischer Charakter erkennbar blieb. Die Abweichungen waren erkennbar unsystematisch, sodass man auch nicht von einem pentatonischen System mit funktional unterschiedlichen Intervallgrößen ausgehen kann. Im übrigen scheinen die Musiker „wahre“ Oktaven nicht zu schätzen, obgleich die Oktave in der Instrumentalmusik Süd-Ugandas der einzige intendierte Akkord ist. „All these instruments, as it seems to me, are tuned in approximate octaves only and in fact on purpose.“19 Die Unschärfe der Oktave deutet auf eine Scheu vor der starken Verschmelzung der Ecktöne hin. Steht die punktuelle Pulsstruktur im Vordergrund der Aufmerksamkeit, dann stehen Tonhöhen mehr oder weniger im Dienst der Pulsstruktur, deren Konturschärfe von Verschmelzungen der Ecktöne eher bedroht wird. Als Verschränkung kann auch die Bildung von simultan auftretenden Tönen zweier Sänger gelten, indem der zweite Sänger seine Note findet, indem er die Tonfolge des ersten Sängers auf einem anderen Niveau verdoppelt. Dieses Niveau liegt exakt zwei Stufen höher oder tiefer als das erste. „The second singer finds his note by skipping one note of the scale. This process is comparable to a xylophone player moving his two sticks in parallel over the keyboard, always leaving one note between the two keys which he strikes simultaneously. If the xylophone is tuned to this kind of pentatonic scale similar sounds to those described will result.“20 Das Intervall dient hier der Verschränkung zweier Skalen und der Kombination zweier Stimmen. Der 19 Kubik S. 58. Das für die Oktave verwendete Wort ist von einem Verb mit der Bedeutung „entfalten, sich ausbreiten“ entlehnt, das Nomen kann mit „Maß, Dimension“ übersetzt werden und wird oft von Textilhändlern für die exakte Größe eines Stoffes gebraucht. Auf das Xylophonspiel angewendet, sind die Distanzen der beiden Klöppel gemeint. „The visual aspect of playing parallel octaves must have been what made Baganda project the term into music. 20 Kubik S. 173 98 eigene innere Beat und der des Partners bilden ein einheitliches Muster auf symbolischer Ebene, was vermuten lässt, dass es sich bei der Tonhöhe ähnlich verhält.21 Zwischen der Klanggestalt der eigenen Stimme und anderen Stimmen unterscheiden zu können, ist bereits durch die Schwingungen gegeben, die vom eigenen Kopf ins Hörsystem gelangen. Hinzukommt die Differenzierung fremder Stimmen, unter denen die Stimme der Mutter herausragt, weil sie einmal als Muster aus der Fötuszeit bekannt ist und zum anderen als Stimme des Versorgers Bedeutung hat. Zur Fähigkeit, die Klanggestalt der Stimme identifizieren zu können, gehört auch die Bestimmung der Tonhöhe. Kleinkinder sind bereits in der Lage, von mehreren gleichzeitig sprechenden Stimmen eine bestimmte zu isolieren. Da Frequenzen geeignet sind, Signale zu übertragen, die Klanggestalt außerdem nicht nur in der Dyade eine besondere Rolle als Informationsträger spielt, gleicht die (virtuelle) Tonhöhe, so Terhardt, der Kontur eines Objekts im Sinne einer Elementargestalt. Mikrogenetisch würde das bedeuten, die Tonhöhe befindet sich im frühen Stadium eines Differenzierungsprozesses, ist also nicht Ergebnis, sondern allgemeinere Klang-Kategorie. Das Timbre, das eher dem individuellen Klangbild eines Gegenstandes entspricht, wäre Ergebnis weiterer Differenzierung. Paradox erscheint, dass die wahrnehmbare Einfachheit eines Tones oder einer Kontur, die wir als Ergebnis einer Abstraktion annehmen, den Weg rückwärts zur Phase der größten Allgemeinheit einer Objektgestalt beschreibt. „Den Schlüssel zum Verständnis zahlreicher Wahrnehmungsphänomene – insbesondere solcher, welche auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen – bildet das Prinzip der hierarchischen Informations21 Bei ein und demselben Sprecher variiert die Stimmbandschwingungsfrequenz ungefähr eine Oktave, sie liegt im Mittel bei Männern 120 Hz, Frauen 240 Hz. (Terhardt, S. 198) In der Pubertät sinkt die Tonhöhe ebenfalls um etwa eine Oktave. – Die Herzfrequenzen von Mutter und Fötus verlaufen synchron, vor allem bei eher gleichmäßigem Verlauf bei der Mutter, was eine schwache Wechselwirkung beider Systeme erlaubt. Gebildet werden einfache ganzzahlige Proportionen – etwa 2:1, oder wenn sich die Frequenz bei Belastungen erhöht, 5:3. (Peter van Leeuwen und Jürgen Kurths in: Spektrum der Wissenschaft, Febr. 2010.) 99 verarbeitung. Einen scheinbaren Widerspruch stellt beispielsweise die Tatsache dar, daß man zugleich die Teile und das Ganze einer Gestalt wahrnehmen kann. Teile einer mehr oder weniger komplexen Gestalt sind häufig selbst Gestalten, welche ihrerseits aus Subgestalten aufgebaut sind, und so weiter – bis auf der untersten Stufe der Hierarchie die Auflösung in Primärkonturen erreicht ist. Die Primärkontur ist sozusagen die Elementargestalt. Auch dieses Prinzip gilt in weitgehender Analogie sowohl für die visuelle als auch für die auditive Wahrnehmung.“22 Diese paradoxe Form spiegelt sich in der makrologischen Form mythischer Zeit, die immer bereits abgelaufen ist und jeder Schritt in die Zukunft tiefer in die Vergangenheit führt. Der Sachverhalt deutet auf einen Zugang des Bewusstseins zum mikrogenetischen Prozess über eine metaphorische Konstruktion, in der Anfang und Ende sich berühren, dies aber die Gegenwart ist. In Analogie zum individuellen internen Puls gibt es eine Tonhöhe der Stimmlage, die physiologisch begründet ist und je nach Emotion variiert. Jedes Gespräch birgt ein Intervallgefälle, das in der Musik in Skalen strukturiert wird und somit eine abstrakte interaktive Qualität bekommt. Das Prinzip der Dingkonstanz gilt auch in der Information, die Signale müssen sich innerhalb eines Toleranzbereichs bewegen, stärkere Abweichungen werden unterdrückt. Das gilt für die individuelle Wahrnehmung, aber auch für die Kommunikation, wenn ein System aufgebaut wird, das Individuen für die Interaktion nutzen. Sind die musikalischen Strukturen aus der Interaktion entstanden, müssen für eine Gestaltanalyse mindestens zwei Einheiten berücksichtigt werden, die aufeinander bezogen sind. Die Beziehung könnte die Tonhöhe als frequenzbasierter Informationskanal leisten, der physikalisch die Obertonreihe und mit ihr die Intervallstruktur enthält. Aus der Interaktion geht eine Modellbildung akustischer Phänomene hervor, die rekursiv verläuft, weil unterschiedliche Perspektiven integriert werden müssen. Für die Impulsketten gilt: „The amadinda performer finds his timing in the strokes of his own part. His tone-row assumes a central position within his universe. The 22 Terhardt, S. 27 100 tone-row of is partner ’falls between’, ’interlocks’. For his partner it is the same: he also considers his tone-row as the primary reference line. And for the dancer it is the empunyi. Thus, the members of a performing unit each have a different standpoint relative to the whole.“23 Sich selbst Referenz zu sein, gelingt eigentlich nur in einer Art von Rückkehr der Wahrnehmung des Ganzen zu sich selber, einem Selbst, das selbstbezüglich seinen Part behauptet. Die Unterschiede der Tonhöhe kommen in einem von Kubik geschilderten Fall durch die individuelle, selbst gewählte Stimmlage zustande. Wenn jeder seinen Part in gemeinsamem Singen absolviert, heißt es, jeder soll seine „eigene Stimme“ singen, zum Beispiel mit einer großen Stimme, d.h. einer tiefen, oder einer kleinen, d.h. einer hohen Stimme. „When someone sang lizi lyalindende, I would ask his partner to sing lizi lyakama together with him. On several occasions the result was indeed a ’second voice’ in thirds or fifths (or forths), but other individuals, according to the range of their voices, just sang the tune an octave lower. ’To sing everyone his own voice’ means to Mbwela-speaking peoples that the same tune should be sung at different pitch levels according to the individual range of the voices of men, women, children, though not the random levels. Although it is not explicitly stated in the terminology, the implication is that the resulting voice combinations should be recognized by the people as sounding good.“24 Der gute Klang gründet sich auf ein kollektives Modell intendierter Verschmelzung. Die Energie, die in der Arbeit auf ein Ziel gerichtet verbraucht wird, lebt in der Wirkung des Produktes fort, welche wiederum reflektiert wird. Einmal in die Objektivität entlassen, löst sich das Reflexionsergebnis vom Subjekt, wird Ding, das dem Subjekt wiederum für eine neue Phase der Verinnerlichung und Reflexion zu Gebote steht. Auf diese Bewegung kann der Begriff des „Eigenwertes“ angewandt werden, den Heinz von Foerster auch auf Objekte anwendet. „Ontologisch gesehen können 23 24 Kubik, African Music, Vol. I, S. 277 Kubik, Theory of African Music, 1994, Vol. I, S. 392 101 ,Eigenwerte’ und ,Objekte’ nicht unterschieden werden...“25 Die Wahrnehmung muss nichts produzieren, sodass es bei ihr zu stabilen Objektvorstellungen im Subjekt kommt. „Eigenwerte stellen Gleichgewichtszustände dar.“26 Dass es sich bei den Objektvorstellungen nicht um subjektive Phantasmen handelt, wird durch ein zweites Subjekt, einen Beobachter, in einem Prozess der Bildung eines gemeinsam erzeugten Modells von Objektivität erzeugt, das auf Beschreibungen beruht, nicht auf unmittelbaren Wahrnehmungen durch Sinnesorgane. In der Musik wird die Objektivität durch die Aufführung gebildet, die sich der Elementargestalten des musikalischen Modellbildungsprozesses bedient – Tonhöhenrelationen und Impulsketten. Der Rückgriff auf frühe auditive Prozessstadien erlaubt eine solche Modellbildung, die jedoch ein Phänomen der Interaktion ist, weil sie auf Symbolbildung beruht und auf einer anderen Ebene stattfindet als die „unmittelbare“ Wahrnehmung. Eine individuelle Symbolbildung ist sinnlos. So bedeutet der Zugriff auf Elementargestalten des mikrogenetischen Prozesses ein kollektives Ereignis. Riten und Feste werden von Symbolen bestimmt, die der Phase der Bildung von Elementargestalten wie Schwellen und Grenzen angehören. So tritt hier eine starke Symbolproduktion in Erscheinung. „A symbol, like a word, can very rarely be created by a single willful act of a single individual. To be sure, it may be possible to posit certain kinds of symbolic references, in the style of and by analogy to the assignment of values to symbols in mathematics. This is, however, a process of limited scope. In general, symbols are more like words, in that the association between signifier and signified depends upon a certain history, forming conventional associations that are to a large extent the common property of the members of a given culture or community.“27 Die Abstraktion der frühen Prozessphase wird vom Symbol entscheidend 25 Heinz von Foerster: Gegenstände: greifbare Symbole für (Eigen-)Verhalten; in: Wissen und Gewissen, Frankfurt 1996, S. 109 26 Foerster, S. 107 27 Maria Pachalska: Re-membering: the recovery of artistic vision after right-hemisphere stroke; in: Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process: Essays in Honor of Jason W. Brown; hsgg. von Maria Pachalska, Michel Weber, 2008, S. 282. 102 übertroffen. Die Kontur hat mit dem Objekt grundlegende topologische Eigenschaften gemeinsam, das Symbol hingegen verweist auf das kategoriale quid pro quo, weil es kontextabhängig entstanden ist. Ein Stuhl hat mit einem Tisch nichts Gestalthaftes gemein, sondern den Nutzungszusammenhang mit dem Subjekt als Zentrum. Der durchgängig in der Gruppe erlebte Kontext erlaubt die Kommunizierbarkeit des Symbols. Das Symbol ist somit aufgeladen mit Erlebnismomenten des Verhaltens innerhalb von Kontexten, die gruppenspezifisch sind. Die Tatsache, dass Grenzen und Schwellen symbolträchtig sind, liegt an der grundsätzlichen Ein- und Ausschließungsfunktion sowie der Transformation von Zuständen und Verhaltensweisen. Das Fest kann zum Supersymbol der Gruppe werden, die sich als Kultur gegenüber der wilden Natur etabliert und mit kollektiv geltenden Symbolen ausgestattet hat. Ein solches Symbol ist auch der frequenzbasierte Laut. Die harmonischen Mittel bieten viele Abstufungsmöglichkeiten der Auflösung und Festigung von Grenzen, höherem und geringerem Verschmelzungsgrad bis hin zur harten Abstoßung der Dissonanz. Der Akkord bietet Mischungen, die in dieser Hinsicht Mehrdeutigkeiten erlauben und im harmonischen Wechsel Erlebnisqualitäten annehmen. Das Intervall steht hinsichtlich der Verschmelzung ebenso für eine Symbolik der Ähnlichkeitsstufe wie die Tonika für das Zentrum eines symbolischen Raums, in dem man sich vom Zentrum in unterschiedlicher Entfernung bewegen kann. Die Entfernung als Symbol „nachlassender Einheit“ wird überlagert von Stationen höheren Verschmelzungsgrades, sodass beim Oktavsprung das Zentrum im Prinzip wieder erreicht und die Einheit hergestellt wird. Zieht man jedoch die Obertonreihe in Betracht und verlässt das kunstvoll erzeugte diatonische System, sind Entfernung und Verschmelzungsgrad im umgekehrten Verhältnis gleich – der längste Schritt, die Oktave, liegt am dichtesten am Zentrum, gefolgt von den Harmonischen. Die Vorstellung der Entfernung basiert auf der ontologischen Stellung des Subjektes im Verhältnis zu anderen Subjekten oder Objekten, ist also beobachterabhängig. Der Beobachter konstituiert eine Relation, in der Entfernungen in Symbole übersetzt werden. Ein solches Symbol ist das Intervall mit entsprechenden Empfindungsqualitäten. Es simuliert sozusagen eine 103 ontologische Aufstellung von Relationen zwischen Subjekten, die selbst in der kollektiven Struktur auch als Objekte auftreten. Die tonhöhenbestimmt organisierte Musik symbolisiert eine sozialontologische Struktur sich auf sich und auf andere beziehender Subjekte. Diese Struktur wird in der kollektiv organisierten und aufzuführenden Musik auch sichtbar, bei der Subjekte sich über Instrumente definieren. In der afrikanischen Musik ist Überlagerung von Pulsen so organisiert, dass die subjektiv stimulierten Pulslinien erst aufeinander bezogen ein Ganzes ergeben, dessen Muster auf einer anderen Bedeutungsebene liegt als die ausgeführten Pulse. Hier wird das interaktive Moment, das der musikalischen Gesamtstruktur zugrunde liegt, deutlicher als in der diatonischen Struktur, die mit den Griechen in Erscheinung tritt. „Inherent patterns emerge subjectively as visual or aural images to the onlookers or participants. They are structurally contained, i.e. inherent, in the total configuration, but cannot be traced as such by any objective measuring apparatus. Their fluctuating, oscillating quality, i.e. their ability to change in perception, and – as everyone has experienced with optical illusions – their potential to collapse and reconfigure without any effort of will-power, illustrates the fact that human perception itself constantly adjusts its scanning patterns to process external stimuli.“28 Kubik betont den phänomenologischen Aspekt, der durch die Überlagerungen zustande kommt, wobei der Wahrnehmungsprozess in Parallele zur sozialen Interaktion gesetzt wird, beide auf Bewusstsein basieren, das nicht statisch ist, sondern mikrogenetisch prozessiert wird. Für das Interlocking der Musik findet Kubik eine Parallele in den Punktmustern der Tusona-Tradition ideograpischer Schrift, die in Ergänzung der auditiven Muster als andere Seite einer raumzeitlich orientierten Anschauung gelten kann. Die Kategorie der Entfernung enthält zeitliche wie räumliche Erfahrungen, die an Ereignisse gebunden sind. Die Spanne kann in eine räumliche und eine zeitliche differenziert werden, jedoch nicht so, dass eine Kategorie ohne die andere auskommt. Das Zeitkonzept in ost-angolanischen Kulturen kennt nur einen Begriff 28 Kubik, African Music, Vol. II, S. 319 104 für Zeit und Raum. „Ntunda“ wird für bedeutende Zeit als auch für bedeutenden Raum verwendet, ist hinsichtlich der Bedeutung auf die erlebende Person bezogen. Raum/Zeit sind subjektiv erlebnisorientiert, es sind keine abstrakten Kategorien. Die etymologischen Beschreibungen erwecken den Eindruck eines Zustandes, den Jaak Panksepp „abjunctive behaviour“ nennt, das auf einen Wartezustand verweist, bevor ein Ereignis eintritt. Es handelt sich dann eigentlich um die Erfahrung einer leeren Zeit, die mit scheinbar leer laufenden Aktionen gefüllt wird. „To the European the African may seem to be idling away useful time, whereas the latter, according to his philosophy, is awaiting experiential time, the time that is right for accomplishing his objective.“29 Dieses Zeitgefühl deutet auf seine Bildung unter Erwartungsbedingungen hin. Der emotionale Zustand verschärft den Sinn für Dauer und Spannung zwischen dem Jetzt und dem Eintritt eines Ereignisses. Diese Spannung wird im Jetzt erlebt. Musik und Drama begründen ein solches Zeitgefühl der Erwartung, dass etwas geschehen wird. Dieses Gefälle scheint im Laufe der Geschichte sich verstärkt und eine Dynamik entwickelt zu haben, die von der Unruhe des leer laufenden Wartens abweicht. Die öffentliche Aufführungsform konstelliert das Warten für alle Beteiligten als kollektives Gefühl, das die Grundlage bildet für spezifische symbolische Kommunikationsmuster. Die Abhängigkeit des Symbols von seiner intersubjektiven Genese, in der Subjekte gleichzeitig Objekte sein können, macht es zum Element von Kommunikationsmustern. Die strukturelle Ähnlichkeit im Interlocking von Puls- und ideographischen Punktmustern erweitert Kubik auf textile Webtechniken. „Structural analogies are perceptible by the naked eye when examining patterns of weaving and plaiting with patterns in musical composition. Intracultural confirmation of such parallels does exist – for example, in the musical terminology in Luganda, where some descriptive terms are borrowed from the realm of textile technique.“30 Die Leere füllt sich mit einem Muster, dessen Prinzip die Verschränkung ist. Das Ornament, das sich als lineare Figur im leeren 29 30 Kubik, African Music, Vol. II, S. 277 Kubik, Vol. II, S. 315 105 Raum frei entfalten kann, lässt eine höhere Komplexität zu, bedarf aber auch der Umgrenzung, einen Rahmen, der für Ornamentflächen konstituierend ist.31 Grenze (Umriss) und Verschränkung bilden ein Ganzes. Die Erzeugungsregel des Ornamentes besteht in der iterativen Anwendung einer Ausgangsregel innerhalb abgesteckter Grenzen. Die aus rekursiven Prozessen entstehenden Muster enthalten Teilgestalten, die ohne den Bezug auf das Ganze nicht erscheinen. Auf gleiche Weise enthalten die sich aus einem Interlocking ergebenden Muster zwar gestalthafte Einzelfiguren, die ohne Beziehung zum Ganzen jedoch nicht bestehen. Ihre Selbständigkeit ist scheinbar, doch so gelingt dem Symbol die Repräsentation eines Ganzen, das selbst interne Grenzen (Konturen) enthält, die Teilmomente voneinander unterscheiden. Das griechische Symbolon, die Bruchstelle einer Scherbe, ist die Metapher für den Zusammenhang. Organische Prozesse sind mit handwerklichen vergleichbar, wenn Teilprozesse gehemmt oder ausgesetzt werden (gestapelt), um andere zum Zuge kommen zu lassen. Voraussetzung für manuelle Bearbeitung ist ein Vermögen, Arbeitsprozesse speichern, ruhen und wieder aufnehmen zu können, je nach Fortschritt der Bearbeitung an unterschiedlichen Stellen des dreidimensional erinnerten Objekts. Wenn der mikrogenetische Prozess den evolutionären im Wesentlichen wiederholt, so sollten die unterschiedlichen Aufbaugeschwindigkeiten und verschachtelten Teilprozesse bei der Objektbildung mit bedacht werden. Die Geometrie dominiert von einem bestimmten Punkt an jedoch die Entwicklung eines bewusst intendierten Gegenstandes und steht in Einklang mit der räumlichen Objektvorstellung des Handwerkers. Musikalische Prozesse entfalten sich ebenfalls unter dem Einfluss von Symmetrien und Erzeugungsregeln von Mustern. Das repetitive Moment der Muster füllt jene Raumzeit, die mit der Leere verwandt ist, die entsteht, wenn das Ende des Gestaltungsprozesses noch nicht erreicht ist, partiell Entwicklungen gehemmt oder unterbrochen werden müssen, um andere zum Zuge kommen zu lassen. Die partielle Entwicklungshemmung bezieht sich zwar 31 Ernst H. Gombrich: Ornament und Kunst, Stuttgart 1982, S. 92 106 nur auf lokale Ereignisse, beeinflusst am Ende jedoch den Gesamtzustand. Mit dem Gewicht, das die Symmetrie auf den Prozess ausübt, ist mehr als ein Teilaspekt betroffen. Die vom Ritus bekannten repetitiven Bewegungen bilden nach Jaak Panksepp die entwicklungsgeschichtliche Grundlage für die manuelle Bearbeitung von Werkstoffen zur Herstellung von Werkzeugen. Das aus dem postnatalen Suchverhalten ableitbare Nicken entspricht den ritualisierten Repetitionen, die Panksepp für sein „seeking system“ annimmt, wenn es überstimuliert ist und Verhaltensweisen hervorruft, die zum Handlungsziel nichts beitragen. Sie treten nur deshalb auf, weil die Unterbrechung eines Handlungsablaufs den Akteur in einen motorischen Leerlauf versetzt. Das Warten ist Zeichen dafür, dass mindestens eine Aktion läuft, die vollendet sein muss, damit die unterbrochene Aktion weitergeführt werden kann. Panksepp nennt solche Verhaltensweisen im Wartezustand adjunctive behaviors.32 Sie gleichen der Aktivität des Suchverhaltens, das eine Sättigung verspricht, indem es halluzinierend wiederbelebt wird. In beiden Fällen treten Bewegungen auf, die repetitive Muster erzeugen können, die aus dem Suchverhalten hervorgehen. Panksepps adjunctive behaviour ist aufgrund der repetitiven Verhaltensmuster innerhalb eines Aktionsleerlaufes mit der Hemmung innerhalb eines mikrogenetischen Prozesses vergleichbar, obgleich sich Panksepps Erkenntnis auf Säugetiere generell bezieht. Doch liegt in diesem Verhalten ohnehin Entwicklungspotential, weil Lernvorgänge auf repetitiven Mustern basieren. Die Sinnfreiheit, die dem adjunctive behaviour zugrundeliegt, entsteht, weil ein Prozess des intendierten Ziels für eine Weile aufgehoben ist und statt dessen Bewegungsmuster leerlaufen. Die auf ein Ziel gerichtete Aktion zerfällt in Impulsketten, die auf sie selbst abgebildet werden müssen und Schleifen bilden. Der die Aktion in Gang setzende Impuls hat nur Sinn innerhalb eines Gesamtkonzeptes dieser Aktion. Er steht in Beziehung zu den anderen Impulsen wie ein Ton einer Melodie. Das ziellose Verhalten scheint jedoch trotz Sinnfreiheit der Stabilisie32 Jaak Panksepp, Lucien Biven: Archaeology of Mind, 2012, S. 110 107 rung des Selbst zu gelten. Die Stabilisierung könnte darin bestehen, dass frühe repetitive Formen des Nahrungsaufnahmeverhaltens simuliert werden, um einen körperlichen Mangelzustand symbolisch auszugleichen. Es handelt sich um die Halluzination einer Aktion, die einmal als frühe ontogenetische Stufe erlebt wurde und nun den intendierten Prozess unterbricht. Die Bruchstelle bietet die Möglichkeit, neue Gestaltformen und komplexe Muster auf der Basis von Repetitionen zu bilden, die dem Wohlbefinden dienen. Die Nachbarschaften von Qualitäten, die nach der Gestalttheorie strukturbildend sind, lassen sich mit den Nachbarschaften des topologisch beschreibbaren Raums vergleichen, und vermutlich sind auch Eigenschaften wie Getrenntsein, Reihenfolge und Umschlossensein bzw. Umgebensein gestalttheoretisch zu werten. Die objektive Organisation von Tönen wird vom subjektiven Gehör, die Weiterverarbeitung im Gehirn eingeschlossen, nach Gestaltkategorien erfasst, wie schon Bachs Solosonaten für Violine zeigen, wenn in Akkordfolgen melodische Linien auftreten, oder wenn Anton von Webern das Phänomen für seine Klangfarbenmelodien nutzt. Die musikalische Struktur, die Kubik „inherent“ nennt, entzieht sich einer näheren Bestimmung, weil die Weiterverarbeitung im Gehirn erst ansatzweise deutlich wird und auf Emergenz beruht. Die Interaktion der Subjekte in der Performance geht in einer Struktur auf, in der der Beobachter eliminiert bzw. orientierungslos ist – ein Merkmal topologischer Beschreibungen und unendlicher Schleifen, die aus Rekursionen entstehen, in die interagierende, aufeinander reflektierende Subjekte verwickelt sind. Die Dyade bietet bereits eine solche Konstellation, in der sich die Objektwahrnehmung ausbildet – taktil, visuell, auditiv. Die topologischen Grundbegriffe bieten Beschreibungsmöglichkeiten von Gestalten, weil diese über die damit einhergehenden Beziehungen Bedeutungen erlangen. Ein Ton ist wie ein Punkt, der erst in Beziehung zu einem zweiten Punkt eine Richtung und erste Bedeutung erlangt. Sie kann angereichert werden durch weitere Punkte und ihre Anordnung. Bedeutung existiert nur in erlebten Kontexten. So liegt die erste Bedeutungsschicht des Tons in der Beziehung auf einen weiteren Ton, also im Intervall. Erst aus dieser Bedeutung heraus, gewinnt der 108 Ton seine Qualität, sodass er ohne Kontext eben bedeutungslos ist, das Gehör den Kontext setzt und mit ihm den Ton als höhenbestimmt. Dies entspricht der Sichtweise Terhardts, der den Ton als Kontur bezeichnet, dem „Rand“ oder der „Kante“ als innere Setzung zur Gliederung objektiver Daten. „I have concluded from these notions that in the auditory system pitch plays a role that in many respects is analogous to that of contour in vision... Pitch may indeed be regarded as ’auditory contour’. Just like visual contour, pitch comes in two varieties: primary, and virtual. To appreciate that analogy, one should be prepared to abstract from the fact that the eye’s primary receptor field (the retina) is two-dimensional, while the auditory one (the low-high dimension) is one-dimensional. This merely has the consequence that visual primary contour (a ’line’) is onedimensional, while auditory primary contour, i.e. spectral pitch, is nulldimensional (a ’point’). Just like a visual Gestalt is defined by a set of contours that occur at appropriate places of the visual receptor plane, an auditory Gestalt is defined by a particular combination of spectral pitches that either occur or are missing at definite points of the auditory low-high dimension. “33 Diese Setzung gehorcht der Effektivität der Wahrnehmung im Umgang mit der Umwelt. 33 Ernst Terhardt: Auditory acquisition of information. Website-Text des Autors: http://www.mmk.ei.tum.de/fileadmin/w00bqn/www/Personen/ Terhardt/ter/top/audiinfo.html 109 9 Symbol als Zeichen subjektiver Entdifferenzierung Der erlebte Ton setzt sich als Bestandteil des Intervallsystems aus subjektiven Anteilen der Wahrnehmung und objektiven Anteilen der Kommunikation zusammen, ermöglicht von einem Rückgriff auf frühe Stufen der Objektbeziehung mit einhergehender Entdifferenzierung, d.h. der Vereinfachung der Gestalten bis hin zu abstrakten Mustern als Fundamente komplexer Erscheinungen. Erklärungsbedürftig ist die Möglichkeit des Hervortretens „abstrakter“ Phänomene, die Leistungen eines Bewusstseins sind, Komplexität zu reduzieren, um aus der Vielfalt der Erscheinungen Grundfunktionen herauszulesen. Dies gilt als höhere Bewusstseinsleistung, obgleich zu vermuten ist, das Frühere in der Entwicklung verfüge nicht über den Gestaltenreichtum des Späteren, sei also strukturell einfach und dem Späteren gegenüber verdeckt, d.h. unbewusst. Doch: „What is the status of the unconscious in the absence of consciousness? Since a mental state is not conscious until its antecedents are transformed, the unconscious achieves a retroactive existence on becoming conscious. Access to unconscious cognition in conscious subjects is limited, for it is transformed by sensation to adapt to conditions in the physical world.“1 Bewusstsein ist der Endpunkt eines unbewussten Prozesses, der nur ältere Stadien erscheinen lassen kann, wenn er unter bestimmten Umständen ins Bewusstsein tritt wie beim Traum, der frei ist von Einschränkungen durch Wahrnehmungsdaten. Der Traum wird einem Formbildungsprozess unterworfen, der aus dem zeitlosen Zusammenhang eine Ereignisfolge bildet. „Parenthetically, the account of dream as a narrative that articulates the simultaneous apprehension of the dream content in the temporal order of waking cognition, is similar to 1 Jason W. Brown: Neuropsychological Foundations of Conscious Experience, 2010, S. 57 110 descriptions of the creative process, in which a work is sensed or imaged as a whole prior to being worked out in detail.“2 Jason W. Browns These von Stadien unvollendeter Objektbildung zielt auf freie, unbewusste und der Zeit enthobene Gestaltformen, deren Simultanität als Kategorien (zu vergleichen mit Arietis „primary aggregations“) erfassbar sind, aber auch den Punkt markieren, an dem der Prozess unterbrochen wurde und als Symptom im Bewusstsein erscheint. Prozesstheoretisch greift die Innenperspektive auf unbewusste Vorstadien zurück. Die Kategorien werden erst auf dem Wege zur Endgestalt der Wahrnehmung ausdifferenziert. Der allgemeine Charakter der Kategorien trägt Züge des Symptoms als Marker eines verfrühten Auftretens eines Prozessstadiums im Bewusstsein. So kann Unbewusstes bewusst werden, stellt aber nur eine partielle Phase des Prozesses dar. „Symptoms refer to normal but earlier phases in mental process, when the phase (category of language, perception, etc.) is disrupted. Categories that are normally transformed leave symptoms as markers of the upstream disruption. The whole-part relation, i.e. the context-to-item or categoryto-member transition, actualizes an exemplar that might otherwise serve as a potential for ensuing phases. The theory of a symptom as an exposed category is a theory of mind, not just an argument about neurological patients. The origin of symptoms as signatures of phases in relation to the phase-sequence is also a description of the mind/brain state, thus a description of an act of thought. The various contents that actualize in this transition — feelings, thoughts, words, images — are outcomes of Ucs process that come into Cs relief.“3 Es scheint, als sei das Bewusstsein aufgerufen, die Stelle des unterbrochenen Prozessverlaufes zu besetzen und einen neuen Prozess einzuleiten, der nicht der Objektwahrnehmung dient, sondern der Symbolbildung als schöpferische Funktion des Bewusstseins, die Ehrenzweig „secondary reification“ nennt. Die Hinwendung zum Symptom, die zum Teil erzwungen wird, wenn es mit der Realität in Konflikt gerät, verstärkt 2 3 Brown, Foundations, S. 233 Brown, Foundations, S. 254 111 die Möglichkeit des Eindringens unbewusster Inhalte. „This reinforcement of inarticulate depth perception at the expense of surface perception calls forth a twofold articulation process by which surface perception regains its full energy charge. It infuses the thing-free form elements with a new thing meaning (secondary reification) and the projects an articulate gestalt into the gestalt-free elements of art form (secondary gestalt elaboration)“4 Die Koppelung von Wissenschaft und Kunst beruht auf der grundlegenden Intention, der auf leichte Erfassbarkeit abgestimmten Wahrnehmung der Realität durch die Sinnesorgane durch eine zweite Wahrnehmung zu ergänzen, deren Aufbau bereits in der frühen Kindheit beginnt und historisch gewachsen ist. Sowohl von der Wissenschaft als auch von der Kunst wissen wir, dass diese zweite Erfahrungsschicht kollektiv so weit wie möglich abgesichert sein muss, um dem Selbst in der Objektbildung – erster und zweiter Ordnung sozusagen – die nötige Stabilität zu verleihen. Die Nähe zwischen der Symbolbildung der zweiten, entwicklungspsychologisch fundierten Wahrnehmung und der biologischen Basis zeigt sich in den Vergleichen von Wissenschaft und Kunst mit Wahnsystemen und ihren Symbolen. Die Bildung eines realitätsgerechten Wahrnehmungssystems beruht auf einem regelkonformen Entwicklungs- und Lernprozess von Kommunikationsstrukturen innerhalb der Dyade. Das Objekt wird ausdifferenziert in Ding und Anderer, unbewusst bleibt die Indifferenz bestehen und kann im Rückgriff wiederbelebt werden. Aus dem Dingklang hebt sich der Ton als Symbol heraus, das aus der Interaktion zweier Subjekte hervorgegangen ist, welche wiederum auf die interaktiv generierten Symbolbestände des Kollektivs zurückgreifen. Der Ton ist zwar einzeln wahrnehmbar, doch bedarf es eines unbewussten Hintergrundes weiterer Töne, die in der Folge als tonale Gestalt auftreten. Die allgemeine Symbolhaltigkeit der Intervallstruktur ist die Basis für bestimmte Bedeutungen, wenn die Töne als Folge (zeitlich) oder überlagert (räumlich) verbunden werden und buchstäblich Gestalt annehmen, indem das Bewusstsein eine Differenzierung und Entfaltung eines 4 Ehrenzweig, Vision and Hearing, S. IX 112 Symbolkomplexes vornimmt, d.h. komponiert. Der subjektive Vorgang findet indessen auf einer Matrix statt, die sich einmal entwicklungspsychologisch früh bildet, indem die auditive Wahrnehmung mit Empfinden verknüpft wird, und zum anderen einen historischen Prozess durchläuft, sodass man es immer mit Endgestalten zu tun hat, deren Symbolkraft aus beiden Prozessen resultiert. Die Matrix erscheint im Grunde undifferenziert, weil sie Möglichkeiten für den Formbildungsprozess bereitstellt, der jedoch anders verläuft als unter Bedingungen der Objektbildung. Die Matrix hat ihre Basis im frühen Objektstatus, und das, was symbolisches Objekt werden soll, schöpft aus ihren Bedeutungsmustern. Der Rückgriff auf den frühen Objektstatus ist deshalb wichtig, weil er in der Entdifferenzierung die Kommunikationsmittel erweitert. Technisch zeigt sich dies an den Formen, die dem Komponisten zu Gebote stehen und den Erfahrungsbereich des Bewusstseins überschreiten. Ehrenzweig „takes up the notion of unconscious hearing proposed by Arnold Schönberg..., deconstructing the compositional techniques of mirroring and inversion and revealing them as unconscious and, hence, ’time-free’. ’Surface perception is bound by the articulation in the order in time; it cannot, therefore, while listening to a piece of music, realize how it would sound in the reverse order’... In Ehrenzweigs terms, for the composer to create such music it would be necessary to hear it all at once. As he puts it, the composer needs ’to comprehend... in a single undifferentiated act of perception’.“5 Die innere Wahrnehmung hat halluzinatorischen Charakter. Als Vorstadium zur Objektwahrnehmung schließen sich Halluzination als „starke Vorstellung“ und die Objektwahrnehmung gegenseitig aus, sodass es bei auditiven Halluzinationen auch zum temporären Verlust des Gehörs kommen kann. Halluzinationen gehören einem Stadium an, auf dem die objektbezogenen Phänomene noch nicht nach außen verlegt wurden.6 Umgekehrt können Halluzinationen auf einer frühen Entwicklungsstufe des Kindes Objekte phantasieren, um deren Absenz oder 5 Beth Williamson: Between Art Practice and Psychoanalysis Mid-Twentieth Century: Anton Ehrenzweig in Context, 2015, S. 74 6 Brown, The Self-Embodying Mind, 2002, S. 77 113 sie als defizient erlebt zu ersetzen. Eine Vorstellung wäre eine schwache Halluzination. Für den künstlerischen Bereich bedeutet dies, dass ein als mangelhaft empfundener Objektbereich mit den Mitteln der Imagination ergänzt werden soll. Das gilt für den visuellen wie für den auditiven Bereich gleichermaßen. Die frequenzbasierten Klänge, die Informationen am besten übertragen können (Terhardt), sind aufgrund ihrer Kommunikationssymbolik emotional bevorzugt. Die Tendenz des auditiven Erlebens zur musikalischen Gestalt könnte als halluzinierte Verstärkung von Frequenzrelationen verstanden werden, also von Tonverhältnissen, für die der Obertonbereich das Material liefert – konsonantes wie dissonantes gleichermaßen. Die musikalische Gestalt bezieht ihre Bedeutung aus dem Kontext des Erlebens. So scheint sich das Erleben früher zu bilden als der Akt der Artikulation, und für dieses Erleben werden dann die passenden Symbole ausgewählt. Das allgemeine Fühlen wird in der Symbolisierung objektive, vermittelbare Gestalt. Was Brown für die Formulierung eines Satzes sagt, gilt auch hier: „Meaning is not bound to language but penetrates language from outside. The greater part of the meaning has been traversed before the proposition has been selected. In fact, the greater part of the meaning remains unexpressed even after the proposition has been explained.“7 Der Unterschied zur Wortfolge des Satzes liegt in dessen Nähe zur Objektwahrnehmung, die er vertritt, d.h die Spitze der Hierarchie an Bedeutungen liegt in der bewussten Botschaft, die sich von den unbewussten Ebenen, auf denen sich die Formulierung aufbaut, unterscheidet. Die Erweiterung der Kommunikationsmittel im Rückgriff auf einen frühen Objektstatus führt paradoxerweise zu einem Gefühl des Mangels an Verstehen. Wenn Entdifferenzierung auf die ursprünglichen Schichten von Kommunikationsbildung stößt, entsprechende Strukturen also noch nicht hinreichend entwickelt sind, sind Ausdrucksmomente nur unscharf lesbar, und die Bedeutung ist so mehrdeutig wie eine komplexe Kategorie – schlimmsten Falls chaotisch. Nun kann es sein, dass der Ausdruck in gewissem Maß authentisch jener ist, mit dem das Hören an7 Brown, Self-Embodying Mind, S. 91 114 fänglich konfrontiert wird. Der Bedeutung einer solchen Musik könnte die Kommunikation von Kommunikationsbrüchen zugrunde liegen, eine Krise des Symbols, auf die die Rezeption der Moderne entsprechend reagiert. Da die Symbolbildung eng mit Kommunikationstechniken verbunden ist, betrifft der Funktionsausfall jener auch die Krise der Kommunikation. Der Rückgriff auf frühe Prozessstadien der Wahrnehmung in der symbolischen Modellbildung von Kunst und Wissenschaft führt zu seltsamen Schleifen, die in der Verknüpfung von Individuation und Abstraktion bestehen. James Joyce ist mit Finnegans Wake diesen Weg gegangen, indem er es schaffte, in seinen Sätzen und Worten mehrere Bedeutungsschichten gleichzeitig anzubieten, damit ein Höchstmaß an Individuation (Singularität) erreicht wird. Das Spektrum der Bedeutungsvarianten des Textes vergrößert und verkleinert das individuierte Selbst zugleich, weil die Erweiterung der Deutungsmöglichkeiten das Individuelle weit überschreitet, die Deutungsrealität des Bewusstseins das Individuelle jedoch kommunikativ isoliert. Ein ähnlicher Vorgang findet in psychotischen Zuständen statt, wenn das Ich zum Überindividuellen, zum Gott vergrößert und gleichzeitig die symbolische Interaktion aufgehoben wird. Individualität besteht in ausgewogener Isolation. Besteht das vermehrte Bedürfnis nach Individuation, scheint die Erweiterung des Selbst zum Überindividuellen ein Versuch zu sein, dieses Ziel zu erreichen. Die Individuation trifft möbiusbandartig auf der anderen Seite auf ihr Gegenteil. In der Psychoanalyse ist das Phänomen als Omnipotenzgefühl bekannt, das im Stadium geringerer Differenziertheit der Dyade zu beobachten ist und beim Erwachsenen auf einer Regression beruht. Die Überlagerung der erwachsenen durch die frühe Phase füllt das Ich mit einem Gefühl der göttlichen Allmacht und ozeanischer Grenzenlosigkeit. Die Regression lebt aber mit der Paradoxie, dass die Omnipotenzphase auf einer weitgehenden Verschmelzung von Subjekt und Objekt beruht, der erstrebte Zustand der sozialen Übereinstimmung und der Kommunikationsfähigkeit jedoch nicht erreicht wird, sondern im Gegenteil die Isolation der daraus folgende Zustand ist. Während Heinz von Försters Konstruktion eines gemeinsamen Weltbildes unterschiedlicher Subjekte 115 rekursiv ermittelt wird und Gott den selbstbezüglichen Punkt eines Systems bildet,8 deckt sich die radikale Isolation des Individuums mit der Vorstellung eines Gottes, sodass umgekehrt der Gott die onto-logische Basis der Individuation bildet. In primitiven Gesellschaften verkörpert der „Begeisterte“ den Typus dessen, der außerhalb der Gruppe steht, an ihre Regeln nur bedingt gebunden ist und die Symbole ebenso verwahrt wie die Riten zelebriert, die das System repräsentieren. Die Individuation beginnt mit der weitgehenden Isolation des Initianden jenseits der Grenzen der Gemeinschaft, und der dortigen Begegnung mit den Dämonen (Göttern), die Klangobjekte „bewohnen“ oder über sie erreicht werden können. Im Ritus regrediert die Wahrnehmung auf einfache Formen der Sinnlichkeit – Berühren, Hören, Sehen, Kosten.9 8 Als der das System vertretende Ort steht das Auge innerhalb und ortlos außerhalb des Systems wie der Gott bei Nikolaus von Cues. Heinz von Foerster: „If god is everywhere in the system, then God, the ultimate constraint, is not a controlling agency external to the system, as is a household thermostat, for example. In other words, the primary locus of constraint and control in this medieval system is exactly where it actually is in all non-engineered living systems: it is in the structural relations of the system itself. Like Cusa’s god, structural relations are everywhere, but since (like memory) they cannot be located or localized, we may also say that they are nowhere at the same time. Constraint and control, as in natural ecosystems and in most social ecosystems, lie in the hierarchical and hetearchical networks of the system itself, both at the level of the individual subsystem and at the level of the whole.“ Cybernetics of Cybernetics, in: Klaus Krippendorf (Hsg.): Communication and Control in Society, 1979, S. 17 f. 9 „The Metaphor of vibrations is reminscent of Gorer’s (1966) argument that the capacity to fall passionately in love is analogous to singing on key or falling in trance. This potential, it is claimed, may be universal to societies but uncommon to individuals. There are similarities to the withdrawal, self-abandon, total possession and oneness in trance as in creative inspiration, but love begins with the value of an individual. On this view, the expectation that one falls in love, stays in love, and marries the one who is passionately loved is analogous to all members of a society singing in tune or falling in a common trance.“ Brown, Love, S. 19 116 10 Kollektiv und Tierschicht In Hiob 28,7 jubeln die Morgensterne gemeinsam, was nicht nur eine Verknüpfung von Laut und Licht bedeutet, sondern auf den divinatorischen Charakter des Klangs hinweist. Das hebräische Wort N„ רJubel, Hymne“ – in der Einheitsübersetzung: „als alle Morgensterne jauchzten, / als jubelten alle Gottessöhne?“ – wird manchmal mit Singen übersetzt, das jedoch bereits artikulierte, klangliche Lautäußerungen bezeichnet, jedoch ist mit Jubeln eher etwas Vorsprachliches gemeint. Wenn die Entgrenzung des Ich mit dem Rückgriff auf frühe Entwicklungsstufen der Objektwahrnehmung zusammenhängt und die Tonhöhe hier ihren Ursprung hat, dann zählt sie zu den überindividuellen Phänomenen von Göttern, Engeln und Dämonen, deren Bereich der raumzeitlose Himmel ist. Der Begriff deutet darauf hin, dass der Ton bereits Ausdruck und intentional zu verstehen ist. Die eher technische Seite der Frequenz, ein guter Übertragungskanal für Signale zu sein, tritt zu dieser emotionalen Färbung eines Lautes hinzu, der auf eine beglückende Begegnung oder Umwelt reagiert. Der Hymnus deutet auf eine Weiterentwicklung des „somatischen“ Freudenrufes zur bewussten Verehrung hin, in der jedoch das Wesen der Anbetung erst hervorgebracht wird. „Im Opfer und Gebet eröffnet sich uns eine theurgische Dimension, in der die Menschen, indem sie eine Reihe ritueller Handlungen vollziehen – die im Fall des Opfers in erster Linie gestischer, im Fall des Gebets sprachlicher Natur sind –, mehr oder weniger erfolgreich auf die Götter einwirken. Trifft dies zu, erscheint die Hypothese vom Vorrang der Verherrlichung über die Herrlichkeit in einem neuen Licht. Vielleicht kommt die Verherrlichung nicht einfach zur Herrlichkeit Gottes hinzu, sondern bringt als wirksamer Ritus die Herrlichkeit allererst hervor...“1 Der Zugriff auf den Prozessbeginn der Wahrnehmung bedarf angemessener Mittel – den Hymnus, 1 Giorgio Agamben: Herrschaft und Herrlichkeit, Frankfurt 2010, S. 271 117 das Gebet, den künstlerischen Akt. Beim Gebet ist der Laut, die Stimme offenbar wichtiger als der Text, der im Hymnus von den Symmetrien des Rhythmus überlagert wird. So ist es nicht der semantische Befehl „Es werde Licht“, sondern das „sprach“, das vorhergehende Lautwerden der Stimme als Schöpfungsakt, ein Umstand, der den Evangelisten Johannes inspiriert hat, das Wort an den Anfang zu setzen; ay’-mer אמ«ר „Sprache, Rede, Gesang, Verheißung“ ist ein Vermögen, das vor der visuellen Erscheinung steht. Der Mund wird im Ägyptischen rA genannt 4 . Der Gott gleichen Namens, Re, dessen Bildzeichen das Augenmo- tiv ist, repräsentiert die Sonne. Im Hebräischen heißt raw-eh’ „ רָאָהsehen, wahrnehmen, erleben“. Hören und Sehen sind Unterkategorien der noch nicht differenzierten Wahrnehmung, sodass die Wahrnehmungsmetaphorik unentschlossen wirkt. So können Licht und Klang gemeinsam auftreten wie beim Jubeln der Morgensterne, dem Tönen der Planeten oder des pfeifenden Sonnenwagens im Lehrgedicht des Parmenides. Die Metapher der gemeinsam singenden Morgensterne verknüpft das Singen mit der Vereinigung – ya-had יח¯ד. Der Hymnus ist eine Form, unter der die vielen Stimmen sich zu einer Stimme verbinden, sodass die Verherrlichung vom Chor ausgeht, von der kollektiven Bindung, die in dieser Form als Bejubeln der Einheit verstanden werden kann, ontogenetisch als Jubel über die Erinnerung an die Subjekt-Objekt-Indifferenz, die sich in der Verschmelzung der Stimmen in einer Stimme, dem Chor wiederholt und „als wirksamer Ritus die Herrlichkeit allererst hervor[bringt]“ (Agamben). Im Chor verschwinden die Unterschiede einzelner Stimmen in einem komplexen Klang. Die differenzierten Frequenzen der Tonhöhen der Stimmen überlagern sich und heben die Differenzierung weitgehend auf. Die menschliche Entwicklungsverzögerung bietet die Möglichkeit, auf Stadien der Indifferenz zurückzugreifen, um Modelle der Einheit von Unterschieden zu bilden. Die Morgensterne jubeln zum Schöpfungsbeginn, auf den Hiob hingewiesen wird, weil das Überindividuelle lange vor ihm existierte, Laut und Licht die ersten Erscheinungen der Wahrnehmung waren. Denn es ist davon auszugehen, dass es sich beim Schöpfungsbegriff um eine zweite Schöpfung handelt, die 118 die erste mit Modellbildungen des Bewusstseins metaphorisch überlagert. Tritt eine frühe Phase des ontogenetischen Entwicklungsprozesses ins Bewusstsein, bezeichnen die Metaphern ein Symptom, das die Unterbrechung des mikrogenetischen Prozesses markiert. Psychoanalytisch handelt es sich um eine Regression. C. G. Jung bespricht in Symbole der Wandlung Phantasien einer Patientin von Théodore Flournoy. Sie litt an schizophrenen Störungen und beginnt in ihrem Schöpfungsgedicht mit dem Ton: When the Eternal first made Sound/ And myriad ears sprang out to hear,/ And throughout all the Universe/ There rolled an echo deep and clear:/ „All Glory to the God of Sound!“. Die zweite Strophe ist dem Licht und die dritte der Liebe gewidmet. Die Worte entstammen dem Traum einer nächtlichen Schiffsreise und wurde von dem Gesang eines Offziers während der Nachtwache angeregt: „Es schien mir, als ob die Stimme meiner Mutter mich gerade zu Ende des folgenden Traumes aufweckte: Zuerst hatte ich eine vage Vorstellung von den Worten ’When the morning stars sang together’ – welche das Präludium einer gewissen unklaren Vorstellung von Schöpfung und von mächtigen das Weltall durchhallenden Chorälen waren. Trotz dem sonderbaren widerspruchsvoll-verworrenen Charakter, der dem Traum eigentümlich ist, mischten sich Chöre eines Oratoriums... und sodann Erinnerungen an Miltons ’Verlorenes Paradies’ hinein. Dann tauchten aus diesem Gewirre langsam gewisse Worte auf, die sich zu drei Strophen ordneten...“2 Der Wecktraum erweitert sich zu einem das All umfassende Erwachen, das dem Schöpfungsvorgang gleichgestellt wird. Die Stimme der Mutter fällt selbst noch in die letzte Phase des Traums, den sie beendet. Dass die Stimme in die „Nacht“ des Schlafes fällt und sich erst dann das Licht zeigt, harmoniert mit der Stimme der Genesis, die das Licht vom Dunkel scheidet. Die nachts hell leuchtenden Sterne geben Anlass für eine akustische Vorstellung, indem die Himmelskörper umstandslos als tönend bezeichnet werden. In der Platonischen Philosophie ist der Weg zum Symbolbereich allenthalben der Grundrhythmus der Dialoge, die formal Prozesse sind, 2 C. G. Jung: Symbole der Wandlung, 2. Auflage 1973, S. 62 119 die sich in der dialektischen Methode entfalten. Die Methode ist ein Verfahren, den Weg zu jenen Gründen zurückzulegen, aus denen das Viele entsprungen sein soll. Es handelt sich um eine Entdifferenzierung, die von der Wahrnehmungswelt weg und zur reinen Form hinführt, die sich auf die Wahrnehmungswelt symbolisch bezieht. Im siebten Buch der Politeia wird die dialektische Methode als Entdifferenzierung und Auflösung der Unterschiede der Wahrnehmung in das allumfassende Licht der Sonne beschrieben. „Nicht wahr, mein Glaukon, sprach ich, das ist erst die wahre Hauptmelodie, die von der Kunst der Dialektik durchgeführt wird? Von ihr, die nur durch die Vernunft ausgeführt wird, dient uns das Vermögen des Gesichtes als Bild, das nach unserer obigen Darstellung die Tiere selbst, die Gestirne selbst und die Sonne selbst anzuschauen strebt. Ähnlich geht es auch, wenn jemand ohne alle Beihilfe der Sinne nur mittels der begrifflichen Tätigkeit des Verstandes zum wesenhaften Sein eines jeden Dinges dringt, und wenn er nicht ablässt, bis er das Wesen des Guten erfaßt hat, dann ist er an dem Ziele des Denkbaren, gerade wie einer in jenem Bilde, bei der Sonne selbst, am Ziele des Sichtbaren.“ 3 In der Beschreibung des Wiedergeburtsrituals der Politeia bestimmen die Seelen ihre Zukunft selbst mittels Losen aus dem Schoße der Lachesis, des Geschehenen, sodass die Seelen der Reihe nach aus den παραδείγματα von Lebensweisen auswählen. Das Wort wird mit „Umrisse“ (Friedrich Schleiermacher) oder „Muster“ (patterns, John Burnet) übersetzt. Dem Kern des Wortes nach handelt es sich um einen Weg, eine Richtung, die etwas einschlägt, zu δικεῖν „werfen“. So kann man davon ausgehen, dass damit die Bahn gemeint ist, die das Leben nach der Wiedergeburt nehmen wird, nachdem aus den verfügbaren παραδείγματα ausgewählt wurde. Andererseits ist die Umrisshaftigkeit als geschlossene Form des Vorbildes nicht zu vernachlässigen, sodass mit der Dynamik der Richtung auch die Bildung einer geschlossenen Figur gemeint ist. Dafür kann auch τρέπω stehen – „wenden, eine gewisse Richtung geben, in die Flucht schlagen“. τρόπος „Wendung“ wird nach Frisk meist 3 Platon, Politeia, 532 a 120 im Sinne von „Art und Weise, Sitte, Charakter“ verwendet, Bedeutungen, die δίκη ebenfalls enthält. So ist anzunehmen, dass die Wendungen einer Bewegung zur „Weise“ beitragen, die als Folge von Wendungen – Änderungen oder Einschlagen der Richtung – Bedeutung erzeugt. Das Verhältnis von Vorbild und Abbild, das das παραδείγματα bezeichnet, ist auch im τύπος enthalten – „Stoß, Schlag“, aber auch „Umriss, Gestalt“. Auch hier ist die Richtung ausschlaggebend, weil vom Stoß oder Schlag bestimmt. Insgesamt deuten „werfen, fliehen, stoßen, schlagen, verfolgen“ auf die Jagd, die bei Platon eine zentrale Metapher für Prozesse geistigen Strebens sind4 und ein Ziel haben. Tier und Idee sind eines Sinnes, und die Modellhaftigkeit der Idee zeugt von der Bedeutung der Tierschicht als Loslösung von der Individuation und Zugriff auf „abstrakte“ Formbildungen, für die die Höhlenzeichungen der Altsteinzeit beispielhaft sind. Es liegt nahe, dass der bewusste Umgang mit Tonhöhen historisch sich zu gleicher Zeit entwickelt hat. Ernst Terhardt wendet den Begriff der Kontur auch auf auditive Wahrnehmungen an, weil auditive Konturen die „Basis für alle tonalen und damit äußerst musikrelevanten Hörempfindungen“ darstellen.5 Die παραδείγματα bilden den Wendepunkt für einen neuen Anfang, die Wiedergeburt, nachdem die Seele ihr Leben aus den vorhandenen oder hinzugekommenen Leben gewählt hat, die der sozialen und animalischen Realität entsprechen. Undifferenziert überlagern sich soziale (biologische) Rolle und singuläres Leben als τεχνή. In dem musikalischen Bild sind acht Sirenen mit festen Tonhöhen versammelt, während die Moiren die Sirenen mit ihren Gesängen preisen – ὑμνεῖν πρός τὴν τῶν Σειρήνων ἁρμονίαν. Der Hymnus gilt der Harmonie der Sirenen, entstammt selbst aber der Zeit als Folge von drei Momenten, die die Moiren verkörpern. Die Sirenen, oft als Vögel dargestellt, zeugen von der Tierschicht als Agens der subjektiven Entdifferenzierung zum Zwecke der Bildung einer neuen subjektiven Einheit, eines neuen 4 5 C. Joachim Classen: Untersuchungen zu Platons Jagdbildern, 1960 Sigurd Rosenau: Untersuchung von physikalischen, phonetischen und psychoakustischen Aspekten der Erzeugung von Singstimmen, 2001, S. 33 121 abstraktionsfähigen und reflektierenden Ich. Der den Sirenen gewidmete Hymnus zielt auf die Harmonie als Aufhebung von Unterschieden, denn die Harmonie der Töne ist als Ordnung von Verschmelzungsprozessen geschaffen. Einem Mythos der Brahmanen zufolge dient der Hymnus als Nahrung der Götter, die ohne ihn nicht existieren würden. „Es war das Ideal der Brahmanen, mit einer Hymnen- und Liedersammlung ein Lebewesen, ein Tier, einen Vogel oder männlichen Menschen herzustellen und diese höchste mystische Nahrung dem weltverzehrenden und -schöpfenden Gott darzureichen.“ 6 Doch entscheidend sei bei den Brahmanen, dass die Hymne nicht nur Nahrung hervorbringt, sondern selber Nahrung ist. Dabei hängen die metrische Form der Hymne und ihre nährende Eigenschaft eng zusammen.7 Das heißt, dass die kunstvolle Form das Wesen der Nahrung für die Götter ausmacht. Die kunstvollen Formen der Hymnen, Lieder, Versmaße und durch Zahlen ausgedrückten Dinge als Nahrung zu bezeichnen, schlägt eine Brücke von abstrakten Symbolbildungsprozessen zum Verzehr in einem Ereignis, das im rituellen Fest begangen wird. Die kollektive Bedeutung der Symbolbildung erinnert daran, dass der Zugriff auf die Frühe nur kollektiv organisiert werden kann. Der individuelle Zugang, so scheint es die Odysseus-Episode mit den Sirenen zu zeigen, ist letal, d.h er verschlingt das Selbst. Von den Formbildungen der Frühe geht eine emotionale Attraktion aus, ihre Erreichbarkeit ist in die Zukunft verlegt, und der Rückweg wird zum zurückzulegenden Weg, auf dem das Alte ständig zum Neuen wird. Die starke emotionale Markierung der abstrakten Formen birgt das Antriebspotential einer Entwicklung von Symbolwelten, bei der das Vergangene unentwegt mit dem Vorzeichen des Kommenden belegt ist und um die Gegenwart kreist. Die Sirenen locken Odysseus mit Wissen, das sich in ihrem hellen (λιγύς Gesang mitteilt. Zwar bedeutet das Wort „laut und helltönend“, doch eine alte Aoristbildung – λίγξε – führt zu 6 7 Zitat Marcel Mauss bei Agamben, S. 280 Dem griechischen Hymnus entspricht keine bestimmte metrische Form, sondern sie bezeichnet seit ihren ältesten Zeugnissen, den sogenannten homerischen Hymnen, zunächst den Gesang zu Ehren der Götter. Der Definition nach enthalten Hymnen einen Lob Gottes und müssen gesungen werden. (Agamben, S. 281) 122 „schwirren“. Die Laute der Sirenen führen den Hörenden in eine Sphäre des Wissens, das Menschen in der Regel nicht zugänglich ist. Das „du mußt unsere Stimmen erst hören“ (ἵναvωιτέρην ὀπ΄ ἀκούης) steckt ein Wort, das zusammen mit dem Hören ein Gehorchen, Folgen ergibt. Das ὀπ verstärkt den Doppelsinn des Hörens als Folgen auf einen Ruf hin.8 Das Wort für den „Gesang“ der Sirenen trifft denn auch eher das Geräuschhafte im „scharfen, durchdringenden Ton“ oder „pfeifenden, sausenden Wind“ (Pape). Der Laut ist signalhaft und scheint unmittelbar eine Aktion zu stimulieren, was auf den undifferenziert elementaren Charakter des Wahrnehmungsprozesses hinweist. Wenig später wird das Signalhafte deutlicher, wenn mit dem Wort ἵημι („werfen“) die Stimme als Objekt erscheint, das in schnelle Bewegung versetzt wird, um zu treffen: ἱεῖσαι ὀπα κάλλιμον. In dem Wortfeld für die Stimme tritt das Hören als Folgen auf, das Folgen wiederum führt zum „Gefährten“, sodass die Stimme einen ebenso dynamischen wie dualistischen Sinn enthält. Aus diesem Bedeutungszusammenhang scheint auch Ovids Echo zu stammen, wobei hier ein Hinweis auf die Sehnsucht nach Entdifferenzierung verborgen ist, auf der ebenso die Narzißsage beruht. Die Spektraltonhöhen bilden das Ausgangsmaterial für die achtstufige Tonskala und deren Schwingungsproportionen, die Platons Kosmosmodell und den Sirenen im zehnten Buch des Staates zugeordnet sind. Hinter einfachen Form der Schwingungen zu Beginn des Wahrnehmungsprozesses, verbirgt sich die Vielzahl von Möglichkeiten einer Klangbildung, die jedoch verhindert wird. Stattdessen wird der auditive Prozess über die Kombination von Tonfolgen und -kombinationen gebildet, die im Laufe eines Musikstückes auf ein komplexes Erlebnis zulaufen, das durch Anreicherung der Erinnerung entsteht – der kurzfristigen des Musikstücks und der langfristigen der Kultur.9 Damit wird eine „symboli8 Frisk, S.402: *ὀπά f. „Gefolgschaft“, Verbalnomen von ἕπομαι „nachfolgen, Folge leisten“. ὠόπ ὄπ ist ein Kommando, das den Rudertakt angibt. ὄψ „Stimme“ des Singenden, z.B. der Sirenen 9 Die Tonarten der Griechen bilden eine erste Stufe der Bildung einer Skala aus der Teiltonreihe. Die unterschiedlichen Charaktere der Skalen deuten darauf hin, dass bereits diese Stufe Bedeutungen enthält, die von der Teiltonreihe und den Beziehun- 123 sche“ Objektwahrnehmung aufgebaut, die ähnlich vom Einfachen und Abstrakten zum Komplexen und Konkreten verläuft wie die reale. Das Konkrete, das erlebte Musikstück, hinterlässt ein virtuelles, gefühltes Bild – virtuell, weil sie das Negativbild oder die Ergänzung von Wahrnehmungskomponenten sind, das auditive Gegenstück der visuellen Illusion optischer Täuschungen. Terhardt schuf den Begriff der virtuellen Tonhöhe für die Wahrnehmung von Tonhöhen, denen keine objektive Frequenz zugrunde liegt wie z.B. bei den tiefen Aliquottönen der Orgel. Die Ergänzung findet in der neuronalen Verarbeitung statt, so wie bei grafischen Figuren eine fragmentarische Gestalt als ganze erkannt wird, weil fehlende Linien oder Teile im Wahrnehmungsprozess von der Vorstellung ergänzt werden. Die Sinnesdaten, die das Objekt liefert, treffen auf subjektive Gestaltungsformen, die mit abstrakten Annäherungen beginnen und unter dem Input der Sinnesdaten sich ausdifferenzieren. Ein unvollständig dargebotenes Objekt kann somit leicht ermittelt werden, weil es als Vorstellung – wenngleich unbewusst – früher existiert als die Wahrnehmung. Die Tonhöhe ist die unvollständige Darbietung eines Klangs, der von der auditiven Wahrnehmung ergänzt wird, sodass die Konstruktion von Folgen und Akkorden eine sehr komplexe Klangbildung erwarten lässt, deren Bedeutung nur vom Fühlen erschlossen wird, das in tiefere Schichten der sensorischen Verarbeitungshierarchie reicht. Im Umriss einen Gegenstand erkennen zu können, basiert auf der Ergänzungsmöglichkeit der Wahrnehmung, die das nicht Erscheinende dennoch „weiß“ und durch dieses Wissen vervollständigt. So verlässt sich auch der Zeichner auf dieses Wissen und stimuliert mit der Konfiguration von ausgeführten und frei gelassenen Zonen den Zwang zur Ergänzung, die auf „abstrakte“ Vorstadien der Objektbildung und dengen der Teiltöne zu den Spektraltonhöhen als auditive Primärobjekte ausgehen, auf deren Signalcharakter das Hören spezialisiert ist. Die Erzeugungsregel der Intervalle, aus denen die Skala gebildet wird, haben die Pythagoreer und Platon (Timaios 34c) der Teilung von Strecken und den Proportionen der Teile untereinander entnommen. Der Grundton ist das Eine, aus dem eine Vielfalt an Tönen mathematisch erzeugt werden kann, deren Teile – die Oktave ist die erste Teilung – untereinander ein Ganzes bilden, jedes Teil über dieses Ganze vermittelt. 124 jenigen Bedeutungen zurückgreifen, die in den Erlebniskontexten gebildet wurden. Mit dem gezielten Einsatz der (Spektral-)Tonhöhe wird ein analoger Prozess in Gang gesetzt. Der Umriss eines Gegenstandes enthält auch seine Bedeutung, er liefert die Informationen, das zu sein, was im Entwicklungsprozess von Wahrnehmung und Erkenntnis zu dem uns bekannten Ding geführt hat. Da der Gegenstand nicht isoliert von seiner Umgebung zum wiedererkennbaren Objekt wird, haften ihm auch Erlebnisse an. Die Bedeutung des Umrisses beruht auf den Kontexten, innerhalb derer sich das Wahrnehmungsobjekt als Kategorie bildet. Davon lässt sich ableiten, dass Konfigurationen, die nicht unmittelbar auf einen bekannten Gegenstand verweisen, dennoch mit Kontexten verbunden sein können. Solche Bedeutungsträger sind kommunizierbar, wenn die Kontexte der individuellen Erfahrungen sich gleichen. Ein Gegenstand lässt sich mit zusätzlichen Bedeutungen versehen, die über die kategoriale Identität hinausgehen. Dem Künstler gelingt es, Abweichungen vom kategorialen Schema mit kollektiv vermittelbarer Bedeutung zu versehen, die dadurch erreicht werden kann, dass hinter die Schwelle der Subjekt-Objekt-Differenzierung zurückgegangen wird, dorthin, wo einerseits die Individuation sich erst entwickelt und ihr Schicksal sich bildet, und andererseits abstrakte Formelemente zur Verfügung stehen, die als Symbolformen Bestandteil dieser Entwicklung bleiben. 125