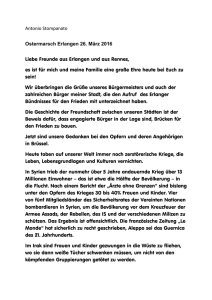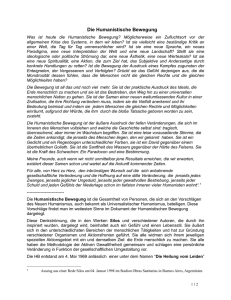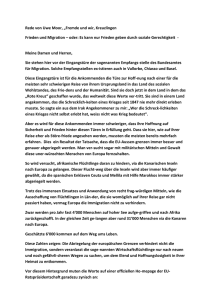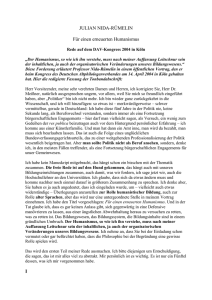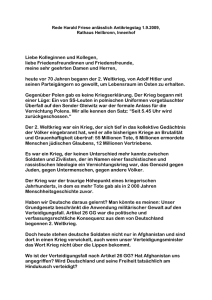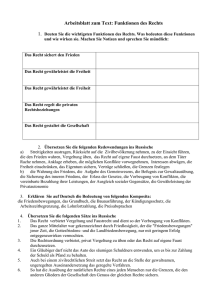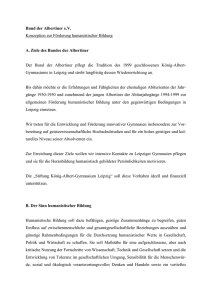Ansätze und Positionen einer humanistischen Friedensethik
Werbung

Thomas Heinrichs und Ralf Schöppner Ansätze und Positionen einer humanistischen Friedensethik Zusammenfassung Zeitgenössische friedensethische und friedenspolitische Positionen stehen oftmals implizit in einer humanistischen Tradition. Sie werden hier in Beziehung gesetzt zu einer bislang nur in Ansätzen vorhandenen, sich explizit humanistisch nennenden Friedensethik. In ethischer Hinsicht wird dabei ein weiter, interpersonal grundierter Begriff von Gewaltfreiheit stark gemacht. Entfaltet werden dessen politische Implikationen für das primäre humanistische Ziel einer friedlichen gesellschaftlichen Ordnung sowie für Grundvoraussetzungen einer politisch opportunen, wenn auch ethisch nicht zu rechtfertigenden Einschränkung des Prinzips der Gewaltfreiheit in Ausnahmefällen. Stichworte Schwach positiver Friedensbegriff, Humanismus, Verantwortungspazifismus, Friedenspolitik, militärische Intervention aus humanitären Gründen Einleitung Eine sich explizit humanistisch nennende Friedensethik ist bislang nur in ersten Ansätzen vorhanden. Was es heute hingegen gibt – neben einem verbreiteten friedensethischen Alltagshumanismus – ist das breite Spektrum einer etablierten Friedensethik und Friedensforschung. Dieses steht oftmals implizit in einer humanistischen Tradition. Nachfolgend wird zunächst eine Bestimmung von Humanismus als die sich über zwei Jahrtausende erstreckende historische Tradition eines „offenen Systems” vorgestellt, in der Frieden als Wert eine zentrale Rolle spielt. Sodann stellen wir einen humanistischen Friedensbegriff vor und setzen ihn in Beziehung zur Entwicklung von Friedenforschung und Friedensbewegung in der BRD nach 1945 und zu zeitgenössischen friedensethischen und friedenspolitischen Positionen. Gewollt ist dabei keine Vereinnahmung der Vielfalt durch die humanistische Tradition, sondern das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten, Differenzen und Leerstellen. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz einer spezifisch humanistischen Friedensethik weiterentwickelt, die andere Friedensethiken nicht als nichthumanistisch diskreditiert und dennoch ein eigenständiges Profil hat. Zwei Abgrenzungen sind zu machen: zum einen von einer theologischen Friedensethik, die den Glauben an eine Existenz Gottes und an einen göttlichen Willen voraussetzt; zum anderen ist humanistische Friedensethik aufgrund der Vielgestaltigkeit von Humanismus zugleich mehr und weniger als eine spezifische Form angewandter philosophischer Ethik – mehr, weil sie sich nicht auf die Form „Philosophie” reduzieren lässt, sondern verwoben ist mit politischen und alltäglichen Praxen, mit weltanschaulichen und narrativen Elementen, weniger, weil sie nicht im Sinne einer Prinzipienethik klare Unterscheidungen zwischen gutem und schlechtem Handeln sowie allgemeingültige Normen und Werte begründen kann, jedenfalls nicht ohne Zweifel und Widerstreit. Humanistische Friedensethik beruht allein auf menschlichen Überlegungen und Entscheidungen; dadurch bleibt sie stets begrenzt und fehlbar, der Aporie und auch der Machtlosigkeit ausgesetzt. Wir setzen, ausgehend von der philosophischen Verantwortungsethik von Emmanuel Levinas, einen weiten, interpersonalen Begriff von Gewaltfreiheit an. Damit sollen zum einen auch die unscheinbareren Formen von Gewalt zwischen Menschen als Friedenshindernisse ernstgenommen werden. Zum anderen werden die ethische Rechtfertigung von Gewalt und eine politische Instrumentalisierung der Ethik erschwert. Gleichzeitig aber erfordert eine solche Ethik das Politische und die Politik, um gute Bedingungen für weitgehende interpersonale Gewaltfreiheit zu schaffen. Der Kern einer humanistischen Friedenspolitik ist der Primat einer Vermeidung von Krieg und Gewalt und nicht etwa die Fokussierung auf die Frage nach der Legitimität humanitärer militärischer Interventionen. Wir diskutieren eine Reihe anthropologischer, sozialer, politischer und pädagogischer Aspekte, die für die Entwicklung nach innen wie außen friedlicher gesellschaftlicher Ordnungen mitentscheidend sind. Im Anschluss daran plädieren wir für einige Grundvoraussetzungen, die 1 gegeben sein müssen, damit in schwierigen Ausnahmefällen humanitäre militärische Interventionen und damit eine Einschränkung des Prinzips der Gewaltfreiheit politisch gerechtfertigt sein können. Allerdings führt dies nicht zu einer ethischen Rechtfertigung solcher Einsätze und Einschränkungen. So wie es nicht den Humanismus gibt, so wird es auch nicht die humanistische Friedensethik geben. Die nachfolgenden Ausführungen verstehen sich explizit als ein Versuch unter möglichen anderen, einen Ansatz für eine zeitgenössische humanistische Friedensethik zu formulieren, die es in dieser expliziten Form nicht gibt. Begriffsfeld Es gibt aktuell wie historisch eine ungeheure Vielfalt von Signifikaten, die sich mit dem Term Humanismus bezeichnen oder bezeichnen lassen.1 Daher liegt es nahe, ein Verständnis von Humanismus anzusetzen, das zweierlei leistet: Es sollte erstens weit genug sein, um die ganze Breite und Heterogenität von Humanismus abbilden zu können; und es sollte zweitens dennoch ein notwendiges Minimum an Einheitlichkeit liefern, um der Vielfalt ein gemeinsames Zentrum geben zu können. In diesem Sinne bestimmt Hubert Cancik Humanismus als „ein offenes System” (Cancik/Cancik 2014). Es ist offen, weil die Gestalt seiner Elemente nicht festgelegt ist: Humanismus ist eine Philosophie, eine kulturelle Tradition, eine soziale Bewegung, eine Weltanschauung, ein Zusammenhang von Werten und Normen, eine Alltagspraxis, ein Bildungsideal, eine Gemeinschaftsform, ein Epochenbegriff (Renaissance), ist verkörpert in historischen Personen und findet seinen Ausdruck in Geschichten, Mythen, Literatur und Kunst. Dieses System ist offen aber auch, weil „die Anforderungen an Kohärenz und Widerspruchslosigkeit (…) weniger hoch” sind, weil es unvollständig, unvorhersehbar, unvollendet und veränderbar ist (ebd., S. 20). Und dennoch ist es ein „System”: Es verfügt über Grundlagen und Kräfte, die die einzelnen Teile sinnvoll miteinander verbinden und eine gewisse Fortdauer des Ganzen ermöglichen. Diese Grundlage ist das stete Zusammen zweier Komponenten: (1) Bildung des Einzelnen, in einem weiten Sinne von Formung und Zivilisierung, und (2) Mitmenschlichkeit, im Sinne von praktischer Humanität, Humanisierung der Gesellschaft, Solidarität.2 Humanismus als ein solcher Zweikomponentenkleber ist historisch weit über zwei Jahrtausende alt, älter als das Christentum.3 Er ist nicht nur als historische Tradition herleitbar, sondern auch anthropologisch – der Mensch als entwicklungs- und unterstützungsbedürftiges Wesen – und begrifflich – unser Begriff „Mensch” impliziert den Gedanken von Entwicklung und seinen eigenen Plural. Bildung und Mitmenschlichkeit sind beide nicht ohne Frieden denkbar, sie sind gleichzeitig schon sein Vollzug wie seine Bedingung.4 Unter einer humanistischen Friedensethik wird der Ausgang von einem ebensolchen Menschenbild verstanden, das den Frieden uneingeschränkt als einen positiven Zustand und Prozess begreift, den Krieg als Mittel der Politik grundsätzlich ächtet und Gewalt gegenüber anderen nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässt. Aus humanistischer Perspektive kann es keine Trennung von Ethik und Politik geben. Eine 1 Vgl. hierzu die sogenannte „Groschopp-Liste”: http://humanismus-aktuell.de/node/120 (zuletzt abgerufen am 27.10.15). 2 Die notwendige Allgemeinheit einer solch weiten Bestimmung von Humanismus wirft eine Reihe zukünftiger, hier nicht diskutierbarer Forschungsfragen auf. 3 Diese Bestimmung von Humanismus als offenes System ist die Bestimmung eines westeuropäischen Humanismus. Sie monopolisiert ihn aber nicht für Europa, sondern lässt die Frage der Existenz von humanistischen Traditionen außerhalb Europas offen. Siehe hierzu: Rüsen/Laass (Hrsg.) 2009. 4 Der Humanismus versteht sich seit Beginn des 20. Jh. vorrangig nicht mehr als eine Bewegung der Rezeption der Antike, sondern als eine Philosophie über den Menschen (Giustiniani 1985, S. 174ff). 2 humanistische politische Position muss immer ethisch begründet sein und eine humanistische ethische Position bezieht sich direkt oder indirekt immer auf den Menschen als ein soziales, ein politisches Wesen. Diese Anforderung beeinflusst bereits die ethische Theoriebildung selber (vgl. Henrich 1990), da von Anfang an klar ist, dass das grundsätzlich unbedingte ethische Gebot in der Praxis vielfach nicht verwirklicht werden kann, da die Handlungsmöglichkeiten der Menschen beschränkt sind. Es ist für eine humanistische Position entscheidend, eine immanente Verbindung von Ethik und Politik zu leisten. Einer angeblich weltfremden Ethik kann nicht eine pragmatische, den scheinbaren Zwängen des Faktischen verpflichtete Politik gegenübergestellt werden. Vielmehr geht es darum, ausgehend von dem, was aus ethischer Perspektive das Richtige ist, im Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage, eine Handlungsposition zu finden, die dem humanistischen Ideal möglichst weitgehend verpflichtet ist und auf die Humanisierung der menschlichen Verhältnisse abzielt. Hauptteil Ein humanistischer Friedensbegriff Frieden ist der Anfang aller Humanisierung. Eine humane Gesellschaft ist nur in einer friedlichen Gesellschaft möglich. Nur sofern das Leben der Menschen im inneren wie im äußeren Verhältnis der Staaten nicht durch menschliche Gewalt gefährdet ist, nur sofern Konflikte zwischen den Menschen mit möglichst wenig Gewalt gelöst werden und nur sofern alle Menschen die Freiheit der anderen akzeptieren und nicht Gruppen versuchen, andere Menschen mit Gewalt ihrer Herrschaft zu unterwerfen, gibt es für alle Menschen die Möglichkeit, in einer gleichen, gerechten, solidarischen und humanen Gesellschaft (vgl. Heinrichs 2012) ihre Lebensmöglichkeiten auszuschöpfen. Pazifismus ist per se eine humanistische Position5 , da jede pazifistische Position dem Grundsatz folgt, dass die Sicherung von „Lebensentfaltungschancen” (Krell 1994, S. 35) absoluten Vorrang hat. Krieg ist kein Schicksal, keine Naturgewalt. Kriege brechen nicht aus, so wie ein Vulkan ausbricht oder ein wildes Tier aus einem Käfig. Menschen beginnen Kriege und Menschen können es lassen, Kriege zu beginnen. Kriege sind das Ergebnis ungelöster Konflikte und eines sozial institutionalisierten asozialen Egoismus der Menschen. Konflikte zwischen den Menschen sind Teil ihres sozialen Lebens. Konflikte haben ein positives und ein negatives Potential. Die strittige Auseinandersetzung miteinander kann ein Anstoß zu positiven Veränderungen sein. Aus humanistischer Perspektive gilt es sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch im Verhältnis von Gesellschaften zueinander gewaltfreie Konfliktlösungsmechanismen zu institutionalisieren, damit Konflikte nicht gewaltförmig eskalieren. Daneben gilt es soziale Strukturen zu schaffen, in denen der asoziale Egoismus der Menschen keine Entfaltungsmöglichkeiten findet, a-soziales Verhalten nicht belohnt wird (vgl. Heinrichs 2002, S. 283ff.) und die Anwendung von Gewalt in den Beziehungen der Menschen untereinander diskriminiert wird. A-humanistische Positionen, die über einen gewissen Kriegsfatalismus hinausgingen und den Krieg nicht mehr als ein Übel, sondern als etwas Positives sehen wollten, fanden sich in der Neuzeit seit ca. 1800 (vgl. Janssen 1982, S. 593, 600ff.). Bereits in der Diskussion um den ewigen Frieden wurde vertreten, dass ein andauernder Friede zur gesellschaftlichen Fäulnis führe (vgl. Embser 1779, 192). Während dies im 18. Jh. wohl noch eine Minderheitenposition war (vgl. Dietze/Dietze 1989) ändert sich dies mit dem Bellizismus des 19. Jh. (vgl. Kunisch/Münkler 1999). Im preußischen Militarismus, der in den ersten Weltkrieg führte, erschien der Krieg als gesellschaftlicher Normalzustand (vgl. Förster 1999, S. 65). Dagegen wurde in den USA im 19. und beginnenden 20. Jh. der Krieg als überholtes Produkt einer „unaufgeklärten, undemokratischen Vergangenheit” verstanden (Wette 1991, S. 129). Erstmals nach dem ersten Weltkrieg entstand eine weltweite Kriegsächtungsbewegung, die mit dem Abschluss des Briand-Kellog-Paktes, in dem der Krieg grundsätzlich als Mittel der Politik geächtet 5 Vgl. zum zwiespältigen Verhältnis der christlichen Kirchen zum Pazifismus und zu den humanistisch-pazifistischen Positionen Beyer 2012. 3 wurde, ihren Höhepunkt fand (ebd., S. 121ff.). Damit war auch dem Konzept des gerechten Krieges der Boden entzogen (ebd.) Dies war ein wesentlicher Schritt hin zu einer Humanisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Im „soldatischen Nationalismus” Ernst Jüngers und anderer Autoren der „Konservativen Revolution” wurde der Krieg dagegen wieder als „schicksalshaft” und als ein „Jungbrunnen der Völker” gepriesen (ebd., S. 133). Dies war eine bewusst antihumanistische Position – „Der geborene Krieger lässt sich auf humanitäre Perspektiven gar nicht ein” (Jünger 1930, S. 63) – die den Krieg außerhalb ethischer Überlegungen stellen wollte und die in den NS führte. Mit der Friedensbewegung und der in ihrem Umfeld entstehenden Friedens- und Konfliktforschung entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg erneut eine humanistisch orientierte Bewegung gegen den Krieg. Ausgehend von einem humanistischen Menschenbild, welches den Menschen grundsätzlich als seinem Mitmenschen wohlgesonnen begreift, ist der Frieden als Zustand einer ungestörten, funktionierenden sozialen Ordnung zu definieren. Dies ist eine schwache positive Definition des Friedens. Sie definiert den Frieden nicht negativ als Abwesenheit von Krieg, verlangt aber keine bestimmte Sozialordnung, um eine Gesellschaft als im Status des Friedens befindlich zu bestimmen. Es geht bei der Bewahrung des Friedens um den Schutz der Menschen vor gegen sie gerichteter physischer Gewalt. Eine soziale Ordnung kann daher dann als funktionierend und damit als friedlich bezeichnet werden, wenn es ihr gelingt, diesen Schutz im Wesentlichen zu gewährleisten. Dafür muss die soziale Ordnung die Leistung erbringen, die in ihr existierenden sozialen Konflikte möglichst ohne physische Gewalt zu regulieren und den Menschen einen friedlichen Umgang miteinander und mit Konflikten zu ermöglichen. Je weniger das der Fall ist, desto weniger funktioniert die Ordnung und desto mehr nähert sich die Gesellschaft einem Kriegszustand an. Frieden und Krieg sind die Endpunkte einer Skala, die den Grad an physischer Gewalt in und zwischen Gruppen von Menschen abbildet. Frieden ist damit nicht nur ein Zustand, er ist auch ein Prozess. Es geht darum, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Gewalt immer weniger nötig ist und Menschen den friedlichen Umgang miteinander lernen und praktizieren können, weil sie von diesem Weg überzeugt sind. Aus humanistischer Perspektive ist zwischenmenschliche Gewalt und Krieg eine Ausnahme, die man vermeiden, soweit dies nicht möglich war, begrenzen und baldmöglichst beenden muss. Bereits im Frieden müssen alle Anstrengungen unternommen werden, Gewalt und Krieg zu verhindern. Bei dem hier vertretenen weiten Gewaltbegriff (s. u.) zielt der Frieden daher idealerweise auf einen gewaltfreien Zustand ab. Dass Frieden ein beständiger Prozess in diese Richtung ist, bedeutet auch, dass nicht erst ein idealer gesellschaftlicher Endzustand als Frieden zu qualifizieren ist. Galtung hat einen solchen stark positiven Friedensbegriff vertreten. Er hat Frieden als völlige Abwesenheit von Gewalt definiert und Gewalt dann als einen Zustand, in dem „Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung” (Galtung 1975, S. 9, vgl. zur Debatte um diesen Gewaltbegriff Wasmuth 1988, S. 281ff.). Das Problematische an diesem weiten Gewaltbegriff und dem mit ihm verknüpften stark positiven Friedensbegriff ist, dass Frieden nur noch als Endzustand menschlicher Gesellschaften gedacht werden kann. Frieden ist für Galtung identisch mit einer Gesellschaft im idealen Zustand der „sozialen Gerechtigkeit” (ebd., S. 32). Damit verkennt Galtung, dass eine positive Entwicklung menschlicher Gesellschaft ein Mindestmaß an Friedlichkeit bereits voraussetzt. Schon diesen Anfang gilt es wertzuschätzen und zu bewahren. Auch wenn man als Humanist die Ziele einer ideal sozial gerechten Gesellschaft und einer ideal sozial gerechten Welt in einer langfristigen Perspektive verfolgt, so ist es doch erforderlich, unter den bestehenden Verhältnissen alles zu tun, um den Frieden auch in einer sozialen Ordnung zu bewahren, die in Hinsicht auf die gewaltfreie Lösung von Konflikten nicht optimal ist. Aus humanistischer Perspektive muss auch ein Frieden in einer nicht perfekten Gesellschaft uneingeschränkt als etwas Positives begriffen werden. 4 Das Feld einer humanistischen Friedensethik nach 1945 Jede humanistische Friedensethik kann heute anknüpfen an einen friedensethischen Alltagshumanismus, an eine – trotz aller vorhandener Gewalt – weit verbreitete Abscheu vor der Gewalt und dem Krieg, wenn auch nicht immer, nicht bei jedem und jeder. Gewalt ist für die meisten von uns keine Selbstverständlichkeit, sondern wird fast immer als Problem betrachtet. Zwar hat es nach 1945 auch friedensethische und friedenspolitische Positionen gegeben, die sich explizit auf den Humanismus bezogen haben (vgl. Große 1964, Hahn 1985, Flechtheim 1987, SchulzHageleit 1999, Beyer 2012), überwiegend jedoch sind im Feld der Friedensbewegung und Friedensforschung Konzepte und Praxen ohne unmittelbaren Bezug auf den Humanismus entwickelt worden, in denen sich leicht Elemente einer humanistischen Friedensethik ausmachen lassen (vgl. Imbusch/Zoll 2006). Internationale Solidaritätsarbeit und Kriegsdienstverweigerung als Teile einer praktizierten Friedenspolitik sowie die entstehende Friedenspädagogik greifen auch auf humanistische Traditionen von Bildung und Mitmenschlichkeit zurück. Die Arbeiten der vielen Institute und Autoren einer breiten interdisziplinären Friedensforschung gehören daher mit zum hier behandelten Feld. Humanismus als säkulare Weltanschauung kennt kein Glaubensbekenntnis und verlangt keine Mitgliedschaft. Humanist/in in einem weiten Sinne ist, wer humanistisch lebt und humanistische Positionen vertritt. So wie Humanismus eine soziale und kulturelle Bewegung ist, in der Reflexion mit praktischer Humanität einhergeht, so haben sich auch Friedensforschung und Friedensbewegung in der BRD im Kontext spezifischer Lebenserfahrungen und politischer Kämpfe entwickelt. Ein zentraler gemeinsamer historischer Bezugspunkt ist das emphatische und emotionale „Nie wieder Krieg„ nach einem Jahrhundert mit Weltkriegen und Völkermorden. Eine historische Lehre, die vielleicht kumuliert in dem berühmt gewordenen Satz: „Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts ähnliches geschehe”(Adorno 1992, S. 358). Nachdem die Anfang des 20. Jh. entstandene Friedensbewegung im Faschismus zerschlagen worden war und ihre führenden Personen emigrieren mussten, kam es nach 1945 in Deutschland aufgrund der „Nie-wieder-Krieg”-Stimmung zunächst zu einer erfolgreichen Wiedergründung pazifistischer Organisationen wie der „Deutschen Friedensgesellschaft”, der „Deutschen Liga für Menschenrechte” und auch der „Internationale der Kriegsdienstgegner” (vgl. Holl 1988, S. 220). Die Entwicklung der westdeutschen Friedensforschung und der sie tragenden Friedensbewegung vollzieht sich dann vor allem im Kontext des Kalten Krieges, in den politischen Debatten um Wiederbewaffnung, Nachrüstung und Formen des Widerstands, vom zivilen Ungehorsam bis hin zum bewaffneten Kampf von Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, Afrika und Asien. Auffällig ist bei all dem, dass Religion in der Regel keine entscheidende Rolle in Hinsicht auf die friedenspolitischen Forderungen spielte. Das bedeutet nicht, dass keine Akteure mit religiösen Motivationen beteiligt gewesen wären, sondern dass die Beantwortung der „Gretchenfrage„ für das Anliegen von Bewegung und Forschung maximal sekundär gewesen ist. In der DDR wurde versucht, die Friedensbewegung als „humanistisches Erbe” (vgl. Klein 1968) in die Staatsapparate zu integrieren. Auch in der DDR war die latente Drohung des Atomkrieges für die Entwicklung einer humanistischen Position zur Friedensfrage entscheidend. Der VI. Philosophenkongress der DDR fand 1984 zum Thema „Sozialismus und Frieden. Humanismus in den Kämpfen unserer Zeit” statt (vgl. die Kongressdokumentation Berlin 1985 und die Darstellung des politischen Kontextes bei Groschopp 2013, S. 479ff.). Der Sozialismus der DDR verstand sich als ein Humanismus und sah die humane Entwicklung der Menschheit, zu der auch der Frieden gehörte,6 als das Ende des menschlichen Fortschritts an. Allerdings reduzierte sich der Humanismus in der DDR dann auf den real existierenden Sozialismus, eine eigenständige Qualität hatte er nicht. Mit dem hier vertretenen Humanismusverständnis hatte er sehr wenig gemein. 6 „Die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft, eine Welt des Friedens, der Arbeit, der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit steht im Mittelpunkt dieses Humanismus” (Hahn 1985, S. 12). 5 Die Gefahr eines Atomkrieges zwischen dem „Westen” und dem „Osten” verlangte bereits jetzt, den Frieden zu bewahren. Zu Recht erkannte man, dass der Frieden nicht das Ende, sondern die Voraussetzung eines Prozesses der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen ist und dass eine friedliche Koexistenz nötig ist. Faktisch orientierte sich die DDR dann jedoch lediglich dahin, dem Westen die „Alleinschuld” an der Kriegsgefahr zuzuschreiben (Rupprecht 1985, S. 55). Grundsätzliche ethische Überlegungen fehlten ebenso wie eine problemorientierte Friedensforschung. Auf Basis der Alleinschuldthese war dies nicht möglich. Es gab nur den Appell an „die Vernunft” (Hager 1985, S. 111). Waren Ost-West-Konflikt und Kalter Krieg der alles dominierende Hintergrund der Anfangsjahre, deren Ende zunächst große Hoffnungen auf eine Friedensdividende weckte, so sieht sich die gesamtdeutsche Friedensforschung – ähnlich wie eine humanistische Friedensethik (s. u.) – heute vor ganz neue Herausforderungen gestellt (Werkner/Kronfeld-Goharani 2011). Es hat seit 1990 eine Reihe von zumeist sehr umstrittenen Militäreinsätzen gegeben – Irak, Kosovo/Serbien, Afghanistan, Libyen u. a. m., die offiziell mit humanistischen oder zumindest humanismuskompatiblen Motiven begründet worden sind: Schutz von Menschenrechten und Demokratie, Verhinderung von Völkermorden, Verhinderung des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen, Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Selbst wenn sich diese Motive oftmals als verwoben mit ökonomischen und geopolitischen Interessen oder sogar als bloß vorgeschoben herausgestellt haben, bleibt doch die schwierige friedenspolitische Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Militäreinsatz legitim sein kann, der Menschen unterstützt, deren Leben bedroht ist. Vor diesem Hintergrund ist Frieden heute explizit ein Kernbegriff in den Debatten um das Selbstverständnis zeitgenössischer humanistischer Organisationen.7 So wird Humanismus nicht nur mit Antimilitarismus, sondern mit Pazifismus zusammengedacht, allerdings ohne eine radikale Version im Sinne einer bedingungslosen Ablehnung von Gewalt zu befürworten (Schulz-Hageleit 1999). An anderer Stelle ist weniger Platz für das Aushalten solcher Ambivalenzen, und die Hinwendung zum Pazifismus fällt rigoroser aus (Beyer 2000). Im aktuell noch gültigen Selbstverständnis des Humanistischen Verbands Deutschlands von 2001 schließlich kommt die neue und ambivalente friedenspolitische Herausforderung dadurch zum Ausdruck, dass sowohl das Recht auf Kriegsdienstverweigerung unterstützt als auch dasjenige eingefordert wird, konfessionsfreie Soldaten in Lebensfragen zu beraten.8 Friedenspolitische Grundsatzfragen sind kontinuierlich Gegenstand der Forschungs- und Bildungsarbeit der Humanistischen Akademien, zuletzt insbesondere auf zwei wissenschaftlichen Tagungen.9 Deutlich zutage tritt dabei nicht nur die inhaltliche Breite und Kontroverse im Spektrum des organisierten Humanismus 10 , sondern auch das gemeinsame Anliegen, die Frage nach sogenannten humanitären militärischen Interventionen in ein der Problematik angemessenes friedenspolitisches Gesamtkonzept zu integrieren, das vor allem auf Prävention und nichtmilitärische Lösungsstrategien fokussiert. Die Ausarbeitung einer solchen humanistischen Ethik und Politik des gerechten Friedens, die sich der Lehre vom gerechten Krieg widersetzt, kann anschließen an die eigenen Traditionen von Bildung und Mitmenschlichkeit wie an zeitgenössische friedenspolitische 7 Vgl. hierzu in diesem Band die Hinweise in dem Beitrag von Horst Groschopp zu Kurtz, SchulzHageleit und Beyer, zum Selbstverständnis des Humanistischen Verbandes Deutschland sowie zur Arbeit der Humanistischen Union. 8 http://www.hvd-bb.de/sites/hvd-berlin.de/files/Humanistisches%20Selbstverst%C3%A4ndnis.pdf 9 Siehe dazu http://www.humanistische-akademie-berlin.de/content/humanistische-verantwortunginternationalen-konflikten und http://www.humanistische-akademie-berlin.de/content/reflektierendesoldat-berufsethische-qualifizierung-bundeswehr-frage-pluralistischen. 10 Vgl. hierzu auch Schulz-Hageleit (1999), den Beitrag von H. Groschopp in diesem Band sowie insbesondere Beyer (2000). 6 und friedensethische Diskurse um Schutzverantwortung. Die aktuelle Position eines friedensethischen Humanismus Selbst wenn die These, „Frieden verkörpern” sei eine „Hauptaufgabe des Humanismus seit eh und je” (Schulz-Hageleit 1999, S. 61) in historischer Perspektive zu differenzieren ist 11 , so bleibt doch in evaluativer Hinsicht richtig, dass Frieden ein „Hauptinhalt humanistischen Denkens” ist, weil er eine wesentliche „Grundbedingung kraftvoll sich entfaltenden guten Lebens” ist, wie der Krieg andererseits eine große „Gefahr für die Humanität als Lebenspraxis und den Humanismus als Lebenstheorie” (Schulz-Hageleit 1999, S. 5, 61) darstellt. Dies ist durchaus ein Spezifikum genuin humanistischer Friedensethik, denn die menschliche Geschichte ist bis heute ungeheuer reich an Beispielen für die Vereinbarkeit von Krieg und Religion für das Führen von Kriegen im Namen oder unter direkter Beteiligung von Religion.12 Wenn nun seit dem 20. Jh. verstärkt Kriege im Namen von Humanität oder impliziter humanistischer Überzeugungen – Menschenrechte – geführt werden, dann ist damit die politische Hauptherausforderung einer humanistischen Friedensethik heute benannt. Das stete Zusammen der beiden Komponenten des Humanismus – Bildung und Mitmenschlichkeit – verweist auf die grundlegende Bedeutung der sozialen Beziehung für menschliches Leben. Die Formung und Zivilisierung des Einzelnen findet in sozialen Bezügen statt, die nicht nur von individuellen Freiheiten, sondern auch von wechselseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen geprägt sind. Dazu gehört von Anfang an der Anspruch praktischer Humanität, der Nichtgleichgültigkeit gegenüber dem jeweils anderen Menschen. Humanismus ist hier immer schon ein „Humanismus des anderen Menschen” (Levinas 1989). Frieden ist aufgrund der Struktur menschlicher Sozialität eine stets prekär bleibende Angelegenheit. In ihr stehen Freiheit und Humanität beständig auf dem Spiel, Friedfertigkeit ist genauso möglich wie Gewalt. „Gewaltsam ist jede Handlung, bei der man handelt, als wäre man allein: als wäre der Rest des Universums nur dazu da, die Handlung in Empfang zu nehmen; gewaltsam ist folglich auch jede Handlung, die uns widerfährt, ohne dass wir in allen Punkten an ihr mitwirken” (Levinas 1996, S. 15). Die Berücksichtigung des anderen ist eine Bedingung der Möglichkeit von Frieden.13 Berücksichtige ich den anderen nicht, so ist dies ein gewaltsamer Akt; berücksichtige ich ihn aber, so ist dies keine Garantie für Gewaltfreiheit und Frieden, denn für ihn kann die Berücksichtigung zu gering wie sie für mich zu viel sein kann. Frieden kann aufgrund dieser unaufhebbaren Fragilität menschlicher Beziehungen nicht erst die Abwesenheit von jeglicher Gewalt sein. Frieden verstanden, als Prozess, ist im humanistischen Sinne die bleibende Aufgabe, den anderen stets so zu berücksichtigen, dass die interpersonalen Beziehungen so weit wie eben möglich gewaltfrei sind. Der angesetzte Gewaltbegriff ist sehr weit, lässt aber dennoch sinnvolle Abstufungen unterschiedlich gravierender Formen von Gewalt zu. Er zielt auf eine besonders intensive Sensibilität für die Realitäten des interpersonale Geschehens und versieht dieses bewusst mit einem starken ethischen Anspruch, der nicht abschließend zu erfüllen ist. Es bleibt die Beunruhigung über die Möglichkeit von Gewalt gegen den anderen. Humanistische Friedensethik ist in diesem Sinne eine Form von Verantwortungsethik: Verantwortung des einen für den anderen. Die aktuell in Deutschland zu beobachtende Parallelität von einerseits verbreiteter Aufnahme- und Hilfsbereitschaft gegenüber nach 11 Vgl. die Beiträge von Hubert Cancik und Frieder Otto Wolf in diesem Band. 12 Religionen sind sowohl zur Rechtfertigung von Kriegen wie zum Kampf für den Frieden einsetzbar (vgl. Weingardt 2011, Meyer 2011). 13 Hier ließe sich auch eine Verbindung zu Kant herstellen, insbesondere zur Friedensschrift, in der das Weltbürgerrecht der Hospitalität zentral und vorrangig ist „Zum ewigen Frieden 1795", ganz so, als ob Frieden viel eher auf der Gastlichkeit als auf der Einheitlichkeit und Abgeschlossenheit eines eigenen Raumes oder Subjekts beruht. Die neuerdings in einigen europäischen Staaten wieder auftauchenden Forderungen nach homogenen Volkskulturen sind vor diesem Hintergrund nicht friedensdienlich. 7 Deutschland flüchtender Menschen und andererseits neuen Rekordzahlen von Übergriffen auf Flüchtlinge und Brandanschlägen auf Flüchtlingswohnheime bezeugt, dass das humanistische Projekt einer friedlichen Gesellschaft zwar bei einer relativ stabilen sozialen Ordnung beginnen, dort aber nicht stehen bleiben kann. Die interpersonale Beunruhigung bedingt die Schaffung, Erhaltung und weitere Humanisierung einer stabilen gesellschaftlichen Ordnung, so wie auch diese Ordnung umgekehrt eine Bedingung für friedliches Miteinander ist. Humanistische Friedensethik ist keine erbauliche Lehnstuhlethik im philosophischen Elfenbeinturm oder theologischen Seminar, sie fordert die Niederungen des Politischen, die Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten.14 Insbesondere zielt sie auf einen modernen demokratischen und laizistischen Rechtsstaat, der anders als ein von dieser oder jener Religion dominierter Staat sich nicht auf Hegemonie, sondern auf den fundamentalen ethischen Wert des Friedens gründen kann. Der Zusammenschluss der Menschen in einem weltanschaulich-religiös neutralen Staat ermöglicht den Pluralismus und ist in eben diesem Sinne nicht neutral: Er dient dem Frieden. Sich an die Gesetze des weltanschaulich-religiös neutralen Staates zu halten stellt ebenfalls eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für den Erhalt des Friedens dar. Darüber hinaus müssen Bürger und Bürgerinnen auch wissen, warum sie sich an die Gesetze halten sollen. Sie müssen wissen, dass sie es „um des lieben Frieden willens” tun. Es kann aber auch sein, dass dieses oder jenes Gesetz gar nicht oder nicht mehr dem Frieden dient. Humanistische Friedensethik verlangt immer auch die kritische Infragestellung der Verrechtlichungen, getroffener Regelungen und des politischen Handelns vor deren eigentlichem Sinnhorizont des Friedens. Eine weitere Bedingung für gesellschaftlichen Frieden ist daher immer auch die Prüfung der bestehenden Gesetze, wozu es ethischer und politischer Urteilsfähigkeit bedarf. Der weltanschaulichreligiös neutrale Staat ist daher in einer weiteren Hinsicht nicht neutral, sondern humanistisch grundiert: Es ist seine Aufgabe, für den ihm zugrunde liegenden Wert des Friedens zu werben und Möglichkeiten zur Ausbildung von ethischer und moralischer Urteilsfähigkeit seiner Bürger und Bürgerinnen zu schaffen. Hier liegt ein wichtiges friedenspädagogisches und friedenspolitisches Ausgabenfeld für staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure. Es gehört zu den Stärken des hier zugrunde gelegten Gewaltbegriffs und Staatsverständnisses, dass sie sich politisch nur schwer instrumentalisieren lassen, sondern stattdessen die Politik ethisch umfassend, genau genommen unendlich, verpflichtet. Staat und Politik bleiben hier konsequent ethisch gebunden. Sie haben den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten und den interpersonalen zu fördern. Auf dieser Grundlage lässt sich kein gerechter Krieg begründen. Jeder Militäreinsatz, ob er Soldaten und/oder Zivilisten betrifft, wird dem Friedensauftrag nicht gerecht, ist Ausübung von Gewalt gegen einen anderen und belastet die interpersonalen Beziehungen. Humanistische Friedensethik widersetzt sich jeglicher Rechtfertigung von Gewalt, insbesondere jeder religiösen im Namen dieses oder jenen Gottes, aber auch derjenigen im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus oder im Namen von Fortschritt, Menschenrechten oder Humanität. Sie widersetzt sich jedem selbstgerechten oder triumphalischen Begleitjubel angesichts von Militäreinsätzen und Gewalt: keine Sinngebung oder Sinnhuberei als unbedingte positive Rechtfertigung des eigenen Tuns. Es wird insbesondere keine höhere – jenseitige – Gerechtigkeit, kein göttlicher Dank für gefallene Soldaten in Aussicht gestellt, es wird nicht auf eine göttliche Weisheit oder Vorsehung rekurriert, es gibt keine religiöse Entlastung vom Unsinn und Leid der Gewalt. Ebenso wird ein weltliches Geschichtsgesetz, eine Teleologie, in der die Opfer von heute ihren vernünftigen Sinn in einer späteren Zeit haben werden, abgelehnt. Aus der Ablehnung jeglicher Rechtfertigung von Gewalt ergibt sich aber kein radikaler Pazifismus: 14 Es ist dies eine spezifisch humanistische Verbindung von Ethik und Politik: Der notwendige innerhumanistische Widerstreit zwischen der Achtung der Anderen als Menschen und der Achtung des Anderen als Anderen. 8 Militärische Gewalt kann das kleinere Übel sein (Wolf 2011a).15 Angesichts der Verantwortung für den anderen muss abgewogen werden. Humanistische Friedensethik stellt keine Metaregel oder Letztbegründung zur Verfügung, aus der im konkreten Fall einfach eine Entscheidung abgeleitet werden kann. Hieraus ergibt sich aber gerade ein Mehr an Verantwortung für die politischen Entscheidungsträger. Die Politik behält eine relative Autonomie gegenüber der Ethik. Wenn auch ethisch weder die Inkaufnahme des Todes von Menschen im Namen der Verteidigung von Menschenrechten noch die Unterlassung der Rettung einer hohen Anzahl von Menschenleben unter Inkaufnahme des Todes einiger weniger zu rechtfertigen ist, so kann dennoch ein Militäreinsatz politisch richtig sein. Sich einzugestehen, dass es solche schlimmen Ausnahmesituationen geben kann, in denen man schuldig wird, egal wie man handelt, gehört zu einer humanistischen Position dazu. Ganz einfach deshalb, weil der Mensch im Humanismus keine gottähnliche Stellung einnimmt. Er und sie, endlich und fehlbar: Unentscheidbarkeiten und moralischen Dilemmata ausgesetzt sein (Derrida 1991); nicht alles wissen können, nicht immer wissen können, ob ein Militäreinsatz besser ist als der Nicht-Einsatz; nicht immer klare und perfekte Lösungen anbieten können; zwischen Übeln wählen müssen; Ambivalenzen aushalten müssen (Schulz-Hageleit 1999); sich irren können; aber auch: sich von ökonomischen, machtpolitischen Interessen oder anderen Begehrlichkeiten leiten zu lassen. Das Humanistische dürfte angesichts von Krieg und Frieden eher in einem verzweifelten, entsetzten und traurigen Gesicht zu finden sein als im vor Gewissheit und Selbstgerechtigkeit strahlenden. Die aktuelle friedenspolitische Position des Humanismus Wenn der Humanismus per se ein Pazifismus ist, so stellt sich die Frage, was seine pazifistische Position ist. Seit es den Pazifismus als Antikriegsbewegung gibt, gibt es auch Debatten, ob Gewalt überhaupt nicht oder in eng begrenzten Ausnahmefällen doch angewendet werden darf. Bejaht man die letztere Position, so stellt sich die Frage, wie dieser Ausnahmefall definiert wird. Allerdings ist aus humanistischer Perspektive die Frage, unter welchen Bedingungen Gewalt angewendet werden darf oder muss, das Letzte, mit dem es sich zu beschäftigen gilt. Vorrangig geht es um die Frage, wie eine friedliche Gesellschaft geschaffen, bewahrt und gestärkt werden kann. Hierfür bedarf es einer möglichst sozial gerecht organisierten Gesellschaft und gewaltfreier Formen der Austragung und Lösung von Konflikten – im Inneren wie im Äußeren. Ob es zu Kriegen zwischen Staaten oder zu Bürgerkriegen kommt oder nicht, hängt maßgeblich auch von der inneren Verfasstheit der Gesellschaften ab. Die erste Aufgabe von Humanisten ist es, aktiv für die Verminderung der Gewalt in sozialen Prozessen einzutreten und alles dafür zu tun, dass die Staaten im Inneren wie im Äußeren friedlicher werden. Entscheidend für die Entwicklung einer humanistischen Position zu Krieg und Frieden war die Entwicklung der Konfliktforschung nach 1945, durch die das Freund-Feind-Schema und das Bild des „bösen” Täters überwunden wurde (vgl. Galtung 2008, S. 34). Eine humanistische Position kennt „das Böse” nicht (Heinrichs 2012, S. 215). Gewaltsame Auseinandersetzungen finden nicht statt, weil böse Menschen Böses tun oder weil der Mensch ein aggressives Wesen wäre (vgl. Jahn 2012, 54ff.). Zwar ist die menschliche Aggressivität eine der Komponenten, auf denen physische Gewalt und Krieg aufbauen, sie reicht jedoch zur Erklärung nicht aus: „selbst wenn die individuelle menschliche Psyche, naturgeschichtlich bestimmt, aggressivitätsgebunden ist, würde dadurch die nicht mehr individuelle erklärbare, gruppenmäßig oder staatlich organisierte Aggressivität noch lange nicht erklärt werden können” (Senghaas 1974, S. 133). Gewaltsame Auseinandersetzungen sind vielmehr zumeist die Folge der Eskalation ungelöster Konflikte: „However, if we incline towards relation-oriented thinking we will feel correspondingly at home in a general peace discourse that sees violence in terms of unresolved, vesterin conflict. In this view, the only way of preventing violence is to solve, or at least transform, the conflict relation in 15 Zu einer humanistischen Friedensethik gehört auch das mögliche Eingeständnis, der weitere Verlauf der Ereignisse stelle die Anfangsdiagnose vom „kleineren Übel” in Frage (Wolf 2011b). 9 order to obtain peace” (Galtung 2008, S 34f.). Dies bedeutet auch, dass es keine einfachen Schuldzuweisungen gibt. Ein eskalierter Konflikt ist immer ein Prozess, in dem beide Seiten etwas falsch gemacht haben. Das Opfer kriegerischer Gewalt ist zumeist eine für die Eskalation des Konflikts mitverantwortliche Partei (ebd., S. 34) und muss, um eine Deeskalation zu bewirken, auch das eigene Verhalten in Frage stellen. Der Umgang mit Konflikten ist immer auch durch die jeweilige Kultur geprägt. Kriegerische Kulturen werden zu gewaltförmigen Lösungen tendieren, während friedliche Kulturen gewaltfreie Lösungen anstreben. Krieg und Frieden sind daher auch das Ergebnis kultureller Prägungen (Galtung 1990). Humanismus als ein kulturelles System steht für eine Kultur des Friedens. Kriege werden aber nicht nur durch ungelöste Konflikte und nicht nur durch die kulturelle Verankerung von Gewalt als Mittel der sozialen Auseinandersetzung verursacht, sondern auch durch den a-sozialen Egoismus der Menschen. Der Konfliktbegriff der Friedensforschung bezieht sich nicht auf Machtkonflikte, in denen es um die Durchsetzung von Hegemonie und um politische Einflusssphären geht. Den Kolonialkriegen und dem Vietnamkrieg lagen in diesem Sinne keine ungelösten Konflikte zugrunde. Auch der sogenannte Ost-West-Konflikt war daher kein Konflikt, der mit den in der Friedensforschung entwickelten Methoden hätte reguliert werden können. Gegen diese Form der Macht- und Gewaltpolitik hilft nur ihre grundsätzliche Diskriminierung. Der Krieg war und ist schon immer auch ein Produktionsmittel. Nur ein grundlegender sozialer Wandel kann diese Kriegsursache beseitigen. Aus humanistischer Perspektive sind Kriegsursachen daher moralisch zu bewerten. Kriege, die Folge eines ungelösten Konflikts um existentielle Ressourcen von Völkern sind (klassisch sind die Wasserkonflikte), haben moralisch eine andere Qualität als Raubkriege, die dazu dienen, den eigenen Wohlstand durch die kriegerische Ausbeutung anderer zu erhöhen. Neben Methoden, die eine friedliche Konfliktlösung ermöglichen, ist in der Friedensforschung ein ganzes Repertoire an Aufgaben und Handlungsoptionen entwickelt worden, die darauf abzielen, den Frieden zu stärken. Sowohl für den Frieden im Inneren wie für den Frieden im Äußeren ist die Installation eines Gewaltmonopols und die demokratische Verfassung von Gesellschaften hilfreich. Mit der Entstehung des staatlichen Gewaltmonopols wurden die innergesellschaftlichen Konflikte befriedet. Das völkerrechtliche Prinzip der Souveränität der Staaten, welches nur der UN militärische Aktionen gegen Staaten gestattet, ist ein wesentliches Fundament der Verhinderung von Kriegen. Nachweislich haben im letzten Jahrhundert die parlamentarischen Demokratien der kapitalistischen Länder kaum Kriege untereinander geführt. Kriege gegen andere Länder wurden dagegen in „normalem” Umfang geführt (vgl. Geis/Wolff 2011). Es kommt für die Friedfertigkeit einer Demokratie jedoch auch auf den Grad ihrer demokratischen Verfassung an. In keiner der parlamentarischen Demokratien des Westens entscheidet die Bevölkerung im Wege direkter Demokratie über die Frage, ob das Land kriegerisch tätig wird. Auch im Verhältnis der Staaten untereinander ist eine gleichberechtigte Verfassung, wie sie durch das Regelsystem der UN ansatzweise vorhanden ist, mit zivilen Konfliktlösungsmechanismen, wie z. B. dem internationalen Gerichtshof, wichtig für die Erhaltung des Friedens. Die demokratische Verfassung von Gesellschaften erschwert es nicht nur im Außenverhältnis, Kriege zu führen, sie erleichtert auch die Integration der unterschiedlichen sozialen Gruppen in diesen Gesellschaften. Integration ist ein dauernder Prozess, jede soziale Gruppe, jede neue Generation muss immer wieder von neuem integriert werden. Eine Gesellschaft muss allen ihren Mitgliedern die Möglichkeit politischer Partizipation eröffnen und die Chance auf ein angemessenes Auskommen geben. Sie muss den unterschiedlichen Kulturen Raum geben und sie gleichermaßen wertschätzen. Verhinderte Integration – wie sie sich gerade am Beispiel der muslimischen Migranten in einigen Staaten zeigt – führt zu Gewalt. Die politische und soziale Integration aller sozialen Gruppen in die Gesellschaft hinein ist damit eine genuin friedenspolitische Aufgabe. Auch hier gilt wie bei der Deeskalation von Konflikten, dass beide Seiten sich ändern müssen, damit Integration gelingen kann. 10 Integration ist nicht etwas, das ich vom Anderen fordern kann, ohne mich in diesen Prozess auch selbst einzubringen. Zu den Voraussetzungen des Friedens zwischen den Staaten gehört auch die Schaffung einer gerechten Weltordnung. Große Wohlstandsdifferenzen zwischen den Staaten sind eine ständige Gefahr für den Frieden. Entwicklungspolitik, humanitäre Hilfe und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen16 sind daher wesentlicher Bestandteil einer humanistischen Friedenspolitik. Der Humanismus ist schon immer ein Projekt der Erziehung gewesen. Die Friedenspädagogik, wie sie sich in Europa und den USA seit Beginn des 19. Jh. entwickelt hat, zielte von Anfang an auf die Abschaffung des Krieges als sozialer Institution, aber auch auf die Schaffung einer konfliktarmen, also demokratischen und gerechten sozialen Ordnung ab (Wintersteiner 2011). Das hierfür nötige Wissen und die hierfür nötigen sozialen Kompetenzen sollen vermittelt werden. Die Friedenspädagogik nach 1945 war dabei schon immer international orientiert. Vor allem seit den 1990er Jahren wird auch verstärkt die kulturelle Prägung in den Blick genommen und die Auflösung „agonaler Kulturen” (Wintersteiner 1999, S. 369) angestrebt. Wintersteiner hat in Anlehnung an Levinas eine Pädagogik, die sich am Umgang mit und am Respekt vor den Anderen orientiert, als eine Pädagogik des Friedens bezeichnet (Wintersteiner 1999). Die Friedenspädagogik hat auch auf den normalen Unterricht ausgestrahlt. So änderte sich das im Sozialkundeunterricht vermittelte Weltbild in den 70er Jahren. Die ethnozentrische Darstellung der Welt in konzentrischen, um das eigene Land herum angeordneten Kreisen wurde zugunsten einer die eigene Stellung in die globalen Zusammenhänge einbettenden Position aufgegeben. Hierbei wurde auch die eigene Verantwortung bei der Entstehung und Eskalation von Konflikten dargestellt (Hamburger 2015). Im Zuge der erneuten Militarisierung der deutschen Außenpolitik zeigt sich, dass diese realistische und friedensorientierte Position in den Schulbüchern wieder aufgegeben und zu Freund-Feind-Mustern zurückgekehrt wird (ebd.). Selbst in einer idealen Gesellschaft mit idealen Menschen würde es Konflikte geben. Kommt es zur Eskalation von Konflikten, so müssen diese mit zivilen Mitteln bearbeitet werden. Eine pazifistische Position verzichtet nicht auf den politischen Kampf. Sie verzichtet in der Regel (zu den Ausnahmen s. u.) nur auf physische Gewalt als Mittel des politischen Kampfs (vgl. Flechtheim 1987, S. 249ff.). Sofern Widerstand gegen eine ungerechte soziale Ordnung, gegen eine gewaltsame Unterdrückung notwendig ist, sind zivile Formen des Widerstandes immer vorrangig.17 Ziviler Ungehorsam, Boykott, politischer Streik, Kooperationsverweigerung sind Formen des politischen Engagements, die über die legalen Möglichkeiten im Zweifel hinausgehen (grundlegend Ebert 1982). Eine politische Ordnung, die ihre Bürger solche Handlungsformen lehrt, wird sich ihrer Unvollkommenheit und Vorläufigkeit bewusst sein, denn solche Formen des zivilen Widerstandes können immer auch gegen die eigene Ordnung eingesetzt werden. Aber nur eine Gesellschaft, die ihre Bürger darin schult, ihre Interesse mit zivilen Mitteln durchzusetzen, schafft mündige und politisch handlungsfähige Bürger. Auch Methoden sozialer Verteidigung sind zu entwickeln und einzuüben. Dabei ist klar, dass ziviler Widerstand und soziale Verteidigung keine Wundermittel sind, sondern mit erheblichen Risiken behaftet sind (vgl. Frei 1983). Dies gilt für gewaltförmige, militärische Aktionen aber auch und ist daher kein grundsätzliches Gegenargument. Im Außenverhältnis sind Friedensmissionen und humanitäre Hilfe vorrangig vor militärischen Missionen. Die Zivile Konfliktbearbeitung hat sich vor allem in den letzten zwanzig Jahren als ein wichtiges Tätigkeitsfeld in der internationalen Politik entwickelt. Hier gab es eine Vielzahl von 16 Die Zerstörung der Umwelt führt zunehmend mehr zu militärischen Konflikten (vgl. Welzer 2008). Auch die Fluchtbewegung aus Syrien ist durch die dort aufgrund der Klimakatastrophe seit Jahren herrschende Dürre mitverursacht. 17 Die Probleme der Rechtfertigung solcher Formen des zivilen Widerstandes, die häufig mit Gesetzesverstößen einhergehen, werden hier ausgeklammert (vgl. Laker 1986). 11 Projekten, die unter anderem dann erfolgreich waren, wenn das Gewaltniveau des Konfliktes noch nicht besonders hoch war (vgl. Schweizer 2009, Müller/Schweitzer 2011). Gewaltfreie Methoden der Friedensstiftung, Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung sind, in Anlehnung an von Galtung schon früher entwickelte Konzepte, ausgebaut worden (vgl. Schweitzer 2009). Zentral ist dabei die Beachtung der Autonomie der Akteure vor Ort. Konflikte können nicht von außen gelöst werden. Nicht zuletzt gehört der Abbau der Rüstungsindustrie und ihrer Lobbystrukturen zum humanistischen Programm der Schaffung einer friedlichen Welt. An Rüstung und Militär wird viel Geld verdient. Es gibt daher starke Interessen der Kriegsprofiteure an der Erhaltung und dem Ausbau von Militär und Krieg. Diese militärisch-industriellen Strukturen müssen abgeschafft werden, um eine friedliche Welt zu schaffen. Ist ein hochgerüsteter militärischer Apparat vorhanden, so besteht so etwas wie ein Zwang des Faktischen, diesen teuren Apparat zur Durchsetzung eigener Interessen auch zu nutzen. Hinzu kommt die Illusion, dass der Stärkere mit Gewalt Konflikte lösen könne. Leider ist die Welt nicht immer und nicht überall friedlich. Humanisten stellen sich der Tatsache, dass von Menschen Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird. Ohne Zweifel hat jemand, der der Gewalt ausgesetzt ist, das Recht, sich mit Gewalt gegen die Gewalt zu wehren, wenn anders Widerstand nicht möglich ist (Flechtheim 1987, 250f.). In extremen Lagen kann es zu dem Dilemma kommen, dass der Verzicht auf Gewalt zum weiteren Anstieg der Gewalt führt (vgl. Krell 1994). Ein humanistischer Pazifismus muss sich diesem Dilemma stellen. Er lehnt den Einsatz von Gewalt nicht um jeden Preis ab. Es kann Situationen geben, in denen es geboten ist, Gewalt einzusetzen, um andere vor Gewalt zu schützen (vgl. Schulz-Hageleit 1999). Die Opfer von Gewalt müssen geschützt werden, in extremen Situationen auch mit Mitteln, die ihrerseits wieder Gewaltopfer verursachen. Ein solcher „Verantwortungspazifismus” (Schweitzer 2000, S. 56ff) ist auch bereit im Notfall aus humanitären Gründen militärisch zu intervenieren (vgl. Heinrichs 2016). Für den Einsatz von Gewalt sind enge Voraussetzungen vorab festzulegen. Der Einsatz militärischer Gewalt ist immer die Ultima Ratio. Er kann daher nur dann gerechtfertigt sein, wenn vorher alle Mittel friedlicher Friedensstiftung ohne Erfolg eingesetzt wurden. „Die dauernde kritische Überprüfung jedweder Gewaltanwendung ist unabdingbar” (Flechtheim 1987, S. 252). Es muss eine Perspektive für das Ende des Einsatzes militärischer Gewalt und für eine neuen Friedensstatus geben. Ohne realistische Erfolgsaussichten darf keine militärische Intervention begonnen werden. Die Effizienz der Mittel ist zwingen erforderlich, um den Gewalteinsatz zu rechtfertigen. Der Einsatz von Gewalt darf keine Strafaktion sein, sondern er muss ausschließlich erfolgen, um die Situation der Opfer vor Ort zu verbessern. Ist dies nicht möglich, so ist Gewalt keine Option. Es gehört auch zu einer humanistischen Position, sich einzugestehen, dass man häufig nicht helfen kann und ohnmächtig zusehen muss. Eine militärische Intervention aus humanitären Gründen darf ausschließlich nur durch die UN und im Rahmen des Völkerrechts stattfinden. Für völkerrechtswidrige Kriege gibt es keine Rechtfertigung. Die wichtige, friedensstiftende Funktion der UN und des Völkerrechts darf nicht gefährdet werden. Eine Selbstermächtigung einzelner Staaten zur Führung „gerechter” Kriege kann es nicht geben. Das entscheidende Problem ist, wie „Menschen vor massiver innerstaatlicher Gewalt geschützt werden können, ohne dass damit die tragenden Pfeiler des UN-Friedenssystems, nämlich das Interventionsund Gewaltverbot, geschwächt werden” (Brock 2013, S. 214). Das primäre Motiv der militärischen Intervention aus humanitären Gründen muss die Sicherung des Friedens sein. Eine humanitäre Intervention kann nur im Rahmen der „Responsibility to Protect” erfolgen. Diese wurde von der UN mit der Resolution 60/1 anerkannt. Die Responsibility to Protect ist auf vier internationale Straftatbestände beschränkt: Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vorrangig ist dabei zunächst die eigene Pflicht des Staates, seine Bürger zu schützen. Erst wenn er dies nicht mehr tut oder kann, darf die internationale Gemeinschaft eingreifen. Ist die militärische Intervention abgeschlossen und ein Friedenszustand wiederhergestellt, so müssen 12 die intervenierenden Staaten sich am Wiederaufbau der zivilen Gesellschaft beteiligen und Unterstützung zur dauerhaften Beseitigung der Kriegsursachen leisten. Ausblicke Das Bild vom Frieden und vom Krieg ändert sich seit dem Ende des klassischen Ost-West-Konflikts wieder. Während Gustav Heinemann 1970 auf der Gründungsversammlung der Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung noch anmahnte, nationale Legenden, die ein Freund-Feind-denken erzeugen, zu tilgen (Wette 1990, S. 245f.), werden heute z.B. mit „dem Islam” wieder neue Feindbilder gebildet. Der Krieg gehört heute wieder zum politischen Repertoire der europäischen Staaten (Münkler 2002). In den derzeit bestehenden asymmetrischen Konflikten sind die Kosten für die überlegenen Staaten kalkulierbar. Gerechtfertigt werden Kriege heute so gut wie immer mit humanitären Argumenten. Es gelte die Durchsetzung der Menschenrechte in dem angegriffenen Staat zu sichern, die unterdrückte, „gute” Opposition zu unterstützen oder die Opfer einer Diktatur zu befreien. Häufig liegt einer militärischen Intervention aus humanitären Motiven ein Bündel unterschiedlicher Motive zugrunde. Neben dem humanitären Motiv, in einer Extremsituation helfen zu wollen, gehören hierzu immer auch machtpolitische Motive der intervenierenden Staaten. Humanitäre Motive verkaufen sich derzeit jedoch innenpolitisch am besten. Mit ihnen kann man Zustimmung organisieren. Vielfach werden humanitäre Argumente daher heute heuchlerisch zur Rechtfertigung von Kriegen, die aus ganz anderen Motiven geführt werden, verwendet. Es ist zu befürchten, dass diese weiter zunehmen wird. Dies entwertet jede tatsächlich humanistische Position. Hier gilt es der staatlichen, inzwischen durch professionelle Werbeagenturen geführten Propaganda (Riewe 2015) entgegenzutreten und die tatsächliche Situation und die tatsächlichen Kriegsgründe aufzuweisen. Humanismus war schon immer auch Aufklärung. Aufklärung über die Gründe, aus denen heute wieder Kriege geführt werden, tut not. Eine humanitäre Friedenspolitik verlangt letztlich eine andere Welt. Sie ist nur im Rahmen eines Projekts der Humanisierung der Welt möglich. Neben den zunehmenden militärischen Interventionen zählen zu den Herausforderungen der Zukunft die Verhinderung eines neuen „kalten Krieges” zwischen der USA und Russland, aber auch China, die zunehmende Zahl der Kriegs- und Armutsflüchtlinge, die Integration der Migranten, die Herstellung stabiler politischer Verhältnisse im arabischen Raum und in Afrika unter Anerkennung der kulturellen Autonomie dieser Regionen und die Roboterisierung 18 des Krieges. Hier wird auch der Humanismus Antworten finden müssen. 18 Vollautomatische Drohnen, die autonom, ohne menschliche Steuerung agieren können, werden in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Andere Waffensysteme werden folgen. 13 Literaturverzeichnis Adorno, Theodor W. 1992: Negative Dialektik, Frankfurt a. M. Beyer, Wolfram 2012: Pazifismus und Antimilitarismus. Eine Einführung in die Ideengeschichte, Stuttgart. Ders. 2000: Kriegsdienstverweigerung zwischen Pazisfismus und Antimilitarismus, in: Beyer W. (Hrsg.), Kriegsdienste verweigern. Pazifismus heute, Berlin, S. 20-30. Brock, Lothar 2013: Der internationale Schutz von Menschen vor innerstaatlicher Gewalt. Dilemmata der Resposibility to Protect, in: Busche, H./Schube, D. (Hrsg.), Die humanitäre Intervention in der ethischen Beurteilung, Tübingen, S. 213-238. Cancik, Hubert/Cancik-Lindemaier, Hildegard 2014: Humanismus – ein offenes System, Aschaffenburg. Derrida, Jacques 1991: Gesetzeskraft, Frankfurt/M. Dietze, Anita/Diezte, Walter 1898: Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800, Leipzig und Weimar. Ebert, Theodor 1982: Soziale Verteidigung, Waldkirch. Embser, Johann Valentin 1779: Die Abgötterei unsers [sic!] philosophischen Jahrhunderts. Erster Abgott. Ewiger Friede, Mannheim. Flechtheim, Ossip K. 1987: Ist die Zukunft noch zu retten? Hamburg. Förster, Stig 1999: Militär und Militarismus im deutschen Kaiserreich – Versuch einer differenzierten Betrachtung, in: Wette, W. (Hrsg.), Militarismus in Deutschland 1871-1945. Zeitgenössische Analysen und Kritik, Münster, S. 63-80. Frei, Daniel 1983: Friedenssicherung durch Gewaltverzicht? Eine kritische Prüfung alternativer Verteidigungskonzepte, Berlin. Galtung, Johan 2008: Searching for peace in a world of terrorism and state terrorism; in: Chib, S./Schoenbaum, T. J. (Hrsg.) 2008: Peace Movements and Pacifism after September 11, Cheltenham, Northampton, S. 32-48. Ders. 1990: Culturelle Violence, in: Journal of Peace Research, Vol. 27, S. 291-305. Ders. 1975: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens und Konfliktforschung 1, Reinbek b.H. Geis, Anna/Wolff, Jonas 2011: Demokratie, Frieden und Krieg: Der „demokratische Frieden” in der deutschsprachigen Friedensforschung, in: Schlotter, P./Wisotzki, S. (Hrsg.), Friedens und Konfliktforschung, Baden-Baden, S. 112-138. Giustiniani, Vito R. 1985: Homo, Humanus, and the Meaning of Humanist, in: Journal of the History of Ideas 46, S. 167-195. Groschopp, Horst 2013: Der ganze Mensch. Die DDR und der Humanismus – Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte, Marburg. Große, Horst 1964: Praktizierter Humanismus im XX. Jahrhundert. Durch optimistisch-ethische Weltanschauung zur Völkerverständigung und zum Frieden auf Erden, München. Hager, Kurt 1985: Unser humanistischer Auftrag, in: VI. Philosophiekongress, S. 106-118. Hahn, Erich 1985: Sozialistischer Humanismus und Frieden. Individuum und Gesellschaft bei der Gestaltung des entwickelten Sozialismus, in: VI. Philosophiekongress, S. 5-45. Hamburger, Franz 2015: Einübung des hegemonialen Habitus, in: Bauer, R. (Hrsg.), Kriege im 21. Jahrhundert, Annweiler. Heinrichs, Thomas 2016: Der gehorchende Soldat, in: Schöppner, R. (Hrsg.), Jahrbuch der HAD, Aschaffenburg (erscheint Anfang 2016). Ders., 2012: Prinzipien sozialer Güterverteilung. Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Humanität; in: Groschopp, H. (Hrsg.), Humanistik. Beiträge zum Humanismus, Aschaffenburg, S. 197-222. Ders., 2002: Freiheit und Gerechtigkeit. Philosophieren für eine neue linke Politik, Münster. Henrich, Dieter 1990: Ethik zum nuklearen Frieden, Frankfurt/M. Holl, Karl 1988: Pazifismus in Deutschland, Frankfurt/M. Imbusch, Peter / Zoll, Ralf (Hrsg.) 2006: Friedens- und Konfliktforschung: Eine Einführung, Wiesbaden. Jahn, Egbert 2012: Frieden und Konflikt, Wiesbaden. 14 Janssen, Wilhelm 1982: Stichwort „Krieg”, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart, Bd. 4, S. 567615. Jünger, Ernst 1930: Krieg und Krieger, in: Ders. Krieg und Krieger, Berlin, S. 51-68. Kant, Immanuel 1984: Zum ewigen Frieden, Stuttgart. Klein, Matthäus 1968: Frieden. Humanismus. Gesellschaftlicher Fortschritt, in: Friedensrat der DDR (Hrsg.), Frieden. Humanismus. Gesellschaftlicher Fortschritt, Karl-Marx-Stadt, S. 10-37. Krell, Gert 1994: Wie der Gewalt widerstehen? Die Frage legitimer Gegengewalt als ethisches und politisches Problem, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 24, S. 29-36. Kunisch, Johannes/Münkler, Herfried 1999: Die Wiedergeburt des Krieges aus dem Geist der Revolution. Studien zum bellizistischen Diskurs des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, Berlin. Laker, Thomas 1986: Ziviler Ungehorsam. Geschichte – Begriff – Rechtfertigung, Baden-Baden. Levinas, Emmanuel 1996: Schwierige Freiheit, Frankfurt/M. Levinas, Emmanuel 1989: Humanismus des anderen Menschen, Hamburg. Meyer, Bertold 2011: Konfliktregelung im onterethnischen und interkulturellen Bereich, in: Ders. Konfliktregelung und Friedensstrategien, Wiesbaden. Müller, Barbara/Schweitzer, Christine 2011: Gewaltfreiheit als Dritter Weg zwischen Konfliktvermeidung und gewaltsamer Konfliktaustragung, in: Meyer, B. (Hrsg.), Konfliktregelung und Friedensstrategien, Wiesbaden, S. 101-124. Münkler, Herfried 2002: Die neuen Kriege, Reinbek b.H. Riewe, Helmut 2015: Verschwörung gegen den Frieden. Medien als Kriegspartei, in: Bauer, R. (Hrsg.), Kriege im 21. Jahrhundert: Neue Herausforderungen der Friedensbewegung, Annweiler. Rupprecht, Frank 1985: Humanismus und Friedenskampf, in: VI. Philosophiekongress, S. 52-57. Rüsen, Jörn / Laass, Henner (Hrsg.) 2009: Interkultureller Humanismus. Schwalbach/Ts. Schulz-Hageleit, Peter 1999: Lebensstrom und Rationalität, Zeitschrift humanismus aktuell, Sonderheft 1, Hrsg. von der Humanistischen Akademie Berlin. Schweitzer, Christine 2009: Erfolgreich gewaltfrei. Professionelle Praxis in ziviler Friedensförderung, Stuttgart. Dies. 2000: Was heißt Kriegsdienst verweigern heute? in: Beyer, W. (Hrsg.), Kriegsdienste verweigern. Pazifismus heute, Berlin, S. 50-59. Senghaas, Dieter 1974: Gewalt – Konflikt – Frieden. Essays zur Friedensforschung, Hamburg. VI. Philosophiekongress der DDR 1985: Sozialismus und Frieden. Humanismus in den Kämpfen unserer Zeit, Berlin. Wasmuht, Ulrike C. 1998: Geschichte der deutschen Friedensforschung. Entwicklung – Selbstverständnis – Politischer Kontext, Münster. Weingardt, Markus 2011: Frieden und Religion, in: Geißmann, H. J./Rinke, B. (Hrsg.), Handbuch Frieden, Wiesbaden. Welzer, Harald 2008: Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, Frankfurt/M. Werkner, Ines-Jacqueline/Kronfeld-Goharani, Ulrike (Hrsg.) 2011: Der ambivalente Frieden. Die Friedensforschung vor neuen Herausforderungen, Wiesbaden. Wette, Wolfram 1991: Militarismus und Pazifismus. Auseinandersetzung mit den deutschen Kriegen, Bremen. Wintersteiner, Werner 2011: Von der „internationalen Verständigung” zur „Erziehung für eine Kultur des Friendes”. Etappen und Diskurse der Friedenspädagogik seit 1945, in: Schlotter, P/Wisotzki, S. (Hrsg.), Friedens- und Konfliktforschung, Baden-Baden, S. 345-380. Ders. 1999: Pädagogik des Anderen. Bausteine für eine Friedenspädagogik der Postmoderne, Münster. Wolf, Frieder Otto 2011a: Retraktationen zu Libyen, in Online-Zeitschrift humanismus aktuell, Heft 2/2011. Ders. 2001b: Humanismus und Pazifismus in Zeiten des Krieges – der Fall Libyen, in: OnlineZeitschrift humanismus aktuell, Heft 1/2011. 15