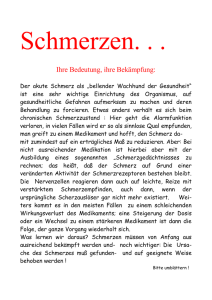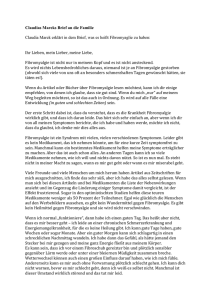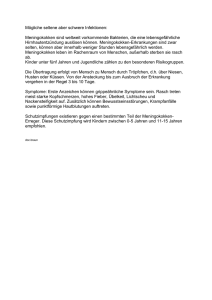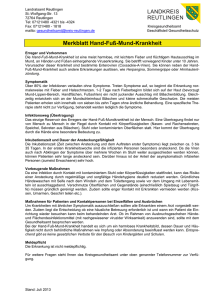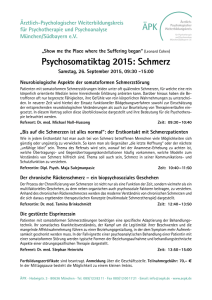„Der betäubte Schmerz“ Sucht als Überlebens
Werbung

Originalarbeit S. 19 - 21 „Der betäubte Schmerz“ Sucht als Überlebens-Strategie Wolfgang Ghedina (1), Patricia Oleksy (2) (1) Psychiatrisches Krankenhaus des Landes Tirol, Hall in Tirol (2) UMIT, Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, Hall in Tirol Zusammenfassung Die möglichen Folgen von „süchtigem" Verhalten, also jenseits von genussvollem, sind jedem bekannt. In diesem Beitrag werden einige weitere Aspekte beleuchtet, weshalb Substanzmittelkonsum, -missbrauch und schließlich -abhängigkeit nicht nur problematisch sind, sondern auch eine überlebenserhaltende Strategie darstellen können. Weiters soll Suchtverhalten auch als identitätsstiftende Reaktion auf innere Leere, Haltlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Traumatisierung eines Individuums ebenso wie einer größeren Population verstanden werden. Sucht als Überlebensstrategie könnte also bedeuten, dass manche Menschen durch Konsumieren legaler oder illegaler Drogen unaushaltbare emotionale Zustände abwenden können und Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren versuchen. Schmerzhafte biographische Erfahrungen und Traumatisierungen werden „betäubt“, sodass unbewusste (abgewehrte) und bewusste Affekte, Kognitionen, Erinnerungen und unkontrollierbare quälende Impulse eher ertragen werden können. Sucht ist somit überlebens-sichernder Lebensstil, Bewältigungsmechanismus oder Coping-Strategie geworden und im Sinne eines Kompromisses als Symptombildung zur Stabilisierung zu sehen. Schlüsselwörter Symptome, Kompensation, Copingmechanismen, Sucht Einleitung Symptome im Sinne von Krankheitszeichen werden in der westlichen Medizin und Psychologie oftmals als „defizitäre“ Erscheinungen sowie „Defekte“ gesehen. So zeigt etwa ein schmerzhafter Zahn einen Substanzdefekt an. Der Schmerz kann als Warnsignal interpretiert werden, welcher zu medizinischen Handlungen leitet, die den erkrankten Zahn vor weiterem Schaden bewahren sollen. Das Symptom Schmerz signalisiert drohende Gefahr der physischen und psychischen Integrität eines Individuums und stellt somit unverzichtbare Voraussetzung für unbewusste und bewusste Handlungsfolgen, die überlebenssichernde Anpassung an innere oder äußere Stressoren ermöglicht. Schmerz ist in diesem Zusammenhang eine Wiener Zeitschrift für Suchtforschung Ɣ Jg. 31 2008 Ɣ Nr. 1 notwendige und sinnvolle (wenn auch unangenehme) Sinneswahrnehmung. In der Schmerzdefinition der IASP (International Association for the Study of Pain) wird dieses Phänomen folgendermaßen beschrieben (Göbel 1988): „Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder drohender Gewebeschädigung einhergeht…" Daraus wird ersichtlich, dass Symptome (hier Schmerz) als Sinnes- und Gefühlserlebnis Erscheinungen physischer und psychischer Prozesse sein können. Die sensorisch-emotionale Wahrnehmung vermittelt einen drohenden Schaden, einen Reizzustand oder eventuell sogar einen psychodynamischen Konflikt. Über den Sinn der Symptome Bereits in seinen „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ beschreibt Sigmund Freud in einem Kapitel („Der Sinn der Symptome“), dass „das Symptom sinnreich sei und hänge mit dem Erleben des Kranken zusammen“. Freud führt mehrere Beispiele an und formuliert diese Ideen auch in anderen Kapiteln im Zusammenhang mit Träumen oder Fehlleistungen, die er auch als „neurotische Symptome“ bezeichnet. Er weist auf Pierre Janet und Josef Breuer hin, welche beide bereits im auslaufenden 19. Jahrhundert Sinnhaftigkeit und Zusammenhänge zwischen Symptomen und innerseelischen Konflikten vermuteten (Freud 1992/1917). Alfred Adler, Begründer der Individualpsychologie, postulierte nach seiner 1907 erschienenen „Studie über Minderwertigkeit von Organen“, dass „angeborene Konstitutionsanomalien nicht nur als Erscheinungen der Degeneration aufzufassen seien, sondern (…) zu kompensatorischen Leistungen und Überleistungen“ führen. „Diese kompensatorische, seelische Anstrengung geht oft, um die Anspannungen im Leben bewältigen zu können, auf anderen, neuen Wegen (…) und erfüllt so den Zweck, ein gefühltes Defizit zu decken, (…) in der wundervollsten Weise“, meint Adler. In der Neurose sieht Adler den Zweck, das Endziel der Überlegenheit erreichen zu helfen, um Minderwertigkeitsgefühle durch Kompensation und Entwicklung eines entsprechenden Lebensplans auszugleichen (Adler 2001/ 1930). Er geht von der Prämisse aus, dass menschliches Verhalten zielgerichtet ist. Dreikurs meint ganz im Sinne Alfred Adlers, dass „nervöse Störungen“ dann auftreten wenn und dadurch anzeigen dass „man vor Aufgaben steht, denen man sich nicht gewachsen fühlt. Die Symptome, ob sie nun minimal oder intensiv sind, stellen eine Art Sicherung dar.“ (Dreikurs 2005/1933). Symptome sind demnach kompensatorische Kompromissbildungen innerpsychischer Dynamiken um psychische Anspannungen aushaltbar zu machen. Das Symp19 Wiener Zeitschrift für Suchtforschung Ɣ Jg. 31 2008 Ɣ Nr. 1 tom wird dadurch auch Ausdruck einer versuchten Problembewältigung. Es spiegelt gleichzeitig einen Konflikt wider wie einen möglichen Lösungsversuch. Auch jenseits der Psychoanalyse findet die Idee der Sinnhaftigkeit von Symptomen in der Literatur Eingang. So schreibt Daniel Hell in einem seiner Bücher („Welchen Sinn macht Depression?“) über die bindungsverstärkende Komponente der Depression. Hell führt aus, dass eheliche Beziehungen Stabilisierung erfahren durch negative Rückkoppelungen in der Depression. Die depressive Kommunikationsweise führe zu einem „Herunterschaukeln der Beziehungsdynamik, was das Zerreißen der beiderseitigen Bindung erschwert“ (Hell 2002). Freud schreibt „das Symptom sei sinnreich und hänge mit dem Erleben des Kranken zusammen“ und betont damit die Subjektivität des Erlebens des Kranken. Das Symptom könnte demnach geradezu als individuelle Anpassung an biographische, persönliche Erfahrungen eines krankgewordenen Menschen erscheinen. Oleksy konnte an Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigen wie konstruktive (oftmals auch unbewusste) Motivationen selbstschädigender Handlungen neben destruktiven Komponenten koexistieren (Oleksy 2007). Sie konnte in Anlehnung an Sachsse (2002) mittels Patienteninterviews darstellen, dass viele betroffene Borderline-Patienten durch Handlungen wie Schneiden, Ritzen oder Brennen ihren emotionalen Zustand verbessern und Stabilisieren konnten. Manche berichteten sogar über lebenserhaltende Distanzierung von Suizidalität durch selbstverletzende Verhaltensweisen. Objektpsychologischen Modellen entsprechend entsteht bei Alkoholikern mit Kontrollverlust und vielen Heroinabhängigen ein (auto)destruktiver Prozess, bei welchem ein „malignes introjiziertes frühes Objekt“ vergiftet und vernichtet werden soll. Süchtige Menschen mit Traumaerfahrungen versuchen demnach ihre emotionalen Schmerzen zu bewältigen. Dieser „Selbstheilungscharakter“ süchtigen Verhaltens findet sich auch in Ich-psychologischen Modellen wieder, wonach strukturell geschwächte Ich-Anteile durch die Wirkung von Drogen kompensiert werden sollen (Rost 1987). Viele Süchtige scheinen ihren Emotionen ausgeliefert zu sein, sodass relativ undifferenzierte Affekte und Wahrnehmungen mittels Drogen betäubt werden müssen. Die Reiz- und Spannungsreduktion stabilisiert in Krisen und schützt vor emotionaler Überflutung. Gerhard spricht in diesem Zusammenhang von der Entwicklung einer „Scheinidentität“ und Verlust des Realitätsbezugs. Die zunächst sinnhafte Kompensation und Abwehr von unbewältigbaren emotionalen Erfahrungen und Erinnerungen gerät damit auch an ihre Grenzen. Die Erhöhung aus der traumatischen und bedrückenden Erniedrigung, das vorübergehende Gefühl des Lebendigseins und die Grandiositätsphantasien (Kohut 1976) durch Drogenwirkung brechen früher oder später zusammen. Durch Abwehr traumatischer Erlebnisse entsteht oft innere Leere, ein Gefühl der Sinnlosigkeit der eigenen Existenz und Perspektivlosigkeit. Durch „Einfuhr, Aufnahme und Wirkung“ von Drogen wird Leben suggeriert. Sucht als Symptom und die Droge als Selbstheilungsversuch Scheidt (1976) meint dazu: „Der Drogenkonsument strebt danach, ein falsches Selbst über den Rausch aufzulösen (…) um endlich (…) an das wahre Selbst zu gelangen.“ Insbesondere frühe traumatische Erfahrungen in den ersten und somit prägenden Lebensjahren können zu späteren psychischen Störungen führen. Sogenannte frühe interpersonale Traumatisierungen wie kindliche körperliche Misshandlung oder sexualisierte Gewalt und mangelhafte Versorgung durch Bezugspersonen sind in der Literatur als Risikofaktoren für Substanzmissbrauch in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter identifiziert worden (Kaplan et al. 1999). Es kann in der Folge zu Bindungsstörungen, Problemen des Selbstwerts und der Identität kommen, weiters auch zu dysfunktionalem Coping und schließlich zur Störung der Affektregulation (Schäfer et al. 2006). Laut Schäfer ist die psychiatrische Komorbidität bei Suchtpatienten mit Traumatisierungen auffallend. Die erhöhten Prävalenzraten finden sich bei der Posttraumatischen Belastungsstörung, der BorderlinePersönlichkeitsstörung, bei Angsterkrankungen und Depressionen. Süchtiges Verhalten kann bei traumatischer Erfahrung überlebenssichernder Lebensstil, Bewältigungsmechanismus oder Coping-Strategie sein und als Symptombildung zur Stabilisierung gesehen werden. Sowohl für Betroffene als auch für behandelnde Therapeuten gilt es aber die Suche nach dem wahren Selbst zu ermöglichen indem die Sucht nicht mehr nur als Störung sondern auch als vorübergehende Form der Bewältigung gesehen wird. Neue gesündere Alternativen werden erkennbar wenn die Sucht als „sinnhafte“ Reaktion auf psychische Verletzung verstanden wird und somit nicht mehr im Zentrum des therapeutischen Interesses steht. In seinem Beitrag „zur Psychoanalyse der Sucht“ beschreibt Gerhard, dass Substanzmissbrauch und Sucht Symptome eines abgewehrten Konflikts darstellen können (Gerhard 2003). Einem inneren Zwang folgend müssen Stoffe aufgenommen werden. Bei schwachem Selbstwertgefühl und Gewöhnungseffekten verliert der Betroffene zunehmend die Kontrolle über seinen Konsum. 20 Summary Everybody knows about the possible consequences of addictive conduct; meaning behavior that goes beyond delightful experience. Some other aspects why the consumption of, abuse of and finally addiction to substances are not just problematic but can also be a strategy of survival are shown in this article. Addiction should also be seen as a means of finding identity – a reaction to inner emptiness, uninhibitedness, Wiener Zeitschrift für Suchtforschung Ɣ Jg. 31 2008 Ɣ Nr. 1 hopelessness or traumatization of an individual as well as of a bigger part of population. Addiction as a means of survival could also mean that some people can avoid unbearable emotional conditions and try to compensate a feeling of inferiority through the consumption of legal or illegal drugs. Painful biographical experiences and trauma are „stunned“; it is easier to endure unconscious (refused) and conscious emotions, cognitions, memories, uncontrollable and agonizing impulses. Addiction has turned to a style of life that helps to survive, a mechanism to cope with difficulties, a coping strategy. It must be seen in the broader sense of a compromise, as a formation of symptoms to become stable. Keywords symptom, compensation, coping mechanism, addiction Literatur Adler, A. (2001/1930): Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 48-51 Dreikurs, R. (2005/1933): Grundbegriffe der Individualpsychologie. Stuttgart: Klett-Cotta Freud, S. (1992/1917): Vorlesungen zu Einführung in die Psychoanalyse. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Zwischen Lifestyle und Sucht. Drogengebrauch und Identitätsentwicklung in der Spätmoderne. Gießen: Psychosozial-Verlag Sachsse, U. (2002): Selbstverletzendes Verhalten. Psychodynamik-Psychotherapie. Das Trauma, die Dissoziation und ihre Behandlung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Schäfer, I.; Krausz, M. (2006): Trauma und Sucht. Konzepte – Diagnostik – Behandlung. Leben Lernen Stuttgart: Klett-Cotta Scheidt, J. (1976): Der falsche Weg zum Selbst. Die Drogenkarriere als gescheiterter Versuch der Selbstheilung. In: Gerhard, H. (2003): Zwischen Lifestyle und Sucht. Drogengebrauch und Identitätsentwicklung in der Spätmoderne. Gießen: Psychosozial-Verlag Korrespondenzadressen Dr. med. univ. Wolfgang Ghedina Psychiatrisches Krankenhaus des Landes Tirol, Primariat B, Drogenstation Thurnfeldgasse 14, A-6060 Hall in Tirol E-Mail: [email protected] MMag. Patricia Oleksy UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik Eduard Wallnöfer-Zentrum 1 A-6060 Hall in Tirol Gerhard, H. (2003): Zwischen Lifestyle und Sucht. Drogengebrauch und Identitätsentwicklung in der Spätmoderne. Gießen: Psychosozial-Verlag Göbel, H. (1988): Über die Schwierigkeit einer umfassenden Definition des Phänomens Schmerz. Der Schmerz: Volume 2: 89-93. Berlin, Heidelberg: SpringerVerlag Hell, D. (2002): Welchen Sinn macht Depression? Ein integrativer Ansatz. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 46 Kaplan, S. J. et al. (1999): Child and adolescent abuse and neglect research: A review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 38, 1214-1122 Kohut , H. (1976): Vorwort zu J.v. Scheidt: Der falsche Weg zum Selbst. Die Drogenkarriere als gescheiterter Versuch der Selbstheilung. In: Gerhard, H. (2003): Zwischen Lifestyle und Sucht. Drogengebrauch und Identitätsentwicklung in der Spätmoderne. Gießen: Psychosozial-Verlag Oleksy, P. (2007): „Sinn im Unsinn. Konstruktive Aspekte selbstschädigenden Verhaltens bei Borderline-Patienten“. Diplomarbeit an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Leopold- Franzens-Universität Innsbruck Rost, W. D. (1987): Psychoanalyse des Alkoholismus. Theorie, Diagnostik, Behandlung. In: Gerhard, H. (2003) 21