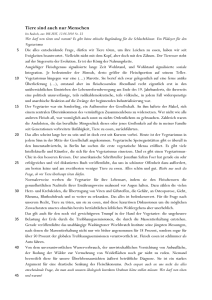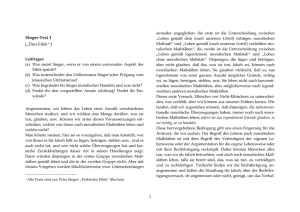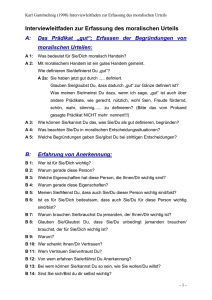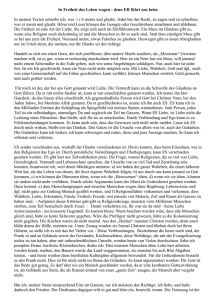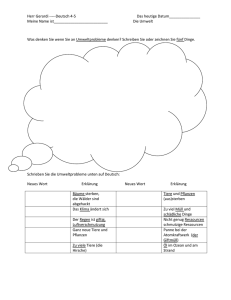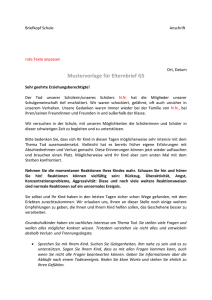Töten, Sterbenlassen und die Mehrdimensionalität
Werbung

Philosophie und/als Wissenschaft Proceedings der GAP.5, Bielefeld 22.–26.09.2003 Töten, Sterbenlassen und die Mehrdimensionalität moralischen Werts Ralf Stoecker Das Problem, mit dem ich mich in meinem Beitrag beschäftige, ist einer der Dauerbrenner der modernen Moralphilosophie: die Frage, inwieweit es für die moralische Bewertung einer Handlung einen Unterschied macht, ob diese Handlung darin besteht, einen Menschen zu töten, oder ob sie darin besteht, ihn sterben zu lassen. Die These, dass der Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen für sich gesehen moralisch wichtig ist, wird gewöhnlich als die Signifikanzthese bezeichnet, die Gegenthese, dass Töten und Sterbenlassen für sich gesehen moralisch gleichwertig seien, als Äquivalenzthese. Die Frage ist also, welche dieser beiden Thesen richtig ist. Auf den ersten Blick scheint das keine allzu schwierige Frage zu sein, denn offenkundig bildet die Signifikanzthese einen zentralen Bestandteil unseres moralischen Denkens, während die Äquivalenzthese absurd falsch klingt. Diese intuitive Überzeugung zeigt sich zumindest in drei Bereichen moralischen Urteilens: Erstens ist es in der medizinischen Ethik eine weltweit verbreitete Praxis, den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen anders zu bewerten als die Tötung von Patienten, und zwar auch dort, wo die ärztliche Tötung nicht unter allen Umständen verboten ist. Weniger offensichtlich, aber für uns alle viel wichtiger, spricht zweitens auch unser moralisches Selbstverständnis für die Signifikanzthese. Wir geben ganz selbstverständlich den größten Teil unseres Geldes für unser Wohlergehen aus, beispielsweise für Philosophiekongresse, obwohl wir es auch einsetzen könnten, Menschen in fremden Ländern vor dem Hungertod oder tödlichen Krankheiten zu retten. Gegeben dass sich niemand von uns berechtigt fühlen würde, einen dieser Menschen zu töten, während wir sie guten Gewissens tatenlos sterben lassen, scheinen unsere moralischen Prinzipien offensichtlich der Signifikanzthese verpflichtet zu sein. Ein dritter Beleg dafür, dass die Signifikanzthese tief in unserem moralischen Denken verwurzelt ist, ist die Feststellung, dass wir auch bei vielen anderen Handlungsweisen moralisch zwischen Bewirken und Geschehenlassen unterscheiden, dass der Glaube an eine ethische Diskrepanz zwischen Töten und Sterbenlassen also wahrscheinlich nur Ausdruck einer generellen Überzeugung ist, dass es aus ethischer Sicht einen Unterschied macht, ob man etwas bewirkt oder ob man es geschehen lässt. Ein Fahrgast in der U-Bahn, der zulässt, dass ein anderer Passagier von einem Skinhead schikaniert wird, fühlt sich vermutlich nicht sehr wohl in seiner Haut, er würde aber sicher die Idee weit von sich weisen, dass er durch sein Geschehenlassen ebenso verwerflich handele wie der aktive Skinhead. Wer die Signifikanzthese bestreitet, stellt also nicht nur unser Verhältnis zum Töten und Sterbenlassen in Frage, sondern auch unsere moralische Haltung zu vielen anderen, ganz alltäglichen Handlungsweisen. Doch trotz dieser anscheinend tiefen Verwurzelung der Signifikanzthese in unserer Praxis moralischer Bewertungen, vertreten viele Philosophinnen und Philosophen gerade in der analytischen Philosophie die Äquivalenzthese.1 Die Gründe für die Äquivalenzthese lassen sich in vier Gruppen unterteilen. Die ersten beiden Gruppen ziehen die Voraussetzung in Zweifel, dass unsere moralischen Intuitionen und Bewertungspraktiken tatsächlich die Signifikanzthese bevorzugen. Erstens gibt es Gedankenexperimente, die belegen sollen, dass die Signifikanzthese doch nicht so intuitiv einleuchtend ist wie es zunächst den Anschein hat. Das prominenteste derartige Gedankenexperiment ist James Rachels Geschichte von Smith, Jones und ihren sechsjährigen Neffen.2 Beide Männer haben von ihren jeweiligen Neffen eine größere Erbschaft zu erwarten, falls diesen etwas zustoßen sollte. Beide schleichen sich deshalb ins Bad, wo ihre Neffen jeweils gerade baden, mit der finsteren Absicht, diese zu ertränken. Nun aber verzweigt sich die Geschichte: Smith setzt seinen Vorsatz in die Tat um und ertränkt seinen Neffen, während Jones voller Freude sieht, wie just in dem Augenblick, in dem er das Bad betritt, der Junge ausrutscht, sich den Kopf anschlägt und mit dem Gesicht nach vorn ins Wasser fällt, so dass Jones bloß neben der Wanne stehen bleiben und das Kind ertrinken lassen muss. Smith hat seinen Neffen getötet, so Rachels, während Jones ihn sterben gelassen hat, trotzdem haben beide durch und durch verwerflich gehandelt. Rachels hält es für intuitiv klar, dass beide Taten gleich verwerflich waren, und er zieht daraus den Schluss, dass es für uns genau genommen doch keinen moralischen Unterschied macht, ob man jemanden tötet oder sterben lässt. Die Argumente der zweiten Gruppe stützen diesen Schluss, indem sie zu zeigen versuchen, dass sich unsere alltäglichen moralischen Urteile, die vermeintlich auf der Signifikanzthese beruhen, in Wirklichkeit auf andere moralisch relevante Eigenschaften der betreffenden Handlungen stützen. Diese eigentlich signifikanten Eigenschaften gehen häufig mit Tötungsakten respektive Akten des Sterbenlassens einher und sorgen somit dafür, dass es in der Regel moralisch weniger anstößig ist, jemanden sterben zu lassen als ihn zu töten. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen für solche, eigentlich signifikante Eigenschaften: 1. Erstens ist es häufig einfacher, jemanden sterben zu lassen, als ihn zu töten. Wie schwierig aber eine Tat ist, spielt zweifellos eine Rolle für ihre moralische Beurteilung. Es ist besonders lobenswert, wenn man das Gute tut, obwohl es Mühe kostet, und entsprechend verwerflich ist es, sich für das Böse auch noch ins Zeug zu legen. Zum Verständnis der unterschiedlichen Bewertungen von Töten und Sterbenlassen trägt dieser Vorschlag allerdings nur wenig bei, denn zum einen ist auch das Töten eines Menschen manchmal kinderleicht. Zum anderen kann der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad nur erklären, wie lobenswert oder verwerflich eine Handlung ist, nicht aber, dass sie es 1 2 Einen guten Überblick gibt die Textsammlung von Bonnie Steinbock und Alastair Norcross, Killing and Letting Die, 2. Aufl. New York 1994. In Deutschland hat Dieter Birnbacher das Thema ausführlich in seinem Buch Tun und Unterlassen, Stuttgart 1995, diskutiert. James Rachels, „Active and Passive Euthanasia“, in: Steinbock, Norcross (Hg.) aaO., deutsch: „Aktive und passive Sterbehilfe“, in: H.-M. Sass (Hg.), Medizin und Ethik, Stuttgart 1989. Vgl. auch Rachels, The End of Life, Oxford 1986, Kap. 7. 596 überhaupt ist, während es für die Signifikanzthese charakteristisch ist, dass sie es unter bestimmten Umständen für zulässig hält, jemanden sterben zu lassen, nicht aber ihn zu töten. 2. Deutlich besser ist der Hinweis, dass Akten des Tötens und Sterbenlassens häufig unterschiedliche Motive zugrunde liegen. Sterbengelassen werden die Menschen in der Regel aus Mitleid, oder aber ganz ohne Grund, unabsichtlich, während die Gründe, aus denen jemand getötet wird, zumeist finster und verbrecherisch sind. Es ist eben kein Zufall, dass die Bösewichte in Krimis viel häufiger töten als sterben lassen. Weil Motive zweifellos eine wichtige Rolle für moralische Bewertungen spielen, kann auch diese Diskrepanz zwischen typischen Akten des Tötens und Sterbenlassens unsere unterschiedliche Haltung diesen Handlungsweisen gegenüber ein Stück weit erklären. Sie aber ganz für die selbstverständliche Attraktivität der Signifikanzthese in Anspruch zu nehmen, würde unserer moralischen Vernunft ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Die Ärzte, die sich weigern, jemanden auf Verlangen zu töten, den sie ohne zögern sterben lassen würden, sind nicht einfach zu dumm, um zwischen guten und bösen Absichten zu unterscheiden. 3. Einleuchtender ist die Annahme, dass die unterschiedliche durchschnittliche Motivlage von Töten und Sterbenlassen dazu führen könnte, dass auch für sich gesehen unbedenkliche Tötungsakte die Gefahr bergen, Grenzen aufzuweichen und so mittelbar illegitime Folgetaten zu provozieren, so dass es sich aus sozialpräventiven Gründen verbiete, jemanden zu töten, selbst wenn es zulässig wäre, ihn sterben zu lassen. Solche externen ethischen Bedenken führen häufig in einen Glaubenskrieg, wie groß die Gefahr eines Dammbruchs oder einer schiefen Bahn tatsächlich ist.3 Jedenfalls zeugen sie aber erneut von wenig Zutrauen in unsere ethische Vernunft. Neben den drei genannten gibt es noch weitere Kandidaten für typischerweise mit Töten bzw. Sterbenlassen verbundene Eigenschaften, die den Anschein moralischer Signifikanz erklären könnten. Allerdings zeigen schon die drei genanten Eigenschaften, dass eine gehörige Portion Naivität nötig wäre, wenn man sich so in den Grundlagen der eigenen ethischen Urteile täuschen würde. Jedenfalls ist es ungleich plausibler, zunächst davon auszugehen, dass die meisten von uns tatsächlich überzeugt sind, dass es einen großen moralischen Unterschied macht, ob wir jemanden töten oder sterben lassen, und zwar auch dann, wenn man von sozialen Nebenfolgen absieht, die Motivationslage die gleiche ist, beide Handlungsweisen den gleichen Aufwand kosten und sie sich zudem auch in allen anderen äußeren Bedingungen gleichen. Wenn die Signifikanzthese überhaupt auf einem Vorurteil beruht, dann jedenfalls auf keinem oberflächlichen, leicht behebbaren. Damit bin ich bei den nächsten beiden Argumentationslinien für die Äquivalenzthese. Sie bestreiten nicht, dass wir intuitiv der Signifikanzthese anhängen, sondern richten sich gegen deren Wahrheit. 3 Einen ausgezeichneten Überblick über diese Debatte gibt Barabara Guckes, Das Argument der schiefen Ebene, Stuttgart 1997. 597 Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass gezeigt wird, dass eine zutreffende Ethik die Äquivalenz von Töten und Sterbenlassen impliziert. Besonders prominent ist ein solcher Schluss aus Sicht konsequentialistischer Ethiken, denn augenscheinlich haben beide Handlungsweisen die gleichen Folgen: den Tod des Opfers. Konsequentialisten müssen folglich Verfechter der Äquivalenzthese sein. Eine moralphilosophische Kritik an der Signifikanzthese kann sich aber auch auf den Grundsatz berufen, dass evaluative Unterschiede stets begründungspflichtig sind, dass es also nicht reicht, die Signifikanzthese einfach zu konstatieren, sondern dass es Gründe dafür geben müsse, warum Tötungshandlungen moralisch anders beurteilt werden sollten als Akte des Sterbenlassens. Ohne stichhaltige ethische Begründung sei die Signifikanzthese nichts weiter als ein moralisches Vorurteil, und sei es noch so eingefleischt. Eine solche Begründung aber, das ist der Vorwurf, gibt es nicht. Dieses Argument ist zunächst metaethisch: keine unterschiedlichen Bewertungen, ohne gute Rechtfertigung. Es lässt sich jedoch moralpraktisch untermauern: In allen Bereichen, in denen die Unterscheidung zwischen Töten und Sterbenlassen eine Rolle spielt, hängt das Schicksal vieler Menschen davon ab, ob wir uns der Signifikanzthese gemäß verhalten oder nicht. Leidende, die gerne sterben wollen, können ihren Arzt nicht bitten, ihr Leben zu beenden. Menschen in der Dritten Welt gehen zugrunde, ohne dass uns unser Gewissen zwingt, ihnen zu helfen. Diese existenziellen Konsequenzen der Signifikanzthese verbieten es, sie einfach als gegeben hinzunehmen. Wenn es einen moralisch wichtigen Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen geben soll, dann muss man ihn benennen. Alle vier Argumentationslinien gegen die Signifikanzthese sind ernst zu nehmen, aber offenkundig spielt die letzte Herausforderung – doch anzugeben, worin der moralisch bedeutsame Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen liegt –, eine besondere Rolle. Erst wenn man sich dieser Herausforderung gestellt hat, ist es sinnvoll, die moraltheoretischen Konsequenzen abzuklopfen oder sich auf ausgeklügelte Gedankenexperimente und knifflige Anwendungen einzulassen. Es ist deshalb mein Ziel im verbleibenden Teil des Vortrags, einen Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen herauszuarbeiten, von dem sich plausibel machen lässt, dass er moralisch signifikant ist, zumindest dann, wenn man ein zu wenig beachtetes Merkmal unserer Commonsense Moral akzeptiert, die im Titel meines Vortrags angesprochene Zweidimensionalität moralischen Werts. Wie gesagt, niemand bestreitet, dass die meisten Tötungen verwerflicher sind als die meisten Akte des Sterbenlassens. Die Frage ist nur, ob dafür akzidentelle, für diese Handlungsweisen allenfalls mehr oder weniger typische Eigenschaften verantwortlich sind, wie zum Beispiel die Handlungsmotive, oder ob es ihnen wesentliche Eigenschaften sind, Eigenschaften, die den Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen nicht nur begleiten, sondern ihn ausmachen. Die Signifikanzthese lässt sich also nur halten, wenn man zeigen kann, dass dasjenige, worin sich Töten und Sterbenlassen unterscheiden, unterschiedliche moralische Urteile rechtfertigt. Wer dies aber zeigen möchte, muss erst einmal erklären, worin überhaupt der Unterschied besteht zwischen Töten und Sterbenlassen. 598 Das ist zunächst nicht schwer: Wer jemanden tötet, bewirkt etwas, nämlich den Tod des Opfers, wer ihn sterben lässt, lässt dagegen diesen Tod geschehen. Es liegt deshalb nahe, wie eben schon erwähnt, dass der moralisch relevante Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen im Unterschied zwischen Bewirken und Geschehenlassen zu finden ist. Warum aber soll es für das moralische Urteil wichtig sein, ob man etwas bewirkt oder geschehen lässt? Eine erste denkbare Antwort lautet: Wer etwas bewirkt, tut etwas, er vollzieht eine Handlung. Wer etwas geschehen lässt, unterlässt hingegen nur etwas, nämlich das Geschehen zu verhindern. Handlungen sind aber dasjenige, wofür man eine Person moralisch verantwortlich macht, also ist es kein Wunder, dass es moralisch bedeutsam ist, ob man jemanden tötet oder sterben lässt. Nur das Töten ist eine Handlung und damit Gegenstand moralischer Urteile. Das ist zweifellos eine mögliche Verteidigung der Signifikanzthese, aber um einen hohen Preis. Wenn nur Handlungen Gegenstand moralischer Urteile sind, es aber keine Handlung ist, etwas geschehen zu lassen, dann ist es moralisch irrelevant, ob man etwas geschehen lässt oder nicht. Ob ich meine Kinder verhungern lasse, ob Terroristen ihre Geiseln unversehrt laufen lassen, das alles ließe sich moralisch nicht bewerten. Niemand kann das ernsthaft vertreten. Ist es aber überhaupt möglich, das Geschehenlassen moralisch zu bewerten, dann fragt es sich sofort, warum das Geschehenlassen nicht den gleichen Wert haben soll, wie ein Bewirken dieses Geschehens, und wir stehen wieder am Anfang. Die Antwort, dass es beim Bewirken eine Handlung gibt, die die Wirkung hervorruft, beim Geschehenlassen nicht, ist aber nicht nur moralphilosophisch extrem unplausibel, sie ist auch handlungstheoretisch problematisch.4 Erstens verträgt sie sich nur schlecht mit der engen Abhängigkeit, die manchmal zwischen Bewirken und Geschehenlassen besteht. Schließlich bewirken wir manchmal etwas, indem wir etwas geschehen lassen. Mein Freund Otto verärgert zum Beispiel den peniblen Nachbarn, indem er das Unkraut auf seinen Beeten ungestört wachsen lässt. Den Nachbarn zu ärgern ist ein Bewirken (Otto verursacht seinen Ärger), das Unkraut wachsen zu lassen, ist hingegen ein Geschehenlassen. Wenn das eine Handlung ist, das andere nicht, Otto den Nachbarn aber ärgert, indem er das Unkraut wachsen lässt, dann schafft er es irgendwie, mit einer Nichthandlung eine Handlung zu vollziehen, was ontologisch zumindest sonderbar klingt. Zweitens passt die Annahme, ein Geschehenlassen sei keine Handlung, nicht dazu, dass wir die ganze Vielfalt handlungstheoretischer Charakterisierungen auch für Akte des Geschehenlassens verwenden. Man kann etwas aus guten Gründen oder grundlos, absichtlich oder versehentlich, aus Schusseligkeit, Zorn oder Willensschwäche geschehen 4 Ich habe mich schon öfter mit den handlungstheoretischen Grundlagen der Unterscheidung zwischen Tun und Geschehenlassen beschäftigt, z.B. in „Tun und Lassen – Überlegungen zur Ontologie menschlichen Handelns“, Erkenntnis 48 (1998), S. 395–413, und in „Agents in Action“, Grazer Philosophische Studien 61 (2001): 21–42. 599 lassen. Nein, der Unterschied zwischen Bewirken und Geschehenlassen ist nicht der zwischen Handeln und Nichthandeln. Ein besserer Ansatz liegt darin, sich ganz von der ontologischen Ebene zu lösen, sich also nicht zu fragen, worin sich ein Bewirken als eine Entität, etwas in der Welt, von einem Geschehenlassen unterscheidet, sondern zu untersuchen, was wir über jemanden sagen, wenn wir behaupten, dass er etwas bewirkt bzw. etwas geschehen lässt. Beginnen wir mit dem Geschehenlassen. Wovon ist die Rede, wenn man sagt, jemand lasse etwas geschehen? Zweifellos von einer Person und außerdem davon, dass etwas geschieht. Wenn Otto das Unkraut im Garten wachsen lässt, dann gibt es Otto und dann wächst das Unkraut. Aber natürlich beschränkt sich die Aussage, er lasse das Unkraut wachsen, nicht darauf, dass es ihn gibt und dass außerdem das Unkraut wächst. Es wird vielmehr ein Zusammenhang hergestellt zwischen Otto und dem Wachstum des Unkrauts, ein Zusammenhang, der nicht gegenüber jedem Geschehen auf der Welt besteht. Auch wenn in der Adria die Algen wachsen, so wäre es doch normalerweise falsch zu behaupten, Otto lasse sie wachsen. Warum sagen wir, Otto lasse das Unkraut sprießen, nicht aber die Mittelmeer-Algen? Ganz einfach: weil es an Otto liegt, dass Unkraut in seinem Garten wächst, während es nicht an ihm liegt, dass dasselbe im Mittelmeer geschieht. Wer etwas geschehen lässt, an dem liegt es, dass dies geschieht. Diese Antwort ist allerdings in zweierlei Hinsicht unbefriedigend. Erstens scheint der Rückgriff auf die Redewendung „es liegt an der Person, dass etwas geschieht“ das Dunkle durch das Finstere zu erklären. Was ist gemeint damit, dass etwas an jemandem liegt? Und zweitens scheint die Erklärung noch viel zu breit zu sein, um das Charakteristische des Geschehenlassens einzufangen, denn schließlich liegt nicht nur das, was jemand geschehen lässt, an ihm, sondern erst recht das, was er bewirkt. Die spezifische Differenz des Geschehenlassens, um die es ja eigentlich gehen soll, scheint unter den Tisch zu fallen. Beginnen wir mit dem erste Einwand: Was kann es heißen, dass es an Otto liegt, dass das Unkraut sprießt? Man kann zunächst versuchen, diese Feststellung kausal zu lesen: Otto ist irgendwie die Ursache dafür, dass das Unkraut sprießt. Doch das stimmt nicht. Das Unkraut in seinem Garten sprießt von alleine, Otto sitzt derweil im Haus und spielt Computer, oder er vergnügt sich auf Mallorca. Er macht nichts mit dem Garten, das ist es ja gerade, was den Nachbarn ärgert, er lässt ihn einfach verwildern. Eine Kausalbeziehung impliziert das Geschehenlassen also nicht. Allerdings hätte er etwas machen können. Otto hätte das Geschehen verhindern können, z.B. indem er das Unkraut gejätet hätte. Liegt es also insofern an ihm, als er es hätte verhindern können? Häufig stimmt es, dass wir dasjenige, was wir geschehen lassen, auch hätten verhindern können. Es gibt allerdings Ausnahmen. Ein Angler kann beispielsweise berichten: Ich konnte den Fisch nicht länger festhalten und musste ihn entwischen lassen. Er hätte es gerne verhindert, aber er konnte es nicht. Vor allem aber gilt, dass es längst nicht immer an uns liegt, wenn etwas geschieht, das wir verhindern könnten, so dass wir all dies auch nicht geschehen lassen. Als ich 600 gestern in meinem Büro saß, bog draußen ein Auto in das Uni-Parkhaus ein. Ich hätte das verhindern können, zum Beispiel wenn ich mich in die Einfahrt gestellt und mit einem Vorschlaghammer gewedelt hätte. Das Auto wäre garantiert am Parkhaus vorbei gefahren, trotzdem kann man nicht sagen, dass es an mir lag, dass es ins Parkhaus gefahren ist oder dass ich es ins Parkhaus fahren gelassen habe, nur weil am Schreibtisch saß, anstatt unten auf der Straße zu randalieren. Schließlich hat niemand erwartet, dass ich mich so verhalten würde. Was hätte ich auch in der Einfahrt zum Parkhaus zu suchen gehabt?! Das aber bedeutet: Jemand, der gerne wissen möchte, warum gerade eben das Auto ins Parkhaus gefahren ist, sollte besser nicht bei mir nach einer Erklärung suchen. Bei Otto ist es anders. Er hat sehr wohl etwas in seinem Garten zu suchen. Es macht diesen Garten gerade zu seinem Garten, dass es wesentlich von ihm abhängt, was dort geschieht. Folglich können wir uns das Geschehen im Garten im Rückgriff auf Otto erklären, sei es aus seinen Absichten (weil er gerne viele Wildkräuter in seinem Garten haben möchte), sei es aus seinen Charaktermerkmalen (er ist ein Chaot) oder aus den äußeren Umständen, in denen er sich befindet (er liegt auf Mallorca im Krankenhaus). Das ist das Charakteristische am Geschehenlassen, das es auch vom Bewirken unterscheidet. Es setzt voraus, dass das Geschehen in einem Bereich stattfindet, für den der Akteur zuständig ist, um den er sich kümmert, der ihm nahe liegt oder für den er verantwortlich ist. Wir alle vereinigen eine Vielfalt solcher Bereiche um uns, die es Dritten erlauben, das, was dort geschieht, im Rückgriff auf uns zu erklären. Wenn man einen weiten Verantwortungsbegriff zugrunde legt, kann man sagen, es sind die Bereiche, für die wir verantwortlich gemacht werden. Zu sagen, dass jemand etwas geschehen lässt, heißt also zu sagen, dass sich das Geschehen im Rückgriff auf ihn erklären lässt, weil es in einem seiner Verantwortungsbereiche liegt. Die Behauptung, jemand bewirke etwas, setzt dagegen keine Verantwortung voraus. Wenn ein Akteur etwas bewirkt, dann ist dieses Geschehen deshalb im Rückgriff auf ihn zu erklären, weil er etwas anderes getan hat, wodurch er das Geschehen bewirkt hat. Man bewirkt etwas, indem man etwas tut, zum Beispiel tötet man jemanden indem man ihn erschießt. Da das, was wir tun, Folgen hat, die wir in unsere Erwägungen einbeziehen können, haben wir die Möglichkeit, Einfluss auf die Welt zu nehmen, auch dort, wo niemand es erwartet oder verlangt. Ganz grob gesprochen liegen dem Geschehenlassen und Bewirken also zwei unterschiedliche Erklärungsmuster zugrunde: Wenn man sagt, ein Akteur habe etwas geschehen lassen, dann beschreibt man das Geschehen als Teil des Verantwortungsbereichs des Akteurs, aus dem heraus es sich erklären lasse. Sagt man dagegen, ein Akteur habe etwas bewirkt, dann beschreibt man das Geschehen als Folge von etwas anderem, was sich im Rückgriff auf den Akteur erklären lasse. Die Frage ist nun, welche moralische Relevanz dieser Unterschied hat. Um das zu beantworten, muss ich zunächst etwas über Verantwortungsbereiche sagen. Verantwortungsbereiche sind normalerweise nicht statisch. Es gibt unterschiedliche Wege, auf denen wir dazu kommen, für einen Bereich besonders verantwortlich zu sein. Der erste 601 ist der zufällige, schicksalhafte. Das beginnt damit, dass wir stets für einen räumlichen Nahbereich um uns herum verantwortlich sind und führt bis hin zu solchen verantwortungsrelevanten Großereignissen wie dem, Kinder zu bekommen. Der zweite Weg ist der, dass uns Verantwortung von außen, von anderen Menschen aufgebürdet wird, z.B. wenn mich jemand bittet, kurz auf seine Tasche aufzupassen, oder wenn man als Schöffe verpflichtet wird, in einem Strafprozess mitzuwirken. Der dritte Weg aber besteht darin, den Bereich der individuellen Verantwortung durch eigenes Verhalten zu beeinflussen. Das geschieht manchmal explizit, etwa wenn man ein Amt übernimmt oder abgibt. Häufig geschieht es aber implizit, dadurch dass man sich auf eine Weise verhält, dass andere davon ausgehen und erwarten, dass man das, was in einem bestimmten Bereich geschieht, zu seiner Sache macht (oder indem man sich so verhält, dass sie erwarten, dass man es gerade nicht zu seiner Sache macht). Kurz, man mischt sich ein oder man hält sich heraus. Dass wir uns mit unserem Verhalten häufig entweder einmischen oder heraushalten können, ist ein wesentliches Instrument des Finetunig unserer Verantwortungsbereiche. Die Möglichkeit, unsere Verantwortungsbereiche durch unsere Handlungen aktiv zu gestalten, hat eine wichtige Folge für deren moralische Bewertungen: ihre im Titel meines Vortrags angesprochene Zweidimensionalität. Inwiefern jemand Verantwortung übernimmt ist selbst wieder Gegenstand moralischer Beurteilungen. (Gewöhnlich ist es lobenswert, Verantwortung zu übernehmen, und tadelnswert, sie zu scheuen.) Also sollte man eine Handlung nicht nur danach bewerten, inwieweit sie den moralischen Verpflichtungen des Handelnden gerecht wird (1. Dimension), sondern auch danach, inwieweit sie zugleich die Grenzen seiner Verantwortlichkeit verschiebt (2. Dimension). Aber nicht alle Handlungen sind gleichermaßen dazu geeignet, den persönlichen Verantwortungsbereich zu modifizieren. Was man geschehen lässt ist stets bereits ein Teil dieses Verantwortungsbereichs und insofern keine Einmischung. Einmischen kann man sich nur dadurch, dass die Folgen des eigenen Tuns die Grenzen des ohnehin Verantworteten überschreiten, zum Beispiel indem man sich in das Leben eines Menschen einmischt und ihn umbringt. Dieser Unterschied zwischen Bewirken und Geschehenlassen spiegelt sich in der Art ihrer moralischen Bewertung: Wer etwas geschehen lässt, ist nur danach zu bewerten, ob er seinen moralischen Verpflichtungen nachkommt, wer etwas bewirkt, lässt sich auch noch danach bewerten, wie er seinen individuellen Verantwortungsbereich gestaltet. In dieser zweiten evaluativen Dimension liegt der moralisch relevante Unterschied zwischen Bewirken und Geschehenlassen allgemein und also auch zwischen Töten und Sterbenlassen. Der Fehler der Äquivalenzthese lag darin, diese Dimension übersehen und zu eindimensional gedacht zu haben. Es gibt also einen nicht bloß akzidentellen, sondern notwendigerweise bestehenden moralisch signifikanten Unterschied zwischen Töten und Sterbenlassen, der potentiell zu unterschiedlichen Bewertungen einzelner Handlungsweisen führen kann. Ob er tatsächlich dazu führt, das Töten generell als viel verwerflicher anzusehen als das Sterben- 602 lassen, hängt davon ab, wie man es beurteilt, wenn jemand bewusst die Verantwortung für das Leben eines Menschen übernimmt, um es dann zu beenden.5 5 Ich habe frühere Versionen dieses Textes außer bei GAP IV auch am ZEWW Hannover, sowie an den Philosophischen Instituten von Graz und Salzburg vorgetragen. Den Organisatoren und Diskutanten danke ich herzlich für ihre kritischen Anregungen. Besonders danken möchte ich Jens Kulenkampff für seine vielfältige inhaltliche Unterstützung. 603