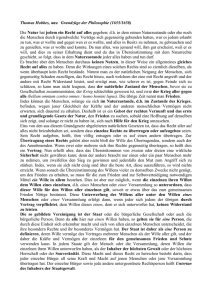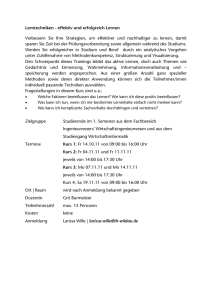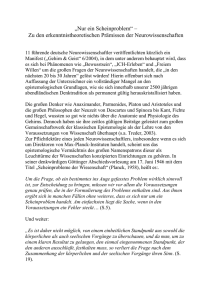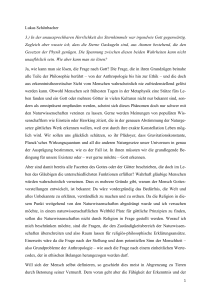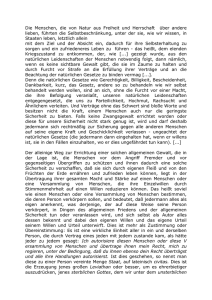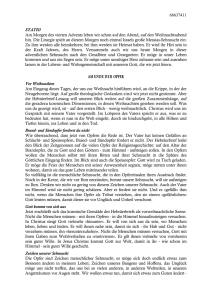Wie entstehen Entscheidungen?
Werbung
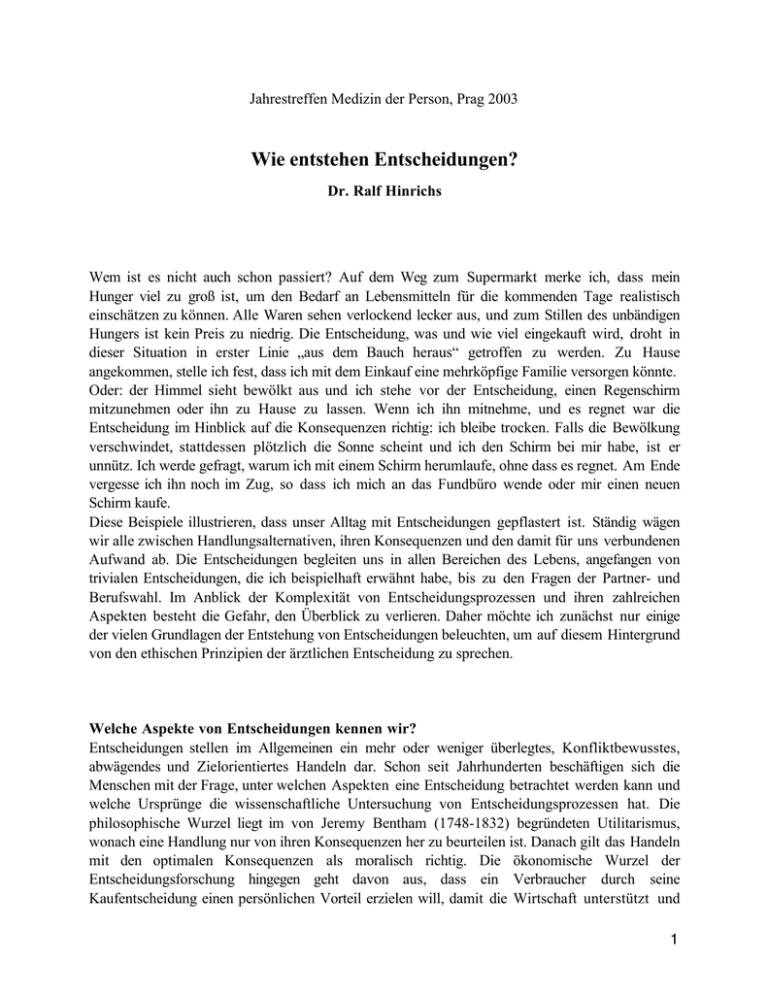
Jahrestreffen Medizin der Person, Prag 2003 Wie entstehen Entscheidungen? Dr. Ralf Hinrichs Wem ist es nicht auch schon passiert? Auf dem Weg zum Supermarkt merke ich, dass mein Hunger viel zu groß ist, um den Bedarf an Lebensmitteln für die kommenden Tage realistisch einschätzen zu können. Alle Waren sehen verlockend lecker aus, und zum Stillen des unbändigen Hungers ist kein Preis zu niedrig. Die Entscheidung, was und wie viel eingekauft wird, droht in dieser Situation in erster Linie „aus dem Bauch heraus“ getroffen zu werden. Zu Hause angekommen, stelle ich fest, dass ich mit dem Einkauf eine mehrköpfige Familie versorgen könnte. Oder: der Himmel sieht bewölkt aus und ich stehe vor der Entscheidung, einen Regenschirm mitzunehmen oder ihn zu Hause zu lassen. Wenn ich ihn mitnehme, und es regnet war die Entscheidung im Hinblick auf die Konsequenzen richtig: ich bleibe trocken. Falls die Bewölkung verschwindet, stattdessen plötzlich die Sonne scheint und ich den Schirm bei mir habe, ist er unnütz. Ich werde gefragt, warum ich mit einem Schirm herumlaufe, ohne dass es regnet. Am Ende vergesse ich ihn noch im Zug, so dass ich mich an das Fundbüro wende oder mir einen neuen Schirm kaufe. Diese Beispiele illustrieren, dass unser Alltag mit Entscheidungen gepflastert ist. Ständig wägen wir alle zwischen Handlungsalternativen, ihren Konsequenzen und den damit für uns verbundenen Aufwand ab. Die Entscheidungen begleiten uns in allen Bereichen des Lebens, angefangen von trivialen Entscheidungen, die ich beispielhaft erwähnt habe, bis zu den Fragen der Partner- und Berufswahl. Im Anblick der Komplexität von Entscheidungsprozessen und ihren zahlreichen Aspekten besteht die Gefahr, den Überblick zu verlieren. Daher möchte ich zunächst nur einige der vielen Grundlagen der Entstehung von Entscheidungen beleuchten, um auf diesem Hintergrund von den ethischen Prinzipien der ärztlichen Entscheidung zu sprechen. Welche Aspekte von Entscheidungen kennen wir? Entscheidungen stellen im Allgemeinen ein mehr oder weniger überlegtes, Konfliktbewusstes, abwägendes und Zielorientiertes Handeln dar. Schon seit Jahrhunderten beschäftigen sich die Menschen mit der Frage, unter welchen Aspekten eine Entscheidung betrachtet werden kann und welche Ursprünge die wissenschaftliche Untersuchung von Entscheidungsprozessen hat. Die philosophische Wurzel liegt im von Jeremy Bentham (1748-1832) begründeten Utilitarismus, wonach eine Handlung nur von ihren Konsequenzen her zu beurteilen ist. Danach gilt das Handeln mit den optimalen Konsequenzen als moralisch richtig. Die ökonomische Wurzel der Entscheidungsforschung hingegen geht davon aus, dass ein Verbraucher durch seine Kaufentscheidung einen persönlichen Vorteil erzielen will, damit die Wirtschaft unterstützt und 1 dadurch dem allgemeinen Wohl dient (Adam Smith, 1723-1790). Die mathematische Wurzel der Erforschung von Entscheidungen schließlich liegt in der Wahrscheinlichkeitstheorie, deren Grundlagen von Jacob Bernouilli (1654-1705) und Pierre Simon de Laplace (1749-1829) vor allem im Zusammenhang mit ihren Überlegungen zum Glücksspiel entwickelt wurden. Aber erst Mitte des 20 Jahrhunderts begann sich das Gebiet der Entscheidungsforschung wissenschaftlich zu etablieren. Heute spielen Entscheidungen vor allem in der Ökonomie eine herausragende Rolle, wie durch die Verleihung von mehreren Nobelpreisen für Wissenschaftler mit entscheidungstheoretischen beziehungsweise spieltheoretischen Arbeiten dokumentiert worden ist. Aus psychologischer Sicht ist Entscheiden eine spezifische kognitive Funktion, ein Zielgerichteter, nach Regeln operierender Prozess. Meistens besteht eine Auswahl an verschiedenen Handlungsmöglichkeiten. Die Optionen werden bewusst miteinander verglichen und im Hinblick auf ihre Wünschbarkeit beurteilt. Auf dem Weg zu einer Entscheidung werden verschiedene kognitive Funktionen benötigt. Wenn ein Patient eine Entscheidung treffen muss, ob er eine Operation durchführen lässt oder nicht, dann hört er beispielsweise die vom Arzt gegebenen Informationen, erinnert sich an ähnliche Fälle und überlegt sich mögliche Konsequenzen seiner Entscheidung. Neben den Informationen setzt Entscheidung immer auch Motivation voraus. Der Entscheider muss eine Lösung selbst und nach eigenen Vorstellungen wollen. Ohne Motivation können Entscheidungen nicht gefällt werden. Weiterhin ist die Entscheidung oft abhängig von Emotionen. Die Emotionen können unabhängig von der Entscheidung bereits vorhanden sein oder im Rahmen von Handlungsfolgen entstehen, beispielsweise wenn ich mich nach geleisteter Arbeit über den aufgeräumten Keller freue. Diese Überlegungen erscheinen auf der Basis der anatomischen und biochemischen Kenntnisse über unser Gehirn geheimnisvoll und unergründbar. Karl Jaspers sagte, dass die Verwandlung von Willen in eine Bewegung die einzige Stelle in der Welt ist, wo das Magische wirklich ist, wo ein Geistiges sich unmittelbar in physische oder psychische Wirklichkeit umsetzt. Aber wie hängen Geist und Gehirn zusammen? Freiheit des Willens durch Reflexion Die Freiheit des Willens ist ein in der Praxis akzeptierter Begriff, aber er wird unbegreiflich, sobald man ihn verstehen will. Unser Wille, der durch Zellen, Hormone und Elektronenflüsse umgesetzt wird, ist geprägt von zahlreichen Einflussfaktoren, wie Familie, Rollenerwartungen und anderen Sozialisationsfaktoren. Eine Entscheidung zwischen mehreren Alternativen entspricht nicht dem Sieg des stärksten Motivs oder dem zufälligen Ausgang eines blinden Kräftespiels, sondern ist das Motiv, das einem inneren, distanzierten Prozess der Überlegung und Bewertung standgehalten hat. Es gebe, so der Berliner Philosoph Peter Bieri, Grade der Willensfreiheit. Ein Wille kann umso freier sein, je umfassender er von Nachdenken geleitet werde und umso unfreier, je weniger dies zutrifft. Wiederholtes Fehlverhalten kommt einem mangelnden Nachdenken gleich. Das Ausmaß des bewussten und unbewussten Nachdenkens formt unseren Charakter, der die Basis für zukünftiges Handeln darstellt. Somit kann Charakter als Zentrum unserer Persönlichkeit als „geronnener Wille“ verstanden werden. In ihm manifestiert sich geleistetes Nachdenken der Vergangenheit. Trotz allem Nachdenken stellt sich die Frage, ob wir mit Hilfe von intensiver 2 Reflexion ein höheres Maß von Freiheit in unseren Entscheidungen erlangen können. Gibt es eine Entscheidung, die ohne Nachdenken aus sich heraus spontan entsteht? Der Wille aus Sicht der Naturgesetze Nach dem bisherigen Verständnis der Naturgesetze herrscht das Prinzip der Kausalität vor, dass heißt jedem Ereignis geht eine Ursache voraus. Nach diesem Verständnis kann es folglich keinen freien Willen geben, da jede Entscheidung auf eine vorherige Ursache zurückzuführen ist. Auch die neueren Erkenntnisse der Quantenphysik helfen bei der Beantwortung unserer Frage, ob es einen freien Willen gibt, nicht weiter. Wann beispielsweise ein radioaktives Atom zerfällt, lässt sich nicht vorhersagen. Der Zerfall geschieht anscheinend ohne Ursache, kann aber selbst eine Wirkung auslösen. Bezogen auf die Willensfreiheit bedeutet dies, dass eine Entscheidung rein zufällig entstehen würde und es daher eine wirklich freie Entscheidung nicht geben kann. Unser Verhalten wäre durch eine große Beliebigkeit gekennzeichnet. Es würde im Alltag zufällig mal zu der einen, mal zu der anderen Handlung führen. So kann man zusammenfassen, dass es nach dem Verständnis der Naturgesetze nach dem Kausalitätsprinzip und Prinzip des Zufalls einen freien Wille nicht geben kann. Der Wille aus Sicht der Theologie Ganz anders ergibt sich die Sicht aus theologischer Perspektive. Die Vorstellung einer Verantwortlichkeit vor Gott setzt einen wirklich freien Willen voraus, da wir nicht für etwas verantwortlich gemacht werden können, was chemische oder physikalische Naturgesetze uns vorgeben, ganz gleich, ob sie sich auf das Kausalitätsprinzip oder auf das Zufallsprinzip berufen. Wie können wir uns Willen daher auf dem Hintergrund dieser teils widersprüchlichen Erfahrungen vorstellen? Unbestritten ist, dass das Gehirn sich in ständiger Aktivität befindet und Assoziationen wie Blasen in einem Glas mit Mineralwasser an die Oberfläche steigen. Die Auswahl von Gedanken, die in das Bewusstsein eingehen, muss eine Balance zwischen Offenheit und sinnvoller Ordnung herstellen. Dabei dürfen Gewohnheiten und Routine der Person nur geringfügig gelockert werden, um unüberlegte Handlungen zu verhindern. Nach diesem Modell könnte der Entwurf einer Handlung, entsprechend der aufsteigenden Luftblase im Mineralwasser, unbewusst durch den Willen geprüft werden, ob eine Handlung unter allen erforderlichen Gesichtspunkten zulässig ist. Dem Willen käme hier eine Veto-Funktion gleich. Obgleich diese Funktion im präfrontalen Cortex lokalisiert scheint, ist eine dieser Funktion zugehörige definierte anatomische Struktur nicht bekannt. Ethische Prinzipien der Entscheidung zwischen Arzt und Patient Wenn wir die Entscheidung, einen Regenschirm mitzunehmen oder ihn zu Hause zu lassen, mit dem Wissen einer nach wie vor schwammigen Vorstellung eines freien Willens untersuchen, betrifft der Prozess der Entscheidung nur die handelnde Person. Der Regenschirm hat keinen Einfluss auf den Willen des Handelnden. In jeder zwischenmenschlichen Beziehung allerdings erleben wir, dass trotz oft unterschiedlicher persönlicher Entscheidung der jeweils Beteiligten, ein gemeinsamer Entschluss gefasst werden muss. Wenn ein Kompromiss nicht gefunden werden kann, setzt sich bei fehlenden Alternativen eine der beide Vorschläge durch. Eine besondere Form zwischenmenschlicher Beziehung stellt das Verhältnis zwischen Arzt und Patient dar. Hier kann 3 es sich in manchen Situationen um gleichberechtigte Partner handeln, die einen gemeinsamen Weg einschlagen, aber oft ist dies aus verschiedensten Gründen nicht der Fall. Die ärztliche Entscheidung folgt im Wesentlichen den ethischen Prinzipien der Fürsorge, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und der sozialen Verträglichkeit. Das Prinzip der Fürsorge umfasst Hilfeleistung und Schadensverhütung. Das Hilfsprinzip, der „beneficience“ in der angelsächsischen Literatur entsprechend, fordert Hilfsbereitschaft und enthält eine Hilfsverpflichtung, die einem moralischen subjektiv verschieden bewerteten Denken entspringen. Das Prinzip der Schadensverhütung („primum non nocere“) bezieht sich auf körperlichen, seelischen und sozialen Schaden. Es fordert die kritische Abschätzung des Schadensrisikos bei allen diagnostischen oder therapeutischen Vorhaben. Das Prinzip der Selbstbestimmung beinhaltet, dass der Patient das Recht hat, über seinen Körper zu entscheiden. Dies wird in der Einwilligung nach Aufklärung des Patienten („informed consent“) zum Ausdruck gebracht. Gerechtigkeit und soziale Verträglichkeit sind Prinzipien, die für eine gerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel sorgen sollen. Diese Prinzipien werden vor dem Hintergrund der ökonomischen Zwänge zunehmend diskutiert werden. Doch die genannten Prinzipien existieren keinesfalls konfliktfrei nebeneinander. Im klinischen Alltag stehen das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und die Fürsorgepflicht des Arztes häufig in einem Spannungsverhältnis. Es wirft die Frage nach einer ethischen Rechtfertigung des Paternalismus auf. Dieser aus der Staatsphilosophie entliehene Begriff bedeutet „väterliche Fürsorge“. Er steht für ein ärztliches Handeln, das sich ohne und gegebenenfalls auch gegen die Einwilligung des Kranken an dessen vermutetem bestem Interesse orientiert. Beide, Selbstbestimmung und Paternalismus, geben nur Teilaspekte der Arzt-Patienten-Beziehung wieder und sind ihrer moralischen Natur nach ambivalent. Die ethische Problematik des Paternalismus liegt in der Vernachlässigung des Selbstbestimmungsrechtes und in dem unsicheren Vermögen des Arztes zu wissen, was das Beste für den Patienten ist. Ein guter Arzt wird in seiner Sorge für den Patienten der Versuchung widerstehen, weder den Patienten paternalistisch zu bevormunden, noch eine übertriebene Autonomie des Patienten zu zulassen. Er wird vielmehr jene einfühlsame Distanz wahren, die dem Patienten seinen Freiraum lässt, ohne ihn dabei sich selbst zu überlassen. Diese Distanz manifestiert sich im Respekt vor der Patientenentscheidung, die auf der Basis einer entsprechenden Aufklärung getroffen worden ist. Das Gespräch mit dem Patienten sollte durch Aufrichtigkeit, Wille zur gemeinsamen Wahrheitsfindung, Wohlwollen und aufeinander hören geprägt sein. Die Besonderheit des Patientengesprächs betrifft das Vertrauen. Die Verschwiegenheit des Arztes eröffnet den Schonraum, der eine Aussprache erst möglich macht. Die Vertrauensbasis wird einerseits durch eine extrem paternalistische Haltung bedroht, wenn eine wahrheitsgemäße Aufklärung - in wohlgemeinter Schonung des Patienten - unterlassen wird. Sie ist aber auch bedroht, wenn das Gespräch im Sinne einer missverstandenen Patientenautonomie zur schonungslosen Sachinformation wird. Schonungslose Sachinformation nimmt den Respekt vor der Autonomie des Patienten zum Vorwand, sich aus der Mitverantwortung für ihn zu stehlen. Nach allen gegensätzlichen Überlegungen über die psychologischen, biochemischen und ethischen Aspekte der Entscheidung zwischen Handlungsalternativen, angefangen vom Regenschirm bis zur Frage, wie man zusammen mit einem Patienten entscheiden kann, ist für Christen die geistliche Dimension einer Entscheidung von großer Bedeutung. Glücklicherweise laufen die meisten Vorgänge auf dem Weg zu einer Entscheidung unbewusst ab. Unvorstellbar, wenn wir selbst alle 4 Alternativen unseres teils noch so trivialen Handelns aktiv überlegen müssten. Regelmäßig beten wir im Vaterunser „Dein Wille geschehe“, ein in letzter Konsequenz sowohl erschreckender als auch beruhigender Wunsch. Wenn wir auf Gottes Hilfe bei der Suche nach der richtigen Entscheidung hoffen dürfen, spielt die Frage, wie das alles in unseren Kopf passt nur eine untergeordnete Rolle und schenkt uns Zuversicht und Kraft, bei schweren Entscheidungen nicht allein zu sein. 5