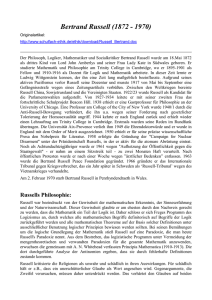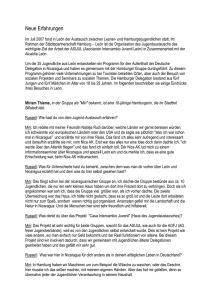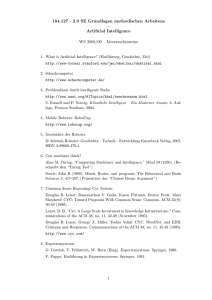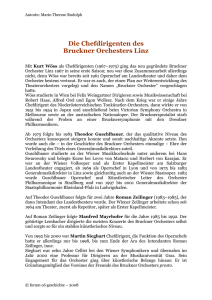Bertrand Russells Metaethik vom Idealismus zum
Werbung

Lehrstuhl für Ethik und politische Philosophie Universität Fribourg, Schweiz Seminar Moore, Principia Ethica Leitung: Prof. Dr. J.-C. Wolf WS 1999/2000 Bertrand Russells Metaethik vom Idealismus zum Emotivismus Urs Bräm 12. Sem. Germanistik 14. Sem. Philosophie Seidenweg 9 3012 Bern 076 327 01 51 [email protected] Inhalt 1. Einleitung................................................................................................................................ 2 2. Analytische Philosophie.......................................................................................................... 3 3. Russell im Überblick............................................................................................................... 4 3.1 Erkenntnistheoretischer Realismus und Idealismuskritik................................................. 5 3.2 Mathematische Logik: die Russellsche Antinomie........................................................... 6 3.3 Logischer Atomismus ....................................................................................................... 7 3.3.1 Erkenntnistheorie ....................................................................................................... 7 3.3.2 Sprachphilosophie...................................................................................................... 8 3.4 Neutraler Monismus........................................................................................................ 10 4. Russels Metaethik ................................................................................................................. 11 4.1 Vor Moore....................................................................................................................... 12 4.2 Mit Moore ....................................................................................................................... 14 4.2.1 Naturalistischer Fehlschluss..................................................................................... 15 4.2.2 Open Question Argument ........................................................................................ 16 4.2.3 Paradox der Analyse ................................................................................................ 17 4.2.4 Argument from Advocacy ....................................................................................... 18 4.3 Nach Moore .................................................................................................................... 18 4.3.1 Wertrelativität .......................................................................................................... 20 4.3.2 Subjektivismus......................................................................................................... 20 4.3.3 Früherer Emotivismus.............................................................................................. 21 4.3.4 Irrtumstheorie........................................................................................................... 23 4.3.5 Späterer Emotivismus .............................................................................................. 24 5. Schluss .................................................................................................................................. 27 6. Literatur................................................................................................................................. 29 6.1 Quellen............................................................................................................................ 29 6.2 Sekundärliteratur............................................................................................................. 29 1. Einleitung At the least he is often interestingly wrong. And not many of us can hope to do better than that. Charles R. Pigden Bertrand Russell ist als eine der Schlüsselgestalten der analytischen Philosophie vor allem im Bereich der Erkenntnistheorie wahrgenommen worden. Seine Arbeit in der Ethik wurde dabei größtenteils übersehen oder subestimiert. Das mag an Verschiedenem gelegen haben: An Russells Mäandrieren zwischen verschiedenen ethischen Positionen, an der Exponiertheit seiner Stellung als öffentlicher Politisierer, oder auch an der systembedingten Schwierigkeit, innerhalb eines logisch-positivistischen Weltbildes Ethik zu begründen. Russell steht im bekannten Zwiespalt zwischen den Ergebnissen kritischen Philosophierens und Sinn- und Wertbedürfnis, zwischen durch analytische Erkenntnistheorie geförderter strenger Wissenschaftlichkeit und dem Wunsch, ›worüber man nicht reden kann‹, trotzdem zu philosophieren. Seine Lösungsversuche für das Dilemma sind, wie im Motto zitiert, ›oft interessant falsch‹, und liefern genügend Material für weitreichende Diskussion. Metaethik ist diejenige philosophische Forschung, die »nicht die Moral selbst, sondern die Ethik bzw. ethische Theorien zu ihrem Gegenstand« hat, und bezeichnet im engeren Sinne die zu Beginn des 20. Jh. im anglo-amerikanischen Sprachraum entwickelte (sprach-)analytische Ethik. Die M[etaethik] unterscheidet sich sowohl von der deskriptiven als auch von der normativen Ethik dadurch, daß sie sich weder mit der Untersuchung faktischer moralischer Phänomene beschäftigt noch mit der Setzung oder Begründung von Normen. Sie beschäftigt sich […] nicht inhaltlich mit ethischen Fragen (Neutralitätsthese), sondern mit den logisch-sprachlichen Voraussetzungen ethischer Sätze bzw. Ausdrücke, d.h. mit deren Bedeutung und Funktion […].1 Russell gehört natürlich dieser enger definierten ›angelsächsischen‹ Schule an, und auch sein Philosophieren beschäftigt sich mit den logischen und sprachlichen Voraussetzungen der ethischen Diskussion – seine Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie, auf denen seine Ethik aufbaut, bestätigen dies. Was ihn aber zum Sonderfall macht, ist, dass er sich der metaethischen Neutralitätsthese nicht unterwerfen kann, dass sein metaethisches Denken stets auch auf normative Ethik ausgerichtet ist. Mit der intrinsischen Widersprüchlichkeit des Begriffs ›analytische Ethik‹ führt Russell einen lebenslangen Kampf. 1 A. REGENBOGEN / U. MEYER, 1998, Artikel Metaethik, S. 410 f. 2 Nach einem sehr kurzen Überblick über die Grundlagen der analytischen Philosophie werden erst die hauptsächlichen Entwicklungslinien von Russells außerethischem Philosophieren dargelegt, als Verständnisbasis für seine ethischen Positionen. Weiter soll versucht werden, die Entwicklung der Russellschen Metaethik durch ihre verschiedenen Phasen hindurch nachzuzeichnen. Dabei folgt diese Arbeit einem bereits vorgespurten Pfad, nämlich der von Charles R. Pigden edierten und kommentierten Ausgabe Russell on Ethics2, einer zielorientierten Zusammenstellung von Exzerpten aus Russells Schaffen, die sich bereits in extenso dieser Aufgabe widmet. In diesem Sinne kann hier nicht viel mehr Originalität eingebracht werden als eine kritische – gezwungenermaßen naive – Auseinandersetzung mit den Thesen Russells und deren Umfeld.3 2. Analytische Philosophie An dieser Stelle soll keine Definition vorgenommen, sondern bloß der Rahmen für das weitere Vorgehen knapp abgesteckt werden: Die Schule der analytischen Philosophie, eine Strömung hauptsächlich des zwanzigsten, mit Wurzeln aber im neunzehnten Jahrhundert, lässt sich methodisch in zwei Kategorien gliedern, in eine ›Philosophie der normalen Sprache‹ und eine ›Philosophie der idealen Sprache‹, beide Resultat der Hinwendung der Philosophie zur Untersuchung ihres Mediums, dem linguistic turn. Erstere, vertreten vor allem durch G. E. Moore und den späten Ludwig Wittgenstein, ist, wie der Name sagt, der normalen, der benutzten Sprache zugewandt. Ihre Hauptmethoden sind ›Begriffsanalyse‹ und ›Therapie‹. In der Analyse werden ›unklare‹ Begriffe durch andere Begriffe informativ erläutert – dies stets auf begrifflicher Ebene, ohne in die Welt empirischer Aussagen vorzustoßen. Da die Analyse allerdings keine neuen (d.h. synthetischen, außerhalb des Systems des Begriffs befindlichen) Elemente hinzubringen darf, ergibt sich ein ›Paradox der Analyse‹, stellt sich die Frage, ob eine korrekte Begriffsanalyse überhaupt informativ sein kann.4 Die zweite Methode der normalsprachlichen Philosophie, Therapie, geht davon aus, dass sich sprachlich generierte philosophische Scheinprobleme entlarven und somit lösen 2 Mit der Sigle ROE wird Russell aus dieser Ausgabe zitiert, mit der Sigle PROE der Pigdensche Kommentar. Weshalb ich es ab und zu wage, auch ausserhalb der Fussnoten Verständnis- und Rückfragen in der ersten Person auszusprechen. 4 Das Paradox der Analyse nimmt in Bezug auf die Theorie Moores eine wichtige Stellung ein und wird weiter unten genauer behandelt. 3 3 lassen, indem »die Begriffe, die für das Entstehen des philosophischen Problems wesentlich sind, aus der metaphysischen Verwendung in ihren alltäglichen Gebrauch«5 zurückgeführt werden. Die Philosophie der idealen Sprache – ihre ursprünglichen Hauptvertreter sind Gottlob Frege, der frühe Wittgenstein und Russell, weiterentwickelt wurde sie vom Wiener Kreis, dann von Karl Popper oder etwa Rudolf Carnap – hingegen hat zum Ziel, »mittels einer logischen Analyse der Normalsprache eine Idealsprache zu konstruieren […], in der sich alles ausdrücken läßt, was wir mit sinnvollen normalsprachlichen Sätzen ausdrücken, nur klarer, prägnanter und logisch eindeutig«6. Eine ihrer Methoden ist etwa die ›rationale Rekonstruktion‹, die Elimination von nicht-logisch-begrifflichen Elementen aus der Wahrnehmung, die erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Reduktion der Phänomene auf ihre logischen Fundamente. 3. Russell im Überblick Bevor wir uns eingehender mit der Ethik und insbesondere der Metaethik Bertrand Russells beschäftigen, soll ein grober Überblick über seine verschiedenen philosophischen Schaffensphasen hergestellt werden.7 Russells Denken ist von stetem Wandel und Übergang geprägt, weshalb Albert Newen und Eike von Savigny vier ineinander übergreifende Perioden bestimmen: 1890–1898: Auseinandersetzung mit der deutschen idealistischen Philosophie: Vor allem entwickelte er eine Kritik am erkenntnistheoretischen Idealismus und argumentierte für einen erkenntnistheoretischen Realismus. 1898–1913: Vom Realismus zur mathematischen Logik: Ausarbeitung einer philosophischen Logik, die in den Principia Mathematica ihren Niederschlag gefunden hat. 1905–1918: Von der mathematischen Logik zum logischen Atomismus: Russell entwickelt eine Erkenntnistheorie, eine Sprachphilosophie und eine Ontologie, die in seiner Philosophie des logischen Atomismus miteinander verknüpft sind. 1918–1948: Vom logischen Atomismus zum neutralen Monismus: Weiterentwicklung von Sprachphilosophie und Bewußtseinstheorie unter Berücksichtigung der zeitgenössischen Psychologie. Die Entwicklung des neutralen Monismus als neue Bewußtseinstheorie ist die markanteste Veränderung in der späten Phase.8 5 A. NEWEN / E. von SAVIGNY, 1996, S. 12. Ebd., S. 11. 7 Wie bereits oben im engen Anschluss an ebd., 1996. Das Werk geht interessanterweise mit kaum einem Wort auf Russells ethische Überlegungen ein. 8 Ebd., 1996, S. 45 f. Warum die vierte Periode nur bis zu Russells sechsundsiebzigstem Lebensjahr angesetzt ist, ist mir unbekannt. 6 4 3.1 Erkenntnistheoretischer Realismus und Idealismuskritik Der frühe Russell steht anfangs in der Auseinandersetzung besonders mit George Berkeley und Immanuel Kant noch auf der Seite des Idealismus, als dessen Grundthese etwa »Alles, was existiert, ist in einem Bewußtsein«9 angegeben werden kann.10 Gemeinsam mit Moore wendet er sich noch vor der Jahrhundertwende von diesem Grundsatz ab. Russell rekonstruiert und bestreitet Berkeleys idealistische Grundthese, die auf folgenden Schluss aufbaut: das Einzige, dessen Existenz wir gewiss sind, sind die Sinnesdaten (bei einer Sinnestäuschung also die Wahrnehmung derselben). Diese wiederum sind in einem Bewusstsein, was heißt, dass das einzige, dessen Existenz wir gewiss sind, in einem Bewusstsein ist. Dazu kommt eine weitere Prämisse: etwas existiert genau dann (= dann und nur dann), wenn wir dessen Existenz gewiss sind, woraus folgt: etwas existiert genau dann (= dann und nur dann), wenn es in einem Bewusstsein ist.11 Berkeley führt seine Argumentation selbst dadurch ad absurdum, dass er eine ›spekulative Denkkrücke‹ zur Hand nehmen muss, damit etwas, was keinem Menschen bewusst ist, nicht plötzlich zu existieren aufhört: es ist immer im Bewusstsein Gottes. Diese Notwendigkeit, nicht nur das zu Hilfe genommene Argument, stellt Russell in Frage, indem er schlicht das Gegenteil behauptet.12 Einleuchtender ist die Kritik an der ersten Prämisse, die besagt, dass Sinnesdaten das einzige sind, von dessen Existenz wir sicheres Wissen haben. Russells Beispiel ist die zweifellos wahre Aussage: alle Paare von natürlichen Zahlen, die noch nie von einem Menschen multipiziert worden sind, haben ein Produkt größer als 1000. Wir haben sicheres Wissen davon, dass eine Tatsache der Fall ist, ohne dass ein Sinnesdatum vorliegt. Die Frage wäre hier bloß, ob ›existieren‹ und ›der Fall sein‹ wirklich das gleiche bedeuten, eine Unterscheidung, auf die Russell später zurückkommt13, als er zwischen nichtpropositionalem Wissen von Dingen und propositionalem Wissen von Tatsachen unterscheidet. 9 Und umgekehrt (vgl. FN 11)! Ebd., 1996, S. 46. Zu Russells frühen Jahren vgl. A moralist in the making: the pre-Principia writings, ROE, S. 25–91. 11 A. NEWEN / E. von SAVIGNY, 1996, S. 47, behaupten, diese Schlussfolgerung sei »äquivalent mit der zuerst vorgestellten Formulierung, daß alles, was existiert, in einem Bewußtsein ist«, was streng genommen so nicht stimmen kann, da nach dem obigen Schluss auch alles, was in einem Bewusstsein ist, existiert. »Alles« impliziert in der Grundthese wohl eine Äquivalenzbeziehung. 12 Ein meines Erachtens nicht ausreichendes Argument! Auch die Berufung (zusammen mit Moore) auf die »tiefgreifende Verankerung der Alltagsüberzeugung […], daß die Existenz von Dingen nicht von unseren Erfahrungen oder unserem Wissen über die Dinge abhängig ist« (ebd., 1996, S. 48) erscheint mir als Argument sehr schütter. 13 Vgl. Kap. 3.3.1. 10 5 3.2 Mathematische Logik: die Russellsche Antinomie Ein weiterer Markstein in Russells früher Entwicklung ist die Entdeckung der sogenannten Russellschen Antinomie. Sie erstand aus Russells Beschäftigung der Philosophie Freges, die die Mathematik als Teildisziplin der Logik ausweist und die Logik streng von der Psychologie trennt. Wichtig für Freges idealsprachliche Konzeption ist besonders die Unterscheidung von Begriff und Gegenstand (und ähnlicher Paare, die auf die Trennung des beschreibenden Vokabulars vom Beschriebenen abzielen), vereinfachend ausgedrückt, die Unterscheidung von Metasprache und Objektsprache. An einem mit diesem Grundsatz verknüpften Punkt setzte Russells Paradox an, das Frege äußerst verunsicherte: Individuen sind Elemente von Klassen. Klassen können wiederum auch Elemente von Klassen sein. Nun gibt es Klassen, die sich selbst als Element enthalten (z.B. die Klasse aller Klassen), und Klassen, die das nicht tun (z.B. die Klasse aller Löwen). Was ist aber mit der Klasse aller Klassen, die sich nicht selbst als Element enthalten? Wenn es wirklich zutrifft, dass sich diese Klasse nicht selbst als Element enthält, sollte sie eben gerade zu dieser Art Klassen gehören, was paradox ist. Wenn nicht, wenn sie sich also selbst enthält, trifft auf sie gerade die Definition zu, sich nicht selbst zu enthalten, was ebenfalls paradox ist. Heutzutage erscheint die Antinomie wohl sehr undramatisch im Vergleich zu dem Schock, den sie für Frege bedeutet habe. Offensichtlich liegt hier ein Klassenfehler vor, eine Vermischung und Verwechslung von verschiedenen Ebenen der Objektsprache und jeweiligen Metasprachen; die Frage nach der ominösen Klasse aller Klassen, die sich nicht selbst enthalten, ist falsch gestellt. Wird eine Typentheorie herangezogen, die die Klassen je nach ihrem Standort in der Hierarchie unterscheidet (eine Klasse ersten Typs enthält Individuen, eine Klasse zweiten Typs Klassen ersten Typs etc.) ist eine Klasse, die sich selber enthält, bereits ein Ding der Unmöglichkeit, und das Paradoxon löst sich in Wohlgefallen auf. Dass dies so selbstverständlich erscheint, dass die Unterscheidung verschiedener logischer Sprachebenen breit in unserem Bewusstsein verankert ist, ist wohl nicht zuletzt dass Verdienst Russells und seiner Lösung zur Russellschen Antinomie, die er in einem Anhang zu den Principia Mathematica (1903, 21927), seiner Schrift zur Etablierung der Mathematik als Teildisziplin der Logik, geliefert hat. 6 3.3 Logischer Atomismus Russells Philosophie des logischen Atomismus, die er etwa von 1905 bis 1918 vertrat, stützt stark auf den Tractatus logico-philosophicus seines Schülers Wittgenstein ab: es geht um analytische Auflösung der normalen Sprache in ihre nichtreduzierbaren, ›atomaren‹, idealsprachlichen Bestandteile. Erkenntnistheorie (Bekanntschaftstheorie), Sprachphilosophie (logische Analyse) und Ontologie (Sparsamkeitsgrundsatz) stehen bei Russell in einem engen Zusammenhang und greifen ineinander über, wie im folgenden gezeigt wird. 3.3.1 Erkenntnistheorie Hier anzusiedeln ist die bekannte Russellsche Position aus Probleme der Philosophie (1912), die besagt, dass wir auf der Ebene der Wahrnehmung nicht über unsere Sinneseindrücke, Sinnesdaten, hinausgelangen können, so dass Sinnestäuschungen denselben Status haben wie richtige Eindrücke: »Sinneseindrücke sind per definitionem so, wie sie uns erscheinen.«14 Diese Position liegt recht nahe am von Russell verworfenen Idealismus, geht aber darüber hinaus. Mit den Sinnesdaten verbindet uns ›Bekanntschaft‹, von dem Objekt ›an sich‹, auf das wir durch die Sinnesdaten schließen, wissen wir hingegen nur durch ›Beschreibung‹. Das Wissen durch Beschreibung stützt sich auf Schlussfolgerungen und Wissen von Wahrheiten. Durch Bekannschaft wissen wir von Dingen mittels gegenwärtiger sinnlicher Wahrnehmung oder mittels erinnerter Wahrnehmung. Bekanntschaft ergibt sich auch bei Introspektion, und bekannt sind wir mit ›Universalien‹, d.h. in diesem Kontext Eigenschaften und Relationen, oder auch Tatsachen, solange die Wahrnehmung unmittelbar ist. Zu unterscheiden vom Begriffspaar ›Bekanntschaft‹ / ›Beschreibung‹ ist das Paar ›nichtpropositionales Wissen‹ (von Dingen) / ›propositionales Wissen‹ (von Tatsachen). Bei ersterem geht es darum, ob »die Person x in einer unmittelbaren Relation zu der Entität y steht«, bei letzterem um den »ontologischen Status der Relata des Wissens, nämlich ob es sich um Dinge oder um Tatsachen (bzw. Fertigkeiten) handelt«15. Wissen von Wahrheiten ist propositionales Wissen, mit der Form ›x weiß, dass p‹. Um etwa zu einem Wissen von einem Alltagsgegenstand zu gelangen, müssen wir zum nichtpropositionalen Wissen aus den Sinnesdaten das propositionale Wissen herbeiziehen, dass diese Sinnesdaten von einem Objekt verursacht 14 15 A. NEWEN / E. von SAVIGNY, 1996, S. 53. Ebd., S. 55. 7 werden. Auch Wissen durch Beschreibung kann bei Russell jedoch – im Gegensatz zum Idealismus – sicher sein, beispielsweise das Wissen eines kompetenten Sprechers, dass ein Junggeselle dasselbe ist wie ein unverheirateter Mann.16 Letztlich ist jedoch die Bekanntschaftsrelation die Grundlage allen Wissens: »Unser gesamtes Wissen – die Erkenntnis von Dingen ebenso wie die von Wahrheiten – hat die ›Bekanntschaft‹ zur Grundlage.«17 3.3.2 Sprachphilosophie Von dieser Erkenntnistheorie, die so stark auf den sprachlichen Prozess der Verarbeitung von Wahrnehmung zu Wissen ausgerichtet ist, führt ein kleiner Schritt hin zur Sprachphilosophie, insbesondere zur Semantik, also zur Thorie der Bedeutung, die hier eigentlich als eine Art Umkehrung der Erkenntnistheorie gesehen werden könnte, als eine Betrachtung des selben Vorgangs aus einer anderen Perspektive – im Sinne des linguistic turn scheint dies so abwegig nicht. Russells Semantik basiert auf dem Kompositionalitätsprinzip, d.h. es wird versucht, die Bedeutung komplexer Ausdrücke auf die Bedeutung ihrer Bestandteile zurückzuführen. Es gibt ›kategorematische‹ und ›synkategorematische‹ Ausdrücke: kategorematische haben ihre Bedeutung unabhängig vom Satzzusammenhang und gehorchen einem ›relationalen Prinzip der Bedeutung‹, d.h. ihre Bedeutung ist die von ihnen bezeichnete Entität. Synkategorematische Ausdrücke sind in der Bedeutung vom Satzzusammenhang abhängig, gehorchen einem ›kontextuellen Prinzip der Bedeutung‹, ihre Bedeutung ändert sich also mit dem jeweiligen Satzzusammenhang (Bsp.: logische Operatoren). Da die Bedeutung der synkategorematischen von der der kategorematischen Ausdrücke abhängig ist, müssen wir primär Kenntnis von der Bedeutung letzterer erlangen. Nun kommt wieder die oben erläuterte Bekanntschaftsrelation ins Spiel: »Jeder Satz, den wir verstehen können, muß vollständig aus Bestandteilen zusammengesetzt sein, die [d.h. deren Bedeutungen, U.B.] uns bekannt sind.«18 16 Dieses Beispiel wird ausführlich erklärt in ebd., 1996, S. 56 f. B. RUSSELL, 1967, S. 44. 18 Ebd., S. 53. Mit Bestandteilen sind nicht Ausdrücke gemeint, sondern das, was sie bezeichnen, weshalb A. NEWEN / E. von S AVIGNY, 1996, S. 60, explizieren: »Wenn wir einen Satz verstehen können, dann müssen die atomaren Aussagen, welche das Ergebnis der logischen Analyse des Satzes sind, aus Ausdrücken bestehen, deren Bedeutungen (das heißt die bezeichneten Entitäten) uns bekannt sind.« 17 8 Komplexe Sätze lassen sich mit diesem Rüstzeug nun in atomare Aussagen19 zerlegen, bis es nicht mehr weitergeht. Dazu lässt sich beispielsweise die wittgensteinsche Analyse von »Der Besen steht in der Ecke«20 anführen, die als ersten Schritt »Der Stiel steht in der Ecke«, »Die Bürste steht in der Ecke« und »Die Bürste ist am Stiel befestigt« ausgibt. Wichtig wäre hier, dass die sprachliche Analyse nicht unversehens in eine realweltliche Analyse überliefe, dass also jenseits der begrifflichen Mindestdefinitionen nicht weiter analysiert würde, in Moleküle beispielsweise. Hier ist ein starker normalsprachlicher Ansatz (mit dem Ziel einer Idealsprache) vorhanden – das Beispiel stammt ja auch vom späten Wittgenstein –, der zu Unklarheiten führen kann: meines Erachtens ist nicht gewährleistet, dass alle kompetenten Sprecher den Begriff auf die selbe Weise analysieren; ein Besenmacher mag andere Komponenten am Gegenstand sehen als ein Hausmann oder ein Physiker.21 Grundlegend für Russells Verständnis der logischen Analyse ist seine Kennzeichnungstheorie:22 Dinge, von denen wir Wissen mittels Bekanntschaft haben, werden mit Prädikaten oder logischen Eigennamen23 bezeichnet, Dinge, von denen wir Wissen mittels Beschreibung haben, mittels Kennzeichnungen der Form ›der/die/das F‹ (F=Prädikat). Die Analyse verfährt nun so, dass sie aus ›Der König von Frankreich‹ den Satz ›der x ist ein König von Frankreich‹ macht. Dabei verschwindet die Kennzeichnung zugunsten von Prädikaten und logischen Zeichen, Universalien, die stets auf Bekanntschaft rückführbar sind. Die Frage, die die Ontologie des logischen Atomismus stellt, ist die nach den minimalen Entitäten, Bausteinen der Welt und der sie beschreibenden, bzw. konstruierenden Sprache. Bei dieser Reduktion auf logische Atome kommt nun noch zusätzlich ›Ockhams Rasiermesser‹, ›Occam’s Razor‹, ins Spiel: ›Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem‹24. Dieses ontologische Ökonomieprinzip lässt die Annahme einer Art von Entitäten ›konstruktiv entbehrlich‹ werden, wenn sie zur Erfüllung ihrer Funktion durch andere Entitäten ersetzt werden können, und ›theoretisch entbehrlich‹, wenn sie zur Erklärung eines Phänomenens, für die sie herangezogen wurden, nicht mehr notwendig sind. Die Frage der Ontologie nach dem 19 Vgl. Der logische Atomismus, in: B. RUSSELL, 1971, S. 23–51. Vgl. L. WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, § 60. 21 Und natürlich ein ›Eskimo‹ noch einmal andere … 22 Vgl. den berühmten Aufsatz On denoting, Über das Kennzeichnen (1905), in: B. RUSSELL, 1971, S. 3–22. 23 Es gibt nur einen logischen Eigennamen: ›dies‹! Der Name einer Person etwa bezeichnet bereits wieder einen über Beschreibung erschlossenen Gegenstand. 24 In dieser Form bei Ockham übrigens nicht nachweisbar, vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel 1971 ff., Bd. 6, Artikel Ockham’s Razor, Sp. 1094–1096. 20 9 linguistic turn »läßt sich nur mit Hilfe von sprachphilosophischen Mitteln beantworten«. Sie lautet: »Welches ist das Minimalvokabular für eine vollständige Beschreibung der Welt?«25 Zwischen Sprache und Welt, zwischen Aussage und Tatsache besteht also eine strukturelle Analogie26, und die Struktur der Sprache sagt etwas über die Struktur der Welt aus. Russell hat die klassische ›Ding-Eigenschaft- (bzw. ›Substanz-Attribut-)Metaphysik‹ durch eine ›Ding-Eigenschaft-Relationen-Metaphysik‹ ersetzt. Tatsachen (die auf Relationen beruhen) gehören neu mit zum Minimalvokabular der Welt, weshalb auch von einer ›Ontologie der Tatsachen‹ gesprochen wird. Allerdings haben in Russells Minimalvokabular auch logische Eigennamen (wie etwa ›dies‹) Platz, und damit die von ihnen durch Bekanntschaftsrelation bezeichneten Sinesdaten. Wenn nun die Welt (auch) aus Sinnesdaten aufgebaut ist, wird sie ›subjektiv‹, und die Theorie idealistisch, was Russell dadurch zu vermeiden trachtet, dass er annimmt, Sinnesdaten seien materielle Entitäten und ließen sich durch zwei normale Rezipienten in derselben Situation objektiv, d.h. übereinstimmend wahrnehmen.27 Diese spekulative Lösung wird Russell als großer Schwachpunkt seiner Theorie des logischen Atomismus angerechnet. Allerdings hat Russells realistische Theorie der Sinnesdaten, die ja aus der Auseinandersetzung mit dem Idealismus erwachsen ist, so oder so einen stark idealistischen Dreh, der meines Erachtens nicht als Schwachpunkt interpretiert, sondern als interessante Zwischenform verstanden werden sollte, mag sich Russell selbst auch dagegen verwehrt haben. 3.4 Neutraler Monismus Nach 1918, in einer Phase, in der er sich besonders stark mit Ethik befasste, wendete sich Russell einer Theorie des ›neutralen Monismus‹ zu, die sich auch auf die zeitgenössische Psychologie (William James), insbesondere des Behaviorismus (John Dewey) stützt. Es gibt keinen Dualismus von Materie und Bewusstsein, Körper und Geist, Leib und Seele; die Welt 25 A. NEWEN / E. von SAVIGNY, 1996, S. 67. Russells Theorie stimmt hier mit Wittgensteins Bildtheorie überein. 27 Die Frage, die ich hier stellen würde, wäre, ob das Vorliegen einer Bekanntschaftsrelation zwischen Eigennamen und Sinnesdaten tatsächlich impliziert, dass letztere zum Minimalvokabular der Weltbeschreibung gehören müssen, oder ob es nicht völlig ausreicht, wenn dies nur die Eigennamen tun. Könnte hier nicht die Russellsche Antinomie herbeigezogen werden und im Sinne eines Typenfehlers (Eigennamen bezeichnen Sinnesdaten, gehören also nicht derselben Klasse an) argumentiert werden? Oder könnten wir nicht die Sinnesdaten über die Klinge der konstruktiven Entbehrlichkeit von Ockhams Razor springen lassen, da sie sich jeweils durch Eigennamen vertreten lassen (wie in der Beschreibung der Konstruktion eines Hauses die einzelnen Ziegelsteine durch den Begriff ›Ziegel‹)? 26 10 besteht aus einem ›neutralen‹ (physischen und psychischen Prozessen zugrundeliegenden) ›Stoff‹. Dieser ›Stoff‹ ist nun eben kein Stoff im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr eine Art Prozess, ein Vorgang, aus dem wir logische Konstruktionen wie Materie und Bewusstsein erstellen, die also nicht zu den Grundbausteinen der Welt gehören. So gesehen kann dieser neutrale Monismus als sinnvolle Weiterentwicklung des logischen Atomismus gesehen werden, wenn er auch auf den ersten Blick den Eindruck macht, es handle sich um simple naturalistische oder heraklitische Metaphysik, in der ein Grundstoff oder ein Prinzip der Welt angegeben werden soll. 4. Russels Metaethik Man könnte gegen die vorangehende grobe Darstellung der außerethischen Philosophie Russells einwenden, sie sei zum Verständnis seiner ethischen Überlegungen nicht zwingend notwendig; Russells Ethik ist zu weiten Teilen ja gerade außerhalb des wissenschaftlichen Philosophierens angesiedelt: »Since ethical notions are essentially subjective, they fall outside the purview of scientific philosophy. […] [A]lthough he sometimes discussed ethical concepts at length, he almost invariably prefaced such discussions with the disclaimer that he was not engaged in philosophy at such times.«28 Gerade diese Haltung Russells, der Hintergrund des strengen analytischen, wissenschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Philosophierens, von dem er seine Ethik absetzt, ist aber grundlegend für das Verständnis seiner Ethik. Russells ethische Positionen mögen manchmal ungenau oder unwissenschaftlich erscheinen, weshalb es wichtig ist, seine gesamte Philosophie in groben Zügen zu kennen, um seine mit angelsächsischer Zurückhaltung und akademischer Skepsis vorgetragenen ethischen Thesen richtig ernst nehmen zu können. Vor dem Hintergrund des Wegs vom Idealismus zum Realismus, von der mathematischen Logik zum logischen Atomismus mit seiner etwas verschrobenen Erkenntnistheorie und seiner äußerst wirkungsmächtigen Sprachphilosophie im Zuge des linguistic turn, vor dem Hintergrund seiner idealsprachlichen Position, in die doch oft einige normalsprachliche Elemente hineinspielen, wird Russells über weite Strecken dem Systemgedanken so abholde Metaethik viel verständlicher. 28 J. G. SLATER, 1994, S. 77 f. 11 Russell hat zeitlebens in einem besonderen Verhältnis zu G. E. Moore gestanden, wenngleich er dessen Auffassungen nur für einen beschränkten Zeitraum teilte. Pigden formuliert dies so: »Just as the Dark Side of the Force dominated the destiny of Darth Vader, so Russell’s destiny as an ethical theorist was dominated by G. E. Moore’s Principia Ethica. There was a Before, a During and an After Principia Period (this last being rather protracted) and each phase needs to be understood in those terms.« (PROE, S. 27) Als erstes Gliederungskriterium für Russells ethische Entwicklung habe ich deshalb die Phasen ›vor‹ (bis 1903), ›mit‹ (1903–1913) und ›nach Moore‹29 (ab 1913) gewählt, wobei hier vor allem die ›mit‹- und ›nach-Moore-Phase‹ der Metaethik Russells eingehender besprochen werden. Weiter ist zu bemerken, dass Russells moralische30 Überzeugungen nie so schwankhaft waren wie seine Rechtfertigungsversuche dafür: »Though his meta-ethical opinions – his views on the nature, justification and status of moral judgements – underwent various changes, his normative opinions remained fairly constant. He was, with reservations, backslidings and occasional hankerings after something more romantic, a utilitarian of sorts.« (PROE, S. 4) – Das moralische Bedürfnis Russells ist Triebfeder seiner theoretischen Suche. 4.1 Vor Moore Russell hat sich in seiner vor-Moore-Periode (den 1890ern) intensiv mit ethischen Fragen beschäftigt.31 In der Auseinandersetzung mit Moore hat er auch zu der Entwicklung von dessen metaethischer Grundthese beigetragen, zum Beispiel im Artikel Is ethics a branch of empirical psychology? (1897)32 Russell bejaht die imTitel gestellte Frage insofern, als er argumentiert, gut sei, was wir begehren zu begehren,33 Moore aber gleichzeitig zu einer genauen Definition von ›gut‹ auffordert, die dieser dann mit seiner berühmten Nicht-Definition in den Principia Ethica (1903), bzw. in dem sie vorausnehmenden Text The Elements of Ethics (1898) geliefert hat. 29 Natürlich ist mit ›Moore‹ nicht der Philosoph Moore gemeint, sondern die in den Principia Ethica vertretene Hauptthese von der Nicht-Analysierbarkeit der organischen Einheit ›gut‹. 30 Ich verstehe unter Moral eine je individuelle Gruppe von Werturteilen, und unter Ethik die Diskussion darüber. 31 Vgl. PROE, S. 8 f. 32 Nicht genauer belegte Aufsätze und Auszüge aus Texten Russells sind alle dem Band ROE entnommen. 33 ›what we desire to desire‹ – Hier greifen Moores Kritik am naturalistischen Fehlschluss und das Argument der offenen Frage, vgl. Kap. 4.2.1 und 4.2.2. 12 Diese Theorie des Begehrens findet sich etwa bereits vorbereitet im (ursprünglich unveröffentlichten) Paper Are all desires equally moral? (1896). Russell mag die Position nicht halten, ›gut‹ sei, was das Begehren befriedige. Er neigt eher der Version zu, ›x ist gut‹ bedeute ›ich begehre x‹, und moralische Aussagen seien eben Aussagen über psychische Zustände. Dabei unterscheidet er zwischen primären und sekundären Wünschen, und damit zwischen ›gut als Zweck‹ und ›gut als Mittel‹. Diese Konstruktion wird benötigt, damit es überhaupt noch möglich ist, etwas schlechtes zu begehren (weil ja per definitionem gut ist, was ich begehre): auf der (primären) Zweckebene kann man nicht fehlgehen, und es ist auch keine ethische Diskussion möglich (»primary desires are not subject to moral praise or blame, being the data […] for the construction of the Good«, ROE, S. 69); auf der Mittelebene hingegen sind Irrtümer (eben bezüglich der Wahl der Mittel) möglich, und damit auch ein schlechtes Begehren. Diese Theorie baut Russell im obengenannten Paper von 1897 weiter aus: ›gut‹ ist nun eben, was wir begehren zu begehren. Diese Formulierung entspricht im weiteren Sinne der obigen von ›primary‹ und ›secondary desires‹, letzteren würde nun ›was wir begehren‹ entsprechen. Wichtig ist der deskriptive, eben meta-ethische Charakter dieser Theorie das Guten, Ethik wird nun wirklich, dem Titel gemäß, zum »branch of empirical psycholgy«.34 In einem anderen Paper, Was the world good before the sixth day? (1899), hat Russell sich bereits der Mooreschen Position der Undefinierbarkeit von ›gut‹ angenähert. Die Frage ist, ob eine Welt ohne Leben überhaupt gut sein kann, ob also andere Dinge als Bewusstseinszustände gut sein können, ob ein Gutsein per se möglich ist. Moore bejaht dies, und auch Russell ist kein berkeleyanischer Pathozentrist35, aber er neigt einer Haltung zu, die besagt: »That nothing is good or bad in itself except psychical states, is a position which could only be maintained by omniscience. […] But it is possible to maintain […] that among the things we know, there is nothing good or bad except psychical states.« (ROE, S. 89) Russell 34 Hier setzt sicher die Verwirrung an, die eine Aussage wie ›gut ist, was wir begehren zu begehren‹ bewirken kann: wird (entgegen den Grundsätzen der analytischen Philosophie) davon ausgegangen, ›gut‹ müsse normativ definiert werden, es reiche nicht aus, reine Metaethik zu betreiben und zu zeigen, was wir generell unter ›gut‹ verstehen, kann eine solche Bestimmung gar nicht verstanden werden. 35 »[…] when a house is tumbling down, it doesn’t begin to make a noise till some one comes along the road, and then only if the some one is not deaf. This theory I shall not adopt. I shall admit that beauty is a quality of the object […].« (ROE, S. 88) Dieses klassische Geräusch-Beispiel scheint übrigens auch deshalb unplausibel, weil einfach angenommen wird, das Haus stürze ein, obwohl gar niemand da ist, um die Bewegung des Einstürzens wahrzunehmen. Es kann konsequenterweise gar nicht von einem einstürzenden Haus ausgegangen werden! 13 nimmt mit Moore an, Schönheit etwa sei eine objektive Eigenschaft, und damit mehr als ein bloßes Mittel zum Zweck36. Der psychische Zustand (den wir bewerten können) dessen, der etwas wirklich Schönes für schön erachtet, ist nun nicht mit dem Zustand dessen, der etwas Hässliches für schön erachtet, zu vergleichen. So bezieht Russell eine Mittlelposition zwischen Moores aufkommender Theorie des nicht-definierbaren, nicht-reduzierbaren Guten und seinem eigenen Psychologismus, seiner Theorie des Begehrens. 4.2 Mit Moore 1903 erscheinen Moores Principia Ethica, denen, wie erwähnt, schon vorbereitende Schriften vorausgegangen sind. Die zentrale These ist: »that moral concepts cannot be reduced to concepts of any other kind«, weshalb »a peculiarly moral property of goodness is required to make moral judgements true« (PROE, S. 8). ›Gut‹ lässt sich nicht einfach in eine naturalistische Ontologie einbauen, ›gut‹ gibt es als ojektive ›organische Einheit‹, ist aber nicht definierbar. Es geht Moore, das ist zu bemerken, nur um das (prädikative)37 Adjektiv ›gut‹: »I do not mean to say that the good, that which is good, is […] indefinable […]; and yet I still say that good itself is indefinable.«38 Das rührt daher, dass Moore Begriffe wie ›gelb‹ oder eben ›gut‹ nicht als komplexe und dadurch in ihre Bestandteile analysierbare Begriffe versteht, sondern als »notions of that simple kind, out of which definitions are composed and with which the power of further defining ceases«.39 Diese nennt Moore ›organische Einheiten‹, sie sind Verwandte der Kleinstteilchen aus dem logischen Atomismus, den ja auch Russell vertreten hat. Russell hat die Principia Ethica in The Elements of Ethics (1910) und The Meaning of Good (1904) zustimmend besprochen und in sein Denken mit einbezogen. Auf letzteren Atrikel bezieht sich Pigden in seiner Zusammenstellung zur Schilderung der Moore-Phase Bertrand Russells, deren wichtigste Punkte im Folgenden herausgestellt werden sollen. 36 Die in diesem Umfeld auftauchenden Argumente zur Frage nach der Objektivität ästhetischer Urteile bauen auf der Annahme auf, dass es schönere und weniger schöne Dinge gibt, sind einem klassischen Bildungsideal verhaftet und einem sehr britisch anmutenden Klassendenken. 37 Zu unterscheiden vom (dem ursprünglichen, griechischen Sprachgebrauch entsprechenden) attributiven Sinn der Funktionstüchtigkeit, wie etwa in ›ein gutes Gewehr‹. 38 G. E. MOORE, 1960, S. 9 f. 39 Ebd., S. 8 f. 14 4.2.1 Naturalistischer Fehlschluss Das Aufzeigen des naturalistischen Fehlschlusses ist ein grundlegendes Verdienst der Principia Ethica. Dieser Fehlschluss erfolgt, wenn ›gut‹ im moralischen Sinn40 auf natürliche Eigenschaften zurückgeführt werden soll: Ein solcher F[ehlschluß] liegt demnach beispielsweise vor, wenn aus »Alle Menschen trachten nach Lust« auf »Lust ist gut« geschlossen wird. Moore expliziert jedoch nicht, worin genau der nalturalist[ische] F[ehlschluß] eigentlich bestehen soll. Wie W. K. Frankena […] zeigt, handelt es sich beim n. F. im Unterschied zu D. Humes Sein-Sollen-Fehlschluß (Sein-Sollen-Dichotomie) um kein logisches, sondern um ein semantisches Problem: Der naturalist. F. bestehe nicht darin, daß ethische Sätze aus rein nicht-ethischen Sätzen deduziert werden, sondern darin, daß moralische Eigenschaften durch empirische Eigenschaften definiert werden, oder darin, daß überhaupt versucht wird, moralische Eigenschaften zu definieren. Frankena spricht daher auch von »Definitionsfehlschluß«.41 Es geht also laut Frankena bei Moore nicht um ethische und nicht-ethische Sätze, sondern um moralische und empirische Eigenschaften. Wir befinden uns also eine Sprachebene tiefer, nicht auf der Metaebene der logisch-sprachlichen Analyse, wie zu erwarten wäre, sondern auf der semantischen Ebene, die die Entitäten der Welt beschreibt. Einfacher ausgedrückt: »the logical autonomy of ethics (no moral conclusions from non-moral premisses) should be distinguished from semantic autonomy (moral words cannot be defined in terms of any others)« (PROE, S. 96). Moore selbst argumentiert folgendermaßen: It may be true that all things which are good are also something else, just as it is true that all things which are yellow produce a certain kind of vibration in the light. And it is a fact, that Ethics aims at discovering what are those other properties belonging to all things which are good. But far too many philosophers have thought that when they named those other properties they were actually defining good; that these properties, in fact, were simply not ›other‹, but absolutely and entirely the same with goodness. This view I propose to call the ›naturalistic fallacy‹ […].42 Aus diesem Mooreschen Statement wird recht deutlich, weshalb der naturalistische Fehlschluss nicht einfach mit der Is-ought-Dichotomie gleichgesetzt werden kann: Eigenschaften, die sich gar nicht zur Definition des gesuchten Begriffes eignen, werden trotzdem dazu herangezogen. Es handelt sich um einen Klassenfehler, in dem sozusagen ein Akzidens mit der Substanz, oder dem Wesen, des zu Definierenden verwechselt wird. 40 Vgl. FN 37. A. REGENBOGEN / U. MEYER, 1998, Artikel Fehlschluß, naturalistischer, S. 218 f. Der Text fährt in der Begriffsgeschichte fort: »Für R. M. Hare […] stellt der naturalist. F. einen ›deskriptiven Fehlschluß‹ dar, eine Verwechslung von deskriptiven und präskriptiven Urteilen […].« (Ebd., S. 219) – Wenn die Humesche Is-ought-Dichotomie jedoch definiert wird als »Auffassung […], wonach der Übergang von deskriptiven (Seins-) auf normative (Sollens-)Aussagen unzulässig ist […], da es zwischen ihnen keine analytischen Beziehungen gibt« (Ebd., Artikel Sein-Sollen-Dichotomie, S. 595), verstehe ich die Anführung Hares unter ›naturalistischer Fehlschluss‹ nun gar nicht. 42 G. E. MOORE, 1960, S. 10. 41 15 Trotz des Unterschieds besteht eine enge Verwandtschaft zwischen naturalistischem Fehlschluss und dem Schluss von Sein auf Sollen.43 Wenn wir von ›alle finden es gut, glücklich zu sein‹ auf ›gut ist, was uns glücklich macht‹ (oder ähnlich) schließen, begehen wir beide Fehlschlüsse zugleich: Einerseits schließen wir von einer deskriptiven auf eine normative Aussage, andererseits nehmen wir ein Atrribut des zu definierenden Begriffs und erheben es zu dessen alleiniger Definition. Zu fragen wäre, ob die beiden Fehlschlüsse überhaupt gänzlich unabhängig voneinander vorkommen können. 4.2.2 Open Question Argument Ein wichtiger Grundstein für die Mooresche Nicht-Definition von ›gut‹ ist das Argument der offenenen Frage. Es beruht auf einer starken normalsprachlichen Voraussetzung, der ›publicity condition‹: »that for B to constitute an analysis of A (or for A to be synonymous with B), the equivalence must be obvious to every competent speaker.« (PROE, S. 10) Dass eine solche Voraussetzung in die Ethik eines Idealsprachlers wie Russell eindringen kann, erscheint seltsam. Die Berufung auf common sense und auf normalsprachliche Bedingungen des Denkens gehören zwar fest zur analytischen Philosophie und zum linguistic turn. Dass aber von einem Faktum, also einer deskriptiven Aussage (die Antwort auf die Frage, wie die normale Sprache bei einem durchschnittlichen kompetenten Sprecher aussieht) auf die wirkliche Bedeutung eines analysierten Begriffs (die ja die analytische Philosophie etwa im logischen Atomismus liefert – und zwar als eine Art normative Aussage, nämlich: A soll das und das bedeuten!) geschlossen wird, erinnert doch stark an den verbotenen Schluss von Sein auf Sollen. Das Argument wird folgendermaßen verdeutlicht: Wenn ›gut‹ beispielsweise als ›was wir begehren‹ definiert wird, kann der kompetente Sprecher immer noch sinnvoll fragen: »Ist es aber auch wirklich gut?« Und so weiter, ad infinitum. Eine solche Argumentationsweise ist meiner Meinung nach kaum haltbar. Sie beruht auf einer in der normalsprachlichen Sprachphilosophie verankerten Öffentlichkeitsbedingung, die dem Wesen des Begriffs ›Definition‹ grundlegend widerspricht. Wenn mit Zustimmung aller 43 Russell selbst bringt die beiden Fälle in seiner Besprechung der Principia Ethica von 1904 in Beziehung: »the Naturalistic Fallacy […] is involved, for example, in every attempt to infer what ought to be, from what is or what will be.« (ROE, S. 99) Prägnant dazu Pigden: »While there is a lot of truth in this, it suggests a confusion that has bedevilled twentieth-century ethics.« (PROE, S. 96) 16 Beteiligten ›gut‹ als ›das Leiden fördernd‹ definiert wird, hat der Begriff diese Bedeutung und keine andere. War der Frager schon während der Begriffsbestimmung Mitglied unserer Sprachgemeinschaft, ist diese auch mit seiner Zustimmung erfolgt, und er ist nicht mehr berechtigt, nachzuhaken. Steht er ausserhalb der Sprachgemeinschaft, ist er nicht kompetent. Der wichtigste Einwand gegen meine Argumentation wird sein, dass gar niemand von Definition gesprochen hat, sondern von Analyse. Ich würde hier die Haltung einnehmen, dass Definition auch Analyse sein kann: ein Begriff wird untersucht und mit den wenigsten, einfachsten und plausibelsten Ausdrücken in seiner Bedeutung erklärt, also unter Zuhilfenahme eines Minimalvokabulars ausgedrückt. Da eine solche Analyse niemals zur vollständigen Zufriedenheit durchgeführt werden kann (hier weiche ich von den logischen Atomisten ab, vgl. Kap. 3.3.2), hat eine Analyse eben stets definitorischen, behauptenden Charakter. 4.2.3 Paradox der Analyse Die oben geäusserte Kritik am Open Question Argument führt direkt in die Thematik des Paradoxons der Analyse, das in der Forschung weitreichend diskutiert wurde. Die Frage ist die, ob informative und zugleich korrekte Begriffsanalyse überhaupt möglich ist. Analysieren wir den Ausdruck ›Junggeselle‹ in ›unverheirateter Mann‹44, und Begriff und Erläuterung sind tatsächlich synonym, war die Analyse nicht informativ. Sind sie hingegen nicht synonym, hat sich die Analyse wohl gelohnt und wir haben etwas dazugelernt; leider war sie nicht korrekt. Das Paradox kann gelöst werden, indem wir von einem Sprecher ausgehen, der sich des Zusammenhangs des Begriffs und seiner Erläuterung nicht bewusst ist, was bei komplizierteren Termini nicht unwahrscheinlich ist; 45 er lernt zweifelsohne durch die Analyse etwas hinzu. Hier wird die Mooresche ›publicity condition‹ unterlaufen; der Sprecher aus unserem Beispiel würde wohl auch die ›offene Frage‹ nicht unbedingt stellen, Moores Frager hingegen käme gar nicht in die Lage, der Erläuterung durch Begriffsanalyse zu bedürfen, da ja sein Wortschatz das letzte Kriterium für die Korrektheit einer Analyse ist. Das Open Question Argument, das auf der Öffentlichkeitsbedingung beruht, muss also falsch sein, wenn wir annehmen, dass korrekte und zugleich informative Analyse möglich ist: 44 Es geht nur um Analyse auf der begrifflichen Ebene, ohne dass also die empirische tangiert würde. Vgl A. NEWEN / E. von SAVIGNY, 1996, S. 13 ff.; PROE, S. 11. Die Widerlegung Moores geht zurück auf Charles Langford, The notion of analysis in Moore’s philosophy (1942). 45 17 The purpose of Analysis […] is to disinter the buried rules, presuppositions or primitive concepts that govern the use of a word […]. Such an analysis need not be obvious to ervery competent speaker. Thus the Paradox of Analysis can be solved if the publicity condition is rejected, but only by reducing the Open Question Argument to rational impotence. (PROE, S. 11) 4.2.4 Argument from Advocacy Ein weiteres Argument gegen eine Definition von ›gut‹, das Russell in seiner Besprechung der Principia Ethica isoliert, ist eine Anwendung der Überlegungen zum naturalistischen Fehlschluss, Pigden nennt es das Argument from Advocacy: Wenn ›gut‹ mit einem naturalistischen Prädikat X gleichgesetzt werden kann, verliert es sämtliche motivierende Kraft: »the assertion that X things are good provides us with no extra reason for promoting them« (PROE, S. 12). Die Aussage, etwas sei gut, wird redundant, tautologisch, während sie doch so beschaffen sein sollte, dass sie uns zu einer Handlung motiviert. Pigden vertritt die Meinung, Russells Definition von ›gut‹ als ›was wir begehren zu begehren‹, werde von diesem Argument nicht angegriffen, Russell versuche nicht »to promote what we desire to desire«, sondern »to explain why predicating goodness of something else gives us some sort of reason to promote it« (PROE, S. 13), im Sinne Humes, der Lust erklärte als das, »what we would approve of at our informed and dispassionate best« (PROE, S. 12), eine Formulierung, die der späteren Russellschen Vorstellung guten Lebens als »inspired by love and guided by knowledge« (ROE, S. 128) – und vielleicht auch Rawls’ ›veil of ignorance‹ – verwandt ist: Es wird keine Definition von ›gut‹ geliefert, vielmehr wird versucht, die Bedingungen ethischer Entscheidungsprozesse zu erklären. So gesehen wird die Russellsche Position vor und nach Moore gleich viel verständlicher. Russell hat die Theorie des naturalistischen Fehlschlusses und das Open Question Argument in seiner Principia-treuen Phase als Widerlegung seiner Theorie, ›gut‹ sei, was wir begehren zu begehren (»what we desire to desire«) akzeptiert und beispielsweise in The Elements of Ethics (1910) und The Meaning of Good (1904) kräftig unterstützt und befördert, weshalb man für die Zeit vom Erscheinen der Principia Ethica bis 1913 von einer Moore-Russellschen Position sprechen kann. 4.3 Nach Moore Russell schreibt, er hätte sich mit der Lektüre von George Santayanas Buch Winds of Doctrine (1913) von der Mooreschen Position abgewandt: 18 I agreed with G. E. Moore in believing in the objectivity of good and evil. Santayana’s criticism […] caused me to abandon this view, though I have never been able to be as bland and comfortable about it as he was.46 Santayana verspottet Moores ›gut‹ als »a metaphysical illusion bred of intolerance«, und »[e]thical absolutism« (PROE, S. 105) und vertritt selbst eine eher emotivistische Theorie der Wertrelativität: Ethische Intuitionen sind nicht Meinungen, um die wir streiten, sondern »preferences we feel«, und das Bewusstsein der Relativität dieser Präferenzen »would tend to render people more truly social« (zit. nach PROE, S. 105). Russell lässt sich von der Offenheit und Toleranz der Position Santayanas überzeugen; im Gegensatz zu seinem Verhältnis zu Moore47 ist dies aber nur ein Startpunkt für die weitere, unabhängige Entwicklung seines eigenen emoivistischen Philosophierens. In On scientific method in philosophy (1914) argumentiert Russell für eine zusätzliche Umkehrung der Is-ought-Dichotomie: man kann auch kein ›Is‹ (also eine außermoralische Schlussfolgerung) von einem ›Ought‹ (einer moralischen Prämisse) ableiten! Das bedeutet, dass Wertvorstellungen nicht in wissenschaftliches Philosophieren (das sich mit dem ›Is‹ beschäftigt48) einfließen dürfen, die beiden Bereiche also vollkommen voneinander getrennt sind: To regard ethical notions as a key to the understanding of the world is essentially pre-Copernican. It is to make man […] the centre of the universe and the interpreter of its supposed aims and purposes. (ROE, S. 109) Schön gesagt! Präkopernikanisch heißt nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch anthropozentristisch, selbstüberschätzend. Ethischer Nonkognitivismus scheint die Konsequenz. Russell nimmt nun aber keine rein subjektivistische Stellung ein, in der ›X ist gut‹ nur noch die Bedeutung ›Ich finde x gut‹ zukäme und es gar keine wirklichen Meinungskonflikte mehr geben könne. Vielmehr heißt ›X ist gut‹ soviel wie »Would that everyone desired X!« (PROE, S. 106), »begehrte doch jeder X!«, also immer noch eine universale Forderung, aber als Wunsch (im Optativ) und Interjektion ausgedrückt und subjektiviert. Damit ist Russell bei einer sogenannt emotivistischen Haltung angelangt.49 46 B. RUSSELL: Portraits from Memory. London 1956. Zit. nach PROE, S. 105. Von den Principia Ethica wurde in den Anhängerkreisen allegemein angenommen, dass mit ihnen eigentlich alles zum Thema gesagt sei – was eine für die analytische Philosophie charakteristische Erscheinung zu sein scheint, denkt man etwa an den völligen Rückzug Wittgensteins aus der Philosophie nach dem Tractatus. 48 »The scientific philosophy […] aims only at understanding the world and not directly at any other improvement of human life […].« (ROE, S. 110) 49 Vgl. Kap. 4.3.3 und 4.3.5. 47 19 4.3.1 Wertrelativität Werden Werturteile als subjektive Äußerungen von Wünschen oder gar bloßen Präferenzen angesehen, muss folgerichtig auch davon ausgegangen werden, dass die unterschiedlichen Positionen wertrelativ bzw. wertneutral sind. Als flammender Moralist konnte sich Russell nie hundertprozentig mit dieser Seite seiner emotivistischen oder subjektivistischen Metaethik anfreunden. Trotzdem war es der Widerstreit der (als falsch empfundenen) Meinungen, der ihn in diese Richtung führte: anhand der Diskussion zum Ausbruch des ersten Weltkriegs diagnostizierte er einen universalen »outburst of righteousness«, der bei ihm zu einem »disgust of all ethical notions, which evidently are chiefly useful as an excuse for murder«50 führte. Die Instrumentalisierbarkeit von Werturteilen und die Inflation instrumentalisierter Moral, die Grundsituation im Krieg, dass jede Seite behauptet, das ewige Recht auf ihrer Seite zu haben, können zwar kein direktes Argument für die Relativität von ethischen Urteilen liefern (schließlich könnten ja die mit Abscheu wahrgenommenen Streitparteien allesamt falsch liegen)51, trugen jedoch im heuristischen Sinne viel zu Russells Abkehr von der Annahme bei, es gäbe eine objektive Eigenschaft ›gut‹ und Werturteile seien verstandesbedingt: »Opinions on such a subject as war are the outcome of feeling rather than thought […]; all that thought can do is clarify and harmonize the expression of such feelings […].«52 Diese Position, kommentiert Pigden, ist nicht einfach zu halten, hat Russell doch kurz davor in The Elements of Ethics noch selbst argumentiert: »the difficulty of discovering the truth does not prove there is no truth to be discovered«53. In dieser Phase ist weiter noch nicht ganz klar, ob Russell in Richtung Subjektivismus, Emotivismus oder Irrtumstheorie tendiert54, drei genauer zu unterscheidende Perspektiven auf die Theorie der Wertrelativität. 4.3.2 Subjektivismus Subjektivismus, wissenschaftstheoretische Grundlage von Emotivismus und Irrtumstheorie Grundlage von Emotivismus und Irrtumstheorie, ist eine über die Ethik hinausreichende 50 B. RUSSELL an S. ALEXANDER, 5. 2. 1915, zit. nach PROE, S. 107. Vgl. PROE, S. 18: »If Russell were simply arguing that the diversity of moral opinion indicates that there is not really a fact of the matter to disagree about, he would be refuted by the second paragraph of his own essay ›War and non-resistance‹ […].« Das wäre sonst ein allzu einfach formuliertes ›Argument from Relativity‹. 52 B. RUSSELL, The Ethics of War (1915), zit. nach PROE, S. 111. 53 B. RUSSELL, Philosophical Essays. London 1966, S. 20, zit. nach PROE, S. 111 f. 54 Vgl. PROE, S. 114. 51 20 Haltung, die spätens seit Descartes großen Einfluss in der Philosophie genießt. Der Bedarf danach entsteht aus dem »neuzeitliche[n] Problem der Erkenntnissicherung«, als »die Erklärung des Erkenntnissubjekts bzw. der Erkenntnisfähigkeiten […] des Forschers zum Garanten […] verbindlicher Erkenntnis, insbes[ondere] gegen Autoritäten und Traditionen […] zur Bedingung einer eigenständigen Wissenschaft« wird. In diesem Sinne bezeichnet Subjektivismus die Auffassung, dass »die Gegenstände der Erkenntnis und des Wollens […] durch das Subjekt – sein Wahrnehmen, Empfinden, Einschätzen, Wünschen – bestimmt wird« und lässt sich als Versuch auffassen, »die Diskrepanz zwischen den Irrtumsmöglichkeiten der erkennenden Subjekte und ihrem gleichwohl erhobenen Anspruch auf (allgemeine) Verläßlichkeit und Verbindlichkeit ihrer Erkenntnisse zu verstehen«.55 Dieses eher wissenschaftstheoretische Verständnis von Subjektivismus kann auch bei Russell gesehen werden, obwohl er dem Subjekt keine so deutliche rettende Rolle in der Frage nach gesicherter Erkenntnis zuspricht. Zumindest ist Russell jedenfalls stark mit dem angesprochenen Dilemma zwischen den Irrtumsmöglichkeiten der Subjekte und ihrem Universalitätsanspruch beschäftigt. Meiner Meinung nach wäre ein ethischer Subjektivismus ohne Beigabe einer weiteren Zutat (wie Emotionen oder Irrtum) kaum möglich. Die Sicherung der je individuellen, aber beurteilbaren, sich auf existierende Eigenschaften beziehenden Werte müsste dann trotz dieser Eigenschaften (die Emotivismus bzw. Irrtumstheorie moralischen Aussagen absprechen) nur über das Subjekt ablaufen, was schwer vorstellbar scheint. 4.3.3 Früherer Emotivismus Die Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie erläutert ›Emotivismus‹ folgendermaßen: In Abhebung von naturalistischen Auffassungen über die Natur von Werten bzw. Wertausdrücken und -aussagen […] und von kognitivistischen Auffassungen über die Erkennbarkeit von Werten […] und die Begründbarkeit von Werturteilen vertreten die Anhänger des E[motivismus] […] folgende Thesen: (1) Wertende Ausdrücke wie ›gut‹, ›schön‹ bezeichnen weder natürliche […] Merkmale von Gegenständen […] noch von G. E. Moore so genannte ›nicht-natürliche‹ Merkmale; sie bezeichnen überhaupt nicht, haben keine ›deskriptive‹, sondern ›emotive‹ Bedeutung. (2) Wertende Äußerungen sind demgemäß keine Behauptungen oder Feststellungen, die einen Wahrheitswert haben können, sondern bringen die individuelle Einstellung des Urteilenden zum fraglichen Gegenstand zum Ausdruck (das im weitesten Sinne ›emotive‹ Element in wertenden Äußerungen). […] (3) (vor allem Stevenson:) Werturteile werden geäußert, um den Hörer zu 55 J. MITTELSTRASS, Enzyklopädie Philosophie, Bd. 4, Artikel Subjektivismus, S. 128 f.. 21 bewegen, die eigene Einstellung zu übernehmen […]; das Vorbringen von angeblichen ›Gründen‹ für ein Urteil dient dem Zweck der Überredung des Hörers […].56 Das in Punkt (3) herausgestellte persuasive Element finden wir auch bei Russell wieder, wenn er die Aussage ›X ist gut‹ als ›would that everyone desired X!‹ interpretiert. Im Anschluss an Punkt (2) kann man den Emotivismus als eine Spezifizierung des Subjektivismus auffassen, und auch ganz generell als eine Form des Nonkognitivismus, wie dies Pigden feststellt, als the view that moral judgements and evaluations generally are neither true nor false […] but serve to express attitudes or emotions, rather in the manner of curses or huzzahs. This, in turn, is a variant of non-cognitivism, the view that moral and evaluative judgements cannot be known since they cannot be true or false.« (PROE, S. 16) In einer 1916 öffentlich geführten Kontroverse mit dem Kriegsbefürworter T. E. Hulme nimmt Russell zum ersten Mal entschieden Stellung für seinen Emotivismus: I do certainly mean to maintain that all Ethics is subjective, and that ethical agreement can only arise through similarity of desires and impulses. It is true that I did not hold this view formerly, but I have been led to it by a number of reasons, some logical, some derived from observation. (ROE, S. 117) Die Argumente für den Emotivismus sind einerseits das ›Argument from Relativity‹, das, wie bereits angesprochen, meines Erachtens mit eher heuristischem Charakter gesehen werden sollte57, andererseits das Ökonomie- oder Effizienzprinzip von Ockhams Messer: da moralische Phänomene auch ohne ein absolutes Gutes erklärt werden können, da Ethik auch ohne dessen Annahme betrieben werden kann, braucht es nicht mehr angenommen zu werden. Das ›Argument from Relativity‹ ist, wie Pigden ausführt (PROE, S. 18), gegen den konsequentialistischen Einwand immun, der die Relativität der Urteile aufhebt, indem er auf gewisse Endfolgen von Handlungen verweist (z.B. Leben, Gesundheit, Glück o.ä.), die dann moralisch eindeutig sind: Russell geht es ja eben gerade um die Relativität dieser grundsätzlichen Urteile, dieser ›basic evaluations‹. Das Ockhamistische Argument wird verständlicher vor dem Hintergrund von Russells Semantik, die ja auch seiner Metaethik zugrunde liegt58 und sich mit Sprachsystemen, Systemen der Weltbeschreibung beschäftigt, für die Effizienz sehr wichtig ist. Pigden verweist darauf, dass man dieses Argument sowohl in Richtung Emotivismus als auch in Richtung Irrtumstheorie auslegen kann (PROE, S. 18). 56 J. MITTELSTRASS, Enzyklopädie Philosophie, Bd. 1, Artikel Emotivismus, S. 539. »Observation of ethical valuations lead me to think […] that the claim of universality which men associate with their ethical judgments embodies merely the impulse to persecution or tyranny.« (ROE, S. 117) 58 Vgl. Kap. 3.3.2. 57 22 Pigdens eigene Zusammenschau dieser beiden Argumente lautet dann folgendermaßen: Wenn wir annehmen, dass die ›Anderen‹ mit ihren grundsätzlichen Urteilen falsch liegen können, müssen wir diese Eventualität auch für uns selbst annehmen, woraus wir dann folgern müssen: »The diversity of moral opinion […] suggests that real properties of goodness and badness are not needed to underwrite the phenomenology of value or to account for people’s beliefs« (PROE, S. 19). Das Messer Ockhams wird in dieser Verison sozusagen vom ›Argument from Relativity‹ geführt. 4.3.4 Irrtumstheorie Russell hat sich anfangs der zwanziger Jahre für eine kurze Zeit vom Emotivismus ab- und der Irrtumstheorie zugewandt, im Bestreben, dem Mooreschen Intuitionismus stichhaltigere Argumente entgegenzusetzen. Als Irrtumstheorie (Error Theory) wird die Position bezeichnet, »that moral judgements are the kinds of things that can be true or false, but since they refer to non-existent properties of good and evil, they are all of them false.« (PROE, S. 18) Es gibt keine Eigenschaften59 wie ›Gutheit‹ und ›Schlechtheit‹: »Since ultimate evaluations ascribe these properties to things, they are all false. […] Morality, therefore, is compounded of falsehoods and rests on a metaphysical mistake« (PROE, S. 20). John Leslie Mackie hat ihr – von Russell zu großen Teilen vorausgenommen – im Rahmen seines ethischen Skeptizismus in Ethics. Inventing Right and Wrong (1977) Ausdruck verliehen: »Obwohl die meisten Menschen bei ihren moralischen Äußerungen implizit auch den Anspruch erheben, auf etwas im objektiven Sinn Präskriptives zu verweisen, ist dieser Anspruch doch falsch.«60 Russell nimmt etwa im zu Lebzeiten unveröffentlichten Aufsatz Is there an absolute good? (1922) für die Irrtumstheorie Stellung. Wieder ist seine semantische Theorie, insbesondere seine Kennzeichnungstheorie, dabei von höchster Wichtigkeit. Bei Russell kann nämlich das Prädikat, beispielsweise ›gut‹, trotz der Absenz einer entsprechenden Eigenschaft bedeutungsvoll sein. Dazu wird auf die Theorie von On denoting zurückgegriffen: Ein Ausdruck wie ›Der König von Frankreich‹, der nichts in der wirklichen Welt vorkommendes bezeichnet, wäre sinnlos und leeres Geräusch, wenn er nicht doch irgend etwas bedeuten 59 Prädikat, ›predicate‹, definiert Pigden als »a word or phrase like ›good‹ or ›is good‹«, Eigenschaft, ›property‹, als »the universal for which a referring predicate stands« (PROE, S. 21). 60 J. L. MACKIE, Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen, S. 39 f. 23 würde. Er ist ein ›incomplete symbol‹, hat isoliert keine Bedeutung, wohl aber im Satzzusammenhang.61 Dasselbe gilt für ›gut‹. Es steht im Zusammenhang mit gewissen Werturteilen, die ihrerseits wiederum auf Emotionen basieren: We have emotions of approval and disapproval. If A, B, C … are the things towards we have emotions of approval, we mistake the similarity of our emotions in the presence of A, B, C … for perception of a common predicate of A, B, C …. To this supposed predicate we shall give the name ›good‹. (ROE, S. 123) Russells Irrtumstheorie ist im Grunde emotivistisch – das erklärt auch gut, wie er überhaupt zu ihr kam – verwehrt sich aber einem allzu weiten Hineinreichen der Emotionen in die Bestimmung von ›gut‹: »It will be seen that the emotions of approval and disapproval do not enter into the meaning of the proposition ›M is good‹, but only into its genesis.« (ROE, S. 123) Gleichzeitig spielt Russell hier auch mit dem von Moore und zuvor auch von ihm selbst bekämpften naturalistischen Fehlschluss: Die Bestimmung von ›gut‹ als ›Prädikate teilend mit A, B, C …‹ ist naturalistisch. Allerdings geht es hier nur um die Beschreibung der Sprachebene, nicht um die wirklichen ›properties‹, die es ja gar nicht gibt, weshalb meines Erachtens die naturalistische Komponente der Bestimmung nicht im Vordergrund steht. 4.3.5 Späterer Emotivismus Bei der Irrtumstheorie blieb Russell nicht lange, bloß bis in die Mitte der zwanziger Jahre, »[p]erhaps because it was just too much to bear« (PROE, S. 20). Russell, so Pigden, war viel zu sehr Moralist, um an einer Theorie festhalten zu können, die den Moralisten zum Verbreiter von Falschheiten macht. Deshalb formte er seine Irrtumstheorie in Emotivismus zurück: ›Good‹, he came to think, does not name a property, but this is not because it is an incomplete symbol, but because the sentences in which it appears do not express propositions. Hence the function of ›good‹ is not to describe anything or to denote some property, but to express some feeling or desire. (PROE, S. 122) Diese Haltung erlaubte es Russell wieder, frei zu moralisieren: »If the purpose of the moral vocabulary is to express certain desires and he had the relevant desires, why shouldn’t he use this cocabulary to express them […]?« Trotzdem war Russell nie richtig zufrieden mit seinem Emotivismus, »since he could not help feeling that he was right to express certain emotions« (PROE, S. 23) – ein schlagendes Paradox, das in engem Zusammenhang steht mit der 61 Es ist ja durchaus sinnvoll, zu sagen: es gibt keinen König von Frankreich – was nicht der Fall wäre, wenn ein Ausdruck im Satz vollkommen sinnlos wäre. 24 Etablierung einer ›reinen‹ Wissenschaft, die die Ethik eben ausschließt und auf Emotionen reduziert: Emotionen, die dann eben doch wieder an objektive Wertmaßstäbe glauben machen. Vor dem Hintergrund dieses wiedergewonnenen Emotivismus versucht Russell nun doch irgendwie zu sagen, was ›gut‹ ist, oder zumindest, was gut ist. Das gute Leben bestimmt er nun als »inspired by love and guided by knowledge«, eine Ansicht, die er letztlich unbegründet lässt: »I cannot […] prove that my view of the good life is right; I can only state my view, and hope that as many as possible will agree.« (ROE, S. 128) Russell verfährt hier also streng emotivistisch, führt gewissermaßen vor, wie man den durch Forschung erreichten Emotivismus mit dem Bedürfnis nach Mitteilung von Überzeugungen und Persuasion anderer verbinden kann; er gibt praktische Argumente und Beispiele an, die die Plausibilität und insbesondere die Nützlichkeit einer solchen Position zeigen sollen: der utilitaristische Chrarakter des Russellschen Emotivismus in seiner zweiten Phase wird deutlich. Wie erwähnt hat sich Russell nie besonders für die Konsequenzen seiner emotivistischen Theorien erwärmen können, weder für die generelle Abwertung von moralischen Aussagen noch für das Verschwinden von intersubjektiven Werten. Er blieb deshalb stets ein skeptischer Emotivist, im positiven Sinne unzufrieden und unsicher mit der von ihm selbst vertretenen Position, was ihn auch immer wieder von seiner eigenen Linie hat abweichen lassen. In Human Society in Ethics and Politics (1954) beispielsweise versucht er, seiner emotivistischen Position etwas intersubjektive Standfesigkeit zu vermitteln, indem er, an Hume wie auch an Sidgwick anknüpfend, »a series of fundamental propositions and definitions in Ethics« (ROE, S. 161) bestimmt. Pigden lässt kein gutes Haar an Russells Argumentation und betitelt den entsprechenden Abschnitt A compromise solution?62; Russell verwässert hier eindeutig seine eigene Theorie. Die »fundamental propositions« lauten folgendermaßen: 1. Surveying the acts which arouse emotions of approval or disapproval, we find that, as a general rule, the acts which are approved of are those believed likely to have, on the balance, effects of certain kinds, while opposite effects are expected from acts that are disapproved of. 2. Effects that lead to approval are defined as ›good‹, and those leading to disapproval as ›bad‹. (ROE, S. 161 f.) Aus der Beobachtung der Emotionen einer nicht genau bestimmten Gemeinschaft wird auf einen Zusammenhang mit den Folgen von Handlungen geschlossen. Nach Pigden stammt 62 Dass Russell nicht auf einmal gefundenen Einsichten oder Überzeugungen sitzenbleibt, ist allerdings konsequent, da es sich bei ihm ja gerade um Einsichten handelt, die die Unverrückbarkeit von Urteilen anzweifeln. 25 diese erste These von Sidgwick, der vertritt, »that common-sense moralities tend to simplify around rules which are believed to have generally beneficial consecuences, where the benefit is cashed in terms of some conception of universal human welfare« (PROE, S. 153). Russells Definition ist stark utilitaristisch und konsequentialistisch ausgerichtet und gerät dabei wieder in die Nähe des naturalistischen Fehlschlusses, indem von beobachteten Phänomenen in der Welt und deren regelmäßigem Auftreten im Zusammenhang mit anderen auf ethische Grundsätze geschlossen wird. Außerdem ist unklar, wer denn die Gruppe ist, die die Standards setzt. Bei Hume gab es noch einen ›idealen Betrachter‹ mit einem optimal funktionierenden moralischen Sinn, Russell erwähnt nur, dass die Gesellschaft, die hier als Maßstab herangezogen wird, ›zivilisiert‹ sein solle, z.B. nicht auf krassen Diskriminierungen aufbauen soll. Da die Meinungen in heterogenen Gesellschaften aber oft diametral auseinandergehen, müsste die Gruppe der Urteilenden reduziert werden, um überhaupt brauchbare Resultate zu erhalten – fragt sich bloß, nach welchen Kriterien. Russell fährt fort mit zwei weiteren Grundsätzen: 3. An act of which, on the available evidence, the effects are likely to be better than those of any other act that is possible in the circumstances, is defined as ›right‹; any other act is ›wrong‹. What we ›ought‹ to do is, by definition, the act which is right. 4. It is right to feel approval of a right act and disapproval of a wrong act. (ROE, S. 162) Paragraph 3 wird von Pigden mit der Bemerkung »a straightforwardly utilitarian or consequentialist definition […] and, as such, palpably false« (PROE, S. 153) abgetan und durch eine eigene Bestimmung von ›right‹ ersetzt – mit der schwer verständlichen Begründung: »it would be a tautology to say that the right thing to do is the action that seems likely to produce the best consequences. This is not.«63 (PROE, S. 153) Deutlich wird in der bei Pigden reproduzierten und kommentierten Passage eine gewisse Verwirrung, die daraus entsteht, dass Russell sich nicht mit seiner eigenen Theorie anfreunden kann, weil er einerseits Mühe hat, die letzten Konsequenzen einer radikal emotivistischen Position zu tragen, sich andererseits aber auch nie auf einmal gefundenen ›Wahrheiten‹ ausruhen will, sondern stets weiterfragt. Seine Bemühungen, die Existenz von zumindest so etwas Ähnlichem wie ethischem Wissen zu belegen, sind jedenfalls nicht von großem Erfolg: »Russell was not at all sure if there was such a thing as ethical knowledge and in extreme old 63 Greift Pigden hier etwa auf das Open Question Argument zurück? 26 age he reverted to […] unhappy emotivism« (PROE, S. 154). Aus kritischem Philosophieren gibt es wohl keinen Weg zurück in systematisches Denken. 5. Schluss Die Philosophie Bertrand Russells, wie sie hier in groben Zügen skizziert wurde, befindet sich in stetem Wandel und hat nie die Bequemlichkeit, sich auf festen Theorien oder Systemen auszuruhen. Trotz oder gerade wegen diesem Wandel weist seine philosophische Arbeit starke Konstanten auf. In der Ethik ist das erstens ein kritischer oder gar skeptischer Ansatz, der allen noch so starken Bemühungen des Philosophen selbst zur Unterwanderung durch aufbauende Theoriebildung trotzt. Zweitens eine starke Neigung zum Moralisieren, die Überzeugung, dass über Ethik und Moral diskutiert werden kann und muss, dass sich persönliche ethische Positionen anderen gegenüber, nicht zuletzt zu Überzeugungszwecken, vertreten lassen. Drittens strenge positivistische Wissenschaftlichkeit, die zum faktischen Ausschluss der Ethik aus der wissenschaftlichen Diskussion, der wissenschaftlichen Philosophie führt. Aus diesen Elementen bildet sich das Spannungsfeld, in dem sich Russells ethisches Philosophieren bewegt: Schreiben, worüber man nicht reden kann. Die Grundfrage von Russells Ethik ist im Grunde nicht die nach dem Guten oder der Bedeutung von ›gut‹, sondern die nach der Möglichkeit, in der Moderne, ausgehend von einem kritschen Standpunkt, überhaupt ethisch philosophieren zu können. Der Mooresche Idealismus ist mit realistischem Positivismus und logischem Atomismus unvereinbar, weshalb die Entwicklung von Russells Denken weg vom Idealismus und hin zu Wertrelativität und Emotivismus vor dem Hintergrund der Entwicklung seines strengen wissenschaftstheoretischen Denkens gut nachvollziehbar ist: die Wissenschaftlichkeit weist in diesem Punkt die Ethik in ihre Schranken. Eine weitere Grundkonstante bei Russell, ein sich einer rein emotivistischen Position widersetzender, leicht verschämter und versteckter Utilitarismus, entstammt hingegen eher dem Bedürfnis, über Moral zu diskutieren und eine Moral zu vertreten, und lehnt sich gewissermaßen gegen das Diktat der Wissenschaftstheorie auf. Russells Ethik ist stark von seinem außerethischen Philosophieren abhängig und erklärt sich aus und im Zusammenspiel mit diesem. Seine Präferenz für mathematische Logik und 27 seine realistische Erkenntnistheorie Wissenschaftlichkeit, die stehen idealistisches im Zusammenhang Philosophieren mit verunmöglicht. der strengen Der daraus erwachsende logische Atomismus und die analytische Semantik Russells sind Gründe seiner Präferenz für sprachanalytische Metaethik, die nach der Form ethischer Aussagen fragt anstatt nach deren Inhalt. Es wäre jedoch falsch, Russell bloß als Metaethiker zu sehen; seine Metaethik ist vielmehr angetrieben von einem starken normativen Impuls, und vielleicht könnte man so weit gehen, sie überhaupt als verkappte normative Ethik zu betrachten. Russell verkörpert exemplarisch die modernen Widersprüche zwischen Wissenschaft und Glauben, zwischen der Forderung nach kommunizierbarer Objektivität und erkenntnistheoretisch begründeter wie persönlich erlebter Subjektivität, zwischen der immer deutlicher werdenden Unmöglichkeit der Erklärung letzter Gründe und dem ungebrochenen Bedürfnis ebendanach. Wird das Feld der Wissenschaft allzu eng und streng abgegrenzt, fallen viele prominente Themen des intellektuellen Diskurses aus dem Rahmen der Diskutierbarkeit heraus in den Bereich bloßen Glaubens oder subjektiven Erfahrens – und somit in den Bereich des wissenschaftlichen Schweigens und unwissenschaftlichen Spekulierens. Russells Anstrengungen gehen dahin, eine Zwischenzone zu errichten, in der zwar nicht eigentlich von Wissenschaft die Rede ist, Auseinandersetzung und Überzeugung aber möglich bleibt. Ein Lösungsversuch für die auch dreißig Jahre nach Russells Tod noch maßgeblichen Dilemmata der Moderne, der trotz seiner äußerlichen Unattraktivität – nichts lässt sich genau festlegen und fundieren, Welterklärungsmodelle und Werte werden keine angeboten, doch ungeachtet dessen wird rege, komplex und zuweilen auch widersprüchlich darüber diskutiert – nicht nur interessant, sondern auch plausibel ist: ein selbst- und sprachkritischer Emotivismus, der die Möglichkeit offenlässt, frei vom Zwang, letzte Gründe nennen zu können, ethisch zu argumentieren. 28 6. Literatur 6.1 Quellen MACKIE, John Leslie: Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen. Übers. von R. Ginters. Stuttgart: Reclam 1981 (RUB; 7680). MOORE, George Edward: Principia Ethica. Cambridge: University Press 1960. RUSSELL, Bertrand: Philosophische und politische Aufsätze. Hg. von Ulrich Steinvorth. Stuttgart: Reclam 1971 (RUB; 7970). RUSSELL, Bertrand: Probleme der Philosophie. Uebers. u. Nachw. von Eberhard Bubser. Frankfurt: Suhrkamp 1976 (es; 207). RUSSELL, Bertrand: Russell on Ethics. Selections from the writings of Bertrand Russel. Hg. [und kommentiert] von Charles R. Pigden. London und New York: Routledge 1999 (Russells Text = ROE; Pigdens Text = PROE). 6.2 Sekundärliteratur MITTELSTRASS, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Mannheim u.a.: Bibliographisches Institut 1980–1996. NEWEN, Albert und von SAVIGNY, Eike: Analytische Philosophie. Eine Einführung. München: Fink 1996 (UTB; 1878). SLATER, John G.: Bertrand Russell. Bristol: Thoemmes 1994. WOLF, Jean-Claude: [Rezension von] Charles Pigden (ed.): Russell on Ethics […]. In: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 46 (1998), S. 342–346. REGENBOGEN, Anne und MEYER, Uwe (Hg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg: Meiner 1998. 29