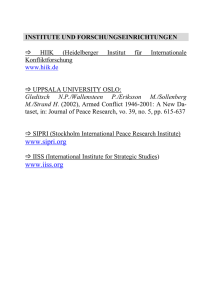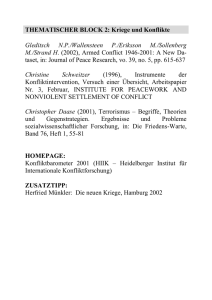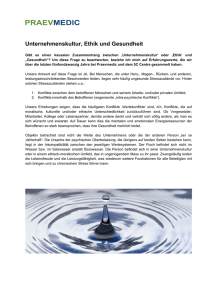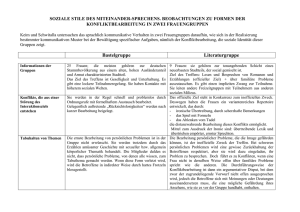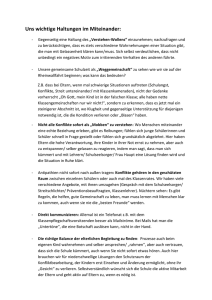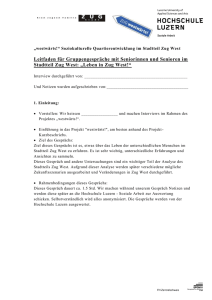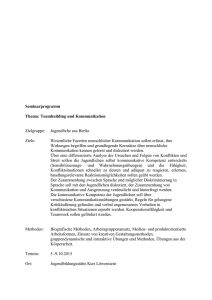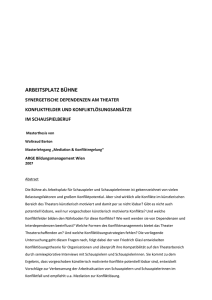Healing Communities: Kriegerische Konflikte und Soziale Arbeit
Werbung
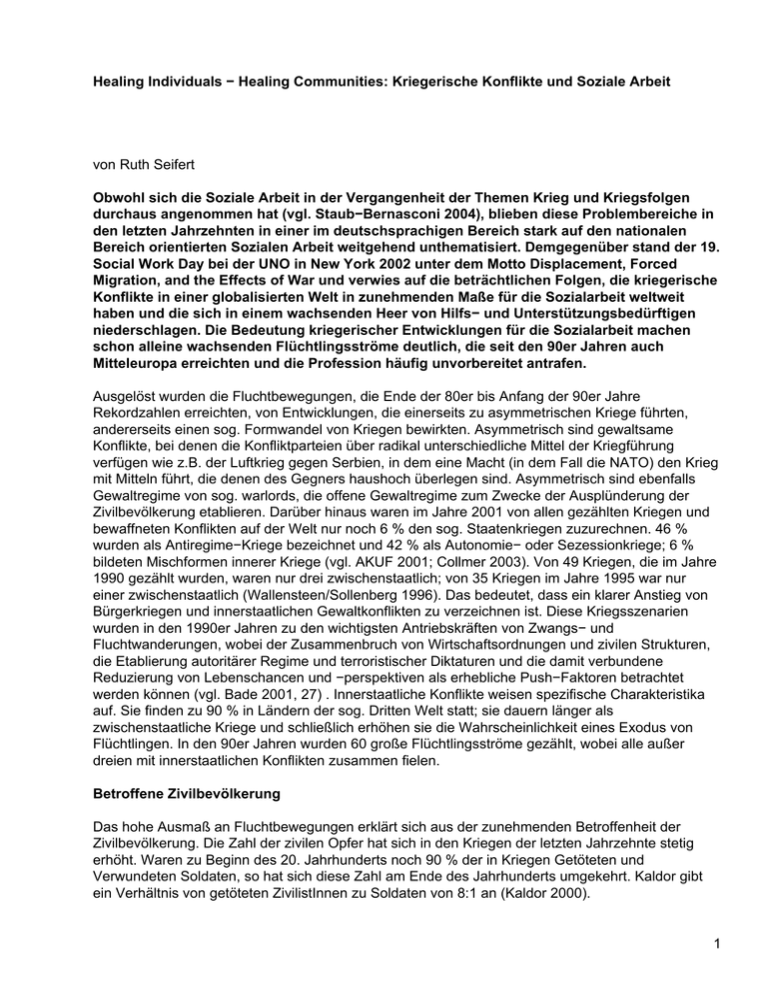
Healing Individuals − Healing Communities: Kriegerische Konflikte und Soziale Arbeit von Ruth Seifert Obwohl sich die Soziale Arbeit in der Vergangenheit der Themen Krieg und Kriegsfolgen durchaus angenommen hat (vgl. Staub−Bernasconi 2004), blieben diese Problembereiche in den letzten Jahrzehnten in einer im deutschsprachigen Bereich stark auf den nationalen Bereich orientierten Sozialen Arbeit weitgehend unthematisiert. Demgegenüber stand der 19. Social Work Day bei der UNO in New York 2002 unter dem Motto Displacement, Forced Migration, and the Effects of War und verwies auf die beträchtlichen Folgen, die kriegerische Konflikte in einer globalisierten Welt in zunehmenden Maße für die Sozialarbeit weltweit haben und die sich in einem wachsenden Heer von Hilfs− und Unterstützungsbedürftigen niederschlagen. Die Bedeutung kriegerischer Entwicklungen für die Sozialarbeit machen schon alleine wachsenden Flüchtlingsströme deutlich, die seit den 90er Jahren auch Mitteleuropa erreichten und die Profession häufig unvorbereitet antrafen. Ausgelöst wurden die Fluchtbewegungen, die Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre Rekordzahlen erreichten, von Entwicklungen, die einerseits zu asymmetrischen Kriege führten, andererseits einen sog. Formwandel von Kriegen bewirkten. Asymmetrisch sind gewaltsame Konflikte, bei denen die Konfliktparteien über radikal unterschiedliche Mittel der Kriegführung verfügen wie z.B. der Luftkrieg gegen Serbien, in dem eine Macht (in dem Fall die NATO) den Krieg mit Mitteln führt, die denen des Gegners haushoch überlegen sind. Asymmetrisch sind ebenfalls Gewaltregime von sog. warlords, die offene Gewaltregime zum Zwecke der Ausplünderung der Zivilbevölkerung etablieren. Darüber hinaus waren im Jahre 2001 von allen gezählten Kriegen und bewaffneten Konflikten auf der Welt nur noch 6 % den sog. Staatenkriegen zuzurechnen. 46 % wurden als Antiregime−Kriege bezeichnet und 42 % als Autonomie− oder Sezessionkriege; 6 % bildeten Mischformen innerer Kriege (vgl. AKUF 2001; Collmer 2003). Von 49 Kriegen, die im Jahre 1990 gezählt wurden, waren nur drei zwischenstaatlich; von 35 Kriegen im Jahre 1995 war nur einer zwischenstaatlich (Wallensteen/Sollenberg 1996). Das bedeutet, dass ein klarer Anstieg von Bürgerkriegen und innerstaatlichen Gewaltkonflikten zu verzeichnen ist. Diese Kriegsszenarien wurden in den 1990er Jahren zu den wichtigsten Antriebskräften von Zwangs− und Fluchtwanderungen, wobei der Zusammenbruch von Wirtschaftsordnungen und zivilen Strukturen, die Etablierung autoritärer Regime und terroristischer Diktaturen und die damit verbundene Reduzierung von Lebenschancen und −perspektiven als erhebliche Push−Faktoren betrachtet werden können (vgl. Bade 2001, 27) . Innerstaatliche Konflikte weisen spezifische Charakteristika auf. Sie finden zu 90 % in Ländern der sog. Dritten Welt statt; sie dauern länger als zwischenstaatliche Kriege und schließlich erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit eines Exodus von Flüchtlingen. In den 90er Jahren wurden 60 große Flüchtlingsströme gezählt, wobei alle außer dreien mit innerstaatlichen Konflikten zusammen fielen. Betroffene Zivilbevölkerung Das hohe Ausmaß an Fluchtbewegungen erklärt sich aus der zunehmenden Betroffenheit der Zivilbevölkerung. Die Zahl der zivilen Opfer hat sich in den Kriegen der letzten Jahrzehnte stetig erhöht. Waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 90 % der in Kriegen Getöteten und Verwundeten Soldaten, so hat sich diese Zahl am Ende des Jahrhunderts umgekehrt. Kaldor gibt ein Verhältnis von getöteten ZivilistInnen zu Soldaten von 8:1 an (Kaldor 2000). 1 Frauen werden in Konflikten dieser Art häufig zu kriegstaktischen Zielen. In besonderer Weise wurde dies im Konflikt im ehemaligen Jugoslawien deutlich, wo Frauen primär als Mitglieder einer bestimmten ethno−nationalen Gruppe − bosnisch, kosovo−albanisch, kroatisch oder serbisch − attackiert wurden. Eine Folge der genderspezifischen Aspekte neuer Kriege ist es, dass die Zugehörigkeit zu einer nationalen, ethnischen oder religiösen Minderheit und die damit verbundene Verfolgung die Hauptursachen für die Flucht von Frauen geworden sind (Schöttes 1995). Auch die Betroffenheit von Kindern ist hervorzuheben. Nach UNICEF−Angaben starben im letzten Jahrzehnt rund zwei Millionen Kinder in Folge kriegerischer Konflikte. Mindestens sechs Millionen Kinder sind aufgrund von Kriegsereignissen behindert oder ernsthaft krank. Mehr als eine Million sind Waisen oder von ihren Eltern getrennt und Millionen von Kinder sind innerhalb oder außerhalb ihrer Heimatländer auf der Flucht (Machel 2002). Als Folge der stetigen Zunahme kriegerischer Auseinandersetzungen dehnten sich zwei Bereiche innerhalb der Sozialen Arbeit aus: Zum einen die Flüchtlings− und Migrationsarbeit in den Empfängerländern, zum anderen die psychosoziale Arbeit, die Menschenrechtsarbeit und die Friedensarbeit in den betroffenen Nachkriegsgesellschaften − ein Bereich, der in Deutschland erst in allerjüngster Zeit in die Studiengänge und Curricula Eingang gefunden hat (vgl. Staub−Bernasconi 2004). Nach Angaben der amerikanischen National Association of Social Workers sind Sozialarbeiter in zunehmenden Maße in diesen Arbeitsgebieten tätig und werden primär bei der Rückführung von Flüchtlingen, beim Wiederaufbau sozialer Infrastrukturen und in internationalen Hilfsorganisationen eingesetzt. Derzeit sind bereits über 40 % des vom Amerikanischen Roten Kreuz in der internationalen Krisenarbeit eingesetzten Personals SozialarbeiterInnen und die Tendenz ist steigend (National Association of Social Workers 2003). Einbezug der Kulturen In diesen Arbeitsgebieten sind interkulturelle bzw. ethno−soziologische Kenntnisse auf der Helferseite von entscheidender Bedeutung: Auch Gewalt− und Kriegserfahrungen werden kulturell verschieden be− und verarbeitet. Die besonderen interkulturellen Problematiken dieser Arbeit können an einer Studie von Luci über das Schweigen der kosovo−albanischen Frauen über ihre im Krieg 1998/99 erfahrenen Vergewaltigungen exemplifiziert werden. Psychosoziale Organisationen vor Ort und in den Empfängerländern der Flüchtlinge stellten schnell fest, dass kosovo−albanische Frauen nicht redeten und waren häufig schnell mit einer Erklärung bei der Hand: Das Schweigen der Frauen sei zurückzuführen auf die patriarchale Unterdrückung in einer traditionalen Gesellschaft und die kulturelle Rückständigkeit der Frauen. Während damit zwar eine Seite des weiblichen Verhaltens erfasst werden kann, wird eine weitere ausgeblendet. Luci macht deutlich, dass eine Erklärung für das Schweigen zwar durchaus in patriarchalen Strukturen und Vorgaben gefunden werden kann, und dass dies berücksichtigt werden muss, wenn es um die Thematisierung von Menschenrechten für Frauen geht; dass sich aber kosovo−albanische Frauen andererseits über das Schweigen auch aktiv positionierten und versuchten, auf diese Weise den Zusammenhalt von Familien und Gemeinschaften zu retten, die durch die Offenlegung der Vergewaltigung auseinander gebrochen und funktionsunfähig gemacht worden wären. Das Ignorieren kriegsbedingter, sexueller Übergriffe stellte einen kulturellen Bewältigungsmechanismus dar, der auch als individuelle Coping Strategie dienen konnte (ausführlich Luci 2004). Wenn HelferInnen insistierten, dass die Betroffenen ihre Erlebnisse verbalisierten, konnte dies zum einen kontraproduktiv und eher schädlich als nützlich sein; zum anderen wurde den Betroffenen auf diese westliche Vorstellungen von individueller Psychologie und Problemlösung aufgezwungen, die kulturelle Gegebenheiten und kulturspezifische Problemlösungsstrategien ignorierten. Was viele Helfer und Helferinnen nicht besaßen, waren kultursensible Genderkompetenzen, die einer komplizierten Situation, in der es sowohl um das empowerment der Frauen in einem patriarchalen Setting, als auch um die Anerkenntnis ihrer kulturellen Bewältigungsstrategien ging, hätten entsprechen können. 2 Während kultursensible Kenntnisse über Traumata also wünschenswert sind, ist an dieser Stelle auf die mittlerweile massive Kritik zu verweisen, die von Seiten der Sozialen Arbeit und der Friedens− und Konfliktarbeit an einer schwerpunktmäßig psychologisch ausgerichteten Bewältigung von Kriegserfahrungen geübt wird (vgl. Stubbs 1999a/b; Pupavac 2000). Der Kern der Kritik besteht darin, dass Krisen und Problemlagen, die aus einem Angriff auf Gemeinschaften und Gesellschaften hervorgegangen sind, psycho−pathologisiert und an einzelnen Personen therapiert werden. Individualpsychologische Ansätze werden dabei auf ganze Bevölkerungen übertragen und zur Beschreibung politischen Verhaltens und seiner Folgen benutzt. Während es zweifellos viele Kriegsopfer gibt, die der psychologischen bzw. psychiatrischen Hilfe bedürfen, geht es demgegenüber bei der Nachkriegsarbeit im wesentlichen um die Wiederherstellung einer zerstörten Gemeinschaft oder Gesellschaft, deren Zerstörung das Leiden und die Dysfunktionalitäten der Individuen erst ausgelöst hat. HelferInnen unterliegen häufig der Versuchung, die Erfahrungen der Opfer zu medikalisieren. Durch die Psychiatrisierung des Problems wird aber zumeist der politische und gesellschaftliche Kontext ausgeblendet. Bei der Behandlung und Betreuung von Menschen, die kollektiver Gewalt ausgesetzt waren, hat man es allerdings nicht ausschließlich mit psychischen Zusammenbrüchen zu tun, sondern mit der Destruktion des gesamten Lebens− und Beziehungszusammenhangs der Betroffenen. Im Zentrum der Nachkriegs− und Krisenarbeit muss dementsprechend schwerpunktmäßig die kollektive Heilung stehen, d.h. die Sicherung des Lebens und der Aufbau eines Gemeinwesens sowie funktionierender sozialer Beziehungen und Netzwerke im Rahmen eines Bewältigungs− und Versöhnungsprozesses. Da der gesellschaftliche Wiederaufbau aufs engste mit der Entwicklung des Gemeinwesens verbunden ist, bringt die individualisierende, an westlichen Subjektvorstellungen orientierte psycho−soziale Intervention in den Augen vieler BeobachterInnen mehr Schaden als Nutzen, denn der zunehmende Einsatz psychosozialer Instrumente zerstört in der Tendenz gewachsene Beziehungsgeflechte, erhöht die Verletzbarkeit von Individuen und schwächt das Sicherheitsgefühl in Gemeinschaften (so Pupavac 2000, 12). Resümierend kann der Stand der Debatte dahingehend zusammengefasst werden, dass sozialarbeiterische und gemeinwesenorientierte Ansätze in der Nachkriegs− und Krisenarbeit dringend der Aufwertung bedürfen, da sie sowohl den betroffenen Gesellschaften als auch den vorgefundenen Problemlagen angemessener sind als Instrumentarien der Individualpsychologie. Aber nicht nur die Arbeit vor Ort, auch die Flüchtlingsarbeit in den Empfängerländern muss auf ihre Auswirkungen hin befragt werden. Die Bedeutung sozialpolitischer und sozialarbeiterischer Maßnahmen für die Entwicklung von Ethnizität und nationaler Identität zeigte Korac in einer vergleichenden Untersuchung der Flüchtlingspolitik mit Kriegsbetroffenen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Italien und den Niederlanden. Ironischerweise führte gerade eine defizitäre Flüchtlingspolitik in Italien, wo kaum Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt wurden, zur Annäherung und Aussöhnung der (zuhause verfeindeten) Ethnien, die in der Diaspora auf gegenseitige Hilfe angewiesen waren und notgedrungen die Bildung von Unterstützungsnetzwerken betreiben mussten. Auf spezifische Ethnien ausgerichtete Hilfsprogramme, wie sie in den Niederlanden angeboten wurden, bestärkten und förderten hingegen ethno−nationale Identifikationen (ausführlich Korac 2004). Aus diesen Befunden lassen sich keine glatten Formeln für die Flüchtlingspolitik oder sozialarbeiterisches Verhalten ableiten. Weitere Forschungsarbeiten nötig Es wäre offensichtlich verfehlt, im Sinne einer möglichen Annäherung ethno−politischer Gruppen auf psychosoziale Hilfen zu verzichten oder sie unbesehen der Bedürfnislage allen Gruppen in gleicher Weise zukommen zu lassen. Korac´ Befunde zeigen allerdings, dass die Soziale Arbeit, will die ungewollte Effekte vermeiden, dringend auf einschlägige Forschungsarbeiten angewiesen ist, die sich mit Ethnizität, ethno−nationalen Konflikten und sozialen Dynamiken in 3 Flüchtlingspopulationen beschäftigen. Die Soziale Arbeit mit Kriegsflüchtlingen in den Empfängerländern wie die vor Ort kann von den Diskursen der Friedens− und Konfliktarbeit nicht mehr getrennt werden. Soziale Arbeit ist neben politischen Lösungsversuchen und diplomatischen Verhandlungen eine wichtige Säule der Bearbeitung globaler Konflikte, indem sie die Beziehungsseite von Konflikten thematisiert und auf diesem Gebiet zur De−Eskalation von Konflikten beitragen kann (vgl. zur Rolle der Sozialarbeit aus Sicht der Friedens− und Konfliktforschung Fischer 2004). Resümierend ist zu sagen: Will man zukünftige SozialarbeiterIinnen auf die Arbeit in einer globalisierten Weltgesellschaft vorbereiten, so werden Angebote zur Theorie und Praxis kollektiver Konflikte, zu ihren Hintergründen und Ursachen, zu den Dynamiken der Konflikteskalation und den Methoden ihrer Beilegung an der Basis der Gesellschaft jenseits politischer und diplomatischer Intervention unerlässlich sein. Literatur: AKUF. Das Kriegsgeschehen 2001 im Überblick. Online: www.sozialwiss.uni−hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege_aktuell.htm. Bade, Klaus, J., Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Ende des 20. Jahrhunderts, in: ders. (Hsg.), Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Ende des 20. Jahrhunderts, Osnabrück 2001. Becker, David, Trauerprozesse und Traumaverarbeitung im interkulturellen Kontext, in: Ztschr. für Politische Psychologie, Jg. 7, 1999. Collmer, Sabine, New War? Vom Staatenkrieg zu den irregulären Kriegen des 21. Jahrhunderts, in: dies. (Hsg.), Krieg, Konflikt und Gesellschaft. Aktuelle interdisziplinäre Perspektiven, Hamburg 2003. Fischer, Martina, Recovering from Violent Conflict: Regeneration und (Re−)Integration as Elements of Peacebuilding, in: Austin, Alex/Martina Fischer/Norbert Ropers (eds.), Transforming Ethnopolitical Conflict. The Berghof Handbook, Wiesbaden 2004. Kaldor, Mary, Neue und alte Kriege. Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt/M. 2000. Korac, Maja, Living Ethnicity in Exile: Identity Processes of Refugees from the Former Yugoslavia, in: Ruth Seifert (Hg.), Gender, Identität und kriegerischer Konflikt. Das Beispiel des ehemaligen Jugoslawien, Münster 2004. Luci, Nita, Das Schweigen der Frauen. Genderkonstruktionen und Genderdynamiken in Vor− und Nachkriegs−Kosova, in: Ruth Seifert (Hsg.), Gender, Identität und kriegerischer Konflikt. Das Beispiel des ehemaligen Jugoslawien, Münster 2004. Machel, Graca, The Impact of Armed Conflict on Children, UNICEF 2002. National Association of Social Workers, Issue Fact Sheet , Pressroom 2003. News − IFSW Message to the 19th Social Work Day at the UN, New York 2002. Pupavac, Vanessa, Securing the Community? An Examination of International Psychosocial Intervention Schmeidl, Susanne, Conflict and Forced Migration: A Quantitative Review, 1964−1995, in: Zolberg, Aristide R./Peter M. Benda (eds.), Global Migrants, Global Refugees. Problems and Solutions, New York 2001. Schöttes, Martina, Fluchtgrund: weiblich. Frauenspezifische Verfolgung und Fluchtmuster, in: Blätter des Informationszentraums 3. Welt, 203/1995. 4 Staub−Bernasconi, Kriegerische Konflikte und Soziale Arbeit − ein altes und neues Thema der Sozialarbeit, in: Ruth Seifert (Hsg.), Soziale Arbeit und kriegerische Konflikte, Münster 2004. Stubbs, Paul, From Pathology to Participation? Reflections on Local Community Development Programmes in Bosnia and Croatia and Prospects for the Future, in: Journal of Social Work Theory and Practice 1/1999. Wallensteen, Peter/Sollenberg, Margareta, The End of International War? Armed conflict 1989−95, in: M. Sollenberg (ed.), States in Armed Conflict 1995, Uppsala 1996. Zur Autorin: Ruth Seifert, Dr. phil., Prof. für Soziologie arbeitet an der FH Regensburg. Aktuelle Forschungsinteressen: Ethno−politische Konflikte, Soziale Arbeit in der Nachkriegs−Rekonstruktion, Gender und krisenhafte Entwicklungen. Die Autorin führt derzeit ein DAAD−Kooperationprojekt mit denFachhochschulen München und Landshut sowie den Universitäten Prishtina undTirana durch mit dem Titel Installing Social Work Modules at the University of Prishtina. www.avenirsocial.ch 5