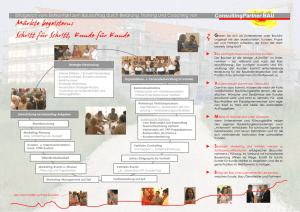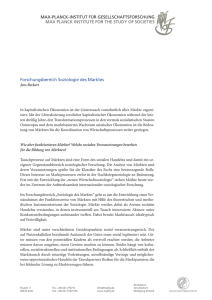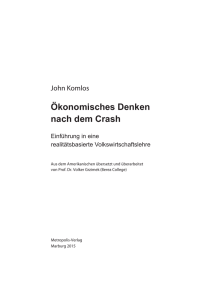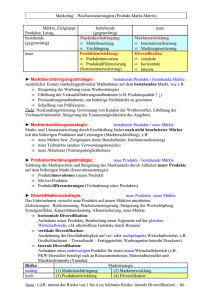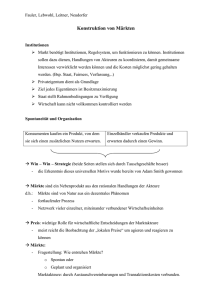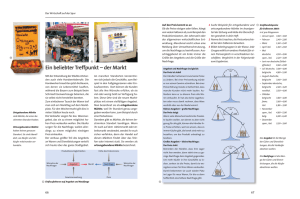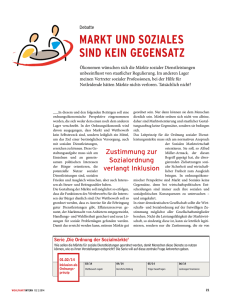Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie
Werbung

Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie These zur Begründung einer soziologischen Disziplin Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doctor rerum politicarum der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz Vorgelegt von Steffen Roth Fribourg, CH Gutachter Prof. Dr. Manfred Moldaschl Prof. Dr. Ralf Wetzel Prof. Dr. Dirk Baecker Chemnitz, 2009 ԱՐՄԻՆԿԱ Meinen ersten Worten in Deiner Sprache Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 5 Dankesworte Eine Doktorarbeit, zumal die eines Systemtheoretikers, ist niemals eine Einzelleistung. Mein aufrichtiger Dank gilt daher: Prof. Manfred Moldaschl (Technische Universität Chemnitz), der nicht nur als Verfahrensleiter, sondern gewissermassen als zwei Professoren in einer Person für das Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswissenschaften und Soziologie steht, in dem sich diese Arbeit ebenso bewegt wie meine eigene Biographie, und dabei Massstäbe setzt in Sachen spitze Feder, Streitkultur und Reflexivität. Prof. Ralf Wetzel (Berner Fachhochschule), der wohl am vorbehaltlosesten an mich geglaubt und mir so ungeahnte Freiräume eingeräumt hat. Dabei ist es ihm ausgerechnet an einer Fachhochschule gelungen, ein Grundlagenforschungsklima zu erzeugen, von dem diese Arbeit ungemein profitieren konnte. Prof. Dirk Baecker (Zeppelin-University Friedrichshafen), der mich bei Ehrgeiz und Ehre packte, für das Fenster zum Bodensee, das er damals öffnete. Auch dass er es dem angehenden Betriebswirt nachsehen konnte, dass dieser eine Neigung zur Menge und daher nicht immer die Form gewahrt hat. Prof. Sandro Cattacin (Université de Genève) für Perspektiven am Genfer See, für unschätzbare Lektionen entlang der versteckten Lehrpläne der Soziologie zwischen Genf, Bern und Prag sowie für das Kostbarste: seine knappe Zeit, mit der er mich nahezu verschwenderisch beschenkt. 6 Steffen Roth Den Mitglieder des PVLC dafür, dass sie die Idee, uns gegenseitig an der schieren Wochenmenge geschriebener Seiten zu messen, durch die Qualität des Geschriebenen adelten: Andra Aldea-Partanen (University of Oulu), Nikolay Trofimov (Russische Akademie der Wissenschaften), Ass. Prof. Hardik Vachhrajani (Amrita Business School), unserem Schnellsten; und schliesslich Lukas Scheiber (Universität Stuttgart), dem smarten Denker, Weggefährten zwischen den zwei Seen, der den Gangstersoziologen mehr als einmal nachdenklich gemacht hat. Schliesslich Prof. Ulrich Wagner (Berner Fachhochschule) für seinen performance based view meiner Person; Prof. Artur Mkrtichyan (Yerevan State University) für das Vergnügen einer anhaltenden Korrespondenz nach mehr als nur einschlägigen Gesprächen in Yerevan und Konstanz; Nada Endrissat (Berner Fachhochschule) für die ein oder andere Neujustierung meiner Augenhöhe; Justine Grønbæk Pors, Prof. Niels Åkerstrøm Andersen und Assoc. Prof. Niels Thyge Thygesen (alle Copenhagen Business School) für die Einladung zum polyphonen Vortragsbrunch im Hotel Geneva; meinen Schwiegereltern Sergey Shatyan und Susanna Shahbazyan für eine ebenso ausgedehnte wie notwendige Reise nach Fribourg; und zu guter Letzt meinen Eltern, Günter und Agnes-Maria Roth, die mir, als Eltern wie als Lehrer, nicht nur die Sprache beigebracht haben, in der diese Arbeit verfasst ist, sondern sich auch die Zeit genommen haben, die Qualität ihrer Arbeit an meiner zu prüfen. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 7 Inhaltsverzeichnis Dankesworte 5 Kapitel I Der Markt! Zum Anliegen einer allgemeinen Marktsoziologie 9 Kapitel II Mehr Markt! Die Märkte der Ökonomik Der Markt als Wirtschaftsraum (A)Historische Märkte Soziales Marktwirtschaften Zusammenfassung: Markt und Wirtschaft im Zentrum der Gesellschaft 13 13 16 19 29 Kapitel III Weniger Markt! Die Märkte der Wirtschaftssoziologie Das Entstehen der Wirtschaftssoziologie Das Entstehen der neuen Wirtschaftssoziologie Varianten der neuen Wirtschaftssoziologie Zusammenfassung: Grenzen der alten und neuen Wirtschaftssoziologie 31 32 37 41 56 Kapitel IV Viele Märkte! Marktsoziologie jenseits der Wirtschaftssoziologie? Die vielen Märkte der neuen Wirtschaftssoziologie Vom Kapital ohne Märkte Polyphone Organisation und monolithischer Markt Zusammenfassung: Nicht-ökonomische Märkte als Forschungslücke? 60 66 70 75 85 Kapitel V Ganze Märkte! Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie Stiefkinder der Wirtschaftssoziologie Marktkalkül und Mengenlehre 89 92 121 8 Steffen Roth Spuren nicht-ökonomischer Märkte Zusammenfassung: Die Märkte einer neuen Marktsoziologie 155 160 Kapitel VI Neue Märkte! Aussichten einer allgemeinen Marktsoziologie 171 Abbildungsverzeichnis 186 Abkürzungsverzeichnis 187 Literaturverzeichnis 188 Anhang I - Erklärung 227 Anhang II - Angaben zum wissenschaftlichen Werdegang Lebenslauf Publikationen Konferenzen 228 230 234 Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 9 Kapitel I Der Markt! Zum Anliegen einer allgemeinen Marktsoziologie Wenn von Märkten die Rede ist, dann denken wir an Gütermärkte (Weber 1980), an Preisbildungsmechanismen (Coase 1990), an „sets of money-mediated exchange transactions (Zafirovski 2007: 313) oder schlicht an die „innere Umwelt des Wirtschaftssystems“ (Luhmann 1988: 91). Die Idee von der ökonomischen Natur des Marktes erscheint uns dabei so selbstverständlich, dass allein der Versuch, das Gegenteil zu behaupten, bestenfalls naiv erscheint, und gleichwohl als angriffslustig gilt, wenn er dennoch unternommen wird: Wer von nicht-ökonomischen Märkten spricht, setzt sich entsprechend rasch dem Verdacht aus, reduktionistisch zu argumentieren, also ökonomische Modelle auf Bereiche der Gesellschaft anzuwenden, für die Ökonomie und Ökonomik eben gerade nicht zuständig sind. Vermarktlichung meint Ökonomisierung. Die Ausweitung des Geltungsbereichs des Marktprinzips auf nicht-ökonomische Sphären der Gesellschaft zu fordern stellt demnach eine Form des ökonomischen Kolonialismus dar, dem allen voran der Marktsoziologe aktiv entgegen zu wirken hat, eben gerade weil er sich bislang als Wirtschaftssoziologe versteht. Das Problem liegt dann aber rasch in der Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes: Wer vom exklusiv ökonomischen Charakter des Marktes spricht, wendet funktionale Differenzierung auf einen Gegenstand an, der daraufhin als dessen eigener Ausschnitt definiert wird. Ein logisch fragwürdiges Unterfangen, das, wenn es überhaupt gelingen kann, dann auch die Frage offen lässt, inwieweit sich ein rein ökonomisch definierter Marktbegriff überhaupt zur Untersuchung von Märkten in Weltregionen und Erd- 10 Steffen Roth zeitaltern eignet, in denen die funktionale Differenzierung keine oder zumindest keine zentrale Rolle spielt(e). Entsprechend sieht die vorliegende Arbeit ihr Anliegen in der Entwicklung eines allgemeinen Marktbegriffes, auf den funktionale (wie jede andere Form der) Differenzierung angewendet werden kann, ohne dass sie bereits vorausgesetzt werden muss. Dieses Anliegen vollzieht sich dabei vor dem Hintergrund der These, dass es neben wirtschaftlichen auch nicht-wirtschaftliche Märkte gibt, und die Marktsoziologie entsprechend nicht länger als Teilgebiet der Wirtschaftssoziologie betrachtet werden kann. Diese im aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurs naheliegender Weise als antievident gehandelte These wird sie zudem auf Grundlage der in eben diesem Diskurs gewonnenen Evidenzen belegen lassen. Mit anderen Worten: Die Argumente für die Existenz nicht-ökonomischer Märkte und damit auch die Notwendigkeit einer Marktsoziologie, die sich nicht länger als Teilgebiet der Wirtschaftssoziologie begreift, werden aus dem wirtschaftssoziologischen Diskurs selbst herausgearbeitet. Vor diesem Hintergrund baut sich die Arbeit wie folgt auf: Im folgenden Kapitel II wird der Markt als eine, wenn nicht die zentrale Kategorie der Ökonomik vorgestellt. Das geschieht durchaus nur skizzenhaft, gewissermaßen in Vorbereitung des Kapitels III, in dem gezeigt wird, dass und wie das Gros der Wirtschaftssoziologie die Idee, Märkte seien zentrale und vor allem rein wirtschaftliche Institutionen zeitgenössischer Gesellschaften, durch eben die Art und Weise letztlich bestätigt, in der sie sie vordergründig bekämpft. Kapitel IV bezieht den Gegenstand der Arbeit daraufhin auf Forschungslücken, die sich aus dem Fehlen eines allgemeinen Marktbegriffes, der auch die Existenz von nicht-ökonomischen Märkten fassen kann, ergeben. In Kapitel V vollzieht sich dann die Operationalisierung sowie der mit den Mitteln der Wirtschaftssoziologie, aber gegen deren eigenen Marktbegriff, geführte Beweis der These von der Existenz nichtökonomischer Märkte und damit der notwendigen Eigenständigkeit der Marktsoziologie. Anliegen ist also nicht die Aus-, sondern vielmehr die Herausdifferenzierung der Marktsoziologie aus der Wirtschaftssoziologie. In diesem Sinne verfolgt die Arbeit vier Strategien: Die Begründung der These erfolgt erstens mit Verweis auf die Arbei- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 11 ten von James Coleman, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann und Dirk Baecker, die von Wirtschaftssoziologen allesamt als Wirtschaftssoziologen rezipiert werden, obgleich sie der Idee nicht-ökonomischer Märkte weitestgehend offen gegenüber stehen. Auf den Beiträgen der genannten Autoren kann die Arbeit damit zweitens nicht nur inhaltlich sondern auch strategisch aufbauen im Hinblick auf ihr Anliegen, einen über die Ökonomie hinausweisenden Marktbegriff nicht einfach nur antithetisch neben den der Wirtschaftssoziologie zu stellen, sondern ihn vielmehr aus deren Mitte heraus als einzig logische Alternative zu entwickeln. Zur entsprechenden Beweisführung bedient sich die Arbeit dabei einer systemtheoretisch informierten Mengenlehre. Im Ergebnis wird sich so zeigen lassen, dass die in wirtschaftssoziologischen Kreisen prominent diskutierte Idee der (Notwendigkeit einer verstärkten) sozialen Einbettung von Märkten zwingend nach einem trans-ökonomischen Marktbegriff verlangt. Diesem strategischen Argument stellt die Arbeit dann drittens auch historische, archäologische und ethnologische Spuren nicht-ökonomischer Märkte zur Seite, die bis in die Frühzeit der Gesellschaftsbildung reichen. Im Rückgriff auf diese empirischen Spuren sowie auf Grundlage einer trans-ökonomisch gewendete Theorie sozialer Systeme entwickelte die Arbeit viertens einen allgemeinen Marktbegriff, der einer apriorischen Assoziation des Marktes mit der Wirtschaft in keiner Weise bedarf und auf den die Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Märkten damit ebenso neutral angelegt werden kann wie die zwischen usbekischen und nicht-usbekischen. Nicht im unversöhnlichen Gegensatz zum Marktbegriff der Wirtschaftssoziologie, wohl aber weit über diesen hinausgehend, wird sich noch im selben Kapitel zu guter Letzt der Gegenstand einer allgemeinen Marktsoziologie bestimmen lassen: Die Kommunikation zwischen Organisationen, d.h. zwischen den einzigen sozialen Systemen, die in der Lage sind, mit anderen sozialen Systemen zu kommunizieren. Dabei wird mit Blick auf die Geburtsstunden des Marktprinzips gezeigt werden, dass der Markt als Nexus der Kommunikation zwischen sozialen Systemen die Lösung des Problems der Kommunikation zwischen Gesellschaften darstellt, die 12 Steffen Roth ihrerseits sowohl ökonomische wie nicht-ökonomische Formen annehmen kann. In Kapitel VI werden schliesslich Forschungsfragen diskutiert, die im Rahmen dieser Arbeit nicht oder nur in Ansätzen beantwortet werden konnten. Dabei stehen neben der Frage nach den Ursachen der Entwicklung zum aktuell ökonomisch verzerrten Marktverständnisses vor allem zwei Gedanken im Vordergrund: Zum einen gilt es ein Theorieproblem zu lösen, das in Form der Frage vorliegt, ob sich die Kommunikation zwischen Organisationen, sozialen Systemen also, fundamental von der zwischen Bewusstseinssystemen, und schliesslich der zwischen einem sozialen und einem Bewusstseinssystem, unterscheidet. Zum anderen lässt sich aus der Idee von der Existenz ökonomischer und nicht-ökonomischer Märkte eventuell auch auf die Existenz von Wechselkursen zwischen diesen nun eben nicht geographisch, sondern funktional differenzierten Märkten schliessen. Damit lässt sich die Idee der historisch kontingenten und damit hochvariablen relativen Wertigkeit der einzelnen Funktionssysteme der Gesellschaft fassen, auf deren Grundlage sich schliesslich neue Formen der Analyse und des Vergleichs von sozialen Systemen bis hin zu ganzen Gesellschaften entwickeln liessen. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 13 Kapitel II Mehr Markt! Die Märkte der Ökonomik Wenn wir von Märkten sprechen, dann denken wir an Wirtschaft. Wie einst die ökonomischen Klassiker stellen wir uns den Markt dabei noch immer gerne als Marktplatz vor. Angesichts globaler Finanz-, Wirtschafts- und Umweltkrisen entfaltet die Idee eines lokalisierbaren, überschaubaren und damit auch irgendwie greifbaren Marktes durchaus Charme. Dass der Finanzmarktkapitalismus aber auch in einer im umfassendsten Wortsinn lokalen Wirtschaft1 seine Blüten treiben kann, zeigte bereits die weitestgehend auf die Vereinigten Niederlande beschränkte Tulpenmanie von 1634-1637, in der Tulpenzwiebeln in einer Art gehandelt und beständig nachgezüchtet wurden, die uns aktuell wieder beunruhigend vertraut erscheint. Dieser Fingerzeig einer invisible hand, die auch mit grünem Daumen (vgl. Siebert 1989) noch uneingeschränkt das Marktprinzip (Thielemann 1996) entfalten kann, lenkt unsere Aufmerksamkeit aber sogleich in weniger konkrete Sphären markt-wirtschaftlichen Denkens. Der Markt als Wirtschaftsraum Die Vorstellung vom Markt als dem räumlich gedachten „Gebiet, auf dem Tausch stattfindet“ (Swedberg 2007: 12) wurde bereits im 18. 1 Damals vertraten in allen namhaften Städten der Vereinigten Niederlande ausgewählte Wirtshäuser, in denen Angehörige aller Schichten um Tulpenzwiebeln handelten, offiziell die jeweilige Börse (vgl. etwa Jacob 1929: 50; Mayer 1938: 14). 14 Steffen Roth Jahrhundert von Adam Smith um „(d)as abstrakte Konzept des Marktes als der Summe aller möglichen Tausch- bzw. Handelsbeziehungen“ (Bluhm und Malowitz 2007: 7) ergänzt. Ähnlich bezeichnete später auch Alfred Marshall (1925) den Markt räumlich als district2, zielte dabei aber auf eine kritische Menge an rational handelnden und wohlinformierten Wirtschaftssubjekten, die mehr oder weniger absichtsvoll an der Herstellung von Preisgleichgewichten beteiligt sind. Und auch wenn vom Markt als Dschungel die Rede ist, denkt man nicht nur an Weltregionen mit Urwaldbestand, sondern man hat auch die Schattenseiten3 im Blick, die den Markt als unüberschaubaren und somit anonymen Nexus wechselseitiger Beobachtungen unter den Bedingungen von existenzieller Knappheit und hohem Selektionsdruck charakterisieren. Auch die Vertreter der klassischen Ökonomik beobachteten zunächst die unterschiedlichen realen Märkte, interessierten sich dabei aber bald auch für deren logische Angleichung über die Identifikation natürlicher oder zumindest naturrechtlicher Gesetze erfolgreicher Marktwirtschaft, die auf all diesen konkreten Märkten gleichermassen Geltung haben und deren Befolgung den Wohlstand der Nationen sichern (sollte). Bereits der Titel von Adam Smiths Standardwerk zeigt dabei, dass wir die Analyseeinheiten der frühen Marktforscher längst nicht mehr nur in lokalen Marktplätzen vermuten dürfen. Ganz im Gegenteil vollzog sich die Ausdifferenzierung der zunehmend eigenlogischen Wirtschaftswissenschaften zunächst als Entdeckung der Konsequenzen, die die Entdeckung der Neuen Welt auf den Kreislauf des Geldes im frühneuzeitlichen Staatskörper hatte: Man erkannte zum einen, dass der Zufluss von Edelmetall aus Amerika die Waren teurer machte. Da man für die gleiche Ware beständig mehr Edelmetall aufwenden musste, galt Geld bald nicht mehr als wertvoll, weil es aus Edelmetall besteht, sondern umgekehrt Edelmetall als wertvoll, weil es Geld ist (vgl. Foucault 1971: 222). Neugierig wurde zum anderen beobachtet, 2 3 „A perfect market is a district, small or large, in which there are many buyers and sellers …” (Marshall 1925: 112). „Disorder, chaos, jungle, or madness“ (Zafirovski 2003: 93). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 15 „dass das amerikanische Gold sich in Europa ausbreitete, Waren kaufte, die Manufakturen wachsen liess, während Spanien ärmer zurückblieb, als es jemals gewesen war. England dagegen hat, wenn es Metall jemals an sich gezogen hat, immer die Arbeit davon profitieren lassen und nicht allein den Luxus seiner Bewohner, das heisst, es hat mit dem Metall vor jeglicher Preissteigerung die Zahl seiner Arbeiter und die Menge seiner Produkte erhöht“ (Foucault 1971: 238). Entlang dieser und weiterer Beobachtungen ließen sich die Redistributionsmechanismen der einzelnen europäischen Staatshaushalte, d.h. die konkurrierenden Varianten des später durch Adam Smith erstmals4 so bezeichneten Merkantilismus, zunehmend im Hinblick auf deren Performance in Sachen Konzentration von Reichtümern, und damit nicht zuletzt auch auf militärische Spielräume und das politische Überleben der betreffenden Staaten und Reiche vergleichen. Das Metall aus den amerikanischen „Dschungeln“ hatte Europa seinerseits in den o.g. Dschungel des merkantilistischen Wirtschaftskrieges verwandelt. Mit Blick auf die Haushaltsstrategien der konkurrierenden Mächte standen nun auch innerhalb der eigenen Machtsphäre traditionelle, feudale Formen der Investition, Produktion und Verteilung zunehmend zur Disposition. Entsprechend stellte sich zunehmend die Frage, was an deren Stelle zu treten hätte. Die klassische Ökonomik bot sich vor diesem Hintergrund an als „Antwort auf die Probleme, die der Zerfall der Feudalgesellschaft (...) aufwarf. (...) Die aus den Fugen geratene Welt muss wieder gefestigt werden, ohne dass unmittelbar und unreflektiert auf Tradition und Religion zurückgegriffen werden könnte“ (Roetz 2006: 35, formuliert im Hinblick auf die Entstehung der klassischen chinesischen Philosophie). Wie einst die Philosophie in Griechenland und China (vgl. Hösle 1997: 699) lange vor ihr, so blühte auch die Ökonomik als eine ihrer Verzweigungen in einer Zeit der streitenden Reiche auf. Die Alternative, die die klassische Ökonomik damit anbot, hätte grundsätzlicher kaum sein können: Während im Merkantilismus die Frage der regionalen 4 Merkantilismus als “(d)ie Wirtschaftspolitik, die erstmals von Adam Smith Merkantilismus, in Frankreich Colbertismus (…) und in Deutschland Kameral(ismus)” genannt wird (Vgl. Menzel 1992: 78). 16 Steffen Roth Begrenzung, der sozialstrukturellen Einbettung und der geopolitischen Instrumentalisierung der Wirtschaft im Vordergrund stand, lautet der Gegenentwurf der klassischen Nationalökonomie nun: Der Markt als „arena of free competition“ (Zafirovski 2003: 70), d.h. letztlich die Abschaffung feudaler Handelsbeschränkungen in Form von Monopol-Privilegien und Zöllen, führe zu natürlichen Preisen und damit stets zu einem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. (A)Historische Märkte Im Übergang von der klassischen zur marginalistischen Ökonomik kommt der Markt dann immer weniger als Ort, statt dessen nun als ein sich selbstregulierender Preismechanismus ins Spiel: „Ökonomen verstehen unter dem Begriff Markt nicht einen bestimmten Marktplatz, auf dem Güter gekauft und verkauft werden, sondern die gesamte Region, innerhalb derer Käufer und Verkäufer sich in solch freiem Austausch befinden, dass Preise gleichartiger Güter sich leicht und schnell einander anpassen“ (Cournot 1925: 55). Im Kern dieses Marktbegriffes steckt nun ein zeitliches Argument: Marktwirtschaft ist nicht nur Kosten-Nutzen-rational, sondern das auch noch schnell. Vor dem Hintergrund der auch unter Merkantilisten anschlussfähigen Idee, dass die Gravitationszentren des Wohlstandes dort zu finden seien, wo das Geld schnell zirkuliert (vgl. Foucault 1971: 216), bietet sich die Marktwirtschaft dem Wohlstand der Nationen nicht mehr nur als ein u.U. verteilungsgerechter interner Distributionsmodus an, sondern eben auch als ein im Zeitalter der streitenden Wirtschaftsreiche durchaus wettbewerbsfähiges Allokationsprinzip. Damit lässt sich die Entwicklung des Prinzips nationaler Marktwirtschaften also zum einen als Internalisierung der externen Konkurrenzsituation interpretieren5. 5 D.h. als ein Vorgang, der sich mit Blick auf die Konversion landwirtschaftlicher Genossenschaften auch im Kontext der aktuellen Globalisierungswelle Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 17 Zum anderen lässt sich die Geschichte des Marktmodells der klassischen Ökonomik aber auch als Exportgeschichte eines Britischen Wirtschaftsmodells erzählen. Ironisch fällt dabei dann auf: Während damals wie heute argumentiert wird, dass mehr Freiheit die Wirtschaft schneller und flexibler machen würde, lernen wir aus der Wirtschaftsgeschichte der Britischen Inseln, dass institutionalisierte Langsamkeit mitunter frei macht, wie uns der Umstand lehrt, dass im Vereinigten Königreich die Verlagerung des Rechtes, Monopole zu verleihen, in die Hände des Parlaments (vgl. Beck 1897: 782) zum Aussterben entsprechender Privilegien und damit entscheidend zur Durchsetzung des Marktmechanismus führte, schlicht, weil die für die Beschaffung der für ein Monopol notwendigen Mehrheit zu (zeit)aufwendig gewesen wäre. In diesem Sinne gehört der Markt dann zu den „historisch-ökonomischen Kategorien“ (Sombart 1930: 247). Auch der Wert der Waren, die auf dem Markt gehandelt werden, wird über deren Produktionskosten errechnet, ergibt sich demnach aus deren Produktionsgeschichte. An genau diesem Punkt widersprach Heinrich Hermann Gossen, dessen „Theorie des Nutzens“ (1854/1987) den Grundstein zur marginalistischen Revolution legte: „Die ‚kopernikanische Wende’ sieht Gossen in der Ableitung des Wertes aus dem Grenznutzen statt aus dem Produktionskosten, in der subjektiven Wertschätzung von Gütern anstelle von den Gütern objektiv anhaftenden Werten“ (Kolb 1997: 120). Demnach besagen die aus seinem Werk abgeleiteten Gossenschen Gesetze zum einen, dass der Konsum eines bestimmten Wirtschaftsgutes dem Konsumenten mit zunehmender Menge einen zunehmend geringeren Zusatznutzen (Gesetz des sinkenden Grenznutzens); und zum anderen, dass unter der Bedingung vielfältiger Bedürfnisse maximalen Nutzen dann erreicht wird, wenn alle Bedürfnisse gleichermassen befriedigt werden (Gesetz des Ausgleichs der Grenznutzen). Märkte sind demnach Wirkungsräume von Grenznutzengesetzen (vgl. Zafirovski 2003: 72). Mit den beiden Konzepten der Bedürfnissättigung und des Optimierungskalküls mutieren bei Leon Walras, Carl Menger und Willibeobachten lässt, ironischer Weise dann aber eben gerade im Zuge der Liberalisierung des Weltagrarmarktes (vgl. Roth 2005). 18 Steffen Roth am Jevons als den prominentesten Vertretern des Marginalismus bald zwei gewissermassen zeitlose Prinzipien zu den Grundgesetzen der Wirtschaft und des Marktes, den man sich in der Tradition von Augustin Cournot, dem Begründer der mathematischen Wirtschaftsforschung, nun zunehmend in Form von Formeln vorstellt. Dabei geht es stets um eine Zielfunktion, die unter Annahme spezifischer Randbedingungen optimiert werden soll; und damit korrespondiert dann ein entsprechendes Menschenbild: Das Wirtschaftssubjekt der Marginalisten ist nun der beständig kalkulierende, nutzenoptimierende homo oeconomicus, der seinesgleichen in Mengers Zwei-Mann-Märkten gegenübertritt, in denen sich Tauschverhältnisse mit mathematischer Präzision berechnen lassen. Die Versuche, die verschiedensten Formen wirtschaftlicher Beziehungen ausgerechnet mit den Mitteln der Naturwissenschaften zu analysieren, sind dabei nicht unwidersprochen geblieben. Bereits John Stuart Mill (1868: 176ff, insb. 187) hatte systematisch zwischen naturgesetzähnlichen Bedingungen der Produktion und weitestgehend freien Möglichkeiten bei der Gestaltung sozialer Distributionsmechanismen unterschieden. Der ältere Methodenstreit der Wirtschaftswissenschaften, zwischen Carl Menger auf der einen Seite und Gustav Schmoller auf der anderen, stand dann auch unter dem Zeichen der Frage nach der den Wirtschaftswissenschaften angemessenen Forschungsmethoden. Menger plädierte dafür, die Wirtschaftswissenschaften als eine ‚exakte’ Wissenschaft ähnlich der Physik und anderen Naturwissenschaften zu begreifen; Schmoller sah die Wirtschaftswissenschaften den induktiven Verfahren der kulturwissenschaftlichen Forschung verpflichtet. Nach etwa zwanzig Jahren der Kontroverse hatten sich die Meinungen der beiden Hauptkontrahenten Ende des 19. Jahrhunderts durchaus wieder angenähert. Gleichwohl hatten die Wirtschaftswissenschaften im Zuge der Kontroverse deutlich eigenständigere Konturen gewonnen, die sie zunehmend von ihren Nachbardisziplinen, allen voran der Politischen Ökonomie, abgrenzten. Unter leicht veränderten Vorzeichen wiederholte sich die Kontroverse Anfang des 20. Jahrhunderts als jüngerer Methodenstreit, in dem Schmoller diesmal ein ethisch-normatives Forschungsprogramm gegen Max Webers Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 19 Konzept einer werturteilsfreien Wissenschaft vertrat. Anders als im ersten Methodenstreit, in dem weder Schmoller noch Menger eindeutig als Sieger hervorgingen, galten Webers Argumente den Zeitgenossen als stichhaltiger. Zudem galten Webers methodische Ausführungen bald als Grundlagentexte einer weiteren jungen Disziplin, die sich immer deutlicher von den Geschichtswissenschaften sowie der Volkswirtschaftslehre abgrenzte: Die Soziologie. Gleichwohl zeigt sich mit Blick auf Max Webers Definition von der Wirtschaft als „friedliche(r) Ausübung von Verfügungsgewalt“ (Weber 1980: 31), dass sich die Sprachbilder der Soziologie und der historisch orientierten ‚politischen Ökonomik’ auch nach dem Methodenstreit nicht ohne weiteres trennen liessen. Entsprechend lesen wir auch: „(D)er rationale ökonomische Monopolist herrscht durch den Markt“ (Weber 1980: 385), der als Thema „den wesentlichen Inhalt der Sozialökonomik bildet“ (ebd.: 382). Soziales Marktwirtschaften In der Zeit nach den Methodenstreiten beobachtet man den langsamen Niedergang des volkswirtschaftlichen Historismus, der u.a. in der Suche nach dezidiert überzeitlichen Theorien der Wirtschaft seinen Ausdruck fand, die auf die Bestimmung der unveränderlichen Konstanten des Wirtschaftens abzielten (vgl. Kolb 1997: 113). Parallel dazu knüpfte man wieder verstärkt an den Klassikern des ökonomischen Denkens, allen voran an Alfred Marshall und dessen 1890 erschienene „Principles of Economics“ an.6. Obgleich durchaus den Marginalisten zugerechnet, sprach er rein mathematischen Marktkonzepten nur eine begrenzte Erklärkraft zu und analysierte auch den Einfluss marktexterner Grössen wie z.B. Steuern auf die Funktionalität von Märkten, die er – durchaus werturteilend – an deren Fähigkeit 6 Wohl nicht zuletzt aufgrund von dessen vielseitiger Anschlussfähigkeit, gilt Marshalls Werk doch als “ein komfortabler Neubau, errichtet auf alten Fundamenten. Überraschender Weise können sich konträre Schulen der Nationalökonomie darin zu Hause fühlen” (Rieter 1989: 137). 20 Steffen Roth zur Armutsbekämpfung mass7. Zudem gelten Marshalls Ausführungen zur Relevanz kultureller Randbedingungen und sozialer Beziehungen in den von ihm im Hinblick auf partielle (Un-) Gleichgewichtszustände hin untersuchten „industrial districts“ als Ausgangspunkt für spätere Netzwerktheorien des Marktes sowie für die Analyse regionaler Unternehmenscluster (vgl. etwa Gordon 2000). Insofern kann er in doppelter Hinsicht als Urvater des Konzepts des sozialen Einbettung von Märkten und damit der neuen Wirtschaftssoziologie gehandelt werden (vgl. Aspers 1999). In der Auseinandersetzung mit Marshalls Werk entstanden neoklassische Preistheorien, die nun von unvollkommenen Wettbewerbsbedingungen auf ebenso unvollkommenen Märkten ausgingen. So unterschied Heinrich von Stackelberg in seiner 1934 erschienenen Arbeit „Marktform und Gleichgewicht“ zwischen Anzahl und Grösse der an Preisbildungsprozessen beteiligten Marktteilnehmer und leitete aus Kombinationen bestimmter Merkmalsausprägungen dieser Faktoren spezifische Marktformen ab. Walter Eucken bezog das „sozialwirtschaftliche Modell“ von Stackelbergs (1934: 6) später auf insgesamt fünf Angebots-Nachfrage-Konstellationen (Konkurrenz, Teiloligopol, Oligopol, Teilmonopol, Monopol) und ergänzte es somit um die von von Stackelberg nicht berücksichtigten asymmetrischen Formen der Preisbildung. Bei diesen beiden Autoren gelten die Beziehungsstrukturen von Märkten entsprechend nicht nur als relevant, sondern bereits auch als formgebend. Darüber hinaus ging Eucken ausdrücklich davon aus, dass Marktstrukturen nicht unabhängig von rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verstanden werden können, deren Gestaltung entsprechend ein Anliegen geeigneter wirtschaftspolitischer Massnahmen sein kann. Er gilt damit als Begründer des Ordoliberalismus (vgl. Linss 2007: 108ff), einer deutschen Variante des Neoliberalismus. Auch der gemeinsame Nenner der umfassenderen neoliberalen Bewegung lag in der Entwicklung der ethischen und rechtlichen Grundlagen des Wirtschaftsliberalismus (Burkert-Dottolo 2003: 578), ein Anliegen, das gerade vor dem Hintergrund der politischen Ver7 Hahn (1989: 29) schliesst daraus, dass Wirtschaft für Marshall nur eine unter vielen Dimensionen von Gesellschaft ist. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 21 hältnisse durchaus auch als politisches Bekenntnis gedeutet werden durfte: „Von Anbeginn war die neoliberale Bewegung in der Nationalökonomie unter Distanzierung vom alten ‚Laissez-faire’-Standpunkt in eine ‚gemässigt’ interventionistische (sozialliberale) und eine den ‚Wettbewerbsmechanismus als ausschliessliches Gestaltungsprinzip’ betrachtende Richtung gespalten. Zu letzterer formierte sich seit den dreissiger Jahren (...) unter dem Erlebnis totalitärer Staatssysteme in erster Linie der Neoliberalismus deutschsprachiger Nationalökonomen (...) und unter Betonung des ‚Laissez faire’ die ‚Chicagoer Schule’ (...). Ebenso wie nach dem Ersten Weltkrieg stiessen die Sozialisierungstendenzen nach dem Zweiten Weltkrieg auf eine liberale Gegenwelle, die durch die energischen Bemühungen der USA, wieder einem freien Welthandel zuzusteuern (...) und durch das bipolare Denken während des ‚Kalten Krieges’ verstärkt wurde“ (Boelcke 1980: 45). Staatsinterventionismus und Laissez-faire waren demnach Pole, zwischen denen der Neoliberalismus durchaus unterschiedliche, in der Regel aber eher gemässigte Positionen einnahm. Insofern besteht zwischen den Traditionen des neoliberalen Denkens und den aktuell üblichen Begriffsverwendungen durchaus eine Diskrepanz: Als Neoliberale bezeichne(te)n sich auch erklärte Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, d.h. neben o.g. Autoren auch jene, die wir auf den ersten Blick so gar nicht mit dem Neoliberalismus in Verbindung bringen würden. Ein Beispiel hierfür ist Joseph Schumpeter8 (vgl. Stelling-Michaud 1976: 366), dem die aktuelle Konjunktur der Konzepte Unternehmertum und Innovation zu neuen Ehren gereicht. Obgleich er sich durchaus bewusst ist, dass Innovationen mindestens kurzfristige Marktungleichgewichte und damit Wettbewerbsverzerrungen erzeugen, gilt: „Schumpeter sees the free operation of the market, in association with entrepreneurship, as the prime mover of economic development. In this view, the market’s working is best described as creative destruction or adaptation – a continuous and simultaneous process of destroying old economic patterns and creating new ones“ (Zafirovski 2003: 83). 8 Der Wirtschaftssoziologen auch als Sozialökonom gilt (Swedberg 2007: 11). 22 Steffen Roth Unabhängig davon aber, welch revolutionäre Kraft dem Markt oder welch starkem Einfluss auf die Marktgestaltung dem Staat im Einzelfall auch zugesprochen werden mag, besteht der Minimal-Konsens des Neoliberalismus doch in einem Anti-Sozialismus, der sich durchaus ganz explizit entlang des Marktkonzepts als Anti-Totalitarismus beschreibt. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Friedrich August von Hayek (2003: 65, 66, 149), der bereits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts die fortgeschrittene Arbeitsteilung als Argument dafür ins Feld führte, dass wenige Planer unmöglich ein gesamtes Wirtschaftssystem bis ins Detail überschauen und entsprechend sinnvoll gestalten könnten. In diesem Sinne sei eine Zentral-, Lenkungs- oder Planwirtschaft einer Marktwirtschaft bei weitem unterlegen. Der Markt des Neoliberalismus präsentiert sich also bereits in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als eine pragmatische Lösung, die ihre (moralischen) Kosten, aber keine Alternativen hat. Gleichzeitig wurde mit Blick auf den Markt aber „die Annahme vollkommener Information (...) aufgegeben und das optimale Verhalten der Wirtschaftssubjekte bei Unsicherheit und Risiko bestimmt“ (Schachtschnabl 1971: 199, vgl. auch Åkerlof 1984: 7ff). Auch der Keynesianismus als Gegenspieler des Neoliberalismus im 20. Jahrhundert beschreibt sich selbst angesichts als dezidierter Anti-Sozialismus. Die staatsintervientionistische Theorie der westlichen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts wird daher eher in die Tradition des Merkantilismus gestellt (vgl. Kolb 1997: 142f): Globalstatt Marktsteuerung, Gütermarkt-bezogene Nachfragesubvention statt Angebotsstimulation, Steuerpolitik statt Geld(markt)politik, Fokus auf Volkswohlfahrt und Beschäftigung. Der Keynesianismus erscheint dabei rasch mehr als politisches, denn als wissenschaftliches Programm. Interessanter Weise lässt sich Gleiches aber auch vom Neoliberalismus sagen, der seinerseits als politisches Programm mit merkantilen Zügen dechiffriert werden kann: „Staatsprotektionismus und öffentliche Subventionen für die Reichen, Marktdisziplin für die Armen“ (vgl. Chomsky und Dieterich 1999: 30; vgl. auch Bourdieu 2000). Im Kontext der Auseinandersetzung zwischen den keynesianistischen Strategien der steuerfinanzierten, nachfrageorientierten staatli- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 23 chen Lenkung der Marktwirtschaft auf der einen und den auf Steuersenkung und Angebotsorientierung hin orientierten Konzepten des Neoliberalismus auf der anderen Seite, identifizieren wir „the ‚real’ economist’s utopia“ (Zafirovski 2003: 83), also die Losung „mehr Markt“, mittlerweile als Schlachtruf v.a. der libertinistischen Neoliberalen (vgl. Mikl-Horke 2008: 34), obwohl beide Bewegungen im Grunde gleich viel Markt anstreben, nur eben je einen anders strukturierten bzw. anders eingebetteten Markt. In diesem Sinne korrespondiert der Konflikt zwischen keynesianistischen und neoliberalen Prinzipien bereits mit einer ganzen Reihe von Konfliktlinien zwischen Wirtschaftssoziologien und Ökonomik. Gleichwohl gilt der Markt nicht anders als bei neoliberalen Autoren auch für Keynes als ein quasi technisches Phänomen, als ein Mechanismus, dessen Funktionen und Dysfunktionen ihn zwar mit Blick auf deren sozialen Fussabdruck interessieren, den er aber nicht seinerseits als soziale Struktur begreift9. Die Grenzen zwischen gemässigten Neoliberalen und Keynesianern verlaufen entsprechend ähnlich fliessend, wie in beiden Fällen die zwischen Wirtschaftswissenschaft und -politik. In diesem Sinne unterscheiden sich die Selbstbeschreibungen des Keynesianismus und des Neoliberalismus letztlich nur vordergründig entlang ihrer Antworten auf die Frage, ab wann ein Markt als ein kaputter Wachstumsmotor (vgl. Swedberg 2007: 16; Bluhm und Malowitz 2007: 8) anzusehen ist, und es folglich einen staatlichen Mechaniker braucht. Begreift man beide Konzepte aus der o.g. Perspektive des Neo-Merkantilismus, erscheinen beide letztlich als gruppenegoistische Konzepte der Wirtschaft, die sich im Kern mit Blick auf ihr Differenzierungsschema unterscheiden lassen: der Keynesianismus strebt den Wohlstand eines bestimmten geopolitischen Segmentes an (segmentäre Primär-Differenzierung), der Neoliberalismus den Wohlstand einer – bekanntermassen durchaus auch transnational denkbaren - ‚Klasse’ (stratifikatorische PrimärDifferenzierung). 9 „By implication, he treats the market as a trancendent or impersonal mechanism for direction and coordination of economic variables“ (Zafirovski 2003: 86f) 24 Steffen Roth Vor diesem Hintergrund haben sich bereits die Klassiker der Ökonomie mit dem Einfluss beschäftigten, den (informelle) Institutionen auf wirtschaftliches und Markt-Handeln haben, die neue Institutionenökonomik. Bereits der Bezug auf einen ihrer Urahnen zeigt dabei, dass wir entlang der Fragestellungen des ökonomischen Institutionalismus rasch an die Grenzen der disziplinären Wirtschaftswissenschaften stossen: Thorstein Veblen, nicht zuletzt der Entdecker des Geltungskonsums, gilt gleichermassen als Ökonom wie als Soziologe (vgl. Coser 1971; Biesecker und Kesting 2003: 155; Holl 2004: 24). Als eigentlicher Vater des Neoinstitutionalismus wird aber gemeinhin Ronald Coase gehandelt: 1937 schrieb er mit „The nature of the firm“ einen Artikel zum Thema Unternehmen, in dem er diese als hierarchische Vertragsgeflechte beschrieb. Zudem gelten ihm bei Marktnutzungskosten, die sog. Transaktionskosten, als Grund für die Entstehung von Unternehmen. Sein bahnbrechender Artikel gilt als Auftakt für die vertragstheoretischen Analysen der Wirtschaft, wie sie später von der Neuen Institutionenökonomik vorgelegt werden. Der Begriff neue Institutionenökonomik selbst wurde erst 1975 von Oliver Williamson geprägt, und rasch weltweit fester Bestandteil der Wirtschaftspolitik (Burchardt 2004: 145), ein Indiz dafür, dass der Ansatz große Anerkennung in der Ökonomik gefunden hat, woran auch der ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Institutionalist Douglass North seinen Anteil hat, dessen Kritik am fehlenden Marktverständnis der Ökonomie die Wirtschaftsoziologie eine Steilvorlage und ihren Gründungsmythos verdankt10. Das Hauptinteresse der Neuen Institutionenökonomik galt dabei der Erklärung der mit dem neoklassischen Postulat vollständiger Märkte nicht kompatiblen Existenz von Unternehmen, die ihr als eine vom Markt durchaus unterscheidbare Institution der Konzentration knapper Ressourcen gilt (vgl. Moldaschl und Diefenbach 2003: 146). Mit anderen Worten: „Die Transaktionskosten- bzw. Institutionenökonomie (...) versucht herauszufinden, wieso bestimmte Transaktionen auf dem Markt erfolgen, andere hingegen in Organisa- 10 “It is a peculiar fact that the literature on economics (…) contains so little discussion on the central institution that underlies neoclassical economics: the market” (Douglass 1977: 710). Wir kommen auf dieses Zitat zurück. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 25 tionen (Unternehmen) vollzogen werden, die geordnete Strukturen und Regeln für die Steuerung ihrer internen Prozesse aufbauen. Diese Suche nach institutionellen Varianten bzw. Alternativen lässt sich als eine Art ´Soziologisierung´ der Ökonomie interpretieren ...“ (Weyer 2000: 5). Dabei unterstellt der Ansatz zunächst im Sinne eines soziologisch angereicherten Verständnisses des homo oeconomicus, dass sich Akteure opportunistisch, sowie nach den Gesetzen der bounded rationality verhalten. Entsprechend stellen sich interindividuelle Transaktionen als nicht ganz selbstverständlich und kostenintensiv dar. Setzt man dabei eine beschränkte Ressourcenlage voraus, ergibt sich die Notwendigkeit, die eigenen Transaktionskosten möglichst niedrig zu halten. Dabei lassen sich drei Dimensionen (Kooperationshäufigkeit, Unsicherheit, Kosten für Beziehungspflege) bestimmen, entlang derer die Art und Kostenintensität der jeweiligen Transaktionsbeziehungen abhängt (vgl. Aldrich 1985, 283). Die Frage ist dann, welcher Modus notwendiger Austauschprozesse für ein Unternehmen mit den jeweils niedrigsten Transaktionskosten verbunden ist. Dabei werden zunächst zwei Formen unterschieden: Markt und Hierarchie, die als idealtypische Eckpunkte ein dualistisches Kontinuum markieren: Der Markt gilt als eine Organisationsform im Sinne einer offenen Arena, in der unabhängige Akteure kurzfristige Kooperationen eingehen, die über den Preis als zentralen Steuerungsmodus koordiniert werden (vgl. Williamson 1975: XI). Im Gegensatz zu idealtypischen Märkten benötigen empirische ein Minimum an Kooperationswillen und institutioneller Absicherung; konkret v.a. geltendes Vertragsrecht und das Commitment der Beteiligten, sich auf dieses Recht festlegen zu lassen. Hierarchie hingegen bezeichnet eine Organisationsform, die langfristige Aktivitäten dadurch absichert, dass sie formalen Regeln unterstellt werden. Regeln bestimmen zudem den Zugang zur Organisation, der Beitritt erzeugt damit auch ein Abhängigkeitsverhältnis: Nicht länger die eigenen Kosten-Nutzen-Abwägungen bestimmen die Handlungen, sondern spezifische Mechanismen der Fremd- und Selbstkontrolle, die im Hinblick auf das Organisationsziel entlang einer Kontrollhierarchie angewandt werden. 26 Steffen Roth Der Übergang von Markt zur Hierarchie vollzieht sich um so wahrscheinlicher, je höher die Faktorspezifität11 der Tauschobjekte ist. Je spezifischer Tauschobjekte und Kooperationsbeziehung, desto schwieriger wird es, eine bestehende Beziehung abzubrechen und die eigenen Beiträge anderen Verwendungszwecken zuzuführen. Auf diese Weise etablieren sich Abhängigkeitsverhältnisse, die einer neuen Form der Regelung bedürfen, da erhöhte Abhängigkeit mehr Unsicherheit provoziert, und Unsicherheit generell die Transaktionskosten steigen lässt. Im Falle zunehmender Faktorspezifität gewinnen Transaktionsstrukturen, die Unsicherheit reduzieren, daher zunehmend Selektionsvorteile. Unter diesen Voraussetzungen kann es für einen Akteur kosten-nutzen-rational sein, das Risiko eines Kooperationsabbruchs zu reduzieren, indem er seine eigenen Autonomiegrade reduziert. Nicht immer aber führt diese Entwicklung zur Ausbildung einer rigiden technokratischen Hierarchie - zwischen den beiden Polen des transaktionskostentheoretischen Kontinuums stehen Mischformen, in der Regel also Netzwerke, die Elemente marktförmiger wie hierarchischer Organisation kombinieren. Obgleich es in der Ökonomik nach wie vor keinen allgemein akzeptierten Institutionenbegriff gibt (vgl. Kolb 1997: 140), hat sich ausgehend von den Impulsen des Neo-Institutionalismus eine breite und auch empirisch sehr fruchtbare Diskussion um die institutionelle Einbettung von Unternehmen, Märkten und ganzen Wirtschaftsregionen entwickelt (DiMaggio und Powell 1983; Osborn und Hagedoorn 1997; Biggerio 1999; Gordon 2000), deren Verlauf die Grenzen zwischen Ökonomik und Soziologie zunehmend verwischt hat, was vor allem auch für seine Kritik an den Kernkonzepten des ökonomischen Institutionalismus gilt12. 11 12 Je leichter ein bestimmter Beitrag auch anderen Verwendungszwecken zugeführt werden kann, desto niedriger ist seine Faktorspezifität (vgl. Williamson 1991, 16). “Eine unklare Grenzziehung zwischen Markt und Hierarchie, (…) eine zu einseitige Orientierung am Effizienzkonzept, (...) eine ungenaue Abgrenzung zwischen Transaktionskosten zu anderen Kostenarten, (…) eine unzulängliche Formalisierung sowie (…) die Ausblendung historisch-gesellschaftlicher Prozesse - insbesondere des Stellenwertes von Macht zur Erklärung der Organisationsentwicklung“ (Weyer 2000, 67). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 27 Während es sich beim ökonomischen Institutionalismus um ein Beispiel für die Soziologisierung der Ökonomik handelt, lässt sich auch der umgekehrte Fall beobachten: Die Ökonomisierung der Soziologie, die überwiegend von den Sozialwissenschaftlern (wie James Coleman, Karl-Dieter Opp, Robert Axelrod und Hartmut Esser) selbst betrieben wird und sich dabei vor allem mit dem Sammelbegriff Rational Choice verbindet. In diesen Sinne sei an dieser Stelle nur auf einen dezidiert ökonomischen Autoren verwiesen, der sich über die Ökonomisierung der Soziologie profilierte: Gary S. Becker gilt als einer der ersten Wirtschaftswissenschaftler, der die bereits umfangreich ‚sozialisierten’ Methoden13 seiner Disziplin auf Untersuchungsbereiche ausdehnte, die traditionell der Soziologie und weiteren Sozialwissenschaften zuzurechnen sind (etwa Diskriminierung, Kriminalität, Familie, Drogenabhängigkeit oder Organspenden). Diesen ‚Übergriff’ rechtfertigten Becker und Kevin M. Murphy (2000: 3) mit dem der Konzeptarmut der Sozialwissenschaften: „(T)hese other fields have not developed powerful techniques for analyzing social influences on behaviour“. Beckers ökonomischer Kolonialismus wäre damit ein gutes Beispiel für die von Habermas wiederholt angeprangerte Kolonialisierung der Lebenswelt durch systemische, hier ökonomische Zumutungen, und bringt ihn damit zumindest in dieser Hinsicht in die Nähe aktueller systemtheoretischer Beiträge zur Wirtschafts- und Markttheorie, von denen man auch nicht Recht zu wissen scheint, ob sie nun mehr den ökonomischen cattalactics oder den sociologics zuzuordnen sind (vgl. Zafirovski 2003: 110). Zunehmend stellen wir demnach fest, dass wir uns in einem Themenkomplex bewegen, der sich nicht mehr unabhängig vom wirtschaftssoziologischen Diskurs erschliesst. Bevor wir uns dem zuwenden, sei noch ein erklärender Hinweis gestattet: In der hier 13 „My research uses the economic approach to analyze social issues that range beyond those usually considered by economists. (…) Unlike Marxian analysis, the economic approach I refer to does not assume that individuals are motivated solely by selfishness or material gain. It is a method of analysis, not an assumption about particular motivations. Along with others, I have tried to pry economists away from narrow assumptions about self-interest. Behaviour is driven by a much richer set of values and preferences” (Becker 1992: 385). 28 Steffen Roth vorgelegten Beschreibung des wirtschaftswissenschaftlichen Denkens zum Markt fehlen auffallend die Vertreter marxistischer und kritischer Wirtschaftstheorien. Das ist dem Umstand geschuldet, dass sich diese Arbeit im Folgenden mit der wirtschaftssoziologischen Auseinandersetzung mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs im Allgemeinen und dessen Marktverständnis im Besonderen beschäftigt. In diesem wirtschaftssoziologischen Diskurs wird auf kritische Wirtschaftstheorie kaum oder lediglich im Sinne von Irrelevanzerklärungen Bezug genommen, insbesondere eben, wenn es um Märkte als soziale Strukturen geht: „Dem gängigen marxistischen Verständnis zufolge ist Ausbeutung im Arbeitsprozess zu verorten, wohingegen der Markt als Sphäre des Äquivalententausches unproblematisch ist“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 24; vgl. auch Aspers und Beckert 2008: 232)14. Andere kritische Zugänge zu den Phänomenen Markt, Wirtschaft und Marktwirtschaft werden in 14 Durchaus übereinstimmend taucht der Markt auch in Stefan Kühls (2008) Aufsatz Wirtschaft und Gesellschaft: neomarxistische Theorieansätze nur als Randnotiz auf. Auch Swedbergs (1987: 93f) Würdigung des Beitrags neomarxistischer Theorietraditionen zur Wiederbelebung der Wirtschaftssoziologie bleibt auf bestimmte Themenfelder beschränkt, die für die Analyse von Märkten weniger relevant sind: “The neo-Marxists have contributed in a substantial way to the renewal of several areas in economic sociology. Two areas where their influence has been felt very strongly are industrial sociology and stratification theory”. Letztlich standen die neomarxistisch inspirierten ‚Mitbegründer’ der US-amerikanischen Neuen Wirtschaftssoziologie, allen voran Vertreter der sog. Stony Brook school um Michael Schwartz, dem Ansinnen der Neubegründung der Disziplin aufgrund des transdisziplinären Anliegens des Marxismus überwiegend ambivalent bis kritisch gegenüber (vgl. Convert und Heilbron: 2007: 31); zudem treffen sich Neomarxismus und Neoliberalismus ausgerechnet im Primat der Ökonomie; mehr noch: „Die marxistische Diskussion bemüht sich nicht um ein anderes Verständnis des Marktes, sondern geht interessanter Weise vom neoklassischen Konzept des Marktes aus, um dieses einer politischen Kritik zu unterziehen“ (Wex 2004: 264). Insofern darf also ganz grundsätzlich daran gezweifelt werden, dass neomarxistische Strömungen der Neuen Wirtschaftsoziologie überhaupt zugerechnet werden sollen oder wollen. Letztlich vertraut die Arbeit daher dem Urteil eines Experten für neomarxistische Wirtschaftssoziologie: „Für eine Programmatik des ‚bringing society back in’ müsste (...) vermutlich auf andere Theorien zurückgegriffen werden“ (Kühl 2008: 145). Immerhin aber werden wir Teile des Theoriestrangs über das Werk Pierre Bourdieus an späterer Stelle wieder aufnehmen. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 29 der Wirtschaftssoziologie vorzugsweise als kritische Sozialtheorien reflektiert, was vor dem Hintergrund der im folgenden skizzierten wirtschaftssoziologischen Selbstbeschreibungen nicht inkonsequent ist. Gleichwohl es also durchaus Charme hätte, etwa Lenins These vom Imperialismus als der spätkapitalistischen Form der Suche nach neuen Märkten gegen Karl Polanyis „Ports of Trade“ (1963) zu lesen, wird doch bereits an dieser Stelle deutlich, dass dabei der Pfad verlassen würde, den diese Arbeit beschreiten wird, indem sie zunächst eine Beschreibung, anschliessend eine kritische Würdigung, und schliesslich eine nicht-reduktionistische Alternative zum Marktverständnis der neuen Wirtschaftssoziologie anbietet, einem durchaus wohlbestellten Feld, das in den folgenden Abschnitten charakterisiert werden soll. Die Arbeit wird auf die genannten kritischen Ansätze daher insoweit zurückkommen, als es im Hinblick auf die kritische Würdigung des existierenden wirtschaftssoziologischen sowie der Entwicklung eines alternativen soziologischen Marktkonzeptes notwendig ist. Zusammenfassung: Markt und Wirtschaft im Zentrum der Gesellschaft Die Ausführungen dieses Kapitels sollten – eingedenk ihres selektiven und fragmentarischen Charakters – schlicht aufzeigen, dass der Markt eine, wenn nicht die zentrale Kategorie der Ökonomik ist. Märkte wurden zunächst als Ort räumlich-konkret eingebetteter Tauschhandlungen gedacht, die sich im Idealfall gerade durch Freiheit vom sozialem Zugriff der allzu sichtbaren Hand eines Feudalherren auszeichnen sollten. Im Anschluss an eine Phase der Suche nach seinen zeitlos-universalgültigen Gesetzmässigkeiten sowie historisch-partikularen Erfahrungen mit Marktversagen erscheint das Marktprinzip heute seinerseits als Machtinstrument, das nun eben zu Wohl und Wehe der Gesellschaft wirken kann oder – mangels oder aufgrund allzu grosser Eignung – eben nicht (uneingeschränkt) eingesetzt werden soll. Indem sie diese Aspekte diskutiert, stellt die Ökonomik selber also bereits eine ganze Reihe von Anknüpfungs- 30 Steffen Roth punkten für die wirtschaftssoziologische Idee von der Notwendigkeit oder der schieren Unhintergehbarkeit der sozialen Einbettung von Märkten bereit. Wo nicht als Universalie beschrieben, bildet der Markt, und damit automatisch die Wirtschaft, das Zentrum einer Gesellschaft, die vom Markt zu leben scheint und ihn deshalb besser auf Rosen oder doch zumindest gut einbettet. Wie sich im nächsten Kapitel zeigen wird, nimmt die Wirtschaftssoziologie diese und weitere Steilvorlagen dankbar an, mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Wirtschaftssoziologen diesen Gedanken mit oder gegen ihre Absicht noch radikalisiert hat: Indem sie beständig gegen die als ökonomischen Imperialismus bezeichnete Idee der funktionalen Universalität bzw. der Übertragbarkeit des Marktprinzips auf nichtökonomische Gesellschaftsbereiche zu Felde zieht, erhält sie der Wirtschaft das Monopol über den „expansiven“ Markt, den sie dabei angestrengt zurück in die Mitte der Gesellschaft zu drängen und dort einzubetten versucht. Wohl einer trans-disziplinären Berufskrankheit geschuldet stellen neben Ökonomen also auch Wirtschaftssoziologen die Wirtschaft nicht nur analytisch ins Zentrum ihres Erkenntnisinteresses, sondern normativ ins Zentrum der gesamten Gesellschaft. Das folgende Kapitel zeigt, welche Formen das im Einzelnen annehmen kann. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 31 Kapitel III Weniger Markt! Die Märkte der Wirtschaftssoziologie Viviane Zelizer (1988: 619) spricht von einer breiten „(a)cceptance of the dominance of the market in modern societies“. Weitere Stimmen aus dem wirtschaftssoziologischen Kanon zeigen rasch, dass man auch ausserhalb des wirschaftswissenschaftlichen Mainstreams recht einhellig von der „centrality of markets in modern societies“ (Fourcade 2007: 1026) ausgeht; sie sind der „stuff our modern societies are made of“ (ebd.: 1018). Ausdrücklich erklärt auch Jens Beckert: „Märkte sind die zentrale Institution kapitalistischer Ökonomien“ (2007: 43), und wiederholt diese Aussage gerne auch in Gesellschaft (vgl. Aspers und Beckert 2008) und auf Englisch (vgl. Beckert 2009). Die Verquickung von Modernitätstheorie und Marktsoziologie hat dabei Tradition: Schon Max Weber (1980: 382) bezeichnete den Markt als Archetypen rationalen gesellschaftlichen Handelns und als Herrschaftsinstrument rationaler Wirtschaftseinheiten (ebd. 385). Auch unabhängig vom Modernisierungsdiskurs ist der Markt ein „central economic phenomenon“ (Zafirovski 2003: 38), mit entsprechenden Konsequenzen, wenn Wirtschaftssoziologie die „sociological perspective applied to economic phenomena“ (Beckert und Besedovsky 2009: 5) darstellt: Bernard Barber (1977) hat den Markt bereits früh als eine für Wirtschaftssoziologen absolute, unhintergehbare Grösse dargestellt (Barber 1977), was sich auch heute noch in Form von empirischen Arbeiten zum einschlägigen Publikationsverhalten abbilden lässt: Die boomende Wirtschaftssoziologie (vgl. Baecker 2006: 7) beschäftigt sich vor allem mit der Analyse von Organisationen und Märkten (vgl. Convert und Heilbron 2005; Zelizer 32 Steffen Roth 2007)15. Entsprechend gilt: „Märkte so stark in den Vordergrund der Wirtschaftssoziologie zu rücken, erscheint gerechtfertigt ...“ (Aspers und Beckert 2008: 242); auch Florian und Hillebrandt (2006: 11) erkennen im Markt eines der „Schlüsselthemen der Wirtschaftssoziologie“. Unterm Strich lässt sich zweifellos festhalten, dass der Markt nicht nur ein Kernkonzept der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch ein zentraler, wenn nicht der zentrale Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftssoziologie ist. Dass dem so ist, hat dabei nicht nur mit der thematischen Nähe der beiden Fachgebiete zu tun, sondern auch mit dem ganz speziellen Entstehungskontext der Wirtschaftssoziologie im Allgemeinen und der sog. Neuen Wirtschaftssoziologie im Besonderen. Im Folgenden gilt es, diesen Kontext zu beschreiben. Das Entstehen der Wirtschaftssoziologie „Die Wirtschaftssoziologie entstand wie die moderne Ökonomie aus dem Versuch heraus, zu verstehen, was der Gesellschaft im 19. Jahrhundert widerfuhr, als die Marktwirtschaft mit grosser Heftigkeit einsetzte“; Richard Swedberg (2007: 11) gilt Karl Marx vor diesem Hintergrund als der Begründer der Wirtschaftssoziologie, während Max Weber die Erfindung des Begriffs zugeschrieben wird. Vor Weber hatte allerdings bereits der Ökonom William S. Jevons den Begriff economic sociology16 zur Bezeichnung einer Disziplin eingeführt, der er die Bearbeitung all jener sozialhistorischen und politischen Randbedingungen des Ökonomischen zuwies, von denen die zeitgenössischen ökonomischen Modelle zunehmend abstrahierten. Beim Begriff Wirtschaftssoziologie handelte es sich demnach zunächst um 15 16 Dem widersprechen bisweilen aktuellere Daten zur Relevanz des Themas in einschlägigen Zeitschriften (vgl. Beckert und Besedovsky 2009). „It is only by subdivision, by recognising a branch of Economic Sociology, together possibly with two or three other branches (…) that we can rescue our science from its confused state “ (Jevons 1879: 22). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 33 eine wirtschaftswissenschaftliche Fremdbezeichnung für Forscher, die eine für die Wirtschaftswissenschaften tendenziell vernachlässigbare Residualkategorie von Untersuchungsgegenständen bearbeiten: „Mit dem Übergang zur reinen Theorie in der neoklassischen Ökonomie wurde die Wirtschaftssoziologie zunächst zum Sammelbecken von allen Elementen, die nicht zur Logik des Modells passten. Im Rahmen der Arbeitsteilung zwischen Soziologie und Ökonomie durfte die Wirtschaftssoziologie als empirische Erforschung der nicht-logischen Elemente wirtschaftlichen Handelns oder als soziologische Interpretation der Wirtschaftsgeschichte ein eingeschränktes Dasein beanspruchen“ (Mikl-Horke 2008: 39; vgl. auch ebd. 25). Als eine Konsequenz der Fremdzuweisung des eigenen Feldes lässt sich der Wirtschaftssoziologie bis in die jüngste Zeit hinein das Problem bescheinigen, dass sie ihren theoretischen Zugang kaum anders als negativ, d.h. nur als Gegenentwurf zu ökonomischen Theorien, beschreiben kann (vgl. Baecker 2006: 37; Fourcade 2007: 1017). Eine andere Konsequenz ist die Bescheidenheit, mit der diese Gegenentwürfe noch heute von einer Gruppe vorgetragen werden, die sich vornehmlich der Auslegung der Klassiker verschrieben zu haben scheint17, mit der Konsequenz, dass man in der Rückbesinnung auf die Klassiker den Weg aus der noch längst nicht vollständig überwundenen Krise der Wirtschaftssoziologie vermutet (vgl. etwa Swedberg 2007b, 2008). Gerade mit Blick auf den Markt, als dem Herzstück der Wirtschaftssoziologie, gestaltet sich diese Rückbesinnung jedoch nicht immer einfach18: Tatsächlich entwickelte Max Weber im Rahmen 17 18 „(W)e should perhaps simply and modestly say that (...) economic sociology is what economic sociologists do. That is, it is nothing but an intellectual world with which people identify themselves“ (Fourcade 2007: 1018). Karl Marx fokussiert weniger den Markt selber, als vielmehr Produktions- und Marktzugangschancen (vgl. Kühl 2008); für Georg Simmel (1907: 11, 153ff) ist das Geld, nicht der Markt, die unpersönliche Kerninstitution der Ökonomie, die traditionelle soziale Beziehungen sprengt; und Emile Durkheim betrachtet Marktbeziehungen v.a. als Vertragsbeziehungen, die eher Gegenstand der Rechts- denn der Wirtschaftssoziologie wären; immerhin aber lesen wir bei Durkheim bereits von Märkten als sozialen Institutionen (vgl. Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 20, 24; Aspers und Beckert 2008: 232; Zafirovski 2003: 119). 34 Steffen Roth seines Grosswerkes Wirtschaft und Gesellschaft (1980: 382-285) einen der ersten soziologischen Marktbegriffe19, tut dies allerdings nur im Rahmen eines unvollendet gebliebenen Exkurses, während sein Kerninteresse der Frage galt, warum sich der rationale Kapitalismus in Westeuropa entwickelt hat. Zudem gilt es, die anfangs des 20. Jahrhunderts noch enge Verbindung von Wirtschaft- und Sozialwissenschaften zu berücksichtigen20, die gerade in der Person von Max Weber sehr eng und ambivalent angelegt ist: Weber steht eben nicht nur für vergleichend-historische (Wirtschafts-) Soziologie, man sieht in ihm auch einen der Gründerväter der Rational Choice Theorie (vgl. Norkus 2001: 99), eben jener ‚reduktionistischen’ Theorieströmung, der seitens führender Wirtschaftssoziologen die Ökonomisierung des Sozialen oder doch zumindest der Soziologie vorgeworfen wird. Etwas schärfer wird gar formuliert, dass erst Talcott Parson’s Weber-Interpretation Weber zum Gründervater der Wirtschaftssoziologen avancieren liess (vgl. Cohen, Hazelrigg und Pope 1975). Vor diesem Hintergrund nimmt es dann auch nicht Wunder, dass die Geburtsstunde der Wirtschaftssoziologie mitunter weiter in Richtung Jahrhundertmitte verlagert wird: „Arguably, the founding moment of the field of economic sociology took place more than a half-century ago at Havard, where Talcott Parsons was developing his grand designs for sociology“ (Stark 2000: 2). In jedem Fall gilt die Zeit zwischen Weber und Parsons, die sich mit den Namen Maurice Halbwachs, Francois Simiand, Leopold von Wiese und Adolph Lowe verbindet, als eine Art Inkubationszeit der Wirtschaftssoziologie (vgl. Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 21), die von wechselseitigen Abgrenzungsbestrebungen zwi19 20 „Von einem Markt soll gesprochen werden, sobald auch nur auf einer Seite eine Mehrheit von Tauschreflektanten um Tauschchancen konkurrieren“ (Weber 1980: 382); und wenig später lesen wir, der Markt sei „ursprünglich eine Vergesellschaftung mit Ungenossen gewesen“ (ebd. 385). „Diese enge Verbindung unter den verschiedenen Sozialwissenschaften zu dieser Zeit zur Kenntnis zu nehmen ist wichtig, will man die nachfolgende Entwicklung der Wirtschaftssoziologie verstehen. Es handelt sich nämlich nicht um eine Erfolgsgeschichte, sondern um eine Geschichte zunehmender Marginalisierung“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 21). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 35 schen Ökonomik und Soziologie geprägt war. Leopold von Wiese hatte die Gegenstandsbereiche von Ökonomie und Soziologie unterschieden, indem er der Ersten die Beziehungen Mensch-Ding und der Zweiten die Beziehungen Mensch-Mensch zugeordnet hatte (vgl. Albert 1998: 148, Fn. 11). Bei Parsons wurde die Wirtschaft dann durchaus passend „als Subsystem der Gesellschaft aufgefasst, das für diese die Anpassungsfunktion an Umweltbedingungen im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des Sozialsystems zu erfüllen hat“ (MiklHorke 2008: 35). In diesem Sinne bildeten Ökonomik und (Wirtschafts-) Soziologie bei Parsons gleichermassen Elemente einer als Supertheorie vorgestellten Handlungstheorie: „Die der Soziologie und Ökonomie übergeordnete allgemeine Handlungstheorie bildete das analytische Raster, innerhalb dessen die Wirtschaftswissenschaften verortet und zugleich anerkannt“ wurden (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 23; vgl. Parsons und Smelser 2003: 296, 306). Diese sogenannte Economy and Society Perspektive (vgl. Swedberg 1987; Granovetter 1990; Deutschmann 2007) ging als pax parsoniana in die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften und –soziologie ein, d.h. als spezifische Form der „peaceful coexistence“ (Zafirovski 2003: 3) zwischen beiden Disziplinen: Während Parsons den Gegenstandsbereich der Wirtschaftswissenschaften in der Auswahl geeigneter Mittel im Mittel-Zweck Kontinuum des menschlichen Verhaltens sah, sollte die Soziologie den Wertfaktor analysieren, d.h. „the ultimate common ends and the attitudes associated with and underlying them, considered in their various modes of expression in human social life“ (Parsons 1934: 529). Die Ökonomik solle demnach den Einsatz knapper Mittel im Hinblick auf feststehende Ziele, die Soziologie hingegen die Entstehung dieser Ziele studieren. „Parsons reproduzierte damit das Selbstverständnis der ökonomischen Theorie als eine Form der Restriktionsanalyse“ (Schluchter 2007: 87). Dabei interpretierte er das akteurszentrierte Handlungskonzept der (neoklassischen) Wirtschaftswissenschaften in Richtung eines institutionalistischen Individualismus, in dem der einzelne Akteur nicht länger aktiver, Bedürfnis geleiteter Agent, sondern zuallererst der Träger inkorporierter sozialer Werte ist (Zafirovski 2006: 95f). Umgekehrt steht Parsons’ Burgfrieden aber eben auch für die Idee, dass es einen 36 Steffen Roth Nexus sozialer Handlung geben könnte, für den allein rationale Kalkulation und geldorientierte Handlung von Individuen als durchaus umfassend gültige Beschreibung gelten könnte (vgl. Deutschmann 2007; Ganssmann 2007). Wirtschaftliche, insbesondere MarktProzesse wurden von den meisten Wirtschaftssoziologen entsprechend als Black-Box behandelt (vgl. Schluchter 2007: 87). „Nicht zuletzt unter dem Einfluss dieser von Talcott Parsons gezogenen Trennlinie fristete die Wirtschaftssoziologie während der Nachkriegsjahre ein Schattendasein. Sie galt als Ergänzung der ökonomischen Theorie unter Anerkennung von deren Oberhoheit“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 23). Im Kielwasser der Parsonianischen Modernisierungstheorie konzentrierte sich die Wirtschaftssoziologie der 50er und 60er Jahre vor allem auf die (nachholende) Entwicklung von Dritt-WeltÖkonomien. In den 70er Jahren repräsentierten dann v.a. marxistisch geprägte Varianten der Industrie- und Arbeitssoziologie den Hardcore der Wirtschaftssoziologie: „Industrielle Strukturen beinhalten zweifellos wichtige Aspekte wirtschaftlichen Handelns, sie sind jedoch nur ein enger Ausschnitt der relevanten wirtschaftlichen Handlungsfelder – und zwar derjenige des Handelns in Organisationen. (...) Die Industriesoziologie verlor ihre beanspruchte Bedeutung für das Erfassen entwicklungsleitender gesellschaftlicher Prozesse – nicht zuletzt aufgrund des Bedeutungsverlustes der industriellen Produktion“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 24). In der Folge fokussierte man dann den Einfluss „... kontingenter, politisch gestalteter Makroregulierung für die Steuerung wirtschaftlicher Prozesse in Unternehmen und auf Märkten“ (ebd. 25). Dies vorausgesetzt interessierte man sich dann für die Varieties of Capitalism (Hall und Soskice 2001), also für spezifische nationale Formen der Makroregulierung und deren Einfluss auf die wirtschaftliche Performance der jeweiligen Untersuchungseinheit. Insbesondere der direkte Vergleich mit dem japanischen Produktionsregime gewann hierbei an Bedeutung. Auch jenseits der Beobachtung nationaler Wirtschaftsregime rückten die soziokulturellen Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg bald in den Vordergrund, v.a. mit Blick auf industrielle Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 37 Distrikte und regionale Ökonomien (vgl. Piore/Sable 1985), die seitdem zunehmend mittels netzwerkanalytischer Konzepte untersucht werden (vgl. Granovetter 1977; Biggerio 1999; Gordon 2000). Damit bewegen wir uns dann endgültig in einem Feld, das thematisch und methodisch der sog. neuen Wirtschaftssoziologie zugeordnet werden kann. Das Entstehen der neuen Wirtschaftssoziologie Wie bereits im Fall der Entstehung der gesamten Teildisziplin, so stammten auch die Impulse, die Anfang der 1980er Jahre zur Erneuerung der Wirtschaftssoziologie führten, nicht aus der (Wirtschafts-) Soziologie, sondern verdankten sich Entwicklungen der Ökonomik. Auch die Entstehungsgeschichte der neuen Wirtschaftssoziologie spiegelt damit wider, „that economic sociology constituated itself as the part of sociology that deals with the objects of economics, rather than economic objects broadly conceived“ (Fourcade 2007: 1017). Gemeinhin werden drei Faktoren angeführt, die zur Entwicklung dieser „Next Economic Sociology“ geführt haben: Der ökonomische Kolonialismus (Swedberg 1990) oder Methodenimperialismus (Boulding 1976; Radnitzky und Bernholz 1987) Lazear 2000), d.h. die zunehmende Anwendung wirtschaftswissenschaftlicher Konzepte zur wissenschaftlichen Erklärung nicht-ökonomischer Phänomene, die Wirtschaftssoziologen seit Mitte der 1970er Jahre auffällt, und die sich v.a. mit dem Namen Gary Becker verbindet. Der Umstand, dass der ökonomische Kolonialismus nicht auf ein rein wissenschaftliches Phänomen beschränkt blieb, sondern als neoliberaler „market fundamentalism“ (Soros 1998: xxii; Sawyer 2000: 46) auch in anderen gesellschaftlichen Be- 38 Steffen Roth reichen, allen voran der Politik der 1980er und 1990er Jahre erheblichen Einfluss hatte. Das als Offenbarungseid der Ökonomik interpretierte Bekenntnis des ökonomischen Neoinstitutionalisten Douglas C. North (1977: 710), wonach den Wirtschaftswissenschaften ein fundiertes Marktkonzept abgehe. Zunächst fiel also auf, dass Ökonomen mit der Anwendung ihrer Theorien und Methoden auf (bislang) nicht-ökonomische Untersuchungsgegenstände zunehmend in Konkurrenz zu Soziologen traten. Das galt sowohl für die von Gary Becker (1992; Becker und Murphy 2000) vorgetragene Anwendung ökonomisch-individualistischer Entscheidungsmodelle auf Phänomene wie Drogenkonsum, Partnerwahl und Religionsausübung, sondern auch für Versuche, die Entstehung von Institutionen und Organisationen auf Grundlage des methodologischen Individualismus zu erklären (vgl. Williamson 1975, 1991; als Soziologe auch Coleman 1979, 1995). Der Waffenstillstand zwischen Ökonomik und Soziologie, die Pax Parsoniana, galt den Wirtschaftssoziologen damit zunehmend als gebrochen, und zwar, wie man in der Folge immer wieder zu lesen bekommt, einseitig seitens der Ökonomik (vgl. Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 27): „Eine Reaktion der Soziologie auf den ökonomischen Imperialismus war, gewissermassen zum Gegenangriff überzugehen und der ökonomischen Theorie ihr Erklärungspotenzial selbst für den Bereich sozialen Handelns abzusprechen, für den Parsons und eingeschränkt auch Weber ihr weitgehende empirische Angemessenheit zugesprochen hatten“21. 21 Die jenseits der puren Metapher vorgetragene Logik des Krieges fällt nicht nur uns auf: Marion Fourcade (2007: 1016) spricht ganz ohne Anführungszeichen davon, dass die wirtschaftswissenschaftliche Invasion einen soziologischen Gegenschlag notwendig machte: “economists’ invasion of the sociological domain called for a response”. Auch Neil Smelser und Richard Swedberg (2005: 14) bezeichnen die anti-ökonomischen Töne der Neuen Wirtschaftssoziologen ausdrücklich als militärisch. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 39 Zu Beginn der 1980er sah es so aus, als hätte die Ökonomik den „Wirtschaftskrieg“ über die Politikwissenschaften (vgl. Chong 2000) auch in die Realpolitik und damit die gesamte Gesellschaft getragen: In den Vereinigten Staaten beschwor Ronald Reagan The Magic of the Markets, und Ähnliches lies sich insbesondere auch für das Vereinigte Königreich unter Margret Thatcher oder Neuseeland mit Roger Douglas als damaligem Finanzminister sagen. Auch vor Indien und selbst vor China schien die Expansion neo- oder marktliberaler Programmatiken nicht halt zu machen. Besonders pikant hat Mart Laar, zwischen 1992 und 1994 sowie 1999 und 2002 Premierminister von Estland, den Einfluss der „neoliberalen“ Ökonomik auf die Realpolitik der 1980er und 1990er Jahre auf den Punkt gebracht, indem er mit Blick auf ersten Amtsantritt seine wirtschaftspolitische Unerfahrenheit in Form des Bekenntnisses bekannte, dass Milton und Rose Friedmans marktradikale Schrift Free to Choose (1980) das einzige wirtschaftswissenschaftliche Buch gewesen sei, das er damals gelesen hatte.22 Durchaus analog zur wissenschaftlichen Kritik am Mainstream der neoklassischen Ökonomik stellen sich Wirtschaftssoziologen auch politisch dem Neoliberalismus als Weltanschauung entgegen, „derzufolge der Markt nicht nur für die Standardprobleme der Wirtschat die beste Lösung bereit hält, sondern auch für viele Herausforderungen, um die sich traditionell der Staat und die örtlichen Gemeinwesen kümmern“ (Swedberg 2007: 14). Entsprechend betonten Wirtschaftssoziologen die sozialen Kosten marktradikaler Reformen, feuerten mit Pierre Bourdieu gegen immerhin zwei der drei von ihm 22 „I had read only one book on economics – Milton Friedman’s ‘Free to Choose’. I was so ignorant at the time that I thought that what Friedman wrote about the benefits of privatisation, the flat tax and the abolition of all customs rights, was the result of economic reforms that had been put into practice in the West. It seemed common sense to me and, as I thought it had already been done everywhere, I simply introduced it in Estonia, despite warnings from Estonian economists that it could not be done. They said it was as impossible as walking on water. We did it: we just walked on the water because we did not know that it was impossible” (Mart Laar, zitiert in Belien 2005). 40 Steffen Roth identifizierten Grundprinzipien neoliberaler Ideologien23 und machten sich vor dem Hintergrund globaler Waren- und Finanzströme eben nicht nur für die rein logische, sondern auch die real-räumliche und wirtschaftspolitische Wiedereinbettung der entfesselten Märkte stark. Hierbei rückt man dann nicht nur ideologisch in die Nähe kommunitaristischer Kapitalismuskritik, sondern mitunter auch institutionell: Die vom „bedeutendste(n) Theoretiker und zugleich Organisator des modernen weltweiten Kommunitarismus“ (ReeseSchäfer 2008: 153) gegründete Society for the Advancement of SocioEconomics (SASE) zählt Jens Beckert, Neil Smelser und Michael Piore zu ihren engagierten Mitgliedern, in Komitee und Beirat des von der SASE herausgegebenen Socio-Economic Review sind zudem Neil Fligstein, Richard Swedberg und Marion Fourcade aktiv. „Es ist Aufgabe jeder Ideologie, bestimmten Akteuren Rückhalt zu verschaffen, anstatt zu erklären, wie die Welt wirklich ist. Daher hält sich der Neoliberalismus zu den Fragen, was ein Markt ist und wie er funktioniert, eher bedeckt“ (Swedberg 2007: 14)24. In diesem Sinne liesse sich der von Douglas North (1977) erklärte Offenbarungseid vom fehlenden Marktkonzept der Ökonomik25 durchaus auch als geschickter Schachzug verstehen. Die Wirtschaftssoziologie erkannte im selbst erklärte Scheitern der ökonomischen Theorie allerdings eher das Einfalltor einer dezidiert wirtschaftssoziologischen 23 24 25 „Das neoliberale Modell basiert auf drei Prinzipien. Zuerst: die Wirtschaft ist ein vom Sozialen getrennter Bereich, in dem Naturgesetze und universelle Gesetze herrschen, die Regierungen nicht konterkarieren sollten. Das zweite Prinzip: Der Markt ist das optimale Mittel, um die Produktion und den Austausch in demokratischen Gesellschaften auf effektive und gerechte Weise zu organisieren. Das dritte Prinzip, das mehr konjunktureller Natur ist: Die Globalisierung erfordert eine Reduzierung der öffentlichen Ausgaben, vor allem im sozialen Bereich, soziale Rechte in den Bereichen Arbeit und Sozialversicherung gelten als kostenaufwendig und dysfunktional“ (Bourdieu 1999) Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die eben bereits leise angeklungene Frage ein, welche Funktion die „kommunitaristischen“ Marktkonzepte der Neuen Wirtschaftssoziologie haben und welchen Akteuren sie von Nutzen sein könnten. “It is a peculiar fact that the literature on economics (…) contains so little discussion on the central institution that underlies neoclassical economics: the market” (Douglass 1977: 710). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 41 Kritik an der Ökonomik, während sich das kollektive Gedächtnis durch dessen überraschende Öffnung rasch zu einem Gründungsmythos der neuen Wirtschaftssoziologie verdichtete (vgl. Callon 1998; Swedberg 2008). Zweifellos ist es gerade angesichts des skizzierten wirtschaftspolitischen Impacts marktliberaler Konzepte verblüffend, wenn sich über die zugrundeliegenden Theoriegebäude der Ökonomik als der Wissenschaft vom Markttausch26 sagen lässt: “The market (…) is the hollow core at the heart of economics” (Lie 1997: 342). Mit anderen Worten: “Today, economists cannot even tell what a market, let alone an efficient market, really is” (Elsner 2000: 421). Die Steilvorlage des Ökonomen Douglas North sorgte daher für eine „Renaissance wirtschaftssoziologischer Forschung: Zunächst in den USA, dann in Frankreich, Deutschland und weiteren europäischen Ländern wenden Soziologen ihr Instrumentarium verstärkt zur Erkundung der Kerninstitutionen der modernen Wirtschaft an. Die Untersuchung von Märkten steht dabei im Vordergrund“ (Beckert, Diaz-Bone und Gannsmann 2007b: 9). Im folgenden sollen entsprechend die Instrumentarien der neuen Wirtschaftssoziologie ebenso vorgestellt werden, wie die Erkenntnisse, die sie in Bezug auf den Marktbegriff bringen. Varianten der neuen Wirtschaftssoziologie „Der theoretische Kern der neuen Wirtschaftssoziologie besteht bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit der einzelnen Ansätze im Detail darin, ökonomische Phänomene wie zum Beispiel (...) die Genese und Dynamik von Märkten und Tauschprozessen (...) als sozial kon- 26 “Markets have always been central to economics, yet they remain strangely illdefined and amorphous” (Jackson 2007: 235). Noch grundsätzlicher formuliert es Milan Zafirovski (2003: 94) in Rückgriff auf die Klassiker des Faches, darunter auch Léon Walras : „... economics has a rationale only as, to paraphrase Whately and Mill, the science of market exchange and values“. 42 Steffen Roth struiert zu erklären“ (Florian und Hillebrandt 2006: 8; vgl. auch Fourcade 2007)27. Sozial konstruiert meint dabei je nach Ansatz, dass soziale Beziehungen soweit Einfluss auf ökonomisches Verhalten nehmen, dass Märkte wie Organisationen als soziale Netzwerke begriffen werden können (Granovetter 1977; White 1981), wirtschaftliche Vorgänge kulturspezifisch geprägt sind (DiMaggio 1994), was auch den kultur- und situationsspezifischen Sinn von und Umgang mit Geld einschliesst (Zelizer 1997), wie schon von Weber zu lernen, die Stabilität spezifischer Marktstrukturen politisch gewollt sein muss (Fligstein 2002, 2002b), oder die Unsicherheit, die mit ökonomischen Entscheidungen einhergeht, sozial bedingt ist, Wirtschaft somit auf Vertrauen angewiesen ist (Beckert 2002; Deutschmann 2007). Gleichwohl funktioniert die Idee der sozialen Bedingtheit oder Einbettung von Wirtschaft im Allgemeinen und Märkten im Besonderen als kleinster gemeinsamer Nenner der neuen wirtschaftssoziologischen Bewegung (vgl. Fourcade 2007: 1017; Beckert 2007b: 7; Aspers und Beckert 2008: 233) und gilt bisweilen auch als ihr Markenzeichen (vgl. Deutschmann 2007b: 4). Das Konzept der embeddedness wird gemeinhin auf den Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi (1957: 57, 70) zurückgeführt, obgleich dieser den Begriff der Einbettung lediglich unsystematisch und sporadisch verwendete, um die freie Marktwirtschaft und deren zerstörerische Kräfte als Ergebnis eines Sonderwegs des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vorzuführen; institutionell ein27 “If everyone in the sociology of markets agrees that markets are socially constructed, then, everyone (…) disagrees on the main principle of this social construction” (Fourcade 2007: 1019). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 43 gebettete, d.h. hier vor allem politisch kontrollierte, Märkte stellten für Polanyi den wirtschaftsgeschichtlichen Normalfall dar, den es wieder herzustellen galt, da die Ausdehnung der Geldwirtschaft auf die ficititious commodities (Polanyi 1957: 68f) Boden, Arbeit und selbst Geld, die Great Transformation also, zur Zerstörung von natürlichen und sozialen Um- und Lebenswelten führe (vgl. Polanyi 1978: 102ff). Zudem wiess er nachdrücklich darauf hin, dass das den Markttausch leitende Prinzip der Reziprozität neben denen des Haushaltens und der Redistribution nur eine von drei Formen des Wirtschaftens28 sei, die auch in modernen Gesellschaften ko-existieren. Wirtschaft ist für Polanyi demnach nicht zwangsläufig Marktwirtschaft (vgl. Rotstein 1970), die Dominanz des Marktprinzips demnach auch in dieser Hinsicht lediglich ein wirtschaftsgeschichtlicher Sonderfall oder gar, in den Worten von Christoph Deutschmann (2007b: 5), „eine Art historische(r) ‚Betriebsunfall’, der fundamentale sozialanthropologische Voraussetzungen des Wirtschaftslebens in Frage stellt und daher zwangsläufig gesellschaftliche Gegenbewegungen und ‚Selbstschutzbewegungen’ elementarer Art mobilisieren muss“. In gewisser Weise lässt sich auch die neue Wirtschaftssoziologie selbst als eine dieser anti-kapitalistischen Gegen- oder Selbstschutzbewegungen begreifen, in jedem Fall gehen die Ambitionen einer Reihe der „intellectual organizers“ (Zelizer 2007: 1057) der Disziplin in diese Richtung, wie nicht nur deren Nähe zur kommunitaristischen Bewegung zeigt. Dennoch greift es zu weit, wenn Jens Beckert (2007b: 7) für die Wirtschaftssoziologen freudig ausruft: „We are all Polanyians now“. Auch wenn Beckert damit vor allem die Tatsache im Auge hat, dass nahezu alle Wirtschaftssoziologen darin übereinstimmen, dass die Idee der sozialen Einbettung das Kernkonzept der soziologischen Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Phänomenen darstellt. Bereits in seinem eigenen Herausgeberband Märkte als soziale Strukturen (Beckert, Diaz-Bone und 28 Reziprozität bezeichnet den Austausch von Gütern zwischen sozialen Einheiten. Redistribution bezeichnet Handel und Produktion über eine zentrale Institution, von der aus Güter innerhalb einer sozialen Einheit an deren Mitglieder verteilt werden. Haushalten meint Subsistenzwirtschaft (Polanyi 1957: 47ff; 53ff). 44 Steffen Roth Ganssmann 2007) stösst Beckert hier auf unmoderierten Widerspruch in Form des Beitrages seines Kollegen Christoph Deutschmann (2007), der insgesamt vier eigenständige Konzepte von Embeddedness unterscheidet, von denen Polanyis Variante eben nur eine darstellt29. Nicht jede wirtschaftssoziologische Referenz auf das Konzept der Einbettung ist demnach eine Reminiszenz an Karl Polanyi. Zweifellos würdigt auch Deutschmann (2007: 85) Polanyis „historisch-soziologisches Konzept sozialer Einbettung, das als Antithese, nicht bloss als Ergänzung zum neoklassischen Modell individueller Nutzenmaximierung zu verstehen ist“, das Deutschmann zufolge aber auch ein übersozialisiertes und pessimistisches Bild der Wirtschaft zeichnet. Auch die Parsonianische Variante der Embeddedness lässt sich als übersozialisiert bezeichnen (vgl. Granovetter 1985), allerdings geht es Parsons, wie bereits weiter oben gezeigt, weniger um eine Kritik des neoklassischen Marktprinzips, sondern um dessen soziologische Ergänzung. „Das heisst, die Legitimität der Konzeptionalisierung wirtschaftlichen Handelns nach dem Modell der individuellen rationalen Wahl wird als solche nicht in Zweifel gezogen. Es wird allerdings behauptet, dass dieses Modell stillschweigend die Existenz bestimmter gesellschaftlicher Kontextbedingungen (...) unterstellt, ohne die die Marktransaktionen nicht in der konzeptionalisierten Weise ablaufen können“ (Deutschmann 2007: 80). Die Analyse der sozialen Kontextbedingungen galt Parsons entsprechend als die zentrale Aufgabe der Wirtschaftssoziologie. Wirtschaft und Gesellschaft gelten als wohlgetrennte Forschungsgegenstände, die erst im Rahmen einer transdisziplinären Handlungstheorie zusammen gedacht und damit gleichermassen eingebettet werden konnten. Als die verbleibenden zwei Varianten nennt Christoph Deutschmann (ebd.: 83, 86) die Ansätze Mark Granovetters und Jens 29 Zudem wendet auch Beckert im gleichen Artikel, in dem er alle Wirtschaftssoziologen als Polanyianer outet, ein, dass das Konzept der Embeddedness nicht von Polanyi entwickelt wurde, sondern von Richard Thunwald in dessen Werk Die menschliche Gesellschaft von 1932 (vgl. Beckert 2007b: 7, Fn. 2). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 45 Beckerts, womit er unter weitestgehender Vernachlässigung der neueren institutionentheoretischen Ansätze bereits zur neuen und neuesten Wirtschaftssoziologie übergeleitet hat. Tatsächlich beginnt „(d)ie Ära der neuen Wirtschaftssoziologie (...) mit dem Erscheinen zweier Arbeiten, deren Autoren bis heute zu den prominentesten Vertretern des Faches gehören, und die für ihre Arbeiten beide einen, wenn auch anders gelagerten, netzwerktheoretischen Zugang wählten“ (Schluchter 2007: 88). Damit sind die Arbeiten von Mark Granovetter (1977, 1985, 1990, 1992, 2002) und Harrison White (1981, 2002, White und Godardt 2007) angesprochen. Für Granovetter galten Polanyis und Parsons’ Konzepte der Einbettung gleichermassen als über- und untersozialisiert: übersozialisiert, weil in beiden Ansätzen eine enge Normenbildung des Handelns schlicht postuliert wird, untersozialisiert, weil beide ausgehend von einem starken Akteursfokus von einem atomistischen Bild vereinzelter Handelnder ausgehen. Granovetter (1985: 504) nimmt im Kontinuum zwischen Über- und Untersozialisierung eine mittlere Position ein: „most behavior is closely embedded in networks of interpersonal relations and such an argument avoids the extremes of under- and oversocialized views of human action“. Individuen orientieren sich demnach weder allein an nutzenmaximierender Vernunft noch ausschliesslich an universalistischen Verhaltensnormen. Zunächst konnte Granovetter (1995) in seiner Studie Getting a Job dieses Argument mit Blick auf den Arbeitsmarkt untermauern: Er konnte zeigen, dass es keine perfekten Arbeitsmärkte gibt, auf denen Stellen nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unter den Voraussetzungen symmetrischer Informationsverteilung gehandelt werden. Ein Grossteil der Informationen, die notwendig sind, um eine Stelle zu bekommen, seien auf dem Arbeitsmarkt schlicht nicht frei erhältlich. So kam seine Studie zu dem Ergebnis, dass sich 20% derer, die eine Arbeitstelle bekommen haben, nicht aktiv um die Stelle bemüht haben; gleichzeitig bekämen diejenigen, die sich besonders aktiv auf dem Arbeitsmarkt betätigen, nicht immer die besten Stellen. Vielmehr scheine es, als ob Informationen, die auf dem Arbeitsmarkt über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, sozusagen als Nebenfolgen 46 Steffen Roth nicht-arbeitsmarktlicher Beziehungen anfallen. Entsprechend liesse sich auch kaum davon ausgehen, dass sich das Verhalten der Nachfragenden im Sinne ökonomisch-rationaler Strategien abbilden lässt. Auch in seiner 1977 erschienen Arbeit The Strength of Weak Ties betonte er, dass Informationsflüsse bis dato unerwarteten Gesetzen folgen: Während enge Beziehungen zwischen Akteuren eines Netzwerkes für die Strukturbildung innerhalb des Netzwerkes, also für die Entstehung von Gruppen oder Freundeskreisen, relevant seien, seien es im Hinblick auf die Informationsverbreitung zwischen diesen Einheiten gerade die loseren Beziehungen: Wenn die Freundschaften, die A mit den ihrerseits nicht befreundeten Akteuren B und C unterhält, als enge Bindungen gelten, dann wäre die Beziehung zwischen B und C als eine lose Bindung einzustufen. Entlang solcher losen Bindungen werden Granovetter zufolge Informationen mit weniger Rücksicht auf die Beziehungsqualität, und damit entsprechend schneller und ungefilterter weitergegeben, als das im Fall enger Beziehungen der Fall wäre. Entsprechend gilt dann auch, dass Akteure mit wenigen losen Beziehungen auch weniger Informationen aus entfernteren Bereichen des gesamten Netzwerkes erhalten und entsprechend eine provinziellere Weltsicht pflegen. In genau diesem Sinne konnte Gernot Grabher (1993) in seinem Aufsatz The Weakness of Strong Ties voll auf der Linie mit Granovetters Arbeit deren Titel auf den Kopf stellen, indem er das damalige Ruhrgebiet als eine in engen Seilschaften gefangene Region vorstellte, welche lange Zeit den überfälligen Strukturwandel von der Montan- zur Dienstleistungs- und Hightech-Region verhindert hatten. Unerwartet stabile Beziehungsgefüge spielten dann auch in einem zweiten bahnbrechenden Aufsatz die Hauptrolle, der seinerseits als „Initialzündung für die neue Marktsoziologie“ (Beckert, DiazBone und Ganssmann 2007: 19) gilt. In seiner Arbeit Where Do Markets Come From? stellte Harrison White (1981: 517) fest, dass sich seine wirtschaftswissenschaftlichen Kollegen erstaunlich wenig um das reale Markt-Verhalten von Unternehmen kümmern; konkret fragte er sich: „Why do so many of our industrial markets have but a dozen or so member firms, several of which produce substantial shares of the total output (...)?“. Die Antwort, die White sich und seinen erstaun- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 47 ten Lesern gab, ist Geschichte: „these markets are not about the supply-demand equilibrium, but about developing stable niches and relations so that individual firms can achieve a certain level of income“ (Fourcade 2007: 1016). Damit hatte White die für die damalige Ökonomik konstitutive Idee vom Preismechanismus als zentralem Marktprozess fundamental in Frage gestellt, nach der sich die Handlungen der Marktteilnehmer als Käufer und Verkäufer preisvermittelt aufeinander beziehen, wobei sich der Konkurrenzdruck unter den Verkäufern so lange erhöht, bis keiner der Verkäufer mehr den Preis seiner Konkurrenten unterbieten kann. White konnte allerdings zeigen, dass sich Unternehmen nicht selten gar nicht an ihren Kunden, sondern vielmehr am Verhalten ihrer Konkurrenten orientierten. In genau diesem Sinne gelten ihm Märkte in einer fast systemtheoretisch anmutenden Formulierung als „self-reproducing social structures among specific cliques of firms and other actors who evolve roles from observations of each other’s behaviour“ (White 1981: 518). Diesen spezifischen Markttyp bezeichnete er als Produktionsmarkt. Diese Produktionsmärkte können White zufolge nur dann bestehen, wenn der Konkurrenzmechanismus durch die Konkurrenten selbst ausgesetzt oder zumindest kontrolliert wird, indem sie sich die einzelnen Produzenten der Konkurrenz zumindest partiell entziehen, indem sie sich auf ein je unterschiedliches Rollenverhalten zurückziehen, oder konkreter: in unterschiedliche Marktnischen, in denen sich dann je unterschiedlich hohe Gewinne erzielen lassen30. Mindestens ebenso entscheidend wie, wenn nicht entscheidender als die Ermittlung von Nachfragekonstellationen, ist den Anbietern auf Produktionsmärkten demnach die Beobachtung der Signale, mit denen andere Anbieter einen allfälligen Rollenwechsel und damit ihr Interesse an einem Strukturwandel des Marktes kommunizieren. Neben der Kommunikation von neuen Preisen (die in diesem Kontext aber nicht als Kommunikation für den Wert eines Gutes, sondern eben als Kommunikation einer veränderten Beziehung zu den Mitkonkurrenten verstanden wird) können dabei auch veränderte For- 30 Daher “kartellieren sich Konkurrenten eher miteinander als Anbieter mit Nachfragen”, wie Lars Clausen bereits 1978 (15) aufgefallen ist. 48 Steffen Roth men der Kommunikation von Qualitäten auf einen solchen ‚Angriff’ hindeuten. Während sich das Konzept der Einbettung bei White also vor allem auf Beziehungen im Markt bezieht, zieht sein Schüler Granovetter bewusst auch nicht-marktliche und nicht-ökonomische Beziehungen in Betracht. Beider Ansätze Stärke liegt darin, dass sie mittels netzwerktheoretischer Überlegungen nachvollziehbar deutlich machen können, warum eine soziologische Analyse von Märkten zu anderen Ergebnissen kommt, als eine wirtschaftswissenschaftliche. „Die Schwäche der Netzwerktheorie liegt (allerdings) darin, dass sie im eigentlichen Sinne keine Theorie darstellt (...), die darüber Auskunft geben (könnte), warum sich Akteure überhaupt in spezifischen Netzwerken befinden, bzw. was die Dynamik von Netzwerken im konkreten Fall ausmacht. An diesem theoretischen Defizit setzt eine zweite Gruppe von Ansätzen der NES an“ (Schluchter 2007: 90): die institutionentheoretischen Ansätze. Wirtschaftssoziologische Erklärungen der institutionellen Einbettung basieren häufig auf dem von Paul DiMaggio und Walter Powell (1983, 1991) vorgelegten Konzept des institutionellen Isomorphismus, wonach Unternehmen sich bestimmte Praktiken nicht deshalb aneignen, weil sie wirtschaftlich effizient sind, sondern weil sie ihnen Legitimation in ihrer Umwelt, also bei Shareholdern, Stakeholdern und Regierungen verschaffen: „Organizations compete, not only for resources and customers, but for political power and institutional legitimacy which socially rather than economically demonstrated fitness“ (DiMaggio und Powel 1983: 10). Der Vielfalt organisationaler Umwelten entspräche dann auch die Vielfalt organisationaler Formen31; das zeige sich etwa auch im Zuge der globalisierungsbedingten Konvergenz politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die zu einer weltweiten Angleichung der Formen von Organisation kommt (DiMaggio 2003: 181; vgl. auch Drori, Meyer und 31 „(T)he diversity of organizational forms is isomorphic to the diversity of environments“ (DiMaggio und Powell 1983: 9). Eine Erkenntnis, die aus systemtheoretischer Perspektive wie eine Plattitüde wirkt, andererseits gewissermassen einen frühen Prototyp des Konzepts der polyphonen Organisation (Andersen 2003) darstellt, einer Organisation also, die die Vielfalt organisationaler Umwelten intern repräsentieren kann. Wir kommen darauf zurück. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 49 Hwang 2006). Auch Neil Fligstein (1990) hatte durch das 20. Jahrhundert hindurch zeigen können, dass die jeweils aktuelle Organisationsform US-amerikanischer Unternehmen mit den jeweils herrschenden Wettbewerbsrechtskonstellationen korrespondierte. Dabei berücksichtigt der Neue Institutionalismus nicht nur formelle Institutionen wie schriftlich fixierte Regelwerke, sondern auch informelle Institutionen, d.h. vorzugsweise32 unausgesprochene Wert- und Moralvorstellungen. In diesem Sinne lassen sich dann auch wirtschaftswissenschaftliche Rationalitätskonzepte ihrerseits als unhinterfragte kulturelle Leitvorstellungen betrachten, die zudem je nach kulturellem Kontext variieren. Auch Frank Dobbin (1994) hatte entlang der gänzlich unterschiedlichen Pfade der Wirtschafts- und Industriepolitik, die den Ausbau des Schienennetzes in den USA, dem UK und Frankreich nahmen, zeigen können, dass die jeweilige politische Kultur massgeblich darüber entschieden hatte, was im jeweiligen Land als rationale Wirtschaftsförderpolitik gelten konnte. „Nach der ökonomischen Theorie dürfte sich die Wirtschaftspolitik verschiedener Staaten bei den gleichen Problemen nicht unterscheiden, da sich die richtige Politik objektiv aus den ökonomischen Zusammenhängen ableiten lassen müßte“ (Schluchter 2007: 91). Im Unterschied zur Institutionenökonomik, und in gewisser Weise auch im Unterschied zu frühen netzwerktheoretischen Konzepten der Einbettung à la Harrison White (1981), konzentrieren sich die Vertreter des (wirtschafts-) soziologischen Institutionalismus also kaum auf (soziale) Beziehungen in Märkten. Märkte sind demnach weniger deswegen soziale Veranstaltungen, weil die bounded rationality der Marktteilnehmer Transaktionskosten entstehen lässt, deren Optimierung Einfluss auf die Marktmacht der Teilnehmer hat; und auch nicht deshalb, weil sie marktspezifische Beziehungsstrukturen erzeugen, indem Akteure nicht nur Preise verhandeln, sondern die 32 „Werte müssen kommuniziert werden. Aber wenn über sie kommuniziert wird, sind ihnen die Zähne bereits gezogen. Wenn man sieht, wozu man sich entscheiden soll, kann man sich auch anders entscheiden“; konsequenter Weise gilt: „Das, was man für wichtig hält, wird indirekt (und oft unfreiwillig) kommuniziert, nämlich durch das, was man tut“ (Luhmann 2000: 370). 50 Steffen Roth Preisverhandlungen anderer Akteure auch als Signale im Hinblick auf die eigenen Position im sozialen Raum des Marktes deuten. Anders als die eben genannten Konzepte der Selbsteinbettung des Marktes begreift die wirtschaftssoziologische Institutionentheorie, durchaus ähnlich wie netzwerktheoretische Ansätze im Stile Mark Granovetters, den Markt als extern eingebettet, nur eben nicht in Netzwerke von sozialen Beziehungen, sondern in ein Geflecht aus kulturspezifischen Institutionen, deren Interpretation die eigentliche Qualität dieser sozialen Netzwerk-Beziehungen im Grunde erst bestimmt33. Mit der Institutionenökonomik wiederum verbindet den soziologischen Institutionalismus allerdings die Ausgangsdiagnose asymmetrischer Informationsverteilung auf Märkten und der Ansatz, die Kernfunktion der institutionellen Einbettung von Märkten in der damit einhergehenden Unsicherheitsreduktion zu erkennen34. Am Konzept der Unsicherheit setzen schliesslich auch die Arbeiten des letzten Autors an, der im Rahmen dieses Kapitels präsentiert werden soll. Das noch relativ junge Werk Jens Beckerts ist dabei einigermassen schwer einzuordnen: Deutschmann (2007: 86ff) stellt seinen Zugang zum Konzept der sozialen Einbettung in eine Reihe mit den Grössen des Faches (Parsons, Polanyi und Granovetter), für andere mag Beckert eher als ein Repräsentant für das gelten, was seine Kollegen im Sinn haben, wenn sie von der neuen Wirtschaftssoziologie als ökumenischer35 oder eklektischer36 Veranstaltung sprechen: So kritisiert er im Rückgriff auf Marion Fourcade (2007) glei33 34 35 36 In gewisser Weise liesse sich also anmerken, dass der Institutionalismus von einer kulturellen, und damit – je nachdem, was mit Kultur angesprochen ist nicht zwangsläufig von einer sozialen Einbettung von Märkten ausgeht. An dieser Stelle unterscheiden sich der ökonomische und der soziologische Institutionalismus dann letztlich ‚nur noch’ entlang der Frage, ob man die Realisierung dieser Funktion vornehmlich den Firmenkulturen der beteiligten Firmen oder eben jenen kulturellen Leistungen zurechnen soll, die in der Umwelt der jeweiligen Märkte erbracht werden. Eine auch steuerrechtlich nicht uninteressante Frage. „(...) mutual references became more ecumenical once a common label had emerged and distinct intellectual programs were launched” (Convert und Heilbron 2007: 31-54) „Today an eclectic group of scholars recognize themselves in the label “economic sociology” (Fourcade 2007: 1017). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 51 chermassen den strukturellen Determinismus der Netzwerkanalyse wie umgekehrt die Strukturvergessenheit des Institutionalismus. Entsprechend gilt ihm: „Eine wichtige theoretische Weiterentwicklung der Marktsoziologie bestünde darin, diese beiden grundlegenden Ansätze enger zusammenzuführen“ (Aspers und Beckert 2008: 238). An anderer Stelle wirbt er dafür, soziologische, historische und anthropologische Perspektiven zu verbinden (Beckert 2007b: 15). Entsprechend umfassend liest sich sein Verständnis von Embeddedness, das Deutschmann (2007: 87) charakterisiert als „(...) konzeptuellen ‚Werkzeugkasten’ der wirtschaftssoziologischen Analyse, mit dem erklärt werden soll, wie Akteure mit dem Problem der Unsicherheit umgehen. Die Schlüsselbegriffe dieses ‚Werkzeugkastens’ lauten: Normen und Institutionen; Tradition, Gewohnheit und Routine; strukturelle Prädispositionen: soziale Netzwerke, Organisationen und Pfadabhängigkeit; Macht“. Damit ist Beckert ausreichend anschlussfähig im aktuellen Diskurs positioniert (vgl. in weniger kompakter Diktion auch Beckert 2007: 57). Unsicherheit bzw. deren Reduktion avanciert aber auch bei ihm dabei zur „indisepensible precondition for the emergence and operation of market economies“ (Beckert 2007b: 11, vgl. auch 1996, 1997). In letzter Instanz argumentiert er also doch institutionalistisch37, nicht aber, ohne den institutionalistischen Unsicherheitsbegriff vom Kopf auf die Füsse zu stellen: Im Anschluss an den Ökonomen Frank Knight unterscheidet er zunächst Unsicherheit von Risiko: „Während man gegen Risiken Versicherungen abschliessen (und diese so als Produktionskosten internalisieren) kann, gilt Ungewissheit als nichtkalkulierbare Bedingung ökonomischen Handelns (Beckert, DiazBone und Gannsmann 2007: 30), um dann drei Koordinationspro37 Beckert (2005: 21) ordnet sich bisweilen selbst dem Institutionalismus zu. 52 Steffen Roth bleme vorzustellen, die dem Umstand zuwiderlaufen, dass Marktakteure stabile Welten38 oder eben Berechenbarkeit (Weber 1980: 48f, 94) benötigen, um marktförmig kalkulieren zu können: Das Wertproblem: Käufer wie Verkäufer müssen in der Lage und willens sein, den Wert eines Gutes zu bestimmen und anzugeben. Das ist für beide Seiten mitunter nicht leicht, auch dann nicht, wenn Unaufrichtigkeit ausgeschlossen werden kann: Bei einer Vielzahl von Produkten (Wein, Kunstwerke, Dienstleistungen) sind Qualitätsfragen Geschmacksfragen, hängen also von subjektiven Bewertungsprozessen ab, über deren Outcome sich (schlecht) streiten lässt. Beckert (2007: 53) zeigt zudem am Beispiel des Whale Watchings und mit Blick auf die Arbeiten von Thorstein Veblen und Georg Simmel zum demonstrativen Konsum und zur Mode, wie die aktuelle gesellschaftliche Konjunktur bestimmter Symbole in die Wertbemessung eines Produktes einfliessen. Entsprechend gilt: „Eine soziologische Theorie von Märkten muss verstehen, wie Prozesse der Klassifikation, mit denen Wert konstituiert wird, gelingen und scheitern (ebd.: 55). Das Problem des Wettbewerbs: „Gewinne werden erst möglich, wenn sich Märkte im Ungleichgewicht befinden (…). Wettbewerb ist so zwar einerseits eine konstitutive Voraussetzung von Märkten, andererseits bedroht Wettbewerb Gewinnerwartungen von Marktanbietern“ (ebd.). Als Folge beschreibt Beckert im Anschluss an Weber (1980: 36) den Tauschkampf zwischen Konkurrenten, Staat und gesellschaftlichen Interessengruppen (z.B. Verbraucherschützern) um die konkrete Ausgestaltung des Wettbewerbs auf konkreten Märkten. In diesem Sinne betont Beckert (2007: 56), dass Wettbewerb nicht nur über den Preis als wirtschaftliche Kategorie ausgetragen wird, sondern auch in Form des Kampfes um die Ausgestaltung von Wettbewerbspolitiken und um die kulturelle Deutungshoheit im Kontext der Definition von Geschmacks- und Qualitätsstandards auch über 38 „It is very difficult for actors to know a priori if a given set of actions will stabilize a firm’s market position vis-à-vis its competitors. Put rhetorically, no actor can determine which behaviors will maximize profits (...), and action is therefore directed towards the creation of stable worlds“ (Fligstein 2002b: 71) Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 53 politische und kulturelle Institutionen in der Gesellschaft verankert ist. Das Kooperationsproblem: Auch wenn Konkurrenz ein konstitutives Element des Marktwirtschaftens ist, bedarf es konkreter Kooperationen, um Märkte zu realisieren. „Sowohl die institutionelle Ökonomie und die Spieltheorie als auch die neue Wirtschaftssoziologie haben eine Vielzahl sozialer Mechanismen untersucht, die dazu beitragen, egos Einschätzung der Wahrscheinlichkeit kooperativen Handelns von alter ego zu verbessern und damit Marktversagen zu verhindern“ (Beckert 2007: 57). Zur Lösung dieser drei Probleme fasst Beckert (2002, 2005, 2007) Lösungsstrategien ins Auge, die „Zuversicht“ oder eben Vertrauen stiften können, indem sie Unsicherheit in Risiko überführen: Die bewusste Gestaltung der Anreizstrukturen der Tauschpartner; die wissenschaftliche Einbettung des Markthandelns in eine Netzwerkperspektive; den Bezug auf Normen, Ethik und Moral; schliesslich die Wirkung von Macht, Zwang und Gewalt, die auf legalen wie illegalen Märkten die Kooperationsbereitschaft erhöht. Anders als seine Vordenker Frank Knight und Karl Polanyi konnotiert Jens Beckert Unsicherheit dabei aber nicht per se als negativ, sondern beschreibt sie auch als die Grundlage für Wahlfreiheit und Bewährungsgrundlage unternehmerische Tugenden39. In diesem Sinne kann dann auch die Joseph Schumpeters Idee vom Unternehmer als schöpferischem Zerstörer ihren Platz im „All economies are embedded“Universum Jens Beckerts40 finden: Auch Märkte unterliegen dem Wandel, konkret dem sozialen Wandel, der durch einen „dynamic process of oscillation between embedding, disembedding and reembedding“ (Beckert 2007b: 19) gekennzeichnet ist. In diesem Sinne sind Märkte also immer sozial verankert, aber eben nicht immer in den gleichen Häfen. 39 40 „One central entrepreneurial function consists of the production and maintenance of the willingness to cooperate in view of the ineluctable freedom actors have to behave opportunistically. Der hier (2007b: 19) den Titel eines Artikels von Benjamin Barber (1995) zitiert. 54 Steffen Roth Patrik Aspers und Jens Beckert (2008: 239) wie weiteren Neuen Wirtschaftssoziologen zufolge gehört noch ein weiterer marktsoziologischer Ansatz zum Kanon der neuen Wirtschaftssoziologie, auch wenn es „keinesfalls allgemein anerkannt (ist), diesen Ansatz überhaupt unter eine vom Begriff der Einbettung ausgehende Marktsoziologie zu subsumieren“: Die auf Michel Callon (1998a, 1998b, 2005) zurückgehende Idee von der Performativität ökonomischen Wissens. Gleichwohl Callon (1998a) die Einleitung seines paradigmatischen Herausgeberbandes The Laws of the Market mit The Embeddedness of Economic Markets in Economics überschreibt, liegt sein Ansatz doch sichtbar quer zum Verständnis von Einbettung, das die neue Wirtschaftssoziologie kultiviert. Entsprechend lautet dann auch die Kritik an letzterem: „Saying that economics has failed by neglecting to develop a theory of real markets and their multiple modes of functioning, amounts to admitting that there does exist a thing – the economy – which a science – economics – has taken as ist object of analysis. The point of view that I have adopted in this introduction, and which the book strives to defend, is radically different. It consists in maintaining that economics, in the broad sense of the term, performs, shapes and formats the economy, rather than observing how it functions“ (ebd.: 2). Callon spricht also davon, dass wirtschaftswissenschaftliche Theorien funktionieren, indem sie die Objekte verändern, auf die sie sich beziehen. Entsprechend erzeugt jeder Wirtschaftswissenschaftler und – praktiker, Märkte mittels Anwendung neoliberaler Markttheorien und von ihnen abgeleiteter Buchhaltungs- und Controlling-Tools. Als Beispiele für derart performte Märkte werden in der Regel Märkte für Finanzprodukte angeführt, die es vor der Erfindung der jeweiligen Produkte gar nicht gab (vgl. MacKenzie und Millo 2003). Im Sinne eines leichter nachvollziehbaren Beispiels verweist man seit langem auf Marie-France Garcia-Parpets (1986, 2007) Arbeit zu den Erdbeermärkten im zentralfranzösischen Fontaines-en-Sologne, die seit 2007 auch in Englisch vorliegt. Die Studie beschreibt wie dieser Markt modifiziert wurde, um effektiver zu funktionieren: Ursprünglich wurden Erdbeeren unkoordiniert entlang persönlicher Beziehungen zwischen Erdbeerpflanzern, Zwischenhändlern und Speditionen Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 55 gehandelt. Nach der Reform des Erdbeermarktes wurden die Erdbeeren in Körbe gepackt, die Körbe mit Informationen versehen und in einer Auktionshalle sortiert dargeboten, so dass jeder potenzielle Käufer schnell Menge und Qualität der angebotenen Erdbeeren abschätzen und im Rahmen einer Auktion erwerben konnte. Dabei war der Auktionsraum so gestaltet, dass Käufer und Verkäufer einander nicht sehen konnten. Entsprechend konnten im Rahmen des Markttausches auch keine sozialen Beziehungen entstehen, noch konnten bestehende Beziehungen Einfluss auf den Handel nehmen. Eine idealtypische Wettbewerbssituation war entstanden. Michel Callon (2007: 335) hat die Bedeutung dieser Studie für die Entwicklung seines Ansatzes hervorgehoben: Am Beispiel des Erdbeermarktes von Fontaines-en-Sologne könne man sehen, dass reale Märkte tatsächlich dem neoliberalen Ideal entsprechen können; gleichzeitig zeige sich aber, dass neoliberale Marktformen, anders als vom neoliberalen Mainstream behauptet, nicht quasi natürlich entstehen, sondern willentlich installiert und kultiviert werden müssen. Diese von Callon gegen die neoklassische Ökonomik gerichtete Kritik wendete sich folgerichtig bald auch gegen seine eigene Performance (vgl. v.a. Aspers 2005, 2005b), gerade weil er es unterlassen hat, die Performance der eigenen Theorie in sie selbst einzubauen41. Während Callon (1998: 30) also dafür plädiert, statt vorgeblich realer Märkte jene Disziplinen und Professionen zu studieren, die Markttheorien hervorbringen und Märkte in deren Anwendung erzeugen, lautet der Anspruch des aktuellen Mainstreams der Wirtschaftssoziologie, dass Theorien die Vielfalt realer Märkte reflektieren sollten. Insbesondere verweist man auf den Umstand, dass die These von der theoretischen Konstruiertheit von Märkten nur auf Auktionsmärkte zuträfe, die Entstehung von Produktionsmärkten im Sinne Harrison 41 In der Tat bindet Callon sein Konzept so eng an eine Kritik des Neoliberalismus, dass man sie bereits mit dem Argument einer möglichen counterperformativity in starke Bedrängnis bringen kann. Gemeint ist damit die schlichte Einsicht, dass die zunehmende Anerkennung von Callons Ansatz zur Verdrängung neoliberaler Marktkonzepte und damit zum Verschwinden der empirischen Belege für seinen eigenen Ansatz führen würde (vgl. Mackenzie 2004: 306). Andererseits hat ein theoretisches Konzept, das genau dann ungültig wird, wenn es nicht mehr gebraucht wird, auch seinen Charme. 56 Steffen Roth Whites und damit der Mehrheit aller Märkte allerdings nicht erklären könne (vgl. Aspers 2007). Grundsätzlich liegt das Konzept der Performativität also gleichermassen kreuz und quer zum Mainstream der neuen Wirtschaftssoziologie: Einerseits rechnet man Callon et al. durchaus zum aktuellen Kanon der Wirtschaftssoziologie; andererseits unterscheidet sich die These, dass Märkte nicht in die (gesamte) Gesellschaft, sondern (nur) in eine wissenschaftliche Disziplin eingebettet seien, deutlich von dem Einbettungsverständnis, das die neue Wirtschaftssoziologie als einen ihrer Kernbestände kultiviert. Callon verdankt der Mainstream-Diskurs dabei in jedem Fall einen weiteren Ansatzpunkt für ein konstruktivistisches Marktverständnis, an dem dieser Arbeit sehr gelegen ist. Aus konstruktivistischer Perspektive verwundert allerdings, dass ein Wirtschafts- und Marktsoziologe die Frage, ob Ökonomen Märkte machen würden, durchaus nachvollziehbar bejaht, und es dabei belässt. Es scheint, als ob nur Ökonomen Märkte machen könnten; oder umgekehrt, als ob alle Akteure, die an der Konstruktion von Märkten beteiligt sind, automatisch als Ökonomen gelten müssen (vgl. Callon 2007: 332f). Letztlich stellt sich dann die Frage, ob wir uns diese ‚Ökonomen’ als wirtschaftliche oder als wissenschaftliche Agenten42 vorstellen müssen? Zusammenfassung: Grenzen der alten und neuen Wirtschaftssoziologie „Die neue soziologische Aufmerksamkeit für den Markt als zentrale Institution kapitalistischer Wirtschaften hat in den letzten Jahren die wirtschaftssoziologische Reflexion auf das Verhältnis von Soziologie und Wirtschaften neu angeregt (...). Die Wirtschaftssoziologie tritt aus ihrer selbst gewählten Rolle der Ergänzungswissenschaft heraus“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 39). 42 Auf Callons (1998: 4ff) Verständnis von Marktteilnehmern als calculative agencies kommen wir an anderer Stelle zurück. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 57 Die Frage, ob die neue Wirtschaftssoziologie tatsächlich mehr sein kann als eine Ergänzungswissenschaft, wenn sie vornehmlich die seitens der Ökonomik aufgezeigten Forschungslücken schliesst, kann hier offen gelassen werden. Die vorliegende Arbeit setzt in ihrer Kritik an der neuen Wirtschaftssoziologie an anderer Stelle an, indem sie im Folgenden nicht nur das Marktverständnis der Ökonomik, sondern auch das der Wirtschaftssoziologie zur Disposition stellt, indem sie fragt: Wie weit hat sich die Soziologie vom ökonomischen Reduktionismus wirklich entfernt, wenn sie Märkte immer noch als wirtschaftliche Phänomene, und damit als exklusiven Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftssoziologie begreift? Macht es wirklich Sinn, die Soziologie des Marktes als Teilmenge der Wirtschaftssoziologie zu begreifen? Wenn Märkte nun nicht mehr nur von Ökonomen performt werden, sondern auch von Soziologen, wieso machen Soziologen dann nach wie vor nur ökonomische Märkte? Können Soziologen nicht auch nicht-ökonomische Märkte machen? In diesem Sinne „gibt es noch einiges zu tun, bis wir eine vollständige soziologische Theorie des Marktes haben werden“ (Swedberg 2007: 17f). Zudem verwundert, wenn wir bei den Protagonisten der Neuen Deutschen Welle der Wirtschaftssoziologie lesen: „Verglichen mit den Ansätzen der politischen Ökonomie stehen in der neuen Wirtschaftssoziologie sehr viel stärker Fragen der Koordination von Handlungen der Akteure und die Entstehung geordneter Tauschbeziehungen zwischen Marktakteuren aus einer Mikroperspektive im Vordergrund. (...) Deshalb konzentriert sich die Forschung der neuen Wirtschaftssoziologie zum einen weniger auf formale Institutionen, verwendet einen weiten Institutionenbegriff und dehnt den Einbettungsbegriff auch auf kulturelle, sozialstrukturelle (Netzwerke) und kognitive Strukturierungen des Handelns aus“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 29). Inwieweit sich ein Fokus auf kognitive Handlungsstrukturen, der den Gegenstandsbereich der Soziologie in Richtung Psychologie verlässt, zur Begründung einer soziologischen Disziplin eignet, darf dahingestellt bleiben. Auch in diesem Sinne ist man von einer konsistenten Soziologie des Marktes noch ein Stück weit entfernt. Neben deren Entwicklung nennt Schluchter (2007: 92f) noch einen weiteren Aspekt, der ihm „für eine konstruktive Weiterentwicklung der neuen 58 Steffen Roth Wirtschaftssoziologie zur Zeit (...) von besonderer Bedeutung zu sein“ scheint: Eine stärkere gesellschaftstheoretische Verankerung der Wirtschaftssoziologie. In diese Richtung argumentieren neben Milan Zafirovski (2003: 2) auch Jens Beckert und Richard Swedberg (2001: 379f): „It was only in the US, through the works of Talcott Parsons (...) that economic sociology remained an integral part of sociological theory, at least up until the 1950s. If we look at the work of Jürgen Habermas or Anthony Giddens, to give just two examples, there are very few theoretical conceptualizations regarding the economy. This is not to say that these theorists do not see the economy as an important social realm, but they did not engage in the systematic theoretical invesitgation of economic structures. Exceptions to this general trend are Pierre Bourdieu and possibly Niklas Luhmann and James Coleman“. Nicht im folgenden, wohl aber im übernächsten Kapitel, gilt es daher insbesondere die Arbeiten dieser drei Autoren näher zu beleuchten. Dabei, und mit Blick auf das Anliegen dieser Arbeit, verblüfft dann weniger die Tatsache, dass Rational Choice und Systemtheorie aus ideologischen und paradigmatischen Gründen im aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurs überwiegend als Randnotizen geführt werden, sondern vor allem, dass eine ganze Reihe von Autoren nahezu jeden neu-wirtschaftssoziologisch anschlussfähigen Aspekt des Werkes von Pierre Bourdieu verwerten, ohne aber dessen unmissverständlich erklärten Standpunkt zum zentralen Gegenstandsbereich der neuen Wirtschaftssoziologie zu reflektieren. Man scheint dem Grandseigneur der kritischen Soziologie inzwischen ebenso bewusst wie stillschweigend nachzusehen, dass dessen Marktkonzept dem unbedarften Leser mitunter enger mit jenem der Gegner der ersten Stunde, allen voran Gary Becker, verwandt erscheinen mag als den Konstrukten des eigenen Lagers43. Das geschieht dabei wohl teils aus Taktgefühl, teils aus argumentativer Not, der sich die noch junge Disziplin zweifellos nicht aussetzen will. Da es der vorliegenden Ar43 Bourdieu (1999: 150ff, 494) spricht ausdrücklich von der Existenz nichtökonomischer Märkte, konkret etwa von Märkten, in denen kulturelles oder symbolisches Kapital erlangt und investiert werden kann. Zudem spricht Bourdieu wie Gary Becker von Heiratsmärkten (ebd. 225). Milan Zafirovski (2001: 40) legt ihm das grosszügig als Spiel mit Metaphern aus. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 59 beit allerdings um die Begründung einer noch jüngeren Disziplin geht, muss und darf sie an diesem Punkt ein wenig rücksichtslos sein. Rücksichtslos meint dabei nicht respektlos, und schon gar nicht desinteressiert. Im unmittelbar anschliessenden Kapitel beschäftigt die Arbeit daher das Anliegen, die Annahme der nichtökonomischen Märkten auch im wirtschaftssoziologischen Diskurs als zumindest legitime, d.h. vom Verdacht des Reduktionismus befreite Forschungsfrage zu verankern. 60 Steffen Roth Kapitel IV Viele Märkte! Marktsoziologie jenseits der Wirtschaftssoziologie? Die Renaissance der Wirtschaftssoziologie (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 19) als einer Disziplin, die sich eher mit den Gegenständen der Ökonomik als denen der Ökonomie beschäftigt (vgl. Fourcade 2007: 1017), verdankt sich durchaus widersprüchlichen wirtschaftswissenschaftlichen Impulsen zum Thema Markt. Zum einen konnte man seit Douglas C. Norths (1977: 710) legendärem Bekenntnis vom unterdefinierten Marktbegriff den Markt zum Waisenknaben der Ökonomik erklären. Rasch entwickelte er sich zum bevorzugten Ziehkind der Wirtschaftschaftssoziologie44, die ihn seither wie ein enfant sauvage behandelt, das mit mehr oder weniger sanfter Gewalt wieder mit sozialen Strukturen vertraut werden muss. Der Markt gilt demnach als Resozialisierungsfall. Die entsprechenden Strategiediskussionen erinnern selbstverständlich nur noch entfernt an die des 18. Jahrhunderts45, je nach theoretischem Hintergrund 44 45 Mitunter erscheint es, als ob diese Erklärung mehr die strategische als die reale Bedeutung des Marktes im wirtschaftssoziologischen Diskurs reflektiert: Eine aktuelle Studie von Jens Beckert und Natalia Besedovsky (2009: 14) kommt zu dem Schluss, dass der Markt nach wie vor hinter den Feldern „wirtschaftliche Makrostrukturen“ und „Arbeit und industrielle Beziehungen“ aktuell nur auf Platz 3 der Themen der Wirtschaftssoziologie liegt; über die letzten Jahrzehnte seit der Entstehung der Neuen Wirtschaftssoziologie gerechnet reicht es hinter dem Thema „Unternehmen“ gar nur für einen vierten Platz. Gleichwohl uns der Markt als „ein Kind des 18. Jahrhunderts“ (Bluhm und Malowitz 2007: 3) vorgestellt wird. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 61 erkennt man gar den Nutzen der so eigentümlichen Eigenlogik des Marktes an. Dennoch erscheint uns der Markt tatsächlich irgendwie wild, anarchisch und unerzogen (vgl. Zafirovski 2003: 93), nicht sozial-kompetent sozusagen. In diesem Sinne korrespondiert Einbettung dann in letzter Instanz tatsächlich mit (nachholender) Erziehung: Es gilt, dem Markt zu einem neuen Selbstbewusstsein, etwa als soziale Struktur, zu verhelfen. Dieser Anspruch bringt den Begriff und dessen Beobachter dann mitunter bis an die Grenze zur experimentellen Neurose: Der historische Betriebsunfall (Deutschmann 2007b: 5) muss lernen, dass er selbst als Form der Vergesellschaftung mit Ungenossen (Weber 1980: 385) eine nach den Gesetzen der Genossen definierte soziale Struktur darstellen oder zumindest in eine solche eingebettet sein muss46. Zum anderen spielt der Markt in wirtschaftssoziologischen Szenarien die Hauptrolle, die im Rückgriff auf Vokabeln wie ökonomischer Methodenimperialismus und Marktfundamentalismus beschrieben werden. Damit sind jene Varianten der Ökonomik angesprochen, die den Markt auch jenseits der klassischen Gegenstandsbereiche der Ökonomik, d.h. in weiteren wissenschaftlichen Feldern sowie in der Politik, als Erklärungs- und Lösungsmodell präsentieren. Vor diesem Hintergrund präsentiert man uns Einbettung dann eher als institutionalistische containment-Strategie, mit deren Hilfe spezifische Bereiche des Sozialen vor den negativen Folgen des Wirkens eines „boundless markets“ (Zelizer 1988: 620) geschützt werden sollen. Wenn man den Markt vor diesem Hintergrund als soziale Struktur47 interpretiert, dann stellt sich die Frage, warum es eine soziale Einheit vor einer anderen zu schützen gilt, oder konkreter, wer auf Grundlage welcher Entscheidungsmodelle definiert, was 46 47 Die Frage stellt sich, warum der Markt nicht auch ebenso den Erwartungen der Ungenossen entsprechen sollte, und sich somit als losgelöst von den je individuellen Erwartungen beider Parteien, in diesem Sinne also als entbettet, betrachten kann. Der Begriff soziale Struktur soll an dieser Stelle lediglich als Containerbegriff im Sinne der Beschreibung einer „complex sociological category, namely, a social structure, system, and institution“ (Zafirovski 2003: 104) und nicht als definitorische Festlegung verstanden werden. 62 Steffen Roth schützenswert ist?48 Etwas weniger politisch gewendet fragt sich, wer definiert, ob und wann eine soziale Struktur nicht sozial genug ist. Was wäre hinreichende Sozialität dann (jeweils)? In diesem Sinne stellt sich die Frage nach dem Gesellschaftsbegriff; in verschärfter Form, wenn wir etwa das Anliegen formuliert finden, „de(n) dritte(n) Weg der Eindämmung und Abpufferung von Marktbeziehungen (…) verbunden mit der gezielten Ermöglichung sozialer Lebensformen“ (Beck 1993: 201) zu beschreiten. Hier fragt man sich verwundert, wie etwas Soziales (Marktbeziehungen) ausserhalb der Gesellschaft (soziale Lebensformen) stehen kann? In diesem Sinne lässt sich der einst durch das berühmte Douglas North Zitat49 ins Rollen gebrachte Ball zweifellos zurückspielen; leicht abgewandelt heisst es dann: Es befremdet schon, dass die wirtschaftssoziologische Literatur so wenig Diskussion über den zentralen Begriff enthält, der ihrer Disziplin zugrunde liegt: der Gesellschaft. Dieser Hinweis darf nun allerdings nicht als Doppelpass mit der Ökonomik missverstanden werden. Vielmehr geht es der vorliegenden Arbeit darum, beide (Teil-)Disziplinen auszuspielen, um eine neue zu etablieren: Eine eigenständige Marktsoziologie, die von der Existenz nicht-ökonomischer Märkte und damit von einem funktions-neutralen Marktmodell ausgeht. Mit diesem Anliegen fordert die Arbeit beide Lager heraus: Zum einem argumentiert sie mit der Wirtschaftssoziologie gegen den reduktionistischen Marktbegriff der Ökonomik. Zum anderen stellt sie aber auch die innerhalb der Soziologie üblichen Reflex in Frage, die Wirtschaftssoziologie als Paradedisziplin für den Umgang mit dem Markt zu begreifen. Kurz: Warum sollte der Markt eben der Gesell- 48 49 Zweifellos war es den Gründervätern der Ökonomik einst darum gegangen, den Markt dem Zugriff der durchaus sichtbaren Hand des Souveräns zu entziehen; Wirtschaftssoziologen geht es heute aber ebenso zweifelsfrei darum, den entfesselten Markt dem mittlerweile demokratisch verfassten Souverän wieder in die Hände zu spielen. In diesem Sinne können sich dann beide Lager also wechselseitig als normativ enttarnen. “It is a peculiar fact that the literature on economics (…) contains so little discussion on the central institution that underlies neoclassical economics: the market” (Douglass 1977: 710) Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 63 schaft, als deren Anwalt sich die (Wirtschafts-) Soziologie begreift, ausschliesslich ein ökonomischer sein? Auf diese eigentlich rhetorische Frage hin lassen sich zwei durchaus ernst gemeinte Antworten diskutieren: 50 Zum einen gilt nicht nur Wirtschaftssoziologen der Rekurs auf nicht-ökonomische Märkte als Teil einer Strategie des ökonomischen Imperialismus, also der als Aggression eingestuften Expansion des methodologischen Individualismus (Kirchgässner 2008: 148), dessen unsichtbare Hand nun auch nach dem familiären Altruismus (Habisch 1998: 36) und dem Ökosystem (Chiesura und de Groot 2001: 221) greift. Der Einwand lautet dann, dass bei der Ausweitung des ökonomischen Kalküls auf nicht-ökonomische Bereiche der Gesellschaft etwas verloren geht oder gar zerstört wird.50 „Ökonomisierung und Vermarktlichung“ (Pohlmann 2006: 230) lassen sich dabei durchaus in einem Atemzug nennen, von Ökonomisierung sprechen wir als „einer ubiquitären Anwendung des Marktsprinzips“ (Kutschker und Schmid 2008: 177). Entsprechend beobachten wir eine wachsende Ökonomisierung der Lebenswelt (vgl. Kurbjuweit 2003), mit dem Ergebnis, dass sich die Lebensführung des Individuums zunehmend verbetrieblicht (Pongratz und Voss 2001: 44f). Wenn wir vom totalen Markt (Schui, Ptak und Blankenburg 1997) hören, dann denken wir nicht an Marcel Mauss (1990), sondern eher an den Terror der Ökonomie (Forrester 1998). An anderer Stelle lesen wir in Form einer Kritik am New Public Management: „Wird Dienstleitung lediglich im ökonomischen Sinn als marktorientierte verstanden, so können die Wir können hier an die geldvermittelte Verwandlung von Liebe in Prostitution denken (Holmes 1985: 32). Aber nicht nur auf der Strasse, sondern auch im Unternehmen ändert sich bekanntlich der Charakter von Investitionen in soziales Kapital, wenn Reziprozität durch externe Incentives modifiziert, also etwa ‚von oben’ verordnet wird, und damit nicht mehr Ausdruck von Kollegialität, sondern von Compliance mit der Firmenpolitik ist (vgl. Moldaschl 2005). Dabei zeigt sich, dass nicht nur Geld, sondern auch Macht ‚das Soziale’ korrumpiert. 64 Steffen Roth spezifischen Probleme einer (...) Dienstleistung nicht ausreichend erfasst werden, da eine zumindest weitgehende Übereinstimmung in Bezug auf Struktur und Funktion von privater Wirtschaft und öffentlicher Dienstleistungserbringung (...) vorausgesetzt wird, die aus verschiedenen Gründen pauschal nicht zutrifft“ (Grunwald 2001: 121). Gleiches gilt dann auch für das Gesundheitssystem: „The market model fails because patients cannot be informed consumers. When people are sick, they go to doctors to help them. When you are in a hospital, you do not shop around and you do not ask for prices“ (Fligstein 2005: 73). Die Grenzen der Marktlogik im Gesundheitssystem zu bestimmen, heisst auch bei Marianne Rychner (2006): Gesundheit lässt sich nicht mit den Mitteln der Wirtschaft herstellen. Ähnliche Grenzziehungen interessieren uns auch vor dem Hintergrund der Ökonomisierung des Bildungswesens, der zunehmenden Drittmittelorientierung der Wissenschaft sowie einer ganzen Reihe weiterer Zeugnisse der ‚Vermarktlichung’. Welcher Teilbereich von Gesellschaft da im Einzelfall dann auch immer angesprochen sein mag: Letztlich erstaunt doch immer wieder, wie viele Beispiele der illegitimen Kommodifizierung Ethiker und Soziologen sammeln können, ohne eine konsistente Grenze für die kritisierte Entwicklung ziehen zu können. Man fragt sich, wie viele der Kritiker, die heute die Ökonomisierung des menschlichen Lebens51 problematisieren, eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, die im 19. Jahrhundert als Form der Kommodifizierung des Lebens und damit als unmoralisch angesehen wurde (Zelizer 1978). Insofern stellt sich mitunter tatsächlich die Frage, was eine derart formulierte Kritik am Marktprinzip anderes ist als eine allenfalls soziologisch unterfütterte Form der Wirtschaftsethik? Wessen (wirtschaftsethischen) Standpunkt vertritt die Wirtschaftssoziologie dann aber? Den der, d.h. welcher, Gesellschaft? Soll man die Wirtschaftssoziologie demnach als Übersetzungsinstanz zwischen 51 Etwa auch im Kontext der embryonalen Stammzellenforschung (BaduraLotter 2005: 349). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 65 Wirtschaft und den nicht-ökonomischen Sphären der Gesellschaft begreifen? Wenn ja, dann erweisst sich die Metapher der nicht-ökonomischen Märkte vielleicht sogar als brauchbar, um der Wirtschaft zu zeigen, dass es ‚da draussen’ in der Gesellschaft einiges gibt, dass mehr als schiere Randbedingung sein und entsprechend umfassend ins Kalkül gezogen werden will. Zum anderen lässt sich gegen die Verwendung des Marktbegriffs jenseits der Wirtschaft schlicht argumentieren: „Apparently, such non-economic markets are metaphors and analogies rather than substantive concepts“ (Zafirovski 2001: 39). Dem lässt sich allerdings entgegnen, dass es sich beim für die neue Wirtschaftssoziologie durchaus zentralen Begriff der Embeddedness seinerseits um eine Metapher handelt (Lütke 2005: 55; Florian und Hillebrandt 2006: 9; Krippner und Alvarez 2007: 220, 232f). Ähnliches gilt für ebenfalls ausgewiesene Metaphern wie Markets as Politics (Fligstein 2002: 656), die sich anders als die ‚Metapher’ von den nichtökonomischen Märkten allerdings nicht zu verbieten scheint. Im nächsten Abschnitt wird sich zudem zeigen lassen, dass es den neu-wirtschaftssoziologischen Ansätzen kaum gelingt, den Markt als soziale Struktur oder Institution in den Begrifflichkeiten der Wirtschaft zu beschreiben; vielmehr stossen wir hier ständig auf nichtökonomische Metaphern, die vornehmlich, aber nicht ausschliesslich, aus den Bereichen Politik und Recht stammen. In den darauffolgenden Abschnitten wird zunächst das reduktionistische Potenzial der Frage nach nicht-ökonomischen Märkten abgeklärt, bevor die nichtökonomischen Märkte als ernstzunehmende Forschungslücke in die Diskurse um nicht-ökonomische Kapitalsorten und organisationale Polyphonie eingebettet werden. Schliesslich wird gezeigt werden, dass die Bearbeitung dieser Forschungslücke nicht durch eine in die Wirtschaftssoziologie eingebettete –oder besser: eingeschlossene – Marktsoziologie zu leisten sein wird. 66 Steffen Roth Die vielen Märkte der neuen Wirtschaftssoziologie Auf den ersten Blick scheint es gar, als sei die neue Wirtschaftssoziologie der Idee von einer Pluralität der Märkte alles andere als abgeneigt: „Tatsächlich (...) besteht ‚der Markt’ aus vielen Märkten, die funktional, regional und generationenspezifisch differenziert sind und nicht einen monistischen und kohärenten Preiszusammenhang bilden“ (Koslowski 1994: 210). Eine Unmenge sozialer Beziehungen strukturieren Märkte also, und das in den unterschiedlichsten Erdregionen (Fligstein 2002b: 198). An anderer Stelle ist die Rede von Märkten für industrielle, für nicht-industrielle Waren, für Arbeit, für Land, für Anlagewerte und zudem von Scheinmärkten (vgl. Costas 2003: 124). Vor dem Hintergrund der Arbeiten von Harrison White und Michel Callon lassen sich Produktions- und Auktionsmärkte unterscheiden. Bei Nicole Biggart und Thomas Beamish (2003) sowie Colin Campbell (2005) lesen wir von den unterschiedlichsten Interaktionsformen auf Märkten, deren Kontinuum von materiellen Stahlmärkten bis hin zu symbolischen Heiratsmärkten reichen, Märkte für Organe und Adoptivkinder nicht zu vergessen (Healy 2004). MarieFrance Garcia-Parpets und Jens Beckert bringen uns Märkte für Erdbeeren, Wein, Kunstwerke oder Whale-Watching näher. Wir können es entsprechend kurz machen und schlicht von einer Richness of Markets (Arnoldi 2007: 91) sprechen. Für die Wirtschaftssoziologie gilt also durchaus: „Märkte existieren überhaupt nur im Plural” (Bluhm und Malowitz 2007: 6). Nur wenige Autoren gehen allerdings so weit wie Viviane Zelizer (1988: 618), die zumindest in ihren frühen Arbeiten unter einem “multiple markets model: the market as the interaction of cultural, structural, and economic factors” verstand, in dem sie zudem “the most useful alternative to the neoclassical paradigm of the market” (Zelizer 1988: 618) erkannte. Allerdings verfolgte sie diese Alternative nicht bzw. nur indirect über ihre Arbeiten zur Social Meaning of Money (1997) weiter. Mittlerweile stellt sie dabei nurmehr die “market Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 67 conception of money” (2007: 1061) in Frage52, indem sie diverse Gebrauchswerte von Geld unterscheidet53 und entsprechend nicht von Geld, sondern von „monies” (1063), also wie Dirk Baecker (2003: 7) von „vielen Gelder(n)“ spricht. Mit der Idee der multiple markets verbindet Zelizer (2007: 1059) inzwischen folgenden Gedanken: „From an earlier almost exclusive focus on production, economic sociologists are now expanding their analysis into other markets, especially financial markets, consumption markets, markets for personal care, and what they loosely call the informal economy”, verschiedene Varianten ökonomischer Märkte also54. Von besonderem Interesse sind dabei ihre Ausführungen zur informellen Ökonomie, die sie in ihrer Arbeit The Real Economy (2008: 190) vorlegt, in der sie einen truism der Nordamerikanischen Soziologie in Frage stellt, nämlich „the notion that there is a real economy characterized by firms and markets, legal tender, government regulation, taxes and national accounts. Then, in the shadows of this formal economy proliferates the dark world of the informal economy. The informal economy (...) contains a crippled, incomplete version of the formal economy destined to disappear as economic rationality takes over“. Was für Zelizer an dieser Dichotomie zwischen der vollwertigen Ökonomie der Firmen und Märkte auf der einen und der QuasiÖkonomie der Haushalte auf der anderen Seite nicht stimmt, ist der 52 53 54 “In keeping with the idea of multiple markets, I propose a model of multiple monies showing that people earmark different currencies for their many, complex, and often delicate social relations” (Zelizer 1994: xi) “(A)s compensation (direct exchange), as entitlement (the right to share) and as a gift (one person’s voluntary bestowal on another). Each implies a different quality of social relations among the parties” (Zelizer 1998: 60). Bleibt an dieser Stelle zu ergänzen, dass Zelizer (2007: 1057) mittlerweile bekennt, dass sie lange Zeit nicht wusste, dass das, was sie tut, Wirtschaftssoziologie ist, zu der sie sich inzwischen offenkundig hingezogen fühlt: „Over the past 10 to 15 years, I have been surprised as anyone else to see myself become part of the economic sociology establishment (…). What happened? Part of it is that I learned more about the variety of work going on in economic sociology and took a greater part in that increasingly energetic conversation”. 68 Steffen Roth Umstand, dass historisch betrachtet die ‚informelle Ökonomie’ jene Form von Ökonomie war, in der sich ein Grossteil des wirtschaftlichen Handelns vollzog. Das erinnert zum einen an die These Polanyis von der Marktwirtschaft als historischem Sonderweg und macht zum anderen deutlich, dass Märkte mittlerweile auch für Zelizer ein Spezialfall der Ökonomie sind. Viele Märkte meint also auch bei Zelizer: Viele ökonomische Märkte. Der Markt gilt also sicher nicht als homogen (Samuels 2004), bleibt aber dennoch der (wirtschaftliche) Markt, selbst wenn Wirtschaftssoziologen wie Jens Beckert (2007: 61), obgleich entschiedene Gegner von Gary Becker’s Idee nicht-ökonomischer Märkte, davon sprechen, dass Märkte „Teil der politischen, moralischen und kulturellen Ordnung von Gesellschaften“ sind. Angesichts solcher Aussagen fragen wir uns, ob das heisst, dass Märkte nicht-ökonomische Dimensionen aufweisen, und dennoch – zumal als bevorzugter Gegenstand der Wirtschaftssoziologie – letztlich als wirtschaftliches Phänomen zu betrachten sind? Oder ist Wirtschaft gar ein Teil von Politik? Tatsächlich lesen wir genau das bei Jakob Arnoldi (2007: 91): „Markets, and the economy itself, are and always have been political constructs, engineered and supported by political decision-makers (though markets also exert influence over these)“. Grundsätzlich scheint man sich im Anschluss an Max Webers Definition von Wirtschaft als friedlicher Ausübung von Verfügungsgewalt auch den Markt schwer ohne politisch informierte Konzepte vorstellen zu können. Wir lassen uns die Marktlogik als Dominanz-Ideologie vorstellen (Hadjar 2004: 42) oder treffen auf Begriffsamalgame wie ökonomische Macht, deren fehlende Würdigung Soziologen gar als Mangel an Professionalität vorgeworfen werden kann55; umgekehrt lassen sie sich aber auch als latente Komplizenschaft mit der Ökonomik interpretieren, die Märkte als Inbegriff oder zumindest als Garanten der Demo55 Diese Einschätzung verdankt sich Richard Swedbergs (1987b) Arbeit Ökonomische Macht und wirtschaftliches Handel, in der der Autor nicht nur mit einer ausführlichen Besprechung wirtschaftssoziologisch relevanter Machtkonzepte aufwartet, sondern auch enttäuscht konstatiert: “In der Regel erachten es Soziologen nicht für notwendig, ‚ökonomische Macht’ als eine besondere Form der Macht zu betrachten“ (Swedberg 1987b: 158). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 69 kratie politisch glorifizieren: „This notion specifies the market as a political institution underlined by what economists, by analogy to the state or prince, call ‚consumer souvereignty’ – that is, a democracy where the consumer is the ‚king’“ (Zafirovski 2003: 123). Der Wirtschaftssoziologie empfiehlt Milan Zafirovski demnach, sich nicht auf eine ideologische Auseinandersetzung mit der Ökonomik über das politische Wesen und Wirken des Marktes einzulassen, sondern den Markt als politisch neutral zu begreifen (ebd.: 125), und sich besser auf eine soziologische Analyse der market laws zu konzentrieren (ebd.: 145ff). Mit diesem Hinweis begibt sich Zafirovski in gute Gesellschaft: Nicht nur Michel Callon (1998) interessiert sich für The Laws of the Markets, auch bei Jens Beckert lesen wir, dass auf dem Markt vornehmlich Rechte gehandelt werden: „Markets (...) provide a social structure and institutional order for the voluntary exchange of rights in goods and services, which allow actors to evaluate, purchase and sell these rights“ (Beckert 2009: 456; vgl. auch Aspers und Beckert 2008). Auch Masudul A. Choudhury untersucht Markets as a System of Social Contracts (1996). Nicht nur Joseph Schumpeter (1956: 93) äussert hohe Erwartungen an den Markt, der für kommunikative und Verteilungsgerechtigkeit sorgen soll; Marktversagen liegt, durchaus im Einklang mit dem Alltagsverständnis, also dann vor, „wenn Kapital und Marktlogik, die das ökonomische Geschehen regulieren, die soziale und politische Balance von ausgleichender Gerechtigkeit in der Gesellschaft nicht mehr sichern können“ (Pühl 2000: 36)57. Wieder neutraler formuliert gilt das Markthandeln schlicht als „change of law through law“ (Medema und Samuels 2000: 89). Indem man den Markt dann als „Bündel von Spielregeln“ (Heinemann 1976: 48) begreift oder vom „Spiel des Marktes“ spricht, verschiebt man den Gedanken an rechtliche Rahmenbedingungen bereits an die Grenze zum Sport. Begreifen wir den Markt schliesslich in der Tradition von Marcel Mauss (1990), so lässt er sich als totaler Markt keinem der gesell56 57 Seite 4 des „online-first“-Artikels ohne Angabe von Seitenzahlen. Interessant: Man erwartet vom Markt als der asozialeren Struktur, dass sie Sozialität in der offenbar auch nicht immer hinreichend sozialen Gesellschaft herstellt. Wieder stellt sich die Frage: Was ist hier sozial? 70 Steffen Roth schaftlichen Teilbereiche wie Wirtschaft, Religion oder Politik mehr eindeutig zuordnen. Diese kurzen Ausführungen zur Pluralität der Märkte zeigen bereits, dass man tatsächlich nur schwer ohne nicht-ökonomische Metaphern auskommt, sobald man den Markt der Ökonomik hinter sich gelassen und sich auf marktsoziologisches Terrain begeben hat. Weder diese Tatsache, noch der erklärte Bedarf nach neuen Ideen58 oder der Anspruch, “Märkte immer wieder neu zu denken und zu beschreiben” (Bluhm und Malowitz 2007: 4), hat die Marktsoziologie bislang allerdings so weit gebracht, die Idee der Existenz nichtökonomischer Märkte sowie deren Implikationen ohne allzu grosse ideologische und paradigmatische Reflexe schlicht zu prüfen. Vom Kapital ohne Märkte Im Folgenden soll mit dem Einwand umgegangen werden, die Verfolgung der Idee nicht-ökonomischer Märkte leiste der an sich schon ausufernden Ökonomisierung der Gesellschaft weiteren Vorschub. Die vorliegende Arbeit verfolgt hier schlicht den Gedanken, dass die Herausforderung des ökonomischen Imperialismus weniger in der Ausweitung des ökonomischen Marktmodels auf nicht-ökonomische Dimensionen der Gesellschaft als vielmehr bereits darin besteht, dass die Ökonomik den Begriff so nachhaltig besetzt hat, dass uns die Idee nicht-ökonomischer Märkte heute als gänzlich kontra-intuitiv erscheint. Stellt man diesen Gleichsatz von Markt und Ökonomie in Frage, fällt zunächst auf, dass sich eine Kritik der Ökonomisierung oder der Ausweitung des Marktprinzips logisch nicht gegen die Idee von nicht-ökonomischen Märkten richtet, sondern lediglich gegen die 58 “We Need More Ideas!” ruft Richard Swedberg (2007b: 1035) in einer Überschrift seines Aufsatzes zu Max Weber’s Interpretative Economic Sociology aus. Noch auf der gleichen Seite bekennt er: “I would say that economic sociology (…) is not very innovative and bold”, um dann auf der darauffolgenden Seite den Rückgriff auf den Klassiker als Innovationsbooster zu empfehlen. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 71 Ausweitung ökonomischer Marktprinzipien.59 Insofern genügt der Verweis auf Gary Beckers methodologisch-individualistische Variante der Idee von den nicht-ökonomischen Märkten60 nicht, um die Idee an sich zu disqualifizieren; das gilt um so mehr, als sonst auch der Wirtschaftssoziologie vom ausdrücklich geforderten Rekurs (Swedberg 2007b) auf ihren Gründungsvater abzuraten: Max Weber gilt nicht umsonst als Begründer der Rational Choice Theorie (vgl. Norkus 2001: 75). In diesem Sinne muss dann ebenfalls gelten: Wer in der kritischen Rückbesinnung auf den Gründungsvater der Idee rationalen Wahlhandelns die Zukunft einer anti-reduktionistischen Wirtschaftssoziologie vermutet, der muss es ohne grössere kognitive Dissonanzen ertragen, wenn andere mit kritisch reflektierten Begrifflichkeiten der Ökonomie gegen die Ökonomisierung arbeiten wollen (vgl. Lebaron 2003). Insofern lässt sich fragen, ob die konventionelle Kritik des ökonomischen Imperialismus der neoklassischen Ökonomik nicht insoweit auf den Leim geht, als dass sie die Marktlogik mit der neoklassischen Logik sowie beide mit Wirtschaftslogik deckungsgleich setzt und damit den weitgehenden Theorie-Monismus der Ökonomik (Hansen 2008: 197) zementiert. Wenn dem so wäre, würden auch und gerade die engagiertesten Wirtschaftssoziologen das Problem mit verursachen, als dessen Lösung sie sich verstehen. Wer Markt und Ökonomie statt dessen gedanklich zu trennen vermag, kann die zunehmende Relevanz des Marktprinzips innerhalb der Gesellschaft ähnlich ökonomisierungs-neutral beobachten wie 59 60 Der man auch entspannt gegenüber treten kann: „Ich betrachte auch den nobelpreisgeschmückten ökonomischen Imperialismus eines Gary Becker nicht als kritikwürdigen Ökonomismus. Warum auch sollte die ökonomische Analyse von Schulen, Sozialversicherungssystemen und Einwanderungsbewegungen, von Heirat, Ehe, Familie und Alter moralisch verwerflich sein? Man mag diesen analytischen Zugriff des ökonomischen Imperialisten auf einen Bereich von besonderer moralischer Werthaftigkeit für anstößig halten. Aber man sollte nicht vergessen, dass Liebe, Heirat und Familie als Hort sozialer Intimität und authentischer Individualität sozialgeschichtlich sehr jung sind und dass es für die Menschen bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert selbstverständlich war, Familien- und Eheangelegenheiten unter ökonomischer Perspektive zu betrachten“ (Kersting 2005: 106) Oder eben doch nur der Expansion ökonomischer Marktprinzipien auf andere Teilbereiche von Gesellschaft. 72 Steffen Roth etwa deren zunehmende Organisierung. Interessanter Weise gelingt diese Trennung im Falle einer durchaus wesensverwandten Metapher zumindest insoweit, als dass sie im aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurs mittlerweile allgegenwärtig ist, wo sie bereits seit einiger Zeit nahezu gänzlich ohne Häresieverdacht und mitunter durchaus gewinnbringend eingesetzt wird: “Innerhalb der Soziologie wird das Konzept Sozialkapital verstärkt von der neuen Wirtschaftssoziologie für sich reklamiert“, erklärt Stefanie Hiss (2006: 206) und verweist dabei vor allem auf die Arbeiten von Frank Dobbin (2004) und Mauro Guillen et al. (2003). Das bestätigen auch Jens Beckert, Rainer Diaz-Bone und Heiner Gannsmann (2007: 28, Fn. 2) mit Blick auf die Analyse regionaler Ökonomien, „in denen Konzepte wie Netzwerke, Vertrauen und soziales Kapital eine ebenso wichtige Rolle spielen wie in der neuen Wirtschaftssoziologie“. Bereits Marc Granovetter (1995) argumentierte gegen den damaligen Mainstream der Arbeitsmarkttheorien, dass nicht nur individuelles Humankapital sondern auch das Beziehungskapital darüber entscheidet, ob man eine Stelle bekommt oder nicht. Soziales Kapital kann demnach sowohl Individuen61 (vgl. sehr ausführlich Braun 2008) als auch Organisationen zugerechnet werden (Gabbay und Leenders 1999). Entsprechend interessieren sich Wirtschaftssoziologen auch für die Entstehung von organisationalem Sozialkapital, etwa durch Vertrauen, das durch dessen Beweis in Form von unbefristeten Verträgen entsteht (Fuchs 2006: 86) und handeln es als einen zentralen Faktor von Unternehmenserfolg (Maurer 2003). Folgerichtig interessiert Unternehmen, die eine gewisse Sensibilität für wirtschaftssoziologische Erkenntnisse zeigen, dann auch der Return on Investment in Soziales Kapital (Raub, Rooks und Tazelaar 2007). Zudem finden wir im Diskurs neben Sozialkapital noch weitere Kapitalformen, die sich – durchaus bestreitbar – unter dem Dachkonzept des kulturellen Kapitals (Bourdieu 1976; 1983) stellen liesen: Humankapital (Becker 1983; Sadovski 1991; Coleman 2000), Organisationskapital (Tromer 1987; Sadowski 1991), Wissenskapital (Edvinsson und Malone 1997; Evinsson und Brünig 2000), spirituelles Kapital (Verter 2003); unbestreitbar jedoch gesellt sich so zur social 61 Auch Individuen in Organisationen (Matiaske 1999). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 73 embeddedness noch eine cultural embeddedness oder cognitive embeddedness (Zukin und DiMaggio 1990; DiMaggio 1990; Piore 1993; Uzzi 1996: Tzeng & Uzzi 2000: 6; Dequech 2003; Sofer und Schnell 2005: 72; Davis 2006: 493). Nun lässt sich diese umfassende Kapitalisierung vortrefflich, aber nicht ausschliesslich als Ökonomisierung interpretieren (Moldaschl 2005: 55): „Im Zusammenhang mit Menschen und menschlichen Fähigkeiten von ‚Ressourcen’ und ‚Kapital’ zu sprechen, mag man als ökonomistisch empfinden, d.h. als unangemessene Übertragung ökonomischer Begriffe auf soziale Verhältnisse, oder gar als Reduktion des Menschlichen auf ökonomisch Verwertbares (wie das auch Pierre Bourdieu und anderen vorgeworfen wurde, die mit Begriffen von Human- und Sozialkapital arbeiten). Fördert das nicht ein Denken, das humane, soziale und kulturelle Gegebenheiten nur in ihrer Verfügbarkeit für instrumentelle Ziele zur Kenntnis nimmt? Tragen wir damit nicht zur wachsenden Hegemonie ökonomischer Handlungsbegründungen und betriebswirtschaftlicher Denkfiguren in nahezu allen Feldern des gesellschaftlichen Lebens bei? Die Antwort ist eindeutig: ja und nein. Ja, weil wir diesen Legitimationsmodus aufgreifen und versuchen, damit jene Werte zu verteidigen, die der ökonomische Zugriff üblicherweise als marginal setzt (...). Nein hingegen insofern, als man den Begriff des Kapitals und generell des ökonomischen Kalküls nicht in der zugleich reduktionistischen und imperialistischen (universalreduktionistischen) Weise gebrauchen muß, die man Neoklassikern wie Gary S. Becker (1983) zu Recht vorwirft”. Auf eben die Weise, auf die Manfred Moldaschl hier eine Sicherung gegen einen allzu eilfertigen Kurzschluss zwischen der Idee nichtökonomischer Ressourcen oder Kapitalien und der Unterstellung einschlägiger Ökonomisierungsstrategien einbaut, lässt sich auch mit Blick auf die Idee nicht-ökonomischer Märkte verfahren. Mit anderen Worten: Wer ein generelles Problem mit der Anwendung vordergründig ökonomischer Konzepte wie Ressource, Kapital oder Markt auf nicht-ökonomische Sphären der Gesellschaft hat, hat demnach auch ein Problem mit ebenso weiten wie zentralen Teilen des aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurses, lässt sich doch auch empirisch zeigen, dass Sozialkapital-Diskurs und Wirtschaftssoziologie aufs Engste miteinander verknüpft sind (Haas und Müntzel 2008: 53): 74 Steffen Roth “Im Bereich der Mikro- und Wirtschaftssoziologie gibt es sehr viele Beiträge zur Netzwerkanalyse, insgesamt werden fast über 40 Prozent aller Beiträge innerhalb dieser Forschungsschwerpunkte verfasst; soziales Kapital spielt hierbei neben Kohäsion und Einbettung die Hauptrolle unter den hier so bezeichneten “theoretischen Konzepten” (ebd.) Die Sozialkapitalforschung lässt sich inzwischen also durchaus begründet als eines der etablierten Anliegen der Wirtschaftssoziologie (Enste 2002: 47) beschreiben. Dennoch gilt allerdings: “Im Unterschied zur Frage nach den Effekten ist die Frage nach den Quellen von Sozialkapital vergleichsweise schwach erforscht worden“ (Nollert 2004: 119). Mit Blick auf das Anliegen dieser Arbeit liesse sich ergänzen und erweitern, dass Gleiches auch für die Frage „Wo wird nicht-ökonomisches Kapital investiert?“ gilt.62 So kann es dann kommen, dass auch Michael Florian und Frank Hillebrandt (2006), die sich ausdrücklich von Pierre Bourdieu: Neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft versprechen, zwar geflissentlich zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital unterscheiden, dabei aber nicht die Fragen nach jeweiligen, kapitalspezifischen Märkten stellen. Die in einer solchen Konstellation durchaus naheliegende Idee vom kulturellen oder sozialem Kapital, das wir in Ermangelung anderer Märkte nur auf dem ökonomischen Markt investieren können, führt dann mitunter tatsächlich dazu, dass Sozialkapital eben nicht nur bei Gary Becker und Kollegen als Der ökonomische Wert sozialer Beziehungen63 (Stadelmann-Steffen und Freitag 62 63 Die die Arbeit an dieser Stelle allerdings nur in den Raum gestellt wissen will, müsste sie doch bereits weit vom Kurs abkommen, wenn sie auch nur den Sozialkapitaldiskurs allein angemessen wiedergeben würde. Eine Navigationshilfe angesichts der „plethora of definitions“ von Sozialkapital (Fine 2001: 190) könnte es allerdings darstellen, ausgehend von einer geeigneten differenzierungstheoretischen Basis genauer zu bestimmen, was im Einzelfall das Soziale des sozialen Kapitals ist: Politik, Religion, Sport, Recht, etc? Dabei stellt sich dann wieder die Frage: Wenn die verschiedensten Formen sozialen Kapitals dem ökonomischen gegenüber gestellt werden, meint das dann nicht einmal mehr, dass Wirtschaft nicht Gesellschaft sei? Oder ist auch das ökonomische Kapital eben doch nur eine Form des sozialen? So die Überschrift eines Beitrages mit der Absicht, die “theoretische Einbettung der sozialkapitalinduzierten Wachstumsforschung (sic!) in die einschlägige ökonomische Theorie” (Stadelmann-Steffen und Freitag 2007) zu leisten. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 75 2007) gehandelt wird. Ohne konsistent konzeptionalisierte nichtökonomische Arenen, Investionshorizonte oder Tauschsphären gilt tatsächlich: „The metaphor ‚capital’ has become somewhat confusing as it encourages an economic interpretation“ (Klamer 2004: 151). Polyphone Organisation und monolithischer Markt Wenn der regelmässige Gebrauch der Kapital-Metapher im wirtschaftssoziologischen Diskurs zum einen den allzu einseitigen Verdacht des ökonomischen Imperialismus von der Idee nichtökonomischer Märkte relativiert und zum anderen auf eine mögliche (wirtschafts-) soziologische Forschungslücke verweist, so gilt insbesondere der zweite Aspekt auch für das im folgenden vorgestellte Konzept der polyphonen Organisation. Ein enger Zusammenhang zwischen Organisations- und Wirtschaftssoziologie, die sich mitunter auch als Lehrstuhlbezeichnung in einem Atemzug nennen lassen, ist nicht zu leugnen: „Economic sociology (…) traces its genealogy from Political Economy and Organisational Sociology” (Malcolm 2001: 287, Fn. 22). An anderer Stelle gelten Unternehmen als das Paradethema der Wirtschaftssoziologie (Beckert und Besedovsky 2009) und dabei als Spezialfall von Organisation (Minssen 2008: 248). Wenn wir Richard Swedberg folgen, dem die Organisationssoziologie gar als Mittel64 der Wirtschaftssoziologie 64 An anderer Stelle ist dann ausdrücklich von „Sozialkapital als monetärer Wert sozialer Beziehungen“ (Hontrich 2003: 105) im Sinne einer Definitionssünde die Rede, die selbstverständlich der Ökonomik zugerechnet wird, die sich aber, wie das vorangegangene Beispiel zeigt, auch in Form einer Überschrift eines (ansonsten?) sozialkapitaldefinitionsarmen Beitrages in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie finden lässt. Dabei lässt sich leicht zeigen, dass man den „ ‚ökonomischen Wert’ des Sozialkapitals“ (Modaschl 2009: Tab. 5 und 6) besser in Anführungsstriche setzt, um ihn so nachhaltig vor allzu kurzgeschlossenen Verwertungsabsichten zu schützen. „Vertreter der neuen Wirtschaftsssoziologie begannen, sich dem Phänomen Markt von verschiedenen Seiten zu nähern, insbesondere mittels der Netzwerktheorie, der Organisationssoziologie und der Kulturssoziologie“ (Swedberg 2007: 12). 76 Steffen Roth gilt, können wir festhalten, dass sich die neue Wirtschaftssoziologie bezüglich der Wahl ihrer Mittel weder ausdrücklich (un-)einig noch besonders bewusst ist: In der Regel weisst man seinen Organisationsbegriff schlicht nicht gesondert aus, sondern führt ihn ähnlich selbstverständlich im Wort wie die Ökonomik einst den Marktbegriff. Dahinter ist nicht in jedem Fall fehlende Auseinandersetzung mit dem Organisationsbegriff zu vermuten, die man etwa Pierre Bourdieu jüngst wieder unterstellt hat (vgl. Dobbin 2008; Vaughan 2008; Schwartz 2008). Im Folgenden schult sich die Wirtschaftssoziologie also schlicht in der Wahl ihrer eigenen Mittel, indem sie sich mit einer der jüngsten Entwicklungen der Organisationssoziologie beschäftigt, die sich den im eigenen Diskurs fest verankerten Konzepten nichtökonomischer Kapitalien als Komplementär-Konzept anbietet. Dabei stellt man einander keine gänzlich Unbekannten vor: Gernot Grabher und David Stark (1997: 16; 1998: 63) beschreiben polyphone Wertediskurse als Problem der Organisation von Diversity; Stark (2002: 389) bezieht sich zudem in einem von John Scott herausgebenen Band zu Social Networks ausdrücklich auch auf Harrison Whites (1992) Werk Identity and Control, wenn er vor dem Hintergrund organisationaler Reflexivität Probleme und Chancen der „polyphony of accounts of work, value, and justice that composes modern society“ (Stark 2002: 389) diskutiert. In seiner Arbeit Gossips, Markets, and Gender bezieht Tuulikki Pietilä (2007: 9) das Konzept der Polyphonie auch auf das Handeln von Marktakteuren: „Indeed, many of the casual conversations of female and male traders in bars and marketplaces are part of a larger dialogue beyond the particular face-toface situation. The traders are aware of the talk and opinions around them, and they address that surrounding talk in their conversations and actions. Bakhtin’s polyphony, or multiple voices, thus exists within what appears as a single voice or monologue“. Der Autor, auf den man die kreative Zweckentfremdung der ursprünglich mit Musik verbundenen „Metapher der Polyphonie“ (Mantere, Sillince und Hämäläinen 2007) zurückführt, ist damit bereits genannt: Während Mikhail Bakhtin (1984) den Begriff einst einführte, um der Vielschichtigkeit des Werkes von Fjodr Dostojewski Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 77 gerecht zu werden, wurde das Konzept bald über die Literatur- auf die Sprachwissenschaft (Allemann-Ghionda 2003: 171) in die Politikwissenschaft (Harney 1996: 214; Clegg, Kronberger und Carter 2007) oder die Religionswissenschaft (Sterkens 2001: 86) übertragen und schliesslich zunehmend auch in der Organisationsforschung eingesetzt (Hazen 1993, 1994; Roberts 2006: 47), wo es dann vor allem damit Karriere machte, dass es die Vielfalt der unterschiedlichsten und grösstenteils informell geführten Diskurse, die die (ganze) organisationale Realität ausmachen, ans Licht zu fördern half (Hazen 1993), und sich somit als Komplementär- und Rahmenkonzept des Diversity-Diskurses sowie von Ansätzen narrativer Beratung empfehlen und kritisieren lässt (Westwood und Clegg 2003: 12f; Boje 2008: 201). Geographisch und kulturräumlich gewendet ist Polyphonie dabei nahezu schon ein alter Hut: “Die Multinationale Unternehmung wäre demnach (…) weniger als eine Institution kohärenter Regeln und Werte zu verstehen, sondern als eine ‘Polyphone Organisation” (…), die dezentral unterschiedliche Problemstellungen bearbeiten muss und hierfür auch lokal unterschiedliche Werte, Regeln und Handlungsorientierungen hervorbringt” (Scherer 2003: 351). Auch auf der nationalen Ebene stösst Organisation schon durchaus routiniert auf Diversity, die sich entlang nahezu jeder sozialstrukturellen Variable durchanalysieren lässt: Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Milieu- und Subkultur-Zugehörigkeit (Bate 1997, 2000) spielen beim strategischen Polyphonie-Management nicht nur in gewohnheitsrechtsbasierten Rechtsystemen (Jury-Design) ihre Hauptrollen, sondern auch bei der Teamzusammensetzung in Innovationsabteilungen und Krankenhäusern oder der Quotierung des Zugangs zu politischen Ämtern. Im Fahrwasser des Diversity-Diskurses entwickelte sich das Konzept der organisationalen Polyphonie zunächst vor allem als eine Kritik am Monolog der in Kultur- und Sozialraum Besser-Gestellten. Typischerweise münden die entsprechenden Analysen in Empfehlungen, wonach Hierarchien in dialogische Netzwerke umzugestalten und Stakeholder in Entscheidungsprozesse zu integrieren seien (Gardiner 1992: 27; Barry und Elmes 1997). Organisationale Verhältnisse, 78 Steffen Roth die Diversity unterdrücken und ungleich verteilte Partizipationschancen erzeugen, müssen verändert werden, auch und gerade zum Wohle der Organisation: “Managing the polyphonic organization means listening carefully to the voices of others and mediating between different language games. (…) Speaking managerially, polyphonic organization has many advantages. Arguably, employees will be more empowered, motivated, and committed. The organization can position itself differently and realize a competitive advantage through reputation management by marketing itself as democratic, open, and multicultural. (…) Drawing on a wider range of perspectives and heterogeneous resources can improve decision-making processes (…) Finally, a polyphonic organization is less standardized and hierarchical, which provides the necessary flexibility to cope in a fast-changing environment” (Clegg, Kronberger und Pitsis 2005: 335). Wenn hier auch nicht von Werbung für eine Art Organisationspsychoanalyse gesprochen werden soll, so kann man mitunter doch den Eindruck bekommen, dass die Pioniere der Bewegung, allen voran Mary Ann Hazen (2007: 245), tatsächlich von einer Art organisationalem (Un-) Bewussten ausgehen, das zudem klassischerweise beständig im Verdacht steht, deformiert zu sein; in diesem Sinne ist dann bereits ein besonders ruhiger Patient schnell ein besonders kranker: „(S)ilences and silencing can exact a terrible toll in depression, severed relationships, derailed careers, and missed opportunities for learning and growth. Silences impact not only the individual (...), but also work group relationships and the organization’s effective accompliment of its mission“. Der eigentliche Ansatzpunkt, den die vorliegende Arbeit für Kritik an den bisher präsentierten Konzepten organisationaler Polyphonie wählt, besteht allerdings in dem Umstand, dass sich das Gros der einschlägigen Arbeiten, die sich als Anleitung zur Dekonstruktion allzu mono-logischer Management-Praxis und organisationaler Realität (Kronberger, Clegg und Carter 2006: 15) verstandenen wissen wollen, seinerseits nahezu ausschliesslich an kulturräumlichen oder sozialstrukturellen Kategorien orientiert. Die Wirtschaftssoziologie ist im Grunde ein recht gutes Beispiel dafür, dass diese beiden Brillen selbst übereinander gelegt nicht das vollständige Bild ergeben: Alte Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 79 wie neue Wirtschaftssoziologen fürchten eben nicht die Vertreibung aus bestimmten Erdregionen, Kulturkreisen oder privilegierten Bevölkerungsschichten, sondern – wenn, dann – den wiederholten Verlust der wissenschaftlichen Deutungshoheit über ein funktional differenziertes Teilsystem der Gesellschaft: die Wirtschaft. Oder noch etwas differenzierungstheoretischer formuliert: Wir können mit Luhmann (1997) davon ausgehen, dass sich neben der segmentären Differenzierung der Gesellschaft in ein geographisch oder kulturell gegliedertes Nebeneinander sowie der stratifikatorischern Differenzierung in Über- und Untereinander noch die Form der funktionalen Differenzierung in ein thematisches In- und Auseinander beobachten lässt. Dennoch fällt es offenbar gerade auch im Kontext von Organisation schwer, funktionale Differenzierung anders als gewissermassen mittelalterlich zu denken: Nach wie vor ist monofunktionale Organisation, die ‚firm firm’ also, das Leitbild. Wie der Kaufmann, der Mönch oder der Fürst, dessen Zugang zur Welt sich von seiner (einen) Position im sozialen Raum ableiten lässt, so konstruiert man noch heute Unternehmen allzu schnell als monofone Organisationen: Vertrauen mag zwar der Anfang von allem sein, aber die Kernfunktion einer Bank ist es, Geld zu vermehren. Ebenso wie wir uns eine Bank also als eine Organisation der Wirtschaft vorstellen, ist eine Partei eine Organisation der Politik, das Krankenhaus eine des Gesundheitssystems und der Fussballverein eine des Sports. Nur die Universität ist sich selbst bisweilen nicht ganz schlüssig, ob sie sich als eine Organisation der Wissenschaft oder des Erziehungssystems betrachten soll. Erst in jüngster Zeit gerät diese vertraute Einteilung der organisierten Gesellschaft ins Wanken. Wenn wir Entwicklungen, wie die zum Mode II der Wissenschaften, die Einführung des Methodenarsenals des New Public Management oder das Auftauchen sogenannter Klima-Agenturen65 ins Auge fassen, dann stossen wir dabei auf Kontexte, in denen sich monofunktionale Organisationen nicht mehr sinnvoll bewegen können: Heutzutage wird die Summe eingeworbener Forschungsgelder als Indikator für wissenschaftliche Exzellenz 65 Mit deren Hilfe man vorzugsweise nach dem Interkontinentalflug seine CO2Balance wiederherstellen lassen kann. 80 Steffen Roth gehandelt, es sprechen Politiker und Beamte vom Bürger als Kunden der öffentlichen Verwaltungen und es sieht mittlerweile wieder so aus, als könne man sich ein gutes Gewissen kaufen66. Vor diesem Hintergrund greift auch die 95. These gegen die Ökonomisierung zu kurz, weil sie zu selektiv beschreibt, was bereits bei einem einzigen Autor zu drei höchst unterschiedlichen Zeitdiagnosen führen kann: In Form dreier kurz hintereinander verlegter Monographien gelang es etwa Noam Chomsky, die Dominanz der Medien (1999a), der Wirtschaft (1999b) und der Politik (2000) nahezu gleichzeitig als akutes Kernproblem der Gesellschaft zu beschreiben, und das nicht ohne Grund: Wir sind gerade erst dabei zu „lernen, Polykontexturalität mit all ihren Konsequenzen zu reflektierten“ (Luhmann 1997: 1045). In der Tat vertrauen wir also einigermassen unreflektiert und mit erstaunlicher Routine Organisationen, die Glauben, Wahrheit, Gesundheit, Macht oder Schönheit miteinander oder gerne auch in Geldwerten verrechnen. Der Gedanke, dass das, was wir dabei Organisation nennen, eigentlich viele sind, oder wenn doch nur eine, dann eine, die je nach Entscheidungskontext unterschiedliche Formen (im Sinne von unterschiedlichen Relevanzhierarchien)67 annehmen kann, fällt uns ebenfalls noch nicht ganz leicht; entsprechend ist die Aufgabe dessen, was Veronika Tacke (2001: 166) als „das Konzept der ‚Multireferenz’ von Organisationen“ bezeichnet, einigermassen ambitioniert: 66 67 Bereits an dieser Stelle hilft der Gedanke an historische Vorläufer des Tauschs von Geld gegen Erlösung, um aufzuzeigen, dass wir die eben genannten Entwicklungen nicht vorschnell als Indikator für die Allgegenwart des Homo Oeconomicus werten dürfen: Der mittelalterliche Ablasshandel vollzog sich in einer Zeit der Oberhoheit des religiösen Codes, und damit mehr als Element kirchlicher Symbolpolitik denn als Geschäft. Es lässt sich leicht vorstellen, dass Politik, Religion und Wirtschaft nicht nur in einer Partei, einer Kirche oder einer Firma im internen Ranking der jeweiligen Organisation eine völlig andere Relevanz haben, sondern dass sich Ähnliches auch dann beobachten lässt, wenn wir nur eine dieser Formen in je anderen gesellschaftlichen Kontexten beobachten: Unternehmen in sozialistischen Gesellschaften ranken anders als jene in sog. marktwirtschaftlichen oder in islamischen Gesellschaften. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 81 „Mit diesem Konzept sollte die gängige (z.B. industriesoziologische) Vorstellung einer exklusiven Zuordnung von Organisationen zu einem Funktionssystem der Gesellschaft bestritten und darauf hingewiesen werden, dass Organisationen ihre Entscheidungen an einer Mehrzahl von Funktionssystemen der Gesellschaft ausrichten. (...) Empirisch (geht) es um die Beobachtung, dass Unternehmen mit enormen Summen Forschung betreiben, grosse Rechtsabteilungen, umfangreiche Ausbildungseinrichtungen vorhalten etc. Theoretisch gesehen drohte mit der Formel der Multireferenz aber die Paradoxie, Organisationen ungeklärt zugleich als funktionsspezifisch (als Unternehmen) und als funktionsunspezifisch (als Multireferenten) zu beschreiben.“ Veronika Tacke (2001) löst diesen Widerspruch, den sie in der hier zitierten Arbeit Organisation und gesellschaftliche Differenzierung überhaupt erst minutiös aus der Luhmannschen Systemtheorie herausarbeiten musste, nicht auf, sondern hält im Ausblick fest: „(N)ur im Rekurs auf das Schema funktionaler Differenzierung und seine folgenreiche Aktualisierung nicht nur in den Funktionssystemen der Gesellschaft, sondern auch in Organisation und Interaktionen lässt sich plausibel machen, dass der Primat funktionaler Differenzierung kein bloss theoretischer, sondern ein empirischer Primat ist“ (ebd.: 167f). Entscheidend für unsere Belange ist dabei, dass Tacke in diesem Schlusszitat zeigt, dass Multireferenz mehr als nur den Re-Entry des Schemas der funktionalen Differenzierung in ein funktional differenziertes Teilsystem der Gesellschaft bezeichnen kann, also etwa den Umstand, dass wir von Wirtschaftspolitik und Gesundheitspolitik sprechen können, wobei in beiden Fällen klar ist, dass es politische Relevanzkriterien sind, die bestimmen, was jeweils im Sinne der Politik als Wirtschaft oder als Gesundheit wahrgenommen wird. Vielmehr lernen wir darüber hinaus, dass das Schema der funktionalen Differenzierung in der Organisation zunächst ohne zwangslogisches Funktionsprimat angewendet wird; wir können an dieser Stelle daraus schliessen, dass die Relevanz der einzelnen Funktionssystembezüge in Organisationen prinzipiell immer zur Disposition stehen; d.h. auch, dass die Entscheidung, in letzter Instanz nach wirtschaftlichen und nicht nach politischen Kriterien zu entscheiden, ihrerseits immer 82 Steffen Roth nur eine Entscheidung ist, und in diesem Sinne auch nicht irreversibel68. Ohne dass er Bezug auf Tacke nehmen würde, setzen an dieser Stelle die Arbeiten von Niels Andersen (2000, 2003, 2003b) an. Vor allem in seiner gewissermassen bereits klassischen Arbeit zu den Polyphonic Organizations arbeitet Andersen ebenfalls in der Tradition Luhmanns systematisch den Unterschied zwischen homophonen und polyphonen Organisationen heraus: „A homophonic organization is one that has a primary codification, which regulates the relevance of codifications“ (2003: 164): eine Bank dient vor allem anderen der Geldanlage, ein Gericht spricht in erster Linie Recht, in einer Partei geht es in letzter Instanz um Macht, im Krankenhaus hat die Gesundheit des Patienten Vorrang vor rechtlichen und wirtschaftlichen Erwägungen? Im Gegensatz zu homophonen Organisationen gilt für polyphone: „An organisation is polyphonic when it is connected to several function systems without a predifined“ (ebd.: 167). Im Anschluss an diese Definition führt er eine Reihe von Beispielen an, etwa das dänische Social Services Department, das auf legalem und bezahlbaren Weg Hilfe leisten muss, oder die Danish Cancer Association, die sich je nach aktueller Mission als Agentin des Fortschritts in der wissenschaftlichen Krebsforschung, als politische Pressure Group oder als Anwalt der Kranken geriert. Andersen bezeichnet polyphone Organisationen entsprechend auch als „shifters of communication“ (ebd.: 178). Kombiniert man beide Ansätze, ergibt sich folgendes Bild: Angesichts der Bedeutung von Konzepten der bereits dargestellten nicht-ökonomischen Kapitalien, der Corporate Social Responsibility (Friedman 2002; Hiss 2006; Bluhm 2007), der Corporate Citizenship (Carroll 1998; Matten und Crane 2005), des Stakeholder-Ansatzes 68 Das weltweit vielfach beachtete Phänomen der Konversion landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften zu konventionellen Agrarfirmen im Zuge der Liberalisierung des Weltagrarmarktes ist ein Beispiel für einen radikalen Wandel des organisationsinternen Funktionsprimates (vgl. Roth 2005). In diesem Sinne können Kritiker der Kirche zumindest der Logik nach darauf hoffen, dass sich die Kirche sich eines Tages in eine Organisation der Kunst oder des Gesundheitssystems verwandelt (ohne dass dabei Anlass zur Sorge oder zur Hoffnung bestünde, dass damit die Religion verschwindet). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 83 (Freeman 1984; Donaldson und Preston 1995; Friedman, Andrew und Miles 2002), der Triple-Helix-Verfassung von Innovationssystemen (Etzkowitz und Leydesdorff 2000; Leydesdorf 2005, 2006), der gesellschaftlichen Robustheit von Wissen (Nowotny, Scott und Gibbons 2004) sowie schliesslich der vielfältigsten CrowdsourcingExperimente69 lassen sich monoreferente Organisationen heutzutage kaum noch vorstellen. Statt dessen fällt auf, dass sich Organisationen auf vielfältigste Weise auf ihre Umwelt beziehen, d.h. eben auch, dass sich ehedem sogenannte wirtschaftliche Organisationen (wie etwa eine Bank) nicht nur auf den Markt als wirtschaftliche Umwelt beziehen, sondern immer bewusster auch auf politische Bewegungen und Institutionen, wissenschaftliche Forschungsergebnisse, rechtliche Rahmenbedingungen, religiöse Befindlichkeiten oder ästhetische Trends. Gleichzeitig stellen monoreferente Unternehmen auch in der Wirtschaftssoziologie eine konstante Denkfigur dar, und das nicht nur als Akteure auf White’schen Produktionsmärkten, die sich in letzter Instanz nur auf die Preissignale ihrer Konkurrenten beziehen. Der von Tacke herausgearbeitete Widerspruch zwischen der Gewohnheit, Unternehmensorganisationen eindeutig dem Wirtschaftssystem zuzuordnen, und der von ihr beschriebenen Multireferenz auch des Unternehmens lässt sich mit Hilfe des Andersen’schen Konzepts der polyphonen Organisation auflösen oder, genauer gesagt, verlagern: Andersen zufolge sind Organisationen immer multireferent; homophone Organisationen zeichnen sich allerdings durch eine feste Primärkodierung aus, d.h. sie beziehen sich auf ihre Umwelt durch den Filter der Erfordernisse eines Funktionssystems. Eine wirtschaftliche Organisation würde sich demnach sehr wohl immer auch auf nicht-ökonomische Aspekte ihrer Umwelt beziehen, diese aber gewissermassen immer ökonomisch recodieren. Polyphone Organisationen sind demgegenüber in der Lage, ihre Umwelt durch die 69 Also die immer frühere und immer umfassendere Integration von Kunden, Stakeholdern und Laien in den Innovationsprozess von Unternehmen (Chesbroug 2003, 2007; West und Gallagher 2006), die wahlweise als In-Sourcing von Ideen und Know-How oder als Out-Sourcing von immer weiterer Teile des Innovationsmanagements interpretiert werden kann (Gassmann und Enkel 2004). 84 Steffen Roth Brille unterschiedlichster Funktionslogiken zu filtern. In diesem Sinne stellt das Konzept der homo-/polyphonen Organisation also zwei unterschiedliche Strategien des Umgangs mit dem Problem der Multireferenz dar. Folgen wir vor diesem Hintergrund zudem noch einer Idee von Rémi Barré (2001), lässt sich auch das von Veronika Tacke formulierte Problem der Gleichzeitigkeit von funktionaler Zurechenbarkeit (oder zumindest dem Bedürfnis danach) und Multireferenz eingrenzen: Barré beschreibt die Dynamiken der Wissensproduktion in den Innovationssystemen des Mode II entlang eines schlichten ZweiPhasen-Modells, mit dessen Hilfe er vor dem Hintergrund des Triple-Helix-Diskurses zwischen einer offenen ‚Agora’-Phase, in der die beteiligten Akteure „can ‚plug’ in their own visions, strategies and hypotheses in a wide and socially diverse perspective“ (ebd.: 16), und einer geschlossenen Entscheidungsphase unterscheidet, in der die einzelnen Elemente einer Triple-Helix in Übereinstimmung mit ‚ihren’ eigenen Funktionserfordernissen entscheiden. Mit Blick auf Tackes Ansatz kann man sich so also vorstellen, dass etwa eben im Triple-Helix-Kontext wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche Organisationen sich in Bezug auf Diskussion, Brainstorming, Ideen-Sourcing und Strategie-Entwicklung multireferent, in Bezug auf die Letztentscheidung allerdings monoreferent verhalten. Mit Blick auf Andersons Konzept stellen wir zudem fest, dass sich auch dieses Entscheidungsverhalten in Bezug auf seine funktionale Offenheit unterscheiden lässt; Organisationen können demnach mal nach dem einen und mal nach dem anderen Code entscheiden. Nach wie vor liessen sich Organisationen damit bestimmten Funktionssystemen zuordnen, also jenen, die für sie am relevantesten sind bzw. für die sie sich am häufigsten entscheiden70. Wie bereits weiter oben angemerkt kann die Relevanz der einzelnen Funktionssysteme für eine spezifische Organisation Veränderungen unterliegen, können im Laufe der Zeit also z.B. aus politischen Organisationen wirtschaftliche werden (vgl. Roth 2005). 70 Vgl. mit Blick vornehmlich, aber nicht ausschliesslich auf die funktionalen Entscheidungskontexte von Personen (Roth 2009). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 85 Die Konzepte der Multireferenz und der Polyphonie lassen sich demnach dynamisch denken: Ein- und dieselbe Organisation lässt sich demnach je nach Beobachtungszeitpunkt und –interesse als mono- oder multireferent, sowie als homo- oder polyphon vorstellen. Dem kann auch Jens Beckert 2007b: 19) zustimmen: „(S)ocial change is conceptionlized as a dynamic process of oscillation between embedding, disembedding and reembedding“. Zudem weist Barrés (2001) Konzept im Hinblick auf das Anliegen dieser Arbeit noch einen weiteren interessanten Aspekt auf: Die Phase des transfunktionssystemischen Diskurses und der Konkurrenz der einzelnen Funktionssysteme bezeichnet er mit dem Begriff Agora71, also dem altgriechischen Wort für den Markt, der damals noch ein Platz war. Es liegt nahe anzunehmen, dass polyphone Organisationen auf diesem gesamtgesellschaftlichen Markt gewisse Vorteile gegenüber monophonen Organisationen haben. In jedem Fall stellt sich so vor dem Hintergrund von organisationaler Multireferenz und Polyphonie auch die Frage, ob es angemessen ist, sich den Markt, auf den sich polyphone Organisationen beziehen, als monofunktionale Veranstaltung vorzustellen. Zusammenfassung: Nicht-ökonomische Märkte als Forschungslücke? In diesem Kapitel wurde die Vermutung geäussert und erhärtet, dass die Herausforderung seitens des ökonomischen Imperialismus weniger in der Expansion des ökonomischen Marktmodells auf nichtökonomische Bereiche der Gesellschaft begründet liegt, als vielmehr bereits in der Tatsache, dass der Marktbegriff mittlerweile so stark ökonomisch konnotiert ist, dass man sich nicht-ökonomische Märkte nur schwer vorstellen kann. 71 Ähnlich auch bezeichnen auch Nowotny, Scott und Gibbons (2004) die Agora als den Platz, auf dem gesamtgesellschaftliche Probleme definiert und Problemlösungen transfunktionssystemisch derart verhandelt werden (können), dass gesellschaftlich robustes Wissen entsteht. 86 Steffen Roth Vor diesem Hintergrund argumentiert die vorliegende Arbeit, dass der Kurzschluss vom Markt auf die Ökonomie hinderlich ist, wenn man Märkte tatsächlich als soziale Strukturen, Institutionen oder Systeme betrachten will. Dass das Anliegen, einen ehedem rein ökonomisch besetzten Begriff auf weitere Bereiche der Gesellschaft anzuwenden, nicht zwangsläufig auf Reduktionismus hinauslaufen muss, konnte mit dem Verweis auf den nicht-reduktionistischen Diskurs um nicht-ökonomische Kapitalien, sowie durch den Umstand gezeigt werden, dass führende Wirtschaftssoziologen sich vor allem über den Sozialkapital-Begriff profilieren, ohne dass die Verwendung der ökonomischen ‚Metapher’ des Kapitals ausserhalb des Kontextes der Ökonomie deshalb ähnlich problematisiert oder gar tabuisiert würde, wie die Idee nicht-ökonomischer Märkte. Zudem besteht eine Wahlverwandtschaft zwischen der Idee nicht-ökonomischer Kapitalien einerseits und der organisationalen Multi-Referenz oder Polyphonie andererseits (vgl. im Folgenden Abb. 1): Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 87 Auch aus der Perspektive des Unternehmens lässt sich MultiReferenz dann als Teil einer Strategie interpretieren, die bewusst auch nicht-ökonomische Kapitalien in Betracht zieht, die seitens des Unternehmens im Hinblick auf das Organisationsziel akquiriert und investiert werden können; je nach Interesse und Umweltsituation liesse sich Unternehmen demnach raten, sich entweder auf Erwerb und Investition genau der Kapitalform zu konzentrieren, die direkt mit der eigenen Funktionserfordernisse korrespondiert, oder aber die Verfügung über ein möglichst breites Spektrum an Kapitalformen anzustreben. Egal ob wir uns Kapital als akkumulierte Arbeit72 (Bourdieu 1986: 241) oder als Kalkulationshorizont (Baecker 2001: 315, 321) vorstellen, gilt, dass sich der Kapitalbegriff nicht ohne einen korrespondierenden Marktbegriff erschliesst: Im ersten Fall gelten ökonomische wie nicht-ökonomische Kapitalien als Realwerte, die beständig relativiert werden: Das Kapital ergibt sich nicht nur aus der akkumulierten Arbeit eines bestimmten Individuums, sondern ebenso aus der akkumulierten Arbeit aller Individuen eines Marktes.73 Im zweiten Fall gelten Kapitalien ebenfalls im Plural als Potenziale, die um ihre Realisierungen konkurrieren (ebd.: 313): „Jede einzelne Kapitalinvestition misst sich an möglichen anderen Investitionen und kalkuliert die jeweiligen Aussichten auf Vermögenserhalt oder Gewinn unter den Gesichtspunkten sachlicher Alternativen, sozialer Beziehungen und zeitlicher Horizonte. Das Kapital ist inhärent und notwendig unruhig, da es nicht nur die Aussichten der jeweils gewählten Investition, sondern auch ständige Verschiebungen im Raum der Alternativen registriert“. 72 73 “(C)apital is accumulated labour (in its materialized form or its ‘incorporated’, embodied form)” (Bourdieu 1986: 241) Der Begriff Markt umfasst bei Bourdieu analog zu den Kapitalformen ökonomische wie nicht-ökonomische Märkte (Bourdieu 1983), z.B. Märkte für Bildungstitel, einer spezifischen Form von kulturellem Kapital also (vgl. Bourdieu, Boltanski und de Saint-Martin 1981). Darüber hinaus denkt Bourdieu auch noch an eine Art Metamarkt, das soziale Feld, das etwa Regionenoder Milieu-spezifisch ausgeprägt sein kann und definiert, welchen relativen Wert die einzelnen Kapitalformen zueinander annehmen können (vgl. Bourdieu 1987: 194, vgl. zu dieser Lesart auch ausführlich Roth 2008). 88 Steffen Roth Auch hier ist ausdrücklich die Rede von der „Möglichkeit kultureller und symbolischer Märkte“ (ebd.: 318), die im Folgenden ernst genommen wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich demnach nicht nur die Frage, wie oder wo kulturelles oder soziales Kapital als die prominentesten Formen nicht-ökonomischer Kapitalien anders akquiriert und investiert werden können, als auf nicht-ökonomischen Märkten? Sondern auch: Wenn multireferente, polyphone Organisationen den potenziellen Outcome von Handlungsalternativen kalkulieren, tun sie das tatsächlich nur vor dem Hintergrund ökonomischer Nutzenmaximierung? Streben nicht auch nicht-ökonomische Organisationen das Optimum an? Oder anders formuliert: Unterscheidet sich eine Kalkulation, die auf die Maximierung des Anteils an Wählerstimmen abzielt so fundamental von einer Kalkulation, die auf die Erhöhung eines (ökonomischen) Marktanteils abzielt, dass sich nicht auch seitens der Organisationstheorie zumindest die berechtigte Frage nach der Existenz von nicht-ökonomischen Märkten stellen lässt? Verweist schliesslich die Idee polyphoner Organisationen nicht letztlich sogar auch auf die Idee polyphoner Märkte, in denen ökonomische und nicht-ökonomische Marktsegmente gleichermassen eine Rolle spielen? In diesem Sinne konnte die vorliegende Arbeit die Auseinandersetzung mit der Idee von den nicht-ökonomischen Märkten entlang der vorgetragenen Ausführungen zu Kapital- und Organisationstheorie als doppelt eingebettete Forschungslücke in die Wirtschaftssoziologie einführen, in deren Kontext sie im Folgenden geschlossen werden soll. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 89 Kapitel V Ganze Märkte! Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie Folgen wir einer Grundidee des ökonomischen Performismus, dann hätte diese Arbeit nicht mehr viel zu beweisen: Es konnte gezeigt werden, dass Ökonomen wie Gary Becker nicht-ökonomische Märkte ebenso machen wie Märkte für Finanzderivate oder Erdbeeren; dabei werden sie von Wirtschaftssoziologen unterstützt, die die Existenz nichtökonomischer Märkte anerkennen, indem sie die Performance der entsprechenden Ökonomen beobachten und dabei überwiegend kritisieren, und so zur Verbreitung der Idee beitragen74. In diesem Sinne lässt sich also problemlos von der Existenz von Märkten ausserhalb des klassischen Gegenstandsbereichs der Ökonomik sprechen. Andererseits liesse sich einwenden oder zumindest fragen, ob es sich bei diesen Märkten dann eben gerade nicht um nicht-ökonomische Märkte handelt, da sie schliesslich von Ökonomen performt wurden.75 Die Idee der nicht-ökonomischen Märkte wäre demnach nach wie vor eine Idee von ausserhalb der Wirtschaftssoziologie, gegen deren Verankerung innerhalb des eigenen Diskurses sich die Disziplin nach wie vor allzu einfach mit dem Hinweis auf die Gefahren 74 75 Statt dem ökonomischen Imperialismus im Sinne einer bewusst angelegten counterperformance (vgl. Fn. 43) zu begegnen. Wir erinnern hier an Michel Callon (2007: 332f), demnach jeder, also auch jeder Wirtschaftssoziologie, der einen Markt modelliert, automatisch ein Ökonom ist; und an die Frage, ob ein Ökonom eher der Wirtschaft oder der Wissenschaft zugerechnet werden muss; in diesem Sinne liese sich dann auch fragen, ob es sich beim vom Ökonomen performten Markt um ein wirtschaftliches oder ein wissenschaftliches Phänomen handelt? 90 Steffen Roth des ökonomischen Imperialismus sperren könnte: Ausufernder Import führt zu kolonialer Abhängigkeit. Vor diesem Hintergrund behauptet die vorliegende Arbeit bewusst, dass die Idee nicht-ökonomischer Märkte bereits im wirtschaftssoziologischen Diskurs selber angelegt ist und quasi bildhauerisch aus ihm herausgearbeitet werden kann. Das soll im Folgenden auf drei Arten gezeigt werden: Erstens werden wir in diesem Kapitel Autoren zu Wort kommen lassen, die im aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurs nicht glänzen, sondern schillern, und in genau diesem Sinne die eigentlich spannenden Erscheinungen sind: Die Rede ist von James Coleman, Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann flankiert von Dirk Baecker, die allesamt von Wirtschaftssoziologen zitiert und als Wirtschaftssoziologen bezeichnet werden, deren Marktverständnis sich von dem des wirtschaftssoziologischen Mainstreams aber stark unterscheidet, nicht zuletzt etwa dadurch, dass mitunter explizit von der Existenz nicht-ökonomischer Märkte ausgegangen wird. Wenn gezeigt werden kann, dass diese Autoren, die im Hinblick auf Konzepte wie Tausch, Sozialkapital, Habitus, Feld, Unsicherheit, Vertrauen oder Organisation von Wirtschaftssoziologen intensiv und wohlgemerkt als Wirtschaftssoziologen zitiert werden, dann stellt das zum einen die Frage, warum ausgerechnet jene Beiträge, die diese Autoren zum Verständnis des Marktes als einem – oder gar dem – zentralen Begriff der Wirtschaftssoziologie leisten, nicht wahrgenommen werden. Zum anderen, und das ist der im Hinblick auf die Beweisführung eigentlich interessante Umstand, kann so gezeigt werden, dass es innerhalb des wirtschaftssoziologischen Diskurses Stimmen gibt, die für ein Modell nichtökonomischer Märkte und damit – nicht in realitas aber doch der Logik nach – für eine Marktsoziologie jenseits der Wirtschaftssoziologie optieren. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 91 Zweitens kontrastieren wir die Marktbegriffe der genannten Autoren mit denen des wirtschaftssoziologischen Mainstreams, und diskutierten sie im Hinblick auf beider Plausibilität. Als Plausibilisierungs- und Visualisierungshilfe soll dabei auf die Formelsprache der Mengenlehre zurückgegriffen werden. Wenn gezeigt werden kann, dass einzelne oder eine Vielzahl der Elemente und Teilmengen der jeweiligen Marktdefinitionen nicht-ökonomischer Natur sind, dann stellt sich die Frage, wie(so) man den Markt noch als rein ökonomische Kategorie denken soll. Auch in diesem Sinne gälte dann, dass der Markt kein exklusiv wirtschaftliches Phänomen, und die Marktsoziologie demnach mehr als ein Teilgebiet der Wirtschaftssoziologie ist. Wenn dabei zudem gezeigt werden kann, dass mit Hilfe eines transökonomischen Marktkonzeptes Widersprüchlichkeiten innerhalb der und zwischen den einzelnen Beiträgen zum wirtschaftssoziologischen Diskurs aufgehoben oder geglättet werden können, dann spricht das darüber hinaus für die Nützlichkeit der Idee nichtökonomischer Märkte. Drittens zeigen wir mit zweifellos nicht erschöpfendem Blick auf die empirischen Referenzen einschlägiger Wirtschaftssoziologen, dass sich Hinweise auf nicht-ökonomische Märkte einigermassen leicht nicht nur mit Blick auf den theoretischen Diskurs, sondern auch im Hinblick auf die jeweiligen empirischen Felder beobachten lassen; auch hierbei verfolgen wir nur Spuren, die von Wirtschaftssoziologen selbst gelegt wurden. Vor diesem Hintergrund lautet die These der Arbeit, dass die Marktsoziologie kein Teilgebiet der Wirtschaftssoziologie ist. Diese These wird dabei mit Rücksicht auf den Diskurs um ökonomischen Reduktionismus oder Imperialismus verschärft formuliert: Ziel der Arbeit ist es, die These mit den Mitteln des aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurses zu bestätigen und erst bei der Formulierung eines 92 Steffen Roth eigenen trans-ökonomischen Marktkonzeptes von diesem Anspruch abzuweichen. Die These wäre somit dann bestätigt, wenn sich im Rahmen der nächsten Abschnitte zeigen lässt, dass von den wirtschaftssoziologischen Gegnern der Idee nicht-ökonomischer Märkte als Wirtschaftssoziologen bezeichnete Autoren bereits seit einiger Zeit bewusst von nichtökonomischen Märkten sprechen, dass die Idee nicht-ökonomischer Märkte im wirtschaftssoziologischen Diskurs nicht nur auf logische Weise anschlussfähig ist, sondern auch dazu beitragen kann, theoretische Inkonsistenzen im Diskurs zu glätten, und schliesslich, dass Wirtschaftssoziologen, darunter auch jene, die den Gedanken an nicht-ökonomische Märkte ablehnen, bereits Spuren von nicht-ökonomischen Märkten entdeckt und verfolgt haben. Aus der begründeten Annahme der Möglichkeit oder der Existenz nicht-ökonomischer Märkte folgt dann, dass die Wirtschaftssoziologie weder exklusiv, noch primär für die Beschreibung von Märkten zuständig ist, sondern schlicht als eine Teilsoziologie unter vielen. In diesem Sinne gilt schliesslich: Die Marktsoziologie ist keine Teildisziplin der Wirtschaftssoziologie, sondern allenfalls eine eigenständige Teildisziplin, die Erkenntnisse der Wirtschaftssoziologie wie der einer Reihe anderer Teildisziplinen mit einem ganz eigenen Erkenntnisinteresse aufgreift. Stiefkinder der Wirtschaftssoziologie Die These, dass die Marktsoziologie keine Wirtschaftssoziologie ist, lässt sich in einem ersten Schritt bereits dadurch untermauern, dass wir uns auf Autoren stützen, mit deren Hilfe sich die Möglichkeit der Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 93 Existenz nicht-ökonomischer Märkte plausibilisieren lässt, oder die von dieser Möglichkeit gar explizit ausgehen. Da die Idee der nichtökonomischen Märkte nicht importiert werden soll (KolonialismusVerdacht), legen wir den Focus auf eine kleine Reihe von Autoren, die von Vertretern der aktuellen Wirtschaftssoziologie ihrerseits als Wirtschaftssoziologen bezeichnet werden. Den Anfang hierbei macht James Coleman. Was seine Einordnung als Wirtschaftssoziologe angeht ist James Coleman zunächst kein ganz eindeutiger Fall: Jens Beckert und Milan Zafirovski (2006) nehmen ihn zwar in ihre International Encyclopedia of Economic Sociology auf, dort wird er allerdings ‚nur’ als „highly influential sociologist of the late twentieth century“ (Mardsen 2006: 69) erwähnt; man konzentriert sich daher auf „elements of Coleman’s sholarship most relevant for economic sociology“. Auch Smelser und Swedberg (2005: 17) halten in der zweiten Auflage ihres Handbook of Economic Sociology fest: „(H)e initially paid little attention to economic sociology (see, however, Coleman 1994)“. Bei der Referenz auf Colemans Arbeit von 1994 handelt es sich dann – however – um dessen Beitrag in der ersten Auflage des gerade genannten Handbuchs; der Titel: A Rational Choice Perspective on Economic Sociology. Und obwohl Swedberg (1996) ein Jahr nach Colemans Tod ausführlich dessen Beitrag zum soziologischen Verständnis der Wirtschaft gewürdigt hat, lesen wir bei Smelser und Swedberg (2005: 17) erneut grosse Nüchternheit: „Foundations, as well as other works by Coleman, contains a number of analysis of much relevance to economic sociology. Three subjects of particular importance are trust, social capital, and the modern corporation“. Interessant ist, dass hier bereits zum zweiten Mal bewusst darauf geachtet wird, zwischen einem Wirtschaftssoziologen und einem für die Wirtschaftssoziologie relevanten Autor zu unterscheiden.76 Auch die Tatsache, dass Coleman (1995: 153) in den hier angesprochenen Grundlagen der Sozialtheorie ebenfalls recht ausführlich auf soziale Tauschsysteme eingeht, die er auch als „soziale Märkte“ bezeichnet und von wirtschaftlichen unterschei76 In diesem Sinne lesen wir bereits zum zweiten Mal in einem einschlägigen Standardwerk von Coleman als wertvollem Hilfswissenschaftler der Wirtschaftssoziologie. 94 Steffen Roth det, bleibt unerwähnt. An anderer Stelle sind gerade die hier ausgeklammerten Ausführungen zum Tausch das Einfallstor für wirtschaftssoziologische Kritik am Theorieprogramm Colmans: „Der Tausch wird, wie die Interpretation des Gabentausches durch James Coleman (...) deutlich zeigt, zu leicht als rationale Handlung zwischen rationalen Akteuren verallgemeinert“ (Hillebrandt 2007: 283). In diesem Sinne gilt Colemann dann auch als Vertreter einer „Kolonialisierung (...) durch eine (...) aggressive Rational-Choice-Theorie und realitätsfremder homini oeconomici“ (Schmid 2008: 96), die sich auf Grundlage falscher Grundannahmen bezüglich der Vernunftbegabung, der Informationslage und des Ich-Bezugs der beteiligten Marktakteure vollzieht, Nebenfolgen absichtsvollen Handelns nicht fassen kann, und deren Sozialmathematik den grössten Teil der sozialen Grundlagen der in jeder Hinsicht begrenzten ökonomischen Rationalität unterschlägt. Zudem ist inzwischen auch in der Wirtschaftssoziologie entdeckt worden, dass „so far unmarked, (Gary) Becker has had a close working relationship with his sociologist colleague at the University of Chigago, James Coleman“ (Fine 2001: 51). Dieser Umstand wird dann auch als Auftakt einer Vernunftehe zwischen Ökonomik und Soziologie interpretiert, deren Ziel „to form a new economic sociology, with social capital officiating at the ceremony“. In diesem Sinne gilt dann rasch Sippenhaft, die auch vor weiteren Sozialkapitaltheoretikern, darunter auch Gründungsväter der neuen Wirtschaftssoziologie, nicht halt macht, wenn etwa mit Blick auf „the ideas of human, social and (even) cultural capital that economc sociology relied upon and which allowed Granovetter, Coleman and others to deal so coldly with friendship and community“ (Fevre 2003: 246) gefordert wird, dass Freundschaft und Nachbarschaftlichkeit wieder mehr als Zwecke denn als Mittel zum Zweck zu (be)handeln und dabei auch die Problematik der möglichen Vernutzung der genannten Kapitalarten (vgl. Moldaschl 2005, 2005b) zu berücksichtigen (Fevre 2003: 246). Auf der anderen Seite wird Coleman aber nicht nur dann neben die Gründungsväter der neuen Wirtschaftssoziologie gestellt, wenn es um Kritik geht: Richard Swedberg (2000: 165) und Andrea Maurer (2008: 67) nennen ihn in einem Atemzug mit Harrison White und Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 95 Arthur Stinchcombe oder Mark Granovetter, sodass wir nicht ohne Grund auch Formulierungen antreffen wie „the new economic sociology as represented by James Coleman and Mark Granovetter“ (Wang 2005: xiii); das mag unbedarft wirken, doch unabhängig davon, ob ihm der Ehrentitel eines Wirtschaftssoziologen nun endgültig zuteil wird oder ob man ihn dem Lager der Gegner zurechnet77, wird Coleman auch in der neueren und neuesten Wirtschaftssoziologie ausführlich rezipiert, sei es als Referenz zum Thema Sozialkapital (Aspers und Beckert 2008: 236)78, sei es bei Viviane Zelizer (1997: 5) als empirische Steilvorlage für die Analyse der sozialen Bedeutung des Geldes für die Diskussion des Wertes eines Kindes (1994: 256) oder sogar – wenn auch nur en passant - in Arbeiten zum Themenkomplex Individuen, Institutionen und Märkte (Mantzavinos 2007: 169). Tatsächlich lesen wir bei Coleman (1995: 153) weniger über Märkte als über Austauschsysteme; beide Begriffe setzt er dabei quasi synonym: „Sozialer Austausch erfolgt oftmals nicht in isolierten Transaktionen zwischen zwei Personen, sondern im Kontext von Austauschsystemen, in denen ein Wettbewerb um knappe Ressourcen stattfindet. Diese sozialen Märkte ähneln manchmal Wirtschaftsmärkten, obwohl sie häufig auch grosse Unterschiede aufweisen“. In Sachen soziale Märkte verweist Coleman (1979: 57) auf Schulen oder Heiratsmärkte: „Man kann eindeutig davon ausgehen, dass Heiraten innerhalb einer Art von Markt stattfinden“ (Coleman 1995: 23). 77 78 Eine Frage, die man nach Richard Swedberg (1990: 17f) auch offen lassen kann: „From a sociological perspective, there might be sharp differences between the ‚new economic sociology’ and ‚rational choice sociology’. In reality, however, the lines are not all that clear and the two are interrelated in intersting und unpredictable ways. This is also true for economic imperialism and its interaction with traditional social sciences. From one viewpoint, economic imperialism is cleary an expression of economics turning inward and isolating itself. But from another point of view, it represents the beginning of a dialogue between economics and the other social sciences“. Nicht aber zum Thema Märkte, obgleich das der Titel der hier zitierten Arbeit von Aspers und Beckert ist. 96 Steffen Roth Zunächst mit Blick auf ökonomische Tauschsysteme präsentiert Coleman (1995: 156f) eine Systematik von Entwicklungsstufen des Tauschhandels; dabei unterscheidet er zwischen Dem unmittelbaren Naturaltausch von Gütern und Dienstleistungen zwischen zwei Tauschpartnern, Dem Tausch zwischen zwei Partnern, bei denen Güter oder Leistungen gegen ein Zahlungsversprechen getauscht werden, das in der Regel durch ein Pfand oder eine Form des Warengeldes repräsentiert wird, Dem Tausch zwischen mehr als zwei Partnern, bei dem das Zahlungsversprechen des einen Partners vom zweiten als Wechsel an einen Dritten übertragen wird, Einem durch eine Zentralbank rückversicherten Papiergeldsystem, in dem auch Wechsel gegen Wechsel getauscht werden können, Einem bargeldlosen System mit einer oder mehreren zentralen Verrechnungsstelle(n), z.B. Kreditkartenunternehmen, an die oder von der Guthaben gezahlt werden. In all diesen Fällen fungiert ökonomisches Geld bei Coleman als „the ultimate impersonal common denominator“, ein Umstand den man ihm mit Swedberg (1993: 196) zum Vorwurf machen kann, wenn man davon absieht, dass es Coleman eben nicht um die Erkundung der prominent von Vivane Zelizer (1997) in Szene gesetzten Social Meaning of Money geht, sondern um die Frage, „ob es in sozialen und politischen Systemen irgend etwas gibt, das bei Transaktionen eine Rolle spielt und, so wie Geld, keinen eigenständigen Wert in sich Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 97 trägt“ (Coleman 1995: 159)79, also einem funktionalen Äquivalent des Geldes in nicht-ökonomischen Bereichen der Gesellschaft. „Es erweist sich schnell, dass es so etwas gibt, denn Versprechen spielen, ganz abgesehen von ihrer Rolle im ökonomischen Austausch, auch in sozialen und politischen Systemen eine bedeutende Rolle“. Coleman verweist in diesem Zusammenhang etwa auf Koalitionsverhandlungen, in deren Rahmen Parteien ein Versprechen gegen ein anderes handeln, oder auf zeitgenössische Ringtausch-Systeme, die ohne ökonomisches Geld auskommen. Gleichzeitig räumt er aber ein, dass die Übertragbarkeit von nicht-ökonomischen Versprechen, und damit eine Kultur nicht-ökonomischer Halbtransaktionen, klare Grenzen hat, die in der Regel mit den Grenzen kleinster gesellschaftlicher Einheiten wie Familien, Freundesnetzwerken oder lokalen Gemeinschaften korrespondieren. Daneben sieht Coleman (1995: 162) eine „weitere Möglichkeit, den Austausch in sozialen und politische Systemen zu erleichtern(:) wenn ein Naturalientausch zwischen zwei Parteien nicht möglich ist, bietet sich der Intermediär oder Mittelsmann“ an, der durchaus auch als korporativer Akteur gedacht werden kann (Coleman 1979; vgl. auch Vanberg 1982: 169f). Coleman (1995: 163) denkt hierbei vor allem an den US-Amerikanischen Parteienapparat der Jahrhundertwende als eine transpersonale Form des Intermediärs, dem er – gewissermassen in Vorwegnahme des Konzeptes der polyphonen Organisation (Andersen 2000, 2003) – die Fähigkeit zuschreibt, unterschiedlichste, d.h. sowohl wirtschaftliche als auch politische Interessen und Investitionen zusammenzubringen und auszugleichen. „Wie James S. Coleman in seinen organisationssoziologischen Analysen hervorhebt, ist (darüber hinaus) jede Übertragung von Macht, Rechten oder anderen Ressourcen an eine Organisation mit einem fundamentalen Dilemma verbunden“ (Baumann 2000: 218); wir interessieren uns an dieser Stelle weniger für das Dilemma, das aus der Übertragbarkeit der verschiedensten Ressourcen resultiert, als vielmehr für die Übertragbarkeit selber: Wenn nicht nur Geld, sondern auch Macht übertragbar ist, lassen sich auch für politische Kontexte „höhere“ Entwicklungsstufen des Tauschhandels vor79 In beiden Fällen lesen wir nach wie vor Spuren des Economy&SocietyParadigmas: Sozial meint nicht-ökonomisch, ökonomisch meint nicht-sozial. 98 Steffen Roth stellen; die die Schule nicht nur als eine Arena des Konkurrenzkampfes um Zensuren (Coleman 1995: 169), sondern auch als einen Markt für Reputation und sozialen Status interpretieren. Im Kontext eines Schulwechsels lässt sich dann leicht vorstellen, dass auch dieses soziale Kapital80 seine Währungsräume hat, die (sozial-räumlich) begrenzt und mit denen des ökonomischen und des Humankapitals nicht deckungsgleich sind. Wir verdanken Coleman also nicht nur Beispiele für ausdrücklich nicht-ökonomische Märkte samt der Idee markt-spezifischer Währungen, sondern die Idee eines korporativen Akteurs, einer Institution oder einer Organisation, die in der Lage ist, zwischen den einzelnen ökonomischen und nicht-ökonomischen Tauschssphären, Märkten81 also, zu vermitteln. Die Organisationstheorie gilt gemeinhin als offene Flanke im Werk Pierre Bourdieu (vgl. Dobbin 2008; Schwartz 2008; Vaughan 2008). Dessen ungeachtet ist Pierre Bourdieu sicher der auch und gerade von Wirtschaftssoziologen meist, und dabei zumeist positiv, rezipierte Vertreter der Idee nicht-ökonomischer Märkte: „Die Arbeiten Bourdieus sind für viele der wirtschaftssoziologischen Ansätze 80 81 „(U)nlike other forms of capital, social capital inheres in the structure of relations between persons and among persons“ (Coleman 1990: 302). Soziales Kapital gilt ihm damit und im Anschluss an Loury (1987) als unveräusserlich, da soziales Kapital ein überindividuelles Strukturmerkmal und es folglich keiner der in die Struktur eingebetteten Akteure es als Privateigentum betrachten kann. Entsprechend betrachtet Coleman (1995: 409) es auch als öffentliches Gut. Gleichzeitig lesen wir aber, dass sich soziales Kapital doch bestimmten Akteuren zuordnen lässt: „Nehmen wir an, dass ein namhafter Historiker und ein namhafter Physiker im selben Restaurant zu Gast sind und jeder von beiden sich in der Aufmerksamkeit mehrerer Bewunderer an seinem Tisch sonnt. Wenn diese beiden, die jeweils einen hohen Status besitzen, die Plätze tauschten, würden die anderen Personen an beiden Tischen ihnen jeweils wenig Ehrerbietung erweisen und jegliche Ehrerbietung, die der Physiker von den Bewunderern des Historikers erhielte, würde ihm wenig bedeuten – und umgekehrt“ (ebd. 167f). Auch in Klaus Heinemanns (1976: 62) Aufsatz Elemente einer Soziologie des Marktes finden wir die Idee von nicht-ökonomischen Märkten bereits skizziert: „Einzelne, zweckspezifisch organisierte und rollenmässig ausdifferenzierte Daseinsbereiche wie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft entwickeln eigene Marktsysteme mit einer Abgrenzung tauschbarer Leistungen“. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 99 in Frankreich ein präsenter Bezug“ (Diaz-Bone 2007: 490). Marion Fourcade (2007: 1015), Daniel Schluchter (2007: 92) sowie Jens Beckert, Rainer Diaz-Bone und Heiner Ganssmann (2007: 34) rechnen ihn zum Kanon der Wirtschaftssoziologie. Auch Michael Florian und Frank Hillebrandt (2006b) versprechen sich von Pierre Bourdieu: Neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft und widmen ihm einen gleichnamigen Sammelband; im Band erklärt dann Bettina Fley (2006: 180), dass Märkte „politische Arenen“ seien, ohne allerdings den Umkehrschluss zu wagen, dass politische Arenen mit Bourdieu auch als (nicht-ökonomische) Märkte gedacht werden können. Richard Swedberg gilt er – nicht zuletzt beeindruckt von der Bewegung um Florian und Hillebrandt – gar als Urvater einer ganzen Unterströmung der Teildisziplin82, spricht gar von einer „jungen ‚Schule’ der Wirtschaftssoziologie“, die sich „kritisch-konstruktiv auf die Sozialtheorie Pierre Bourdieus“ (Swedberg 2008: 67) bezieht, allerdings eben nicht auf deren Marktkonzept, sondern auf deren praxistheoretischen Kernbestand, der eine „alternative Lösung des Makro-Mikro-Makro-Problems sein will und sich sowohl gegen die Theorie der bewussten Handlungswahl wie gegen Konzepte mittlerer Reichweite wendet“. Bourdieus (2001) Aufsatz The Forms of Capital hat Eingang in den von Mark S. Granovetter und Richard Swedberg herausgegebenen Band The Sociology of Economic Life gefunden. An anderer Stelle diskutiert Swedberg (2005: 233) Bourdieu explizit als Marktsoziologen: „A small number of attempts have been made to construct a theory of markets – by Max Weber, Harrison White, Neil Fligstein, Pierre Bourdieu, and a few others – and these have neither been fully explored nor very much discussed by economic sociolo82 Ähnliches lesen wir auch bei Marion Foucarde (2007: 1019), für die „field analysts” als „followers of Bourdieu and/or DiMaggio“ eine der drei Hauptströmungen der Marktsoziologie darstellen. Rainer Diaz-Bone (2006: 65) würdigt, „dass die Arbeiten Bourdieus eine vollständige Systematik zur Verfügung stellen, für die konzeptionelle und methodologische Einbettung wirtschaftssoziologischer Forschung, die diese auch praktisch so integrieren, dass die thematischen Vernetzungen notwendig zu einer umfassenden Sozialtheorie führen. Diese Systematik fehlt anderen Ansätzen der aktuellen Wirtschaftssoziologie“; in diesem Sinne handelt er Bourdieus Ansatz als aktuell bestes Theorieangebot der Wirtschaftssoziologie. 100 Steffen Roth gists themselves“. Entsprechend diskutiert dann auch Swedberg (2005: 248ff) Bourdieus Marktkonzept umso ausführlicher, klammert aber hierbei ebenfalls konsequent aus, dass Bourdieu ausdrücklich von der Existenz nicht-ökonomischer Märkte ausgeht; statt dessen passt er Bourdieus Denken dem aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurs an, indem er den Markt sofort dem ökonomischen Feld zuordnet. Ähnlich verfahren auch Andrea Dederichs und Michael Florian, die den Markt zunächst als Governance-Struktur bezeichnen, dann aber zu dem Schluss kommen, dass der (eine) Markt das Kampffeld der – selbstverständlich wirtschaftlichen – Unternehmen sei83. Zuvor hatte bereits Neil Fligstein (2002) seine Architecture of Markets auf dem Bourdieu’schen Feldbegriff errichtet, ohne dass er dabei die Existenz von Konzepten nicht-ökonomischer Märkte im Werk Bourdieus reflektiert hätte. Statt dessen bedient man sich seiner vorzugsweise um (wirtschaftliche) Märkte als soziale Strukturen zu dechiffrieren, etwa indem man zeigt, welchen Impact Lebensstilmuster auf die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Entstehung von Märkten für Produkte haben, bei denen der Geschmack einen erheblichen Wertfaktor bildet, z.B. Märkten für Wein oder Kunstwerke also (Beckert und Rössel 2004). Auch als Kritiker der (ökonomischen) Marktlogik wird Bourdieu gerne zitiert. In diesem Sinne nehmen Jens Beckert (2007b: 19) sowie Patrick Aspers und Jens Beckert (2008: 238) bereits Bourdieus ethnographisches Frühwerk für die Wirtschaftssoziologie in Anspruch, in dem er zeigte, wie die Logik der ‚ökonomischmarktlichen’ Kalkulation im Maghreb zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Logik der Subsistenz oder zumindest die des Haushaltes zu verdrängen beginnt. Ermutigt werden derlei einäugige Lesarten von Bourdieus Aussagen zu nicht-ökonomischen Kapitalien und vor allen zu den korrespondierenden Märkten vermutlich gerade durch die Ähnlichkeit, die sein Marktverständnis mit dem James Colemans und dessen Arbeits83 „Ein Markt ist ein Aggregat von sozialstrukturell differenzierten, ungleich positionierten Unternehmen oder Unternehmenskooperationen, die das gleiche Produkt erzeugen und durch ihre Konkurrenzbeziehungen ein soziales Kräfte- und Kampffeld bilden (Dederichs und Florian 2004: 91). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 101 kollegen Gary Becker hat. Obgleich Bourdieu (1998) zeitlebens gegen die „pure mathematical fiction“ des ökonomischen Imperialismus argumentiert hat, liest man: „Despite (t)his disclaimers Bourdieu does indeed share a great deal with Gary Becker and other rational choice theorists“ (Calhoun 1993: 84)84. Wer sich mit dem Impact of Economics on Contemporary Sociology (Baron and Hannan 1994: 1123) beschäftigt, kommt mitunter auch zu dem Schluss, dass Bourdieus Konzept kulturellen Kapitals direkt von Beckers HumankapitalKonzept beeinflusst sei. Tatsächlich treffen sich Bourdieu, Coleman und Becker nicht nur in ihrem Interesse für nicht-ökonomische Kapitalien, sondern eben auch im Interesse für die korrespondierenden Märkte, abgesehen vom Heiratsmarkt (Becker 1994; Bourdieu 1983: 188; Coleman 1995: 23) zunächst vor allem für den schulischen (Bourdieu 1983: 185; Coleman 1979: 57) oder akademischen Markt (Bourdieu, de Saint Martin und Clough 1998: 276), wobei mit letzterem noch gar nicht der Markt der (reinen) Wissenschaft gemeint ist (vgl. Bourdieu und Emanuel 1996: 249), der, offenbar nicht ganz deckungsgleich mit dem akademischen, einen der „two types of cultural markets“ (Swartz 1997: 228) darstellt. Den zweiten Typus dieser Märkte für Kulturgüter stellt der Markt der Kunst85 dar, bei dem es sich gerade nicht um den Markt für Kunstwerke handelt, an den sich Jens Beckert (2007: 54) erinnert, um das ‚Soziale’ in den ökonomischen Markt hineinzudenken, sondern: „These specialized cultural markets tend to be structured around specific forms of symbolic capital that are relatively autonomous from economic and political capital“ (Schwartz 1997: 228). Der ökonomische Markt ist für Bourdieu (1976: 357) demnach nur eine spezifische Form des allgemeinen Phänomens des Sozialtausches86, der eben auch nicht-ökonomische Formen des Tausches 84 85 86 Tatsächlich wird Bourdieu gleichermassen sowohl der Ökonomisierung der Soziologie (Nassehi und Nollmann 2004; als sein Anwalt: Lebaron 2003) als auch der Übersoziologisierung der Wirtschaftswissenschaften (Smart 1993) für schuldig befunden. Ein Kontext der inversen Ökonomie, der „anti-‚economic’ economy of pure art“ (Bourdieu und Emanuel 1996: 142), in dem bewusst nicht für den Markt produziert wird. Ein Gedanke, den wir auch bei Lars Clausen (1978: 16) formuliert finden. 102 Steffen Roth beinhaltet. Von dieser Tatsache lenkt mitunter der Umstand ab, dass Bourdieu nicht immer von Märkten spricht, wenn Märkte angesprochen sind, sondern auch den Begriff des Feldes ins Feld führt. In gewisser Weise hilft der Feldbegriff dabei, die sprachliche Unterscheidung zwischen gewohntermassen mit Markt bezeichneten ökonomischen Feldern87 und den nicht-ökonomischen Feldern zu treffen. Umgekehrt folgt aus diesem Tribut ans sprachliche Alltagsverständnis allerdings auch, dass nicht nur Autoren wie Neil Fligstein (2002, 2002b, 2005) Architecture of Markets auf Bourdieus Wirtschaftssoziologie aufbauen können (und das gänzlich ohne die Idee nicht-ökonomischer Märkte auch nur anzusprechen), während Bourdieu unübersehbar gar von der Existenz eines sprachlichen Marktes88 ausgeht, auf dem sich jegliche Kommunikation in gleich welchem Feld vollzieht89. Insofern lesen wir also bei Bourdieu nichts von einer Gleichsetzung von Markt und Feld, sondern vielmehr davon, dass das ökonomische Feld mehr umfasst als den (ökonomischen) Markt, also auch Produktionsfelder (Bourdieu 1984: 33), die es offenkundig vom Feld des ökonomischen Tausches zu unterscheiden gilt. Noch deutlicher lesen wir an anderer Stelle einen Unterschied zwischen Markt und Feld: „(I)m ökonomischen Feld selbst konnte die Logik des Marktes die nicht-ökonomischen Faktoren in der Produktion oder in der Konsumption nie vollständig verdrängen” (Bourdieu 1997c: 171). Ganz abgesehen davon, dass wir verblüfft feststellen, dass sich im ökonomischen Feld auch nichtökonomische Faktoren behaupten können (und wir uns fragen, wie ein ökonomisches Feld anders bestellt sein kann als durch – eben ausschliesslich – ökonomische Faktoren), wird hier deutlich, dass der Markt nur eine von mehreren Formen des ökonomischen Feldes darstellt90. Vor diesem Hintergrund scheint es, als ob nicht nur Markt 87 88 89 90 Bei Rainer Diaz-Bone (2006: 46, Fn. 3) lesen wir von Agrarmärkten oder Märkten für Eigenheime als Beispiele für ökonomische Felder, und von Unternehmen als Subfeldern in (diesen) Feldern (ebd. 47). Siehe allein Bourdieus (1993) Arbeit mit dem Titel Der Sprachliche Markt. „Nach Bourdieu findet also Kommunikation immer auf einem Markt statt” formuliert Inci Dirim (1998: 143) im Rahmen einer Arbeit zu interkulturellen Sprachkontakten in Schulen. Hier treffen wir mit Bourdieu dann auf Polanyi (1957, 1978). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 103 und Feld auf unterschiedlichen Analyseebenen rangieren, sondern mitunter auch einzelne Felder, da der Begriff sowohl einerseits Familien, Organisationen oder Nationen (also einzelne Segmente einer umfassenden Gesellschaft) bezeichnen kann, als auch andererseits einzelne Funktionsbereiche der Gesellschaft (Wirtschaft, Politik, Erziehung, etc): Indem wir etwa die Wirtschaft der Familie mit der Volkswirtschaft vergleichen, können wir die Familien-Wirtschaft einerseits als einen Teilaspekt der Wirtschaft im Allgemeinen und der Volkswirtschaft im Besonderen betrachten, stellen dabei dann aber nicht nur fest, dass die Volkswirtschaft streng logisch der Subsistenzwirtschaft der Familie gegenübergestellt ist, Volkswirtschaft demnach also nicht alle Aspekte der Familienwirtschaft umfasst, sondern eben auch, dass Wirtschaft nur ein Aspekt familiärer wie nationaler Vergesellschaft unter vielen ist. In diesem Sinne gälte dann: Dass das Feld der Familie das der Wirtschaft ebenso umfasst wie es von diesem umfasst wird91. Vor diesem Hintergrund scheint es, als ob sich der Feldbegriff letztlich immer auf das aktuelle Referenzsystem bezieht, also auf die Untersuchungseinheit, die gerade von Interesse ist, und im Hinblick auf die sich alle weiteren Begriffe zu verhalten haben. Da wir uns für den Markt interessieren, der Markt also unser Feld ist, lassen sich Markt- und Feldbegriff zum Zwecke der sprachlichen Vereinfachung im Folgenden also synonym setzen (vgl. exemplarisch König 2003: 103). In diesem Sinne erlaubt Bourdieus Feldbegriff dann „gerade durch die Kapitaltheorie eine stärkere analytische Spezifikation der Strukturmerkmale eines Marktes“ (Fley 2006: 182). Möglich wird das, indem wir uns den Markt als ein Feld vorstellen, in dem neben ökonomischem auch nicht-ökonomische Kapitalien relevant sind. Kapital ist für Bourdieu „accumulated labour (in its materialized form or its ‚incorporated’, embodied form)“ (Bourdieu 1986: 241). Kapital ist demnach ein Realwert, dessen Tauschwert beständig durch alternative Realwerte relativiert wird: Der Wert eines Kapitals bestimmt sich 91 Ebenso wie die Familie als Akteur auf dem – ökonomischen – Markt auftreten kann, kann sie demnach auch ihrerseits einen – trans-ökonomischen – Markt darstellen (vgl. Bourdieu 1987: 150f). 104 Steffen Roth also nicht nur aus der akkumulierten Arbeit eines einzigen Individuums, sondern eben auch aus der akkumulierten Arbeit aller potenziellen Tauschpartner. Vor dem Hintergrund seiner Feldtheorie geht Bourdieu nun davon aus, dass die Logik eines jeden Feldes (Familie, Nation, Wirtschaft, Schule, etc.) definiert, welche Formen von Kapital jeweils relevant bzw. besonders relevant sind (vgl. Bourdieu 1987: 194). Neben dem ökonomischen denkt er hierbei zunächst vor allem an kulturelles und soziales Kapital. Kulturelles Kapital kann in objektivierter, inkorporierter oder institutioneller Form vorliegen (Bourdieu 1986: 242ff); Schriftstücke, Gemälde oder Monumente sind typische Beispiele für objektiviertes Kulturkapital (ebd.: 245), allerdings nur dann, wenn sie sich von natürlichen Objekten als Formen der Kunst oder der Kunstfertigkeit unterscheiden lassen. Beim institutionalisierten Kulturkapital handelt es sich um das Ergebnis erfolgreicher Interaktion im Kontext von Tests, Prüfungen und anderen Bewährungsproben des Erziehungssystems zu verstehen; Form dieses Ergebnisses sind vor allen Bildungstitel, also Zeugnisse und Diplome von Schulen und Universitäten. Im Gegensatz dazu resultiert inkorporiertes Kulturkapital eben nicht aus sozialer Interaktion, sondern aus einem Streben nach Selbstveredelung „in the absence of any deliberate inculcation“ (ebd.: 248). Soziales Kapital ist für Bourdieu „die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 1987: 190). Soziales Kapital ist also ein Kapital an Beziehungen (vgl. ebd.: 194), ein Kapital an Achtung und Ansehen, das von Nutzen ist, wenn es darum geht, Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten (ebd.: 204). Sozialkapital kann also in diesem Sinne von einem Akteur akkumuliert werden, hängt in seinem Wert aber „sowohl von der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen ab, die er tatsächlich mobilisieren kann, als auch von dem Umfang des (ökonomischen, kulturellen oder symbolischen) Kapitals, das diejenigen besitzen, mit denen er in Beziehung steht“ (Bourdieu 1983: 191). Ähnlich wie kulturelles Kapital kann Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 105 Sozialkapital dabei gesellschaftlich institutionalisiert und garantiert werden, konkret in Form von Titeln. Hierbei handelt es sich dann um Titel, welche die Zugehörigkeit zu einer spezifischen Gruppe oder Schicht anzeigen, also beispielsweise Adelstitel (ebd.: 183). Die Institutionalisierung vollzieht sich dann etwa über die Annahme eines gemeinsamen Namens, der Zugehörigkeit zu einer Familie symbolisiert, die den einzelnen nicht nur prägt, sondern deren mehr oder weniger guter Name auch für eine spezifische Konstellation von Kapitalverhältnissen steht. Gemeint sind hierbei dann gleichermassen Bestände an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital.92 Daneben existiert bei Bourdieu noch das Konzept des symbolischen Kapitals, das sich auf den relativen Wert der einzelnen Kapitalien zueinander bezieht, und das sowohl innerhalb eines (Teil-)Feldes als auch in der Interaktion zwischen (Teil-)Feld und umfassenderen Feld. Bourdieu verwendet den Begriff des symbolischen Kapitals dabei allerdings auf äusserst unterschiedliche und mitunter verwirrende Weise. So lesen wir etwa: „a school diploma is a piece of universally recognized and guaranteeed symbolic capital, good on all markets“ (Bourdieu 1989: 21), und das, obgleich er uns den Bildungstitel bereits als Form kulturellen Kapitals vorgestellt hat. An anderer Stelle rückt der Begriff des symbolischen Kapitals in erstaunliche Nähe zum Sozialkapital: Mit der Idee des symbolischem Kapitals ist der Umstand bezeichnet, dass die einzelnen Kapitalformen zwar theoretisch gleichwertig und inkommensurabel sind (Fischer 2006: 2852), in der Realität aber als unterschiedlich relevant gehandelt und 92 „Tatsächlich richten sich die Chancen einer Gruppe zur Aneignung einer beliebigen Art seltener Güter (gemessen am gewichteten arithmetischen Mittel des Zugangs zu ihnen) zunächst einmal nach ihren entsprechenden Kapazitäten – d.h. dem ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapital, das sie zur materiellen und/oder symbolischen Aneignung der betreffenden Güter einsetzen kann; hängen mithin ab von ihrer sozialen Position, und weiter von der Beziehung zwischen ihrer geographischen Verteilung und der jener Güter (eine Beziehung, die anhand der durchschnittlichen Entfernung zu den Gütern oder Einrichtungen gemessen werden kann, oder anhand des Zeitaufwands, um zu ihnen zu gelangen – womit das Problem des Zugangs zu individuellen wie kollektiven Transportmitteln berührt ist)“ (Bourdieu 1987: 207). 106 Steffen Roth dabei auch verrechnet93 werden können und auch müssen, eben weil spezifische Kapitalformen in spezifischen Feldern relevanter sein können, als in anderen (Bourdieu 1987: 281): Eine alternativökologische Familie hat eine andere „hierarchy of values“ (Bourdieu 1989: 21) als eine neureiche. Die Fähigkeit, diese Wertehierarchien von Familien, Milieus, Kulturen oder ganzen Welten94 zu entwickeln, zu kultivieren und allenfalls umzugestalten bezeichnet Bourdieu (1989: 22f) als „symbolic power, whose form par excellence is the power to make groups“95; diese demiurgische Kraft sei demnach die „power granted to those who have obtained sufficient recognition to be in a position to impose recognition“. Gemeint sind damit bei Bourdieu (1989: 21) ausdrücklich „the nobles (etymologically, those who are well-known and recognized), (who) are in the position to impose the scale of values most favorable“ angepasst an ihre eigenen Kapitalverhältnisse, sodass sie sich in den so angepassten Feldern wie Fische im Wasser bewegen können (Bourdieu 1986: 257, Fn. 18). 93 94 95 „Eine objektive Grundlage für dieses abstrakte Verfahren liegt in der immer gegebenen Möglichkeit vor, eine Kapitalsorte in eine andere zu konvertieren – zu je nach historischen Momenten variablen Umtauschraten, d. h. je nach Stand des Kräfteverhältnisses zwischen den Eignern der verschiedenen Sorten. Indem sie zwingt, das Postulat von der Konvertierbarkeit der verschiedenen Kapitalsorten zu formulieren, weil nur so der Raum auf Eindimensionalität reduziert werden kann, macht die Konstruktion eines zweidimensionalen Raumes sichtbar, daß die Umtauschrate der verschiedenen Kapitalsorten selbst eines der grundlegendsten Streitobjekte zwischen den verschiedenen Klassenfraktionen darstellt, deren spezifische Verfügungsgewalt und Privilegien an eine jeweilige Sorte geknüpft sind; ein Objekt vor allem aber auch im Kampf um das dominierende Prinzip von Herrschaft (ökonomisches, kulturelles oder soziales Kapital, wobei letzteres über den allgemeinen Bekanntheitsgrad des Namens, sowie Ausmaß und Qualität des Beziehungsnetzes in engem Zusammenhang steht mit der Anciennität innerhalb der Klasse), den die Fraktionen der herrschenden Klasse durchgehend miteinander austragen“ (Bourdieu 1987: 209). Bourdieu spricht von symbolischer Macht als der “power of ‚world making‘“(Bourdieu 1989: 22). Wir erinnern uns, dass Bourdieu Sozialkapital über Gruppenzugehörigkeit herleitet. In diesem Sinne wäre die Ausübung von symbolischer Macht, also der Fähigkeit, die Gruppe herzustellen, der man dann angehört, auch ein Paradefall der Herstellung von sozialem Kapital. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 107 Adel wurde uns zuvor allerdings bereits als eine Form des institutionalisierten Sozialkapitals vorgestellt. Und auch der Umstand „that symbolic capital is nothing other than economic or cultural capital when it is known and recognized, when it is known through the categories of perception that it imposes“ trägt auch nicht bei zu mehr Klarheit in Bezug auf die Charakterisierung und Abgrenzung der einzelnen Kapitalien – die nicht umsonst als unterdefiniert (Smart 1993, Saake 2004), überraschender Weise aber auch als zu wenige (Verter 2003) gelten. Dessen ungeachtet verdanken wir dem Werk Pierre Bourdieus ein bislang beispielloses, nicht-reduktionistisches Konzept für die Beobachtung nicht-ökonomischer Märkte sowie deren Zusammenspiel mit ökonomischen Märkten, das damit auch den Umständen Rechnung trägt, dass nicht-ökonomische Kapitalien ebenso nach nichtökonomischen Investitionshorizonten verlangen wie ökonomisches Kapital auf ökonomische Märkte verweist, dass die Idee nicht-ökonomischer Märkte als eben genauso angemessen betrachtet werden muss wie die der nicht-ökonomischen Kapitalien. dass damit nicht jede Form von akkumulierter Arbeit oder markt-bezogenem Kalkül zwangsläufig Wirtschaft ist, und dass schliesslich die einzelnen Kapitalien je nach Kontext unterschiedliche Werte haben können, dass also Konversionen von einer Kapitalform zu einer anderen nicht nur denkbar, sondern auch beobachtbar sind, und dass sich damit – nun in eigenen Worten – so etwas wie über die Zeit und den Sozialraum schwankende Wechselkurse zwischen ökonomischen und nicht-ökonomischen Kapitalien gibt. Will man auf diesen Vorzügen des Bourdieuschen Ansatzes aufbauen, dann macht es Sinn, sich mit Theorieangeboten zu beraten, deren 108 Steffen Roth Stärken an den bereits angesprochenen Schwachstellen des fehlenden Organisationsbegriffs und der unterdefinierten/-differenzierten Kapitalformen liegen oder hier zumindest Schützenhilfe leisten können. Dass vor diesem Hintergrund im Folgenden auch die Wirtschaftssoziologie Niklas Luhmanns (1984, 1988, 1997) ins Feld geführt wird, mag verwundern, da Luhmann, anders als die zuvor vorgestellten Autoren, den Markt exklusiv der Wirtschaft zuordnet. Auch wenn Luhmanns Schüler Dirk Baecker (2006, 2006b) also bereits eine knapp gehaltene systemtheoretische Variante der Idee der nichtökonomischen Märkte vorgelegt hat, lässt sich nicht von einer Wahlverwandtschaft zwischen dem Kernanliegen dieser Arbeit und der Theorie sozialer Systeme sprechen; im Gegenteil: Luhmann (1970) beschreibt die vergleichsweise früh und mit ausdrücklichem Bezug auf den wirtschaftssoziologischen Diskurs die Wirtschaft als soziales System96 und Märkte als deren innere Umwelt (1988: 91), und befindet sich damit in bestem Einklang mit dem „Markt=Wirtschaft“Paradigma des neu-wirtschaftssoziologischen Mainstreams. Angesichts dieses fundamentalen Einverständnisses verwundert die Randständigkeit des Wirtschaftssoziologen97 Niklas Luhmann im aktuellen Diskurs. Immerhin fällt Luhmanns Schattendasein mittlerweile auf: „Many of the major European sociologists have (...) written on the economy as part of their general concern with society. This is not only true of Raymond Aron, Michel Crozier, and Ralf Dahrendorf, but also of major sociologists with notable contemporary influence, such as Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, and Pierre Bourdieu (…). Luhmann (1927-1998), for example, has 96 97 „(E)conomic sociology can only develop if its approach is overhauled and it sets out (…) from the concept of the economy as a subsystem of society” (Luhmann 1982: 221f). „I emphasize, as a strength of Luhmann’s economic sociology, that the problem of uncertainty is posed explicitly“; während sie sich intensiv für sein Verständnis des Konzepts Unsicherheit interessieren, erklären Jens Beckert und Barbara Harshav (2002: 207) Luhmann ganz unkompliziert zum Wirtschaftssoziologen. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 109 written a number of essays on the economy, which, however, have been somewhat neglected in the current debate” (Smelser and Swedberg 2005: 17f)98. Während Neil Smelser und Richard Swedberg hierbei übersehen, dass Luhmann neben ein paar Essays der Wirtschaft der Gesellschaft (1988) eigens eine Monografie gewidmet hat, findet sich hier bereits eine zentrale Tendenz der Luhmann-Rezeption im aktuellen wirtschaftssoziologischen Diskurs: Auch wenn man an ihm nicht vorbeikommt99, hält man sich nicht lange mit ihm auf, was zweifellos weniger auf eine gewisse Betriebsblindheit des wirtschaftssoziologischen Mainstreams als vielmehr auf eine Selbstmarginalisierungsstrategie100 der systemtheoretischen Wirtschaftssoziologie zurückzuführen ist. Vor allem Luhmanns Marktkonzept wird entsprechend wenig bis gar nicht diskutiert: Heiner Ganssmann (2007: 77) zufolge lässt sich die Relevanz zentraler systemtheoretischer Konzepte für die Wirtschaftssoziologie nicht genug hervorheben, konkret etwa das der doppelten Kontingenz, mit dessen Hilfe sich gegen neoklassische Rationalitäts- und Gleichgewichtsannahmen argumentieren lässt; dabei gilt dann: 98 Es entsteht ein wenig der Eindruck, als ob Luhmann seine Wirtschaftssoziologie allzu gut in seine umfassende soziologische Theorie eingearbeitet hat. 99 Luhmann’s (1982) Aufsatz The Economy as a Social System wird von Richard Swedberg und Mark Granovetter (2001), Pierre Bourdieu und Loic Wacquant (1992) sowie in Nico Stehr’s Monografie Die Moralisierung der Märkte (2007) zitiert; er hat einen eigenen Eintrag in der von Jens Beckert und Milan Zafirovski (2006) herausgegebenen International Encyclopedia of Economic Sociology (Paul 2006: 417ff); siehe zudem die übernächste Fussnote. 100 „Es steht zu vermuten, dass etliche Beiträge mit dieser Ausrichtung nach Gründung der Zeitschrift Soziale Systeme (1995) dort erschienen und daher in unserem Datensatz nicht enthalten sind. Dies würde zugleich auf eine Selbstmarginalisierung des systemtheoretischen Ansatzes in der Wirtschaftssoziologie hindeuten, denn Gegenstand unserer Untersuchung sind die allgemeinen soziologischen Fachzeitschriften, die die Disziplin insgesamt am stärksten prägen“ (Beckert und Besedovsky 2009: 23). Indem die (nichtsystemtheoretischen) Autoren des hier zitierten Aufsatzes Die Wirtschaft als Thema der Soziologie wirtschaftssoziologische Beiträge in der Zeitschrift Soziale Systeme in ihrer Untersuchung nicht berücksichtigen, marginalisiert sich die Theorie sozialer Systeme selbst. 110 Steffen Roth „Auch ohne zu behaupten, dass die Soziologie mit Parsons und Luhmann bereits über ausreichende Analysen und theoretische Formulierungen des Problems der doppelten Kontingenz verfügt, gilt, dass es seinen Platz in der Wirtschaftstheorie finden muss, wenn diese zu einem auch nur rudimentären Verständnis der sozialen Dimension wirtschaftlicher Sachverhalte kommen soll“. Obgleich dieses Zitat dem von ihm mit herausgegebenen Band Märkte als soziale Strukturen entnommen ist, interessiert sich Ganssmann nicht weiter für die Märkte der Systemtheorie. Auch Gertrude Mikl-Horke (2008b: 36) zählt im von Andrea Maurer herausgegebenen Handbuch der Wirtschaftssoziologie die systemtheoretischen Beiträge zur Wirtschaftssoziologie und hier vor allem zur Markttheorie, „welche in Bezug auf das Abstraktionsniveau als eine mit der ökonomischen Modellkonzeption vergleichbare Konzeption der monetär ausdifferenzierten Wirtschaft der Gesellschaft gesehen werden kann (...). Mit ihrer Hilfe wird die Markttheorie der Ökonomie durch die System-Umwelt-Differenz reformuliert, so dass der Markt als Beobachterkonstrukt begreifbar wird“. Den Beitrag zu Märkten schreiben aber auch hier wieder die üblichen Verdächtigen (Aspers und Beckert 2008), während Dirk Baecker (2008) im gleichen Band lediglich im Kontext seines zwangsläufig allgemeiner gehaltenen Beitrages Wirtschaft als funktionales Teilssystem auf die Stärken der systemtheoretischen Markttheorie eingehen kann: „Mit der Kombination von gesellschaftlicher Funktion (der Knappheitskommunikation) und operativer Reproduktion (den Zahlungen) liegt ein robustes Theorem vor, dem es mühelos gelingt, Fragen der Geld- und Markttheorie mit Fragen der Gesellschaftstheorie zu verbinden“ (Baecker 2008: 117). Ähnlich wie es Rainer Diaz-Bone (2006: 65) für die Theorie Pierre Bourdieus tut, reklamiert also auch Dirk Baecker für die Systemtheorie, dass sie zu einer stärkeren gesellschaftstheoretischen Einbettung beitragen kann, die – wie gesagt – „für eine konstruktive Weiterentwicklung der neuen Wirtschaftssoziologie zur Zeit (...) von besonderer Bedeutung zu sein“ (Schluchter 2007: 92f) scheint101. 101 Wir erinnern an dieser Stelle, dass auch Milan Zafirovski (2003: 2) sowie Jens Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 111 Wenn wir uns auf Luhmann einlassen, dann können wir Wirtschaftssoziologie nicht betreiben, ohne uns eben auf Wirtschaft, und damit auf funktionale Differenzierung zu beziehen: Ökonomie ist nicht Politik ist nicht Wissenschaft ist nicht Religion etc. Wie viele dieser sogenannten Funktionssysteme zu unterscheiden sind, ist nach wie vor umstritten; sehen wir von der Liebe, der Moral und der sozialen Hilfe als eben umstrittenen Exoten der Theorie funktionaler Differenzierung (vgl. Luhmann 1997: 595ff) ab, dann können wir entlang Luhmanns Theorie sozialer Systeme (1984) folgende zehn Funktionssysteme unterscheiden: Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Religion, Sport, Recht, Kunst, Gesundheit, Erziehung und schliesslich das System der Massenmedien. Unabhängig davon lässt sich der Vorzug dieses differenzierungstheoretischen Ansatzes, „(s)eine Eigenart und Vorteilhaftigkeit (...) daran erkennen, dass diese Hauptdifferenzierung es ermöglicht, verschiedene Differenzierungstypen nebeneinander zu verwenden und darüber hinaus widersprüchliche und erweiterungsfähige Differenzierungsrichtungen vorzusehen“ (Luhmann 2005: 276). In diesem Sinne kann Luhmann drei basale gesellschaftliche Differenzierungsformen unterscheiden: Die segmentäre, die stratifikatorische und die funktionale Differenzierung. Beckert und Richard Swedberg (2001: 379f) diese Forderung unterschrieben haben. Während Swedberg nach wie vor die gesellschaftstheoretische Anbindung an den Nationalökonomen Weber sucht, kommt Beckert (2002, 2005) mittlerweile zumindest im Hinblick auf die für ihn aktuell zentralen Variablen zur Erklärung des Markthandelns (doppelte Kontingenz, Unsicherheit, Vertrauen) an Luhmann nicht vorbei. Gleiches gilt auch für Heiner Ganssmann (2007: 77), der sich zudem auch früh für den Geldbegriff Luhmanns interessierte (Ganssmann 1996: 146ff), den auch Christoph Deutschmann (2001: 67f, 2002) genauer unter die Lupe nahm. Zafirovski (2003: 110) zitiert Luhmanns Marktverständnis, allerdings nur en passant als ein schlechtes Beispiel für kattalktisches Marktdenken unter vielen und stellt ihn dabei in eine Reihe mit Gary Becker, James Coleman oder Peter Blau. Dass dies zu kurz greift, zeigt Johannes Berger (1990: 105) im von Alberto Martinelli und Neil Smelser herausgegebenen Band Economy and Society: Overview in Economic Sociology, indem er vorführt, dass sich mit Luhmann auch vortrefflich gegen neoliberale Wirtschaft- und Politikmodelle argumentieren lässt. 112 Steffen Roth „Segmentäre Differenzierung entsteht dadurch, dass die Gesellschaft in prinzipiell gleiche Teilsysteme gegliedert wird, die wechselseitig füreinander Umwelt bilden. Dies setzt, in welchen Formen auch immer, Familienbildung voraus. Die Familie bildet eine künstliche Einheit über den natürlichen Unterschieden des Alters und des Geschlechts, und dies durch Inkorporation dieser Unterschiede. Es gibt immer schon Gesellschaft, bevor es Familien gibt. Die Familie wird als Differenzierungsform der Gesellschaft konstituiert, und nicht umgekehrt die Gesellschaft aus Familien zusammengesetzt“ (Luhmann 1997: 634f). Darauf sowohl aufbauend als auch im Gegensatz stehend präsentiert sich dann die Form der stratifikatorischen Differenzierung, die mit der Entstehung vererblicher Privilegien einer Oberschicht einhergeht: „Dabei ist mit Oberschicht, also mit stratifikatorischer Differenzierung, eine Ordnung von Familien, nicht von Individuen gemeint, also eine soziale Prämierung von Herkunft und Anhang. Und im Verhältnis zu heute geltenden Ordnungsvorstellungen kommt es darauf an, dass die Schichtzugehörigkeit multifunktional wirkte, also Vorteile bzw. Benachteiligungen in so gut wie allen Funktionsbereichen der Gesellschaft bündelte und damit einer funktionalen Differenzierung kaum überwindbare Schranken zog. Von Stratifikation wollen wir nur sprechen, wenn die Gesellschaft als Rangordnung repräsentiert wird und Ordnung ohne Rangdifferenzierung unvorstellbar geworden ist“ (ebd.: 679). Im Übergang vom Mittelalter zur Moderne beobachtet Luhmann dann eine silent revolution, in deren Zuge die feudalen Oberschichten und mit ihnen das Ordnungsmodell stratifizierter Gesellschaften seine Vormachtstellung schliesslich nicht durch den Aufstieg einer anderen Klasse, sondern „durch die allmähliche Entwertung der Differenz, die den Adel vom Volk unterscheidet“ (ebd.: 712) einbüsste. An die Stelle der alten Ordnung der Dinge tritt ein Szenario, in dem die Gesellschaft zunehmend entlang bestimmter Funktionslogiken differenziert wird: „Jede Funktion wird autonom von einem Teilsystem erfüllt. Jedes Teilsystem hypostasiert den Primat der eigenen Funktion. (...) Im Wirtschaftssystem wird zum Beispiel die Orientierung an der wissenschaftlichen Wahrheit verworfen, aber die Relevanz der Wissenschaft für die Gesellschaft akzeptiert“ (Baraldi, Corsi und Esposito 1999: 68). Wissenschaft ist also nicht Wirtschaft, beide Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 113 und weitere Funktionssysteme sind aber gleichermassen ein Teilsystem der Gesellschaft. Wenn wir also von Wirtschaft sprechen, dann gilt immer auch: „Dabei geht es um Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Formel gibt uns aber noch nicht das Problem. Sie führt eher in die Irre, denn sie verführt dazu, sich Wirtschaft und Gesellschaft wie zwei unabhängig voneinander fassbare Sachverhalte vorzustellen“ (Luhmann 1988: 43). Luhmann distanziert sich hiermit gleichzeitig sowohl von Vorstellungen, die die Wirtschaft als ein (momentan) ausserhalb der Gesellschaft angesiedeltes Aktionsfeld betrachten – das es entsprechend (wieder) sozial einzubetten gälte – als auch von der Idee, dass Wirtschaft und Gesellschaft mehr oder weniger gleichzusetzen seien, d.h. also gegen die affirmativ oder kritisch vorgetragene Idee von der ökonomischen Kolonialisierbarkeit oder Kolonialisierung der Gesellschaft. Wirtschaft ist für ihn vielmehr ein spezifisches Teilsystem von Gesellschaft, die er als das umfassendste System des beständigen Anschlusses von Kommunikationen an Kommunikationen102, als Kommunikationssystem also und in diesem Sinne als soziales System beschreibt. Auch das Funktionssystem Wirtschaft ist demnach ein soziales (Teil-)System und in diesem Sinne auch nicht mehr oder weniger sozial als andere Teilsysteme des sozialen Systems Gesellschaft. Als Wirtschaft bezeichnet Luhmann dann die Gesamtheit aller geldvermittelten Kommunikationen: „Die Operationen des Wirtschaftssystems sind Zahlungen; alle Operationen, die mit Geld zu tun haben, sind dem Wirtschaftssystem zuzurechnen“ (Baraldi, Corsi und Esposito 1999: 209), oder in den Worten Luhmanns: „Der ‚unit act’ der Wirtschaft ist die Zahlung“ (Luhmann 1988: 52) im Medium Geld. Insofern, und nur „(i)nsofern wirkt die Geldform sozial destabilisierend, sie kappt kommunikativ mögliche Bindungen, und genau das ist die Bedingung der Ausdifferenzierung eines besonderen Funktionssystems. Dieser Informationsverlust ver102 „Die Gesellschaft ist ein autopoietisches System auf der Basis von sinnhafter Kommunikation. Sie besteht aus Kommunikationen, sie besteht nur aus Kommunikationen, sie besteht aus allen Kommunikationen. Sie reproduziert Kommunikationen durch Kommunikationen“ (Luhmann 1988: 50). 114 Steffen Roth stärkt sich nochmals auf der Ebene derjenigen Konditionierungen, die als ‚Preise’ allgemein festgesetzt sind: denn solche Preise geben nicht einmal darüber Auskunft, ob und wie häufig zu diesem Preis tatsächlich Zahlungen erfolgt sind. Andererseits ermöglichen feststehende Preise aufgrund dieses Verzichts auf Informationen auch Informationsgewinn. Man kann sich anhand von Preisen über Zahlungserwartungen informieren, kann also beobachten, wie andere den Markt beobachten“ (ebd.: 18). Indem Luhmann den „Markt als innere Umwelt des Wirtschaftssystems“ (ebd. 91) vorstellt, lässt er keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Markt (auch für ihn) eine wirtschaftliche Veranstaltung ist. Als Markt beobachtet man demnach alles, die Wirtschaft genauso wie alle anderen Funktionssysteme der Gesellschaft, „nur mit Hilfe der Preise, also mit einem reduzierten, zirkulär geschlossenen Netzwerk von Beeinflussungen (...) Das Wirtschaftssystem macht, um diesen zentralen Punkt nochmals zu betonen, sich selbst zur Umwelt, um auf diese Weise Reduktionen zu erreichen, mit denen es sich selbst und anderes in einer Umwelt beobachten kann“ (ebd.: 95). Ein weiteres Zitat, auf das wir an anderer Stelle noch einmal zurück kommen werden, macht diesen Gedanken zumindest etwas nachvollziehbarer: „Als Markt kann man (...) die wirtschaftsinterne Umwelt der partizipierenden Systeme des Wirtschaftssystems ansehen, die für jedes eine andere, zugleich aber für alle dieselbe ist. Der Begriff des Marktes bezeichnet also kein System, sondern eine Umwelt – aber eine Umwelt, die nur als System, in diesem Fall also als Wirtschaftssystem, ausdifferenziert werden kann. Als Markt wird mithin das Wirtschaftssystem selbst zur Umwelt seiner eigenen Aktivitäten“ (ebd.: 94). Die Idee ist eigentlich schlicht: Luhmann unterstellt den an Wirtschaft beteiligten Systemen Erwartungen bezüglich der Erwartungen anderer an Wirtschaft beteiligter Systeme. Diesen spekulativen Erfahrungsraum bezeichnet er als Markt, etwa als den Markt einer Organisation. Dabei wird rasch deutlich, dass sich das Marktbild des Systems Organisation zum einen eindeutig auf deren Umwelt bezieht; zum anderen ist dieser Umwelt-bezogene Spekulationsraum aber ebenso eindeutig Teil der Organisation, also deren höchsteigene Vorstellungswelt von der umgebenden Umwelt, und in diesem Sinne: Die innere Umwelt dieser Organisation. Es lässt sich nun nachvollzieh- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 115 bar argumentieren, dass sich die innere Umwelt der Organisation, also das Bild, das eine Organisation von der sie umgebenen Umwelt hat, sich von Organisation zu Organisation grundsätzlich unterscheidet: Microsoft hat einen anderen Markt als Apple, und das allein schon deshalb, weil die Umwelt von Apple aus Microsoft et al. besteht, aber keinesfalls auch aus Apple selber; und umgekehrt die Umwelt von Microsoft aus Apple et al. besteht, aber eben nicht auch aus Microsoft. In diesem Sinne bewegen sich Apple, Microsoft und andere je in gänzlich unterschiedlichen Märkten. In diesem Sinne gibt es dann auch kein absolutes, objektives Bild des Marktes als der inneren Umwelt der Wirtschaft, sondern allenfalls den beständigen Versuch, mittels der Gestaltung eigener und der Interpretation fremder Preissignale indirekt an möglichst viel Information über die Märkte, also die inneren Umwelten möglichst vieler anderer Marktteilnehmer heranzukommen, um so lohnende Investitionschancen auszuloten oder das Risiko einer Fehlinvestition minimieren zu können, was – nun aus der Perspektive der Gesamtwirtschaft betrachtet – letztlich die Anschlusswahrscheinlichkeit von Zahlungen an Zahlungen, und damit die fortlaufende Autopoiesis, also den Fortbestand der Wirtschaft als geldvermitteltem System der Knappheitsbewältigung, wahrscheinlich und zunehmend wahrscheinlicher werden lässt. Entsprechend ist der Markt bei Luhmann also nicht ein spezifisches System an Tauschhandlungen oder Zahlungen, sondern ein intersystemischer Verweisungszusammenhang von aus Preissignalen deduzierten Zahlungserwartungen, der Zahlungen stimuliert103: „Der Markt ist mithin nichts anderes als eine Grenze, er ist die Wahrnehmung des Konsums aus der Sicht der Produktion und Verteilungsorganisation. (...) Abstrakter formuliert ist der Markt als Grenze die Differenz zwischen be- 103 In diesem Sinne ist der Markt bei Luhmann also nicht nur eine wirtschaftliche Form der Beobachtung des Nicht-Wirtschaftlichen, sondern mitunter eben auch eine spezifische soziale Form der Beobachtung des Asozialen; mit dem Markt verhält es sich demnach wie mit einer Methode, mit der wir der Existenz und gewisser Strukturmerkmale eines schwarzen Loches Aufschluss verschaffen können, indem wir die Art und Weise beobachten, wie es die sichtbare Materie beeinflusst, obgleich es selbst unsichtbar bleibt. Die sichtbare Materie des Wirtschaftssystems wären Zahlungen. 116 Steffen Roth stimmter und unbestimmter (eigener und umweltmässiger) Komplexität“ (Luhmann 1988: 73f). Ein solcher Marktbegriff liegt damit zum einen deutlich quer zu den in der neuen Wirtschaftssoziologie geläufigen Versuchen, Märkte als mehr oder weniger sichtbare Tauschhandlungen, Tauschnetze oder als Formen zunehmend verdichteter und verdinglichter Regeln, Normen und Institutionen in den Griff zu bekommen. Zum anderen stimmt er mit dem aktuellen wirtschaftssoziologischen Mainstream in zwei für diesen wesentlichen Punkten überein: Er beschreibt Märkte gleichermassen als wirtschaftliche wie als soziale Veranstaltung. In diesem Sinne ist er, das ist bereits angeklungen, auch der Komplizenschaft mit den zuvor dargestellten Konzepten nicht-ökonomischer Märkte von Gary Becker, James Coleman, Pierre Bourdieu und anderen auch nicht zu überführen. Die Idee nicht-ökonomischer Märkte müsste demnach nicht nur aus der Wirtschaftssoziologie im Allgemeinen, sondern eben auch aus der Theorie sozialer Systeme gewissermassen herausgeschält werden. Dieser Umstand für das Anliegen dieser Arbeit in dreifacher Hinsicht relevant: Zum einen lässt sich entlang der Luhmannschen Begriffswelt zeigen, dass sich mit dem sogenannten ökonomischen Imperialismus oder Ökonomik, konkret also den wissenschaftlichen Fürsprechern der (freien Markt-) Wirtschaft, auch entspannter verfahren lässt als es die gegenwärtig aktiven Anwälte der Gesellschaft – bzw. genauer gesagt – deren nicht-wirtschaftlicher Teilsysteme tun. Im Luhmannschen Sinne ist es als beinahe zwangsläufig (und in diesem Sinne auch als ernst, aber nicht allzu ernst) anzusehen, dass Wirtschaftswissenschaftler die Gesellschaft aus der Perspektive der Wirtschaft rekonstruieren, und dabei erfolgreich sind: Wirtschaftliche Kommunikation ist einem Systemtheoretiker ebenso Gesellschaft wie wissenschaftliche, rechtliche oder religiöse. Das lässt sich auch weniger systemtheoretisch ausdrücken: „Wer sich für Reichtum interessiert, Geld hortet, Zinsen nimmt und bezahlt, Arbeiter ausbeutet, auf steigende Aktienpreise spekuliert oder feindliche Unternehmensübernahmen plant, handelt sozial, denn ohne das Mitspielen anderer, ohne die wie immer umstrittene, dann aber doch faktische Anerkennung Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 117 entsprechender Handlungsmotive (...) wäre dieses Handeln nicht möglich“ (Becker 2008: 111). Bei Wirtschaft handelt es sich demnach um eine, aber eben auch nicht mehr als eine spezifische Form des Vollzugs von Gesellschaft. Zum anderen stellt sich vor diesem Hintergrund dann aber auch in aller Konsequenz die Frage, auf welchem Standpunkt die Fürsprecher der Gesellschaft ihrerseits stehen, wenn man den Gesellschaftsbegriff entlang der Luhmannschen Differenzierungstheorie höher auflöst. In diesem Sinne: Wie hält man es in diesem Lager mit dem Gesellschaftsbegriff? Oder konkreter: Welches ist das Referenzsystem der neuen Wirtschaftssoziologen, also jenes, in das die Wirtschaft wieder eingebettet werden soll: die Politik104? Die Religion105? Die Wissenschaft106? Oder ist es tatsächlich die gesamte Gesellschaft (und damit eben auch die Wirtschaft selbst)107? Schliesslich eignet sich die Theorie sozialer Systeme Luhmannscher Prägung als unverdächtiges Theorieangebot auch als Rahmenkonzept für den nächsten Abschnitt, in dem das Zeichensystem der mathematischen Mengenlehre auf die Theorie sozialer Systeme bezogen wird und derart als Ordnungsrahmen für die Diskussion der sozusagen taxonomischen Verhältnisse zwischen zentralen Begriffen des wirtschaftssoziologischen Diskurse, allen voran: Markt, Wirtschaft, Gesellschaft, verwandt werden soll. Dieser Ordnungsrahmen soll dabei Vergleichbarkeit in Bezug auf den logischen Gehalt der einzelnen Ansätze herstellen, und somit die Frage klären helfen, ob die Idee nicht-ökonomischer Märkte tatsächlich weniger logisch ist. Im nächsten Abschnitt bewegt man sich dabei also entlang einer Theorie, die der Idee nicht-ökonomischer Märkte eindeutig skeptisch gegenüber steht. 104 Möchte man die Wirtschaft also besser in bestimmte Machtverhältnisse eingebettet wissen? 105 Möchte man die Wirtschaft demnach (mehr) in Gottes Hand wissen? 106 Möchte man die Wirtschaft also besser in die eigenen wissenschaftlichen Ansätze eingebettet wissen? 107 Bis zu welchem Grad soll die Wirtschaft dann eben doch wieder in sich selbst eingebettet werden (dürfen)? 118 Steffen Roth Vor dem Hintergrund des eben gesagten könnte man nun denken: Der systemtheoretische Marktbegriff ist zweifellos interessant, doch warum wird er in einem Kontext behandelt, in dem Autoren zu Wort kommen, die von der Existenz nicht-ökonomischer Märkte ausgehen? Dieser Umstand ist einem Zitat von Dirk Baecker (2006b: 333) geschuldet, indem er systemtheoretische Differenzierungs- und Markttheorie kombiniert: „Markets are considered essentially economic phenomena, but are common in other spheres, including the spheres of politics, science, religion, art, education, law (...)“. In diesem Sinne können wir uns also ebenso viele Märkte vorstellen, wie es Funktionssysteme der Gesellschaft gibt. Mit Baecker spricht sich demnach auch ein systemtheoretischer Wirtschaftssoziologe108 für die Idee nicht-ökonomischer Märkte aus, allerdings nicht ganz so eindeutig, wie es dieser Arbeit durchaus recht sein könnte: „Meine Chancen, Macht und Wissen zu erwerben, erschliesse ich mir nicht auf Märkten, sondern in der Politik und in Schulen“ erklärt Baecker (2003: 13) an anderer Stelle, will allerdings an wieder anderer Stelle „auch nicht ausschliessen, sondern einschliessen, dass es Märkte der Sicherung des Absatzes von Performanzen an ein Publikum auch in der Politik, in den Massenmedien, in der 108 Dirk Baecker (2008) ist, wie bereits angesprochen, im von Andrea Maurer herausgegebenen Handbuch der Wirtschaftssoziologie vertreten, wo er die Wirtschaft als funktionales Teilsystem vorstellt. Getraude Mikl-Horke (2008: 94) diskutiert Baecker in Werken Sozialwissenschaftliche Perspektiven der Wirtschaft und Historische Soziologie der Wirtschaft. Auch Jens Beckert, Rainer Diaz-Bone und Heiner Ganssmann (2007: 36) nennen ihn – wenn auch äussert knapp und einseitig – als einen Vertreter der Geldsoziologie, die „bis heute einen wichtigen Strang der Wirtschaftssoziologie dar(stellt) (...) – insbesondere in Deutschland findet sich hier eine grosse Stärke der Wirtschaftssoziologie (Baecker 2006 (...)“, wobei dann interessanter Weise aber gleich seine gesamte Wirtschaftssoziologie zitiert wird, in der Baecker den Märkten ein ganzes Kapitel gewidmet hat. In Geld und Arbeit zitiert Heiner Ganssmanns (1996) Baeckers Metamorphosen des Geldes (1993) und dessen Aufsatz Die Wirtschaft als selbstreferentielles soziales System (1994) von sowie Baeckers Doktorarbeit zu Information und Risiko in der Marktwirtschaft (1986), die auch Axel Paul (2006) in seinem Beitrag zu Luhmann in Jens Beckerts und Milan Zafirovskis (2006) International Encyclopedia of Economic Sociology zitiert. Baecker (2002) ist mit einem Beitrag zur Form der Zahlung im von Christoph Deutschmann (2002) herausgegebenen LeviathanSonderheft Die gesellschaftliche Macht des Geldes vertreten. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 119 Wissenschaft, in der Kunst, in der Religion und der Erziehung gibt“ (Baecker 2006: 127), und das, obwohl er – diesmal nahezu im gleichen Atemzug (ebd.: 45; 106) – Märkte als Netzwerke der Kommunikation von Knappheit und damit als eine konkrete Struktur der Wirtschaft verstanden wissen will. Dabei fällt auch auf, dass Baecker ähnlich, wie zuvor gezeigt Bourdieu (Markt und Feld), auf mitunter nicht immer ganz leicht nachvollziehbare Art und Weise zwei Begriffe übereinander legt, um einen davon genauer zu beschreiben. Das führt dann u.U. auch dazu, dass wir uns Märkte vielleicht gar als Öffentlichkeiten109 vorstellen, deren es ebenso viele – eben so viele wie Funktionssysteme – zu geben scheint wie Märkte: „Es gibt nicht nur eine Öffentlichkeit der Politik, sondern auch eine Öffentlichkeit des Sportes, der Religion, der Wirtschaft, ...“ (Baecker 2007: 81).110 Wir werden uns im folgenden Abschnitt, d.h. im Rahmen der Diskussion der Konzepte und der Argumente der Gegner wie der Befürworter der Idee nicht-ökonomischer Märkte, erneut mit Baeckers systemtheoretischer Wirtschaftssoziologie im Allgemeinen und seiner in Bezug auf unsere These unentschiedenen Marktsoziologie im Besonderen beschäftigen. An dieser Stelle soll uns ein erster Eindruck davon genügen, dass die Theorie sozialer Systeme die Idee nicht-ökonomischer Märkte weder zwingend ein- noch ausschliesst, und sich in diesem Sinne dem Anliegen dieser Arbeit als neutraler Diskursrahmen anbietet. Mögliche Einwände gegen die hiermit unterstellte wirtschaftssoziologische Neutralität der Theorie sozialer Systeme werden dabei reflektiert: Es „steht und fällt die Theorie eines funktionalen Teilsystems der Wirtschaft mit der Annahme, dass die Ausdifferenzierung der Wirtschaft zu einem autono109 Die Öffentlichkeit charakterisiert uns Baecker (2007: 80f) tatsächlich als „so etwas wie der ‚Markt’ der Politik, ein Terrain der Beobachtung weniger der politischen Entscheidungen selbst als vielmehr der steigenden oder sinkenden Möglichkeiten, für diese Entscheidungen machterhaltende Zustimmungen zu erhalten“. 110 An dieser Stelle drängt sich dann bereits die begriffsstutzig machende Frage auf, ob die Politik die Öffentlichkeit nicht ebenso kolonial besetzt hält wie die Wirtschaft den Markt, ob es sich also anders gesagt bei Markt und Öffentlichkeit wirklich um Begriffe handelt, die zwangslogisch und exklusiv je ‚ihrem’ Funktionssystem zugeordnet werden müssen. 120 Steffen Roth men System gesellschaftlich funktional ist. Auf diesen Punkt konzentriert sich daher die Kritik seitens anderer soziologischer Theorien und wirtschaftssoziologischer Ansätze an der funktionalistischen Position. Es wird ihr vorgeworfen, dass sie die Autonomie der Wirtschaft nicht nur untersucht, sondern auch mit ihr einverstanden ist und sich damit in der Auseinandersetzung der Wirtschaft mit der Gesellschaft auf die Seite der Wirtschaft schlägt (...). Diese Kritik lebt davon, zwischen Wirtschaft und Gesellschaft zu unterscheiden und innerhalb der Gesellschaft zwei Auffassungen von der Gesellschaft zu unterscheiden, deren eine auf eine kommunikative Verständigung über die Möglichkeiten menschlichen Lebens und deren andere auf eine strategische Sicherung und Ausbeutung klassenspezifischer Unterschiede zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft besteht“ Baecker 2008: 111). Baecker argumentiert im Folgenden (ebd. 113), dass sich (marxistisch unterlegte) Kritik und funktionalistisch-evolutionstheoretisch informierte Skepsis durch eine Reihe von Konvergenzpunkten auszeichnen, deren bedeutendster ist, dass beide die funktionale Ausdifferenzierung der Wirtschaft als eine „kritische Variable der Gesellschaft betrachten“111. Dem kann sich die vorliegende Arbeit nur anschliessen; sie betont aber auch vor diesem Hintergrund erneut, dass sich aus der Annahme einer funktionalen Autonomie der Wirtschaft keinerlei Argumente für oder gegen eine wie auch immer geartete Haltung zu Märkten ableiten lassen, eben weil Märkte nun einmal keine (rein) wirtschaftlichen Veranstaltungen sind. Im Folgenden wird daher in Auseinandersetzung mit dem wirtschaftssoziologischen Diskurs systematisch heraus zu arbeiten sein, welchen Unterschied die zunächst anti-evidente Idee nichtökonomischer Märkte macht und warum er sich lohnt. Der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit halber greifen wir in diesem Zusammenhang einen weiteren Gedanken Dirk Baeckers auf, der – 111 In diesem Zusammenhang betont Baecker ausdrücklich die Distanz zwischen neoliberalen und systemtheoretischen Konzepten der Wirtschaft (2008: 113): „(F)ür die funktionalistische Position ist das Wirtschaftssystem eine unwahrscheinliche, evolutionäre Errungenschaft, die im Zusammenhang einer ebenso unwahrscheinlichen Koevolution von Mensch und Gesellschaft steht und von der angesichts der ökologischen Folgeschäden unklar ist, wie lange sie gehalten werden kann“ (ebd.). In eben diesem Sinne begreift Baecker die systemtheoretische Position nicht als wirtschaftsaffin, sondern als wirtschaftsskeptisch. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 121 hier gemünzt auf den vergleichsweise niedrigen Stellenwert des (wirtschafts-) soziologischen Theorieangebots – eine Schwachstelle der Soziologie in deren allzu geringer Formalisierung ausmacht: „Wenn man sich anschaut, dass es in den Naturwissenschaften, aber auch in den Wirtschaftswissenschaften gelungen ist, kontraintuitiv arbeitende Ansätze mithilfe ihrer Mathematisierung gegenüber Anschaulichkeitsbedürfnissen des Publikums der Wissenschaft zu immunisieren, so muss man wohl auch eine mangelnde Mathematisierung zu den Schwächen des hier vorgestellten Ansatzes zählen. Dies erstaunt umso mehr, als der Funktionsbegriff letztlich aus der Mathematik kommt und auch der Systembegriff mathematisch bereits vielfältig interpretiert wurde. “ (Baecker 2008: 117f). In diesem Sinne leistet die Arbeit im nächsten Abschnitt einen bescheidenen Beitrag an die systemtheoretisch informierte Mathematisierung der Wirtschaftssoziologie, ein Abenteuer, an dem ihr im Grunde wenig gelegen wäre, wenn es sich nicht als recht nützlich für den Zweck der Sortierung der äussert kontrovers und mitunter wenig konsistent gehandelten Verhältnisse zwischen zentralen (wirtschafts-) soziologischen Konzepten herausstellen würde. Da das Anliegen damit ein taxonomisches ist, liegt der Rückgriff auf das Begriffs- und Aussagensystem der Mengenlehre im Folgenden nahe; zudem lassen sich mit Hilfe der Mengenlehre die verschiedensten Einbettungsverhältnisse bildlich und förmlich nachvollziehbar darstellen und diskutieren. Marktkalkül und Mengenlehre Der Idee einer mathematischen Formalisierung nun auch des wirtschaftssoziologischen Diskurses kann man durchaus skeptisch gegenüberstehen, gerade auch weil der Kurzschluss zwischen Wirtschaft(swissenschaft) und Mathematik nicht nur Wirtschaftssoziologen, sondern bereits recht früh auch dem Hardcore der Ökonomik unangenehm aufgefallen ist: „Year after year economic theorists continue to produce scores of mathematical models and to explore in great detail their formal properties; and the eco- 122 Steffen Roth nometricians fit algebraic functions of all possible shapes to essentially the same set of data (Leontief 1982: 104). Auch Roland Coase (1999: 2) zufolge ist die Ökonomik „a theoretical (meaning mathematical) system which floats in the air and which bears little relation to what happens in the real world“; und sogar Milton Friedman (1999: 137) bezeichnet seine Disziplin mittlerweile als einen obskuren Zweig der Mathematik. Den Wirtschaftssoziologen mag die damit einhergehende (Rück-) Besinnung auf eine Real World Economics (Fullbrook 2007) durchaus (selbst-) zufrieden stimmen, obwohl ausser Zweifel steht, dass auch und gerade Wirtschaftssoziologen ihren Teil zur Aufrechterhaltung der engen Wahlverwandtschaft zwischen Mathematik und Ökonomik beitragen: Bereits Max Weber (1980: 384) stellt uns „den Marktmechanismus mit seinem Feilschen und vor allem mit seiner rationalen Kalkulation“ vor. Seither gilt nahezu einhellig: Wer auf dem Markt agiert – und damit eben automatisch Wirtschaft betreibt – rechnet entlang „der individuellen Kosten-Nutzen-Kalkulation der Marktlogik“ (Guggenberger 2007: 173) und gilt damit als berechnend, d.h. als verdächtig, auf Erfolg aus zu sein und nicht auf Verständigung (Habermas 1981). Und selbst wer beeindruckt durch mehr als eine Kritik der ökonomischen Vernunft (Gorz 1989) dieser „angeblichen Marktlogik“ (Hillebrandt 2007: 293) nicht mehr auf den Leim gehen will, konfrontiert diese mit der Idee, dass alle „Formen des Tausches (...), entgegen der Vorstellung neoklassischer Wirtschafts- und Markttheorien, eng an die praktische Konstitution und Reproduktion dauerhafter Sozialbeziehungen gekoppelt (sind), die sich nicht unter die Logik der Kalkulation subsumieren lassen“ (ebd.: 294). Wieder ist (nur) Wirtschaft Kalkulation112. Auch bei Pierre Bourdieu (1997c: 178) lesen wir, dass Kalkül und strategische Vernunft im ökonomischen Feld in besonders starkem Masse anzutreffen sind, was hier allerdings eben genauso bedeutet: nicht nur dort. Wie wir nicht nur von Bourdieu wissen, investieren wir vor allem auch Zeit, nicht nur Geld in Beziehungen und damit (in) soziales Kapital, und tun dies 112 So lesen wir auch bei Luhmann (1988: 28): „Man stelle sich dieses Wirtschaftssystem als Umwelt kalkulierender Unternehmen vor“. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 123 vor einem Horizont von Alternativen, angesichts dessen wir weder mehr oder weniger ‚rational’ als im ökonomischen Kontext abwägen, welche Investition sich lohnt und welche nicht. Das gilt auch für kulturelles oder spirituelles Kapital (Verter 2003). Hier treffen wir mit Bourdieu dann auch auf Dirk Baecker: „Deswegen sagen wir nicht, dass Gott nicht rechnet, sondern wir sagen, dass er anders rechnet“ (Baecker 2008b: 4; vgl. auch Baecker 2004); und: „Nicht nur Gott, auch die Wissenschaft rechnet anders. Die Wissenschaft entwickelt einen allgemeinen Begriff des Rechnens, unter den die besonderen Fälle des ökonomischen, des religiösen, des politischen oder des wissenschaftlichen Rechnens fallen, ohne dass das eine oder das andere Phänomen aus der Welt des Rechnens heraus fällt (...). Genau darin steckt dann wiederum eine Zumutung, die dazu führen kann, dass der eine oder andere sich auf diese Art von Wissenschaft nicht einlässt, sondern sich lieber an das Rechnen der Wirtschaft oder an das Rechnen der Religion und das eine wie das andere für so besonders hält, dass alles andere in der Welt nicht unter den Begriff des Rechnens, sondern etwa des Bestands oder der bloßen Wirklichkeit fällt, was immer darunter dann verstanden wird. Für die Wissenschaft gibt es hingegen in der Welt nur Dinge, die rechnen, auch wenn sie jeweils anders rechnen“. Das gilt zumindest und umso mehr dann, wenn die Dinge, mit denen sich Wissenschaft beschäftigt, soziale sind. Unser allgemeiner Begriff des Rechnens bezieht im Folgenden grundlegende Aussagen der Theorie sozialer Systeme auf das Aussagensystem der Mengenlehre. Hierfür lassen sich augenzwinkernd rein definitorische Gründe ausmachen113, im Eigentlichen aber die beiden folgenden: Zum einen erlaubt die Mengenlehre einen mathematischen Zugang zum Markt, der ohne Zahlen, und damit ohne mitunter allzu naheliegende Assoziation mit Zahlungen auskommen kann. Dieser Umstand erleichtert den Gedanken an nicht-ökonomische Märkte ohne dessen Richtigkeit zu postulieren. 113 „Markets emerge as soon as signals are reproduced and interpreted with respect to qualities and volumes of products or services, actions or events supplied and demanded“ (Baecker 2006b: 333, Herv. d. A.). Markttheorie ist demnach ganz sprichwörtlich immer auch Mengenlehre. 124 Steffen Roth Zum anderen hält die Mengenlehre mit den Begriffen der Elemente, der Teilmenge, der Menge und der Obermenge Konzepte bereit, deren Nutzen für die Formalisierung und Visualisierung des wirtschaftssoziologischen Diskurses, der sich massgeblich über die Diskussion unterschiedlicher Formen der sozialen Einbettung von Märkten definiert, kaum offensichtlicher sein könnte: Die Frage, woraus Märkte je nach Autor bestehen (Elemente, Teilmengen) und, wesentlich spannender, in welche Kontexte (Obermengen) sie eingebettet sind, lässt sich auf Grundlage der Mengenlehre sehr plastisch vergleichend diskutieren. In gleichem Masse kommt die Mengenlehre dabei dem Anliegen dieser Arbeit entgegen, der es um die Prüfung einer These geht, die die Möglichkeit einer sprichwörtlichen Aus-Differenzierung der Marktsoziologie aus der Wirtschaftssoziologie behandelt. Wie jede systemtheoretische Analyse nimmt auch diese systemtheoretische Reformulierung der Mengenlehre und die darauf aufbauende Systematisierung des wirtschaftssoziologischen Diskurses ihren Ausgangspunkt in der Differenz von System und Umwelt114: „Systeme sind (...) strukturell an ihrer Umwelt orientiert und können ohne Umwelt nicht bestehen. Sie konstituieren und sie erhalten sich durch Erzeugung und Erhaltung einer Differenz zur Umwelt, und sie benutzen ihre Grenzen zur Regulierung dieser Differenz. (...) In diesem Sinne ist Grenzerhaltung (...) Systemerhaltung“ (Luhmann 1984: 35). Kein System also ohne Umwelt, die damit „ihre Einheit erst durch das System und relativ zum System“ (ebd. 36) erhält. Dieser Umstand lässt sich mengentheoretisch unterstützt wie folgt darstellen (vgl. Abb. 2): Die Beobachtung eines Systems, in unserem Fall also die Bildung der Menge A, verweist als Grenzziehung automatisch auf einen Bereich jenseits der Grenze, der mit diesem System nichtidentisch ist, also auf dessen Umwelt, mit anderen Worten: die Kom114 „Als Ausgangspunkt jeder systemtheoretischen Analyse hat, darüber besteht heute wohl fachlicher Konsens, die Differenz von System und Umwelt zu dienen“ (Luhmann 1984: 35). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 125 plementär-Menge A’, die alles umfasst, was nicht dem System Menge A angehört. Die Einheit der Differenz beider Mengen bezeichnet Luhmann (ebd. 105) als Welt, den „Letzthorizont allen Sinnes“. Die so definierte Welt ist demnach die finale Obermenge B der Systemtheorie, „also eine unnegierbare, eine differenzlose Kategorie“ (ebd. 95). Dabei gilt es zu beachten, dass die Theorie sozialer Systeme die Welt nicht a priori als gegeben, sondern als vom System konstruiert betrachtet: Erst die Beobachtung der Unterscheidung (eines Systems) zwischen System und Umwelt ermöglicht die Beobachtung einer systemspezifischen Form der Einheit der Differenz von System und Umwelt. Das System ist demnach Teilmenge einer Welt, die es selbst erfunden hat. Auch lässt sich damit vorstellen, dass die Umwelt des Systems ihrerseits so lange kein System ist, wie sie nicht als eigenständige Menge betrachtet und in diesem Sinne das Ausgangssystem zur Umwelt des nun im zweiten Schritt beobachteten Systems macht, also die Verhältnisse von Menge und Komplementärmenge auf den Kopf stellt. 126 Steffen Roth Bereits an dieser Stelle ist der streng relationale Charakter der Theorie sozialer Systeme nicht zu übersehen. Als Sonderfall einer Menge besteht ein System daher auch nicht aus einer Menge von Elementen, sondern aus einer Menge von Teil- und Komplementärmengen, die zueinander in Beziehung stehen115. In diesem Sinne gilt es nun auch das Verhältnis von Menge und Teilmenge systemtheoretisch zu formulieren: „Die Differenz von System und Umwelt zwingt als Paradigma dazu, die Differenz von Ganzem und Teil durch eine Theorie der Systemdifferenzierung zu ersetzten. Systemdifferenzierung ist nichts weiter als die Wiederholung der Systembildung in Systemen. Innerhalb von Systemen kann es zur Ausdifferenzierung weiterer System/Umwelt-Differenzen kommen. Das Gesamtsystem gewinnt damit die Funktion einer ‚internen Umwelt’ für die Teilsysteme, und zwar für jedes Teilsystem in spezifischer Weise. (...) Jede Differenz von Teilsystem und interner Umwelt ist wiederum das Gesamtsystem – aber dies in je verschiedener Weise“ (ebd. 37f). Im Folgenden diskutieren wir diese Idee mengentheoretisch, indem wir die Gesellschaft als System, d.h. also als eine Menge vorstellen, die aus mindestens zwei Teilmengen besteht, die wir zueinander in Relation stellen können (vgl. Abb. 3). Da wir uns im Folgenden mit 115 „Ein Minimalfall von System ist demnach eine blosse Menge von Relationen zwischen Elementen“ (Luhmann 1984: 44); eine Seite später lesen wir in ähnlicher Formulierung: „Wir nehmen an, dass Systeme mindestens Mengen von Relationen zwischen Elementen sein müssen, dass sie sich aber typisch durch weitere Konditionieren und damit durch höhere Komplexität auszeichnen“. In diesem Sinne argumentiert Jean Clam (2001: 226) unseres Erachtens nach etwas vorschnell gegen die Mengenlehre: „Im Zentrum dieser neuen Geometrien stehen Relationen und nicht Elemente oder Mengen, höhere Funktionen und nicht Sachen oder festgegebene Strukturen“. Zum einen lässt sich, das zeigen die eben genannten Formulierungen Luhmanns, der Mengenbegriff auch post-ontologisch im Wort führen. Zum anderen gilt (damit), dass sich aus der Zugehörigkeit einer Reihe von (Teil-)Mengen zu einer Obermenge noch wenig bis gar nichts über deren Relation zueinander ableiten lässt. In jedem Fall reagieren wir auf den gemeinsamen Nenner der Aussagen beider Autoren und betreiben im Folgenden eine Mengenlehre, die auf den Begriff des Elements verzichtet, und das auch wenn auffällt, dass Luhmann (1988: 17) den Begriff der Elemente oder der Letztelemente regelmässig verwendet, etwa eben mit Blick auf Wirtschaft: „Als Letztelement eines solchen Wirtschaftssystems haben Zahlungen besondere Eigenschaften“. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 127 der Soziologie der Wirtschaft auseinander setzen, was – wie bereits im vorangegangenen Kapital gezeigt – in gleich zweifacher Hinsicht auf funktionalen Differenzierung von Gesellschaft verweist, haben wir als Beispiele für gesellschaftliche Teilmengen naheliegender Weise das Wirtschafts- und das Wissenschaftssystem gewählt (vgl. Abb. 3). In beiden Fällen handelt es sich dabei um Kommunikationssysteme, also um gesellschaftliche Teilmengen, die ihrerseits wieder aus Relationen bestehen. Anders als das Wirtschaftssystem reproduziert sich das Wissenschaftssystem aber nicht über den Anschluss von Zahlungen an Zahlungen (Luhmann 1988: 17), sondern über Wahrheitskommunikation. Der Code des Wissenschaftssystems lautet entsprechend: wahr|unwahr. „Immer wenn mit Hilfe eines solchen binären Codes Beobachten beobachtet wird, ordnet die entsprechende Operation sich dem durch sie erzeugten System Wissenschaft zu“ (Luhmann 1990: 174). 128 Steffen Roth Umgekehrt bedeutet das, dass alle Kommunikation, die nicht entlang des Codes wahr|unwahr verläuft und damit entsprechend nicht der Teilmenge S zugeordnet werden kann, der Komplementärmenge der Wissenschaft (S’) zugeordnet werden muss. Die Gesellschaft, d.h. die Menge aller Kommunikationen lässt sich aus Sicht der Wissenschaft demnach als Einheit der Differenz von S|S’ beschreiben. In diesem Sinne sprechen wir von der Gesellschaft der Wissenschaft (GdS), die von der Gesellschaft der Wirtschaft (GdW) eindeutig zu unterscheiden ist, die sich als Einheit der Differenz von W|W’ beschreibt: Während in der Gesellschaftsbeschreibung der Wirtschaft die Wissenschaft (nur) im Sinne einer Teilmenge der eigenen kommunikativen Umwelt (S ⊂ W’)116 beobachtet werden kann, kommt die Wissenschaft in ihrer eigenen Umwelt selbstverständlich nicht vor; statt dessen gilt: W ⊂ S’. Beide Teilsysteme befinden sich damit in jeweils ganz anderer Gesellschaft, und entwerfen daher ein gänzlich anderes Gesellschaftsbild, auch wenn sie Teilmengen der selben Gesellschaft sind. Die Gesellschaft der Gesellschaft (GdG), also die gesellschaftliche Selbstbeschreibung, ist demnach auch als Einheit der Differenz von Systemen und deren Umwelten nicht durch eine einheitliche, sondern durch unterschiedlichste gesellschaftliche Selbstbeschreibung(en) gekennzeichnet117. Indem wir uns im Folgenden den Marktbegriffen der der Wirtschaftssoziologie zuwenden, beobachten wir nicht Märkte im Sinne spezifischer wirtschaftlicher Ereignisse, sondern Beobachtungen des Vollzugs von Wirtschaft entlang des Codes wahr|unwahr und damit Ereignisse im System der Wissenschaft. In diesem Sinne gilt: Die Märkte der Wirtschaftssoziologie sind keine Teilmengen der Kommunikation des Wirtschaftssystems, sondern der Kommunikation der 116 Für eine Erläuterung der Formelsprache der Mengenlehre siehe das Abbildungsverzeichnis im Annex der Arbeit. 117 Vor dem Hintergrund einer Reihe weiterer Funktionssysteme, sowie angesichts der umfangreichen Möglichkeiten, jenseits des Schemas funktionaler Differenzierung zu differenzieren, entwickelt sich so bereits nach wenigen Worten ein gleichermassen überkomplexes wie ein – in Form von je erkenntnisinteressespezifischen Ausschnitten – durchaus systematisch beobachtbares Bild von Gesellschaft. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 129 Wissenschaft. Oder kurz gesagt: Wissenschaft betreibt auch dann keine Wirtschaft, wenn sie von ökonomischen Märkten spricht118. Wenn wir also im folgenden von Märkten sprechen, dann sprechen wir von den Märkten der Wirtschaftssoziologie oder allenfalls noch denen der Ökonomik. Diese Märkte betrachten wir demnach allesamt als reine Modelle; anders als das performative Paradigma geht es uns mit diesem Hinweis dann aber gerade nicht um den Einfluss, den diese wissenschaftlichen Modelle auf die wie auch immer vorgestellte reale Ökonomie haben, sondern einzig darum, deren logische Konsistenz vor allem im Hinblick auf die bislang geläufige Idee der rein ökonomischen Märkte zu prüfen, und damit auch im Hinblick auf die Idee von der Marktsoziologie als Teilmenge der Wirtschaftssoziologie (MS ⊂ WS), die nur dann Sinn macht, wenn es sich bei den Märkten der Wirtschaftssoziologie um rein wirtschaftliche Phänomene handelt. Die Kernfigur des konventionellen Marktbildes lautet demnach (vgl. Abb. 4): 118 In diesem Sinne gilt im Vorgriff auf die Auseinandersetzung mit dem performativen Paradigma (Callon 1998): Wirtschaftswissenschaftler performen möglicher Weise ökonomische Märkte, sie performen – in Ihrer Funktion als Wissenschaftler – dabei aber nicht in ökonomischen Märkten. 130 Steffen Roth Der Markt ist eine Teilmenge der Wirtschaft (M ⊂ W). Wenn der Markt also in diesem Sinne ein „central economic phenomenon“ (Zafirovski 2003: 38; vgl. auch Beckert 2007, 2009; Beckert und Aspers 2008) und nur ein ökonomisches Phänomen sein soll, dann kann der Markt als Teilmenge der Menge Wirtschaft (W) keine Schnittmenge mit der Komplementärmenge der Umwelt der Wirtschaft (W’)119 aufweisen; in diesem Sinne gilt also M ⊂ W = (M ∩ W’ = Ø). M ∩ W’ = Ø ist demnach die notwendige Komplementärbedingung einer logischen Aussage über den rein ökonomischen Charakter von Märkten. An dieser Stelle deuten sich bereits an, dass man Märkte (M) zunächst auf zwei Wegen als soziale Strukturen, Institutionen oder Systeme beschreiben und damit sozial einbetten kann: Zum einen besteht die Möglichkeit, Wirtschaft ihrerseits sozial zu denken, etwa indem man der Menge Wirtschaft (W) eine soziale Obermenge (X) zuordnet und sich Wirtschaft so als Teilsystem der Gesellschaft vorstellt. Als Teilmenge der damit sozialen Menge W lassen sich Märkte dann ihrerseits gar nicht anders als sozial denken, während weiterhin gelten kann: M ⊂ W. Der ökonomische Markt wäre somit gesellschaftlich eingebettet, womit sich aus einer solchen Perspektive auch nicht ohne weiteres erschliesst, was mit der Forderung nach der sozialen Einbettung von Märkten anderes erreicht werden kann als die Beschreibung eines Gemeinplatzes: Auch Wirtschaft ist Gesellschaft! Ja, und? In diesem Sinne stellt sich dann auch an dieser Stelle wieder die Frage, was soziale Einbettung von Märkten im konkreten Fall heissen soll? Politische, religiöse, wissenschaftlichen Einbettung? Zudem stellt sich auch die Frage, warum der Markt (M) denn in der nicht-wirtschaftlichen Umwelt (W’) besser aufgehoben sein sollte als in der Wirtschaft, zumal dann, wenn doch dem allgemeinen Konsens folgend weiterhin M ⊂ W gelten, es sich beim Markt also nach wie vor um eine Teilmenge der Wirtschaft handeln soll? Zudem: Wie soll man sich das vorstellen, wenn eine Teilmenge der Komplementärmenge der Wirtschaft W’ den Markt einbettet, der dabei aber weiterhin ein rein wirtschaftlicher und damit eine exklusive Teilmenge von W bleibt? Gar nicht. Die Einbettung 119 Also der nicht-ökonomischen Mengen der Obermenge X (X\W). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 131 wirtschaftlicher Märkte kann vor diesem Hintergrund nicht anders funktionieren denn als Selbsteinbettung der Wirtschaft; was in den meisten wirtschaftssoziologischen Ohren neoliberal bis systemtheoretisch klingt, und damit als wirtschaftsaffirmativ oder allenfalls als lediglich skeptisch, will heissen: zu wenig kritisch. Zum anderen bleibt dem, der sich in diesem allzu deskriptiven Konzept der sozialen Einbettung von Märkten nicht wiederfindet, als kritische Alternative, Märkte zuerst (zumindest teilweise) aus der – eben nicht sozial gedachten – Wirtschaft herauszudenken, bevor man sie dann in der Umwelt der Wirtschaft (W’) und in diesem Sinne sozial einbettet. Für diese dann in – die Ökonomie transzendierenden – Netzwerken, Kulturen und Gesellschaftsbereichen verankerten Märkte gilt dann allerdings zwangsläufig: M ∩ W’ bzw. M ⊂ W’ = M ⊄ W, woraus für Strategien der sozialen Einbettung von Märkten im Erfolgsfall folgt: Entweder erzeugen sie genau das, was sie zu bekämpfen vorgeben: die Verlagerung des – gemeinhin als unveränderlich wirtschaftlich geltenden – Marktprinzips in die nichtökonomische(n Teilbereiche der) Gesellschaft. Als Direktimport ökonomischer (Markt-) Kommunikation etwa ins politische System ist ein solcher Vorgang allerdings nicht nur systemtheoretisch schlichtweg nicht denkbar, was sich auch mengentheoretisch darstellen lässt: Wenn wir uns das Wirtschaftssystem als Menge von Zahlen-Relationen und das politische System als Menge von Buchstaben-Relationen vorstellen, dann zeigt sich rasch, dass der Import einer Zahl den Charakter der Buchstabenmenge fundamental verändern würde: Sie wäre schlicht keine Buchstabenmenge mehr, aber auch keine Zahlenmenge, sondern etwas Drittes. Entsprechend lassen sich auch keine „fünf Grade der Ökonomisierung unterscheiden“ (Schimanck und Volkmann 2008: 385). In der Politik gibt es nur Politik, andernfalls gibt es keine Politik. Will man die Vermarktlichung der Politik also nicht als deren abruptes Ende gedacht wissen, dann lässt sie sich nicht länger als Im- und Export ökonomischer Kolonialwaren interpretieren, sondern nur als Politik-internen Vorgang; glei- 132 Steffen Roth ches gilt für andere Teilbereiche der Gesellschaft. Wenn man also mit kritischem Augenmerk die zunehmende Relevanz marktlicher Prinzipien in der Politik, wie weiteren nichtökonomischen Sphären der Gesellschaft beobachtet, dann beobachtet man nicht-ökonomische Märkte, für die die Ökonomik dann ebenso wenig (und schon gar nicht exklusiv) zuständig ist wie die Wirtschaftssoziologie120; Oder die soziale Einbettung bewirkt die fortschreitende Sozialisierung des ehedem rein wirtschaftlich gedachten Marktes, etwa dergestalt, dass man geläufigen kritischtheoretischen oder konservativen Linien der Kulturkritik folgend den Markt so lange als Verkörperung sozialer Machtbeziehung (vgl. Stehr 2007: 135) beschreibt, bis auch die entschiedensten Gegner des neoliberalen Marktmodells die Karriere des Marktes als Politikinstrument (Fourcade und Babb 2002) fördern. Diese Sozialisierung hätte dann zwar zur Folge, dass nicht von nicht-ökonomischen Märkten gesprochen werden kann, aber eben auch nicht länger von rein ökonomischen, sondern nur von einem trans-ökonomischen Markt der Gesellschaft, der in gewisser Weise dem Bild entspricht, dass wir uns von dem ganzen Markt der antiken Polis, der Agora, machen. Der wirtschaftssoziologische Diskurs pendelt aktuell zwischen den Optionen, und blendet dabei geflissentlich aus, dass die soziale Einbettung von Märkten der Idee M ⊂ W nur dann nicht widerspricht, wenn man sich die Wirtschaft ihrerseits als soziale Veranstaltung vorstellt, und das Plädoyer für soziale Einbettung von Märkten unter diesen Voraussetzungen nur dann nicht-trivial ist, wenn man höher auflöst, was genau nun mit sozial gemeint ist. In allen anderen Fällen gilt schlicht M ∩ W’ bzw. M ⊂ W’ = M ⊄ W. 120 Man beachte nicht ganz ohne Ironie, dass sich das anti-reduktionistische Argument nicht nur gegen die Ökonomik, sondern auch gegen die Wirtschaftssoziologie führen lässt. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 133 Dass diese Aussage ihrerseits nicht-trivial ist, ist dem Umstand geschuldet, dass das Gros der Wirtschaftssoziologen erhebliche Anstrengungen darauf verwendet, gleichzeitig die verschiedensten Varianten der sozialen Einbettung von Märkten zu besprechen und dabei sowohl die Idee nicht-ökonomischer Märkte als auch die Idee einer unhintergehbar gegebenen Sozialität der Wirtschaft ablehnen. Spannungen dieser Art treten im Diskurs immer wieder nicht nur zwischen, sondern auch in den Werken der einzelnen Autoren auf: Bereits Parsons schiebt den Marktbegriff an die Grenzen der Ökonomie und darüber hinaus, ohne deshalb von der Idee der ökonomischen Märkte Abstand zu nehmen: „We will deal with four markets which link different sub-systems. At the goalattainment boundary of the economy we will treat the labour market and the market for consumers’ goods. At the adaptive boundary we will discuss the capital funds market and the market for ‚control of productivity’“ (Parsons und Smelser 2003: 146). Märkte stellen demnach zum einen ein Grenzphänomen der Wirtschaft („at the (...) boundary of the economy“) dar; entsprechend gilt: M ⊂ W. Gleichzeitig verbinden („which link different subsystems“) sie die Wirtschaft mit den nicht-wirtschaftlichen Subsystemen des sozialen Systems, etwa in Form von „double interchanges between the economy and the polity“ (ebd. 77), die zweifellos keinem der beiden Subsysteme allein zugerechnet werden können. In diesem Sinne gilt also auch M ∩ W’ = M ⊄ W! Diese Märkte gelten ihm aber schliesslich ‚nur’ als symbolische Märkte, d.h. sie sind „not in the usual sense a market“ (ebd.), da sie nicht hinreichend ökonomisch sind: „In many respects this interchange can scarcely be described as a market, since the role of direct economic sanctions is often unimportant (...). But as we shall see, this limitation upon short-term economic sanctions is at the centre of imperfection in this market“ (ebd. 162). Für welche Variante haben sich Parsons und Smelser hier letztlich entschieden? M ⊂ W oder M ⊄ W? Der Rezeption von Economy and Society entnehmen wir, dass letztlich M ⊂ W verstanden worden ist: Dementsprechend wird das Werk noch heute gedeutet und als Grundlagentext der Pax Parsonia gehandelt, der Ökonomik und der Soziologie ihre wohlgeschiedenen 134 Steffen Roth Plätze innerhalb der handlungstheoretischen Sozialtheorie ebenso zuweist, wie er es in Bezug auf die Ökonomie und – aufgemerkt – der Komplementärmenge der Ökonomie innerhalb der Gesellschaft tut121. Vor diesem Hintergrund verwundert dann aber – und darauf bezieht sich ‚aufgemerkt’ – wie sich seither hartnäckig die Einschätzung halten kann, dass die Pax Parsonia als Grund für die marginale Rolle der Wirtschaftssoziologie als Ergänzungswissenschaft der Ökonomik gehandelt werden kann: „Nicht zuletzt unter dem Einfluss dieser von Talcott Parsons gezogenen Trennlinie fristete die Wirtschaftssoziologie während der Nachkriegsjahre ein Schattendasein. Sie galt als Ergänzung der ökonomischen Theorie unter Anerkennung von deren Oberhoheit“ (Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 23)? Aus Parsons agiler Aufteilung des Sozialsystems folgt aber doch gerade, dass die Wirtschaft Teilmenge der Gesellschaft ist, also gilt: W ⊂ G. Zumindest handlungstheoretisch informierte Soziologen hätten aus diesem Verhältnis auch den Schluss ziehen können, dass sie nicht nur eingeladen sind, die Belange der Komplementärmenge der Wirtschaft122 ins Auge zu fassen, sondern auch die Einheit der Differenz der Unterscheidung von Wirtschaft und Nicht-Wirtschaft. Und auch wenn wir, wie durchaus nicht unüblich, die Komplementärmenge der Wirtschaft mit der Gesellschaft verwechseln, ist immer noch nicht logisch nachvollziehbar, warum Wirtschaftssoziologen sich in der Folge Parsons als Hilfswissenschaftler der Ökonomik erfanden123, hätte man der Gesellschaft doch auch und vor allem gesellschaftlich relevante Aspekte der Wirtschaft zutragen können, statt umgekehrt vornehmlich den Wirtschaftswis121 „Parsons came to develop a four sub-system model of the social system around four ‚tasks’ facing a social system in relation to its environment. These four subsystems (the GAIL system) were goal-attainment (the polity), adaptation (the economy), integration (cultural system of general values which is concerned with law and social control), and latency (the normative problem of motivation to fulfil positions in the social system” (Turner 1991: xvii). 122 Bei Parsons (1973: 231ff) die Politik, die gesellschaftlichen Institutionen und die Kultur. 123 „(E)conomic sociology constituated itself as the part of sociology that deals with the objects of economics, rather than economic objects broadly conceived“ (Fourcade 2007: 1017). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 135 senschaften wirtschaftliche relevante gesellschaftliche Randbedingungen. Wie bereits beschrieben beendet die Ökonomik die Selbstdemütigung der Wirtschaftssoziologie mit dem Bruch der Pax Parsonia. Die neue Strategie der Ökonomik lautet nun: Es gibt Märkte nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Rest der Gesellschaft, M ∩ W und M ∩ W’ also. Man hätte diesen ‚Angriff’ anders parieren können, als es Geschichte ist: Man hätte konzedieren können, dass es sich bei M ∩ W und M ∩ W’ um eine wahre Aussage handelt, aus der dann aber folgt: M ⊄ W; entsprechend seien die ökonomischen Marktmodelle im nicht-ökonomischen Kontext anpassungsbedürftig bzw. durch Konzepte nicht-ökonomischer Märkte zu ersetzten, was allein die Soziologie leisten könne. Man hätte das Argument der Ökonomie zu Ende denken können: M ⊂ G, also ein Aspekt von Gesellschaft, der unabhängig von der Unterscheidung W|W’ beobachtet werden kann; um so mehr würde dann gelten, dass Märkte ein Gegenstandsbereich der Soziologie seien. Statt die Preisgabe der Idee des rein wirtschaftlichen Marktes als Chance für die Soziologie zu erkennen, statt der Ökonomik also den Markt souverän aus der Hand zu nehmen, versteht die Wirtschaftssoziologie statt M ∩ W ∧ M ∩ W’ = M ⊄ W ‚Bahnhof’, nämlich M ⊂ W ⊂ W’ (der Ökonomik nach sollen ökonomische Marktprinzipien nun auch in nicht-ökonomischen Gesellschaftsbereichen gelten), und schickt im Gegenzug genau die gleiche Logik zurück: Die Ökonomik habe zu bedenken, dass Märkte Wirtschaft und nur Wirtschaft seien und zu bleiben hätten, sich also nicht zum Export in nichtökonomische Bereiche der Gesellschaft eignen und damit weiterhin M ⊂ W zu gelten habe. Gleichzeitig, sei zu begreifen, dass Märkte und Wirtschaft sozial eingebettet seien, was als Aussage nur dann Sinn macht, wenn man beide als nicht-sozial denkt, somit also auch M ⊂ W ⊄ G gelten kann. Entsprechend bleibt der Wirtschaftssoziologie dann nurmehr die Option, die Einbettung von Markt und Wirt- 136 Steffen Roth schaft in nicht-ökonomische Netzwerke, Strukturen, Institutionen oder Teilsysteme der Gesellschaft und damit in die Umwelt der Wirtschaft zu denken oder zu fordern, also ihre eigene Variante von M ⊂ W ⊂ W’ zu kolportieren. Im Rahmen ihres Scheingefechtes mit der Ökonomik fällt der Wirtschaftssoziologie also nichts anderes ein, als ihr eigenes Missverständnis vom Angriffsmanöver der Ökonomik zu kopieren. Sie bestätigt damit bis heute die Gültigkeit der Logik, die sie der Ökonomik als Akt des Kolonialismus unterstellt und der sie die Aufkündigung des Paronianischen Friedensvertrages zuschreibt. Nach wie vor ganz auf der Linie einer Hilfswissenschaft sichert die Wirtschaftssoziologie damit die Ökonomik und nicht zuletzt sich selbst ein deutungshoheitliches Monopol das betreffend ab, was beide Disziplinen für einen ihrer zentralsten Untersuchungsgegenstände halten: Den Markt. Der Soziologie als ganzer erweist sie damit allerdings einen Bärendienst, und sei es jenseits aller unterstellten Absichten nur aufgrund strategischer Schwächen, die bereits bei der Auswahl geeigneter Verbündeter augenscheinlich sind: So stehen der Ökonom Karl Polanyi und die von ihm eingeführte Variante der Embeddedness für denkbar ungeeignete Denkfiguren, wenn es darum geht, die Idee nicht-ökonomischer Märkte abzuwehren – liest sich der Kern von Polanyis Marktkritik doch wie folgt: „This institutional gadget, which became the dominant force in the economy – now justly described as a market economy – then gave rise to yet another, even more extreme development, namely as a whole society embedded in the mechanism of its own economy – a market society“. (Polanyi und Pearson 1977: 9). Polanyi argumentiert hier auf eine uns durchaus geläufige und zunächst nachvollziehbare Weise, dass der Markt das dominante Prinzip der Wirtschaft geworden ist, und im Zuge der Verbreitung des Marktprinzips in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen die Gesellschaft (G) mittlerweile eine Marktgesellschaft und damit vollständig ökonomisiert worden ist. Das liest sich geschmeidig, sieht in seiner mengentheoretischen Entsprechung allerdings so aus: Der Markt (M) ist eine Teilmenge der Wirtschaft (W) und deren Obermenge Gesellschaft („the mechanism of its own economy“, siehe erneut o.g. Zitat), entsprechend gilt M ⊂ W ⊂ G. Gleichzeitig gilt aber offenbar Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 137 auch: G ⊂ M ⊂ W („a whole society embedded in the mechanism of its own economy“, ebd.). Und da Polanyi Markt und Wirtschaft zudem – Zitat: billigermassen – synonym setzt, gilt darüber hinaus noch M ⊂ G ∧ G ⊂ M bzw. W ⊂ G ∧ G ⊂ W; zumal dann, wenn wir an anderer Stelle die Marktgesellschaft so definiert bekommen: „instead of the economy being embedded in social relations, social relations are embedded in the economy“ (Polanyi 1978: 57). Während wir weiter oben noch den Eindruck bekommen konnten, dass der Markt Teil der Gesellschaft und damit seinerseits sozial ist, lesen wir nun, dass es sich bei wirtschaftlichen Beziehungen nicht um soziale handelt, sondern um eine offenbar asoziale Menge, die ehedem Teilmenge der Menge sozialer Beziehungen war, nun aber umgekehrt zu deren Obermenge geworden ist. Damit haben wir eine Situation, in der eine nicht-soziale Menge (die Wirtschaft) eine soziale Teilmenge hat (die Gesellschaft) eingebettet, ohne dadurch eine soziale Menge zu sein oder zu werden, statt dessen drohe aber der umgekehrte Fall. Im Sinne des weiter oben bereits verwendeten Bildes gesprochen heisst das, dass eine Menge von Zahlen auch aus einer Teilmenge von Buchstaben besteht, wobei es die Buchstaben vor der endgültigen Verzahlung zu bewahren gilt124. Wenn wir schliesslich lesen: „a market economy can function only in a market society” (Polanyi 1978: 57, Herv. d. A.), dann gilt, dass sich eine Marktgesellschaft dadurch definiert, dass die Gesellschaft in einer Marktwirtschaft eingebettet ist, die ihrerseits nur funktioniert, wenn sie in einer Marktgesellschaft eingebettet ist. Ein Lied ohne Ende ... entsprechend bezeichnen wir die Polanyischen Gesetze in Bezug auf Ihre Aussagekraft über das Verhältnis von Markt, Wirtschaft und Gesellschaft als leere Menge. 124 „Polanyi speaks of the embeddedness of early economies within social relations, and a subsquent historic process of what might be called ‚disembedding’ culminating in nineteenth-century laissez faire. Little attempt ist made, however, to explain what general relations exist between society and economy during this process. The notion of the ‚protection’ of society from economic processes is not elaborated in theoretical terms such as might challenge the theoretical provenance of conventional economics on ist own intellectual ground. We are left insteand with some implicit notion of regulatory norms“ (Holton 1986: 93f). 138 Steffen Roth Anders als bei seinem Lehrer Harrison White (1981: 543), der wirtschaftliche Märkte unverblümt als soziale Strukturen bezeichnet und entsprechend von einer Einbettung vom Typ M ⊂ W ⊂ G ausgeht, sind wir auch bei Marc Granovetter (1990: 98) nicht recht sicher, wie es um das Verhältnis von Markt, Wirtschaft, Gesellschaft und Einbettung bestellt ist, wenn er davon ausgeht, dass wirtschaftliches Handeln samt seiner Resultate und Institutionalisierungsformen „affected by actors’ personal relations, and by the structure of the overall network of relations“ ist. Zweifellos nachvollziehbar ist hier der Gedanke, dass es ungemein gewinnbringend ist, singuläre Handlungen auch als in einem Netzwerk zeitlicher und sozialer Bezüge verankert zu betrachten: „(A) sophisticated account of economic action must consider its embeddedness in such structures“ (Granovetter 1985: 481). Die eigentlich spannende Frage ist dann aber die nach dem Verhältnis, nicht zwischen ökonomischem Handeln und Netzwerken sozialer Beziehungen, sondern dem zwischen den Beziehungen auf Märkten und den Beziehungen auf jenen Netzwerken. Wenn wir aus Granovetters eben zitiertem Aufsatz Getting a Job die Erkenntnis ziehen dürfen, dass der Weg auf der ökonomischen Karriereleiter des Arbeitsmarktes nicht selten über das soziale Netzwerk führt, dann stellt sich die Frage, ob das Netzwerk sozialer Beziehungen tatsächlich in dem Sinne die passende Obermenge für die Menge der ökonomischen Marktbeziehungen ist, so dass tatsächlich von einer Einbettung des Marktes und der Ökonomie in jenes Netzwerk die Rede sein kann? Damit ist das Problem angesprochen, dass eine logische Trennung von Marktbeziehungen und sozialem Netzwerk erstere als unsoziale Beziehungen charakterisiert, was erneut die Frage aufwirft, von welchem Begriff des Sozialen hier ausgegangen wird, die erneut zu der erstaunlichen Antwort führt, dass das Soziale auch hier von einem Theoretiker der sozialen Einbettung negativ, d.h. als Komplementärmenge (W’) und nicht als Obermenge der Wirtschaft definiert wird. Diesen Umstand kann man daran erkennen, dass wir uns leicht vorstellen können, dass man durch ein gutes soziales Netzwerk leichter und bessere Jobs bekommen kann, sondern eben auch durch einen guten Job ein besseres Netzwerk; in diesem Sinne liest sich also auch das Embeddedness-Konzept von Granovetter M Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 139 ⊂ W ⊂ W’: auch hier soll man das Unmögliche erkennen, nämlich dass das Netzwerk ökonomischer Beziehungen in das Netzwerk sozialer, d.h. nicht ökonomischer, Beziehungen eingebettet ist; oder man erwägt, dass Märkte vielleicht doch Netzwerke aus ökonomischen und aus nicht-ökonomischen Beziehungen sind (M ∩ W ∧ M ∩ W’). Für die Vertreter des soziologischen Institutionalismus (Zelizer 1978, 1988, 1997; DiMaggio und Powell 1983, 1991; Dobbin 1994; Fligstein 2001) ist M ∩ W ∧ M ∩ W’ ein beinahe schon alltäglicher Gedanke: „Organizations compete, not only for resources and customers, but for political power and institutional legitimacy which socially rather than economically demonstrate fitness“ (DiMaggio und Powel 1983: 10). Diese trans-ökonomische Form der Konkurrenz findet in Arenen, Feldern, Sektoren oder anderen Einheiten sozialräumlicher Gliederung statt. In diesem Sinne fokussiert der Institutionalismus zunächst ein Segment der Gesellschaft, in dem er dann das Wirken der unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Kräfte beobachtet. Das gilt auch für den Markt: „Markets are social constructions that reflect the unique political-cultural construction of their firms and nations. The creation of markets implies societal solutions to the problems of property rights, governance structures, conceptions of control, and rules of exchange“ (Fligstein 2002: 97). Ganz explizit spricht man in diesem Zusammenhang also nicht nur von Markets as Politics (Fligstein 2002b), sondern eben auch von rechtlichen und weiteren Formen der Einbettung, die sich mit Sharon Zukin und Paul DiMaggio (1990: 14ff) den vier Kategorien der sozialen, der kulturellen, der politischen und der kognitiven Einbettung zuordnen liessen. Indem wir den Blick nun wieder über den Institutionalismus hinaus weiten, fallen überraschende Trends ins Auge: Wir erkennen, dass es in der Wirtschaftssoziologie alles andere als unüblich ist, Märkte als Politik zu denken, es in der Wirtschaftssoziologie also eine Tradition des M ∩ W ∧ M ∩ W’ gibt, deren Konsequenz M ⊄ W allerdings bestenfalls unterschwellig mitgeführt oder ganz ausgeblendet wird. Ein gu- 140 Steffen Roth tes Beispiel für die Gleichzeitigkeit beider Sachverhalte ist Jens Beckert (2007: 43, 61), für den gilt: „Märkte sind die zentrale Institution kapitalistischer Ökonomien“ und „Teil der politischen, moralischen und kulturellen Ordnung von Gesellschaften“. Mit anderen Zeichen: M ⊂ W ∧ M ⊂ W’. Zweifellos lässt sich Beckert eine gewisse Nähe zum Institutionalismus nachsagen, allerdings lassen sich – wie bereits im Abschnitt Die vielen Märkte der neuen Wirtschaftssoziologie ausgeführt – die Aussagen einer ganzen Reihe namhafter Wirtschaftssoziologen auf die gleiche Formel bringen. Daneben lässt sich ein Trend zur Mehrfach-Einbettung von Märkten bzw. zur Ausdifferenzierung des entsprechenden Einbettungsbegriffes beobachten, der bereits mit Weber beginnt125; die Dimensionen der Einbettung von Sharon Zukin und Paul DiMaggio (1990: 14ff) sowie Jens Beckert (2007: 61) sind eben angesprochen worden; auch Christoph Deutschmann (2007: 87) weiss den Markt in „Normen und Institutionen; Tradition, Gewohnheit und Routine; strukturelle(n) Prädispositionen: soziale(n) Netzwerken(n), Organisationen und Pfadabhängigkeit; Macht“ verankert. Schliesslich scheint die mit ungebrochener Intensität geführte Diskussion um den Terror der Ökonomie (Forrester 1998), die kaum mehr erkennbaren Grenzen der Marktlogik (Zelizer 1988; Rychner 2006) sowie die Konjunktur des Marktfundamentalismus (Soros 1998; Sawyer 2000), des ökonomischen Kolonialismus (Swedberg 1990) und des Methodenimperialismus (Boulding 1976; Lazear 2000) anzuzeigen, in wie vielen nichtökonomischen Nischen sich der Markt schon eingenistet, oder soll man sagen: eingebettet hat. 125 „Sehr oft wird der Marktfrieden unter den Schutz eines Tempels gestellt, weiterhin pflegt aber dieser Friedensschutz vom Häuptling oder Fürsten zu einer Gebührenquelle. Der Tausch ist die spezifisch friedliche Form der Gewinnung ökonomischer Macht“ (Weber 1980: 385). Der Tausch ist hier gleichermassen Wirtschaft und Politik, der Markt ebenso politisch wie religiös eingebettet. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 141 Zudem fallen die Unterschiede der Abstraktionsniveaus der einzelnen Dimensionen von Einbettung, sowie deren mitunter unzureichende Moderation auf, etwa dann, wenn eben von der sozialen, der kulturellen, der politischen und der kognitiven Einbettung die Rede ist (Zukin und DiMaggio 1990: 14ff), und man sich so fragen muss, ob neben der Wirtschaft nun auch die Politik kein soziales Phänomen darstellt. Auch stellt sich die Frage, ob Spekulationen über die kognitive Einbettung von Märkten tatsächlich noch zum Gegenstandsbereich der Soziologie gehören; damit korrespondieren dann auch die Forderungen nach einer angemessenen interdisziplinären Anbindung (Beckert 2007b: 15) und einer stärkeren gesellschaftstheoretischen Verankerung (Beckert und Swedberg 2001; Zafirovski 2003; Schluchter 2007) der Wirtschaftssoziologie. Weiterhin verlässt der Diskurs immer wieder die Untiefen wissenschaftlicher Argumentation, um sich nicht ohne Genuss im Reich der offenbar sorglos formulierbaren Fragen des empörten Anstandes und des guten Geschmacks zu verirren, etwa in der Auseinandersetzung mit Gary Beckers Idee von Märkten für Adoptivkinder: „Becker (...) was again sloppy in his use of market language. In some modern societies, babies may be adopted, in return for payment. Becker wrote of babies being sold, when in fact what is involved is the sale of parental rights. However as Richard Posner (...) rightly pointed out: ‚The term baby selling, while inevitable, is misleading. A mother who surrenders her parental rights for a fee is not selling her baby; babies are not chattels, and cannot be bought and sold. She is selling her parental rights’. A reckless and imprecise use of terms, along with a neglect of cultural and institutional realities of market economies – especially by those that claim to pursue and admire precision and rigour as well as explanatory scope – combines both tragedy and farce“ (Hodgson 2001: 253). Delikat an diesem Zitat ist nicht nur der Vergleich zwischen Kindern und Rin- 142 Steffen Roth dern, der die Frage nach sich zieht, warum man nicht auch bei Rindern ebenso spitzfindig sein und davon ausgehen sollte, dass auch hier nicht Rinder verkauft werden, sondern lediglich Melk- und Schlachtrechte; alles andere wäre aus tierrechtlicher Perspektive seinerseits Tragödie und Farce zugleich. Viel mehr verblüfft allerdings, dass der Kauf und Verkauf von Erziehungsrechten auch von Kritikern des ökonomischen Imperialismus relativ problemlos diskutiert wird, der Kauf und Verkauf von Rechten also als das Wesen der Wirtschaft angesehen wird (Beckert 2009: 4)126, während der Kauf und Verkauf von Macht127 als Korruption und damit als – auch theoretisch – gänzlich illegitimer Übergriff des Wirtschaftssystems interpretiert würde. Es scheint, als wüsste man immer ganz genau, was kommodifiziert werden darf, und was nicht. Glücklicher Weise zeigen Wirtschaftssoziologen allerdings auch, dass derartige Moralurteilskonstellationen durchaus dem Wandel unterliegen: In ihrer Arbeit über die Marktdurchsetzung des Prinzips Lebensversicherung stellte Viviane Zelizer (1978) ein eindrucksvolles Beispiel für durchaus wirksame Formen der religiösen Markteinbettung, die sich mit einer Ablehnung der Kommodifizierung des menschlichen Lebens begründeten, wie sie durch den Abschluß einer Lebensversicherung gegeben sei. Im Zusammenhang mit dieser Wette aufs Leben wurden gar „Vorstellungen eines magischen Zusammenhangs zwischen dem geldmässigen Versichern des Lebens und dem dadurch eventuell heraufbeschworenen Verlust des Lebens“ (Mikl-Horke 2008: 204) kultiviert. Gleichzeitig lassen sich am Beispiel auch weniger erfolgreiche Versuche der politischen Einbettung beo- 126 „Markets (...) provide a social structure and institutional order for the voluntary exchange of rights in goods and services, which allow actors to evaluate, purchase and sell these rights“ (Beckert 2004: 4). 127 Etwa in Form des Ämter- oder Stimmenkaufes, also des Erwerbs von Repräsentations- oder Wahlrechten. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 143 bachten: Lebensversicherungen für Kinder waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein grosser Erfolg, obgleich Kinderschutzverbände in ihnen die posthume Verlängerung der Kinderarbeit ausmachten. Für Eltern aus den unteren Bevölkerungsschichten stellte die Versicherung des Lebens ihrer Kinder allerdings eine Möglichkeit dar, ihren Kindern ein Armenbegräbnis zu ersparen, und darüber hinaus einen Teil des Einkommensverlustes zu kompensieren, der ihnen durch den Verlust ihres Kindes entstand (vgl. Honig 2002: 321). Es mag einen Allgemeinplatz darstellen, wenn wir angesichts dieser Trends festhalten, dass wir uns Märkte nicht nur als Politik vorstellen können, sondern auch von Konstellationen multipler Einbettung von Märkten ausgehen können, die zudem offensichtlich dem Wandel unterliegen. Allerdings überrascht es doch positiv, diesen Umstand aus der Feder eines federführenden Wirtschaftsoziologen wie folgt formuliert zu finden: Der Einbettungskontext von Märkten befindet sich sichtbar in einem ständigen und „dynamic process of oscillation between embedding, disembedding and reembedding“ (Beckert 2007b: 19). Wenn wir uns vor dem Hintergrund des Beispiels und des Zitats nun vorstellen können, dass in den vergangenen Jahrhunderten religiöse Formen der Einbettungsrhetorik eine grössere Bedeutung hatten als heute, und dass in dieser Zeitspanne politischen Form(ulierung)en der Einbettung eine zunehmend grössere Relevanz zukam, dann macht die im Rahmen dieser Arbeit bereits mehrfach gestellte Forderung umso mehr Sinn, als Autor auszuweisen, auf was man aktuell mit der Metapher der gesellschaftlichen Einbettung abzielt: Auf Veränderung der religiösen, der politischen, der rechtlichen oder gar der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Märkten? Aber auch ohne derartige Bekenntnisse können wir uns nun bereits im besten Einklang mit dem wirtschaftssoziologischen Diskurs vorstellen, dass es sich bei den jeweils ausgeprägten Einbettungspräferenzen um sachlich, historisch und sozial kontingente Zugänge handelt: Kaum ein ‚westlich’ geprägter Wirtschaftssoziologie wird, wenn er sich erst einmal auf eine präzisere Bestimmung seines Konzepts der sozialen Einbettung einlässt, für mehr primär religiös geprägte 144 Steffen Roth Formen der Einbettung des Marktes plädieren, wie sie uns CNN gerne mit Blick auf die islamische Welt vorstellt, oder etwa für eine sportliche oder künstlerische, sondern es eher mit den entsprechenden Plänen der verschiedensten politischen Bewegungen halten. In diesem Sinne lässt sich dann auch davon ausgehen, dass sich neben den bevorzugten Einbettungsrhetoriken beständig auch die zones of indifference (Barnard 1938: 168ff) der Embeddedness entlang sachlicher, zeitlicher und sozialer Dimensionen verschieben. Nicht jede Form der gesellschaftlichen Einbettung erregt zu jeder Zeit die gleiche Aufregung. Und wenn Entbettung zudem als ein einigermassen normaler Vorgang vorgestellt wird, verstehen wir Beckerts Idee der dynamischen Osziallation zwischen Einbettung, Ausbettung und Wiedereinbettung von Märkten auch als eine Absage an eine prinzipielle je-desto-Kausalität der Einbettung: Mehr Einbettung ist nicht zwangsläufig besser als weniger Einbettung, politische Einbettung nicht besser als religiöse, und mehr wissenschaftliche nicht besser als mehr wirtschaftliche Einbettung der Märkte. Darüber hinaus korrespondiert die Idee der dynamischen Oszillation zwischen Einbettung, Ausbettung und Wiedereinbettung von Märkten durchaus mit dem im Abschnitt Polyphone Organisation und monolitischer Markt beschriebenen Gedanken, dass Organisationen zwischen Multi- und Monoreferenz (Tacke 2001) oder Poly- und Monophonie (Andersen 2000, 2003, 2003b) pendeln, sich in ihren Entscheidungen also je nach Phase oder Kontext mal auf mehrere Funktionssysteme oder gar ausdrücklich auf einen als multifunktionale Agora (Barré 2001: 16) gedachten Markt beziehen, mal auf spezifische Märkte einzelner Funktionssysteme. Abbildung 5 zeigt die Gesellschaft umseitig als in exemplarisch sechs Funktionssysteme differenzierte Menge G, in der polyphone Organisationen (O) auf dem Markt (M) agieren: Wenn für polyphone Organisationen gilt: O ∩ K ∧ O ∩ P ∧ O ∩ S ∧ O ∩ R ∧ O ∩ W ∧ O ∩ L, dann ist nicht einzusehen, wie angesichts von O ⊂ M weiterhin gelten soll: M ⊂ W. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 145 Mit anderen Worten: Es fällt vor diesem Hintergrund schwer nachzuvollziehen, dass und wie es sich bei den Akteuren auf Märkten problemlos auch um multireferente oder polyphone Organisationen handeln kann, dass wir uns Märkte zudem als multipel eingebettet vorstellen können, und dass es sich bei Märkten ihrerseits dann aber dennoch um Wirtschaft und nur um Wirtschaft (und ein bisschen Politik) handeln kann128. 128 Zweifellos liesse sich nun argumentieren, Märkte ‚bestünden’ nun mal nicht aus allen Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren, sondern lediglich aus deren wirtschaftlichen Beziehungen. Das widerspräche dann aber der Idee von Märkten als sozialen Strukturen im Allgemeinen – zumindest dann, wenn mit sozial nicht-ökonomisch gemeint ist – und der Idee von Märkten als Politik im Besonderen. Zudem müsste man dann auch von der Idee der zunehmenden Vermarktlichung etwa des Gesundheits- oder des Mediensystems (Schimank und Volkmann 2008), die demnach aus allen gesundheits- oder medienbezogenen Beziehungen der beteiligten Akteure bestehen, verzichten. Das einzige, was sich dann noch beobachten liesse, wäre, dass sich in vielen Organisationen, auch in jenen, deren Selbstbeschreibung sich vor allem auf 146 Steffen Roth Unterm Strich steht, dass das Gros der Wirtschaftssoziologen gleichzeitig Dinge wie M ⊂ P, M ⊂ L, etc, und damit M ⊂ W’ oder in einer abgeschwächten Variante M ∩ W’ behauptet, dabei aber auch immer gleichzeitig von M ⊂ W (Märkte sind Teilmenge der Wirtschaft, Vermarktlichung ist Ökonomisierung, etc) ausgehen, was logisch nicht möglich ist. Dennoch wird der Markt immer wieder nichtökonomische Teilmengen zugeordnet, oder es werden nichtökonomische Teilmengen bis hin zur gesamten Gesellschaft (Polanyi 1977, 1978) in ihn hineinprojiziert. Auf beiden Grundlagen lässt sich nicht gegen die Idee nicht-ökonomischer Märkte bzw. eines transökonomischen Marktes diskutieren. Der letzten verbleibenden Strömung des wirtschaftssoziologischen Mainstreams, dem performativen Paradigma (Callon 1998, 2007), verdanken wir schliesslich die Idee, dass es sich bei Märkten nicht nur um den Vollzug von Wirtschaft, sondern allzu oft auch um die Performance von Wirtschaftswissenschaftlern handelt, in diesem Sinne also um Wissenschaft handelt. Dieser Gedanke kommt der These der nicht-ökonomischen Märkte durchaus entgegen (postuliert er doch M ⊂ S oder zumindest M ∩ S). Andererseits verwundert nach wie vor der argumentative Kurzschluss Callons (2007: 332f), wonach jeder, der an der Konstruktion von Märkten beteiligt ist, ein Ökonom sei. Der Gedanke, dass sich ein Soziologe automatisch in Gesundheits- und Informationsrhetorik kapriziert, Notwendigkeiten erkannt werden, sich über Geld zu unterhalten. Es ist nicht an Wirtschaftssoziologen, diesen Umstand nicht kritisieren, sondern schlicht erst einmal wieder zu fragen: „Warum?“, bevor die Jahrzehnte alten Antworten kolportiert werden: „(Neo-) Liberalismus“, „ökonomischer Kolonialismus“, „Marktfundamentalismus“, etc, die unterm Strich, wenn nicht einen Jahrzehnte alten Irrtum, dann doch nur eines ausdrücken: Die Konzepte „der Anderen“ sind überzeugender, oder zumindest weiter verbreitet, also ein Content- und ein Marketing-Problem der Wirtschaftssoziologie. Kein Wunder: Hieße diese Variante von Einbettung, die sich demnach im schlichten Hinweis auf den Umstand, dass es in der Gesellschaft und damit in der Umwelt der wirtschaftlich gedachten Märkte noch mehr gibt als eben Wirtschaft, doch, einen allzu grossen Aufwand für die Beschreibung eines allzu kleinen Allgemeinplatzes zu betreiben. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 147 einen Ökonomen verwandelt, sobald er ein auch nur halbwegs anwendungstaugliches Marktmodell vorlegt, kann keinem Soziologen recht behagen. In diesem Sinne scheint es, als trage auch das performative Paradigma nach wie vor das Erbe der Zeiten in sich, als die Wirtschaftssoziologie eine Hilfswissenschaft jener Disziplin war, die sich für Märkte als allein zuständig definierte. Es ist vor diesem Hintergrund kaum als unangemessen zu bezeichnen, wenn wir im Folgenden davon ausgehen, dass die letzte und einzige Bastion der Idee, dass es sich bei Märkten zum einen um soziale Phänomene und zum anderen um Wirtschaft und nur um Wirtschaft handelt, ausgerechnet von der Theorie gehalten wird, der man nicht zuletzt seitens des wirtschaftssoziologischen Mainstreams „die affirmative Verstärkung der bestehenden Kommunikationsrealität“ (Mikl-Horke 2008: 51) auch und gerade in Bezug auf die Wirtschaft nachsagt: Der Theorie sozialer Systeme. Der im vorherigen Abschnitt dieser Arbeit bereits ausgeführte Marktbegriff Niklas Luhmanns basiert im Wesentlichen auf der Idee, den „Markt als innere Umwelt des Wirtschaftssystems“ (Luhmann 1988: 91) zu begreifen, das wiederum ein Teilsystem der Gesellschaft als umfassendstem System aller Kommunikationen darstellt. Für Luhmann gilt mithin M ⊂ W ⊂ G, allerdings auf eine höchst spezifische Art und Weise (vgl. Abb. 6). Für den Markt als innere Umwelt der Wirtschaft gilt, dass wir ihn uns als interne Komplementärmenge denken müssen: „Als Markt kann man (...) die wirtschaftsinterne Umwelt der partizipierenden Systeme des Wirtschaftssystems ansehen, die für jedes eine andere, zugleich aber für alle dieselbe ist. Der Begriff des Marktes bezeichnet also kein System, sondern eine Umwelt – aber eine Umwelt, die nur als System, in diesem Fall also als Wirtschaftssystem, ausdifferenziert werden kann. Als Markt wird mithin das Wirtschaftssystem selbst zur Umwelt seiner eigenen Aktivitäten“ (ebd. 94). „Das Wirtschaftssystem macht, um diesen zentralen Punkt nochmals zu betonen, sich selbst zur Umwelt, um auf diese Weise Reduktionen zu erreichen, mit denen es sich selbst und anderes in einer Umwelt beobachten kann“ (ebd. 95). 148 Steffen Roth Diese zweifellos gewöhnungsbedürftige Konstruktion zeigt auf, dass sich die Theorie sozialer Systeme hier an ihren Grenzen bewegt: Der Markt ist für Luhmann insofern innere Umwelt der Wirtschaft, als es sich bei ihm um die Beobachtung des Systems aller Zahlungen (Geldkommunikation) unter der Berücksichtigung alternativer, d.h. nicht-realisierter Zahlungen und entsprechender Motive für Nicht/Zahlungen handelt. Während wir uns vorstellen können, dass das Wirtschaftssystem als System der realisierten Zahlungen für alle Beteiligten dasselbe ist, lässt sich das für Märkte nicht denken, da der geldkommunikative Möglichkeitsraum des einen Systems in keinem Fall identisch mit dem des anderen sein kann, und sei es nur deshalb, weil das System X1 keine Zahlungen, also intersystemische Kommunikation im Medium Geld, mit sich selbst durchführen kann, wohl aber mit den Systemen X2, X3, usw., die ihrerseits wiederum keine Selbstkontakte haben können, die sich als Vollzug von Gesellschaft beschreiben ließen. In diesem Sinne ist mengentheoretisch also frag- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 149 lich, ob sich der so interpretierte Luhmannsche Marktbegriff, also ein Potential möglicher Geldkommunikationen überhaupt Teilmenge der real-sozialen Menge Wirtschaft der Gesellschaft (W) sein kann129. Wenn wir aber unmittelbarer an den o. g. Definitionen ansetzen, dann stossen wir auf den Begriff der „partizipierenden Systeme des Wirtschaftssystems“. Setzen wir in die Gleichung M=W\X für die Menge X ein partizipierendes System der Wirtschaft ein, dann lässt sich der Markt (M) problemlos als innere Umwelt der Wirtschaft in dem Sinne verstehen, als dass die Menge M all jene partizipierenden Systeme umfasst, die nicht mit X identisch sind; entsprechend gilt dann M=X’. Diese Aussage kommt dem Alltagsverständnis sehr weit entgegen, lässt sich also noch theoretisch verfeinern: Zum einen ist ein partizipierendes System allein noch keine Menge im Sinne unserer systemtheoretischen Definition von Menge, zum anderen handelt es sich bei der Theorie nicht um eine Handlungstheorie, die Verknüpfungen zwischen Akteuren beobachtet, sondern um eine Kommunikationstheorie, die den Anschluss von Kommunikation an Kommunikation, also die Relationierung von Relationen beobachtet. In diesem Sinne steht X im Folgenden streng genommen nicht für ein Wirtschaftssubjekt, sondern für eine Menge von Zahlungen, die sich 129 Damit sind nicht nur „(d)ie Komplikationen einer solchen polykontexturalen Analyse, die bis in ein Aufsprengen der zweiwertigen Logik und damit bis in die Wissenschaftstheorie hineinreichen“ (Luhmann 1988: 98) angesprochen, sondern auch der Umstand, dass sich der Markt schwer als kommunikatives System vorstellen lässt: „Man rechnet zwar mit dem Konkurrenten, hat aber wenig Anlass, sich ihm zuzuwenden und mit ihm zu kommunizieren. Konkurrenz neutralisiert insofern das Problem der ‚doppelten Kontingenz’“ (ebd. 102), das für die Theorie sozialer Systeme konstitutiv ist. Bei Märkten, wie sie uns Luhmann vorstellt, handelt es sich um ein Aggregat intrasystemischer Beund Zurechnungen bzw. um intrasystemische Interpretationen von intersystemischen Ereignissen. Lassen sich diese intrasystemischen Operationen im Fall von Organisationen noch als soziale beschreiben, ist das im Fall von als Personen gedachten Marktteilnehmern schwierig. Entsprechend lassen sich Märkte – das ist bereits an anderer Stelle angesprochen worden – nur indirekt, gewissermassen als Fussabdruck sozialer Systeme (etwa von Systemen der Preiskommunikation) beobachten, etwa so wie schwarze Löcher in der Astronomie. In eben diesem Sinne ist es auch schwierig, Märkte einem sozialen System zuzuordnen. 150 Steffen Roth der Adresse X zuordnen lassen. Diese Zurechnungseinheit benötigt der Nexus der systemtheoretischen Rechnungen, in dem es neben Mengen- eben auch um Allokationsentscheidungen geht (vgl. Luhmann 1988: 98f); die Polykontexturalität des Marktes wird flankiert von einer Polyzentrik. Entscheidend ist aber, diese Zahlungsadressen oder –zentren nicht mit Organisationen zu verwechseln: Organisationen sind Systeme von Entscheidungen, die – so wirtschaftlich orientiert – Zahlungen an eine oder von einer Adresse auslösen können, aber weder mit dem durch sie irritierten System von Zahlungen noch mit ihrer Zahlungsadresse identisch sind. Diese spitzfindige Unterscheidung leitet zu der Frage über, welche Voraussetzungen bei einem an der Wirtschaft partizipierenden System gegeben sein müssen, damit es seine Umwelt als Markt beobachten kann? Für welche Systeme gilt also, dass Märkte ihre Komplementärmenge sind? Dass nicht jedes an der Wirtschaft partizipierende System automatisch als auf einen Markt bezogen gelten kann, zeigt eine eigentlich auf die Diskussion der Konzepte Markt- und Planwirtschaft fokussierte Aussage Luhmanns (ebd. 97): „Der Gegenbegriff zu Marktwirtschaft, den man jetzt ins Auge fassen muss, ist nicht Planwirtschaft und nicht Staatstätigkeit, sondern Subsistenzwirtschaft“. Mithin gibt es also (hier trifft man sich mit Karl Polanyi) auch für Luhmann Wirtschaft jenseits des Marktes. Der Unterschied, den die Marktwirtschaft dann macht, ist der Wettbewerb, also eine spezifische Vorstellung von der (inneren) Umwelt der Wirtschaft (Luhmann 1988: 101), die Kalkulation erfordert und nach Entscheidung verlangt: Wer am Markt agiert, muss sich entscheiden, wie er agiert, damit er gewünschte Entscheidungen anderer stimuliert. Marktorientierung gelingt mithin nur Systemen von Entscheidungen, verlangt also Organisation130.. In diesem Sinne argumentiert die vorliegende Arbeit also, dass es sich bei Märkten nicht um die (innere) Umwelt der Wirtschaft handelt, sondern um die (innere) Umwelt der Organisation. 130 Organisationen kann man „als autopoietische Systeme auf der operativen Basis der Kommunikation von Entscheidungen charakterisieren. Sie produzieren Entscheidungen aus Entscheidungen und sind in diesem Sinne operativ geschlossene Systeme“ (Luhmann 1997: 830). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 151 Bei der Idee vom Markt als der Umwelt der Organisation handelt es sich nicht nur um ein systemtheoretisches Argument: auch bei Christoph Deutschmann lesen wir vom Markt als ökonomischer Umwelt der Organisation (2008: 64), und ganz ähnlich wie bei Luhmann auch den Hinweis, dass „Organisationen nicht unmittelbar mit ‚dem Markt’ konfrontiert (sind), sondern immer nur mit dem Bild des Marktes, das sie sich selbst unter dem Einfluß der gesellschaftlichen Umwelt machen. Erst diese Bilder schneiden die Wahrnehmung des Marktes auf ein Format zu, das überhaupt rationales oder strategisches Handeln ermöglicht“ (ebd. 63). Entscheidend ist dann, dass wir die Konzepte rationales Handeln, Strategie, Berechnung, Kalkül und damit Organisation nicht im Kurzschluss mit Wirtschaft gleichsetzen, sondern eben, wie bereits ausgeführt, das System der Zahlungen vom System der Entscheidungen, das diese Zahlungen idealer Weise induziert, trennen, und dabei gleichzeitig attestieren, dass es Formen der Berechnung, des Kalküls des Wettbewerbs und entsprechend der marktorientierten Organisation auch in, oder besser gesagt, in Bezug auf nicht-ökonomische Sphären gibt131. Das gilt auch dann, wenn man sich die Märkte als eine spezifische Form des Umgangs mit Knappheitskommunikation denkt (vgl. Baecker 2006: 21ff), da wir Knappheitsbewältigung nicht notwendiger Weise mit Wirtschaft gleichsetzen müssen (vgl. Balla 2005), also eine Reihe von Faktoren kennen, die sich dem Preiskalkül entziehen (sollen) und die unserer Auffassung nach dennoch als knapp gelten können: „Seelenheil oder Eheglück oder politische Ämter“ (Luhmann 1988: 111); wir denken in diesem Zusammenhang an die 144'000 Plätze im Paradies, Scheidungsstatistiken und den Umstand, dass sich die meisten Demokratien über einen Wettbewerb um knappe politische Ämter reproduzieren, ohne dass wir eines dieser Beispiele als Ausdruck der Ökonomisierung interpretieren müssen. So lesen wir dann auch bei Dirk Baecker (2007: 80) von der Öffentlichkeit als einem Horizont des Kalküls der Zustimmung zu politi131 In diesem Zusammenhang lässt sich durchaus an Weber (1980: 17f) erinnern, für den sich rationales Handeln beileibe nicht nur auf ökonomische Werte und Zwecke bezog. 152 Steffen Roth schen Entscheidungen, als einem „’Markt’ der Politik, ein Terrain der Beobachtung weniger der politischen Entscheidungen, als vielmehr der steigenden oder sinkenden Möglichkeiten, für diese Entscheidungen machterhaltende Zustimmung zu erhalten“. Unserer Auffassung nach lassen sich, zumal Baecker (2006b) ohnehin von der Existenz nicht-ökonomischer Märkte ausgeht, die Anführungszeichen um den Markt herum getrost weglassen, und man kann von folgender Situation ausgehen (vgl. Abb. 7): Wir beschreiben den Markt (M) zunächst als innere Umwelt der organisierten Wirtschaft (OW), also als Umwelt eines am Wirtschaftssystem partizipierenden Systems, das in der Lage ist, Entscheidungen zwischen „konkurrierenden und kollidierenden Zwecken und Folgen (...) in eine Skala ihrer von ihm bewusst abgewogenen Dringlichkeit (zu) bringen“ (Weber 1980: 13), die sich an einem mehr oder minder rationalen Kalkül orientiert, das auch das Kalkül anderer am Wirtschaftssystem partizipierender Systeme einschliesst. Baecker (2006: 100f) beschreibt, dass diese Form der Beobachtung bereits in den Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 153 Geburtsstunden der ersten Märkte zu beobachten ist und dass eine gewisse Form der Konkurrenz, d.h. der an Alternativen orientierten (Binnen-) Organisation von Marktteilnehmern – die wir uns zu dieser Zeit noch als ganze Familien, Sippen oder Stämme, mitunter also als ganze Gesellschaften vorstellen können – gegeben sein bzw. parallel zur Entstehung von Märkten entstanden sein muss; Organisation und Markt bedingen einander und entstehen gemeinsam. Da wir uns Organisationen allerdings nicht nur neuerdings (Stichwort: organisationale Polyphonie), sondern auch mit Blick auf das „ganze Haus“ der antiken Stadtgesellschaften als transökonomische Veranstaltungen vorstellen müssen, macht es kaum Sinn davon auszugehen, dass Organisationen ihre Umwelt als rein ökonomische wahrnehmen, die Märkte der Organisation also rein ökonomische sind. Abbildung 7 ist in diesem Sinne nicht falsch, wohl aber unvollständig bzw. bezeichnet lediglich einen Ausschnitt der gesellschaftlichen Realität der Märkte: den Markt der wirtschaftlichen Organisation. Einer strengeren Lesart zufolge „kann man, mit nur wenig Übertreibung, sagen, dass es erst unter dem Regime funktionaler Differenzierung zu jenem Typus autopoietischer Systeme kommt, den wir als organisiertes Sozialsystem bezeichnen“ (Luhmann 1997: 840). Im Sinne unserer Definition wäre demnach davon auszugehen, dass es Märkte erst gibt, seit es funktionale Differenzierung gibt. Aber auch jenseits dieser Definition wird deutlich, dass es zumindest wirtschaftliche Märkte, also Märkte im Sinne der landläufigen Definition, erst geben kann, seit es funktionale Differenzierung gibt. In diesem Fall wäre zu schlussfolgern, dass Märkte älter sind als die funktionale Differenzierung, und wirtschaftliche Märkte entsprechend einen vergleichweise jungen Sonderfall von Märkten darstellen. Die Alternative wäre, sich Märkte und Organisationen als von der funktionalen Differenzierung unabhängige Konzepte vorzustellen, und damit als trans-ökonomische Veranstaltung. In beiden Fällen gilt M ⊄ W! In diesem Sinne betrachten wir heutige Märkte also prinzipiell als Komplementärmenge (O’) der Organisation (O), und real als Summe der Komplementärmengen der Organisationen einer Gesellschaft 154 Steffen Roth (O1, O2, ...), also als innere Umwelt der organisierten Gesellschaft (OG) der Gesellschaft (vgl. Abb. 8). Mit der Idee vom Markt als innerer Umwelt der Organisation bzw. der organisierten Gesellschaft konnte somit eine logisch konsistente Alternative zum klassischen systemtheoretischen Marktbegriff, und damit zur letzten theoretischen Bastion der Idee vom M ⊂ W, entwickelt werden. Diese Alternative werden wir im Folgenden weiter verfolgen, und das auch dann, wenn sich zunächst entlang historisch, archäologisch und ethnologisch inspirierter Argumentationsgänge erste greifbare Spuren von nicht-ökonomischen Märkten verfolgen, die der Vorstellungskraft als Ankerpunkte im Konkreten dienen können, bevor wir die abstrakte Idee vom Markt als innerer Umwelt der Organisation wieder aufgreifen, wenn wir im letzten Abschnitt des Kapitels eine theoretisch konsistente Alternative zum geläufigen Marktkonzept skizzieren. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 155 Spuren nicht-ökonomischer Märkte In diesem Abschnitt sollen Spuren und Hinweise für die Existenz von nicht-ökonomischen Märkten zusammengetragen werden, die dem wirtschaftssoziologischen Diskurs allesamt nicht fremd sind. Wenn es an dieser Stelle also zu Überraschungen kommt, dann nicht aufgrund der dargestellten Sachverhalte, sondern allenfalls aufgrund von deren Darstellung. Die einzelnen Indizien werden dabei in eine einigermassen zeitliche Reihenfolge gebracht, ohne dass daraus folgt, dass es sich hierbei um eine Chrono-Logie oder eine besonders systematische Zusammenstellung handelt. Die Darstellung erfolgt entsprechend in Form einer Liste, die jedes Indiz als einen ihrer Punkte ausweist. Bezüge zwischen den einzelnen Punkten werden, wo augenscheinlich, hergestellt, sind aber nicht Anliegen dieses Abschnittes, der eben keine alternative Geschichte des Marktes schreiben will, sondern nur anzeigen, dass dies möglich ist, wenn man die Konsequenzen, die aus der Idee nicht-ökonomischer Märkte resultieren, zu Ende denkt. In diesem Sinne können wir uns dann an den Hinweis Michel Callons (1998: 1) halten, ohne in allzu grosse theoretische Verlegeneheit zu geraten: "Thus, the weakness of the market theory may well be explained by its lack of interest in the market place“, eine Aussage, die wir als Einladung verstehen, uns schliesslich auch mit ganz konkreten Märkten zu beschäftigen: Eine mögliche Variante des Urzustands der Märkte wird uns von P. J. Hamilton Grierson (1980) vorgestellt: Der Silent Trade. Grierson beschreibt „primitive markets“ (ebd. 25) als ein Szenario, dass sich problemlos mit Webers (1980: 385) Idee der Vergesellschaftung von Ungenossen deckt: Wir lesen von Menschen, die sich aller Risiken zum Trotz aus dem Schutz ihrer Familie oder ihres Stammes herauswagen, um sich fremden Familien, Stämmen, Gesellschaften anzunähern, um an bestimmten Orten in einer neutralen Sphäre132 Gegenstände niederzulegen in der Hoffnung, dass es zum Austausch kommt, um dann aus sicherer Entfernung zu beobachten, was mit diesen Gegenständen geschieht und wie sie allenfalls vergolten wer132 „(A) spot within the border-land“ (Grierson 1903(1980): 26). 156 Steffen Roth den. Diese Form der Märkte gilt nicht nur Hamilton als die früheste (vgl. auch Baecker 2006: 101), die zu Beginn eher als Experiment denn als regelmässige Institution beschrieben werden kann. Interessant ist allerdings, dass Baecker betont, dass die Motivation, sich auf die waghalsige Annäherung an die Ungenossen einzulassen, mit der „Unvermeidbarkeit der heimischen Statuskonkurrenz“ verknüpft. Im Zuge der zunehmenden Institutionalisierung des Ortes und der Regeln des Markttausches, stellt uns Grierson (1980: 25) „Egba“ oder einen seiner Verwandten vor, der als Gott des Marktes, des Handels und auch bereits der Diebe, wie später Hermes oder Merkur über jene mit einem sakralen Tabu belegten Orte wachte, an denen regelmässig Austausch zwischen den frühen Kerneinheiten der Gesellschaft entstand. Entsprechend lesen wir auch: „Then came the priest and took one-third part of the price for the god: and what was left remained in safety untill the sellers came and took it“. Die erste Mehrwertsteuer der Geschichte war demnach eine Kirchensteuer. In diesem Sinne verstehen wir also: Wenn funktionale Differenzierung zu dieser Zeit bereits Sinn machen würde, dann würden wir eine Form der religiösen Einbettung von Märkten beobachten; mehr noch: Märkte wären religiöse Orte und Markttausch ein Ritual, das Transzendenz (von Stammesgrenzen und alltäglichen Erfahrungswelten) beinhaltet und somit einen Balance-Akt zwischen Vertrautem und Unvertrauten133. Markt wäre demnach nicht Wirtschaft, sondern Religion. Es nimmt daher auch nicht Wunder, dass eine Vielzahl von Begriffen, die wir heute im Kurzschluss mit Wirtschaft assoziieren, ihre Ursprünge in religiösen Verweisungskontexten haben. Betrachtet man Märkte eben als Formen der Vergesellschaftung mit Ungenossen (Weber 1980: 385) und damit nicht nur aus der Perspektive einer, sondern notwendiger Weise auch aus der Perspektive zweier Marktteilnehmer (hier aber eben zweier Stämme, also zweier Gesellschaften), dann fällt weiterhin auf, dass Märkte in ihrer Frühzeit in neutralen Bereichen zwischen den Territorien der gesellschaftlichen Segmente lagen (Grierson 1980: 26; Simmel 1992: 788). Die 133 „In ihren Ursprüngen ist Religion am besten zu begreifen, wenn man sie als eine Semantik und Praktik versteht, die es mit der Unterscheidung von Vertrautem und Unvertrautem zu tun hat“ (Luhmann 1997: 232). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 157 territoriale Neutralität des Marktes war, nicht zuletzt als Garant der Freiwilligkeit und damit der Fairness des Tausches, ein derart wichtiges Prinzip, dass es auch dann aufrecht erhalten wurde, als oder wenn die räumlichen Voraussetzungen dafür nicht (mehr) gegeben waren134. Eines der eindrucksvollsten Beispiele für diesen Umstand stellt der Kula-Ring der Argonauts of the Western Pacific (Malinowski 1979) dar, auf den Marcel Mauss (1990) massgeblich seine Theorie der Gaben stützt, die im Kula-Ring einer festen Rotationsbewegungen folgend an immer anderen Orten übergeben werden. Mauss (1990: 66) beschreibt den Kula eindeutig als ein Tauschsystem, in dessen Zentrum religiös-symbolische Artefakte und Rituale stehen, und gleichzeitig als Anlass für Gimwali, den profanen Tausch alltäglicher Waren. Das, was wir mit heutigem Begriffsarsenal einigermassen guten Gewissens als Wirtschaft bezeichnen können, ist demnach eine randständige Funktion des Kula, dessen Kernfunktion Mauss damit angibt, alles zu verpönen, „was an Hass und Krieg erinnert“ (ebd. 63). Den Kula im Sinne eines beliebten Missverständnisses als Gabenökonomie (Sykes 2005: 64; Moritz 2006: 174, Beckert, Diaz-Bone und Ganssmann 2007: 35), also als spezifisches „economic system“ (Burt 1995: 251) zu betrachten oder die „logische Unmöglichkeit der reinen Gabe“ (Hillebrandt 2007: 291) zu diskutieren, meint demnach, eine spezifisch wirtschaftssoziologische Form des ökonomischen Kolonialismus zu betreiben. Eine Alternative dazu könnte darin bestehen, die Gabe ähnlich wie den Markt als ein Prinzip zu beobachten, das älter ist als die funktionale Differenzierung, und damit zunächst nicht nur als räumlich, sondern auch als funktional neutral. Darüber hinaus muss man sich diesen totalen Markt (Mauss 1990: 9f) zumindest im Hinblick auf seine Entstehungsgeschichte nicht als den Markt der Trobriander, sondern eben als eine Form der Vergesellschaftung mit Ungenossen, also als – im heutigen Sprachgebrauch – internationale Veranstaltung vorstellen. Vor diesem Hintergrund, genauso wie vor dem des zeitgenössischen Globalisierungsdiskurses, stellt sich auch unabhängig von der funktionssystemischen Proble134 Etwa in Form eines Waffenstillstandes zu Kriegszeiten: „Sometimes this neutrality takes the form of a truce, which is ended so soon as the barter is completed“ (Grierson 1980): 27). 158 Steffen Roth matik die Frage, worauf die Idee der Einbettung von Märkten in die Gesellschaften abzielt? Wie vergesellschaftet man sich im Inneren der eigenen Gesellschaft mit Ungenossen? Wie soll die einzelne Insel im Pazifik den gesamten Kula-Ring, deren sie lediglich ein Teil ist, einbetten? Wie soll der Nationalstaat ähnliches in Bezug auf die Weltmärkte leisten? Und: Widerspricht der Gedanke der Einbettung von Märkten nicht basalen Prinzipien der Fairness, denn: wenn es denkbar wäre, dass eine Gesellschaft ihren Markt oder all ihre Märkte vollständig nach eigenem Gutdünken gestalten kann, verfügt sie dann nicht auch nach eigenem Gutdünken über ihre Tauschpartner, die sich damit in einer Situation vollständiger Abhängigkeit befänden? Steht eine Rhetorik der Einbettung in diesem Sinne also nicht für die gruppenegoistische Idee, Marktprozesse zu Gunsten der ‚Genossen’ zu beeinflussen? Die ersten Formen der gesellschaftlichen Einbettung von Märkten können wir uns dann ganz plastisch zunächst als zunehmende räumliche Annäherung des Marktes an die Territorien der sich entwickelnden Zentren der frühen Hochkulturen denken, sie sind also eng gekoppelt an die Entstehung und die Konsequenzen einer Zentrum-Peripherie-Differenz (Luhmann 1997: 663ff) und damit sichtbar als eine Form der Asymmetrisierung der Chancen und Kosten der einzelnen Marktteilnehmer: Auch wenn die Marktplätze der frühen Zentren meist noch vor den Toren der Stadtstaaten und damit streng genommen ausserhalb derer Territorien lagen (vgl. Polanyi 1963), mussten sich Angehörige der Peripherien doch bereits weit in die Einflusssphäre der Zentren hineinwagen, um am Markttausch teilnehmen zu können. Gleichzeitig bewegten sich die ‚fremden’ Marktteilnehmer weiterhin auf neutralem Terrain, d.h. auf dem Boden einer zunehmend prekäreren virtuellen Neutralität, wie sie etwa das Gastrecht herstellt, indem sie dem Gast weniger abverlangt und ihm mehr gibt als selbst dem Freund, dabei aber ausser Acht lässt, dass das Gastrecht seinerseits und damit die Neutralität selbst bereits eine Gabe darstellt, was im weiteren Verlauf des Spiels um Gabe und Gegengabe nicht ohne Wirkung ist. Im weiteren Verlauf der Geschichte beobachten wir die zunehmende Internalisierung von Märkten, zunächst in der Form, in der sie uns Richard Swedberg (2007: Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 159 14) vorstellt: „ Zum Beispiel lag die Agora von Athen innerhalb der Stadt, in einem von Grenzsteinen markierten Bereich. In eigens errichteten offenen Säulenhallen (Stoa) boten Händler ihre Waren dar. Zahlreiche soziale und politische Aktivitäten fanden ebenfalls auf dem Markt statt, wo etwa Sokrates wohlhabende junge Athener behelligte, die mehr an ihrem Reichtum als an ihre Seelen dachten. Speziell dafür ernannte Beamte sorgten dafür, dass auf dem Markt Ordnung herrschte, genaue Masse und Gewichte verwendet wurden und kein Falschgeld im Umlauf war. Auf dem Markt verübte Straftaten wurden von speziellen Gerichten geahndet“. Swedberg führt uns hier ein lebendiges und buntes Markttreiben vor Augen, an dem uns vor allem zwei Aspekte interessieren: Zum einen lässt sich am Bild der Grenzsteine sowie der Marktgerichtsbarkeit der Markt intuitiv nachvollziehbar als innere Umwelt beschreiben, hier eben als einen Sozialraum der Stadtgesellschaft, der auch Nicht-Mitgliedern zugänglich und unter dieser Massgabe von anderen gesellschaftlichen Sphären abgegrenzt ist, auf dem also andere Regeln gelten und anderes zu erwarten ist als im Rest der Gesellschaft. Zum anderen genügt bereits Swedbergs knappe Beschreibung, um sich vorstellen zu können, dass Wirtschaft nur eine unter vielen Funktionen war, die auf Märkten realisiert wurden. Mit Blick auf die konkrete Position der Stoae, jener Säulengänge, in denen Handel getrieben wurde, liesse sich auch argumentieren: Wirtschaft war eine eher marginale Funktion des Marktes; die Stoae standen in der Regel am Rande des Marktplatzes (vgl. Thompson 1954) und nicht in dessen Zentrum. Die Einschätzung Sarah C. Humphreys (1969: 185), den Markt „as a mechanism for limiting contact between incompatible economic systems“ zu bezeichnen, betrachten wir entsprechend nicht als falsch, sondern lediglich aus unvollständig: Tatsächlich handelt es sich beim Markt um eine Form der Regulierung von Umweltkontakten, die sich allerdings eben nicht nur auf wirtschaftliche Aspekte beschränken. Das zeigt sich nicht zuletzt am von Richard Swedberg beschriebenen Beispiel; der Markt als selektiver Kontakt und so als Sinnesorgan der Gesellschaft funktioniert nicht nur in Richtung Wirtschaft, und auch nicht nur nach aussen: die Internalisierung der Märkte beginnt das Leben der Stadtstaaten so massgeblich zu beein- 160 Steffen Roth flussen, dass die Perspektive des Sehens und Gesehen-Werdens, die Orientierung der Form der eigenen Rede, der eigenen Gedanken, des eigenen Urteils, des Geschmacks, des Glaubens, der Produktion des eigenen Hauses an den Alternativen, die der Markt, d.h. die Anderen (und bald eben auch die Anderen in den eigenen Reihen) anboten, zum unhintergehbaren Standard wurde, der bald so tief in der Gesellschaft verankert war, dass Regierungsformen kritisiert wurden, die „confined the citizens to the privacy of their households“ (Arendt 1993: 290) und so dafür sorgten, dass „(t)he only public activity left under such conditions was the exchange market of the craftsmen, whose concern was with making and not with acting, and whom the Greeks exclude from political life as banausic“ (Canovan 1977: 61). Ganz ausdrücklich assoziierte man Despotismus oder Tyrannei also mit der Entpolitisierung des Marktes (Arendt 1958: 160). Vor diesem Hintergrund erscheint – insoweit weiss sich diese Arbeit mit dem Gros der Wirtschaftssoziologie im Einklang – der ökonomische Kolonialismus tatsächlich auch als spezifische Form von Politik. Gleichzeitig wird so denkbar, dass es der Soziologie weniger darum gehen sollte, die Gesellschaft vor der Allmacht des als ökonomisch gedachten Marktes zu bewahren. Ganz im Gegenteil kann es einer trans-ökonomisch gewendeten Marktsoziologie nun auch darum gehen, die ganze Gesellschaft wieder auf den Markt zu holen, und damit nicht nur den Polit-Ökonomie-Bias einer Gesellschaft in Frage zu stellen, die ihre Märkte, also die Horizonte ihrer Entscheidung, und damit gewissermassen das Prinzip Organisation selbst, im nahezu unhinterfragten Kurzschluss mit Wirtschaft (und allenfalls noch mit Politik) assoziiert Zusammenfassung: Die Märkte einer neuen Marktsoziologie Bislang konnte die These der Arbeit auf drei Wegen erhärtet werden: Zum einen wurden wirtschaftssoziologische Autoren ins Feld geführt, die, anders als das Alltagsverständnis sowie das Gros ihrer Fachkollegen, von der Existenz nicht- bzw. trans-ökonomischer Märkte ausgehen. Zum Anderen konnte im Rahmen einer mengentheoretisch informierten Diskussion der gängigen wirtschaftssoziolo- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 161 gischen Marktkonzepte gezeigt werden, dass sich die Idee vom Markt als eine (in letzter Instanz doch immer wieder) wirtschaftliches Phänomen logisch nicht halten lässt. Schliesslich konnten entlang historisch, archäologisch und ethnologisch inspirierter Argumentationsgänge erste greifbare Spuren von nicht-ökonomischen Märkten verfolgt werden. Im Verlauf dieses Abschnittes sollen diese drei einigermassen ausführlich beschrittenen Wege um zwei argumentative Abkürzungen ergänzt werden, die schliesslich zu einer ersten theoretisch konsistenten Skizze eines alternativen, trans-ökonomischen Marktverständnisses führen, vor deren Hintergrund sich eine eigenständige Marktsoziologie entfalten kann. Das erste Argument lautet schlicht: Märkte sind älter als die funktionale Differenzierung. Oder weniger schlicht: Mit Blick auf den vorangegangenen Abschnitt der Arbeit zeigt sich, dass die Marktsoziologie einen adäquaten, d.h. trans-ökonomischen Marktbegriff benötigt, will sie in der Lage sein, Märkte in Zeiten und Erdregionen untersuchen zu können, in denen die Beobachtung funktionaler Differenzierung weder absolut ausgeschlossen, noch besonders wahrscheinlich, in jedem Fall aber kein dominantes Differenzierungsmuster ist und war135. Das zweite Argument nimmt ebenfalls den Gedanken auf, dass funktionale Differenzierung anwendet, wer der Idee vom M ⊂ W das Wort redet. Dabei gilt das Hauptaugenmerk dann aber nicht mehr der Anwendbarkeit des Differenzierungsmusters, sondern der Anwendung selber: Wie bereits beschrieben, lassen sich mit Luhmann neben der funktionalen Differenzierung noch zwei weitere gesellschaftliche Differenzierungsformen unterscheiden: die segmentäre und die stratifikatorische. Diese beiden Differenzierungsformen wer135 Das zu vergegenwärtigen hilft „eine gewisse chinesische Enzyklopädie“, die Michel Foucault (1971: 17) mit Verweis auf Jorge Louis Borges (1966: 212) zitiert, der zufolge sich Tiere noch vor wenigen hundert Jahren wie folgt kategorisieren ließen: „a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörige, i) die sich wie Tolle gebärden, k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, l) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen haben“. 162 Steffen Roth den ebenso landläufig wie routiniert auf Märkte angewendet: der Deutsche Markt ist ein anderer als der Russische, wer Luxus nachfragt bekommt anderes angeboten als Kunde des Premiumsegments. Wer nun aber M ⊂ W sagt, wendet funktionale Differenzierung nicht einfach nur an, sondern setzt deren Anwendung bereits vor deren Anwendung voraus. Dabei passiert mit dem Markt in funktionaler Hinsicht etwas, das sich, segmentär gewendet, so anhören würde: Nur der Deutsche Markt ist ein Markt. Ohne sich in dieser offenkundig widersrpüchlichen Idee allzu sehr zu verlieren lässt sich doch erkennen, dass man es mit zwei Unterscheidungen zu tun hat, die uns lediglich so häufig nicht nur als einzig richtige sondern auch als eine präsentiert wurden, dass es mitunter schwer fällt, sie als zwei zu erkennen: Wer M ⊂ W sagt, entscheidet sich erst für die Anwendung der funktionalen Differenzierung und dann für die Beobachtung nur eines der solchermassen ausdifferenzierten Teilsysteme, und blendet dabei kontinuierlich die Frage aus, auf was man funktionale Differenzierung denn angewendet haben muss, damit man nach der Anwendung in der Schublade Wirtschaft auch wirklich den Markt vorfindet. Mit anderen Worten handelte es sich bei der Frage nach der Obermenge X, deren Ausdifferenzierung zur Menge des ökonomischen Marktes (M) und zu einer Komplementärmenge, die M ⊂ W zufolge dann nur aus nicht-ökonomischen und nicht-marktlichen Teilmengen (M’1-n) bestehen kann, nicht umsonst um einen blinden Fleck der einschlägigen Diskurse (vgl. Abb. 9, umseitig). Bei der Obermenge X, die als eine ihrer Teilmengen die Menge ökonomischer Markt (M) beinhalten kann, handelt es sich offenkundig um eine Tabelle, die sich aus der Kreuzung der Unterscheidungen ökonomisch/nicht-ökonomisch und Markt/Nicht-Markt ergibt. Entsprechend zeigt sich rasch, dass die Idee ausdrücklich ökonomischer Märkte automatisch neben dem Konzept der nichtökonomischen Nicht-Märkte (M’3) auch das der nicht-marktlichen Wirtschaft (M’2) und eben das der nicht-ökonomischen Märkte (M’1) erzeugt. Oder umgekehrt: die Obermenge, in der für die Komplementärmenge M’ der Menge ökonomischer Markt (M) gilt, dass sie nur aus M’2 und M’3 besteht, und damit eine notwendige Bedingung für M ⊂ W erfüllt, kann es logisch nicht geben. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 163 Vor diesem Hintergrund halten wir nun nicht länger die Idee nichtökonomischer Märkte, sondern eben die Formel M ⊂ W für – bestenfalls – stark begründungswürdig, zumal dann, wenn es dieser Arbeit im Folgenden gelingt, eine stimmige Antwort auf die Frage nach dem X in ihrer eigenen Gleichung anzubieten. Wie bereits angedeutet, emanzipiert sich die Arbeit dabei nicht nur vom konventionellen Marktverständnis, sondern auch ein Stück weit von dem der Theorietradition, mit deren Hilfe sie sich vom konventionellen Marktverständnis gelöst hat. Als das X der vorliegenden Arbeit hat sich dabei die Frage herauskristallisiert, was Märkte entstehen lässt, und zwar nicht nur als innere Umwelt der organisierten Wirtschaft, sondern als innere Umwelt organisierter Gesellschaft. Dass die Idee vom Markt als der inneren Umwelt von Gesellschaft nicht nur rein systemtheoretisch anschlussfähig ist, zeigte dabei nicht zuletzt die im vorangegangen Abschnitt historisch, archäologisch und ethnologisch nachverfolgte Wanderbewegung des Marktes von neutral gedachten Sphären zwischen den gesellschaftlichen Ein- 164 Steffen Roth heiten vor die Stadttore und schliesslich in die Herzen der antiken Hochkulturen hinein. Und gerade diese zunehmende Internalisierung des Marktes zeigt auch, dass wir Organisationen und Märkte als Lösung eines zunehmend naheliegenden gesellschaftlichen Problems begreifen müssen, das sich zunächst vielleicht nur den Hochkulturen, mehr und mehr aber wohl allen Gesellschaften stellte. Wie aus systemtheoretischer Perspektive nicht anders zu erwarten, denken wir hierbei an ein Problem der Kommunikation, konkreter aber an kein geringeres als das der Kommunikation zwischen Gesellschaften. Dessen Lösung liegt dann in der Form der Einmalerfindung eben genau des Typus sozialer Systeme, der mit anderen sozialen Systemen kommunizieren kann: der Organisation136. Organisation löst demnach ein hochspezifisches Problem der Systembildung: „Soziale Systeme entstehen (...) dadurch (und nur dadurch), dass beide Partner doppelte Kontingenz erfahren und dass die Unbestimmbarkeit einer solchen Situation für beide Partner jeder Aktivität, die dann stattfindet, strukturbildende Bedeutung gibt. Das ist mit dem Grundbegriff der Handlung nicht zu fassen“ (Luhmann 1984: 154). Erst recht dann nicht, wenn es sich im Falle beider Partner bereits um soziale Systeme handelt. Gerade am Beispiel des bereits angesprochenen Silent Trades (Grierson 1980) zwischen Tauschpartnern, die einander nicht zu Gesicht bekommen, lässt sich leicht nachvollziehen, dass und wieso es zum Verständnis der Funktionsweise von Märkten kaum auf Tauschverhalten individueller Akteure ankommt: Wem soll ich welche Motive unterstellen, wenn ich nicht sehe, wer mein Tauschpartner ist und mit Sicherheit nur eines annehmen kann: dass er nicht allein ist137. Dessen ist man sich auf beiden Seiten ebenso bewusst, wie dem Umstand, dass man nur hergeben mag, was man entbehren kann. Entsprechend gilt, dass man sich über die relative Wertigkeit der potenziellen Tauschmittel verständigen muss, eine Situation, die man dem Tauschpartner, dem alter ego, dann kurzerhand ebenso unterstellen kann wie den Gedanken, dass der wahrscheinlich Gleiches 136 „Sie sind der einzige Typ sozialer Systeme, der diese Möglichkeit hat, und wenn man dies erreichen will, muss man organisieren“ (Luhmann 1997, 834). 137 Menschliches Leben außerhalb von Gruppen hatte damals aller Kenntnis nach eine geringe Halbwertszeit. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 165 tut und unterstellt. Und eben so kommt vor dem Hintergrund dessen, was wir uns dank Hamilton Grierson (1980: 25) als primitive markets vorstellen können, ein kommunikatives Spiel zwischen zwei sozialen Systemen zu Stande, die wir uns entsprechend als Organisationen vorstellen müssen. Im Hinblick auf das Verständnis von Märkten ist dann auch weniger relevant, was da im einzelnen getauscht wird; interessant ist vielmehr, was die angebotenen Tauschmittel über die internen, kommunikativen Relevanzstrukturen sowohl der anderen wie auch der eigenen, in beiden Fällen nun als Entscheidungssystem verstandenen, Organisation der Gesellschaft138 verraten. Man überlegt gemeinsam, was man von sich geben und was man getrost annehmen kann, was der Andere wie gerne für sich behalten würde und was er dennoch gerne dafür hätte: Ranken, listen, kalkulieren. So entdecken soziale Systeme ihre Präferenzen im Zuge der Entdeckung der unterstellten Präferenzen der Anderen, und das immer differenzierter: Organisation und Markt ko-evoluieren, und differenzieren sich so weiter aus. Vor diesem Hintergrund lässt sich demnach folgender Zusammenhang beschreiben: Wenn wir den Markt als Form der Kommunikation (K) zwischen Gesellschaften (G1, G2) begreifen, dann ergibt sich daraus, dass diese Gesellschaften über Organisation, das X(1, 2) in 138 Damit soll nicht – wie etwa bei Peter Fuchs (2007) gewendet als Listenförmigkeit des menschlichen Lebens – unterstellt sein, dass nun automatisch alle Kommunikation organisiert und Gesellschaft damit Organisation ist. Vielmehr gilt, dass von nun an alle Kommunikation prinzipiell organisierbar ist. Die Gesellschaft hat Organisation und damit eine Alternative zur Tradition. Und indem man lernt, die Alternativen (ein)zuschätzen, die man der marktförmigen Beobachtung anderer Gesellschaften verdankt, kann man auch die eigene Gesellschaft als mögliche andere verstehen und sich damit auch intern einen Horizont gesellschaftlicher Alternativen erschließen: Wenn sich Traditionen in einer Zeit streitender Reiche unter der Maßgabe beobachten lassen, welche von siegreichen und welche von untergegangenen Reichen gelebt wurden, dann lassen sich Traditionen nicht nur prinzipiell in Rangfolgen bringen, sondern auch ganz konkret die der eigenen Gesellschaft evaluieren. Im Angesicht der Tradition der anderen gibt es keine Tradition mehr; es sei denn als Entscheidung. Und so entsteht die Philosophie als Entscheidungshilfe in China wie in Griechenland (Hösle 1997: 699; Roetz 2006: 35), und zwar gleichermaßen auf dem Markt zwischen und in den einzelnen Gesellschaften. 166 Steffen Roth unserer Gleichung, verfügen müssen. Das Interessante ist nun, dass die Organisation der Gesellschaft(en) nicht nur auf einen MarktZusammenhang verweist, der die Gesellschaft(en) transzendiert (K), sondern eben auch auf jene Bereiche der Gesellschaft, die nicht Organisation, damit aber automatisch ebenfalls organisierbar sind (M1, M2). Mit anderen Worten: Die zunehmende Entstehung eines Marktes zwischen den Gesellschaften korrespondiert mit der Entstehung eines Marktes innerhalb der Gesellschaften (vgl. Abb. 10): Märkte entstehen so immer gleichzeitig als Märkte innerhalb und zwischen Gesellschaften, oder allgemeiner: innerhalb oder zwischen sozialen Systemen. Wann immer soziale Systeme mit sozialen Systemen (oder mit sich selbst) kommunizieren, tun sie das in Form eines Marktes, und damit vermittels Organisation. Wir können diesen allgemeinen Begriff des Marktes als Kommunikation zwischen Organisationen dabei herleiten, ohne dabei bereits auf funktionale Differenzierung zurückgreifen zu müssen. Gleichzei- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 167 tig ist damit nicht ausgeschlossen, das im Folgenden zu tun139. Entscheidend ist dann aber, dass der hier vorgestellte Marktbegriff uns – wie bereits beschrieben – in die Lage versetzt, die entsprechende Differenzierung vornehmen zu können, ohne sie bereits vorausgesetzt haben zu müssen. Kurzum: Wenn man den Markt als Kommunikation und Märkte damit als Gesellschaft der Organisation begreift, dann macht – wie ebenfalls bereits ausgeführt – die Idee, dass es sich bei Märkten zwangsläufig oder zumindest schlussendlich allein um Wirtschaft handelt, rein logisch in etwa soviel Sinn, als würde man sagen: Nur deutsche Märkte seien Märkte. Nun ließe sich smart argumentieren, dass dem in gewisser Weise auch so ist, handle es sich bei französischen Märkten schliesslich um marchés, bei englischen um markets oder bei chinesischen um 市场 . In all diesen Fällen, und dabei am sichtbarsten in Form des chinesischen Zeichens140, steht die Bezeichnung aber doch zweifellos für das selbe Prinzip, nämlich für den Horizont alternativer Entscheidungen . In diesem Sinne macht es dann auch nur begrenzt Sinn, auf unterschiedliche Begriffstraditionen zu verweisen: Sicher, was in der Wirtschaft der Markt ist, ist manchem die Öffentlichkeit der Politik oder im Sport die Arena. Allerdings konstruiert man so zum Einen Unterschiede, wo dem Prinzip nach keine sind; und zum Anderen verwischt man Unterschiede, die es statt dessen im Auge zu behalten gälte: Während wir uns die Öffentlichkeit der Politik gemeinhin als einen Bezugsrahmen vorstellen, der Personen auf Personen bezieht, stellen wir uns den Markt der Wirtschaft leichter als organisationale 139 Etwa auch, indem man einen Schritt über Sarah Humphreys (1969: 185) Idee, den Markt „as a mechanism for limiting contact between incompatible economic systems“ hinausgeht und sich die ökonomische Monopolisierung des Marktes als einen Mechanismus vorstellt, den Kontakt zwischen zwei als inkompatibel gedachten Gesellschaften zu limitieren. Dieser Gedanke korrespondiert dann mit der bereits mehrfach zitierten Idee Hannah Arendts (1958: 160) vom ökonomisierten Markt als einer despotisch auf das als minimal notwendig erachtete Mass reduzierten und damit eben auch unpolitischen Form des gesellschaftlichen Selbstkontakts. 140 Ein Zeichen, das auch für Sehfeld steht, also im zunächst astronomischen Sinne für das, was man sieht, wenn man sich entschieden hat, was man vergrößern, für relevant erachten und sich damit einmal genauer ansehen will. 168 Steffen Roth Wettbewerbssphäre vor. Probleme ergeben sich dann, wenn die politische Öffentlichkeit (eben gedacht als System der Kommunikation verständigungsorientierter Bewusstseinssysteme) die Wirtschaft (vorzugsweise gedacht als System der Kommunikation konkurrenzorientierter Organisationen) in irgendeiner Form einbetten will. Dass die meisten landläufigen Unterscheidungen zwischen Öffentlichkeit und Markt dabei systematisch den Unterschied zwischen der Kommunikation zwischen Bewusstseinssystemen und der Kommunikation zwischen sozialen Systemen ignorieren, fällt meist kaum auf. Im Unterschied zu diesen und ähnlichen Kurzschlüssen argumentiert die Arbeit, dass es beide Formen der Kommunikationen in und – das wird die Pointe der folgenden Ausführungen sein – zwischen allen Funktionssystemen gibt. Wenn wir uns den Markt vor dem Hintergrund der bislang präsentierten Ausführungen als Form der Kommunikation zwischen (und in) segmentär differenzierten Gesellschaften vorstellen können, also als Form der Kommunikation zwischen (und in) den Reichen wie denen der Kelten und der Römer ebenso wie zwischen (und innerhalb) der Europäischen Union und Indien, dann stellt sich die Frage, warum sich Märkte nicht auch als Form der Kommunikation zwischen (und in) funktional differenzierten Gesellschaften beobachten lassen sollten? Kommen wir der Wahrheit näher, wenn wir „den Markt“ weiterhin ausschliesslich in nationale oder Status-Segmente unterteilen? Nein, denn logisch gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Unterschiede, die sich aus der segmentären Differenzierung ergeben, folgenschwerer sein sollten als jene, die sich aus der funktionalen Differenzierung ergeben. Unterscheidet sich die Schweizer Wirtschaft signifikanter von der Deutschen oder von der Schweizer Politik? Den Bogen weiter gespannt, lässt sich also abzielen auf die Idee, dass Organisationen und Märkte ebenso zwischen durch funktionale Differenzierung entstandenen Gesellschaftssystemen vermitteln können wie zwischen segmentär oder stratifikatorisch differenzierten. Mit anderen Worten: Wenn Organisationen und Märkte Kommunikation zwischen (und in) Frankreich und Turkmenistan oder zwischen (und in) den Reihen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer her- und darstellen können, dann auch zwischen (und in) Politik, Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 169 Wirtschaft, Wissenschaft, Religion oder Kunst. Abgesehen vom Alltagsgebrauch der „Marktmetapher“, sowie allenfalls von bereits hinlänglich beschriebenen (politischen) Motiven für die einseitige Marktbereinigung zugunsten der Ökonomie, spricht offenbar nichts dagegen, zumal von wissenschaftlicher Seite aus. Mit anderen Worten, es ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 11): Wenn die Gesellschaft (G) den Nexus aller Kommunikationen bezeichnet, dann steht der Markt (M) für den Nexus aller Kommunikationen zwischen Organisationen. Wie Gesellschaften im Allgemeinen, so lässt sich auch dieser Nexus entlang der drei bislang bekannten Differenzierungsformen (D) strukturieren. Mit anderen Worten: Ebenso, wie sich Gesellschaften nach Segmenten, Schichten und Funktionsbereichen differenzieren lassen, lassen sich auch Märkte nach eben diesen Mustern unterscheiden. Entsprechend gibt es US-Amerikanische, Ungarische oder Usbekische Märkte ebenso wie Luxus-, Premium- oder Massenmärkte und eben wirtschaftliche, politische oder wissenschaftliche Märkte (MD1, 2, ...) – mit anderen Wor- 170 Steffen Roth ten: Wenn Markt-Kommunikation zwischen (und in) den in USAmerika, Ungarn und Usbekistan differenzierten Gesellschaften der Gesellschaft (Luhmann 1997) möglich ist, dann auch zwischen (und in) Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, und zwar in beiden Fällen (nur) über Organisation141. Vor diesem Hintergrund wäre es ein weiteres Mal nicht nachzuvollziehen, warum die Kommunikation zwischen zwei sog. wirtschaftlichen Organisationen ‚Markt’, die zwischen einer dieser beiden Organisationen und einer nichtökonomischen bzw. die zwischen zwei nicht-ökonomischen dann aber als irgendeine Form von Nicht-Markt bezeichnet werden sollten, obwohl sie doch alle gleichermassen dem oben ausgeführten Marktprinzip folgen? Vor dem Hintergrund der bereits mehrfach angesprochenen Idee der organisationalen Polyphonie lässt sich diese Frage schliesslich noch radikaler stellen: Wenn eine Organisation, die 55% wirtschaftliche, 25% politische, 10% wissenschaftliche und 10% ästhetische Kommunikation betreibt, mit einer Organisation kommuniziert, die eine 35%/35%/20%/10%-Verteilung hat, wie können wir dann ohne den in diesem Abschnitt vorgestellten allgemeinen Marktbegriff überhaupt noch von Märkten sprechen? Vor dem Hintergrund der in diesem Absatz zusammengefassten und zugespitzten Argumente, und damit im Gegensatz zu ihrer wirtschaftssoziologischen Variante, sieht die hier skizziert allgemeine Soziologie des Marktes ihren Gegenstand in der Kommunikation zwischen sozialen Systemen, konkret also zwischen Organisationen, die ebenso national wie ökonomisch, und ebenso international wie nicht-ökonomisch geprägt sein kann. 141 Entsprechend ist Rudolf Stichweh (1995) nicht der einzige geblieben, der die Frage stellt, ob die uns so vertraute segmentäre Differenzierung der Weltgesellschaft in geopolitische Einheiten nicht längst einer Situation gewichen ist, in der die funktionale Differenzierung die Primär-Differenzierung darstellt. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 171 Kapitel VI Neue Märkte! Aussichten einer allgemeinen Marktsoziologie So vielstimmig der wirtschaftssoziologische Diskurs auch sein mag, in einem Punkt ist sich das Gros der Wirtschaftssoziologien doch einig: Bei Märkten handelt es sich um einen Untersuchungsgegenstand, dessen Form, dessen Funktion und vor allem dessen Prinzip zwingend der Wirtschaft zugeordnet und auf diese beschränkt bleiben muss; Märkte in nicht-ökonomischen Sphären der Gesellschaft gibt es entweder nicht, oder wenn doch, dann haben sie dort nichts zu suchen. Die von der Wirtschaftssoziologie mal als Sachtatbestand, mal als Werturteil angemahnte soziale Einbettung der Märkte in die Gesellschaft vollzieht sich damit immer als eine Eindämmung in die Wirtschaft, die dann ihrerseits zivilisiert werden soll. Dieser Gedanke aus der Grauzone zwischen Logik und Norm hat spätestens seit der Krise wieder Konjunktur: Der Umstand, dass die aktuell kolportierte Krise auch auf nicht-ökonomische Systeme über zu greifen scheint, hat dann weniger mit deren eigenen Problemen als vielmehr einmal mehr mit einer „Anspruchsinflation des Wirtschaftssystems“ (Beckert 2009b) zu tun. Einmal mehr gilt es dann, den Rest der Gesellschaft vor der Wirtschaft zu schützen. Dabei kann man auf einer bis mindestens in die Frühzeit des Christentums hineinreichenden Tradition des Ressentiments gegen den – selbstverursachten – Kurzschluss von „Ökonomisierung und Vermarktlichung“ (Pohlmann 2006: 230) aufbauen, so dass uns noch heute, vorzugsweise im Kontext der Globalisierung, der Markt als ein rein ökonomisch verfasstes Einfallstor des Fremden erscheint. 172 Steffen Roth Gleichwohl uns Viviane Zelizer also bereits 1988 vorgeführt hat, dass man gar das Geld auch nicht-ökonomisch schauen kann, bleibt der Markt der Wirtschaftssoziologie selbst als ‚soziale Struktur’ noch Wirtschaft, in die sich dann selbst das Kunstwerk verwandelt, sobald es mit dem Midas Markt in Berührung kommt. Der wirtschaftssoziologischen Marktsoziologie ist dieses Tabu folglich auch nicht Thema sondern Existenzgrundlage: Die Limitierung des marktförmigen Fremdkontaktes auf die Ökonomie (vgl. Humphreys 1969: 185) und die Vertreibung nicht-ökonomischer Funktionssysteme vom Binnenmarkt (Arendt 1958: 160) wird somit nicht reflektiert, sondern schlicht tradiert. Als selbsternannte Marktwacht marschiert die Wirtschaftssoziologie dabei beständig an ihren eigenen Grenzen: Die Anwendung des Marktprinzips bei Schlachtrechten und Arbeit ist ihr Wirtschaft, dessen Übergriff auf Wählerstimmen und Liebe dagegen Korruption und Prostitution. Trotz aller, zumal vornehmlich aus den eigenen Reihen stammenden, Evidenzen gilt für die Wirtschaftssoziologie nach wie vor M ⊂ W: der Markt ist eine Teilmenge der Wirtschaft und nur der Wirtschaft, die man allenfalls wieder bewusster als soziale Struktur und damit eben auch als Teil der Gesellschaft begreift. Wenn der Markt als Teil der Wirtschaft seinerseits Teil von Gesellschaft ist, was ist mit der Vision einer besseren gesellschaftlichen Einbettung des Marktes dann eigentlich noch gesagt? Vordergründig nicht viel, und doch zeichnet sich vor dem Hintergrund dieser Frage das eigentliche Problem der Idee der ökonomischen und nur ökonomischen Märkte ab: Es handelt sich bei ihr um ein von starken Denkgewohnheiten geleitetes, aber logisch nicht durchführbares Spiel mit dem Konzept der funktionalen Differenzierung, an dessen Ende nur die Einsicht stehen kann, dass es eben doch auch nicht-ökonomische Märkte geben muss, und damit notwendiger Weise eine über die Wirtschaftssoziologie hinaus verweisende Marktsoziologie. Die Begründung dieser These verfolgte die Arbeit auf vier Wegen: Erstens zeigte sie mit Verweis auf die Arbeiten von James Coleman, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann und Dirk Baecker, die von einschlägigen Wirtschaftssoziologen allesamt als Fachkollegen zitiert Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 173 werden, dass die Idee nicht-ökonomischer Märkte durchaus bereits im wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs verankert ist. Auf den Beiträgen dieser Autoren konnte die Arbeit zweitens nicht nur inhaltlich aufbauen, sondern auch strategisch im Hinblick auf ihr Anliegen, einen über die Ökonomie hinausweisenden Marktbegriff nicht einfach als nur eine Alternative neben den der Wirtschaftssoziologie zu stellen, sondern ihn vielmehr als einzig logische Alternative aus deren eigenen Diskurs herauszuschälen. Gelungen ist das durch Anwendung einer systemtheoretisch informierten Mengenlehre, die letztlich auch gegen den ebenfalls rein ökonomischen Marktbegriff der Systemtheorie gewendet werden konnte: Wenn der Markt ein Teilsystem der Wirtschaft und nur der Wirtschaft darstellt (M ⊂ W), und Wirtschaft ein Teilsystem von Gesellschaft (W ⊂ G), dann lässt sich eine stärkere gesellschaftliche Einbettung des Marktes nur erreichen, wenn man entweder Die Wirtschaft ihrerseits stärker in die nicht-wirtschaftlichen Teilsysteme der Gesellschaft (G\W) und damit in ihre eigene Komplementärmenge integriert (W ⊂ G\W), oder Den Markt eben sowohl in der Wirtschaft als auch in deren Komplementärmenge verankert (M ∩ W ∧ M ∩ W’). Während die erste Variante logisch nicht machbar ist (W ⊂ G\W = W ⊂ W’), zeigt die zweite Variante, dass eine stärkere soziale Einbettung des Marktes nur denkbar ist, wenn man von der Idee reinökonomischer Märkte absieht (M ∩ W ∧ M ∩ W’ ≠ M ⊂ W). Mit anderen Worten: Dem wirtschaftssoziologisch prominent vorgetragenen Anliegen der stärkeren sozialen Einbettung von Märkten trägt man nur dann Rechnung, wenn man die Existenz von Märkten in nicht-wirtschaftlichen Teilsystemen anerkennt; ein wirtschaftlicher Markt lässt sich nicht in nicht-ökonomische Teilsysteme der Gesellschaft einbetten, schlicht weil man Wirtschaft nicht in Politik, Wissenschaft oder Religion einbetten, etwas Wirtschaftliches eben keine Teilmenge von etwas Politischem, Wissenschaftlichem oder Religiösem sein kann. Die Idee der sozialen Einbettung verlangt also nach einem trans-ökonomischen Marktbegriff. 174 Steffen Roth Zu diesem strategischen Argument passt, dass drittens auch historische, archäologische und ethnologische Spuren nichtökonomischer, trans-ökonomischer oder eben „totaler“ (Mauss 1990) Märkte gesichert werden konnten, die bis in die Frühzeit der Gesellschaftsbildung reichen. Entsprechend gesellte sich zum strategischen auch ein rein logisches Argument: Märkte sind Phänomene älter als die funktionale Differenzierung. Eine eigenständige, allgemeine Marktsoziologie muss demnach einen Marktbegriff vorlegen, mit dem sich auch Markt-Phänomene beobachten lassen, die weiter zurückliegen als die Ausdifferenzierung des Funktionssystems Wirtschaft. Auch wer dem Argument nicht gleich folgen mag, muss einräumen, dass es in jedem Fall zunächst eines Gegenstandes bedarf, auf den man funktionale Differenzierung gewissermassen anlegen kann, bevor sich überhaupt von – zumal exklusiv – ökonomischen Märkten sprechen lässt. Im Gegensatz zum wirtschaftssoziologischen Marktbegriff muss eine eigenständige, allgemeine Marktsoziologie demnach den Markt als einen Forschungsgegenstand ausweisen, auf den man funktionale Differenzierung anwenden kann, ohne deren Anwendung bereits vorausgesetzt haben zu müssen. Im Rückgriff auf die empirischen Spuren sowie eine transökonomisch gewendete Theorie sozialer Systeme entwickelte die Arbeit viertens einen allgemeinen Marktbegriff, der diesen Ansprüchen genügt. Ausgangspunkt hierfür war die grundlegende Frage: Warum gibt es Märkte? Oder mit anderen Worten: Welches Problem lösen Märkte, und verdanken ihm so ihre Existenz? Die Antwort lautete: Märkte lösen das Problem der Kommunikation zwischen Gesellschaft, das nicht nur theoretisch recht heikel ist. Denn als Gesamtheit aller Kommunikationen können Gesellschaften, d.h. das Gesamtsystem sozialer Beziehungen in eben seiner Gesamtheit, nachvollziehbarer Weise nicht kommunizieren. Vor dem Hintergrund dieser Idee konnte die Notwendigkeit der Entstehung von Organisationen als den einzigen sozialen Systemen, die in der Lage sind, mit (sozialen) Systemen in ihrer Umwelt zu kommunizieren (Luhmann 1997: 834), nachvollzogen werden. Konkret geschah das mit Blick auf das Phänomen des Silent Trade (Grierson 1980: 25ff), der als eine Urform des Markttausches gehandelt wird, die sich unter den Bedingungen Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 175 der Unkenntnis des Tauschpartners sowie der Unbeobachtbarkeit des unmittelbaren „Tauschaktes“ vollzieht. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der Lebensrealität frühmenschlicher Existenzen musste angenommen werden, dass die „Tauschakteure“ nur eines sicher wissen konnten: dass keiner der Tauschpartner allein bzw. ein einzelnes Individuum war. Entsprechend konnte geschlossen werden, dass es sich bei diesen frühen Märkten um eine spezifische Form der Kommunikation handelt, eben um die Kommunikation nicht zwischen personalen, sondern zwischen sozialen Systemen, die schlusslogisch nur durch Organisationen als den einzigen zur Kommunikation befähigten sozialen Systemen realisiert werden kann. Dabei konnte mit Blick auf die Veränderungen, die die Existenz eines Austausches mit fremden Gesellschaften im Inneren der beteiligten Gesellschaften mit sich bringt (konkret etwa den Zwang zur Entscheidung, was sowohl entbehrlich, als auch relevant genug ist, um „auf den Markt“, also die anfangs sichtbar neutrale Sphäre zwischen den beteiligten Gesellschaften, gebracht zu werden), gezeigt werden, dass die Entwicklung von Organisation und Markt einander bedingen, dass beide Formen ko-evoluieren und so zwei Seiten ein- und derselben Medaille sind. So konnte Organisation (und nicht etwa Ökonomie) als einzig notwendige Voraussetzung bzw. Komplementärbedingung für die Entstehung von Märkten präsentiert werden. Oder zur Definition gewendet: Der Begriff Markt bezeichnet (den Anschluss der) Kommunikation zwischen Organisationen, ausdrücklich also Kommunikation zwischen sozialen Systemen, die sich so systematisch von der Kommunikation zwischen Personen bzw. psychischen Systemen unterscheiden lässt. Damit konnte ein logisch schlüssiger, ebenso universeller wie trennscharfer Marktbegriff entwickelt werden, der der funktionalen Differenzierung und damit einer apriorischen Assoziation des Marktes mit der Wirtschaft in keiner Weise bedarf, auf den die Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Märkten also ebenso neutral angelegt werden kann wie die zwischen usbekischen und nicht-usbekischen. Nicht im Gegensatz zum Marktbegriff der Wirtschaftssoziologie, wohl aber weit über ihn hinausgehend, konnte damit der Gegenstand einer allgemeinen Markt- 176 Steffen Roth soziologie bestimmt werden als der der Kommunikation zwischen sozialen Systemen, konkret also Organisationen, die prinzipiell ökonomischer wie nicht-ökonomischer Natur sein kann. Ein solcher Markt-Begriff füllt dann auch insofern die in Kapitel IV und hier vor allem im dritten Abschnitt präsentierte Forschungsund Theorielücke, die sich aus der an dieser Stelle besprochenen Frage ergab, ob tatsächlich angenommen werden kann, dass sich mittlerweile empirisch ausführlich beschriebene polyphone, d.h. also transökonomische Organisationen (Andersen 2003) in ihrem mittlerweile hinlänglich dokumentierten Bezug auf immaterielle, intangible oder nicht-ökonomische Ressourcen, Kompetenzen oder Kapitalien, tatsächlich ausschliesslich auf ökonomische Märkte kaprizieren? Oder anders gewendet: Wenn wir also geneigt sind, die Kommunikation zwischen zwei zumindest primär ökonomisch orientierten Organisationen Markt zu nennen, warum dann nicht auch die politische Kommunikation zwischen eben diesen beiden Organisationen oder zwischen zwei (zumindest primär) politischen, wissenschaftlichen oder religiösen Organisationen? Da gezeigt werden konnte, dass es keinerlei logisch begründbare Wahlverwandtschaft zwischen Markt und Wirtschaft gibt, kann auf Grundlage des von der Arbeit entwickelten Marktbegriffes zweifellos festgestellt werden, dass es nichtökonomische Märkte gibt, und damit jedwede Art von Kommunikation auch zwischen den polyphonsten oder eben transökonomischsten Organisationen einen Fall von Marktkommunikation darstellt. Der wiederholte Verweis auf die mit deren Zuspitzung zunehmend ausgeprägten logisch-theoretischen Qualitäten der Arbeit soll dabei nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass die Arbeit weder aufgezeigt hat, wie es zur ökonomischen Kolonialisierung des Marktes kommen konnte. Ebenso wenig wurden neben diesem historischen Ansatz alternative Formen des empirischen Feldzugangs gewählt. Gegenstand der Arbeit waren damit also weniger empirische Märkte als vielmehr Formen der wirtschaftssoziologischen Beschreibungen von Märkten, die vor allem im Kapitel III dargestellt wurden. Gegen den Aufbau dieses Kapitels lässt sich nun einwenden, dass es die einzelnen wirtschaftssoziologischen Marktkonzepte mehr nacher- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 177 zähle denn theorie- oder paradigmengeschichtlich diskutiere. Dieser Einwand, so er denn trifft, zielt dann allerdings am Anliegen der Arbeit im allgemeinen sowie des Kapitels im besonderen vorbei, dem es nicht um eine ideengeschichtliche Rekonstruktion des wirtschaftssoziologischen Marktdenkens ging, sondern schlicht um eine Sammlung von wirtschaftssoziologischen Varietäten des Kurzschlusses zwischen Markt und Wirtschaft sowie um die Vorbereitung der in den darauffolgenden Kapitel angebotenen Begründung des Gedankens, dass – wenn nicht die Wirtschaftssoziologie selbst – dann zumindest die Soziologie besser daran täte, diesen Kurzschluss zu beseitigen. Mit Blick auf die entsprechende Beweisführung liesse sich der Arbeit dann vorwerfen, dass sie ein Konzept nicht-ökonomischer Märkte hergeleitet hat, ohne jemals mit einer eigenen Definition von Wirtschaft aufzuwarten. Hinter dieser Kritik steckt dann der Gedanke, dass man erst einmal definieren müsse, was ein ökonomischer Markt sei, bevor man entsprechend nicht-ökonomische Märkte unterscheiden könne. Genau diesen Gedanken korrigiert die Arbeit aber ebenso ausdrücklich wie ausführlich entlang des Arguments, dass man erst einmal einen allgemeinen Marktbegriff haben muss, bevor man überhaupt von spezifisch wirtschaftlichen Märkten sprechen kann. In diesem Sinne liegt dann auch der Vorteil einer allgemeinen Markttheorie darin, dass sie sich nicht-ökonomische Märkte auch dann weiter erschliessen kann, wenn die Wirtschaftssoziologie einen definitorischen Konsens in Bezug auf deren eigentlichen Kerngegenstand, die Wirtschaft, einmal schuldig bleiben sollte. Qualifizierte Auskünfte zur Spezifik ökonomischer Märkte erhofft man sich zukünftig also von einer marktsoziologisch informierten Wirtschaftssoziologie. Schliesslich lässt sich zukünftig auch die methodische Dimension der Arbeit vertiefen, allen voran etwa das Verhältnis von Mengenlehre und Systemtheorie vor dem Hintergrund möglicher formtheoretischer Alternativen diskutieren. Zweifellos kann die Arbeit aber auch bereits auf eine Reihe solider Anknüpfungspunkte für durchaus lohnenswerte Forschungsunternehmen verweisen: 178 Steffen Roth Zum einen stellt sich die Frage nach der Spezifik der Marktkommunikation, also der Kommunikation zwischen Organisationen im Unterschied zur Kommunikation zwischen Personen. Damit sei auf einen Fragenkomplex verwiesen, der sich mit Blick auf Abbildung 12 konkretisieren lässt: Kommunikation (KA) entsteht als Lösung des Problems der wechselseitigen Abstimmung von Personen (P), also Systemen, denen sich Bewusstsein (B) unterstellen lässt (vgl. Luhmann 1987: 153ff). Wenn wir uns nun vorstellen, dass die Gesamtheit der Kommunikationen zwischen den Personen Pa-m auf der eine Seite und die der Kommunikationen zwischen den Personen Pn-z auf der anderen keinerlei Schnittmenge aufweist, dann lässt sich von der Existenz der Gesellschaften G1 und G2, also zweier eigenständiger, voneinander gänzlich unabhängiger sozialer Systeme sprechen, und damit eine Situation vorstellen, die in früheren Phasen der Gesellschaftsentwicklung durchaus nicht unüblich war. Die jeweilige Kommunikation zwischen Personen (KA) war demnach das konstituierende Gesellschaftsprinzip. Das Aufeinandertreffen zweier solcher bis dato isolierter Gesell- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 179 schaften verändert die Situation aber nun insofern, als dass sich – wie weiter oben bereits ausgeführt - zum Problem der Abstimmung zwischen Personen noch ein weiteres kommunikatives Problem gesellt: Das der Abstimmung zwischen Gesellschaften, also transpersonalen, sozialen Systemen. Wie ebenfalls gezeigt, löst die Idee vom Markt als Form der Kommunikation zwischen Organisationen das Problem der doppelten Kontingenz auf der Ebene sozialer Systeme. Die Frage, ob es sich bei der Kommunikation zwischen sozialen Systemen (KB) dann aber noch um (spezifischere Formen der) Kommunikation vom Typ KA oder aber um eine logisch eigenständige Form der Kommunikation handelt, muss an dieser Stelle offen gelassen werden, nicht ohne den Hinweis allerdings, dass es sich bei der Klärung dieser Frage nicht nur um eine theoretisch spannende, sondern letztlich auch um eine für die Sozialforschung äusserst fruchtbare handeln kann. Denn im Sinne von ersten Vorüberlegungen lässt sich bereits vermuten, dass KB eine Menge darstellt, die eben keine Schnittmenge mit G1 und G2 aufweist: Einigermassen logisch begründet lässt sich argumentieren, dass das Problem der Kommunikation zwischen zwei zum Zeitpunkt to isolierten Gesellschaften eben nur über die Entstehung eines beiden Gesellschaften übergeordneten kommunikativen Zusammenhangs (G0(t1)) gelöst werden kann142. Entsprechend liesse sich dann analog fragen, ob es sich bei G0 nun um eine neue, oder doch eben wieder nur um die Gesellschaft handelt. Schliesslich ergibt sich rein kreuztabellarisch eine dritte Form der Kommunikation, namentlich die zwischen psychischen und sozialen Systemen (KC), bei der sich das Problem ergibt, dass beide Systeme zwar zum einen zur Kommunikation mit 142 Die Idee, Kommunikation zwischen Gesellschaften über die Kommunikation zwischen Personen herleiten oder gar herstellen zu wollen, führt bereits rein logisch nicht zur Kommunikation zwischen existierenden, sondern zum „Herbeikommunizieren“ neuer Gesellschaften. Entsprechend begegnet uns im inter-systemischen Austausch dann auch die Figur des Repräsentanten, dessen Wort eben gerade nicht persönliche Neigung und Motive, sondern soziale Präferenzen und damit die Organisation einer Gesellschaft widerspiegelt, und das nicht nur im Aussenkontakt mit einigem Erfolg: Noch heute spiegelt sich die Organisation der Gesellschaft – vorzugsweise ausschnittsweise – gerne in Form der Staats- oder Amtsperson. 180 Steffen Roth Systemen in ihrer Umwelt befähigt sind, sich zum anderen aber kaum davon ausgehen lässt, dass Bewusstseins- und soziale Systeme einander ohne erhebliche Fehleinschätzung als alter ego wahrnehmen können. Im Falle der Kommunikation zwischen Personen und Organisationen wäre Verständigung also nicht nur – wie in den anderen beiden Fällen – tendenziell unwahrscheinlich, sondern das Missverständnis vielmehr Funktionsgrundlage – eine Idee, die im Bezug auf Probleme der Corporate Social Responsibility oder der zivilgesellschaftlichen Einbettung der organisierten Wirtschaft spannende Einblicke verspricht. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob und wie sich die Kommunikation zwischen Organisation und Person, und dabei dann eben auch der Anschluss zwischen diesen Kommunikationen, denken und beobachten lässt. Oder anders gefragt: Wie reagieren sozial bewegte Personenkreise darauf, dass ihnen die von ihnen kritisierte Organisation ihrerseits Organisation und damit Berechnung unterstellt? Und wie gehen Organisationen mit der umgekehrten Zumutung um? Als ein weiterer Ausgangspunkt für ambitionierte Forschungsvorhaben bietet sich das schlichteste Argument der Arbeit an: Märkte, und damit eben auch das Prinzip der Organisation, sind älter als funktionale Differenzierung, oder setzen diese zumindest nicht zwingend voraus. Entsprechend interessant wäre es eben, Märkte nicht nur alternativ zum bisherigen ökonomischen Marktverständnis funktionsneutral als Kommunikation zwischen Organisationen zu beobachten, sondern dies eben auch im Kontext von Gesellschaften zu betreiben, die sich nicht (primär) über funktionale Differenzierung definieren. Vor diesem Hintergrund stellt die Idee eines Projektes zu den „Markets in the emerging markets“ mehr als ein Wortspiel dar. Die Idee nicht-ökonomischer Märkte bzw. eines transökonomischen Marktes, der neben einem ökonomischen (Teil-) Markt eben auch aus nicht-ökonomischen Teilmärkten besteht, führt uns schliesslich zu einer letzten durchaus reizvollen Idee: Die Anwendung der segmentären Differenzierung auf das Konzept Markt versetzt uns in die Lage, deutsche von armenischen von südafrikanischen Märkten zu unterscheiden. Zunächst, mit dem üblichen Hauptaugenmerk auf der Ökonomie, begegnen wir dabei dann dem Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 181 Problem der Kommunikation nicht nur zwischen den Organisationen auf oder in den jeweiligen nationalen Märkten, sondern eben auch dem der Beziehungen zwischen den Märkten selbst, mit anderen Worten: dem Konzept der Wechselkurse. Indem wir einen allgemeinen Marktbegriff vorgelegt haben, der die prinzipiell gleichwertige Anwendung der segmentären wie der funktionalen Differenzierung auf das Prinzip Markt ermöglicht, sehen wir uns nun in die Lage versetzt, die Frage nach den Wechselkursen nicht nur zwischen den Märkten nationaler Segmente, sondern eben auch zwischen den Funktionsbereichen der Gesellschaft zu stellen (vgl. Abb. 13). Entsprechend lässt sich die Hypothese formulieren, dass es – ähnlich den Wechselkursen zwischen Euro, Dollar und Kronen – Wechselkurse zwischen politischen, ästhetischen, wissenschaftlichen oder 182 Steffen Roth eben auch ökonomischen Werten und Währungen gibt143. Entsprechend könnten sich dann auch Wechselkursschwankungen oder der Aufstieg und Niedergang von Leitwährungen beobachten lassen: Beim aktuellen Marktwert der Wirtschaft gegenüber der Politik oder Religion würde es sich demnach nicht um eine irgendwie auch immer geartete Konstante handeln, die auf der zunehmenden Organisierung der Gesellschaft beruht, sondern um eine Momentaufnahme. Gerade der kontrastive Blick auf den ehedem hohen relativen Wert der Religion im Abendland zeigt dann auch, dass der Idee, dass gewisse Dinge nicht auf den Markt gehörten und es eine Instanz mit der entsprechenden Entscheidungskompetenz geben müsse, etwas Mittelalterliches anhaftet. Im Gegensatz dazu zeigen Erinnerungen, die über das Zeitalter des Primats der einen Religionen hinausreichen, dass gesellschaftliche Selbstbeschreibung sich durchaus religiös verfassen kann, ohne damit zwangsläufig das Primat der einen (und damit selbst der religiösen) Funktion über die andere zu verfassen: Im antiken Griechenland galt der aktuelle Stellenwert, den ein amtierender Herrscher den einzelnen Göttern im funktional bereits einigermassen gut ausdifferenzierten Pantheon einräumte, durchaus bereits als Indikator für dessen Wertepräferenzen (Watson und Badal 2006: 168). In diesem Universum hat dann auch der Markt seinen Schutzgott: Während Zeus über Freundschaft, Gastrecht, Hochzeitsnacht und die Stadt wachte (also alles, was das System ausmachte und reproduzierte), zählte Hermes als Der Gott, der den Markt erfand (Pinter 2000), neben Hunden vor allem eben Diebe, Künstler und Händler (die Umwelt) zu seinen Schützlingen. Dabei zeigt sich nicht nur, dass über den Markt neben Ökonomen auch (Lebens-) Künstler in die Stadt kamen, sondern eben auch, dass die Entscheidung, als Zeus’ Nachfolger das Gastrecht mehr auf die einen denn auf die anderen anzuwenden, eben nichts anderes als eine Entscheidung mit Alternativen darstellte144. Damit soll an dieser Stelle nicht mehr als angedeu143 Auf Grundlage des in dieser Arbeit vorgelegten allgemeinen Marktbegriffs weist der Begriff der Wechselkurse dabei ausdrücklich über dessen rein „symbolischen“ Gebrauch bei Talcott Parsons und Niel Smelser (2003: 77) hinaus. 144 Einmal mehr erinnern wir an dieser Stelle an die Idee des Marktes als Form des entschieden limitierten Kontaktes (Humphreys (1969: 185) und die Moti- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 183 tet werden, dass es leicht so hätte kommen können, dass wir den Markt heute mit Kunst und nicht ausgerechnet mit der – bis in den Städtebau der damaligen Zeit hinein nachvollziehbar – randständigen Funktion der Wirtschaft assoziieren würden. Eine Untersuchung der Umstände, die zu dieser spezifischen Form der Ökonomisierung geführt haben, steht noch aus. Das Anliegen der vorliegenden Arbeit war es, zunächst einen allgemeinen Marktbegriff zu formulieren, auf dessen Grundlage sich ein solches Forschungsgebiet überhaupt erst erschliessen lässt. Gleichzeitig konnte die Arbeit auf der Grundlage empirischer Befunde der Wirtschaftssoziologie sowie einen über deren Denktraditionen hinausgehenden Marktbegriff zeigen, dass die Ökonomisierung des Marktes weder total ist, noch total sein kann. Mit Blick auf eben die Stellung, die die Religion als Gravitationszentrum der Gesellschaft des Mittelalters inne hatte, kann man nun auch ein etwaiges Primat des Wirtschaftsmarktes als historisch kontingent begreifen (vgl. Abb. 14). ve, die Hannah Arendt (1956: 160) den betreffenden Entscheidungen des Prinzips unterstellt, die sie in „den Herrschenden“ repräsentiert sieht. 184 Steffen Roth Die Idee von den Wechselkursen zwischen Religion, Wirtschaft, Politik, Kunst, etc und damit die von der prinzipiell schwankungsfähigen relativen Wertigkeit der einzelnen Funktionssysteme, ermöglicht dann neue Ein- und Ausblicke in und auf soziale Systeme und deren Märkte. So liesse sich etwa der Gedanke weiter verfolgen, dass in jeder Organisation mal das eine, mal das andere Funktionssystem im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, manche dabei aber eben doch häufiger als andere, sodass sich zumindest für eine bestimmte Zeit der Eindruck einstellt, es handle sich bei diesen Organisationen um Organisationen der Wirtschaft, der Politik, des Sportes oder der Kunst. Mehr und mehr begreifen wir dieses monophone Bild der Organisation jedoch als unvollständig, erkennen im Sportverein, der Universität und selbst in der Bank also polyphone Organisationen, die sich bewusst auf viele, wenn nicht gar alle Funktionssysteme beziehen. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Marktbegriff kaum mehr einzig auf die Kommunikation zwischen monophonen, wirtschaftlichen Organisationen anwenden. Der Markt ist demnach die Sphäre der Kommunikation zwischen polyphonen Organisationen, was nicht nur bedeutet, dass die einzelnen Organisationen in ökonomischer und nicht-ökonomischer Hinsicht am Markt konkurrieren und kooperieren können, sondern auch, dass damit die einzelnen Funktionssysteme ihrerseits in Konkurrenz zueinander beobachtet werden können: Wenn oft zugunsten wirtschaftlicher Gesichtspunkte entschieden wird, dann bedeutet das eben auch, dass nur entsprechend selten ein politisches, künstlerisches oder religiöses Argument den Ausschlag gibt. Entsprechend lassen sich soziale Systeme bis hin zu ganzen Gesellschaften durchaus gewinnbringend danach beobachten und unterscheiden, welchen Stellenwert die einzelnen Funktionssysteme zueinander haben: Dabei zeigt sich dann auch, dass modische Begriffe wie Nachhaltigkeit zu kurz greifen, wenn sie nicht angeben, ob damit etwa politische, ästhetische oder religiöse Nachhaltigkeit gemeint ist, und vor allem, was zu tun sei, wenn die einzelnen Nachhaltigkeitsverständnisse einander widersprechen: Was also, wenn das wirtschaftlich Nachhaltige (Schuldenabbau) nicht auch das politische Nachhaltige (Wiederwahl) zu sein scheint? Was, wenn sich wissenschaftlich zeigen liesse, dass Demokratie krank macht? Wenn sich Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 185 abzeichnet, dass die avantgardistische Architektur in die totalitäreren Staaten der Erde abwandert? Jedes soziale System hat mehr oder weniger „bewusste“ Mechanismen zur Lösung dieser und ähnlicher Problemlagen, die sich aus der Notwendigkeit des Vergleichs bzw. der Verrechnung an sich inkommensurabler Alternativen ergeben. Mit anderen Worten: In Form von Organisation, im Medium des Marktes, rechnen alle soziale Systeme mit allen Funktionssystemen, und lassen sich nach den Lösungen unterscheiden und vergleichen, die sie für diese Aufgaben finden. Halten Kanadier Politik für relevanter als Wirtschaft? Geben Georgier im Zweifelsfall der Wissenschaft oder dem Erziehungssystem den Vorzug? Was ist das wichtigste Funktionssystem der Luxemburger? Welchen Sinus-Milieus gilt Kunst mehr als Gesundheit? Auf Grundlage eines allgemeinen Marktbegriffes, der die Anwendung der funktionalen Differenzierung auf das Phänomen Markt nicht bereits implizit voraussetzt und damit überhaupt erst möglich macht, lassen sich diese und ähnliche Fragen nach dem relativen Wert der Funktionssysteme und dessen Wandel in Zeit und Sozialraum bereits recht geschmeidig operationalisieren. Vielleicht steht am Ende entsprechender Untersuchungen tatsächlich das Ergebnis, dass unsere Intuition durchaus richtig liegt, und unser gesellschaftliches Sonnensystem aktuell tatsächlich um einen politökonomischen Doppelstern kreist. Und doch zeigt uns ein letzter Blick auf die zentrale Stellung der Religion im Mittelalter, dass die Gravitationskräfte der gesellschaftlichen Funktionssysteme ihrerseits den Gesetzen der Zeit unterliegen. Die Möglichkeit einer Kopernikanischen Wende ist damit immer gegeben. Auf der Grundlage eines allgemeinen Marktbegriffes erscheint uns diese Wende dann weniger als Gegenstand der Hoffnung oder als Wunder, denn schlicht als Ergebnis jederzeit aktualisierbarer Entscheidungen. 186 Steffen Roth Abbildungsverzeichnis Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14 Ökonomische Märkte als Forschungslücke Die Welt als Einheit der Differenz von System und Umwelt Die Gesellschaft der Wissenschaft und die Gesellschaft der Wirtschaft Die Kernaussage der Idee rein wirtschaftlicher Märkte Polyphone Organisationen und multiple Markteinbettung, aber nur ein ökonomischer Markt? Der Markt als innere Umwelt der Wirtschaft der Gesellschaft Der Markt als innere Umwelt der organisierten Wirtschaft Der Markt als (innere) Umwelt der Organisation Das Problem der Obermenge und der Komplementärmenge des rein wirtschaftlichen Marktes Der Markt als Gesellschaft der Organisation Allgemeines Modell der Differenzierung von Märkten Drei Formen der Kommunikation Die Wechselkurse der Gesellschaft Die funktionalen Gravitationszentren der Gesellschaft 86 125 127 129 145 148 152 154 163 166 169 178 181 183 Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 187 Abkürzungsverzeichnis ⊂ ⊄ ≠ ∩ ∧ \ ’ Fn. o.g. sog. u.U. v.a. Ist Teilmenge von Ist nicht Teilmenge von Ist nicht Ist Schnittmenge von Und Ohne, minus (Etwa C=A\B, d.h. C ist die Menge A ohne deren Teil-Menge B) Ist Komplementärmenge von (etwa C=B’, d.h. C ist die Komplementärmenge von B) Fussnote Oben genannte/r/s Sogenannte/r/s Unter Umständen Vor allem 188 Steffen Roth Literaturverzeichnis Allemann-Ghionda, Cristina (2003): The Yellow Streetcar: Shaping a Polyphonic Identity. In: T. Tokuhama-Espinosa (Hrsg.): The multilingual mind: issues discussed by, for, and about people living with many languages. London: Greenwood Press. Andersen, N. A. (2000): ”Public Market – Political Firms. In: Acta Sociologica 43/1, S. 43-61. Andersen, N. A. (2003): Polyphonic Organizations. In: T. Hernes und T. Bakken (Hrsg.): Autopoietic Organization Theory. Drawing on Niklas Luhmann's Social System Perspective. Copenhagen, S. 151-182. Andersen, N. A. (2003b): Discursive analytical strategies – Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Bristol: Policy Press. Akerlof, G. (1984): An Economic Theorist’s Book of Tales. New York: Cambridge University Press. Albert, H. (1998): Marktsoziologie und Entscheidungslogik: Zur Kritik der reinen Ökonomik. Tübingen: Mohr Siebeck. Aldrich, H. E. (1985): The origins and persistence of social networks. In: Marsden, P.V. (Hrsg.): Social structure and network analysis. Beverly Hills: Sage, S. 281-293. Arendt, H. (1958): The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 189 Arendt, H. (1993): Between past and future: eight exercises in political thought. New York: Penguin Books. Arnoldi, J. (2007): Introduction: The Richness of Markets. In: Theory, Culture and Society 24/7-8, S. 91-96. Aspers, P. (1999): The Economic Sociology of Alfred Marshall. An Overview. In: American Journal of Economics and Sociology 58, S. 651-667. Aspers, P. (2005): Markets in Fashion. A Phenomenological Approach. London: Routledge. Aspers, P. (2005b): Markets, Sociology of. In: J. Beckert und M. Zafirovski (Hrsg.): International Encyclopedia of Economic Sociology. London and New York: Routledge. Aspers, P. (2007): Theory, Reality, and Performativity in Markets. In: American Journal of Economics and Sociology 66/2, S. 379-398. Aspers, P. und J. Beckert (2008): Märkte. In: Andrea Maurer (Hrsg.), Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 225-246. Badura-Lotter, G. (2005): Forschung an embryonalen Stammzellen: Zwischen biomedizinischer Ambition und ethischer Reflexion. Frankfurt am Main: Campus. Baecker, D. (1986): Information und Risiko in der Marktwirtschaft. Dissertationsschrift an der Universität Bielefeld. Baecker, D. (1993): Die Metamorphosen des Geldes. In: J. Kintzelé und P. Schneider (Hrsg.): Georg Simmels ‚Philosophie des Geldes’. Frankfurt am Main: Hain, S. 286-300. 190 Steffen Roth Baecker, D. (1994): Die Wirtschaft als selbstreferentielles soziales System. In: E. Lange (Hrsg.): Der Wandel der Wirtschaft. Berlin: Edition Sigma, S. 17-45. Baecker, D. (2001): Kapital als strukturelle Kopplung. In: Soziale Systeme, 5/2, S. 313-327. Baecker, D. (2002): Die Form der Zahlung. In: C. Deutschmann (Hrsg.): Die gesellschaftliche Macht des Geldes. Leviathan, Sonderheft 21/2002. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 73-82. Baecker, D. (2003): Geldfunktion und Medienkonkurrenz. In: Ders. (Hrsg.): Viele Gelder. Berlin: Kulturverlag Kadmos, S. 12-30. Dirk Baecker (2004): Rechnen lernen. In: Ders. (Hrsg.): Wozu Soziologie? Berlin: Kulturverlag Kadmos, S. 299-330. Baecker, D. (2006): Wirtschaftssoziologie. Bielefeld: Transcript. Baecker, D. (2006b): Markets. In: A. Harrington, B. Marshall und H.-P. Müller (Hrsg.): Encyclopedia of Social Theory. London und New York: Routledge, S. 333-335. Baecker, D. (2007): Wozu Gesellschaft? Berlin: Kulturverlag Kadmos. Baecker, D. (2008): Wirtschaft als funktionales Teilsystem. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 109-123. Baecker, D. (2008b): Gott rechnet anders. Manuskript zu einem Vortrag in der Reihe ‚Capitalism Now’ am Theater Freiburg (Großes Haus) am 6. April 2008, *.pdf, 23 Seiten). Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis: University of Minnesota Press. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 191 Baraldi, C., G. Corsi und E. Esposito (1999): GLU. Glossar zu Niklar Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Barber, B. (1977): Absolutization of the market: Some notes on how we got from there to here. In: G. Dworkin, G. Bermant und P. Brown (Hrsg.): Markets and moral. New York: John Wiley, S. 15-31. Barber, B. (1995): All Economies are ‘Embedded’: The Career of a Concept, and Beyond. In: Social Research 62, S. 387-413. Baron, J. und M. Hannan (1994): The Impact of Economics on Contemporary Sociology”. In: Journal of Economic Literature 32/3, S. 1111-1146. Barré, R. (2001): The Agora Model of Innovation Systems: S&T Indicators for a Democrativ Knowledge System. In: Research Evaluation 10/1, S. 13-18. Barry, D. und M. Elmes (1997): Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse. In: Academy of Management Review 22/2, S. 429-452. Barthélemy, D., M. Nieddu und F.-D. Vivien (2005): Economie patrimonile, identité et marché. In: C. Barrère, D. Barthélemy und F.-D. Vivien (Hrsg.): Réinventer le patrimoine: de la culture à l'économie, une nouvelle pensée du patrimoine? L’Harmattan, S. 121-150. Baumann, M. (2000): Der Markt der Tugend: Recht und Moral in der liberalen Gesellschaft: eine soziologische Untersuchung. Tübingen: Mohr Siebeck. Bate, S. P. (1997): Whatever happened to organizational anthropology? A review of the field of organizational ethnography and anthropological studies. In: Human Relations 50, S. 1147-1175. 192 Steffen Roth Bate, S. P. (2000): Changing the culture of a hospital: From hierarchy to networked community. Public Administration 78/3, S. 485212. Beck, L. (1897): Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung. Braunschweig: F. Vieweg und Sohn. Beck, U. (1993): Die Erfindung des politischen: Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Becker, G. S. (1974): A Theory of Marriage. In: T. W. Schultz (Hrsg.): Economics of the Family. Marriage, Children and Human Capital. Chicago: University of Chicago Press, S. 299-344. Becker, G.S. (1983): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press. Becker, G. S. (1992): Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behaviour. In: Journal of Political Economy 101/3, S. 385409. Becker, G. S. und K. M. Murphy (2000): Social Economics. Market Behaviour in a Social Environment. Cambridge/MA, London: Havard University Press. Beckert, J. (1996): Was ist soziologisch an der Wirtschaftssoziologie? Ungewissheit und die Einbettung wirtschaftlichen Handelns. In: Zeitschrift für Soziologie 25/2, S. 125-146. Beckert, J. (1997): Grenzen des Marktes. Die sozialen Grundlagen wirtschaftlicher Effizienz. Frankfurt am Main: Campus. Beckert, J. (2002): Vertrauen und die performative Konstruktion von Märkten. In: Zeitschrift für Soziologie 31/1, S. 27-43. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 193 Beckert, J. (2005): Trust and the Performative Construction of Markets. In: MPIFG Discussion Paper 05/8. Verfügbar unter: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp05-8.pdf Beckert, J. (2007): Die soziale Ordnung von Märkten. In: J. Beckert, R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt am Main: Campus, S. 43-62. Beckert, J. (2007b): The Great Transformation of Embeddedness. Karl Polanyi and the New Economic Sociology. In: MPIfG Discussion Paper 07/1. Beckert, J. (2009): The Social Order of Markets. In: Theory and Society, 383/3, S. 245–269 Beckert, J. (2009b): Die Anspruchsinflation des Wirtschaftssystems. In: MPIfG Working Paper 09/10. Verfügbar unter: http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp09-10.pdf Beckert, J. und N. Besedovsky (2009): Die Wirtschaft als Thema der Soziologie: Zur Entwicklung wirtschaftssoziologischer Forschung in Deutschland und den USA. In: MPIfG Discussion Paper 09/1. Beckert, J., R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (2007): Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt/M.: Campus, S. 19-39. Beckert, J., R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (2007b): Danksagung. In: Dies. (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt/M.: Campus, S. 9. Beckert, J. und B. Harshav (2002): Beyond the Market: The Social Foundations of Economic Efficiency. Princeton: Princeton University Press. 194 Steffen Roth Beckert, J. und J. Rössel (2004): Kunst und Preise. Reputation als Mechanismus der Reduktion von Ungewissheit auf dem Kunstmarkt. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 56, S. 32-50. Beckert, J. und R. Swedberg (2001): Introduction. In: Symposium: The Return of Economic Sociology in Europe. Special Issue of the European Journal of Social Theory 4/4, S. 379-386. Beckert, J. und M. Zafirovski (2006) (Hrsg.): International Encyclopedia of Economic Sociology. London and New York: Routledge. Belien, P. (2005): Walking on Water: How to Do It. Interview mit Mart Laar. In: The Brussels Journal vom 27.8.2005, als AudioDatei erhältlich unter: http://www.brusselsjournal.com/system/files?file=interviewmart-laar.mp3 Biesecker, A. und S. Kesting (2003): Mikroökonomik: Eine Einführung aus sozial-ökologischer Perspektive. München: Oldenbourg. Berger, J. (1990): Market and State in Advanced Capitalist Societies. In: A. Martinelli und N. Smelser (Hrsg.) Economy and Society: Overview in Economic Sociology. London: Sage, S. 103–132. Biggart, N. W. und T. D. Beamish (2003): The Economic Sociology of Conventions: Habit, Custom, Practice, and Routine. In: Annual Review of Sociology 29: S. 443-464. Biggiero, L. (1999): Markets, hierarchies, networks, districts: A cybernetic approach. In: Human Systems Management 18/2, S. 7187. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 195 Bluhm, H. und K. Malowitz (2007): Märkte denken. Ideengeschichtliche und ideenpolitische Konnotationen. In: Dies. (Hrsg.): Märkte denken. Berliner Debatte Initial 18/6, 4-25. Bluhm, K. (2008): Corporate Social Responsibility. Zur Moralisierung der Unternehmen aus soziologischer Perspektive. In: A. Maurer und U. Schimank (Hrsg.): Die Gesellschaft der Unternehmen die Unternehmen der Gesellschaft. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 144-163 Boelcke, W.A. (1980): Liberalismus. Liberalismus, Ordoliberalismus, Neoliberalismus. In: W. Albers (Hrsg.): Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HDWW), zugleich Neuauflage des Handwörterbuchs der Sozialwissenschaften, S. 44–45. Boje, D. M. (2008): Storytelling Organization. Beverly Hills: Sage. Borges, J. L. (1966): Die analytische Sprache John Wilkins’. In: Ders. (Hrsg.): Das Eine und die Vielen. Essays zur Literatur. München: Hanser. Boulding, K. (1976): Ökonomie als Wissenschaft. Piper: München. Bourdieu, P. (1976): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: R. Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt, Sonderband 2. Göttingen, S. 183-198. Bourdieu, P. (1984): Sozialer Raum und ‚Klassen’. In: Ders. (Hrsg.): Sozialer Raum und ‚Klassen’. Leçon sur la leçon, 2 Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 7-81. 196 Steffen Roth Bourdieu, P. (1986): The forms of capital. In: J. G. Richardson (Hrsg.): Handbook of the Theory of Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, S. 241-258. Bourdieu, P. (1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1992): Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. In: Ders. (Hrsg.): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg, S. 49-75. Bourdieu, P. (1993): Der sprachliche Markt. In: Ders. (Hrsg.): Soziologische Fragen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 115-130. Bourdieu, P. (1997): Die männliche Herrschaft. In: I. Dölling und B. Krais (Hrsg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktionen in der sozialen Praxis. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 153177. Bourdieu, P. (1997b): Männliche Herrschaft revisited. In: Feministische Studien 2, S. 88-98. Bourdieu, P. (1997c): Das ökonomische Feld. In: P. Bourdieu et al. (Hrsg.): Der Einzige und sein Eigenheim. Hamburg: VSA, S. 162-204. Bourdieu, P. (1998): The essence of neoliberalism. What is neoliberalism? A programme for destroying collective structures which may impede the pure market logic. In: Le Monde Diplomatique 12/98. Bourdieu, P. (1999) Neoliberalismus. In: 4/12/1999. Die Tageszeitung, Bourdieu, P. (2000) Der Neoliberalismus ist konservativ. Will Gegenfeuer legen: Pierre Bourdieu sieht im Neoliberalismus eine Ge- Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 197 fahr für Europa. Interview mit Pierre Bourdieu. In: Tagesanzeiger, 20/05/2000. Bourdieu, P. (2001): The Forms of Capital. In: M. S. Granovetter und R. Swedberg (Hrsg.): The Sociology of Economic Life. Boulder: Westview Press, S. 96-112. Bourdieu, P. (2005): Principles of Economic Anthropology. In: N. Smelser und R. Swedberg (Hrsg.): The Handbook of Economic Sociology (Second Edition). Princeton: Princeton University Press, S. 75-89. Bourdieu, P., L. Boltanski und M. de Saint-Martin (1981): Kapital und Bildungskapital. Reproduktionsstrategien im sozialen Wandel. In: Dies. (Hrsg.): Titel und Stelle. Über die Reproduktion sozialer Macht. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, S. 23-87. Bourdieu, P., M. de Saint Martin und L. C. Clough (1998): State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Palo Alto: Stanford University Press. Bourdieu, P. und L. Wacquant (1992): Résponses: Pour une Anthropologie Réflexive. Paris: Seuil. Norman Braun (2008): Sozialkapital aus Sicht der Rational Choice Soziologie. In: W. Matiaske und G. Grözinger (Hrsg.): Sozialkapital – eine (un)bequeme Kategorie. Ökonomie und Gesellschaft 20, S. 43-78. Bourdieu, P. und S. Emanuel (1996): The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Palo Alto: Stanford University Press. Burchardt, H.-J. (2004): Zeitenwende: Politik nach dem Neoliberalismus. Stuttgart: Schmetterling. 198 Steffen Roth Burkert-Dottolo, G. (2003): Mit Optimismus und Skeptizismus in die Zukunft. Über NeoCons, „bekehrte“ Sozialisten und die Notwendigkeit eines liberalen Konservatismus. In: Österreichisches Jahrbuch für Politik 2003, S. 559 – 584. Calhoun, C. (1993): Habitus, Field, and Capital: The Question of In C. Calhoun, E. LiPuma und M. Postone (Hrsg.) Bourdieu: Critical perspectives. Cambridge: Polity Press Historical Specificity, S. 89-115. Callon, M. (1998a): „Introduction: The embeddedness of economic markets in economics“. In: Ders. (Hrsg.): The Laws of the Markets. Oxford: Blackwell, S. 1-57. Callon, M. (1998b): „An essay on framing and overflowing: economic externalities revisited by sociology“. In: Ders. (Hrsg.): The Laws of the Markets. Oxford: Blackwell, S. 244-269. Callon, M. (2005): „Why virtualism paves the way to political impotence“. In: Economic Sociology. Electronic Newsletter 6/2, S. 321. Callon, M. (2007): What does it mean to say that economics is performative? In: D. MacKenzie, F. Muniesa und L. Siu (Hrsg.): Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics. Princeton: Princeton University Press, S. 311-357. Campbell, C. (2005): The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. York: Alcuin Academics. Carroll, A. (1998): The Four Faces of Corporate Citizenship. In: Business and Society Review 100/1, S. 1–7. Chesbrough, H. (2003): Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 199 Chesbrough, H. (2007): Business model innovation: it's not just about technology anymore. In: Strategy & Leadership 35/6, S. 12- 17. Chiesura, A. und R. de Groot (2001): Critical Natural Capital: a Sociolo-Cultural Perspective. In : Ecological Economics 44/2-3, S. 219-231. Chong, D. (2000): Rational Lives: Norms and Values in Politics and Society. Chicago: University of Chicago Press. Choudhury, M. A. (1996): Markets as a System of Social Contracts. In: International Journal of Social Economics 23/1, S. 17-36. Chomsky, N. (1999a): Media Control. San Francisco. Chomsky, N. (1999b): Profit over People. New York. Chomsky, N. (2000): The Rule of Force in World Affairs. Cambridge, MA. Clam, J. (2001): Probleme der Kopplung von Nur-Operationen. Kopplung, Verwerfung, Verdünnung. In: Soziale Systeme 7/2, S. 222-240. Clausen, L. (1978): Tausch. Entwürfe zu einer soziologischen Theorie. München: Kösel. Clegg, S., M. Kronberger und C. Carter (2003): The Différend, Strangers and Democracy: Theorizing Polyphonic Organization. In: Conference Proceedings of the Academy of Management Best Conference Paper Proceedings, S. 1-6. Clegg, S., M. Kronberger und T. Pitsis (2005): Managing and organizations: an introduction to theory and practice. Beverly Hills: Sage. 200 Steffen Roth Coase, R. (1937): The Nature of the Firm. In: Economica 4, S. 386405. Coase, R. (1999): Interview with Ronald Coase. In: Newsletter of the International Society for New Institutional Economics 2/1 (spring). Cohen, J., L. E. Hazelrigg und W. Pope (1975): Deparsonizing Weber. A Critique of Parsons Interpretation of Weber’s Sociology. In: American Sociological Review 40, S. 229-241. Coleman, J. S. (1979): Macht und Gesellschaftsstruktur. Tübingen: Mohr Siebeck. Coleman, J. S. (1990): Foundations of Social Theory. Cambridge: Belknap Press. Coleman, J. S. (1995): Grundlagen der Sozialtheorie, Bd. 1. Handlungen und Handlungssysteme. München, Wien: Oldenbourg. Coleman, J. S. (2000). Social capital in the creation of human capital In: Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications. Ed. E. Lesser, 17-41. Boston: Butterworth Heinemann. Coser, L. A. (1971): Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Costas, L. (2003): Social Foundations of Markets, Money and Credit. New York, London: Routledge. Cournot, A. A. (1925): Untersuchungen über die mathematischen Grundlagen der Theorie des Reichtums. Jena: G. Fischer. Convert, B. und J. Heilbron (2005): La réinvention américaine de la sociologie économique. In: L’Année Sociologique 55/2, S. 329364. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 201 Convert, B. und J. Heilbron (2007): Where Did the New Economic Sociology Come From? In: Theory and Society 36: S. 31-54. Davis, G. (2006): Organizational Fields. In: J. Beckert und M. Zafirovski (Hrsg.): International encyclopedia of economic sociology. London und New York: Routledge, S. 491-493. Dederich, A. und M. Florian (2004): Felder, Organisationen, Akteure – eine organisationssoziologische Skizze. In: J. Ebrecht und F. Hillebrandt (Hrsg.): Bourdieus Theorie der Praxis: Erklärungskraft, Anwendung, Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 69-96. Dequech, D. (2003): Cognitive and Cultural Embeddedness: Combining Institutional Economics and Economic Sociology. In: Journal of Economic Issues 27, S. 461-70. Deutschmann, C. (2001): Die Verheissung des absoluten Reichtums: Zur religiösen Natur des Kapitalismus. Frankfurt am Main: Campus Verlag. Deutschmann, C. (2002): Die gesellschaftliche Macht des Geldes. Leviathan, Sonderheft 21/2002. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Deutschmann, C. (2007): Unsicherheit und soziale Einbettung: Konzeptionelle Probleme der Wirtschaftssoziologie. In: Beckert, J., R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt am Main: Campus, 79-94. Deutschmann, C. (2007b): Dynamische Konzepte institutioneller Einbettung. Beitrag zur Konferenz „Die institutionelle Einbettung von Märkten“ am Max-Plank-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, 1.-3.2-2007; Fassung vom 14.2.2007). Diaz-Bone, R. (2006): Wirtschaftssoziologische Perspektiven nach Bourdieu in Frankreich. In: M. Florian und F. Hillebrandt 202 Steffen Roth (Hrsg.): Pierre Bourdieu: neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft. Wiesbaden: VS Verlag, 43-72. Diaz-Bone, R. (2007): Qualitätskonventionen in ökonomischen Feldern. In: Berliner Journal für Soziologie 4, S. 489–509. DiMaggio, P. J. und W. W. Powell (1983): The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In: American Sociological Review 48, S. 147-160. DiMaggio, P. (1990): Cultural Aspects of Economic Action and Organization. In: R. Friedland und A. F. Robertson (Hrsg.): Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society. New York: Aldine, S. 113-136. DiMaggio, P. J. und W. W. Powell (1991): Introduction. In: Dies. (Hrsg.): The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press, S. 1-38. DiMaggio, P. J. (1994): Culture and Economy. In: N. J. Smelser und Richard Swedberg (Hrsg.): Handbook of Economic Sociology (1. Auflage). Princeton: Princeton University Press, S. 27-57. DiMaggio, P. J. (2003): The Twenty-First-Century Firm: Changing Economic Organization in International Perspective. Princeton: Princeton University Press. Dobbin, F. (1994): Forging Industrial Policy: The United States, Britain and France in the Railroad Age. Cambridge: Cambridge University Press. Dobbin, F. (1994b): Cultural Modes of Organization. The Social Construction of Rational Organizing Principles. In D. Crane (Hrsg.): The Sociology of Culture: Emerging Theoretical Perspectives. Cambridge (MA): Blackwell, S. 117-42. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 203 Dobbin, F. (2008): The poverty of organizational theory: comment on: Bourdieu and organizational analysis. In: Theory and Society 37/1, S. 53-63. Donaldson, T. und L. E. Preston (1995): The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. In: Academy of Management Review 20/1, S. 65-91. Drori, G. S., J. W. Meyer und H. Hwang (2006): World Society and the Proliferation of Formal Organization. In: Dies. (Hrsg.): Globalization and Organization: World Society and Organizational Change. Oxford: Oxford University Press, S. 25-50. Edvinsson, L. und G. Brünig (2000): Aktivposten Wissenskapital. Unsichtbare Werte bilanzierbar machen. Wiesbaden: Gabler. Edvinsson, L. und M. S. Malone (1997): Intellectual Capital. London: J. Piatkus Publishers. Elsner, W (2000): An Industrial Policy Agenda 2000 and Beyond – Experience, Theory, and Policy. In: Ders. (Hrsg.): Industrial Policies after 2000. Boston: Kluwer, S. 411-486. Enste, D. (2002): Schattenwirtschaft und institutioneller Wandel. Tübingen: Mohr Siebeck. Etzkowitz, H., and L. Leydesdorff (2000): The Dynamics of Innovation: From National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. In: Research Policy 29, S. 109-123. Faulstich-Wieland, H. (2000): Individuum und Gesellschaft: Sozialisationstheorien und Sozialisationsforschung. München: Oldenbourg. Fevre, R. (2003): The New Sociology of Economic Behaviour. Thousand Oaks: Sage. 204 Steffen Roth Fine, B. (2001): Social Capital Versus Social Theory. Political Economy and Social Science at the Turn ofthe Millennium. London: Routledge. Fischer, J. (2006): Bourdieu und Luhmann. Soziologische Doppelbeobachtung der ,bürgerlichen Gesellschaft’ nach ihrer Kontingenzerfahrung. In: K. S. Rehberg, (Hrsg.): Soziale Ungleichheit Kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München 2004, S. 2850- 858. Fligstein, N. (1990): The Transformation of Corporate Control. Cambridge: Havard University Press. Fligstein, N. (2002): The Architecture of markets: an economic sociology of twenty-first-century capitalist societies. Princeton: Princeton University Press. Fligstein, N. (2002b): Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions. In: N. W. Biggart (Hrsg.): Readings in Economic Sociology. Malden: Blackwell, S. 197-218. Fligstein, N. (2005): Agreements, Disagreements, and Opportunities in the ‚New Sociology of Markets’. In: M. F. Guillén et al. (Hrsg.): The New Economic Sociology. Developments in an Emerging Field. New York: Russell Sage Foundation Publications, S. 61-78. Florian, M. und F. Hillebrandt (2006): Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Pierre Bourdieu: neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft. Wiesbaden: VS Verlag, S. 7-19. Florian, M. und F. Hillebrandt (2006b): Pierre Bourdieu: neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft. Wiesbaden: VS Verlag. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 205 Forrester, V. (1998): Der Terror der Ökonomie. München: Goldmann. Foucault, M. (1997): Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Fourcade, M. und S. Babb (2002): The rebirth of the liberal creed: paths to neoliberalism in four countries. In: American Journal of Sociology 108, S. 533-579. Fourcade, M. (2007): Theories of Markets and Theories of Society. In: American Behavioral Scientist 50, S. 1015-1034. Fourcade, M. und K. Healy (2007): Moral Views of Market Society. In: Annual Review of Sociology 33, S. 285-311. Freeman, E. R. (1984): Strategic Management: A stakeholder approach. Bosten: Pitman. Friedman, M. (1999): Conversation with Milton Friedman. In: B. Snowdon und H. Vane (Hrsg.): Conversations with Leading Economists: interpreting modern macroeconomics. Cheltenham: Edward Elgar, S. 124-144. Friedman, M. (2002): The Social Responsibility of Business is to Increase Ist Profits. In: T. Donaldson, P. H. Werhane und M. Cording (Hrsg.): Ethical Issues in Business. A Philosophical Approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, S. 38-48. Friedman, M., L. Andrew und S. Miles (2002): Developing Stakeholder Theory. In: Journal of Management Studies 39/1, S. 1–21. Fuchs, M. (2006): Sozialkapital, Vertrauen und Wissenstransfer in Unternehmen. Wien: Springer. Fuchs, P. (2007): Das Maß aller Dinge. Eine Abhandlung zur Metaphysik des Menschen. Weilerswist: Velbrück. 206 Steffen Roth Fullbrook, E. (2007): Introduction. In: Ders. (Hrsg.): Real World Economics: A Post-Autistic Economics Reader. London: Anthem Press, S. 1-12. Gabbay, S. und R. Leenders (1999) (Hrsg.): Corporate social capital and social liability. Dordrecht: Kluwer. Ganssmann, H. (1996): Geld und Arbeit: Wirtschaftssoziologische Grundlagen einer Theorie der modernen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag. Ganssmann, H. (2007): Doppelte Kontingenz und wirtschaftliches Handeln. In: J. Beckert, R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt am Main: Campus, 63-78. Gassmann, O. und E. Enkel (2004): Towards a theory of open innovation: three core process archetypes. Paper presented at the R&D Management Conference. Garcia-Parpet, M.-F. (1986): La construction sociale d’un marché parfait: Le marché au cadran de Fontaines-en-Sologne. In: Actes de la Rechere en Science Sociales 65, S. 2-13. Garcia-Parpet, M.-F. (2007): The Social Sonstruction of a Perfect Market: the Strawberry Auction at Fontaines-en-Sologne. In: D. MacKenzie, F. Muniesa und L. Siu (Hrsg.): Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics. Princeton: Princeton University Press, S. 20-53. Gardiner, M. (1992): The Dialogics of Critique. London: Routledge. Grabher, G. (1993): The weakness of strong ties. In: Ders. (Hrsg.): The Embedded Firm. London, New York: Routledge. Grabher, G. und D. Stark (1998): Organizing Diversity: Evolutionary Theory, Network Analysis and Post-Socialism. In: Dies. (Hrsg.): Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 207 Restructuring networks in post-socialism: legacies, linkages, and localities. Oxford: Oxford University Press. Grabher, G. und D. Stark (1998): Organizing Diversity: Evolutionary Theory, Network Analysis and Post-Socialism. In: J. Pickles und A. Smith (Hrsg.): Theorising Transition: The Political Economy of Post-Communist Transformations. London: Routledge. Granovetter, M. S. (1995): Getting a Job: A Study of Contacts and Careers, 2. Auflage. Cambridge (MA): Havard University Press. Granovetter, M. S. (1977): The Strength of Weak Ties. Social Networks - A Developing Paradigm. New York: Academic Press, S. 347-367. Granovetter, M. S. (1985): Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. In: American Journal of Sociology 91/3, S. 481-510. Granovetter, M. S. (1990): The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda. In: R. Friedland und A. F. Robertson (Hrsg.): Beyond the Market Place. New York: de Gruyter, S. 89-112. Granovetter, M. S. (1992): Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis. In: Acta Sociologica 35/1, S. 3-11. Granovetter, M. S. (2002): A Theoretical Agenda for Economic Sociology. In: M. Guillén et al. (Hrsg.): The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field. New York: Russel Sage Foundation, S. 35-59. Grundwald, K. (2001): Neugestaltung der freien Wohlfahrtspflege: management organisationalen Wandels und die Ziele der sozialen Arbeit. Weinheim: Juventa. 208 Steffen Roth Gordon, I. R. (2000): Industrial Clusters: Complexes, Agglomeration and/or social networks? In: Urban Studies 37/3, S. 513-533. Gorz, A. (1989): Kritik der ökonomischen Vernunft. Berlin: Rotbuch. Gossen, H. H. (1854(1987): Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln. Braunschweig: Vieweg und Sohn. (FaksimileAusgabe: Frankfurt am Main, Düsseldorf). Guggenberger, W. (2007): Die List der Dinge: Sackgassen der Wirtschaftsethik in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Berlin, Hamburg, Münster: LIT Verlag. Gullien, M. F. et al. (2003): The Revival of Economic Sociology. In: Dies. (Hrsg.): The New Economic Sociology. Developments in an Emerging Field. New York: Russell Sage Foundation, S. 148192. Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bände. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habisch, A. (1998): Extending Capital Theory – gesellschaftliche Implikationen eines theoretischen Forschungsprogramms. In: I. Pies und M. Leschke (Hrsg.): Gary Beckers ökonomischer Imperialismus. Tübingen, Mohr Siebeck, 31-50. Hahn, F. H. (1989): Marshalls „Principles“ in der Sicht moderner Theorien. In: F.H. Hahn et al. (Hrsg.): Alfred Marshalls Lebenswerk. Düsseldorf: Wirtschaft und Finanzen. Hadjar, A. (2004): Ellenbogenmentalität und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen: Die Rolle des hierarchischen Selbstinteresses. Wiesbaden: VS Verlag. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 209 Hall, P. und D. Soskice (2001): Introduction. In: Dies. (Hrsg.): Varieties of Capitalism. Oxford: Oxford University Press, S. 1-45. Hansen, H. (2008): Politik und wirtschaftlicher Wettbewerb in der Globalisierung: Kritik der Paradigmendiskussion in der Internationalen politischen Ökonomie. Wiesbaden: VS Verlag. Harney, S. (1996): Nationalism and Identity: Culture and the Imagination in a Caribbean Diaspora. St. Augustine: University of the West Indies Press. Hayek, F. A. v. (2003): Der Weg zur Knechtschaft. München: Olzog. Hazen, M. A. (1993): Towards polyphonic organization. In: Journal of Organizational Change Management 6/5, S. 15–26. Hazen, M. A. (1994): Multiplicity and change in persons and organizations. In: Journal of Organizational Change Management 7/5: S. 72-81. Hazen, M. A. (2007): Silences, perinatal loss, and polyphony. A PortModern Perspective. In: Journal of Organizational Change Management 19/2, S. 237-249. Healy, Kieran (2004): Altruism as an Organizational Problem: the Case of Organ Procurement. In: American Sociological Review 69: 387-404. Heinemann, K. (1976): Elemente einer Soziologie des Marktes. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 28, S. 48-67. Hillebrandt, F. (2007): Kaufen, Verkaufen, Schenken: Die Simultanität von Tauschpraktiken. In: J. Beckert, R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt am Main: Campus, S. 281-295. 210 Steffen Roth Hiss, S. (2006): Warum übernehmen Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung?: Ein soziologischer Erklärungsversuch. Frankfurt am Main: Campus. Hodgson, G. M. (2001): How Economics Forgot History: the Problem of historical specificity in social sciences. London: Routledge. Holl, C. (2004): Wahrnehmung, menschliches Handeln und Institutionen: Von Hayeks Institutionenökonomik und deren Weiterentwicklung. Tübingen: Mohr Siebeck. Holmes, S. (1985): Differenzierung und Arbeitsteilung im Denken des Liberalismus. In: Luhmann, N. (Hrsg.): Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee. Wiesbaden: VS Verlag. Holton, R. J. (1986): Talcot Parsons and the Theory of Economy and Society. In: R. J. Holton und Bryan S. Turner: Talcott Parsons on Economy and Society, S. 25-106. Hontrich, G. (2003): Gut in der Zeit: Zur zeitlichen Genese des Subjekts aus Sozialwissenschaftlichen und theologisch-ethischen Perspektiven. Berlin, Hamburg, Münster: LIT Verlag. Hösle, V. (1997): Moral und Politik. München: Ch. Beck. Humphreys, S. C. (1969): History, Economics, and Anthropology: The Work of Karl Polanyi. In: History and Theory 8/2: S. 165212. Jackson, W. A. (2007): On the Social Structure of Markets. In: Cambridge Journal of Economics 31/2, S. 235-253. Jacob, E. G. (1929): Daniel Dafoe, Essay on Projects. Leipzig: Tauchnitz. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 211 Jevons, W. S. (1879): The Theory of Political Economy. London: Macmillan. Kersting, W. (2005): Wem gehört die Moral? Ein wirtschaftsphilosophischer Essay. In: Cicero. Magazin für politische Kultur, Heft April 2005, S. 106-111. Kirchgässner, G. (2008): Homo oeconomicus: Das ökonomische Modell individuellen Verhaltens und seine Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Tübingen: Mohr Siebeck. Klamer, A. (2004): Cultural Goods are Good for More than their Economic Value. In: V. Rao und M. Walton (Hrsg.): Culture and Public Action. Palo Alto: Stanford University Press, S. 138-162. Kolb, G. (1997): Geschichte der Volkswirtschaft. Dogmenhistorische Positionen des ökonomischen Denkens. München: Franz Vahlen. Koslowski, P. (1994): Die Ordnung der Wirtschaft: Studien zur praktischen Philosophie und politischen Ökonomie. Tübingen: Mohr Siebeck. Krippner, G. R und A. S. Alvarez (2007): Embeddedness and the Intellectual Projects of Economic Sociology. In: Annual Review Sociology 33, S. 219–240. Kronberger, M., S. Clegg und C. Carter (2007): Rethinking the Polyphonic Organization: Managing as Discursive Practice. In. Scandinavian Journal of Management 22, S. 3-30. Kühl, S. (2008): Wirtschaft und Gesellschaft: neomarxistische Theorieansätze. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 124-152. Kurbjuweit, D. (2003): Unser effizientes Leben. Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen. Reinbeck: Rowohlt. 212 Steffen Roth Kutschker, M. und S. Schmid (2008): Internationales Management. München: Oldenbourg. Lazear, E. P. (2000): Economic Imperialism. In: Quarterly Journal of Economics 115, S. 99-146. Lebaron, F. (2003). Pierre Bourdieu: economic models against economism. In: Theory and Society 32/5-6: 551-565. Leontief, W. A. (1982): Academic Economists. In: Science 217 (Ausgabe vom 9. Juli 1982), S. 104-7 Leydesdorff, L. (2005): The Triple Helix Model and the Study of Knowledge-Based Innovation Systems. In: International Journal of Contemporary Sociology 42, S. 12-27. Leydesdorff, L. (2006): The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model. In: W. Dolfsma und L. Soete (Hrsg.): Reading the Dynamics of a Knowledge Economy. Cheltenham: Edward Elgar, S. 42-76. Lévi-Strauss, C. (1993). Die elementaren Formen der Verwandtschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Lie, J. (2007): Sociology of Markets. In: Annual Review of Sociology 23, S. 341–360. Linss, V. (2007): Die wichtigsten Wirtschaftsdenker. Wiesbaden: Matrix. Loury, G. (1987): Why Should We Care About Group Inequality? In: Social Philosophy and Policy 5, S. 249-271. Lütke, P. (2005): Kreative Produktionsmilieus in der Film- und Fernsehwirtschaft: Content-Produktion in Köln. Berlin, Hamburg, Münster: LIT Verlag. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 213 Luhmann, N. (1982): The economy as a social system. In: Ders. (Hrsg.): The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press, S. 190–225. Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Luhmann, N. (1988): Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Luhmann, N. (1990): Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Luhmann, N. (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Luhmann, N. (2000): Organisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag. Luhmann, N. (2005): Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Wiesbaden: VS Verlag. MacKenzie, D. und Y. Millo (2003): Constructing a Market, Performing Theory: The Historical Sociology of a Financial Derivatives Exchange. In: American Journal of Sociology 109/1, S. 107–45. MacKenzie, D. (2004): The Big, Bad Wolf and the Rational Market: Portfolio Insurance, the 1987 Crash and the Performativity of Economics. In: Economy and Society 33/ 3, S. 303-334. Malcolm, J. D. (2001): Financial Globalisation and the Opening of the Japanese Economy. London: Routledge. Malinowski, B. (1979). Argonauten des westlichen Pazifiks. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 214 Steffen Roth Mantere, S., J. A. A. Sillince und V. Hämäläinen (2007): Music as a Metaphor for Organizational Change. In: Journal of Organizational Change Management 20/3, S. 447-459. Mantzavinos, C. (2007): Indidviduen, Institutionen und Märkte. Tübingen: Mohr Siebeck. Mardsen, P. V. (2006): Coleman, James S. In: J. Beckert und M. Zafirovski (Hrsg.): International Encyclopedia of Economic Sociology. London und New York: Routledge, S. 69-72. Marshall, A. (1925): Principles of Economics: An Introductory Volume. London: Macmillan. Martinelli, A. und N. Smelser (1990): Economy and society: overviews in economic sociology. Thousand Oaks: Sage. Matiaske, W. (1999): Soziales Kapital in Organisationen. Eine tauschtheoretische Studie. München und Mering: Hampp Matten, D. und A. Crane (2005): Corporate Citizenship: Towards an Extended Theoretical Conceptionalization. In: Academy of Management Review 30/1: S. 166-179. Maurer, I. (2003): Soziales Kapital als Erfolgsfaktor junger Unternehmen. Wiesbaden: VS Verlag. Maurer, A. (2008): Institutionalismus und Wirtschaftssoziologie. In: Dies. (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 62-86. Maurer, A. (2008b) (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag Mauss, Marcel (1990): Die Gabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 215 Mayer, A. (1938): Finanzkatastrophen und Spekulanten. Berlin: Goldmann. Medema, S. G. und W. S. Samuels (2000): The Economic Role of Government as, in Part, a Matter of Selective Perception, Sentiment and Valuation: The Cases of Pigovian and Paretian Walfare Economics. In. American Journal of Economics and Sociology 59/1, S. 87-108. Mikl-Horke, G. (1999): Historische Soziologie der Wirtschaft. München: Oldenbourg. Mikl-Horke, G. (2008): Sozialwissenschaftliche Perspektiven der Wirtschaft. München: Oldenbourg. Mikl-Horke, G. (2008b): Klassische Positionen der Ökonomie und Soziologie. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 19-44. Mill, J. S. (1868): Principles of Political Economy, Vol. 1. New York: Appelton and Company. Minssen, H. (2008): Unternehmen. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 247-267. Moldaschl, M. und T. Diefenbach (2003): Regeln und Ressourcen. Zum verhältnis von Institutionen- und Ressourcentheorie. In: M. Schmid und A. Maurer (Hrsg.): Ökonomischer und soziologischer Institutionalismus: Interdisziplinäre Beiträge und Perspektiven der Institutionentheorie und -analyse. Metropolis. Moldaschl, M. (2005): Das soziale Kapital von Arbeitsgruppen und die Nebenfolgen seiner Verwertung. In: Gruppendynamik und Organisationsberatung 36, S. 221-239. 216 Steffen Roth Moldaschl, M. (2005b): Kapitalarten, Verwertungsstrategien, Nachhaltigkeit. In: Ders. (Hrsg.): Immaterielle Ressourcen, München/Mering, S. 47-68. Moldaschl, M. (2009): Wem gehört das Sozialkapital? In: U. Kägi und S. Mülle (Hrsg.): Change auf Teamebene. Multiperspektivische zu Teams in organisationalen Veränderungsprozessen. Zürich: NZZ Libro Verlag, S. 83-108. Nassehi, A. and G. Nollmann (2004): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Nollert, M. (2004): Intermediäre Organisationen als Gegenstand der komparativen Wirtschaftssoziologie. In: M. Nollert, H. Scholz und P. Ziltener (Hrsg.): Wirtschaft in soziologischer Perspektive: Diskurs und empirische Analysen. Berlin, Hamburg, Münster: LIT Verlag. Norkus, Z. (2001): Max Weber und Rational Choice. Marburg: Metropolis. North, D. (1977): Markets and other Allocation Systems in History. In: Journal of European Economic History 6, S. 703-716. Nowotny, H., P. Scott und M. Gibbons (2004): Re-thinking Science, Knowledge and the Public in the Age of Uncertainty. Weilerwist: Velbrück. Osborn, R. N. und J. Hagedoorn (1997): The Institutionalization and Evolutionary Dynamics of Interorganizational Alliances and Networks. In: Academy of Management Journal 40/2, S. 261278. Parsons, T. (1934): Some Reflections on “The Nature and Significance of Economics. In: Quarterly Journal of Economics 48, S. 511545. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 217 Parsons, T. (1973): Einige Grundzüge der allgemeinen Theorie des Handelns. In: H. Hartmann (Hrsg.): Moderne amerikanische Soziologie. Stuttgart: Enke, S. 216-244. Parsons, T. und N. Smelser (2003): Economy and Society. London: Routledge. Paul, A. T. (2006): Luhmann, Niklas. In: J. Beckert und M. Zafirovski (Hrsg.): International Encyclopedia of Economic Sociology. London und New York: Routledge, S.417-419. Pietilä, T. (2007): Gossip, markets, and gender: how dialogue constructs moral value in post-socialist Kiliman. Madison: University of Wisconsin Press. Piore, M. J. und C. F. Sabel (1985): Das Ende der Massenproduktion. Berlin: Wagenbach. Pohlmann, M. (2006): Die Gegenwart der Zukunft: Das Management und der Wandel der Arbeitsgesellschaft. In: U. Brinkmann, K. Krenn und P. Windolf (Hrsg.): Endspiel des Kapitalismus? Institutioneller Wandel unter den Bedingungen des marktzentrierten Paradigmas. Wiesbaden: VS Verlag, S. 218-238. Piore, M. (1993): The Social Embeddedness of the Labor market and Cognitive Processes. In: Labour 7/3, S. 3-18. Polanyi, K. (1957): The great transformation. The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press. Polanyi, K. (1963): Ports of Trade in Early Societies. In: Journal of Economic History 23, S. 30-45. Polanyi, K. (1978): The great transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 218 Steffen Roth Polanyi, K. und H. W. Pearson (1977): The livelihood of man. New York: Academic Press. Pongratz, H. J. und G. G. Voss (2001): Erwerbstätige als ‚Arbeitskraftunternehmer’. In: SOWI. Sozialwissenschaftliche Informationen 30/4, S. 42-52. Pühl, H. (2000): Supervision und Organisationsentwicklung. Wiesbaden: VS Verlag. Radnitzky, G. und P. Bernholz (1987) (Hrsg.): Economic imperialism: the economic approach applied outside the field of economics. New York: Paragon House Publishers. Raub, W., G. Rooks und F. Tazelaar (2007): Erträge des Sozialkapitals in zwischenbetrieblichen Beziehungen: Eine empirischtheoretische Studie. In: A. Franzen und M. Freitag (Hrsg.): Sozialkapital: Grundlagen und Anwendungen. Sonderheft der KZfSS 47, S. 241-271. Reese-Schäfer, W. (2008): Wirtschaft als Gemeinschaft: die kommunitaristische Wirtschaftsethik. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 152-160. Rieter, H. (1989): Alfred Marshall (1842-1924). In: Starbatty, J. (Hrsg.): Klassiker des ökonomischen Denkens, Band II. München, S. 135-157. Roberts, D. (2006): Art and Enlightenment: Aesthetic Theory after Adorno. Lincoln: University of Nebraska Press. Roetz, H. (2006): Konfuzius. München: Ch. Beck. Roth, S. (2005): Rinder – Genossen – Exportweltmeister. Zur Evolution einer strukturellen Kopplung. In: J. Aderhold, M. Meyer und R. Wetzel (Hrsg.): Modernes Netzwerkmanagement. Stuttgart: Gabler, S. 91-112. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 219 Roth, S. (2008): The exchange rates of society: an essay on bringing society back in market. In: Leading Systems 08/2, S. 32-53 Roth, S. (2009): The total market: a research program on the relative value of values. In: Dilemmata. Jahrbuch der Altonaer Stiftung für Philosophische Grundlagenforschung 4, S. 143-158. Rotstein, A. (1970): Karl Polanyi's Concept of Non-Market Trade. In: Journal of Economic History 30, S. 117-126. Rychner, M. (2006): Grenzen der Marktlogik: Die unsichtbare Hand in der ärztlichen Praxis. Wiesbaden: VS Verlag. Saake, I. (2004). Theorien der Empirie. Zur Spiegelbildlichkeit der Bourdieuschen Theorie der Praxis und der Luhmannschen Systemtheorie. In: A. Nassehi u. G. Nollmann (Hrsg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorienvergleich. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 85-117. Sadowski, D. (1991): Humankapital und Organisationskapital – Zwei Grundkategorien einer ökonomischen Theorie der Personalpolitik in Unternehmen. In: D. Ordelheide, B. Rudolph und E. Büsselmann (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Theorie, Stuttgart: Schaeffer Pöschel, S. 127-143. Samuels, W. J. (2004): Markets and their social construction. In: Social Research 71, S. 357-370. Sawyer, M. (2000): The Theoretical Analysis of Industrial Policy. In: W. Elsner und J. Groenewegen (Hrsg.): Industrial Policies after 2000. Boston: Kluwer, S. 23-55. Schachtschnabel, H. G. (1971): Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Stuttgart: Kohlhammer. 220 Steffen Roth Scherer, A. G. (2003): Multinationale Unternehmen und Globalisierung: Zur Neuorientierung der Theorie der multinationalen Unternehmung. Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser. Schluchter, D. (2007): Soziologie der Märkte. In: H. Bluhm und K. Malowitz (Hrsg.): Märkte denken. Berliner Debatte Initial 18, S. 85-97. Schmid, M. (2008): Individuelle Entscheidungsrationalität und soziale Einbettung. Zum Verhältnis von Ökonomie und Wirtschaftssoziologie. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 87-108. Schimank, U. und U. Volkmann (2008): Ökonomisierung der Gesellschaft. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 382-410. Schui, H., R. Ptak und S. Blankenburg (1997): Wollt ihr den totalen Markt? Der Neoliberalismus und die extreme Rechte. München: Droemer Knaur. Schumpeter, J. (1956): The Great Economists. London: Allen and Unwin. Schumpeter, J. (2002): Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. In: American Journal of Economics and Sociology 61/2, S. 405– 437. Schwartz, D. L. (2008): Bringing Bourdieus master concepts into organizational studies. In: Theory and Society 37/1, S. 45-52. Siebert, H. (1989): Die unsichtbare Hand wird grün. In: Der Spiegel 33/1989 vom 14.08.1989, S. 33-40a. Simmel, G. (1907): Philosophie des Geldes. München, Leipzig: Duncker und Humboldt. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 221 Smart, A. (1993): Gifts, Bribes, and Guanxi: A Reconsideration of Bourdieu’s Social Capital. In: Cultural Anthropology 8/3, S. 388408. Smelser, N. J. und R. Swedberg (2005): Introducing Economic Sociology. In: Dies. (Hrsg.): The Handbook of Economic Sociology. Princton, Oxford: Princeton University Press, S. 3-25. Sofer, M. und I. Schnell (2005): Ethnic Entrepreneurship and Embeddedness: The Case of Lower Galilee. In: A. Lagendijk und P. Oinas (Hrsg.): Proximity, distance, and diversity: issues on economic interaction and local development. Farnham: Ashgate Publising, 69-88. Sombart, W. (1930): Die drei Nationalökonomien. Geschichte und System der Lehre von der Wirtschaft. München, Leipzig: Duncker und Humboldt. Soros, G. (1998): The Crisis of Global Capitalism. Open Society Endangered. New York: New York Public Affairs. Stackelberg, H. v. (1934): Marktform und Gleichgewicht. Wien, Berlin: Springer. Stadelmann-Steffen, I. und M. Freitag (2007): Der ökonomische Wert sozialer Beziehungen. Eine empirische Analyse zum Verhältnis von Vertrauen, sozialen Netzwerken und wirtschaftlichem Wachstum im interkulturellen Vergleich. In: A. Franzen und M. Freitag (Hrsg.): Sozialkapital: Grundlagen und Anwendungen. Sonderheft der KZfSS 47, S. 294-320. Stark, D. (2002): Recombinant Property in Eastern European Capitalism. In: J. Scott (Hrsg.): Social Networks: Critical Concepts in Sociology. Milton Park: Francis and Taylor. Stark, D. (2000): For a Sociology of Worth. In: Working Paper Series, Center on Organizational Innovation, Columbia University. 222 Steffen Roth Available online http://www.coi.columbia.edu/pdf/stark_fsw.pdf at Stehr, N. (2007): Die Moralisierung der Märkte. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Stelling-Michaud, S. (1976): Sismondi européen actes du colloque international tenu à Genève les 14. et 15 septembre 1973. Slatkine: H. Champion. Sterkens, C. (2001): Interreligious learning: the problem of interreligious dialogue in primary education. Leiden, Boston: Brill. Stichweh, R. (1995): Zur Theorie der Weltgesellschaft. In: Soziale Systeme 1/1, S. 29-45. Swartz, D. (1997): Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: Chicago University Press. Swedberg, R. (1987): Economic Sociology: Past and Present. In: Current Sociology 35, S. 1-221. Swedberg, R. (1987b): Ökonomische Macht und wirtschaftliches Handeln. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie, Sonderheft (28): Soziologie wirtschaftlichen Handelns, S. 150-168. Swedberg, R. (1990): Economics and Sociology: Redefining their Boundaries: Conversations with Economists and Sociologists. Princeton: Princeton University Press. Swedberg, R. (1993): Explorations in Economic Sociology. New York: Russel Sage Foundation. Swedberg, R. (1996): Analyzing the Economy: On the Contribution of James S. Coleman. In: J. Clark (ed.): James S. Coleman. London: Falmer Press, S. 313-328. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 223 Swedberg, R. (2000): Max Weber and the Idea of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press. Swedberg, R. (2005): Markets in Society. In: N. Smelser und R. Swedberg (Hrsg.): The Handbook of Economic Sociology. Second Edition. Princeton: Princeton University Press, S. 233-253. Swedberg, R. (2007): Vorwort. In: J. Beckert, R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt am Main: Campus, S. 11-18. Swedberg, R. (2007b): Max Weber’s Interpretative Economic Sociology. In: American Behavioral Scientist 50/8, S. 1035-1055. Swedberg, R. (2008): Die neue Wirtschaftssoziologie und das Erbe Max Webers. In: A. Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 45-61. Swedberg, R. und M.S. Granovetter (2001): Introduction to the Second Edition. In: Dies. (Hrsg.): The Sociology of Economic Life. Boulder: Westview Press, S. 1-31. Tacke, V. (2001): Organisation und gesellschaftliche Differenzierung. Wiesbaden: VS Verlag. Thompson, H. A. (1954): The Agora at Athens and the Greek Market Place. In: The Journal of the Society of Architectual Historians 13/4: S. 9-14. Tielemann, U. (1996): Das Prinzip Markt. Kritik der ökonomischen Tauschlogik. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt. Tomer, J. F. (1987): Organizational Capital. The Path to Higher Productivity and Well Being. Westport (CT): Praeger. Turner, B. S. (1991): Preface to the New Edition. In: Parsons, T.: Social System. London: Routledge, S. xiii-xxx. 224 Steffen Roth Tzeng, R. und B. Uzzi (2000): Embeddedness and Corporate Change in a Global Economy. Bern, London, New York, Wien: P. Lang. Uzzi, B. (1996): The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: the Network Effect. In: American Sociological Review 61, S. 674-698. Vanberg, V. (1982): Markt und Organisation: Individualistische Sozialtheorie und das Problem korporativen Handelns. Tübingen: Mor Siebeck. Vaughan, D. (2008): Bourdieu and Organizations: The Empirical Challenge. In: Theory and Society 37/1, S. 65-81. Verter, B. (2003). Spiritual capital: theorizing religion with Bourdieu against Bourdieu. In: Sociological Theory 21/2, S. 150-174. Wang, N. (2005): Making a Market Economy: The Institutional Transformation of a Freshwater Fishery in a Chinese Community. London: Routledge. Watson, P. und Y. Badal (2006): Ideen: Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur Moderne. Gütersloh: Bertelsmann. Weber, M. (1980): Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr Siebeck. Wex, T. (2004): Der Nonprofit-Sektor der Organisationsgesellschaft. Wiesbaden: DUV. West, J. und S. Gallagher (2006): Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firms’ Investment in Open Source Software. In: R&D Management 36/3, S. 319-331. Westwood, R. I. and S. Clegg (2003): The Discourse of Organization Studies: Dissensus, Politics, and Paradigms. In: Dies. (Hrsg.): Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 225 Debating Organization: Point-Counterpoint in Organization Studies. Indianapolis: Wiley-Blackwell. Weyer, J. (2000): Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München: Oldenbourg. White, H. C. (1981): Where Do Markets Come From? In: American Journal of Sociology 87/3, S. 517-547. White, H. C. (1992): Identity and Control. A Structural Theory of Social Action. Princeton: Princeton University Press. White, H. C (2002): Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton: Princeton University Press. White, H. C. und F. C. Godart: Märkte als soziale Formationen. In: In: J. Beckert, R. Diaz-Bone und H. Ganssmann (Hrsg.): Märkte als soziale Strukturen. Frankfurt am Main: Campus, 197-217. Williamson, O. E. (1975): Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. A study in the economics of internal organization. New York, Free Press. Williamson, O.E. (1991): Comparative Economic Organization: The Analysis of Discret Structural Alternatives. In: Aministrative Science Quarterly 36, S. 269-296. Zafirovski, M. (2001): Exchange, Action, and Social Structure. Westport, London: Greenwood Press. Zafirovski, M. (2003): Market and Society. Two theoretical frameworks. Westport: Praeger. Zafirovski, M. (2006): Parsonian Economic Sociology. Bridges to Contemporary Economics. In: American Journal of Economics and Sociology 65, S. 75-197. 226 Steffen Roth Zafirovski, M. (2007). Convergent origins, divergent destinations. In: Social Science Information 46/2, S. 305-354. Zelizer, V. A. (1978): Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19th Century America. In: American Journal of Sociology 84/3, S. 591-610. Zelizer, V. A. (1988): Beyond the Polemics on the Market: Establishing a Theoretical and Empirical Agenda. In: Sociological Forum 3/4, S. 614-634. Zelizer, V. A. (1994): Pricing the Priceless Child: the Changing Social Value of Children. Princeton: Princeton University Press. Zelizer, V. A. (1997): The Social Meaning of Money: Pin Money, Paychecks, Poor Relief, and Other Currencies. Princeton: Princeton University Press. Zelizer, V. A. (2007): Pasts and Futures of Economic Sociology. In: American Behavioral Scientist 50/8, S. 1056-1069. Zelizer, V. A. (2008): The Real Economy. In: Qualitative Sociology 31/2, S. 189-193. Zukin, S. und P. DiMaggio (1990): Introduction. In: Dies. (Hrsg.): Structures of Capital: The Social Organization of the Economy. Cambridge: Cambridge University Press, S. 1-36. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 227 Erklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Es wurden keine individuellen Unterstützungsleistungen durch andere Personen bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts erbracht. Weitere Personen, insbesondere Promotionsberater, waren an der geistigen Herstellung der Dissertation nicht beteiligt. Fribourg, den 15. November 2009 Steffen Roth 228 Steffen Roth Lebenslauf Aktuelle Affiliation Seit 2007 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Unternehmensführung der Berner Fachhochschule Ehemalige Affiliationen 2006-2009 2007-2007 2004-2006 2002-2004 2000-2002 1998-2000 Promotionsstudent am Lehrstuhl für Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der Technischen Universität Chemnitz Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Nachhaltige Modernisierung” am Lehrstuhl für Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der Technischen Universität Chemnitz Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich „Hierarchielose Regionale Produktionsnetze“ (SFB 457) an der Technischen Universität Chemnitz Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Historische Unternehmensverflechtung 1898-1938. Deutschland, Frankreich und USA im Vergleich” am Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Organisation der Universität Trier Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Innovationsforschung und nachhaltiges Ressourcenmanagement der Technischen Universität Chemnitz Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie der Technischen Universität Chemnitz Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 1997-2000 229 Herausgeber von R.Kant (damalige Studentenzeitung der Technischen Universität Chemnitz); Gründungsmitglied des Studentenclubs bspw.; Mitglied und Sprecher des Fachschaftsrates der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz; Mitglied des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät sowie des Konzils der Technischen Universität Chemnitz. Ausbildung 2003-2004 1996-2002 Zertifikatstudien "Ostasienwissenschaften: China" an der Universität Trier Studium der Soziologie (Abschluss: Diplom-Soziologe), der Psychologie, der Politikwissenschaften, derPhilosophie und der deutschen Literatur an der Technischen Universität Chemnitz 230 Steffen Roth Publikationen Herausgeberschaften Roth, S. und L. Scheiber (2010): Identität und Organisation in der „Next Society“. Heidelberg: Carl Auer (im Erscheinen). Roth, S. and J. Kaivo-oja (2010): Open innovation, closed societies. Special Issue of the International Journal of Innovation and Sustainable Development (im Erscheinen). Müller, K., S. Roth and M. Zak (2010): The social dimension of innovation. Prague: Concil on Czech Competitiveness. Roth, S., R. Wetzel and K. Müller (2010): Non-technological and non-economic dimensions of innovation systems. Special Issue of the International Journal of Innovation and Regional Development (im Erscheinen). Roth, S. (2009): Non-technological and non-economic innovations: contributions to a theory of robust innovation. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group. Artikel, Berichte und Reviews in Zeitschriften Roth, S. (2010): New for whom? Initial images from the social dimension of innovation. In: International Journal of Innovation and Sustainable Development 4/4 (im Erscheinen). Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 231 Roth, S., R. Wetzel und K. Müller (2010): Editorial: Going beyond the hard core of innovation. Non-technological and noneconomic dimensions of innovation systems. In: International Journal of Innovation and Regional Development 2/1 (im Erscheinen). Roth, S. (2009): The total market: a research program on the relative value of values. In: Dilemmata. Jahrbuch der Altonaer Stiftung für Philosophische Grundlagenforschung 4, S. 209-224. Roth, S. (2009): "Social theory and the sociological discipline(s)". Bericht über die Konferenz der Theoriesektion der European Sociological Association in Innsbruck, 11.-13. September 2008. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 2009/1, S. 99101. Roth, S. (2008): Open innovation across the prosperity gap: an essay on getting the Caucasus back into the European innovation society. In: International Black Sea University Journal, 2/2, S. 5-20. Roth, S. (2008): Review on Drori, G.S., Meyer, J.W., Hwang, H., Globalization and organization: world society and organizational change. In: International Sociology, 23/5, S. 779-782. Roth, S. and J. Aderhold (2008): World society on the couch: antiterror consultancy as object and test-bed for professional sociology. In: HUMSEC Journal, Vol. 2, No. 1, S. 67-82. Beiträge zu Herausgeberbänden Рот, С. (2009): Каковы перспективы краудсорсинга? Транснациональные стратегии открытых инноваций для предотвращения “утечки умов” из стран СНГ Перевод с английского. In: Пипия, Л. К. (сост.): Общественные и гуманитарные науки: тенденции развития и перспективы 232 Steffen Roth сотрудничества. М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 327345. Roth, S. (2009): How far can crowdsourcing go? Discussing transnational open innovation strategies against the brain drain from CIS countries. In: Pipiya, L. (ed.): The Social Sciences and Humanities: Research Trends and Collaborative Perspectives. Moscow: ISS RAS, S. 285-300. Roth, S. (2009): Introduction: towards a theory of robust innovation. In: Roth, S. (ed.): Non-technological and non-economic innovations: contributions to a theory of robust innovation. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group. Roth, S. (2005): Rinder – Genossen – Exportweltmeister. Zur Evolution einer strukturellen Kopplung. In: Aderhold, J.; Meyer, M.; Wetzel, R. (Hrsg.): Modernes Netzwerkmanagement. Wiesbaden: Gabler Verlag. Aderhold, J. und S. Roth (2005): Trittbrettfahrer der Globalisierung: Antiglobale Netzwerke und das Problem ihrer Unzerstörbarkeit. In: Aderhold, J.; John, R. (Hrsg.): Innovation – Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Konstanz: UVK. Roth, S. (2000): Sozialismus und Kommunitarismus. In: W. Abel (Hrsg.): Das 20. Jahrhundert. Berlin: Aufbau-Verlag. Arbeitspapiere Roth, S. (2009): Neu für wen? Erste Aufnahmen aus der Sozialdimension der Innovation. In: Leading Systems 2009/1, S. 1-25. Roth, S. (2008): The total market: a research program on the relative value of values. In: Leading Systems 2008/4, S. 77-92. Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 233 Roth, S. (2008): The exchange rates of society: an essay on bringing society back in market. In: Leading Systems 2008/2, S. 32-53. Roth, S. and T. Vordank (2008): Generative incubators – towards an evolutionary perspective on incubators. In: Monarch 2008/65. Roth, S. (2006): How many networks are we to manage. In: Papers and Preprints of the Chair for Innovation Management at the Chemnitz University of Technology 2006/1. Roth, S. (2004): Die dunkle Seite des Netzwerkmanagements: Von der Kunst, ein funktionierendes Netzwerk zu zerstören. „A4 Working Papers“ des SFB 457 1/2004. In: Monarch 2008/64. 234 Steffen Roth Konferenzen Veranstaltung von Konferenzen und Konferenz-Sessions Co-Veranstalter der 3rd International Conference on Indicators and Concepts of Innovation zum Thema “The Social Dimension of Innovation”, 1.-2. Oktober 2009 in Prag. Partner: Prof. Karel Müller, Karls-Universität Prag; Prof. Milan Zak, Prague University of Economics and Management. Co-Veranstalter des Workshops zu “Identity and Organization” im Rahmen des diesjährigen Kongresses der Schweizer Gesellschaft für Soziologie, 7.-9. September 2009 in Genève. Partner: Lukas Scheiber, Universität Stuttgart. Co-Veranstalter der Session zu “Open Innovation, Closed Societies” auf dem 39th IIS World Congress des International Institute of Sociology, 11.-14. Juli 2009 in Yerevan. Partner: Dr. Jari Kaivooja, Turku School of Economics und Academy of Finland. Veranstalter der 2nd International Conference on Indicators and Concepts of Innovation on "Non-Technological and NonEconomic Innovations and Their Impact on Economy" (ICICI 2008), 1.-2. Juli 2008 in Bern. Teilnahme an Konferenzen "The markets of society and the markets of organization". Präsentiert im Rahmen des Workshops "Post-normal science and its ethical Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie 235 aspects" (2009) der Altonaer Stiftung für Philosophische Grundlagenforschung in Hamburg, DE. "How far can crowdsourcing go? On benefits and limits of joint open innovation projects between Russia and the European Union". Präsentiert im Rahmen des International Seminar Program on the 'Cooperation between Russian and EU Country Scientists in Social Sciences and Humanities' of the Russian Academy of Sciences 2008 in Moscow, RU. "Bringing society back in market: Why market sociology is no subset of economic sociology". Präsentiert im Rahmen der ESA Social Theory RN 29 Conference 2008 on "Social Theory and the Sociological Discipline(s)", Innsbruck, AT. "The markets of society: A research design on trans-economic exchange rates". Präsentiert im Rahmen des First ISA Forum 2008, Barcelona, ES. "Drei Märkte Innovation". Präsentiert im Rahmen des ISInovaWorkshop 2007 "Bestimmungsfaktoren für Innovation - Indikatoren, Berwertungen und Konzepte" in Halle/Saale, DE. "Using a thesaurus to find your ideal workmate". Präsentiert im Rahmen der Konferenz "Personal Construct Psychology in Business Context" (PCPBC 2006) in Chemnitz, DE. "Generative incubators" (mit Tino Vordank). Präsentiert im Rahmen der "International Conference on Entrepreneurship Research" (IECER 2006) in Regensburg, DE.