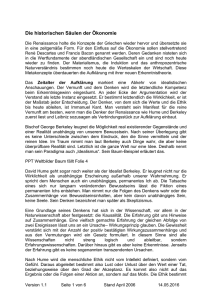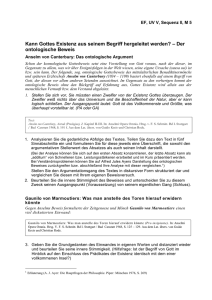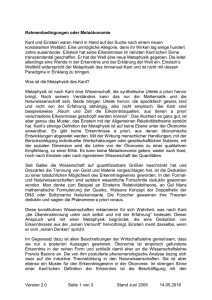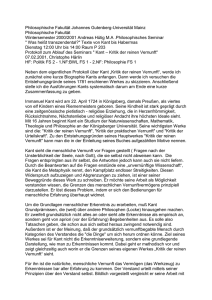Die Überschriften sind seitens des EuFoBio vorgegeben, ebenso
Werbung
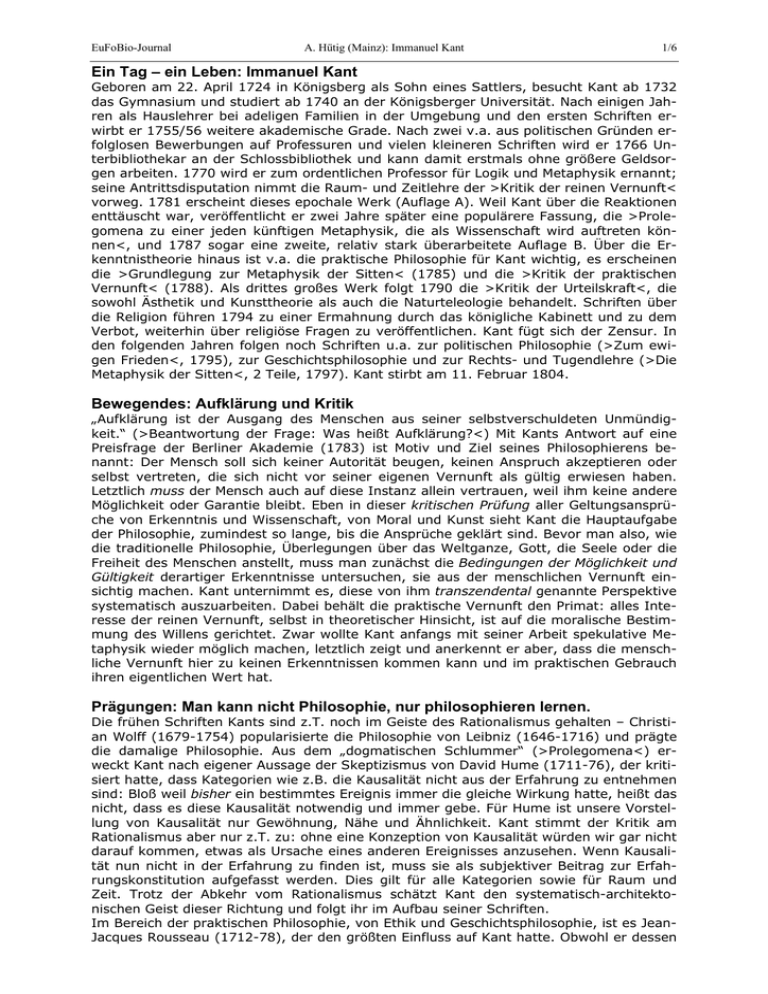
EuFoBio-Journal A. Hütig (Mainz): Immanuel Kant 1/6 Ein Tag – ein Leben: Immanuel Kant Geboren am 22. April 1724 in Königsberg als Sohn eines Sattlers, besucht Kant ab 1732 das Gymnasium und studiert ab 1740 an der Königsberger Universität. Nach einigen Jahren als Hauslehrer bei adeligen Familien in der Umgebung und den ersten Schriften erwirbt er 1755/56 weitere akademische Grade. Nach zwei v.a. aus politischen Gründen erfolglosen Bewerbungen auf Professuren und vielen kleineren Schriften wird er 1766 Unterbibliothekar an der Schlossbibliothek und kann damit erstmals ohne größere Geldsorgen arbeiten. 1770 wird er zum ordentlichen Professor für Logik und Metaphysik ernannt; seine Antrittsdisputation nimmt die Raum- und Zeitlehre der >Kritik der reinen Vernunft< vorweg. 1781 erscheint dieses epochale Werk (Auflage A). Weil Kant über die Reaktionen enttäuscht war, veröffentlicht er zwei Jahre später eine populärere Fassung, die >Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können<, und 1787 sogar eine zweite, relativ stark überarbeitete Auflage B. Über die Erkenntnistheorie hinaus ist v.a. die praktische Philosophie für Kant wichtig, es erscheinen die >Grundlegung zur Metaphysik der Sitten< (1785) und die >Kritik der praktischen Vernunft< (1788). Als drittes großes Werk folgt 1790 die >Kritik der Urteilskraft<, die sowohl Ästhetik und Kunsttheorie als auch die Naturteleologie behandelt. Schriften über die Religion führen 1794 zu einer Ermahnung durch das königliche Kabinett und zu dem Verbot, weiterhin über religiöse Fragen zu veröffentlichen. Kant fügt sich der Zensur. In den folgenden Jahren folgen noch Schriften u.a. zur politischen Philosophie (>Zum ewigen Frieden<, 1795), zur Geschichtsphilosophie und zur Rechts- und Tugendlehre (>Die Metaphysik der Sitten<, 2 Teile, 1797). Kant stirbt am 11. Februar 1804. Bewegendes: Aufklärung und Kritik „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.“ (>Beantwortung der Frage: Was heißt Aufklärung?<) Mit Kants Antwort auf eine Preisfrage der Berliner Akademie (1783) ist Motiv und Ziel seines Philosophierens benannt: Der Mensch soll sich keiner Autorität beugen, keinen Anspruch akzeptieren oder selbst vertreten, die sich nicht vor seiner eigenen Vernunft als gültig erwiesen haben. Letztlich muss der Mensch auch auf diese Instanz allein vertrauen, weil ihm keine andere Möglichkeit oder Garantie bleibt. Eben in dieser kritischen Prüfung aller Geltungsansprüche von Erkenntnis und Wissenschaft, von Moral und Kunst sieht Kant die Hauptaufgabe der Philosophie, zumindest so lange, bis die Ansprüche geklärt sind. Bevor man also, wie die traditionelle Philosophie, Überlegungen über das Weltganze, Gott, die Seele oder die Freiheit des Menschen anstellt, muss man zunächst die Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit derartiger Erkenntnisse untersuchen, sie aus der menschlichen Vernunft einsichtig machen. Kant unternimmt es, diese von ihm transzendental genannte Perspektive systematisch auszuarbeiten. Dabei behält die praktische Vernunft den Primat: alles Interesse der reinen Vernunft, selbst in theoretischer Hinsicht, ist auf die moralische Bestimmung des Willens gerichtet. Zwar wollte Kant anfangs mit seiner Arbeit spekulative Metaphysik wieder möglich machen, letztlich zeigt und anerkennt er aber, dass die menschliche Vernunft hier zu keinen Erkenntnissen kommen kann und im praktischen Gebrauch ihren eigentlichen Wert hat. Prägungen: Man kann nicht Philosophie, nur philosophieren lernen. Die frühen Schriften Kants sind z.T. noch im Geiste des Rationalismus gehalten – Christian Wolff (1679-1754) popularisierte die Philosophie von Leibniz (1646-1716) und prägte die damalige Philosophie. Aus dem „dogmatischen Schlummer“ (>Prolegomena<) erweckt Kant nach eigener Aussage der Skeptizismus von David Hume (1711-76), der kritisiert hatte, dass Kategorien wie z.B. die Kausalität nicht aus der Erfahrung zu entnehmen sind: Bloß weil bisher ein bestimmtes Ereignis immer die gleiche Wirkung hatte, heißt das nicht, dass es diese Kausalität notwendig und immer gebe. Für Hume ist unsere Vorstellung von Kausalität nur Gewöhnung, Nähe und Ähnlichkeit. Kant stimmt der Kritik am Rationalismus aber nur z.T. zu: ohne eine Konzeption von Kausalität würden wir gar nicht darauf kommen, etwas als Ursache eines anderen Ereignisses anzusehen. Wenn Kausalität nun nicht in der Erfahrung zu finden ist, muss sie als subjektiver Beitrag zur Erfahrungskonstitution aufgefasst werden. Dies gilt für alle Kategorien sowie für Raum und Zeit. Trotz der Abkehr vom Rationalismus schätzt Kant den systematisch-architektonischen Geist dieser Richtung und folgt ihr im Aufbau seiner Schriften. Im Bereich der praktischen Philosophie, von Ethik und Geschichtsphilosophie, ist es JeanJacques Rousseau (1712-78), der den größten Einfluss auf Kant hatte. Obwohl er dessen EuFoBio-Journal A. Hütig (Mainz): Immanuel Kant 2/6 Glauben an die Natur und ihre heilsame Kraft nicht teilt, folgt er ihm doch v.a. in bezug auf die Kritik an allem nur scheinbaren Fortschritt und allzu optimistischem Vernunftvertrauen. Weitere Bezugspunkte sind der antike Stoizismus, die Naturrechtstradition sowie in Abgrenzung von deren Theorie eines moralischen Gefühls die englischen Moralisten, z.B. A. A. C. Shaftesbury (1671-1713) oder Francis Hutcheson (1694-1764). In der Ästhetik ist es der Erfinder dieser philosophischen Disziplin, Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-62), auf den Kant v.a. in der Terminologie, aber auch in der Aufwertung der Autonomie des Kunstwerks und der Vorstellung einer harmonischen Ganzheit zurückgreift. Kant unterhielt einen z.T. regen Briefwechsel und Kontakt mit anderen Philosophen seiner Zeit, so mit Herder, Hamann, Herz, Maimon, Mendelssohn, Reinhold und Fichte. Jedoch ist Kant, obwohl er natürlich auch gelegentlich explizit zu anderen Positionen Stellung bezieht, zum einen ein originärer Denker, der seine eigene Position ohne viele Bezüge entwickelt und die philosophische Sprache und Methodik verändert hat wie kaum ein zweiter. Zum anderen sieht er selbst Philosophie nicht als Abfolge oder Entwicklung der Systeme, sondern als Idealbild der Reflexion: Philosophie ist „eine bloße Idee von einer möglichen Wissenschaft, die nirgend in concreto gegeben ist, welcher man sich aber auf mancherlei Wegen zu nähern sucht, so lange, bis […] das bisher verfehlte Nachbild, so weit als es Menschen vergönnt ist, dem Urbilde gleich zu machen gelingt. Bis dahin kann man keine Philosophie lernen; denn, wo ist sie, wer hat sie im Besitze, und woran läßt sie sich erkennen? Man kann nur philosophieren lernen, d.i. das Talent der Vernunft in der Befolgung ihrer allgemeinen Prinzipien an gewissen vorhandenen Versuchen üben, doch immer mit Vorbehalt des Rechts der Vernunft, jene selbst in ihren Quellen zu untersuchen und zu bestätigen, oder zu verwerfen.“ (KrV, A 838/B 866) Baupläne: Vernunft und Freiheit – „… der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“ Kants eigenen Worten zufolge befasst sich die Philosophie mit drei Grundfragen, die in einer vierten münden: „1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich hoffen? 4. Was ist der Mensch?“ Mit einiger Berechtigung kann man seine Philosophie ebenfalls diesen Fragen zuordnen. Kant stellt zunächst die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit und Gültigkeit von Erkenntnis- und normativen Ansprüchen, er geht dabei nicht psychologisch vor, sondern prüft, welche Ansprüche epistemologisch zu recht bestehen. Hierzu beginnt er bei den Strukturen des menschlichen Erkenntnisvermögens; nachdem er zwei Erkenntnisquellen, Sinnlichkeit und Verstand, identifiziert hat, rekonstruiert er deren implizite Strukturen. Raum und Zeit sind die zwei Formen der Anschauung, die alles, was für uns wahrnehmbar ist, immer schon formen: Wir können uns nichts ohne räumliche Ausdehnung vorstellen, zudem den Raum überhaupt nicht als nicht existent oder als zusammengesetzt. Räumlichkeit ist also eine Form, die all unserer sinnlichen Anschauung a priori – vor aller Erfahrung – zugrunde liegt. Gleiches gilt für die Zeit, ohne die Dauer, Folge usw. nicht vorstellbar sind. Raum und Zeit haben empirische Realität, d.h. objektive Gültigkeit für alle je sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände, aber transzendentale Idealität, sie sind nur Bestimmungen unserer Anschauung, nicht der Dinge, wie sie außerhalb dieser Anschauung sind. Alles, was in Raum und Zeit angeschaut wird, ist deshalb nur Erscheinung, nicht Ding an sich, das wir nicht erkennen können; wir können bzw. müssen aber annehmen, das da irgend etwas ist, was uns erscheint. Auch in bezug auf den Verstand entdeckt Kant a priori gegebene Elemente, die 12 Kategorien wie Kausalität, Substanz oder Möglichkeit. Sie verknüpfen und bringen Ordnung und Zusammenhang in die Anschauungen. Erkenntnis entsteht im Zusammenspiel der subjektiven Strukturen von Sinnlichkeit und Verstand: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (KrV, A 51) Die Anwendung der Kategorien auf die Anschauung geschieht im Schematismus: Die Einbildungskraft verbildlicht die Kategorien, indem sie zu jeder ein zeitliches Schema konstruiert. So ist z.B. die Dauer das Schema der Substanz, die Folge das Schema der Kausalität und die Gleichzeitigkeit das Schema der Wechselwirkung. Wichtiger und schwieriger jedoch ist der Nachweis, warum gerade diese Kategorien Geltung besitzen sollen und warum diese subjektiven Strukturen objektive Erkenntnisse produzieren können sollen. In der transzendentalen Deduktion versucht Kant, dies plausibel zu machen. Dazu ist zu zeigen, dass die Kategorien a priorische und notwendige Ordnungsfunktionen sind. Für Kant ist dafür das Selbstbewusstsein zentraler Bezugspunkt: Alle Gedanken müssen von einem „Ich denke“ begleitet werden können, sonst wären es nicht die Gedanken eines Ichs. Darin zeigt sich die Einheit und EuFoBio-Journal A. Hütig (Mainz): Immanuel Kant 3/6 Identität des Denkenden; im Bezug auf das Ich zeigt sich auch der interne Zusammenhang der Gedanken. Die Kategorien sind nun die Regeln des Übergangs zwischen verschiedenen Vorstellungen; genauso wie das Selbstbewusstsein ist auch ein Wissen um diese Regeln der Synthesis a priori gegeben. Alles, was für uns Objekt werden kann, steht unter diesen a priorischen Regeln; die Kategorien konstituieren erst Objekthaftigkeit. „Die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt sind zugleich die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung.“ (KrV, B 197). Kant nennt das Verfahren dieses Nachweises Deduktion. Dies bezeichnet nicht eine logische Schlussfolgerung, sondern stammt aus der Rechtslehre seiner Zeit und meint die Begründung eines Rechtsanspruchs aus einem unbezweifelbaren Faktum heraus. In Übertragung der Gerichtsanalogie kann man sagen, dass Kant hier keinen Beweis für die Gültigkeit der Kategorien liefern will, sondern vor der Instanz der Vernunft einen Anspruch vorträgt, den man gar nicht nicht akzeptieren kann, wenn man sich nicht selbst als unvernünftig abqualifizieren will. Der Titel Kritik der reinen Vernunft meint deswegen sowohl die Untersuchung der Vernunft als auch die Untersuchung durch die Vernunft. Die metaphysischen Ergebnisse des Werkes sind v.a. negativ: Erkenntnisse über Gott, die Seele und das Weltganze sind nicht möglich, weil von diesen Gegenständen keine Anschauung möglich ist, sie also nicht Objekt unserer Erfahrung sein können. Zugleich ist die Gültigkeit der Kausalität im Bereich der Erscheinungen absolut. Doch damit ist nicht bewiesen, dass der Mensch nicht auch ein freies Wesen sein könnte: Gerade weil die Kausalität auf den Bereich der Erscheinungen eingeschränkt ist, sagt ihre Gültigkeit nichts über den Menschen, wie er an sich ist. Die Vorstellung, dass der Mensch auch aus Freiheit wirken kann, ist zwar nicht beweisbar, aber auch nicht widerlegbar, und sie widerspricht auch nicht den Ergebnissen der KrV. Somit ist Freiheit denkmöglich. In den ethischen Schriften untersucht Kant nun, was in positiver Hinsicht zur Freiheit gesagt werden kann und wie eine Ethik zu begründen ist. Zum Handeln benötigt man in jedem Fall die Vernunft, zur Ableitung von Konsequenzen aus Gesetzen oder Klugheitsregeln. Zielen diese auf eine vorgegebenes Ziel, z.B. Sättigung, so folgt das Handeln den Vorgaben der Neigung, in diesem Fall dem Hungergefühl. Neigungen sind zufällig, veränderlich und nicht verallgemeinerbar, können also kein moralisches Prinzip begründen; ein solches müsste unabhängig von zufälligen Bedingungen sein und sogar „für alle Vernunftwesen“ (GMS) gelten. Der Wert einer Handlung bemisst sich überdies nicht aus den Folgen, die unvorhersehbar sind und den Intentionen widersprechen können, sondern aus dem Willen, der dahinter steht. Ein guter Wille ist nun einer, der aus reiner Vernunftmotivation tätig wird, der sich an einem Prinzip a priori orientiert, nicht an zufälligen oder erfahrungsabhängigen Regeln. Ein solches Prinzip ist ein kategorischer Imperativ (KI), der ein unbedingtes Sollen ausdrückt. Da jeder Inhalt dieses Sollens eine Bedingtheit zeigen würde, ist die Form entscheidend: Unbedingt gilt nur das, was widerspruchsfrei als allgemeingültiges Gesetz gedacht werden kann, was formale Allgemeinheit besitzt. Der KI lautet daher: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ (KpV, §7) Handelt man allein aus Achtung vor diesem Prinzip, so handelt man aus Pflicht und nicht nur äußerlich der Pflicht gemäß. Kant unterscheidet noch vollkommene Pflichten, z.B. gegen sich das Verbot des Selbstmordes und gegen andere das der Lüge, und unvollkommene Pflichten, z.B. gegen sich das Gebot der Selbstkultivierung und gegen andere das Gebot der praktischen Nächstenliebe. Hier zeigt sich, dass er keineswegs eine puristische Gesinnungsethik vertritt, die einer folgensensiblen Verantwortungsethik unterlegen ist: Es ist eine Pflicht, anderen zu helfen und im Lichte möglicher Konsequenzen alle verfügbaren Mittel einzusetzen; für die moralische Bewertung jedoch sind die Folgen aufgrund ihrer Kontingenz nicht geeignet. Beim Handeln aus Pflicht gibt man sich selbst ein Gesetz vor, man handelt autonom und versetzt sich und alle Vernunftwesen damit gedanklich in ein (ideelles) Reich der Zwecke, wo nur Vernunftgesetze herrschen. Auch wenn es oft schwer fällt, so zu handeln, und das Moralprinzip als Imperativ mit Nötigung auftritt: weil der Mensch als zwar neigungsbestimmtes, aber auch vernunftbegabtes Wesen zu dieser Handlung aus Pflicht fähig ist, besitzt er Würde – die freie Selbstbestimmung ist durch nichts, auch durch keine göttlichen oder weltlichen Gebote, ersetzbar. Der KI ist so die Verbindung des reinen Moralprinzips zu einem auch empirisch bestimmten Willen, die Idee der Freiheit muss dabei vorausgesetzt werden, damit Handeln überhaupt möglich ist. Freiheit ist zwar nicht beweisbar, aber von praktischer Bedeutung und lässt sich positiv als Autonomie verstehen. „Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben EuFoBio-Journal A. Hütig (Mainz): Immanuel Kant 4/6 darum in praktischer Rücksicht wirklich frei“ (GMS). Wie Freiheit sind die Unsterblichkeit der Seele und Gott Postulate, unbeweisbare, aber praktisch wirksame Vernunftbegriffe, denen empirisch nichts entspricht. Religion kann daher nur als Vernunftreligion, die die Befolgung der Moral unterstützt, nicht als Offenbarung gerechtfertigt sein. In der Kritik der Urteilskraft analysiert Kant die ästhetischen und die teleologischen Urteile. Schönheit ist danach interesseloses Wohlgefallen; der Mensch erfreut sich am freien Spiel seiner Erkenntniskräfte: Im Bezug auf die ästhetische Lust entdeckt die Urteilskraft ohne vorgängigen Begriff die Zweckmäßigkeit eines künstlich Hergestellten und damit auch die Zweckmäßigkeit der menschlichen Geisteskräfte, die so harmonisch ineinander greifen. Weiter nennt Kant erhaben, was über alle Maßen groß ist, uns aber doch deutlich macht, wie unsere Vernunft nach noch Größerem strebt, nämlich nach der Unbedingtheit des moralischen Sollens. „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“ (KpV, 288) In der Natur entdecken wir eine Zweckmäßigkeit der Organismen, die von uns in diese hinein gelegt wird. Damit zeigt sich in der Idee der Zweckmäßigkeit die Einheit des vernünftigen Subjekts, dessen Vernunft nicht in heterogene Teile zerfällt, und zugleich die Kompatibilität der Forderungen der praktischen Vernunft mit den Ergebnissen der theoretischen, wenn auch nur mit subjektiver Notwendigkeit. In der Rechtslehre legitimiert Kant eine monarchische Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus dem äußerlichen Verhältnis der Menschen zueinander, also ohne Bezug zu ihrem Willen. Recht ist „der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit vereinigt werden kann“ (MS, Einl. § B), und gleichsam durch einen Vertrag entstanden. Revolutionen und aktiver Widerstand sind demnach selbst gegen Tyrannei nicht legitim, weil sie zur Aufhebung des Rechtszustandes führen würden. Trotz dieser eher herrschaftslegitimierenden Elemente war Kant ein Bewunderer der französischen Revolution: Sie kann als Geschichtszeichen aufgefasst werden, als Indiz dafür, dass es mit der menschlichen Gattung weiter Richtung Freiheit und tugendhafter Gesellschaft geht. Die Moralisierung der Gattung, die Kultur der Vernunft sind so praktisches Ziel – eine Garantie für tatsächliche Verbesserungen gibt es aber nur, insofern die Menschen selbst es sind, die diese in Angriff nehmen. Nachklang: Die Revolution der Denkungsart In der Philosophie der Neuzeit gibt es kaum einen Philosophen, der so einflussreich ist wie Kant; jeder Nachfolgende hat sich mit ihm auseinander zu setzen. Selbst wer ihn kritisiert, muss die von ihm gesetzten Bedingungen der Erkenntnis beachten; wer hinter Kant zurückfällt, wird als ‚vorkritisch’ abgetan. Unmittelbar an Kant anknüpfend entstand der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel), der von ihm ausgehend, v.a. mit Bezug auf die Ethik und die Ästhetik, neue metaphysische Systeme entwarf. Auch Schopenhauer ist in diese Linie zu stellen; in gewisser Weise vollzieht auch Nietzsche eine Radikalisierung des transzendentalen Standpunkts. Nach Hegels Tod 1831 war die Zeit der großen Systeme vorbei, die Naturwissenschaften gewannen an Einfluss. Der Neukantianismus (ca.1870- ca.1920) versuchte, diese neuen Entwicklungen mit Kant zu interpretieren. Dilthey (1833-1911) entwarf eine Kritik der historischen Vernunft, in der er die Geschichte und die Kultur mit kantischen Mitteln analysiert, ähnlich kurz darauf Simmel und Cassirer. Die originäre Kant-Interpretation von Heidegger (1927/28) war wichtig für dessen eigene Philosophie. Wittgenstein (1889-1951) vertrat eine Sprachtheorie, die kantische Züge trägt. In der sprach- und logikorientierten sog. analytischen Philosophie der Gegenwart diskutiert man die Möglichkeit transzendentaler Argumente und die Bedeutung von Schemata. In der praktischen Philosophie ist der Gedanke der Universalisierung Teil der allermeisten Theorien; neben dem genannten Neukantianismus der Jahrhundertwende knüpfen v.a. die Diskursethik (Habermas, Apel) und die liberale Vertragstheorie eines John Rawls (geb. 1929) produktiv an Kant an: Erstere erweitert das monologische Modell des Subjekts zur Idee der Kommunikationsgemeinschaft, Rawls unternimmt eine Operationalisierung des KI mit spiel- und entscheidungstheoretischen Mitteln. Feministische Positionen kritisieren Kants Selbst-Konzept, die Vernunftzentriertheit und die Abstraktheit, knüpfen aber auch positiv an die Forderung nach Achtung des anderen an. Bioethika: „… nur der Mensch … ist Zweck an sich selbst.“ Auf den ersten Blick scheint die bioethische Position Kants eindeutig zu sein: Eine Fassung des KI fordert, die „Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines je- EuFoBio-Journal A. Hütig (Mainz): Immanuel Kant 5/6 den anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel“ (GMS) zu brauchen. Diese Fassung verbietet jede Instrumentalisierung eines Menschen zu anderen Zielen, also auch Menschenversuche, kommerziellen Organhandel oder Stammzellgewinnung aus Embryonen. Allerdings ist ja gerade umstritten, ob z.B. Embryonen bereits als ‚vollwertige’ Menschen anzusehen sind und ihnen Menschenwürde im vollen Sinn zukommt. Mit Kant kann es keine Abstufungen der Menschenwürde geben; entweder hat etwas Würde oder nicht. Kant benutzt zwar auch den Person-Begriff, der in manchen bioethischen Positionen zur Unterscheidung von bewussten und damit Rechte tragenden Menschen von ‚bloß biologischem menschlichen Leben’ verwendet wird; bei ihm bezeichnet Person jedoch den Menschen, insofern er aufgrund seiner auch vernünftigen (Gattungs-)Natur einen absoluten Wert hat. Über die Zugehörigkeit zur Gattung Mensch sagt Kant dagegen nicht viel. Da die Würde für ihn an der Fähigkeit zur Selbstbestimmung hängt, scheint der Schluss möglich, dass vorbewusstes oder nicht mehr bewusstes Leben keine Würde besitzt. Die Vernunft ist jedoch so unendlich, dass ein einzelnes menschliches Wesen sie niemals ausschöpfen kann, so dass der Grad der Vernünftigkeit unerheblich ist. Zudem können wir uns bei anderen, aber sogar bei uns selbst nie sicher sein, ob wir tatsächlich aus freier, selbstbestimmter Vernunft handeln oder doch nur unseren Neigungen folgen; wir sind uns selbst ja auch nur als Erscheinung zugänglich, besitzen keine vollständige Selbsttransparenz. Die Würde kommt deshalb der Gattung Mensch zu, von der als ganzes man hoffen darf, dass sie immer mehr Freiheit und Vernunft verwirklicht; die Würde des Einzelnen bemisst sich nach seiner Teilhabe an dieser Gattung, nicht nach seiner tatsächlichen Ausprägung der Vernunft. Für Kant ist die leibhafte Präsenz eines Menschen ein ausreichendes Symbol seiner Vernünftigkeit, um einen sittlichen Anspruch auf Anerkennung zu begründen (KdU, §§17 u. 59). Für die Menschheit als biologische Gattung unter anderen ist die Angabe von empirischen Kriterien der Zugehörigkeit sicher möglich. Aber der normative Status resultiert ja nicht aus diesen Naturtatsachen, sondern gerade aus der Vorstellung, neben der Naturgesetzlichkeit einer anderen Art von Gesetzen folgen zu können. Dabei ist Kants Ethik jedoch nicht anthropozentrisch, sondern ethikozentrisch: jeder vernunft- und damit moralfähigen Gattung kommt Würde zu. Die Menschheit ist in dieser Hinsicht ein Vernunftbegriff, ein Ideal, das unser Verhalten orientieren soll und kann. Jede empirische Festlegung würde daraus einen Erfahrungsbegriff machen, der diese normative Funktion nicht mehr erfüllen könnte. Auch die Pflicht zur Selbstkultivierung und zur Fortentwicklung der Gattung gelten nur, insofern wir uns als Vernunftwesen anerkennen, und impliziert keinen biologischen Züchtungsgedanken. Diese Anerkennung sollten wir aus begrifflichtheoretischen wie aus normativ-praktischen Gründen möglichst weit vollziehen. Eine Pflicht zur Hilfe und Nächstenliebe, aus der eine Ethik des Heilens ableitbar wäre, existiert nur, insoweit sie nicht mit anderen, grundlegenderen Pflichten kollidiert. Zudem ist Leidminderung als solche für Kant kein moralisches Ziel, weil Leid und Glück unscharfe, kontingente Begriffe sind und auch missbraucht werden können: Manche haben an eigenem oder fremden Leid Freude, jeder versteht unter Glück etwas anderes und kann dies selbst gar nicht genau definieren, so dass dies nicht als Basis einer moralischen Forderung dienen kann. Die Würde des Menschen resultiert daraus, dass er sich über die Bedürfnisse und Neigungen hinwegsetzen und sich durch moralisches Handeln als glückswürdig erweisen kann, nicht jedoch daraus, tatsächlich glücklich zu sein. Mit Kant kann man folgende Überlegung anstellen: Die Menschenwürde ist in der Unersetzbarkeit der individuellen Selbstbestimmung begründet. Unersetzlich ist diese auch, weil mit ihr jeweils etwas Neues, unhintergehbar als frei Anzusehendes in die Welt kommt. 1 Damit müssen genetische Manipulation, Keimbahntherapie und reproduktives Klonen als äußerst problematisch angesehen werden, weil damit in den Entstehungskontext eines potentiellen Vernunftwesens eingegriffen und die Grundlage dieses Wesens als verfügbares Material angesehen wird. Kant betont, allerdings im rechtsphilosophischen Kontext, dass Eltern mit dem Moment der Zeugung eine Pflicht zur Erhaltung und Versorgung des Kindes haben, da sie keine Sache, sondern ein „mit Freiheit begabtes Wesen“ (MdS, §28) in die Welt gebracht haben, wobei unerheblich ist, wie viel Vernunft es [Als Hypertext] Die Philosophin Hannah Arendt prägte dafür den Begriff der Natalität, des Geborenseins: Auch mit der Geburt eines Menschen entsteht etwas Unvorhersagbares, und gerade darin liegt die Unersetzbarkeit. In gleicher Weise finden sich in der Naturrechtstradition, so bei Rousseau und Locke, und in Erklärungen der Menschenrechte, z.B. in der Französischen Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers (1789) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948), Formulierungen wie ‚alle Menschen werden frei und gleich geboren’; daher kann als normativ relevantes Kriterium die Tatsache, von Menschen abzustammen, gelten. 1 EuFoBio-Journal A. Hütig (Mainz): Immanuel Kant 6/6 konkret zeigt oder zu nutzen in der Lage ist. Dann kommt die Würde aber nicht nur, wie man aufgrund der Wichtigkeit der Selbstbestimmung denken könnte, psychophysischen Einheiten zu, die für sich existieren können. Feten in utero wären in dieser Hinsicht auch Träger der Würde, obwohl sie ja keineswegs Individuen sind, die sich nur zufällig innerhalb einer ungewöhnlichen Umgebung aufhalten, sondern in ihrer Existenz von einer Trägerin von Würde abhängig, die eigentlich nicht gegen ihren Willen instrumentalisiert werden darf, noch nicht einmal von ihr selbst. Ein Recht auf Abtreibung gibt es, auch wenn Feministinnen gelegentlich ein solches mit Kant aus der Pflicht zur Selbstentwicklung, die durch eine Schwangerschaft beeinträchtigt wird, ableiten wollen, wohl nicht. Ob sich ein Konflikt zwischen moralischen Normen, z.B. dem Instrumentalisierungsverbot und dem absoluten Wert des Individuums, auch des potentiellen (aber bereits existenten, um nicht verschmolzene Gameten auszuschließen), immer auflösen lässt, wie Kant annahm, ist zumindest zweifelhaft. Der Status extrauteriner und in vitro erzeugter Zellen, die gar nicht zur Geburt vorgesehen sind – von Kant verständlicherweise nicht thematisiert –, ist noch prekärer. Sobald aber die technischen Möglichkeiten existieren, z.B. durch künstliche Gebärmütter, lässt sich argumentieren, dass dann die Reifung zu einem Vernunftwesen möglich und damit moralisch geboten wäre. Für jede potentiell vernunftbegabte Gattung verbieten sich genetische Manipulation, Hybridbildung oder industrielle Nutzung; erwiesenermaßen nicht vernunftfähige Gattungen dagegen sind für Kant explizit den Sachen gleichgestellt und dürfen be- und genutzt werden. Ein solcher Nachweis ist jedoch schwierig; in einer Nachlassnotiz stellt Kant die Überlegung an, dass man auf Pferden, wenn sie ‚Ich’ sagen könnten, nicht mehr reiten dürfte. So lange wir die Sprache anderer Wesen nicht verstehen, sollten wir vorsichtig sein; auch unser Verhalten lässt ja nicht immer auf Vernunft schließen. Zudem lässt sich ein womöglich irreversibler Eingriff in die Grundlagen des Lebens als Geschichtszeichen im negativen Sinne verstehen, als Indiz dafür, dass dem Menschen nichts unantastbar ist – für Kant ist das „radikal böse“. Natürlich kann man an Kants Positionen und Theoremen einiges kritisieren, die Philosophiegeschichte seit Kant ist voll von solchen Einwänden. Trotz der nicht unbezweifelbaren Ausgangspunkte, des heute vielleicht weniger heftig auftretenden Vernunftvertrauens und der Infragestellung des generellen Erkenntnisziels kann man jedoch von Kant Entscheidendes lernen, das auch in bioethischen Kontexten als Leitfaden dienen kann. Was nämlich bei praktisch-normativen Entscheidungen, gerade bei solchen des Umgangs mit den Grundlagen unserer eigenen naturhaften Existenz, immer mit auf dem Spiel steht, ist neben dem Anspruch moralischer Forderungen auf ausnahmslose und durch keine anderen Erwägungen zu suspendierende Geltung und neben der unhintergehbaren Bedeutung der Anerkennung der Freiheit als Bedingung und Ziel unseres Handelns vor allem eines – unser Selbstverständnis als freie, handelnde, zumindest teilweise vernünftige und deshalb zur Moral fähige Wesen. Spuren Kant-Literatur allgemein: Daniel, Claus: Kant verstehen. Einführung in seine theoretische Philosophie, Frankfurt am Main 1984. Höffe, Otfried: Immanuel Kant, München 1983. Höffe, Otfried (Hg.): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, Frankfurt/Main ²1993. Kaulbach, Friedrich: Immanuel Kant, Berlin ²1982 oder später (dann zus. mit V. Gerhardt). Literatur zu bioethischen Fragen mit Blick auf Kant: Braun, Kathrin: Menschenwürde und Biomedizin. Zum philosophischen Diskurs der Bioethik, Frankfurt am Main 2000. Links zu Kant: http://www.uni-mainz.de/~kant/kfs/Welcome.html http://www.uni-marburg.de/kant/ http://ethics.acusd.edu/theories/Kant/index.html