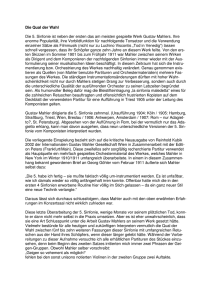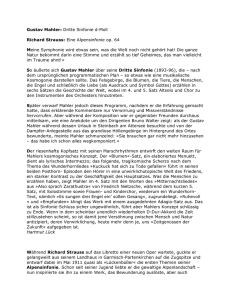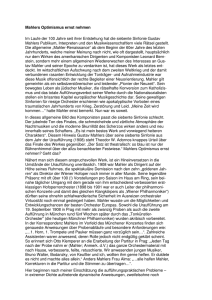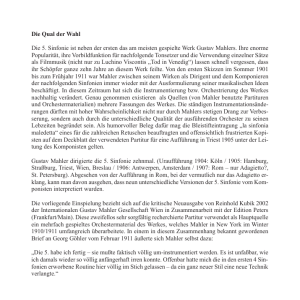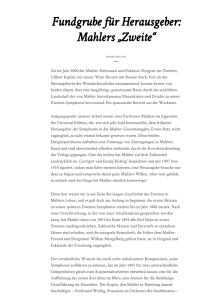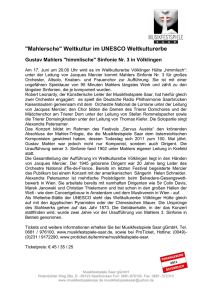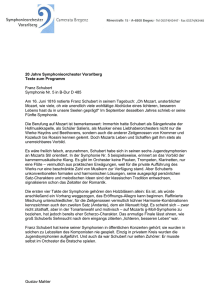93.098 Beiheft-Text als
Werbung

Gustav Mahler (1860-1911) Sinfonie Nr. 9 D-Dur »Ich habe wieder einmal die 9. Sinfonie Mahlers durchgespielt«, schreibt Alban Berg 1912 an seine Frau: »Der erste Satz ist das Allerherrlichste, was Mahler geschrieben hat. Es ist der Ausdruck einer unerhörten Liebe zu dieser Erde, die Sehnsucht, in Frieden auf ihr zu leben, sie, die Natur, noch auszugießen bis in ihre tiefsten Tiefen – bevor der Tod kommt. Denn er kommt unaufhaltsam. Dieser ganze Satz ist auf die Todesahnung gestellt. Immer wieder meldet sie sich. Alles irdische Verträumte gipfelt darin (daher die immer wie neue Aufwallungen ausbrechenden Steigerungen nach den zartesten Stellen) – am stärksten natürlich bei der ungeheuren Stelle, wo diese Todesahnung Gewissheit wird, wo mitten in die ›höchste Kraft‹ schmerzvollster Lebenslust ›mit höchster Gewalt‹ der Tod sich anmeldet – dazu das schauerliche Bratschen- und Geigensolo und diese ritterlichen Klänge: der Tod in der Rüstung. Dagegen gibt’s kein Auflehnen mehr. –« »Es kommt mir«, so immer noch Alban Berg, »wie Resignation vor, was jetzt noch vor sich geht – immer mit dem Gedanken an das ›Jenseits‹, das einem in der Stelle ›misterioso‹ gleichsam wie in ganz dünner Luft – noch über den Bergen – ja, wie im luftverdünnten Raume erscheint. Und wieder, zum letzten Mal, wendet Mahler sich der Erde zu – nicht mehr den Kämpfen und Taten, die er gleichsam von sich abstreift, sondern ganz und nur mehr der Natur. Was ihm und wie lang ihm die Erde noch ihre Schätze bietet, will er genießen: er will, fern von allem Ungemach, in freier, dünner Luft des Semmerings ein Haus schaffen, um diese Luft, diese feinste Erdenluft in sich zu saugen, mit immer tieferen Atemzügen – immer tieferen Zügen, dass sich das Herz, dieses herrlichste Herz, das je unter Menschen geschlagen hat, weitet – immer mehr sich weitet – bevor es hier zu schlagen aufhören muss ...« So sehr der bewegte, bewundernde Alban Berg Mahlers 9. Sinfonie auf dessen persönliche Situation bezieht – der Bruch mit der Wiener Staatsoper, der Tod der älteren Tochter, der von einem Landarzt festgestellte, von einem Spezialisten bestätigte Herzklappenfehler: all das hatte Mahlers ›Lebenseinstellung‹ ja von Grund auf verändert: »Ich durchlebe jetzt«, hat er Anfang 1909 an Bruno Walter geschrieben (der die 1908/09 entstandene 9. Sinfonie posthum dann uraufgeführt hat, am 26. Juni 1912 in Wien), »ich durchlebe jetzt so unendlich viel (seit anderthalb Jahren), kann kaum darüber sprechen. Wie sollte ich die Darstellung einer solchen ungeheuren Krise versuchen! Ich sehe alles in einem so neuen Lichte, bin so in Bewegung; ich würde mich manchmal gar nicht wundern, wenn ich plötzlich einen neuen Körper an mir bemerken würde. (Wie Faust in der letzten Szene.) Ich bin lebensdurstiger als je und finde die ›Gewohnheit des Daseins‹ süßer als je ...«; – so sehr Berg also Mahlers Biographie von dessen 9. Sinfonie nicht ferngehalten sieht, so sehr will ihm gleichzeitig erscheinen, dass das Werk weit über alles Persönliche hinausgehe. Was, auf anderer Ebene, nichts anderes hieße denn: Mahler findet einen neuen Stil. Oder, wie Mahler selber es Bruno Walter gegenüber ausgedrückt hat: »Es ist da etwas gesagt, was ich seit längerem auf den Lippen habe.« Der Berg-Schüler Theodor W. Adorno nun beschreibt in seiner »Wiener Gedenkrede« auf Mahler, 1960: Der erste Satz der Neunten – »zwei Themen, Dur und Moll, alternieren dialogisch. Sie holen weit aus zur erinnernden Erzählung von Vergangenem. Ihre Stimmen verflechten, übertönen sich, rauschen ineinander, bis, unterm Ansporn eines dritten Motivs, das Gebilde in leidenschaftliche Gegenwart sich verstrickt, um unter einem Schlag zusammenzubrechen, den man ahnt seit dem Rhythmus des ersten Takts. Nichts bleibt zurück als Bruchstücke und die Süße von schmeichelnd vergeblichem Trost. Das letzte Werk, das Mahler vollendete und dessen dritter Satz schon Partien einer vom Generalbaßschema wegstrebenden Polyphonie enthält, ist das erste der neuen Musik.« Für Michael Gielen nun ist gerade dieser erste Satz von Mahlers Neunter »der wichtigste und der empfundenste und der wahrste und der endgültige Satz des ganzen Mahler. Schon formal, indem die Sonate überwunden wird – ein Schritt, der gar nicht wichtig genug zu nehmen ist in der Entwicklung der Form ›Sinfonie‹, nicht zuletzt, weil sich das auch in der Art der Empfindung niederschlägt: da gibt es überhaupt keine akademische Art der Verarbeitung mehr. Die Erinnerung an Schönes kennzeichnet noch den ersten Komplex, die Ausweglosigkeit den zweiten. Und der Hauptrhythmus, der gleich zu Anfang, im Vorspann da ist und dann am Höhepunkt in den Posaunen, das ist ein ›Todesrhythmus‹: so soll das Herz doch nicht schlagen, das ist ein Herzfehler, sozusagen, eine Herz-Rhythmus-Störung, auf die Bühne gebracht. Wie aber nun die beiden Komplexe sich gegenseitig durchdringen, wie das zu einem Ganzen wird, wie es gelingt, zwei so kontrastierende Charaktere zu einem Satz zusammenzuzwingen – da kann man ja wirklich nicht mehr sagen, es sei ein erstes Thema und ein zweites Thema, diese Dualität gibt es da nicht, sondern es sind Varianten: sie gehören zusammen wie die ersten zwei Sätze von Mahlers Fünfter, es sind die ›zwei Seelen, ach‹ in seiner Brust, die erst mal jede für sich nach Ausdruck verlangen, bis sich schließlich herausstellt, dass sie doch nur verschiedene Aspekte derselben Negativität sind.« Die Mittelsätze dagegen? »Sind eher ein Rückblick auf Gesellschaftliches, auf Volkstümlichkeit, auf Vulgarität der andern, auf Negativerfahrungen, auf Träume auch – der utopische Moment mit der Trompetenmelodie im dritten Satz, der Burleske, hat etwas Erhabenes, etwas von einem Blick über die Niederungen der anderen Menschen hinweg, vielleicht auch hinweg über Mahlers eigene Niederungen.« Das Finale der Neunten schließlich? Zieht mit dem ersten Satz gewissermaßen an einem Strang: »Was sich im Lied von der Erde auf den letzten Satz hin entwickelt, der ja ›Abschied‹ heißt und Abschied von der Erde, Abschied vom Leben meint«, ist fraglos zum »Gesamtinhalt« der Neunten geworden, besonders eben ihrer Außensätze. Freilich: Im Verhältnis zum ersten Satz »ist die Erfindung im Finale vielleicht weniger neuartig. Der – nach dem ersten großen Komplex in Des-Dur – zweite Einfall, der ja erst nur, ›etwas zögernd‹, angedeutet wird mit dem cis-moll-Fagott, ist rein diatonisch und insofern überhaupt nicht avanciert, und doch in seiner Nacktheit ein besonderes Moment. Und wenn er in der Coda, auf der letzten Partitur-Seite, in Zeitlupe und in Dur kommt und sich dann verliert, ist er der Todestopos in seinem anderen Aspekt, eben nicht in dem erschreckenden Aspekt wie bei den Posaunen im ersten Satz, sondern in einem sich Öffnen gegenüber einem Unbekannten.« Pierre Boulez (*1925) Rituel in memoriam Bruno Maderna Daten: Boulez hat die Gedenk-Komposition 1974/75 geschrieben – Bruno Maderna, der italienische Komponist und Dirigent, Mitstreiter und Freund, war im Alter von 53 Jahren am 13. November 1973 in Darmstadt gestorben. Uraufgeführt wurde das Rituel am 2. April 1975 in London. Besetzung: Das Orchester ist unterteilt in acht Gruppen unterschiedlicher Größe – ein bis sieben Instrumente zählend respektive vierzehn Blechbläser vereinend, worüber hinaus jeder der Gruppen ein Schlaginstrument beigesellt ist (die Blechbläser beanspruchen deren zwei). Selbstkommentar: »In ständigem Wechsel folgen sich gleichsam Psalmverse und Responsorien einer imaginären Zeremonie. Es ist eine Zeremonie der Erinnerung: daher die vielen Wiederholungen immer gleicher Formeln, wobei sich dennoch Umrisse und Perspektiven wandeln. Es ist eine Zeremonie des Erlöschens, ein Ritual des Verschwindens und Überlebens: so prägen sich die Bilder in die musikalische Erinnerung ein – sind gegenwärtig und abwesend zugleich in einem Zwischenreich.« Vorüberlegung: »Psalmverse« – das geht auf fester gefügte musikalische Formen, auf ›standfeste‹ Choral-Zeilen in homophon chorischem Satz. »Responsorien« dagegen sind eher locker gefügt, einstimmig, womöglich beim Gehen gesungen. Den Klang der »Psalmverse« werden die Blechbläser bestimmen. Die »Responsorien « werden durch die Schlaginstrumente einen hörbaren Puls erhalten. Beobachtung: Ein Aufbau geht vor sich, als Zunahme instrumentaler Quantität bzw. struktureller Qualität. Ihm folgt, verkürzt spiegelbildlich, ein Abbau. »Dieser Abgesang«, kommentiert Josef Häusler, »ist als eine Art Boulez’scher ›AbschiedsSinfonie‹ bezeichnet worden. Das Wort mag zutreffen im Sinn eines zunehmenden Verschwindens von Instrumentalgruppen. Damit aber erschöpft sich die musikhistorische Assoziation. Denn der Abschied in Rituel ist ein letztes Lebewohl. Im Verebben gelangt das Werk zu seiner äußersten expressiven Dichte, wird in der Reduktion zur ›Summe‹.« Notations für Orchester I Modéré – Fantasque / II Très vif – Strident / III Très modéré / IV Rythmique / VII Hiératique. Lent 1945 komponiert Boulez, als sein »Opus 1«, Douze Notations für Klavier, zwölf jeweils zwölf Takte lange, von der Zwölftontechnik auf den Weg gebrachte Stücke. Mitte der 1970er Jahre fragt man bei ihm an, ob er etwas gegen eine Aufführung der dreißig Jahre alten Klavierstücke einzuwenden hätte, man denke an ein Konzert mit Kompositionen ehemaliger Messiaen-Studenten. Boulez macht sich auf die Suche nach den alten Noten, wird nicht fündig, ließ sie sich schicken – und stellt bald fest, dass er sein Interesse an den Stücken nicht verloren, wie sehr auch immer er sich von ihrer Begrenztheit entfernt hat. Zur Aufführung kommt es, die Drucklegung der Klavierstücke aber wird erst einmal hinausgeschoben. Bayreuth, Sommer 1976: Boulez probt Wagners »Ring«; bedauert, dass er keine Zeit zum Komponieren hat; überlegt, ob und wie er seine als Dirigent inzwischen reichlich angesammelten Orchestererfahrungen in eine Komposition einbringen könnte, in der womöglich »nichts zu komponieren«, bloß Vorhandenes »auszuarbeiten« wäre – und bleibt an den Notations hängen: die er zuerst schlicht transkribieren will. Bald aber zeigt sich: das große Orchester, das ihm hinsichtlich Farben, Timbres, Klangballungen vorschwebt, kann sich an den zumeist gerade mal zwanzig oder dreißig Sekunden langen Stücken allenfalls die Zähne ausbeißen. Ausweg? »Ich muss die ursprünglichen Ideen vergrößern.« 1977/78 arbeitet Boulez vier Notations für großes Orchester aus; 1997 – inzwischen hat er vom Chicagoer Sinfonieorchester den Auftrag zu vier weiteren Orchesterversionen erhalten – wird Notation VII fertig. Das zuletzt zugrundegelegte Klavierstück dauert etwas über eine Minute, das Orchesterstück wuchs auf deren wenigstens acht an, aus den ursprünglich zwölf wurden zweiundsechzig Takte. Weniger ausführlich noch war den Notations I-IV zugesetzt worden: sie kommen, ausgearbeitet, auf acht Minuten nur, nimmt man alle vier zusammen. Die Uraufführung sowohl der Notations I-IV wie der Notation VII dirigiert Daniel Barenboim: am 18. Juni 1980 in Paris (es spielt das Orchestre de Paris), am 14. Januar 1999 in Chicago (jetzt spielt das Chicagoer Sinfonieorchester). Als Boulez später mit Barenboim über seine Notations spricht, erinnert er sich an seinerzeit gelesene Berichte: wie man in etlichen ägyptischen Gräbern Getreidesamen gefunden, sie in Wasser gelegt und dann in die Erde gesteckt und damit neuerdings zum Keimen gebracht habe. So in etwa sei auch er verfahren, befindet er jetzt: die Samen waren alt, das Denken und die Entwicklung, die von ihnen ihren Ausgang nahmen, neu. Was Boulez aber genauer angestellt hat, hat er selber beschrieben in einem »Die Transkription und ihre Phantasiegebilde« betitelten Text, in welchem es schnell zu dem Satz kommt: »Es stellt sich jedoch das Problem einer Neukomposition. « »Das musikalische Material steht dir zur Verfügung, ist bereits erfunden, du fühlst dich als sein Besitzer, denn du hast es ja geformt; das stilistische Profil ist da, tief verborgen, geschützt durch die Ferne der Jahre, aber aus diesem Kern sind – mehr oder weniger sprunghaft, mehr oder weniger kontinuierlich – die verschiedenen Phasen deiner Entwicklung hervorgegangen, die du jetzt wieder in ihrem Zusammenhang siehst. Und so wird in dir der Wunsch wach, diesen Zusammenhang darzustellen, dieses ursprüngliche Material wieder aufzugreifen und ihm seine heutige Geschichte zu geben, die es in seiner Urform noch nicht kennen konnte.« Denn also: »Man geht den alten Text durch, macht ihn sich erneut zu Eigen, entdeckt seine Ursprünge und Wurzeln wieder; man schickt ihn durch das Sieb einer Analyse, die zunächst von Neugier und Absicht bestimmt ist, dann das Prisma der Imagination und der Möglichkeiten durchläuft; man erkennt seine Äderungen, seine Risse und Brüche, seine Gelenke; man ermittelt die Elemente, die nicht entwicklungsfähig sind, unverändert bleiben, und solche, die schrumpfen oder wachsen sollen; zwischen diesem Text, der dir schon gehört und dir noch nicht gehört, zwischen diesem Text und dir webst du Netze des Einvernehmens. Diese Figur bedarf einer Feineinstellung ihres rhythmischen Profils; bei jener Figur wird jeder einzelne Punkt zum Ort eines Wurzelschösslings, eines Pfropfreises; eine dritte Figur spiegelt sich in einer Reihe von immer stärker deformierenden Spiegeln ...« Schließlich: »Originaltext und Transkription, vielmehr Neukomposition, weichen derart voneinander ab, dass der Originaltext sich zu einer Art Geistererscheinung wandelt, die in dieser neu erstandenen Welt nur mehr spukhaftes Dasein besitzt.«