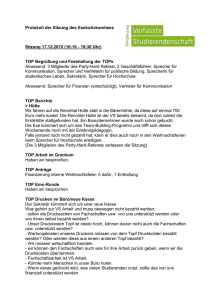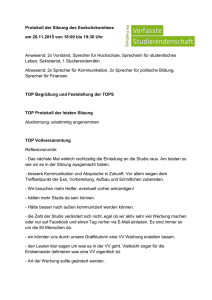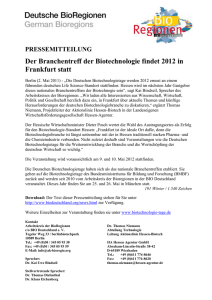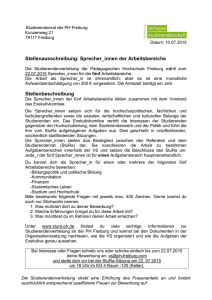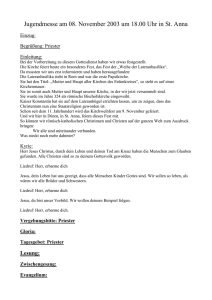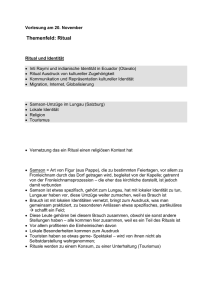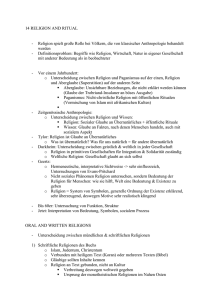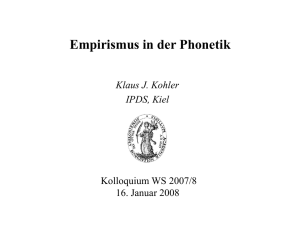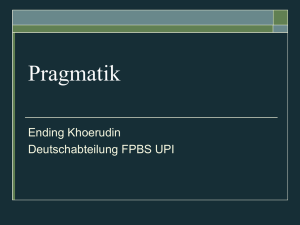SWR2 Essay
Werbung

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Essay Höhere Ordnung - Rituale in der Musik Von Torsten Möller Sendung: Montag, 5. Januar 2015 Redaktion: Lydia Jeschke Regie: Lydia Jeschke Produktion: SWR 2014 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Essay sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Musik 1: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 24 in c-moll, KV 491 Maurizio Pollini (Solist), Wiener Philharmoniker (Leitung: Maurizio Pollini) Deutsche Grammophon, Labelcode: LC 00173, Best. Nr. 1450507, bis 45´´ Sprecher 1: Ich gehe ins Konzert. Auf dem Programm: Ein Klavierkonzert Wolfgang Amadeus Mozarts, ein kleines orchestrales Divertimento Joseph Haydns, zum Abschluss die Dritte Symphonie Gustav Mahlers. Erste Überraschung: Die Garderobe ist zu. Meine Jacke unterm Arm betrete ich den Saal und nehme Platz. Versprengt trudeln die künftigen Hörer herein. Atmo 1: Instrumente stimmen des Orchesters Sprecher 1: Der Platz neben mir: noch leer. Mein Sitznachbar naht. Er hat eine Fahne, setzt sich, während der Dirigent die Bühne betritt in Jogginghose und T-Shirt. Ich könnte fortfahren, könnte berichten von der bierselig schnarchenden Schlafeinlage des Sitznachbarn, von seinem aufgeschreckten Applaus zwischen den Sätzen oder von störendem Popcorn-Konsum in den vorderen Reihen. Aber die Stoßrichtung ist schon klar. Gleich einiges stimmt nicht bei diesem Konzertbesuch – oder, mit anderen Worten: Das gewohnte Ritual ist empfindlichst gestört. Der Genuss Joseph Haydns fällt schwer. Musik 2: Joseph Haydn: Divertimento für Violinen, Cello und Klavier in C Dur Hob. XIV:4 United European Chamber Orchestra ARTS Music. LC 2513. Best. Nr. 47710-2. 0‘28 Sprecher 1: Der Konzertrahmen ist verinnerlicht, bestärkt durch Wiederholung, durch die Strenge des Geregelten wie Regulierten, durch eine Tradition, die fest verankert ist im – wie es Carl Gustav Jung einmal ausdrückte – „kollektiven Unbewussten“. Was ein Ritual genau ist, ist gar nicht so leicht zu sagen in Zeiten, in denen schamanische Rituale bekannt sind, in denen das Kind das Zu-Bett-Geh Ritual kennt, in denen Soziologen selbst die oberflächlichste TV-Talkshow als „rituelle Inszenierung von AlltagsGeselligkeit“ bezeichnen. Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger meint, dass die Geschichte der Ritualforschung immer zugleich eine Geschichte unterschiedlicher Ritualdefinitionen ist. Eine „richtige“ Definition gebe es nicht. Bloß eine Annäherung, einen Vorschlag: Sprecherin 1: Zitat Stollberg-Rillinger: „Als Ritual im engeren Sinne wird (...) eine menschliche Handlungsabfolge bezeichnet, die durch Standardisierung der äußeren Form, Wiederholung, Aufführungscharakter, Performativität und Symbolizität gekennzeichnet ist und eine elementare sozial strukturbildende Wirkung besitzt.“ (Barbara Stollberg-Rillinger: Rituale, Campus Verlag Frankfurt a.M. 2013 , (=Historische Einführungen Band 16), ISBN 978-3-593-39956-0, S. 9) 1 Sprecher 1: Lange war das Ritual verpönt. In der Geschichtswissenschaft galt es noch bis in die 1970er Jahre als Ausdruck des Irrationalen, des bloß Primitiven oder Archaischen – beides Sphären, mit denen der zivilisiert-moderne, auf Recht, Staat und Politik basierende Nationalstaat europäischen Zuschnitts nichts zu tun habe. Vor dem einschneidenden „cultural turn“ in den Geistes- und Sozialwissenschaften war die Schriftlichkeit, das Dokument, das Ereignis mit Jahreszahl das Entscheidende. „Weiche Faktoren“ waren für Historiker Nebensachen. Betrachtet man aber ein bloßes Dokument nur unter schriftlicher Perspektive, gerät Wesentliches aus den Augen. Die Krone – so Stollberg-Rillinger – galt zwar als... Sprecherin 1: „materielles Substrat des zunehmend transpersonalen Staatsverständnisses der europäischen Monarchien“ Sprecher 1: Was aber...: Sprecherin 1: „...darüber hinausging, wurde gewöhnlich als zeremonielles Dekor angesehen, das von der Eitelkeit, Naivität und mangelnden Abstraktionsfähigkeit des ‚mittelalterlichen’ oder ‚barocken’ Menschen zeugte.“ (Barbara Stollberg-Rillinger: Rituale, Frankfurt a.M. 2013 (Campus Verlag), (=Historische Einführungen Band 16), ISBN 978-3-593-39956-0, S. 32) Sprecher 1: Zurück zur Musik: Konzentration auf die Schrift war lange auch Sache der Musikwissenschaft. Das Augenmerk galt ausschließlich harmonischen Implikationen des Tristanakkords oder der Klärung kleinster Elementarteilchen in motivisch thematischen Zusammenhängen. Aber Beethovens Form-, Mahlers Instrumentationskunst, ja selbst Schönbergs psychologische Formen treffen nur eine Seite von Musik. Musik ist vor allem auch ein soziales Ereignis – das beweist das Konzertritual, aus dem Bestandteile des Rituals ohne Weiteres abzulesen sind: Sprecher 2: Erstens: Ein Ritual ist unmöglich ohne Gemeinschaft. Zweitens: Das Ritual kennt Regeln, gehorcht einem streng definierten Ablauf. Und die Dritte zeigt: Musik hat eine ernst-düstere Ritualseite quasi in sich. Musik 3: Gustav Mahler: 3. Symphonie in d-moll. Utah Symphony Orchestra, Leitung Maurice Abravanel. Vanguard Classics 1991. Best. Nr. 08 4006 72. EAN 3351474006720. Labelcode 00381. Ab 7´10´´ bis 8´ (evtl. drunter lassen und ff.) Sprecher 1: Der Ausdruck „Konzertritual“ ist kaum zufällig. Zu weiteren Bedeutungshöfen des Rituals gehören Begriffe wie Transzendenz, Spiritualität, nicht zu vergessen die 2 Religion, die im Wort schon steckt: das lateinische „ritus“ bezeichnet den einzelnen formalisierten sakralen Akt, während „rituale“ steht für das kodifizierte Regelwerk der Riten. Kodifiziert, genormt ist auch das Konzertritual, das aber eine relative neue Erscheinung ist. Noch im 18. Jahrhundert, zu Joseph Haydns Zeiten, fanden Konzerte in Gasthäusern, Kneipen statt. Hat ein Satz oder auch nur eine Passage gefallen, dann gab´s bierselige Heiterkeit, manchmal auch spontanen Applaus, der erst endete, wenn es eine Wiederholung der schönen Stelle gab. Anfang des 19. Jahrhunderts deutet sich etwas an, das heute unter dem Namen Kunstreligion firmiert. Sein Adagio aus der Missa Solemnis solle „Mit Andacht“ gespielt werden, so wünschte es sich ihr Schöpfer Ludwig van Beethoven. In der Zeit, als Richard Wagner seine Opern als „Bühnenweihfestspiele“ bezeichnete, hatte er sich längst durchgesetzt, der religiöse Habitus im Konzertsaal. Seine Markenzeichen: Stille, kontemplative Verinnerlichung, und gerade in Bayreuth, wo es nur der Kunst gilt: die unbequeme Sitzposition, vor allem auch: Geduld. Aus Elias Canettis Masse und Macht: Sprecher 2: Zitat Elias Canetti: Die Menschen sitzen regungslos da, als brächten sie es fertig, nichts zu hören. Es ist klar, dass eine lange künstliche Erziehung zur Stockung hier notwendig war, an deren Ergebnisse wir uns bereits gewöhnt haben. (Elias Canetti: Masse und Macht, Fischer Taschenbuchverlag Frankfurt a. M. 1995, S. 40) Sprecher 1: Elias Canetti bringt Leiden und Entzug als Voraussetzung des Rituals ins Spiel. Tatsächlich gilt das auch für den Konzert- oder Opernsaal, wenn auch nicht in so drastischer Form wie beim berühmten Stehen auf Arafat, das Canetti so beschreibt: Sprecher 2: Zitat Elias Canetti: In leidenschaftlicher Spannung horchen sie auf die Worte des Predigers, der vom Hügel herab zu ihnen spricht. Seine Predigt ist eine ununterbrochene Lobpreisung Gottes. Sie entgegen mit einer Formel, die sich tausendmal wiederholt: „Wir harren Deiner Befehle, Herr, wir harren Deiner Befehle!“ (...) Manche werden in der Hitze ohnmächtig. Aber es ist wesentlich, dass sie in diesen glühend langen Stunden auf der heiligen Ebene ausharren. Erst bei Sonnenuntergang wird das Zeichen zum Aufbruch gegeben. (Elias Canetti: Masse und Macht, Frankfurt a. M. 1995, S. 40) Sprecher 1: Ohnmacht, das heißt Pathologisches, wird zum Thema. Engführungen von Kunst und Religion sind bekannt, nicht aber ihre Konsequenzen. Richard Wagners Bühnenweihfestspiele kamen zur Sprache. Sie machten Eindruck auch auf den jungen Friedrich Nietzsche, dessen rauschhaft-dionysische Philosophie ohne die Musik Wagners wohl so nicht entstanden wäre. Vom Schwimmen in der Musik sprach Nietzsche. Und es ist kein Zufall, dass der Ethnologe Hans Peter Dürr Nietzsche zitiert just im Kapitel über die bewusstseinsverändernde Wirkung von Hexensalben. Nietzsches „Hexensalbe“ war Wagner: 3 Sprecher 2: Zitat Nietzsche: Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich. (Zit. nach Hans Peter Duerr: Traumzeit. Über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, Frankfurt a. M. 1985 (=Edition Suhrkamp 1345), S. 17) Sprecher 1: Friedrich Nietzsche sprach und polarisierte wie Hans Peter Duerr. Duerr schrieb, dass wir ins Haus gelieferte Erkenntnisse verkonsumieren und vergessen haben, dass die Wahrheit ihren Preis hat. Er zitierte einen Eskimo Schamanen, der zum Knud Rasmussen sagte, „Ihr wisst nicht, dass nur der erkennt, der in die Einsamkeit geht und Leiden erträgt.“ Es ist heikel, die abendländische Kultur mit Schamanen indigener Kulturen zu vergleichen. Unser Konzertritual ist – Stichwort Körperlichkeit – nicht vergleichbar mit der Ritenpraxis sibirischer Tenheri-Schamanen. Wie gesehen gibt es aber doch ähnliche Hintergründe und geistige Verwandtschaften. Auch grundsätzliche Ritual-Mechanismen zeigen sich in Ost wie West. Das betrifft zum Beispiel das Verhältnis von strenger Fixiertheit einerseits und nötigem Wandel andererseits. Die öffentliche, auf allen Kanälen gesendete Inaugurationsrede Barack Obamas musste wiederholt werden, nur weil das Adjektiv „faithfully“ an der zwar grammatikalisch richtigen, aber der Überlieferung nach falschen Stelle stand. Doch bezeichnend ist auch die Veränderung von Ritualen, damit Menschen dem Fortschritt Tribut zollen, damit das rituelle Geschehen in je eigener Gegenwart glaubwürdig bleibt. Schon in den indigenen Ritualen der Schamanen war Flexibilität gewährleistet: durch die mündliche Überlieferung oder, wie es neudeutsch heißt, durch „Face to Face“-Kommunikation. Für das moderne Konzertritual gilt ähnliches. Es wird zwar nicht wieder getrunken und gegessen wie noch im 18. Jahrhundert. Aber: Man darf heute schon mal in Jeans kommen. Viele Dirigenten, siehe die Selbstinszenierung eines Herbert von Karajan, waren einst so etwas wie bodenständige Statthalter Welt enthobener Komponisten. Heute sehen sie sich schon mal als ganz weltliche Vermittler. Das ist gut und bringt allzumenschlich Bodenständiges ins sterile Treiben. Trotz solcher Modifikationen steht das klassische Konzert mitsamt seinen Ritualen unter keinem guten Stern. Sprecherin 1: Zitat Cristiane Tewinkel: Es ist immer das Gleiche. Der Dirigent tritt auf, Händeschütteln, hinterher werden fünf gleiche Blumensträuße verteilt – das ist alles so erwartbar und so hohl. Ich frage mich dann: „Was ist hier überhaupt noch in irgendeiner Form lebendig?“ (Christiane Tewinkel: Eine kurze Geschichte der Musik. DuMont Verlag, Köln 2007, ISBN 9783832179342) Sprecher 1: Christiane Tewinkel ist in ihrem Buch Eine kurze Geschichte der Musik nicht die einzige Kritikerin des Konzertrituals. Die Argumente der Kritiker ließen sich allerdings auch gegen gewisse Erscheinungen des öffentlichen Lebens wenden. Das Abschalten des I-Phones fällt schwer. Stille, Konzentration und Verinnerlichung gerät 4 in Konflikt mit Signa unserer Zeit, mit omnipräsenter Verfügbarkeit, mit regem Informationsfluss, mit dem Bedürfnis nach Zerstreuung. Warum also nicht Konzertrituale positiv belegen? Denn wo kann und darf man heute noch abschalten, wo hat man noch seine Ruhe? Und: Wo bringt man noch die Geduld auf, sich auf nur eine Sache, auf das konzentriert Erdachte eines anderen zu konzentrieren? Das klassische Konzert ist einer der wenigen Orte, wo Menschen zusammenkommen, zusammen eine stille Gemeinschaft bilden. Es war von der Ambivalenz des Rituals die Rede, die sich spiegelt in der Polarisierung. Auch Arnold Schönberg empfand das Konzertritual, das heißt, die strengen Konventionen der Bildungsbürger, als Problem. Er gründete den Verein für musikalische Privataufführungen, der vorsichtige Variationen des bekannten Rituals bot. Applaus war bei Schönberg und dem Wiener Kreisen verpönt, weniger aber die Stille als Voraussetzung für ungestörten Musikgenuss. Im Fluxus der 1960er Jahre ging es rabiater zu: das Überschreiten der Bühne war Programm. Zum Dialog mit dem Publikum kamen ausdrucksstarke Attacken auf bildungsbürgerliche Musiksymbole. Nam June Paiks Geigenzerstörungen sprechen eine deutliche Sprache, ebenso das Hämmern auf einem ausrangierten Klavier, dem bildungsbürgerlichen Symbol per se. Doch: So vehement die Institution Konzert im Fluxus auch attackiert wurde und so energisch das Band zwischen Kunst und Leben wieder geknüpft sein sollte; eines behielten auch die fluxuesken „Happenings“ oder „Performances“ bei: den rituellen Charakter einer Aufführung! Man könnte es den umfassenden Bedeutungshöfen des Ritualbegriffs zuschreiben. Doch letztlich bleibt es bei dem fast universellen Grundsatz, dass jedes inszenierte Ereignis mit menschlicher Beteiligung und mit markiertem Anfang und Ende rituell aufgeladen ist: siehe –jenseits der Stille – das Popkonzert oder das Fußballspiel. Fehlt aber der temporäre Ereignischarakter mitsamt Performer – so etwa bei der stetig laufenden Klanginstallation oder in Form der neuerdings so genannten Konzertinstallation –, wird das Ritual unterwandert. Die Konsequenz beschrieb der Musikpublizist Heinz-Klaus Metzger: Sprecher 2: „Der Wegfall des Ritus bei dieser grundsätzlich akusmatischen Musik, wo es nichts zu sehen gibt, zeitigt Probleme. Ein Beispiel: wenn wir jetzt einer Aufführung elektronischer Musik harrten, sagen wir mit vier Lautsprechern oder Lautsprechergruppen in den vier Ecken des Saales, wüsste man nicht genau, wann das Stück anfängt und wann es endet, denn eine solche Komposition mag ja sehr wohl mit einer Pause anheben oder verklingen (...). Es ist schwer, ohne einen agierenden Ausführenden den Anfang und das Ende zu markieren. Hier merkt man plötzlich: Es fehlt das Ritual.“ (Heinz-Klaus Metzger: Rituelle Aspekte des bürgerlichen Musiklebens, in: Musik und Ritual, hrsg. von B. Barthelmes und H. de la Motte-Haber, Darmstadt 1999 (=Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung, Band 39), S. 23) Musik 4: Maria de Alvear: Tannenbaum. Aus: Maria de Alvear: Baum. Maria de Alvear (Stimme), Drums Off Chaos (Jaki Liebezeit, Manos Tsangaris, Reiner Linke, Gero Sprafke). Maria de Alvear World Edition Bestellnr. 0006, LC 10625 1‘56‘‘ 5 Sprecher 1: Ein erstes Fazit: Moderne und Ritual stehen in prekärem Verhältnis. Die Rationalität, die nach Max Weber so benannte „Entzauberung der Welt“, verdrängte lange archaische, kaum auf den Begriff zu bringende Riten. In Zeiten, in denen das Interesse an Meditation, Mystik, Zen und Chi Gong wächst, in denen Spiritualität wieder fröhliche Urständ feiert, ist der Ritus wieder im Kommen, mitsamt seiner Ambivalenz. Man könnte es auch so sehen: Je stärker die Zurückdrängung des Körperlichen, der Irrationalität, des Unerklärlichen – desto stärker tritt das alles wieder zu Tage, wenn auch unter neuen Vorzeichen, meint die Anthropologin Mary Douglas in ihrem Buch Ritual, Tabu und Körpersymbolik: Sprecherin 1: Zitat Mary Douglas: Revolutionäre, die für die Redefreiheit auf die Barrikaden gegangen sind, greifen zu repressiven Sanktionen, um eine babylonische Sprachverwirrung zu verhindern. Jedes Mal jedoch, wenn die Welle der Revolte und des Antiritualismus abebbt und das Bedürfnis nach rituellem Ausdruck sich wieder durchsetzt, hat das erneuerte Symbolsystem etwas vom kosmisch-umfassenden Charakter des ursprünglichen verloren. Dass wir am Ende der Bewegung, nach der Säuberung der alten Rituale, einfacher und ärmer dastehen, gleichsam als rituelle Bettler, entspricht der Absicht. Aber auch andere Dinge gehen bei diesem Reinigungsprozess verloren, nicht zuletzt das Gefühl für die historische Artikulation, die Breite und Tiefe der Vergangenheit. (In: Mary Douglas: Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur, Frankfurt 1981 (=Suhrkamp Taschenbuch 353), ISBN 3-518-07953-0, S. 36/37) Sprecher 1: Soziologen, Anthropologen wie Ethnologen beschäftigten sich viel mit Ritual und Mythos. Claude Levi Strauss überschreibt seine Kapitel in seinem Klassiker Das Rohe und Gekochte mit klassischen Musikgattungen und Formen. Er betont, wie sehr der Mythos der Musik ähnelt: Sprecher 2: Zitat Claude Levi-Strauss: Das Hören des musikalischen Werks hat also, aufgrund von dessen innerer Organisation, die vergehende Zeit zum Stillstand gebracht; es hat sie eingeholt und aufgebrochen, wie ein vom Wind zerstreutes Nebelfeld. So dass wir, wenn wir Musik hören und während wir sie hören, eine Art Unsterblichkeit erlangen. (Claude Levi-Strauss: Mythologica I: Das Rohe und das Gekochte, Suhrkamp Verlag Frankfurt a.M. (1976, S. 31) Sprecher 1: In Kreisen der Musikwissenschaft hält man sich bedeckter. Merkwürdig insofern, da Musik im oder als Ritual stets wichtige Funktionen erfüllt – sei es im Konzertsaal, sei es bei den Ich Verwandlungen der Kaluli auf Papua-Neuguinea, sei es in afrikanischen Tanzriten oder den in Rausch geschwängerten Extasen europäischer Techno-Hochburgen. 6 Sprecher 2 Zitat: „Tatsächlich ist Musik ihrem Wesen nach Ritual, freilich ein abstraktes“ Sprecher 1: ... schrieb der Komponist Dieter Schnebel. Die Worte „rituelle Züge“ oder „Ritualcharakter“ gehen auch dem Musikjournalisten schnell über die Lippen. Aber: Worin besteht nun das Rituelle? Ist es in Musik strukturell überhaupt fassbar? Oder lässt sich zumindest etwas Konkretes konstatieren, das so etwas wie beschwörende Wirkung hat, das transzendente, spirituelle Zustände transportiert oder evoziert? Musik: 5 Maria de Alvear: Ölbaum. Aus: Maria de Alvear: Baum. Maria de Alvear (Stimme), Drums Off Chaos (Jaki Liebezeit, Manos Tsangaris, Reiner Linke, Gero Sprafke). Maria de Alvear World Edition Bestellnr. 0006, LC 10625 Sprecher 1: Nach Tannenbaum nun Ölbaum. Beide Stücke stammen von Maria de Alvear, der 1960 in Madrid geborenen und nun in Köln lebenden Komponistin. De Alvear steht nicht im Konzertsaal, sondern draußen als Performerin vor einer stämmigen Eiche. Von Gesang will man nicht sprechen. Eher gibt de Alvear so etwas wie ein animalisch-gutturales Knurren von sich. In den 70er Jahren studierte de Alvear Komposition bei Mauricio Kagel, doch später verließ sie die Pfade mitteleuropäischer Kunstmusik. Schon als junge Frau begeistert sich de Alvear für Joseph Beuys rituelle Aktionen und Installationen, die – wie Zeige deine Wunde – in ihrer Kargheit und Bildgewalt Tiefenschichten menschlicher Existenz ansprechen. In den frühen 1990 er Jahren beginnt nach einer persönlichen Krise ein Neuanfang. De Alvear betreibt ausgiebig so etwas wie angewandte musikalische Feldforschung. In Finnland oder Sibirien studiert sie Rituale von Schamanen. Lange lebt sie bei den Indianern Nordamerikas, beim Volk der Irokesen. „The mind is a drunken monkey“ sagen sie dort, „der Kopf ist ein betrunkener Affe“. Entscheidend bei den Irokesen ist nicht die Ratio. Entscheidend ist der seelische, körperliche und vor allem spirituelle Zustand eines Menschen, oder auch: eines Baumes, dessen Wesen nun, in diesem Ölbaum lebendig werden soll. Musik: Maria de Alvear: (Ölbaum hochziehen) (s.o.) ges.1‘59‘‘ Sprecher 1: Maria de Alvears Beschwörungen enthalten außereuropäische Ingredienzen, die lange verpönt waren, gerade in Kreisen der musikalischen Avantgarde: Trommeln, ostinate rhythmische Muster treiben das Geschehen ohne formale Zäsuren voran. Unablässig insistierende Wiederholungen prägen Ölbaum von Maria de Alvear, prägen aber auch die meisten Rituale indigener Völker. Sprecherin 1: Es gibt keine Bühne. Was da passiert, ist echt. 7 Sprecher 1: … sagt Maria de Alvear und verweist damit auf natürliche Feinde des Rituals, zu denen jegliches Distanz förderndes zählt: Die Passivität der Musikwissenschaft hat Gründe und sie erinnert an die schwierigen Rechtfertigungskämpfe von Soziologen und Ethnologen vom Schlage eines Claude Levi-Strauss, eines Hans Peter Duerr oder eines Clifford Geertz. Rituale sind weder zu ergründen durch GeschichtsBetrachtung, durch Feldforschungen, durch strukturelle Analysen. Empathie, emotionale Hingabe ist gefordert statt distanzierter Analyse, ein Bewusstsein für Spiritualität anstelle des Versuchs rationaler Durchdringung. Was auf der Rezeptionsseite offensichtlich ist, spiegelt sich auch in der Kompositionssphäre: das Geistvolle, die Ironie wie das Manirierte, das epische Theater ebenso wie das postmoderne Zitatspiel stehen rituellen Erfahrungen fern. – Aber wie erreicht nun de Alvear das „Echte“? (Wobei schon die Frage eine bewusste Intention unterstellt, die noch zu ergründen wäre.) Wiederholungen sind unüberhörbar – jene Wiederholungen, die Arnold Schönberg und Theodor W. Adorno gar nicht echt, sondern wie eine Lüge empfanden, geradezu eine Beleidigung für den gewünschten hoch intelligenten Hörer, dem im reichen Variationsspiel doch bitteschön nichts entgehen möge. Seit Schönberg ist das Bewusstsein für verschiedene Musikkulturen gewachsen. Es gab nicht nur Arnold Schönberg, sondern es gab auch schon Igor Stravinskys und dessen Sacre du Printemps, der furiosen – durchaus wiederholungsträchtigen – Adaption volkstümlich russischer Riten. Weitgehend unberücksichtigt blieb der Däne Rued Langgård. Seine 1918 beendete Sphärenmusik ist ein Sonderling wie ihr Schöpfer, der seine Werke schuf aus einer kruden Mischung von französischem Symbolismus und einer vom Vater übernommenen theosophischen Weltanschauung. Schon in den späten zehner Jahren war Langgård auf einem Weg fernab des Etablierten. 1936 schrieb der extatische Außenseiter: Sprecher 2: Zitat Rued Langgård: Der Modernismus interessiert sich nur für Sachlichkeit und Wissenschaft, sollte sich aber auch für Stimmungen interessieren. Moderne, das heißt für mich das Stimmungs-verlassene. Musik: 6 Rued Langgård: Sphärenmusik für Orchester und Chor (1916-1918) Danish National Choir and Danish National Vocal Ensemble, Ltg. Thomas Dausgård, Dacapo LC 09158, Best. Nr. 6.220535, EAN Code: 0747313153565 bis 1´15´´ Sprecher 1: Von Rued Langgård sprechen nicht viele, auch nicht Hanns Werner Heister, der sich vorrangig beschäftigt mit der Musikgeschichte nach 1950. Ein Kapitel seines Textes Synthese versus Exotismus überschreibt Heister mit „Vereinfachungen, Ritualismus und Minimalismus“. Im Text stößt man auch auf Carl Orff. Heister sieht ihn als Vorläufer gewisser Erscheinungen der zweiten Jahrhunderthälfte: Sprecher 2: Über die Kluft der Generationen hinweg zeigen sich (...) Parallelen zu Carl Orffs Schaffen. Auf der Suche nach dem Ursprung verbindet Orff Ritualisierung musikalische mit einem Minimalismus avant la lettre: unaufhörliche einhämmernde Wiederholung einfacher Muster, und eine Motorik, die eigentlich auf moderne 8 Mechanik und Maschinelles verweist, aber als Ursprüngliches aus Urzeit verklärt wird. Hier fallen Prä- und bzw. Antimoderne, wie sie kompositorisch und ästhetisch ideologisch Orff präsentiert, einmal mehr mit Postmoderne zusammen. (Hanns-Werner Heister: Synthese versus Exotismus – Entdeckung der neuen „Dritten Welt“ und universalistische Integration des „Exotischen“, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert 1945-1975. Hrsg. v. Hanns-Werner Heister, Laaber 2005 (=Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert Band 3), ISBN 3-89007-423-5, S. 281) Sprecher 1: Spürbar ist Heisters Unbehagen an der seines Erachtens übertriebenen Reaktionen gegen Dogmen serieller Komplexität. Stockhausens intuitive, meditative Musik gerät ebenso ins Visier wie der Minimalismus amerikanischer Provenienz: Sprecher 2: Zitat Hanns Werner Heister: Der musikalische Minimalismus verbündet sich meist mit dem Ritualismus. Dieser war und ist samt einer nun vorwiegend fernöstlich-fernwestlichen statt abendländischen Re-Sakralisierung der Musik eine mächtige Tendenz auch und gerade nach der Zäsur von 1945. Sie speist sich aus verschiedenen Quellen. Eine sehr weit zurückreihende ist die Sehnsucht nach dem Sakralen, ein nostalgischer Rückgriff auf Vorvergangenes nach jenem Traditionsbruch, den die (vorwiegend bürgerliche) Emanzipation der Musik als eigenständige Kunst bedeutet hat. Ist Sakralisierung insoweit Restauration, die Aneignung von Vergangenem, zu dem keine direkte Traditionsverbindung mehr besteht, so ist sie zugleich auch ein Stück Tradition unmittelbare Fortsetzung einer Linie des explizit oder implizit Religiösen, das im bürgerlichen Zeitalter fortdauerte. Bezieht sich dieser Aspekt vorwiegend auf die stofflich-inhaltliche Dimension, so hat Ritualisierung zugleich eine damit verbundene strukturell-formale. Ein gemeinsamer Nenner ist die Angst vor substanziell Neuem und das daraus herrührende Bedürfnis nach Gleichbleibendem, das sich als Wiederholungsbedürfnis äußert. (Hanns-Werner Heister: Synthese versus Exotismus – Entdeckung der neuen „Dritten Welt“ und universalistische Integration des „Exotischen“, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert 1945-1975. Hrsg. v. Hanns-Werner Heister, Laaber 2005 (=Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert Band 3), ISBN 3-89007-423-5, S. 281) Sprecher 1: Heister scheint unzufrieden mit Erscheinungen, deren Kunstcharakter schwerlich zu definieren, geschweige denn zu beweisen sind. Empathische Einfühlung, keine minutiöse Partituranalyse ist nötig, um das Ritual zu verstehen. Die These sei erlaubt: Eine Wiederholung ist keine Wiederholung. Ein langsam, unablässig im piano gezupfter Geigenton wird ganz andere Folgen haben als die schnellen Trommelrhythmen in de Alvears Tannenbaum. Wiederholungen können je nach Klang und Tempo ganz verschiedene Funktionen erfüllen; sie können sich im Konzertsaal flächig ausdehnen, das Gefühl von Zeitenthobenheit wecken. Sie können aber auch, wie in den Initiationsriten der brasilianischen Candomblé-Kultur zur Steigerung extatischer Tänze dienen, die auf pathologische Zustände zielen; darauf, durch immer intensiver kreisende Bewegungen den Gleichgewichtssinn außer Kraft zu setzen. Im Candomblé führt das Tanzen zu tranceartigen Zuständen, zu körperlichen Dysfunktionen wie Krämpfen, Taumeln, Schaumbildungen vorm Mund, Lähmungen oder Kreislaufstörungen. Zu solch bewusst anvisierten rituellen 9 Manipulationen kommen konkret physische: Nach den Tanzritualen folgen beim Candomblé Inzisionen, vorsätzliche Schnitte in die Kopfhaut, die die Einführung verschieden stimulierender Tinkturen ermöglichen. Solch eklatanter Kontrollverlust macht nicht nur dem im engen Korsett der Affektenregulierung steckenden Europäer Angst. Auch die brasilianischen Novizinnen der Candomblé Kultur fürchten die Initiationsriten. Wenn sie aus Angst oder Panik die Tanzfläche verlassen wollen, greift der Kultleiter ein, klemmt den Kopf der jungen Frauen gewaltsam ein und schleift sie zurück auf die Tanzfläche. Warum das alles, könnte man fragen, um was geht es? Arnold Gennep, der französische Ethnologe, hat schon Anfang des letzten Jahrhunderts nach Antworten gesucht: 1909 präsentiert er in seinem Buch Les rites de passage einen dreiphasigen Ablauf von Initiationsriten, der universale Gültigkeit hat: In einer ersten Phase geht es um die Trennung vom bisherigen Leben. Es folgt eine Zwischenzeit, in der sämtliche Standesattribute außer Kraft gesetzt werden. In der dritten Phase folgt die Rückkehr in die Gemeinschaft – wohlgemerkt als neuer Mensch, als eine neue Persönlichkeit, die der Orishá, der Kultleiter bestimmt. – Der Exkurs zu Maria de Alvear und den drastischen Initiationsriten der Candomble-Kultur bieten Hintergründe, um „unsere Rituale“ zu verstehen. Parallelen zum Techno sind offenbar: die Medikation, Extasy als Brücke zu anderen Welten, das wilde Trance artige Tanzen sowie die Ausschaltung der Begriffssphäre nicht zuletzt durch pathologische Lautstärken. Aber selbst im ungleich körperloseren und domestizierteren Konzertritual gibt es Schnittmengen. Um geheime Mächte der Musik geht es dabei, um schwer zu fassende Tiefendimensionen emotionaler wie intuitiver Natur. Wenn sich ein Hörer für knapp zwei Stunden in den Konzertsaal begibt, geschieht auch etwas mit ihm. Es ist sicher kein Abschied vom bisherigen Leben, wie Gennep beschrieb. Aber doch kann es ein eindringliches Erlebnis sein, das in seiner Direktheit und relativen Körperlichkeit einem Museumsbesuch bei weitem überlegen ist. Die Messung von Hirnströmen und Durchblutungen verschiedener Hirnareale reicht beileibe nicht, um das Feuerwerk der Neuronen beim Musikhören und -Machen zu verstehen. Aber die These sei erlaubt: Durch das verinnerlichte Hören, durch die Konzentration auf etwas so abstraktes wie Musik besinnt sich der Hörer seiner selbst. „Oasen der Ruhe“ klingt kitschig in Zeiten des Wortverschleißes. Aber fernab alltäglicher akustischer Umweltverschmutzung und ständiger Erreichbarkeit leistet der Konzertsaal Wesentliches: eine Gemeinschaftsbildung zweckfreier Natur, ein offenbar schwer gewordenes Einlassen auf von Anderen konzentriert Erdachtes. Musik: 7 Dieter Mack: Taro für zwei Klaviere, Flöte, Bass-Klarinette und Schlagzeug (1991) Ensemble SurPlus, Leitung: James Avery Edition Zeitklang, LC 00581 bis 40´´ Sprecher 1: Kammermusik von Dieter Mack. Wie Maria de Alvear, so beginnt auch Macks Ausbildung unter europäischen Vorzeichen. Während seiner Ausbildung bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough an der Freiburger Musikhochschule besucht er einen Kurs über Gamelan-Musik bei Hans Oesch, einem bekannten Musik-Ethnologen in Basel. Die indonesische Gamelan-Praxis fasziniert den noch jungen Mack. Seit 1978 bereist er regelmäßig den Südosten Asiens und spielt mit in diversen GamelanEnsembles und Orchestern. Die Kraft des kollektiven Musizierens lernt Mack so kennen – und zu schätzen: Noch sein heutiges Interpretationsideal rührt von 10 Erfahrungen mit der Gamelan-Praxis – es ist ein rituelles Ideal, das nur dann verwirklicht ist, wenn der Einzelne es versteht, sich zu Gunsten des Kollektivs zurückzunehmen und so seinen Beitrag leistet zu einem geschlossenen Ensembleklang. Mack ergreift nicht Partei wie Heister. Er weiß, dass jede Kultur seine eigenen Voraussetzungen hat. Und er kennt übliche Vorurteile: Sprecher 2: Zitat Mack: Es ist eine gängige Auffassung, die Idee des Rituals im weitesten Sinne als nicht mehr zeitgemäß zu betrachten. Rituale setzen in der Regel eine kollektive, ganzheitliche Konzeption einer Gesellschaft voraus, da die rituelle Erfahrung das Subjektive zu Gunsten eines nur im Ritual erfassbaren Etwas auflöst, das sowohl kollektivistisch als auch individualistisch ist. Es sei dahingestellt, inwieweit diese Erfahrungen einer primär partikularistischen oder pluralistischen modernen Industriegesellschaft inzwischen verwehrt sind und jegliche Art des so genannten „Sich-Selbst-Aufgebens“ eine aktuelle Form der Selbsttäuschung ist, wie es manche Kritiker behaupten. Ich selbst glaube nun daran, dass diese Erfahrungen in Form eines kollektiven Rituals durchaus zeitgemäß sind, vorausgesetzt dieses neue Kollektive entsteht durch das intensive Zusammenwirken der beteiligten Individuen und wird zudem durch die Faktur des Werks ausgelöst. (Dieter Mack: Auf dem Weg zu einer eigenen Kultur – Gedanken, Behauptungen und Positionen zur Zielsetzung und Notwendigkeit meines eigenen Komponierens, in: Neue Musik 2000 – Fünf Texte von Komponisten. Hrsg. v. Klaus Hinrich Stahmer. ISBN Würzburg (Königshausen & Neumann) 2001 (=Schriften der Hochschule für Musik Würzburg Band 6). ISBN 3-8260-2056-1, S. 32) Musik: Dieter Mack: (Taro für zwei Klaviere, kurz hochziehen) (s.o.) Sprecher 1: Doch was meint Mack mit der Faktur des Werkes? Kargheit prägt dieses Taro für zwei Klaviere, Flöte, Bass-Klarinette und Schlagzeug. Die Unisono Führungen der beiden Klaviere schaffen konzentrierte Spannung. Dialogstrukturen der Instrumente fallen auf. Zugleich betont Mack die Notwendigkeit zur Emanzipation vom Notentext. Sein Schönheitsideal ist die Verselbständigung des Geschehens, die er selbst erlebt hat als Mitspieler in Gamelan-Orchestern. Musik: Dieter Mack: (Taro, von 14´20´´ bis Ende 15.30´´) (s.o.) ges.: 3‘05‘‘ Sprecher 2: Zitat Mack: Der/die einzelne soll in die Sache – die Komposition bzw. den erst durch das adäquate Spielen entstehenden Ausdruck – so hineinwachsen, dass die Kombination der subjektiven Momente ein neues Ganzes ergibt, das allerdings nur bedingt vorhersehbar oder in der Partitur ablesbar ist. Komponieren in diesem Sinne und das Werk selbst (einschließlich seiner praktischen Realisierung) präsentieren sich somit als Metapher für soziale Verantwortlichkeit und kompensieren das latent Elitäre, das der Neuen Musik oder Kunst überhaupt anhaftet. Dieser – durchaus ebenso utopische – Ansatz ist einer meiner wesentlichen Antriebskräfte zum Komponieren und zugleich für intensive pädagogische Arbeit. 11 (Dieter Mack: Auf dem Weg zu einer eigenen Kultur – Gedanken, Behauptungen und Positionen zur Zielsetzung und Notwendigkeit meines eigenen Komponierens, in: Neue Musik 2000 – Fünf Texte von Komponisten. Hrsg. v. Klaus Hinrich Stahmer. ISBN Würzburg (Königshausen & Neumann) 2001 (=Schriften der Hochschule für Musik Würzburg Band 6). ISBN 3-8260-2056-1, S. 33/34) Sprecher 1: Dass, was Dieter Mack unter Idee einer zeitgenössischen, kollektiven Erfahrung beschreibt, hat gewiss Utopie-Charakter. Aber der Aspekt des Überindividuellen ist zunehmend wichtig in einer Zeit, in der Individuelles Denken sichtbar in Sackgassen führt. Hans Peter Duerr plädierte für die Relativierung des Ichs, um einer Situation entgegen zu wirken, in der – so Duerr sinngemäß – viele ihr Ego beim Psychologen holen und bestärken. Von den Auswüchsen des Egozentrismus einmal abgesehen: Es ist ein erstaunlicher Befund, dass sich Dieter Macks Ambitionen fast 1:1 in den Ritual-Definitionen der Historikerin Stolberg Rilinger wiederfinden: Sprecherin 1: Zitat Stolberg-Rilinger: Rituale ordnen den einzelnen Akt in ein kollektives, überindividuelles Strukturmuster ein. Denn sie weisen zeitlich über die Gegenwart in doppelter Weise hinaus: Sie erinnern an vergangenes und verpflichten zu zukünftigem Handeln. Rituale verbinden in sich Dauer und Wandel, sie bilden ein Scharnier zwischen Individuum und Gesellschaft. Gerade indem sie zum Beispiel einen individuellen Statuswechsel bewirken, bekräftigen sie umgekehrt zugleich die Beständigkeit der Ordnung als Ganzer. Indem sie sich in hergebrachten, wiederholbaren Formen abspielen, stellen sie die Beteiligten in eine Ordnung hinein, die älter ist als sie selbst und sie zugleich überdauern wird. (Barbara Stollberg-Rilinger: Rituale, Frankfurt a.M. 2013 (Campus Verlag), (=Historische Einführungen Band 16), ISBN 978-3-593-39956-0, S. 13) Sprecher 1: Bewusste Weckung ritueller Erfahrungen hat es in der Musikgeschichte immer wieder gegeben. Rued Langgård, Igor Stravinsky, Carl Orff, Maria de Alevar, Dieter Mack wurden genannt. Übergangen wurden Johann Sebastian Bachs Beiträge zur streng definierten Messe, die rituellen Anflüge beim französischen Sonderling Erik Satie, die besondere spirituelle Dimension in Alvin Luciers akustischer Übertragung von Gehirnströmen im Stück Solo for Performer. Insbesondere ab 1960 kommt das Ritual zur Entfaltung. Karlheinz Stockhausens intuitive Musik wäre in diesem Licht zu betrachten. Die exorbitante Gewalt von Bernd Alois Zimmermanns 1969 beendetem Requiem für einen jungen Dichter nicht erklärbar ohne die rituelle Seite des Werks zur Kenntnis zu nehmen, die Zimmermann selbst als Lingual beschrieb, einer Neukombination der Begriffe Lingua – lateinisch für Sprache – und Ritual. Eine besondere Spielart ritueller Musik brachte der griechische Außenseiter Jani Christou ins Spiel. Unermüdlich arbeitete Christou an Möglichkeiten, über Musik das Unbewusste zu erreichen, den Weg ebnen zu jenen unbewussten Archetypen, die der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung beschrieb. Sprecher 2: Zitat Letsokos: Christou war weit davon entfernt, 12 Sprecher 1: schrieb Christous Biograf George S. Letsokos, Sprecher 2: die Musik als eine Aktivität um ihrer selbst willen zu betrachten (er verachtete eine solche Auffassung als „Dekorativismus“ oder „Ästhetizismus“). Er sah die Musik vielmehr als ein Mittel an, uranfänglich gemeinsame Emotionen zu aktivieren, die ansonsten durch die Zivilisation unterdrückt sind, und einen mystischen Zustand der Trance oder der Hysterie zu erreichen. (George S. Letsokos: Art. Jani Christou, in: New Grove Dictionary of Music and Musicians, Hrsg. v. Stanley Sadie, London (Macmillan), 1980) Musik: 8 Jani Christou: Schreie aus „Epicycle Edition RZ 2001, Best. Nr. 1013, LC 08846 ab 7´ = 0‘44‘‘ Sprecher 1: Christou ließ nicht nur schreien. Er gab seine Komponistenfunktion auf, überließ mittels grafischer Partituren den Ablauf den Interpreten. Patterns nannte der Grieche bestimmte, oft wiederholte Formeln, die das Unbewusste ansprechen sollten. Sein großes Orchesterwerk Anaparastis war wohl die Vorstufe zu einer bisher nicht aufgeführten Orestie, einem gigantischen Bühnenritual für Schauspieler, Sänger, Tänzer, Chor, Orchester, Tonband und visuelle Effekte. Aischylos gleichnamige Trilogie sollte als Ausgangspunkt dienen für die Beschäftigung mit mythischen Archetypen. In seinem letzten Interview vor seinem Tod durch einen Autounfall brachte Jani Christou die Orestie und sein geplantes Ritual in Zusammenhang mit … Sprecher 2: … der Panik vor der Unlösbarkeit des Problems menschlicher Existenz. Sprecher 1: Ursprungssuchen, das Verhältnis von Kollektiv und Individuum, die Ambivalenz des Rituals – all das kam zur Sprache, und doch fehlt Wesentliches: Der Hörer, die Hörerin, die Magie der Kommunikation. Wenn Gustav Mahler oder ein Adagio Beethovens „rituelle Energie“ im Konzertsaal bekommen, so liegt das nicht an den Komponisten, die beide eher ritualfern veranlagt waren. Es liegt am Hörer, an seiner gespannten Ruhe, an seinen ausgefahrenen Antennen, die selbst kleinste Schwingungen vernehmen. Unerklärlich, gleichzeitig unbestreitbar ist die elektrisierende Aufladung zwischen den Verliebten beim ersten gemeinsamen Kinobesuch. Alles erscheint plötzlich in Vergrößerung. Jede kleinste Bewegung, Regung bekommt Gewicht. Man muss nicht frisch verliebt sein, um solche Erfahrungen im Konzertsaal zu machen. Die Konzentration auf eine Sache, die Wortlosigkeit fördert die Fähigkeit zur Empathie. Ob die Musik dem Sitznachbarn gefällt oder nicht, ist unmittelbar und ganz mühelos abzulesen an Bewegungen, kleinen Seufzern, Atmen, ja vielleicht sogar an der Herzfrequenz, die man zuweilen zu spüren vermeint. Die Musik stellt in diesen Momenten nur das Klima her, kann es aber je nach Charakteristik unterstützen. So erhellt sich, warum so Vieles ein Ritual sein kann, warum es ein Zu-Bett-Geh Ritual des Kindes gibt, warum die Zigarette danach ein Ritual sein kann, warum die Garderobe im Konzerthaus so wichtig ist. Es 13 geht auch um Orientierungen, die man sich selbst schafft, letztlich auch um Zuschreibungen, für die sich der Begriff Ritual eingebürgert hat: Sprecher 2: Zitat Hans Neuhoff: Wenn es eine Tendenz gibt, profane Konventionen und bloße Handlungsroutinen heute als ‚Ritual’ zu bezeichnen… Sprecher 1: Schreibt der Musikwissenschaftler Hans Neuhoff Sprecher 2: so kann dies nicht bedeuten, dass sie es tatsächlich auch wären, sondern es besagt, dass wir Bedeutungen in sie hineinlegen, die sie von sich aus weder besitzen noch beanspruchen. Vielleicht tun wir dies, weil in der entzauberten Welt, im ‚stählernden Gehäuse des Kapitalismus’, um mit Max Weber zu reden, die profanen Dinge die einzigen sind, die uns geblieben sind. Ebenso geblieben ist aber – und es wäre töricht, das zu leugnen – das Bedürfnis, unser Leben durch den Anschluss an ein wie immer gedachtes Anderes selbst zu überhöhen, ganz so, wie Rituale dies zu leisten haben. (Zitat Hans Neuhoff: Musik im Besessenheitsritual, in: Musik und Ritual, hrsg. von B. Barthelmes und H. de la Motte-Haber, Darmstadt 1999 (=Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung, Band 39), S. 87) Sprecher 1: Es bleiben Fragen, es gibt kein Resümee, nur Thesen. Im Licht des Rituals verändern sich gewohnte Perspektiven. Skandale, der berühmte Skandal bei der Uraufführung des Sacre von Igor Stravinsky, erscheinen plötzlich nicht mehr nur als Ergebnis einer befremdenden Musik, sondern auch als Ergebnis einer Brechung des äußerst aufgeladenen Konzertrituals, dessen regulierter Ablauf plötzlich verloren ist. Fest steht: so unterschiedlich Rituale auch ausfallen mögen. Alle verweisen sie auf Grundbedürfnisse des Menschen. Schon das Baby braucht Geborgenheit, die es durch wiederholte Abläufe von Eltern bekommt, die ganz natürlich wissen, was zu tun ist. Am Ende noch einmal zur Musik: ihr Klingen hört in John Cages knapp viereinhalb minütiger Generalpause auf. Wenn der Pianist sich setzt, den Tastendeckel hebt, beginnt das Ritual, ein Ritual der Stille, das aber noch manche Noten hinzufügt: Sie sind, wie der Komponist Ernstalbrecht Stiebler so schön bemerkt, meditativer Natur, magischer, ja mysteriöser: Sprecher 2: Zitat Ernstalbrecht Stiebler: Raum geben ist einer der wichtigsten Aspekte einer reduktiven Musik. Was heißt das? Fangen wir beim Hörer an: ihm Raum geben heißt, ihm eine Chance zu geben, sich zu beteiligen. Ihn nicht mit einer ungeheuren Fülle musikalischer Informationen zu überfordern oder mit geradezu vernichtender Intensität die Persönlichkeit des Hörers quasi auszulöschen. (…) Kafka sagte, jeder Mensch habe ein Zimmer in sich – das könne man sogar über das Gehör nachprüfen. Dieses Zimmer, diesen Raum sollte die Musik erreichen, ihn aber nicht, wenn auch auf Zeit, dem Bewusstsein entziehen. John Cage hörte im akustisch schalltoten Raum eines amerikanischen Studios zwei Töne, den seines Blutkreislaufs und den seines Nervensystems und 14 fand: es gibt keine Stille. Wir klingen selbst, das ist unser Klangraum, den wir in absoluter Stille klanglich wahrnehmen können. Viel wichtiger aber ist seine psychisch-spirituelle Wirklichkeit. Das heißt, wir müssen die Wirklichkeit des Kafkaschen Zimmers in uns nicht nachprüfen, wir kennen, wir fühlen seine Wirklichkeit. (Ernstalbrecht Stiebler: Reduktion als Chance, in: Neue Musik 2000 – Fünf Texte von Komponisten. Hrsg. v. Klaus Hinrich Stahmer. ISBN Würzburg (Königshausen & Neumann) 2001 (=Schriften der Hochschule für Musik Würzburg Band 6). ISBN 38260-2056-1, S. 11) Musik 9: Morton Feldman: Triadic Memories für Klavier , Susanne Liebner Oehms Classics, Best. Nr. OC 510. LC 12424 2’35 15