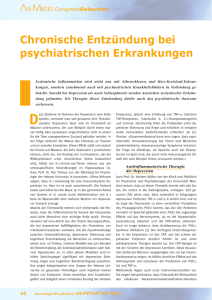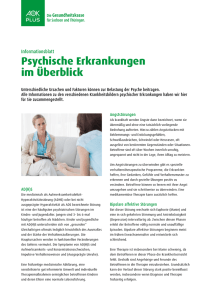Handout
Werbung

UPDATE Gesellschaft zur Förderung der ärztlichen Fortbildung und medizinischen Forschung e.V. XXI. Update in Psychiatrie, Psychotherapie & Psychopharmakotherapie 2015 28. und 29. Mai 2015 MuseumsQuartier/Arena 21, Wien Vortrags-Booklet in Kooperation mit Die in dieser Broschüre verwendeten Personenbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen. Inhalt Österreichischer Suizidreport Thomas Niederkrotenthaler 5 Erkennen und Behandeln der Schizophrenie – eine europäische Perspektive Gabriele Sachs 7 Einsatz von Depotantipsychotika in der klinischen Praxis Siegfried Kasper 10 Benzodiazepine – Grundprinzipien einer sinnvollen Anwendung Josef Hättenschwiler 12 Therapieresistenz bei Depression Siegfried Kasper 16 Vortioxetin bem älteren Patienten Josef Marksteiner 18 Personalisierte Antidepressivatherapie in der klinischen Praxis – State of the Art Erich Seifritz 20 Sexuelle Funktionsstörungen beim depressiven Patienten Martin Aigner 21 Internistisch relevante Veränderungen unter Psychopharmakatherapie Martin Letmaier 23 Elektrokonvulsionstherapie, klinische Durchführung und biologische Veränderungen Richard Frey 24 Schmerzentstehung, Verarbeitung und Behandlung Michael Bach 28 Schlaf, Schmerz und Depression Edith Holsboer-Trachsler 32 Einsatz von Antidepressiva im Spektrum von Endokrinologie und Onkologie Andreas Walter 33 Bipolare Erkrankungen – ein Update Andreas Erfurth 36 Psychopharmaka im Alter Michael Rainer Transgender Projekt am AKH Marie Spies 43 Non-invasive Hirnstimulation in der Therapie psychiatrischer Erkrankungen Georg Kranz 46 State of the Art differentielle Psychotherapie Henriette Löffler-Stastka 49 3 IMPRESSUM: Eigentümer, Herausgeber und Medieninhaber: UPDATE Gesellschaft zur Förderung der ärztlichen Fortbildung und medizinischen Forschung e.V., Tigergasse 3/4–5, A-1080 Wien, Tel. +43/1/4055734, Fax +43/1/4055734-16. Redaktionsanschrift: UPDATE Gesellschaft zur Förderung der ärztlichen Fortbildung und medizinischen Forschung e.V., Tigergasse 3/4–5, A-1080 Wien. Für den Inhalt dieser Ausgabe verantwortlich: Jeder Autor ist für seinen eigenen Vortrag verantwortlich. Layout & Satz: MP/Update, A-1080 Wien. Copyright 2015 by UPDATE Gesellschaft zur Förderung der ärztlichen Fortbildung und medizinischen Forschung e.V. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von UPDATE Gesellschaft zur Förderung der ärztlichen Fortbildung und medizinischen Forschung e.V. Österreichischer Suizidreport Assoz.Prof. Priv.Doz. Dr. Thomas Niederkrotenthaler, PhD, MMS Institut für Sozialmedizin, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien In Österreich gibt es seit 2011 einen überarbeiteten Nationalen Suizidpräventionsplan (SUPRA), dessen Implementierung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit seit 2012 über eine Kontakstelle an der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) vorangetrieben wird (Haring et al., 2011). Diese Umsetzung erfolgt vor dem Hintergrund der seit Mitte der 80er-Jahren deutlich rückläufigen Suizidzahlen. Dennoch sind Suizide in Österreich gegenwärtig weitaus häufiger als tödliche Verkehrsmittelunfällle, und verschiedene Bevölkerungsgruppen sind unterschiedlich stark betroffen. In diesem Vortrag wird ein epidemiologischer Überblick über Suizid in Österreich gegeben sowie über den österreichischen Suizidpräventionsplan und seine Umsetzung berichtet. Im Jahr 2013 starben in Österreich 1.291 Personen (324 Frauen, 967 Männer) durch Suizid. Obwohl diese Zahlen deutlich geringer sind als noch Mitte der 1980-er Jahre, als über 2.100 Suizide pro Jahr registriert wurden, sind dies fast dreimal so viele Todesfälle wie z. B. Verkehrstote (2013: 455 Tote). Seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 bewegen sich die Suizidraten auf einem relativ konstanten Niveau. Österreich liegt mit einer Rate von 12,8 pro 100.000 Einwohnern in etwa im Durchschnitt der Europäischen Union (Durchschnitt 2008–2011: 10,3) und unter den Raten der osteuropäischen Länder. Auch innerhalb Österreichs bestehen Unterschiede in der Suizidprävalenz. Insbesondere in der Steiermark und Kärnten sind die Raten tendenziell höher als der österreichische Durchschnitt, während in Vorarlberg und in Wien die Raten niedriger sind. Insbesondere eine Verbesserung des psychosozialen und biomedizinischen Angebotes, stärkere Nutzung dieser Angebote durch Entstigmatisierung von Suizidalität und psychischen Erkrankungen, aber auch legislative Voraussetzungen wie eine verschärfte Schusswaffengesetzgebung und eine weniger sensationsträchtige Medienberichterstattung über Suizidfälle durch Einführung von Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Suizid haben zu diesem Rückgang beigetragen (Tomandl, Sonneck, Stein, & Niederkrotenthaler, 2014; Kapusta et al., 2014). Der Rückgang der Suizidraten seit 1987 war besonders stark in städtischen Gebieten ausgeprägt, sodass ländliche Regionen heute einen speziellen Präventionsfokus benötigen. Deutliche Unterschiede im Suizidrisiko bestehen je nach Altersgruppe und Geschlecht: Während junge Menschen selten durch Suizid sterben, ist in dieser Gruppe Suizid nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen, und der Verlust an potentiellen Lebensjahren ist besonders ausgeprägt. Insbesondere Männer haben über alle Altersgruppen hinweg ein mehr als dreifach erhöhtes Suizidrisiko, und dabei sind gerade Männer ab dem 75. Lebensjahr (doppeltes Risiko im Vergleich zur männlichen Durchschnittsbevölkerung) stark betroffen. Für hochbetagte Männer ab 85 Jahren ist die Suizidrate sogar ca. dreifach höher. Für Suizidversuche liegen wenige verlässliche Daten vor, doch Schätzungen gehen davon aus, dass diese etwa 20-mal häufiger sind als Suizide. Insbesondere Frauen und jungen Menschen sind häufiger von Suizidversuchen betroffen. Der Österreichische Suizidpräventionsplan, der seit 2012 über eine Kontaktstelle an der GÖG umgesetzt wird, soll die Suizidprävention und die Versorgungssituation auf Basis eines multidimensionalen Ansatzes weiter stärken. Diverse professionelle Grupen, Institutionen, Interessensgemeinschaften und Personen arbeiten dabei an folgenden Zielen, die mit internationalen Modellen (Mann et al., 2007; World Health Organization, 2014) in Einklang stehen: 1.Schaffung von erhöhtem Bewusstsein und Wissen 2. Verbesserung von Unterstützung und Behandlung 3. Integration des Themas Suizid in bestehende Gesundheitsförderungsmaßnahmen 4. Reduktion der Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Suizidmitteln 5. Implementierung von Mental Health in All Policies 6. Erhöhung der Expertise (Grundlagenforschung, Weiterentwicklung der Suizidprävention und Qualitätssicherung) Im Vortrag werden sowohl aktuelle Aspekte bei der Konzepterstellung als auch exemplarische aktuelle Präventionsprojekte mit Relevanz für niedergelassene Psychiater und Allgemeinmediziner besprochen (vgl. Haring et al., 2011; Kapusta et al., 2014; Till & Niederkrotenthaler, 2014; Niederkrotenthaler et al., 2014). 5 Zusammenfassung Suizid ist in Österreich heute deutlich seltener als vor 30 Jahren, doch das vorhandene und steigende Wissen rund um die Evidenzbasis suizidpräventiver Maßnahmen sowie aktuelle epidemiologische Daten belegen ein deutliches Verbesserungspotential, insbesondere um den gegenwärtig hohen Suizidraten unter älteren Menschen zu begegnen, aber auch und dem Phänomen des Jugensuizids adäquat zu begegnen. Maßgeschneiderte Prävention braucht dabei einen mehrdimensionalen Ansatz, der sowohl klinische als auch nichtklinische Angebote umfasst. AllgemeinmedizinerInnen und PsychiaterInnen kommen bei diesen Ansätzen essentielle Rollen zu. Literatur Haring C, Sonneck G, Gollner G, Kapusta ND, Niederkrotenthaler T, Stein C, Watzka C, Wolf J. SUPRA—Suizidprävention Austria. Bundesministerium für Gesundheit, Wien, 2011. Siehe: http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/2/9/CH1453/CMS1392806002773/supra_gesamt10092012.pdf Kapusta N, Grabenhofer-Eggerth A, Blüml V, Klein J, Baus N, Huemer J. Suizid und Suizidprävention in Österreich--Basisbericht 2013. Wien: Bundesministerium für Gesundheit, 2014. Siehe: http://www.kriseninterventionszentrum.at/dokumente/suizid_und_suizidpraevention_in_oesterreich.pdf Mann JJ, Apter A, Bertolote J, Beautrais A, Currier D, Haas A, Hegerl U, Lonnqvist J, Malone K, Marusic A, Mehlum L, Patton G, Phillips M, Rutz W, Rihmer Z, Schmidtke A, Shaffer D, Silverman M, Takahashi Y, Varnik A, Wasserman D, Yip P, Hendin H. Suicide prevention strategies: a systematic review. JAMA 2005;294(16):2064-74 Niederkrotenthaler T, Reidenberg DJ, Till B, Gould M. Increasing help-seeking and referrals for individuals at risk for suicide by decreasing stigma–The role of mass media. American Journal of Preventive Medicine 2014;47:235-43 Till B, Niederkrotenthaler T. Surfing for suicide methods and help: Content analysis of websites retrieved with search engines in Austria and in the United States. Journal of Clinical Psychiatry, 2014;75:886–92 Tomandl G, Sonneck G, Stein C, Niederkrotenthaler T. (2014). Leitfaden zur Berichterstattung über Suizid. Kriseninterventionszentrum. Siehe: http://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/sozialmedizin/pdf3_Leitfaden_Medien.pdf World Health Organization, 2014. Preventing suicide – a global imperative. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Siehe: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/ 6 Erkennen und Behandeln der Schizophrenie – eine europäische Perspektive Ao. Univ.Prof. DDr. Gabriele Sachs Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Wien In den letzten Jahren konnte die psychopharmakologische Behandlung von Patienten mit Schizophrenie bedeutend verbessert werden. Ein Teil der Patienten leidet jedoch trotz Response an nicht unbeträchtlichen kognitiven Defiziten und Beeinträchtigungen in der psychosozialen Funktionsfähigkeit. Der Krankheitsverlauf variiert in der Häufigkeit und in dem Schweregrad der Rückfälle. Einer der häufigsten Gründe für einen Rückfall liegt im Absetzen der Antipsychotika. Derzeit wird europaweit eine Reihe von Studien mit dem Ziel durchgeführt, weitere Verbesserungen in der Diagnostik, der Behandlung und im Krankheitsverlauf der Schizophrenie zu erreichen. Einleitung Für die Diagnostik der Schizophrenie steht derzeit das ICD-10 F (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme klassifiziert im Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen) und das neu herausgegebene DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zur Verfügung (1). Im Bereich der Erkrankungen aus dem schizophrenen Spektrum wurde im DSM5 auf die bisherigen Subtypen verzichtet. Im DSM-5 kam es zur Einführung neuer Verlaufskriterien und Vorgaben zur Schweregradeinschätzung psychotischer Symptome. Durch eine verstärkte Berücksichtigung dimensionaler Aspekte soll eine genauere Krankheitsbeschreibung ermöglicht werden. Um das zu erreichen, wurde ein Untersuchungsinstrument entwickelt, mit dessen Hilfe Patienten mit Symptomen psychotischer Störungen hinsichtlich 8 Merkmalausprägungen dimensional evaluiert werden. Damit sollen Symptome besser als bisher abgegrenzt werden. Als Orientierung zur Behandlung der Schizophrenie stehen derzeit nationale und internationale Leitlinien zur Verfügung. Zur klinischen Entscheidungsfindung sind systematisch entwickelte Empfehlungen basierend auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens für eine optimale Diagnostik und Therapie der Patienten wesentlich. Internationale Leitlinien wurden von der Task Force der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP-Leitlinien) für die biologische Behandlung der Schizophrenien entwickelt, die entsprechend der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse regelmäßig überarbeitet werden (2,3). Antipsychotika sind der wesentliche Pfeiler in der Behandlung von Patienten mit einer Schizophrenie – die Überlegenheit in der Reduktion psychotischer Symptome und in der Rezidivprophylaxe wurde in den letzten 50 Jahren vielfach belegt. Entscheidend für eine gute antipsychotische Behandlung mit entsprechender Adhärenz sind ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Substanzen und eine besondere Beachtung möglicher Nebenwirkungen und Behandlungskomplikationen. Neue Entwicklungen in der Diagnostik und dem Krankheitsverlauf bei Schizophrenie Die EU-GEI Studie (European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene Environment Interactions) Ein Grund für ungünstige Behandlungsverläufe bei Schizophrenie ist oft, dass es zu einer sehr späten Behandlung kommt. Wesentlich ist daher die Früherkennung von psychotischen Symptomen. Im Anhang des DSM-5 wurde das „attenuierte Psychosesyndrom“ eingefügt. Hierunter ist ein Prodromalstadium mit abgeschwächt auftretenden psychotischen Symptomen zu verstehen, welches einer schizophrenen Erkrankung vorausgehen kann. Patienten mit Schizophrenie erleben gewöhnlich frühe psychotische Symptome ungefähr 1–5 Jahre vor dem Ausbruch der Krankheit. Dieser frühe Zustand der Krankheit wird auch als Risiko(ARMS=At Risk Mental State) oder Prodromalzustand bezeichnet. Menschen, welche diese ARMS-Kriterien aufweisen, scheinen einem extrem hohen Risiko ausgesetzt zu sein, eine Psychose zu entwickeln. Es ist unklar, warum nur ein Teil der hochvulnerablen Personen eine Psychose entwickelt. Um die Krankheitsmechanismen der Schizophrenie besser zu verstehen und den Übergang von einem Prodromalzustand in eine Schizophrenie zu untersuchen, wird das Projekt „Europäisches Netzwerk zum Studium von Gen-Umwelt-Interaktionen bei Schizophrenie (EU-GEI): Gen-Umwelt Interaktion im Prodromal- 7 stadium” durchgeführt (4,5). Es gibt zunehmende Evidenz dafür, dass ätiologische Modelle zur Erklärung der Schizophrenie die Rolle von genetischen, biologischen und psychosozialen Faktoren sowie deren Interaktion berücksichtigen sollten. Das Ziel dieses Projektes mit dem Arbeitsschwerpunkt „Prodrom” ist es, ein Instrument zu entwickeln, um genetische und umweltbezogene Faktoren zu identifizieren. Weiters wird der Stellenwert der neurokognitiven Störungen für den Übergang in eine Psychose untersucht. Genetische Untersuchungen inkludieren genomweite Assoziation-Scans sowie Kandidatengene wie z.B. Neuregulin 1. Umweltbezogene Einflussfaktoren beinhalten Urbanizität, Traumata und Substanzabusus. Die Identifikation dieser Faktoren sowie deren Interaktion kann eine Vorhersage über die eventuelle Entwicklung einer Psychose möglich machen. Es sollen auch jene Faktoren identifiziert werden, die protektiv gegen die Entwicklung einer Psychose wirken. Diese Erkenntnisse würden bedeutsam zur Entwicklung von zukünftigen Präventions- und Interventionsstrategien beitragen. Die PSYSCAN Studie (Translating neuroimaging f indings from research into clinical practice) Patienten unterscheiden sich im weiteren Krankheitsverlauf und der Rückfallsrate. Bisher existieren noch wenig Prädiktoren, die eine personalisierte Behandlung der Patienten ermöglichen. Eine weitere EU-Studie (PSYSCAN) widmet sich den Faktoren, die den Krankheitsverlauf vorhersagen können. In der Untersuchung werden bei ersterkrankten Patienten mit einer Schizophrenie Psychopathologie, strukturelle und funktionelle Veränderungen im Gehirn und biologische Marker im Blut untersucht. Die Studie soll helfen, mit Hilfe objektiver Kriterien eine spezifische Behandlung zu ermöglichen. 8 Neue Ansätze zur Behandlung der Schizophrenie In der EUFEST-Studie, einer offenen, randomisierte Studie, wurden Patienten mit einer Ersterkrankung Schizophrenie sowie mit schizophreniformen oder schizoaffektiven Störungen im Verlauf über ein Jahr untersucht. 498 Patienten wurden in fünf Behandlungsgruppen randomisiert, wobei jede Gruppe entweder mit einem der vier atypischen Neuroleptika Amisulprid, Olanzapin, Quetiapin und Ziprasidon behandelt wurde, oder das Standard-Neuroleptikum Haloperidol erhielt. Der primäre Endpunkt der Studie war die Gesamtabbruchrate der Behandlung und die Zeitdauer bis zum Abbruch einer Therapie. Es zeigte sich, dass eine Verbleibquote von 70% im ersten Jahr der Behandlung bei schizophrenen Patienten erreichbar ist, wobei Olanzapin zu einer besonders langen Therapiedauer und der geringsten Gesamtabbruchrate führte. Hinsichtlich der symptomatischen Besserung (gemessen an PANSS) waren jedoch keine Unterschiede innerhalb der Gruppe der verwendeten Atypika und zwischen den Atypika und Haloperidol festzustellen. Eine signifikante Unterscheidung der in der Studie verwendeten Wirkstoffe ergab sich aber in Bezug auf Abbruchrate und Nebenwirkungen sowie in Bezug auf die allgemeine Besserung der Schwere der Erkrankung und der allgemeinen psychologischen Funktion. Amisulprid führte zu der deutlichsten allgemeinen Besserung (6,7). Das Projekt OPTIMISE (Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe) ist ein neues EU-Projekt im EU-Rahmenprogramm Horizon 2020. Ziel der 6-jährigen Studie ist es, bisherige Therapien zur Behandlung der Schizophrenie zu optimieren und unter Einbeziehung der Genetik neue Mechanismen zur Medikamenten-Entwicklung zu entdecken. 500 Patienten mit einer Ersterkrankung Schizophrenie sollen mit einer 4 Wochen-Therapie mit Amisulprid starten. Amisulprid hat sich in der EUFESTStudie in Bezug auf Wirkung und Nebenwirkungsprofil (geringe extrapyramidale Symptomatik und Gewichtszunahme) als effektiv erwiesen. Diejenigen Patienten, die nach 4 Wochen keine Remission erreicht haben, werden verblindet entweder auf Amisulprid belassen oder auf Olanzapin umgestellt. Ein weiterer Anteil an Patienten, die nach dieser Behandlungsphase noch psychotische Symptome aufweisen, werden in einem offenen Therapiearm auf Clozapin eingestellt. MRI-Untersuchungen werden zur Diagnose und Prognose eingesetzt. Zur Verbesserung der Compliance und zur Rückfallprophylaxe erhalten die Patienten psychosoziale Interventionen, Psychoedukation und Textnachrichten auf einem Mobiltelefon als Reminder für die Medikamenteneinnahme. In einem weiteren Teil der OPTIMISE-Studie kommt zur Verbesserung der Negativsymptome (6) die Substanz „Cannabidiol CBD” im Vergleich zu Olanzapin zum Einsatz. Cannabidiol ist eine Substanz mit antipsychotischer Wirkung, blockiert jedoch nicht die D2-Rezeptoren. Eine weitere neue Studie zur Verbesserung des Krankheitsverlaufes untersucht den Vorteil der DepotBehandlung. Häufig setzen Patienten, die auf eine Behandlung gut ansprechen, die Medikation ab und erleiden einen Rückfall. Ein möglicher Ansatz zur Verbesserung der Medikamentencompliance liegt in der Behandlung mit Depot-Medikamenten. In einer Studie soll nun der Vorteil von Depot-Antipsychotika gegenüber oralen Antipsychotika in einem randomierten Studiendesign über 3 Jahre mit 600 geplanten Patienten über- prüft werden. Verglichen werden Aripiprazol oral (10–30mg/d) vs. Aripiprazol Depot (400mg) und Paliperidon oral (6mg) vs. Paliperidonpalmitat (25–150mg) im Hinblick auf Abbruchraten, Positiv-Negativ-Symptomatik, Nebenwirkungen, subjektives Wohlbefinden mit Neuroleptika, Lebensqualität, kognitive Funktionen und psychosoziale Funktionsfähigkeit. Die Frage ist, ob eine Depot-Medikation eher mit einem besseren Behandlungsverlauf einhergeht und wie die Tolerabilität im Vergleich zu oraler Medikation ist. Zusammenfassung Derzeit zielen europaweite intensive Forschungsbemühungen darauf ab, die Krankheitsmechanismen bei Schizophrenie und den Übergang in eine Psychose besser zu verstehen und die Behandlungsmöglichkeiten und den Therapieverlauf zu optimieren. Die EU-GEI-Studie (European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene Environment Interactions) und die PSYSCAN-Studie (Translating neuroimaging findings from research into clinical practice) widmen sich der Erarbeitung von Instrumenten zur Optimierung der Früherkennung vor Beginn der Therapie und Behandlung von ersterkrankten Patienten mit Schizophrenie. Als Orientierung zur Behandlung der Schizophrenie werden nationale und internationale Leitlinien entsprechend den neuen Forschungsergebnisse aktualisiert. Die OPTIMISE-Studie (Optimization of Treatment and Management of Schizophrenia in Europe) ist ein Beispiel im Bemühen um neue effiziente Therapieoptionen. Zur Verbesserung der Medikamentencompliance und Rückfallrate soll in einer weiteren Studie der Vorteil der Depot-Antipsychotika im Vergleich zur oralen Therapie geprüft werden. Literatur (1) Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen - DSM-5 ®: American Psychiatric Association. 2014. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Falkai P und Wittchen HU et. al. Hogrefe. (2) Hasan A, Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthoj B, Gattaz WF, Thibaut F, Möller HJ. 2012. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, part 1: update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. J Biol Psychiatry 13(5):318-78. (3) Hasan A, Falkai P, Wobrock T, Lieberman J, Glenthoj B, Gattaz WF, Thibaut F, Möller HJ. 2013. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, part 2: update 2012 on the long-term treatment of schizophrenia and management of antipsychotic-induced side effects. World J Biol Psychiatry 14(1):2-44. www. wfsbp.org/activities/wfsbp-task-forces.html. (4) van Os J, Rutten BP, Poulton R. Gene-environment interactions in schizophrenia: review of epidemiological findings and future directions. Schizophr Bull 2008;34(6):1066-82 (5) van Os J. European Network of National Networks studying Gene-Environment Interactions in Schizophrenia (EU-GEI). Identifying gene-environment interactions in schizophrenia: contemporary challenges for integrated, large-scale investigations. Schizophr Bull 2014;40(4):729736 (6) Boter H, Peuskens J, Libiger J, Fleischhacker WW, Davidson M, Galderisi S, Kahn RS. Effectiveness of antipsychotics in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder on response and remission: an open randomized clinical trial (EUFEST). EUFEST study group. 2009. Schizophr Res 2009;115(2-3):97-103 (7) Davidson M, Galderisi S, Weiser M, Werbeloff N, Fleischhacker WW, Keefe RS, Boter H, Keet IP, Prelipceanu D, Rybakowski JK, Libiger J, Hummer M, Dollfus S, López-Ibor JJ, Hranov LG, Gaebel W, Peuskens J, Lindefors N, Riecher-Rössler A, Kahn RS. Cognitive effects of antipsychotic drugs in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder: a randomized, open-label clinical trial (EUFEST). Am J Psychiatry 2009;66(6):675-82 (8) Fusar-Poli P, Papanastasiou E, Stahl D, Rocchetti M, Carpenter W, Shergill S, McGuire P. 2014. Treatments of negative symptoms in schizophrenia: Meta-analysis of 168 randomized placebo-controlled rrials. Schizophr Bull 2014 Dec 20 [Epub ahead of print] 9 Einsatz von Depotantipsychotika in der klinischen Praxis O.Univ.Prof. Dr.h.c.mult. Dr. Siegfried Kasper Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, AKH 10 Die Akut- und Langzeittherapie schizophrener Erkrankungen wurde in den vergangenen Jahren durch die Verfügbarkeit von neueren Medikamenten entscheidend verbessert. Nebenwirkungen, die vorher im Vordergrund standen, und die Erkrankungen, die die Patienten zusätzlich stigmatisierten wie z. B. die extrapyramidalen Nebenwirkungen (EPS), finden sich erfreulicherweise nur sehr selten. Dadurch hat sich die Adhärenz verändert und Patienten diskutieren mit ihrem Behandlungsteam die verschiedenen medikamentösen, aber auch psychotherapeutischen und soziotherapeutischen Hilfestellungen. Die Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie (ÖGPB) hat in diesem Zusammenhang im letzten Jahr den österreichweiten Konsensus über den Einsatz von Depotmedikation aus dem Jahr 2006 auf den neuesten Stand gebracht, und die wesentlichen Gesichtspunkte werden in diesem Vortrag zusammengefasst. Etwa zwei Drittel der Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises zeigen sich im Krankheitsverlauf als chronisch rezidivierend. Der Einsatz der Depot-Neuroleptika hat eine wesentliche Verbesserung der Erkrankungen schizophrener Patienten bewirkt. Dabei zeigte sich bereits frühzeitig, dass durch Verabreichung einer Depotbehandlung Rückfälle weiter reduziert werden konnten, da die Patienten die notwendige Medikation über einen längeren Zeitraum einnahmen. Die Vorteile der Depotantipsychotika sind die zuverlässige Freisetzung eines antipsychotischen Wirkstoffes, die bessere Bioverfügbarkeit, das Fehlen eines „First-Pass-Effektes“, konstantere Plasmaspiegel und häufigere Kontakte, die im Zusammenhang mit der Verabreichung der Depotmedikation notwendig sind. Als Nachteile wurde von verschiedenen Kollegen genannt, dass das individuelle Empfinden der Patienten mit einem reduzierten Gefühl der Autonomie und damit mit einer höheren Stigmatisierung einhergeht. Mit Einführung des Begriffes Adhärenz wurde deutlich, dass sich die Behandlung insofern verändert hat, als die Arzt-Patient-Beziehung symmetrischer wurde und der Patient in die aktive Gestaltung im Rahmen der Therapie einbezogen ist. Eine entsprechende Aufklärung und Einbeziehung in die Therapieentscheidungen ist dafür eine Voraussetzung, während der Begriff Compliance lediglich festhält, dass der Patient die ärztlichen Anweisungen konsequent befolgt. Die modernen Depotantipsychotika, die zur Zeit zur Verfügung stehen, schließen Risperidon LAI (long acting injectable), Olanzapin (LAI), Paliperidonpalmitat (LAI) sowie Aripiprazol (LAI) mit ein. Die Medikamente wirken im Wesentlichen wie die oral verabreichte Medikation, wobei jedoch hervorzuheben ist, dass bei Olanzapin (LAI) die Möglichkeit des Auftretens eines Post-Injektionssyndroms mit Delir und/oder übermäßiger Sedierung gegeben ist und daher die Anwendung vorwiegend auf Institutionen beschränkt ist. Zur näheren Charakteristik der Substanzen ist die Tabelle 1 aus dem ÖGPB-Konsensus beigefügt, aus der ersichtlich ist, dass sowohl Aripiprazol (LAI) als auch Paliperidonpalmitat (LAI) in einem monatlichen Abstand, Olanzapin (LAI) und Risperidon (LAI) in einem 2-wöchigen Abstand verabreicht werden, wobei hervorhebenswert ist, dass Olanzapin (LAI) auch 4-wöchentlich gegeben werden kann. Zusammengenommen stellen die modernen Depotantipsychotika eine wertvolle Alternative zur oralen Medikation in der Behandlung schizophrener Patienten dar und sind auch in der Behandlung bipolarer Erkrankungen ernsthaft zu erwägen, wenn eine regelmäßige Medikamenteneinnahme und Blutspiegel der Medikation schlecht erreicht werden können. Literatur Kasper S, Psota G, Erfurth A, Geretsegger C, Haring C, Hausmann A, Hofer A, Kapfhammer HP, Kastner A, Lehofer M, Marksteiner J, Naderi-Heiden A, Oberlechner H, Praschak-Rieder N, Sachs GM, Stetter R, Walter E. Depot-Antipsychotika/-Neuroleptika. Konsensus-Statement - State of the art 2014. CliniCum neuropsy Sonderausgabe September 2014 Citrome L (2010) Paliperidone palmitate – review of the efficacy safety and cost of a new second – generation depot antipsychotic medication. International Journal of Clinical Practice 2010;64(2):216–239 Tabelle 1 Charakteristika der Depot-Antipsychotika Charakteristika Aripiprazol LAI Olanzapin LAI Paliperidonpalmitat Risperidon LAI Markteinführung 2013 2009 2011 2003 Wirkstoff Aripiprazol Olanzapin 9-OH-Risperidon Risperidon und 9-OH-Risperidon Europäische Indikationen Erhaltungstherapie der Schizophrenie bei Erwachsenen Erhaltungstherapie der Schizophrenie bei Erwachsenen Erhaltungstherapie der Schizophrenie bei Erwachsenen Erhaltungstherapie der Schizophrenie bei Erwachsenen Injektionsfrequenz monatlich zwei- bis vierwöchentlich monatlich zweiwöchentlich Startdosis 400mg 210mg/2 Wochen 300mg/2 Wochen 405mg/4 Wochen 150mg an Tag 1 100mg an Tag 8 Deltoidale Injektion 25mg Erhaltungsdosis 400mg Intramuskulär (gluteal) 150mg/2 Wochen 210mg/2 Wochen 300mg/2 Wochen 300mg/4 Wochen 405mg/4 Wochen 75mg (25–150mg) Deltoidale oder gluteale Injektion 25mg (max. 50mg) Deltoidale oder gluteale Injektion Orale Supplementierung Ja – 14 Tage lang erforderlich Nein Nein Ja – 21 Tage lang Observierung nach der Injektion Ja (drei Stunden) Nein Nein Nein Kasper et al. 2014, ÖGPB-Konsensus 11 Benzodiazepine – Grundprinzipien einer sinnvollen Anwendung Dr. med. Josef Hättenschwiler Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung Zürich (ZADZ) 12 Zusammenfassung Benzodiazepine sind die wichtigsten Substanzen innerhalb der Gruppe der Anxiolytika, also der angstlösenden Medikamente. Da sie neben der anxiolytischen auch sedative Eigenschaften aufweisen, werden sie oft auch als Tranquilizer bezeichnet. Wenn die sedativen Eigenschaften stark ausgeprägt sind, sprechen wir von Benzodiazepin-Hypnotika. Benzodiazepine gehören innerhalb der Medizin weltweit zu den am meisten verschriebenen Medikamenten (1,2). Dazu kontrastiert die Tatsache, dass seit vielen Jahren – obwohl dringend notwendig – kaum mehr Fortbildungen auf diesem Gebiet stattgefunden haben. Benzodiazepine verfügen über angstlösende, beruhigende, schlaffördernde und krampflösende Eigenschaften, was ihre grosse klinische Verbreitung erklärt. Trotz des günstigen Wirkungs-Nebenwirkungsprofils ist es in den letzten Jahren wegen möglicher Missbrauchs- und Abhängigkeitsgefahr zu einer kritischen Auseinandersetzung betreffend ihrer Verordnung gekommen. Die in diesem Beitrag gemachten Ausführungen betreffen weitgehend auch die sogenannten Z-Drugs (sogenannte Nicht-Benzodiazepin-Hypnotika: Zolpidem, Zopiclon, Zaleplon). Trotz chemischer Unterschiede beider Substanzgruppen konnten auf Basis der publizierten Evidenz keine klinisch relevanten Unterschiede bezüglich Wirksamkeit, Nebenwirkungen sowie Missbrauch und Abhängigkeitspotenzial zwischen Z-Drugs und kurzwirksamen Benzodiazepinen gefunden werden (3). Ziel des Vortrages ist es, die wichtigsten Grundsätze einer sinnvollen Benzodiazepinbehandlung darzustellen und dem Kliniker Sicherheit in deren Anwendung zu vermitteln. Hierzu gehören: Wirkungen und Nebenwirkungen von Benzodiazepinen, klare Indikationsstellung, Auswahl des Präparates und geeignete Dosierung, Dauer der Behandlung (so kurz wie möglich), langsames Ausschleichen, frühzeitiges Prüfen von Alternativen. Werden diese Aspekte berücksichtigt, sind Benzodiazepine wirksame und gut verträgliche Medikamente in vielen Akutsituationen. Es muss verhindert werden, dass Patienten allein aus ideologischen Gründen gar nicht oder mit weniger wirksamen, z. T. nebenwirkungsreicheren oder z. T. gar schädlichen Alternativen behandelt werden. Die aktuelle Forschung ist bemüht, spezifischere Therapieoptionen zu entwickeln. Die raschen Fortschritte im Bereiche der Grundlagenforschung, insbesondere die Entdeckung differenzierter Funktionen von Rezeptoruntereinheiten durch die Zürcher Forschungsgruppe um Prof. Möhler, dem Entdecker sowohl des Benzodiazepinrezeptors wie auch des Benzodiazepinrezeptorantagonisten Flumazenil, lässt darauf hoffen, dass in absehbarer Zeit Medikamente mit gezielterem Angriffspunkt und weniger Nebenwirkungen in Anwendung kommen (4). Eine aktuelle, wenn auch sehr kontrovers geführte Debatte betrifft die Frage, ob längere Benzodiazepinbehandlungen bei Älteren das Risiko für das Auftreten von M. Alzheimer erhöht (5). Wirkmechanismen/Wirkungen Benzodiazepine sind Verstärker des wichtigsten inhibitorischen Systems im ZNS, der Gamma-Aminobuttersäure (GABA) und des ionotropen GABAA-Rezeptors. Wenn Benzodiazepine an eine spezifische Stelle des GABAA-Rezeptors angreifen, wird die Bindung von GABA an seinen Rezeptor erleichert, wodurch die GABA-induzierte Hyperpoalarisation der Zellmembran durch den Einstrom von Chlorid-Ionen verstärkt wird. Durch die verstärkte Wirkung von GABA kommt es zu einer gedämpften Aktivität bestimmter ZNSAreale und einer verminderten Antwort auf emotionale und psychische Reize. Für das Verständnis der möglichen Suchtentwicklung bei Benzodiazepinkonsum ist es wichtig zu wissen, dass Benzodiazepin-Rezeptoren modulierend auf die Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens und im ventralen Tegmentum einwirken, was als gemeinsame Endstrecke der meisten Suchtmittel angesehen wird (6,7). Die α1-Untereinheit des GABAA-Rezeptors spielt eine zentrale Rolle für die physiologische Abhängigkeit von Benzodiazepinen (8). Klinisch können wir einerseits zwischen kurz-, mittel- und langwirksamen Benzodiazepinen und ande- rerseits solchen mit oder ohne pharmakologisch aktiven Metaboliten unterscheiden. Benzodiazepine mit langen Halbwertszeiten und aktiven Metaboliten bergen das Risiko einer Akkumulation im Blut, was v.a. bei älteren Patienten zu verstärkten Nebenwirkungen führen kann. Grundlage der weiten klinischen Verbreitung der BDZ ist einerseits das pharmakologische Wirkprofil, charakterisiert durch anxiolytische, sedativ-hypnotische, muskelrelaxierende, antikonvulsive und amnestische Wirkungen und andererseits eine eindeutig positive Nutzen-Risiko-Bilanz: Die Benzodiazepine zeichnen sich durch ihren schnellen und sicheren Wirkungseintritt, ihre grosse therapeutische Breite, ihre gute Verträglichkeit, geringe Toxizität und, verglichen mit anderen Substanzen, auch überschaubaren Arzneimittelinteraktionen aus. Unterschiede zwischen den einzelnen Substanzen sind einerseits v.a. dosisbedingt, andererseits durch ihre Rezeptoraffinität, die Halbwertszeit sowie das Vorhandensein von aktiven Metaboliten bedingt. Das Profil der Substanzgruppe darf allerdings auf keinen Fall dazu verleiten, Benzodiazepine leichtfertig zur Behandlung von Alltagstress oder zur Erleichterung von Frustrationen etc. zu verschreiben. Die Toleranzentwicklung betrifft v.a. die sedierende, muskelrelaxierende und antikonvulsive Wirkkomponente, während sie gegenüber der anxiolytischen Wirkung wenig ausgeprägt ist (3). Indikationen In niedriger Dosierung wirken Benzodiazepine angstlösend, beruhigend und antikonvulsiv, in höheren Dosen schlafanstossend und muskelentspannend, in ganz hohen Dosen amnestisch. Daraus ergeben sich auch die Therapieindikationen. Benzodiazepine eignen sich für alle Situationen, in denen eine Angstlösung erreicht werden muss. Dies kann bei akuten Angstsymptomen der Fall sein, bei Phobien, aber auch bei agitierter Depression. Sie sind zudem sinnvoll bei der Einleitung einer antidepressiven Behandlung, um die Nebenwirkungen vieler moderner Antidepressiva – diese machen die Patienten eher etwas unruhig und schlaflos – zu lindern. Benzodiazepine haben aber auch ihren Stellenwert bei Angst im Rahmen anderer psychischer und somatischer Erkrankungen und, kurzfristig eingesetzt, als Schlafmittel. Daneben kommen sie als Muskelrelaxans, bei epileptischen Anfällen, bei Psychosen, bei akuten mutistischen oder stuporösen Zuständen, Akathisie, tardiven Dyskinesien, zur prä- und perioperativen Sedierung, in der Notfallmedizin und bei akuter Entzugssymptomatik – z.B. bei Alkoholabhängigkeit – zum Einsatz. Unabhängig von der Indikation sollten Benzodiazepine so lange wie nötig und so kurz wie möglich eingesetzt werden (9). Kontraindikationen Zu den Kontraindikationen gehören neben der seltenen, aber oft genannten Myasthenia gravis, schwere Atemprobleme, Schlafapnoe, die Frühschwangerschaft und Stillperiode sowie eine bekannte Abhängigkeitsproblematik. Gerade bei letzterer muss man die Situation individuell abwägen. Hier kann ein kurzfristig eingesetztes Benzodiazepin dazu beitragen, in dieser Zeit die Grundproblematik zu lösen. Bei Lebererkrankungen sollten gewisse Benzodiazepine, vor allem Substanzen, die in aktive Metabolite umgewandelt werden, nicht zum Einsatz kommen. Vorteilhaft sind z.B. Lorazepam, Lormetazepam und Oxazepam, da beide nur einem Phase-II-Metabolismus unterliegen und damit glukuronidiert über die Niere leicht ausgeschieden werden können. Im Alter sind dann auch diese BDZ aufgrund ihrer mittleren Eliminations-HWZ und fehlenden Bildung von aktiven Metaboliten anderen vorzuziehen. Überlegungen zur Verordnung von Benzodiazepinen Die Verordnung von Benzodiazepinen bedarf einer kritisch geprüften Indikation. Ausserdem ist es wichtig, allfällige Therapiealternativen, eine Suchtgefährdung und die voraussichtliche Therapiedauer zu bestimmen. Oft wird vergessen nach früheren Erfahrungen mit BDZ und Parallelbehandlungen zu fragen. Der Patient muss wissen, dass es sich in den meisten Fällen um eine befristete Übergangsmedikation handelt, in der Regel 1 bis 3 Wochen, z.B. bis die Wirkung einer antidepressiven Therapie greift. Des Weiteren soll der Patient über die potenziellen Nebenwirkungen, die oft teil der gewünschten Wirkungen sind, aufgeklärt werden: Tagessedation (Fahr-, Arbeitsfähigkeit), Schläfrigkeit, eingeschränkte Aufmerksamkeit, Gleichgültigkeit, Amnesie (anterograde), Muskelschwäche, Ataxie, Gangstörungen, Stürze (bei älteren Patienten), Atemdepression (i.v.-Applik), Verwirrtheitszustände (bei älteren Patienten), Absetzphänomene, Abhängigkeitspotenzial (9). Die Behandlung sollte mit niedriger Dosis beginnen, dann bis zur niedrigst wirksamen Dosis aufdosiert werden und möglichst nicht über 4–6 Wochen hinaus andauern. Bei Behandlungsdauer über 6 Wochen soll- 13 te ein Psychiater beigezogen werden, um Therapiealternativen zu prüfen (3). Weitere Empfehlungen sind: Verordnung in Form von kleinen Packungsgrössen, keine Repetierrezepte (in der CH sind Verordnungen über 30 Tage nur bei klarer Indikation erlaubt, ansonsten müssen die Rezepte monatlich neu ausgestellt werden). Verordnungen im Sinne von Substitutionsbehandlungen bei schwerer Mehrfachabhängigkeit erfordern in der Schweiz wie auch in Österreich eine amtliche Bewilligung. Eine BDZ-Behandlung erfordert eine engmaschige ärztliche Begleitung, eingebettet in ein Gesamtkonzept mit supportiven, psychotherapeutischen und soziotherapeutischen Massnahmen einschliesslich der regelmässigen Überprüfung der Therapieindikation und Versuchen, das BDZ zu reduzieren respektive auszuschleichen. 14 Missbrauch / Abhängigkeit Die Anwendung von BDZ schliesst die Möglichkeit eines Missbrauchs respektive einer Abhängigkeit mit ein. Das Risiko steigt mit der Dauer der Behandlung und bei hohen Dosen. Unterschieden wird zwischen einer Niedrigdosisabhängigkeit und einer Hochdosisabhängigkeit. Schon früh nach der Einführung der Benzodiazepine ist auf dieses Potential der Abhängigkeitsentwicklung hingewiesen worden. Die Anwendung der ICD-Kriterien auf das Konsummuster von Benzodiazepinen ist allerdings problematisch. So kommt es nur bei einer Minderzahl der Langzeitkonsumenten von Benzodiazepinen zur Dosissteigerung, und die sozialen Folgen einer sog. Niedrigdosisabhängigkeit sind in der Regel gering; dennoch sind beim Absetzen Entzugserscheinungen möglich. Leider sind solche Entwicklungen zu einem hohen Anteil iatrogen verursacht. Nach etwa 4-monatiger Einnahme von therapeutischen BDZ-Dosen muss nach abruptem Absetzen mit Absetzphänomenen gerechnet werden. Wir unterscheiden Absetzphänomene, die an die Grunderkrankung gebunden sind (Rebound-, Rezidivsymptome) und solche, die nicht an die Grunderkrankung gebunden sind („echte“ Entzugssymptome; waren vor der Behandlung nicht vorhanden). So sehr das Missbrauchs-/Abhängigkeitspotenzial Realität ist, so sehr wird das Risiko oft überschätzt. Dazu gehört auch die häufige, in den Medien geäusserte Kritik, dass Ärzte Benzodiazepine kritiklos verschreiben würden. Dies ist nach heutigem Wissensstand nicht korrekt: Eine 2007 in der Schweiz durchgeführte Erhebung mit 520.000 Patienten hat gezeigt, dass die Verschreibung von Benzodiazepinen bei den meisten Patienten angemessen war, in therapeutischen Dosen und gemäss der geltenden Richtlinien erfolgte (10). Absetzen von Benzodiazepinen / Entzugsbehandlung Die beste Voraussetzung für das Ausschleichen der BDZ besteht dann, wenn die Grunderkrankung, die deren Verordnung notwendig gemacht hat (z.B. Depression, Angsterkrankung, Insomnie) durch eine spezifische Therapie in Form von Psychotherapie und/oder Pharmakotherapie, schon ausreichend gebessert ist. Auch nach kurzer BDZ-Behandlung ist ein langsames Ausschleichen über 2–4 Wochen sinnvoll. Bei Abhängigkeit hat die Dosisreduktion über Wochen, manchmal Monate zu erfolgen. Die ersten 50% der Gesamtdosis können relativ schnell reduziert werden, gefolgt von einem Intervall, das sicherstellt, dass keine Entzugserscheinungen auftreten. Die nächsten 25% sollen deutlich langsamer und die letzten 25% sehr langsam abgebaut werden. Die unterschiedliche Halbwertszeit von BDZ ist beim Absetzvorgang zu berücksichtigen. Erforderlich ist eine engmaschige Betreuung, um Entzugssymptome frühzeitig zu identifizieren und den Abbauprozess zu verlangsamen. Nach jedem Reduktonsschritt soll die Dosis mindestens eine Woche beibehalten werden (3). In der Praxis wird oft auf BDZ mit langer Halbwertszeit umgestellt, um den Entzugsprozess zu vereinfachen. Gesicherte empirische Erkenntnisse liegen dafür aber nicht vor. Erfahrene Autoren (11) empfehlen in komplexen Fällen eine Umstellung auf das langwirksame Diazepam, das wegen Verfügbarkeit in Tropfenform, besonders unkompliziert dosiert und ausgeschlichen werden kann. Alternativen zu Benzodiazepinen Das hängt von der vorherrschenden Symptomatik ab. In erster Linie sind hier Entspannungsverfahren zu nennen, Psychotherapie, Phytotherapie, Nicht-Benzodiazepin-Hypnotika wie Zolpidem, Betablocker, Antidepressiva oder, z.B. bei generalisierter Angst, das Antikonvulsivum Pregabalin. Im Rahmen eines Benzodiazepinentzugs werden verschiedene Optionen diskutiert, um den Verlauf zu verkürzen respektive die Erfolgsrate zu erhöhen. Es sind dies einerseits (sedierende) Antidepressiva wie z.B. Imipramin, Doxepin, Mirtazapin, Trazodon, andererseits Antikonvulsiva wie Carbamazepin (heute eher obsolet), Oxcarbazepin, Gabapentin, Valproat. Ein neuerer, erfolgsversprechender Ansatz zur Entzugsunterstützung ist Pregabalin, das aber selbst auch ein gewisses Suchtpotenzial aufzuweisen scheint (3, 12). Hinweis: Ein PDF der Präsentation ist über die Webseite des Zentrums für Angst- und Depressionsbehandlung Zürich abrufbar: http://zadz.ch/vortrage-und-handouts/ Literatur 1) Olfson M et al. Benzodiazepine use in the United States. JAMA Psychiatry 2014 Dec 17 [Epub ahead of print] 2) Donoghue J & Lader M. Usage of benzodiazepines: A review. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, June 2010 3) Benkert O & Hippius H. Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie. 10. Auflage 2015. Springer Verlag 4) Möhler H, Crestan F, Rudolph U. GABAA-rezeptor subtypes: a new pharmacology. Curr Opin Pharmacol 2001;1:22-25 5) Billioti de Gage S, et al. Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study. BMJ 2014; 349 : g5205 6) Tan KR., Brown M, Labouèbe G., Yvon C, Creton C, Fritschy JM, Rudolph U, and Luescher C. Neural bases for addictive properties of benzodiazepines. Nature 2010;463,769-774 7) Soyka M, Batra A. Benzodiazepinabhängigkeit. In: Therapie psychischer Störungen. State of the art. DGPPN. 10. Auflage 2015, Elsevier GmbH, München 8) Fischer BD, Teixeira LP, et al. Role of gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor subtypes in acute benzodiazepine physical dependence-like effects: evidence from squirrel monkeys responding under a schedule of food presentation Psychopharmacology (Berl) 2013;227(2):347354 9) Laux G & Dietmaier O. praktische Psychopharmakotherapie. 6. Auflage 2012, Elsevier GmbH München 10) Petitjean S, Ladewig D, et al. Benzodiazepine prescribing to the Swiss adult population: results from a national survey of community pharmacies. Int Clin Psychopharmacol 2007;22:292-298 11) Lader M, Tylee A, Donoghue J. Withdrawing benzodiazepines in primary care. CNS Drugs 2009;23:19-34 12) Bobes J et al. Pregabalin for the discontinuation of long-term benzodiazepines use: an assessment of its effectiveness in daily clinical practice. Eur Psychiatry 2012;27(4):301-307 Doble A, Martin IL & Nutt D. Calming the brain. Benzodiazepines and related drugs from laboratory to clinic. Martin Dunitz 2004, London 15 Therapieresistenz bei Depression O.Univ.Prof. Dr.h.c.mult. Dr. Siegfried Kasper Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, AKH Der Großteil der mit Antidepressiva behandelten Patienten spricht auf die Antidepressiva-Gabe sehr günstig an, sodass sich daraus auch die weite Verbreitung der Antidepressiva ableiten lässt. Prinzipiell sollten folgende Begriffe auseinandergehalten werden: 1. Ungenügendes Ansprechen: Patienten, die auf erste Therapie, die in ausreichender Dosierung in ausreichender Dauer gegeben wird, ungenügend ansprechen. 2. Therapieresistenz: Patienten sprechen auf zwei konsekutiv verabreichte Medikamente, die in ausreichender Dosierung in ausreichender Dauer gegeben werden, nicht an. 3. Therapierefraktäre Depression: Patienten sprechen auf mehrere unterschiedliche Therapieoptionen, einschließlich Elektrokonvulsionstherapie, nicht an. 4. Chronische Depression: Patienten sind trotz adäquater Therapienter-Iventionen seit mindestens zwei Jahren depressiv verstimmt. 16 Für das inadäquate Ansprechen ist in Europa lediglich das Antipsychotikum Quetiapin XR als additive Therapie von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen, während eine Zulassung in den USA auch für das Medikament Aripiprazol vorliegt. In der Praxis haben sich die beiden letztgenannten Medikamente als günstig erwiesen, wobei die EMA für Aripiprazol und Olanzapin die Zulassung als Zusatztherapie zu Antidepressiva nicht erteilt hat, weil zum Zulassungszeitpunkt die notwendigen Langzeitstudien nicht vorlagen. Da nun all diese letztgenannten Medikamente bereits als Generika erhältlich sind und GenerikaFirmen und auch Universitätskliniken derartige Studien aufgrund der damit verbundenen Mittel nicht durchführen werden, wird auch in Zukunft eine Indikationserteilung für diese Medikamente nicht zu erwarten sein. Zur Behandlung der therapieresistenten Depression liegen verschiedene Guidelines in Europa und den USA vor, die in dem von der Österreichischen Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie (ÖGPB) herausgegebenen Konsensus-Dokument zusammengefasst sind (siehe Tabelle 1). Die Abbildung 1 aus dem ÖGPB-Konsensus zeigt einen Therapie-Algorithmus bei der Depression, wie sie von den Guidelines der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) vorgeschlagen werden, wobei dabei festgehalten wird, dass die Psychotherapie zu egal welchem Zeitpunkt der Therapie angewandt werden kann und dass die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) ebenso keinem festgesetzten Rhythmus unterworfen ist, in dem Sinne, dass lediglich schwerstkranke Patienten diese Therapie erhalten. Dies ist insofern auch von Bedeutung, da bei Patienten mit großem Erfolg eine Erhaltungs-EKT durchgeführt wird. Zu den Termini Kombination bzw. Augmentationstherapie sei festgehalten, dass diese Strategien in den USA einfach als „Add-on“-Medikation bezeichnet wird, da die Augmentationstherapie auch Medikamente einschließt, die selbst keine antidepressive Wirkung aufweisen (z.B. Lithium und Quetiapin). Literatur Bauer M, Severus E, Köhler S, Whybrow PC, Angst J, Möller HJ on behalf of the WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Unipolar Depressive Disorders (Adli M, Anderson I, Ayuso-Gutierrez JL, Baldwin D, Bauer M, Bech P, Berk M, Bitter I, Bschor T, Burrows G, Cassano G, Cetkovich-Bakmas M, Cookson JC, da Costa D, Gheorghe MD, Grunze H, Hasler G, Heinze G, Higuchi T, Hirschfeld RMA, Höschl C, Holsboer-Trachsler E, Kang RH, Kasper S, Katona C, Keller MB, Kirli S, Köhler S, Kostukova E, Kulhara P, Kupfer DJ, Lee MS, Leonard B, Licht RW, Lim SW, Lingjaerde O, Liu CY, Lublin H, Mendlewicz J, Mitchell P, Möller HJ, Paik JW, Park YC, Paykel ES, Pfennig A, Puzynski S, Rush AJ, Rybakowski JK, Tadic A, Tylee A, Unützer J, Vestergaard P, Vieta E, Whybrow PC, Yamada K, Yazici A; World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for biological treatment of unipolar depressive disorders. Part 2: Maintenance treatment of major depressive disorder - update 2015. World Journal of Biological Psychiatry 2015;16(2):76-95 Kasper S, Bach M, Hausmann A, Hofmann P, Konstantinidis A, Lentner S, Psota G, Rainer M, Schosser-Haupt A, Spindelegger C, Wrobel M, Frey R, Geretsegger C, Haring C, Jelem H, Kapfhammer HP, Claudia Klier, Marksteiner J, Oberlerchner H, Praschak-Rieder N, Rados C, Windhager E, Winkler D. Therapieresistente Depression. Klinik und Behandlungsoptionen. Konsensus-Statement - State of the art 2011. CliniCum neuropsy Sonderausgabe November 2011 Tabelle 1 Die Behandlung nach Algorithmen in wichtigen Guidelines in Europa und den USA Organisation URL Publikation Zielgruppe Erkrankung American Psychiatric Association (APA) http://www.psychiatryonline. com/pracGuide/pracguide Topic_7.aspx 2000; tw. Update 2005; revision 2010 Psychiater Depression Dysthymie Saisonale Depression British Association for Psychopharmacology (BAP) http://www.bap.org.uk/ docsbycategory. php?docCatID=2 2008 Psychiater, Ärzte für Allgemeinmedizin Depression Subklinische Depression Canadian Network for Moodand Anxiety Treatments (CANMAT) http://www.bap.org.uk/ docsbycategory. php?docCatID=2 2009 Psychiater Depression National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) http://guidance.nice.org.uk/ CG90 2009 Psychiater, Ärzte für Allgemeinmedizin Depression Dysthymie Leichte Depression Texas Medication Algorithm Project (TMAP) http://www.dshs.state.tx. us/mhprograms/TIMA.shtm 2008 Psychiater, Ärzte für Allgemeinmedizin Depression World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) http://www.wfsbp.org/ treatment-guidelines/unipo lar-depressive-disorder.html 2002 Primary Care Version 2007 Psychiater, Ärzte für Allgemeinmedizin Depression Dysthymie • Clinical Practice Recommendations for Depression (2009) (Malhi et al. Acta Psychiatr Scand 2009) • Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) Healthcare Guideline for Major Depression in Adults in Primary Care (Institute for Clinical System Improvement 2010) • S3 Guidelines (Deutschland 2009) Kasper et al., 2011, ÖGPB-Konsensus Abbildung 1 Therapie-Algorithmus bei Depression: WFSBP-Guidelines Partielles Ansprechen oder Non-Response nach zwei bis vier Wochen Therapie mit einem Antidepressivum (AD) Optimierung der Dosis (Dosiserhöhung) Kombination zweier AD aus unterschiedlichen Klassen Augmentationsstrategien Erwäge Psychotherapie zu egal welchem Zeitpunkt der Therapie Wechsel zu einem neuen AD derselben oder einer anderen Klasse Erwäge EKT zu egal welchem Zeitpunkt der Therapie Kasper et al., 2011, ÖGPB-Konsensus 17 Vortioxetin beim älteren Patienten Prim. Univ.Prof. Dr. Josef Marksteiner Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie A, LKH Hall in Tirol Die Depression gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter. Die Prävalenz der Major Depression bei Personen jenseits des 65. Lebensjahres liegt bei bis zu neun Prozent, für subsyndromale Ausprägungen bei 27 Prozent. Für diese hohe Prävalenz sind neben altersassoziierten psychosozialen und neurobiologischen Faktoren auch die im fortgeschrittenen Lebensalter hohen Raten an somatischen Komorbiditäten (z.B. vaskuläre Erkrankungen, Diabetes oder Arthritis) verantwortlich. Die Häufigkeit der Depression ist bei multimorbiden älteren Personen erhöht; bei älteren Heimbewohnern finden sich Prävalenzen bis zu 40 Prozent. Individualisierte Therapiekonzepte bei der Altersdepression beinhalten psychotherapeutische Interventionen, deren Stellenwert im Alter nach wie vor unterschätzt wird, sowie pharmakologische Strategien. Vortioxetin Im Dezember 2013 erteilte die Europäische Kommission die Zulassung für das Antidepressivum Vortioxetin zur Behandlung der Major Depression. Vortioxetin ist unter dem Handelsnamen Brintellix® (Lundbeck) in 5, 10, 15 und 20 mg Tabletten erhältlich. Die Zulassung basiert auf Daten aus 12 RCT (einschließlich einer RCT bei älteren Patienten > 65 Jahren (Katona et al., 2012), von denen bei 9 RCT Vortioxetin (in mindestens einer der untersuchten Dosierungen) Placebo signifikant überlegen war. Pharmakodynamik und Pharmakokinetik 18 Zusätzlich zu einer Serotonin-(5-HT-)Wiederaufnahmehemmung zeigt Vortioxetin einen Agonismus an 5-HT1A-Rezeptoren, einen partiellen Agonismus an 5-HT1B-Rezeptoren sowie einen Antagonismus an 5-HT3-, 5-HT7- und 5-HT1D-Rezeptoren (Pehrsen et al., 2013). Vortioxetin wird nach oraler Gabe langsam und gut resorbiert, maximale Plasmakonzentrationen werden nach 7–11 Stunden erreicht. Vortioxetin braucht nicht nüchtern eingenommen werden, da Nahrung keinen Einfluss auf die Pharmakokinetik hat. Vortioxetin wird extensiv über die Leber unter Beteiligung des Cytochrom P450-Systems metabolisiert, insbesondere von CYP2D6, in geringerem Ausmaß von CYP3A4/5 und CYP2C9. Der Hauptmetabolit von Vortioxetin ist pharmakologisch inaktiv. Die Eliminationshalbwertszeit liegt im Mittel bei 66 Stunden, Steady-State-Plasmakonzentrationen werden nach 2 Wochen erreicht. Therapie mit Vortioxetin Bei der Wahl der Pharmakotherapie sollten differenzielle Aspekte von Wirksamkeit und Verträglichkeit der einzelnen Substanzen berücksichtigt werden. Die Anfangs- und empfohlene Erhaltungsdosis von Vortioxetin bei Erwachsenen unter 65 Jahren beträgt 10 mg/Tag einmal täglich. Abhängig vom Ansprechen des Patienten kann die Dosis auf 20 mg Vortioxetin einmal täglich (Tageshöchstdosis) erhöht werden. Für ältere Patienten ab 65 Jahren werden eine Anfangsdosis von 5 mg/Tag und eine Erhaltungsdosis von maximal 10 mg/Tag empfohlen, Dosierungen über 10 mg/Tag führten bei Patienten > 65 Jahren zu einer erhöhten Studien-Abbruchrate (Mahableshwarkar et al., 2014). Eine Dosisanpassung bei leichten oder mittelschweren Leberfunktionsstörungen oder Nierenfunktionsstörungen ist nicht erforderlich, bei Komedikation mit CYP2D6-Inhibitoren oder -Induktoren kann eine Dosisanpassung erforderlich sein. Nebenwirkungen Die Häufigkeit und Schwere von Nebenwirkungen ist ein wesentliches Kriterium in der Auswahl eines Antidepressivums. Vortioxetin zeigt insgesamt ein günstiges Nebenwirkungsprofil (geringe Rate an sexuellen Funktionsstörungen, keine kardialen Nebenwirkungen, keine Veränderungen der Herzfrequenz oder des Blutdrucks, keine Verlängerung des QTc-Intervalls, keine Gewichtszunahme, keine Absetzeffekte (Mahableshwarkar et al., 2014). Für den älteren Patienten besonders wichtig zeigten sich keine Veränderungen der Herzfrequenz oder des Blutdrucks, auch fanden sich keine signifikanten Wirkungen auf EKG-Parameter wie z.B. das QTc-Intervall. Die häufigste Nebenwirkung war Übelkeit, daneben werden als häufige Nebenwirkungen Erbrechen, Obstipation, Diarrhoe, Appetitminderung, Schwindelgefühl, abnorme Träume und generalisierter Pruritus angegeben (Mahableshwarkar et al., 2014). Zusammenfassung Mit Vortioxetin liegt ein neues Antidepressivum vor, das zusätzlich zu einer Serotoninwiederaufnahmehemmung auch weitere Rezeptorwirkungen aufweist. Vortioxetin scheint für den älteren Patienten sehr gut geeignet zu sein. Ob sich Vorteile oder Nachteile gegenüber SSRI oder anderen Antidepressiva ergeben, wird sich in weiteren klinischen Studien zeigen. Literatur Alvarez E, Perez V, Dragheim M, Loft H, Artigas F. A double-blind, randomized, placebo-controlled, active reference study of Lu AA21004 in patients with major depressive disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2012;15(5):589-600 Baldwin DS, Hansen T, Florea I. Vortioxetine (Lu AA21004) in the long-term open-label treatment of major depressive disorder. Curr Med Res Opin 2012;28(10):1717-24 Boulenger JP, Loft H, Florea I. A randomized clinical study of Lu AA21004 in the prevention of relapse in patients with major depressive disorder. J Psychopharmacol 2012;26(11):1408-16 [EMA] http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002717/WC500159447.pdf Henigsberg N, Mahableshwarkar AR, Jacobsen P, Chen Y, Thase ME. A randomized, double-blind, placebo-controlled 8-week trial of the efficacy and tolerability of multiple doses of Lu AA21004 in adults with major depressive disorder. J Clin Psychiatry. 2012 Jul;73(7):953-9. Katona C, Hansen T, Olsen CK. A randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced, fixed-dose study comparing the efficacy and safety of Lu AA21004 in elderly patients with major depressive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2012;27(4):215-23 Pehrson AL, Cremers T, Bétry C, van der Hart MG, Jørgensen L, Madsen M, Haddjeri N, Ebert B, Sanchez C. Lu AA21004, a novel multimodal antidepressant, produces regionally selective increases of multiple neurotransmitters–a rat microdialysis and electrophysiology study. Eur Neuropsychopharmacol 2013;23(2):133-45 Rothschild AJ, Mahableshwarkar AR, Jacobsen P, Yan M, Sheehan DV. Vortioxetine (Lu AA21004) 5 mg in generalized anxiety disorder: results of an 8-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial in the United States. Eur Neuropsychopharmacol 2012;22(12):858-66 19 Personalisierte Antidepressivatherapie in der klinischen Praxis – State of the Art Prof. Dr. med. Erich Seifritz Direktor, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Die klassische Definition der personalisierten Behandlung in der Medizin bezieht sich auf polymorphe und andere genetische Besonderheiten, die eine treffsichere Voraussage des Erfolgs einer bestimmten Therapie bei einem bestimmten Patienten erlauben. Dieses Paradigma hat sich bei wenigen Erkrankungen sehr erfolgreich durchgesetzt, etwa bei der Behandlung von bestimmten Tumorformen. Bei psychischen Störungen, ähnlich wie bei vielen anderen Erkrankungen, ist der Zusammenhang zwischen Genotyp und Phänotyp bzw. zwischen genetischer Prädisposition und pharmakodynamischen Faktoren wesentlich weniger klar. Abgesehen von wenigen pharmakogenetischen erfolgversprechenden Befunden wurde aus diesem Grund in der Psychiatrie das Augenmerkt auf Endophänotypen gelegt, die eine Zwischenstellung zwischen Geno- und klinischem Phänotyp einnehmen und als Biomarker pathophysiologische Prozesse abbilden. Hier spielen Befunde mit Bildgebung, Elektrophysiologie, Endokrinologie, Neuropsychologie etc., aber auch klinische Parameter bei der Individualisierung der Therapie eine wichtige Rolle. Das von der NIMH lancierte aktuelle Programm, Research Domain Criteria RDoC, hat entsprechend dieser Idee das Ziel, das Prinzip von syndromalen Störungsdomänen anstelle von diagnostischen Kriterien für die individualisierte Therapieplanung zu verwenden. Im Referat wird eine Übersicht zu aktuellen klinischen Studien sowie eine Würdigung der klinisch praktischen Bedeutung gegeben. 20 Sexuelle Funktionsstörungen beim depressiven Patienten Prim. Univ.Prof. Dr. Martin Aigner Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsklinikum Tulln, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften Die Prävalenz von sexuellen Dysfunktionen in der Allgemeinbevölkerung beträgt nach Laumann et al. (1999) etwa 43 % für Frauen und 31 % für Männer. „Sexuelles Versagen“ entsteht oft in einem Teufelskreis von überzogenen Erwartungen, Erwartungsängsten, Vermeidung, Misstrauen, Vorwürfen, Grübeln, was wiederum Erwartungsängste steigert und oft in Zusammenhang mit Depressionen zu bringen ist. Sexuelle Funktionsstörungen (SF) sind bei depressiven PatientInnen etwa doppelt so häufig wie in der Allgemeinbevölkerung. Etwa 70 % der depressiver PatientInnen leiden an SF (Werneke et al., 2006). SF werden aber oft in Erstgesprächen nicht angesprochen, zum einen ist der Bereich Sexualität für viele noch immer schwierig zu besprechen, zum anderen werden sexuelle Funktionsstörungen oft unterschätzt bzw. vergessen, da eine Fülle von Symptomen gerade bei PatientInnen mit Depressionen die Sicht auf sexuelle Funktionsstörungen verstellen kann. Ein Libidoverlust ist jedoch nicht selten ein Symptom einer Depression. Es gibt zudem PatientInnen, bei denen es erst sekundär zu SF kommt. Für die Therapie depressiver Störungen ist es daher besonders wichtig, das Thema Sexualität in das Erstgespräch mit einzubeziehen. Spontan berichten nur etwa 15 % der PatientInnen über ihre SF, bei direktem Ansprechen geben beinahe viermal so viele PatientInnen SF an. Im DSM-5 (2014) wurden die sexuellen Funktionsstörungen neu definiert, dabei wurde besonderes Augenmerk auf „Substanzinduzierte Sexuelle Funktionsstörungen“ gelegt und eine neue Diagnose definiert: Substanz-/Medikamenteninduzierte sexuelle Funktionsstörung (Alkohol, Opioid, Sedativum, Anxiolytikum, Hypnotikum, Amphetamin/Stimulans, andere Substanz). Der Erste Schritt in der Diagnostik ist wie bei den meisten Störungen/Krankheiten die Anamnese: Wichtig ist es, Informationen zum Sexualpartner zu erheben: z.B. sexuelle Probleme des Partners, Gesundheitszustand des Partners, die Beziehung (schlechte Kommunikation, Diskrepanz im Verlangen sexueller Aktivität). Gibt es individuelle Vulnerabilitätsfaktoren (z.B. negatives Körperbild, sexuellen oder emotionellen Missbrauch in der Vergangenheit), psychische Komorbidität (z.B. Depression, Angststörungen) oder Stressoren (Arbeitsplatzverlust, Trauer). Auch kulturelle oder religiöse Einflüsse auf die Sexualität müssen unbedingt erfasst werden, da sie das Sexualverhalten entscheidend mit beeinflussen können. Schließlich dürfen Medizinische Faktoren und Substanz- bzw. Medikamenteneinnahme (Diabetes mellitus, Alkohol,…) nicht vergessen werden. Die Gründe für eine gestörte Sexualfunktion sind meist multifaktoriell! Wichtig ist es, den Bereich der Sexualität schon im Erstgespräch abzudecken, z.B. die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexualleben?“ ermöglicht, sexuelle Funktionsstörungen bereits früh zu erfassen und in das therapeutische Konzept mit einzubeziehen. Eine breite Palette von Substanzen (Alkohol, Nikotin,...) und Medikamenten (Amphetamine/Stimulantien/Antiparkinsonmittel, Antidepressiva, Antiepileptika, Antipsychotika, Kortikoide, NSAR/NSAID, Opioide, Sedativa, Anxiolytika, Hypnotika) werden in Zusammenhang mit sexuellen Funktionsstörungen gesehen. Ebenso breit ist die Palette der verschiedenen Pathomechanismen (z.B. Beeinflussung der Libido, Potenz, Orgasmusfähigkeit). SF können durch eine Reihe von psychopharmakologischen Mechanismen verursacht werden. In einem Literaturüberblick (Lee et al., 2010) werden die unterschiedlichen Raten von SF präsentiert. In einer MetaAnalyse (Serretti und Chiesa, 2011) wurde hinsichtlich einer generellen SF, einer gestörten Libido, einer gestörten Erregungsfähigkeit und einer Orgasmusstörung ausgewertet. Die Odds Ratios der SF können dabei in ein Ampelsystem gebracht werden, um die Fülle der Daten klinisch verwendbar zu machen. Unter den Antidepressiva sind des vor allem die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), die in Zusammenhang mit sexuellen Funktionsstörungen gebracht werden (Werneke et al., 2006). Durch spezifische Blockade von Serotoninrezeptoren (z.B.: 5-HT2-Rezeptor) können diese Nebenwirkungen abgemildert werden. Ebenso kann die Umstellung auf Antidepressiva mit noradrenergen Wirkungen eine Besserung der SF bringen. Auch Antiepileptika und Antipsychotika, die bei PatientInnen mit Depressionen ebenfalls zum Einsatz 21 kommen können, sind mit erhöhten Raten an SF verbunden. Zu einer guten Lebensqualität gehört eben ein erfülltes Sexualleben. Die psychiatrische Begutachtung unter Einschluss des Sexuallebens gewinnt in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung. Therapie-Strategien bei Medikamenten-induzierter sexueller Funktionsstörung umfassen eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, angefangen vom Umstellen der Medikation, von Dosisanpassungen, Kombinationen von entsprechenden Medikamenten. Die „primären“ sexuellen Funktionsstörungen erfordern eine klare Abklärung und je nach Ursache eine spezialisierte Therapie. Literatur Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United states: Prevalence and predictors. JAMA 1999;281:537-44 Lee KU, Lee YM, Nam JM, Lee HK, Kweon YS, Lee CT, Jun TY. Antidepressant-Induced Sexual Dysfunction among Newer Antidepressants in a Naturalistic Setting. Psychiatry Investig 2010;7:55-9 Serretti A and Chiesa A. Sexual Side Effects of Pharmacological Treatment of Psychiatric Diseases. Clinical pharmacology & Therapeutics 2011;89:142-147 Werneke U, Northey S, Bhugra D. Antidepressants and sexual dysfunction. Acta Psychiatr Scand 2006;114:384-97 22 Internistisch relevante Erkrankungen unter Psychopharmakotherapie OA Dr. Martin Letmaier Verhaltenstherapeutische Station 1A, Universitätsklinik für Psychiatrie Graz Zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen liegt mittlerweile eine Fülle von medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten vor. Neben der erkrankungsbezogenen Wirkung einzelner Präparate treten unter Behandlung von Psychopharmaka immer wieder internistisch relevante Nebenwirkungen auf. Im Rahmen von Pharmakovigilanz-Programmen wie beispielsweise dem Institut für Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie (AMSP), dem auch die Österreichische Gesellschaft für Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie (ÖAMSP) zugehörig ist, werden kontinuierlich schwere, internistisch relevante Arzneimittelnebenwirkungen dokumentiert, systematisiert und evaluiert (1). Anhand von Stichtagsdaten besteht die Möglichkeit, Inzidenz- und Risikoberechnungen durchführen zu können. Aufgrund der Fülle unterschiedlicher internistisch relevanter Nebenwirkungen von Psychopharmaka kann im Rahmen des Vortrags nur auf vereinzelte Nebenwirkungen wie beispielsweise die Hyponatriämie (2) oder das erhöhte Blutungsrisiko (3) unter Antidepressiva bzw. das Auftreten von thromboembolischen Ereignissen unter Therapie mit Antipsychotika (4) eingegangen werden. Ergänzend seien auch noch die Polypharmazie und die dadurch bedingten Interaktionsstörungen im Zusammenhang mit dem Auftreten von internistisch relevanten Nebenwirkungen erwähnt. Hier ist vor allem die besondere Berücksichtigung der Cytochrom-Systeme (Phase I) beziehungsweise der Phase II-Biotransformation zu nennen (5). Besonders relevant wird von internistischer Seite die Beurteilung nach Interaktionsproblemen im Rahmen von schwerwiegenden körperlichen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs erachtet. Der Vortrag soll einen Überblick über durch Psychopharmakotherapie bedingte Nebenwirkungen wie Hyponatriämie, erhöhtes Blutungsrisiko beziehungsweise thromboembolische Ereignisse geben. Zusätzlich wird fallbezogen auf Interaktionsprobleme einzelner Substanzen und daraus resultierende Nebenwirkungen hingewiesen. Literatur (1) Grohmann et al. The AMSP drug safety program: methods and global results. Pharmacopsychiatry 2004, 37(Suppl. 1):S4-S11 (2) Letmaier et al. Hyponatraemia during psychopharmacological treatment: re-sults of a drug surveillance programme. Int J Neuropsychopharmacol. 2012;15(6):739-748 (3) Wang et al. Short-term use of serotonin reuptake inhibitors and risk of upper gastrointestinal bleeding. Am J Psychiatry 2014;171(1):54-61 (4) Letmaier et al. Venous thromboembolism during treatment with antipsychotics - results of a drug surveillance program. 2015; submitted (5) Kaufman et al. Lamotrigine toxicity secondary to sertraline. Seizure 1998,;7(2):163-5 23 Elektrokonvulsionstherapie, klinische Durchführung und biologische Veränderungen Univ. Prof. Dr. med. Richard Frey Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien Einleitung Elektrokonvulsionstherapie (Elektrokrampftherapie, EKT) ist die Auslösung eines generalisierten epileptischen Krampfanfalls durch frontotemporale elektrische Stimulation zur Therapie von schweren psychiatrischen Erkrankungen. Die Wirkung der EKT ist insbesondere bei affektiven Störungen unbestritten (Conca et al., 2004; Frey et al., 2001). Um die Arbeit besser lesbar zu machen, wird auf Gender-gerechte Formulierungen verzichtet, – selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gleichermaßen gemeint. 24 Indikationen zur EKT International am häufigsten ist die Anwendung bei therapieresistenten Depressionen, wenn verbale Interventionen und Psychopharmaka ineffizient geblieben sind, insofern als 2. Wahl. Indikationen 1. Wahl • schwere uni- oder bipolare depressive Episode mit vitaler Gefährdung • hyper- oder hypokinetische Katatonie mit vitaler Gefährdung, perniziöse Katatonie Indikationen 2. Wahl • therapieresistente Depression • therapieresistente Schizophrenie (insb. bei Katatonie) • therapieresistente schizoaffektive Störungen • therapieresistente Manie mit psychotischer Symptomatik • malignes neuroleptisches Syndrom Wissenschaftlich sehr gut begründet ist die Wirksamkeit bei schweren depressiven Episoden und bei therapieresistenten Depressionen. Die Wirksamkeit der EKT bei den anderen Indikationen ist weniger gut belegt (schwierige ethische Voraussetzungen, weil Patienten häufig nicht reversfähig sind), aber klinisch anerkannt. Die Wirksamkeit der EKT wird belegt durch: • Fallberichte • EKT im Vergleich zu Antidepressiva wirkungsvoller • EKT wirkungsvoller als Schein-EKT (nur Narkose) • Bilaterale (BL) EKT effektiver als unilaterale (UL) • UL hochdosiert effektiver als UL niedrigdosiert Eine besonders hohe EKT-Responserate von 75–95% wird bei depressiven Patienten ohne Psychopharmakaresistenz bzw. bei Durchführung in 1. Wahl beschrieben. Bei Therapieresistenz bietet EKT immerhin noch eine Responserate von 50%–60% (Prudic et al., 1996). Weitere Prädiktoren für eine besonders gute Wirksamkeit bei Depression sind eine kurze Dauer der akuten Phase, ein episodischer Verlauf und eine psychomotorische Hemmung oder Agitation. Narkose zur EKT Die Durchführung der EKT erfordert eine Zusammenarbeit mit einer Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Die Narkose zur EKT ermöglicht die Muskelrelaxation mit Succinylcholin (Lysthenon), sodass kein tonisch-klonisches Krampfen auftritt und Verletzungen vermieden werden. Während der Narkose erfolgt eine assistierte Beatmung mittels Gesichtsmaske und Sauerstoff-Insufflation. Folgende Narkotika und Dosierungen werden international zur EKT favorisiert: • Methohexital (Brevital) 50–120mg • Thiopental 5mg/kg KG • Propofol (Diprivan) 50–120mg • S-Ketamin (KetanestS) ̴100mg Die Narkotika wirken antikonvulsiv und schwächen daher die EKT-Wirkung ab („mitigierte EKT“). Die Ketamin-Narkose zur EKT (Hoyer et al., 2013, aus der Arbeitsgruppe von A. Sartorius) ist eine wertvolle Alternative, weil Ketamin als einziges Narkotikum keine Erhöhung der Krampfschwelle nach sich zieht. Es ist aber auch insofern die Ausnahme, als es den Sympathikotonus erhöht und dadurch bei arterieller Hypertonie, Herzerkrankung oder auch hohem Alter problematisch ist. Kontraindikationen, Risiken Es gibt keine absoluten Kontraindikationen für EKT. Sie kann auch bei Herzschrittmacher, Epilepsie und komorbidem Organischem Psychosyndrom (OPS) durchgeführt werden. Bei schwerer Depression und Psychose im hohen Alter oder bei Gravidität ist die EKT eine Option. Wegen des intra- und postiktalen Blutdruck- und Frequenzanstiegs kann es zu kardialen Komplikationen kommen. Personen mit einer arteriellen Hypertonie, koronarer Herzerkrankung oder Herzrhythmusstörung sollten daher vor der geplanten EKT eine kardiologische Stellungnahme bzw. Optimierung erfahren. Transiente Kopfschmerzen oder Übelkeit sind an EKT-Tagen nicht selten. Bei der Behandlung von Depressionen kommt selten ein Kippen in die Manie vor. Bei bipolaren Patienten können die Lithium- und Antikonvulsiva-Dosierungen in möglichst niedrigen therapeutischen Dosierungen (Plasmaspiegel) belassen werden. Gedächtnisstörungen Unmittelbar nach dem Anfallsgeschehen sind die Patienten in der Aufwachphase verwirrt, die Reorientierung ereignet sich in der Regel innerhalb von 10–30 Minuten. Während der etwa 3 bis 4-wöchigen EKT-Serie kommt es bei bis zu 50% der PatientInnen im Laufe der Behandlungsserie zu kumulativen antero- und (seltener) retrograden mnestischen Störungen, deren Inzidenz und Intensität bei bilateraler Applikation höher ist (Sackeim et al., 1993). Die EKT-verursachten Gedächtnisstörungen sind schwer einzuschätzen, weil zum Ausgangszeitpunkt (Baseline) das Leistungsvermögen krankheitsbedingt eingeschränkt und schwer zu testen ist. In einer Metanalyse über 84 Studien (2981 Patienten) haben Semkovska & McLoughlin (2010) bei Patienten mit Depression EKT-assoziierte kognitive Störungen für drei Zeiträume jeweils im Vergleich zur Baseline untersucht: 0–3 Tage nach EKT-Serie, 4–15 Tage nach EKT und >15 Tage nach EKT. Einleitend halten die Autoren fest, dass sie keinen standardisierten Test für retrograde Amnesie identifizieren konnten. Reduzierte kognitive Leistungen fanden sich nur unmittelbar nach EKT, vor allem betreffend verbales Gedächtnis (z.B. Wiedergeben von Wörterlisten) und Exekutivfunktionen (z.B. Zahlen-Verbindungs-Test, WortFlüssigkeit-Tests) mit Effektstärken von >0,6. Danach wurden aber in den verschiedensten Tests nur mehr Verbesserungen im Vergleich zur Baseline gefunden, die nach 15 Tagen oder später am deutlichsten waren (Effektstärken etwa 0,2 bis 0,6). EKT – Durchführung Voraussetzungen Während einer EKT ist der Patient für mindestens 30 Minuten im Behandlungsraum. Ein qualifiziertes EKT-Team muss zur Verfügung stehen, bestehend aus Psychiater, Anästhesist und diplomierter Pflegeperson. In Österreich wird derzeit überwiegend das zeitgemäße Thymatron System IV-Gerät (Hersteller: Somatics Inc., Illinois, USA) vertrieben, das die Energie in Form bidirektionaler, kurzer Rechteckimpulse abgibt und eine Maximalladung von etwa 1000 Millicoulomb (mC) (200%) aufbringt. Eine Ladung von 500 mC (Stimulusparameter: Impulsbreite 0,5 ms, 70 Hz, Stimulationsdauer 8 s) ist am Stellrad mit 100% vermerkt, weil dies früher die maximale, zugelassenen Ladung war. Die EKT mit Rechtsstrom verursacht deutlich weniger Gedächtnisstörungen als die frühere EKT mit Sinusstrom. Das Gerät bietet die Möglichkeit für vier Ableitungen, die üblicherweise für zwei EEG-Kanäle (beidseits frontopolar versus Mastoid), EMG (am rechten Unterarm) und EKG genützt werden. Der freiwillig aufgenommene Patient hat spätestens am Vortag der EKT eine Indikation und Freigabe zur EKT erhalten und sowohl eine psychiatrische als auch eine anästhesiologische Einverständniserklärung unterschrieben. Bei Patienten, die ohne Verlangen nach dem Unterbringungsgesetz (UbG) stationär aufgenommen sind, kann das Gericht die „Besondere Heilbehandlung“ im Rahmen des §36 des UbG genehmigen. Bei „Gefahr im Verzug“ kann die 1. EKT sofort durchgeführt werden. Lithium und Antikonvulsiva („mood stabilizer“) sollen am Vorabend und am Morgen der EKT pausiert werden. Benzodiazepine sollten wegen ihrer antikonvulsiven Wirkung am EKT-Tag möglichst pausiert oder niedrig dosiert werden. SNRI, NARI, Bupropion und MAO-Hemmer sollten am Morgen der EKT pausiert werden, da sie Blutdruckanstiege während der EKT verstärken könnten. Leider gibt es keine Daten, welche Antidepressiva oder Antipsychotika im Sinne einer optimalen Wirksamkeit mit EKT kombiniert werden sollten. 25 Elektrodenplazierung Unilaterale EKT (UL): Nach d’Elia werden die Stimuluselektroden (5 cm im Durchmesser) mit Kopfband oder Klebeelektrode rechts frontotemporal und mit Handgriff rechts hochparietal platziert. Rechts wird die nicht-nichtdominante Hemisphäre angenommen. Bilaterale EKT (BL): Beide Stimuluselektroden werden frontotemporal rechts sowie links (an den Schläfen) mit Hilfe des Kopfbands oder einer Klebeelektrode platziert. Die bilaterale (BL) EKT ist effizienter als die unilaterale (UL) EKT ist, d.h. die antidepressive und antipsychotische Wirkung tritt rascher und ausgeprägter ein (Sackeim et al., 1993). Weil die rechts UL Stimulation deutlich weniger Risiko für Gedächtnisstörungen birgt als die BL, wird in den meisten Zentren die akute EKT-Serie mit einer UL begonnen und nur im Falle einer Non-Response ab der 6.–8. EKT auf BL umgestellt. Stimulusdosierung und Anfallsqualität 26 Für eine wirksame UL-EKT soll die Ladung 3x höher sein als die Schwellendosis. Die Schwellendosis ist die minimale elektrische Ladung, die bei der 1. EKT einen Anfall auslöst. In Anlehnung an die Publikationen von Sackeim und Mitarbeitern (Columbia University, New York) wird in den meisten Zentren bei der ersten Stimulation eine Titration der Ladung unternommen, um die Schwellendosis zu detektieren und eine Orientierungshilfe für die Auswahl der Stimulusdosierungen in den Folge-EKTs zu haben. Erste Behandlung zur Festlegung der Krampfschwelle (auch Schwellendosis): - Stimulationen mit zunehmender Ladung von 10%, 20%, 40% der Maximalladung (504 mC) bis zum Erreichen der Krampfschwelle (=Titration) Folgebehandlungen: - Bilaterale (BL) Stimulation: 1,5 bis 2faches der Schwellendosis - Unilaterale (UL) Stimulation: 3 bis 5faches der Schwellendosis In der Praxis liegt die Schwellendosis bei nahezu allen jüngeren Patienten bei 10% (50 mC) und bei Älteren bei 10% oder 20%, letzteres am ehesten bei zusätzlicher Verordnung von Benzodiazepinen oder Antikonvulsiva (als Mood Stabilizer). Daher ist es im Sinne der Vereinfachung vertretbar, dass bei Jüngeren die ULSerie gleich mit 30% bis 50% begonnen wird, bei Älteren mit 60% oder mehr. Die EKT-Serie wirkt antikonvulsiv, die Krampfschwelle steigt im Verlauf der EKT-Serie zunehmend, d.h. man muss die Ladung von Sitzung zu Sitzung adaptieren, in der Regel erhöhen, um wieder eine adäquate Anfallsaktivität zu erzielen. In der EKT strebt man eine zentrale Anfallsdauer, fassbar im EEG, von >25 sec an, eine motorische Anfallsdauer von >20 sec. Die Krampfdauer zeigt aber keine positive Korrelation mit der Stimulusdosis. Im Gegenteil, sehr hohe Stimulusintensitäten führen eher zu kurzen Anfällen, die sich dann aber allenfalls durch hohe Intensität auszeichnen können. Folgende Kriterien, die im Thymatron durch verschiedene EEG-Parameter belegt werden, sollen in die Beurteilung der Anfallsgüte bei EKT einfließen: 1. Anfallsdauer 2. Amplitude 3. Rekrutierungszeit (Zeit bis zur maximalen Power) 4. Generalisierung 5. Zentrale Inhibition (postiktale Suppression in %, 100% entsprächen einer Null-Linie) Bei inadäquater Anfallsaktivität wird eine Restimulation mit der 1,5 bis 2fachen Ladung im gleichen Narkosevorgang empfohlen. Der 2. Stimulus soll etwa 2 Minuten nach dem Ausgangsstimulus erfolgen. Die optimale Wahl der Stimulusdosis ist nicht trivial und muss folgende Aspekte berücksichtigen: • Therapieerfolg? – Bei mäßiger Wirkung → UL-Dosissteigerung! BL? • Krampfdauer? – Bei schlechter Anfallsgüte → UL-Dosissteigerung! BL? • Gedächtnisstörung? – Bei Gedächtnisstörungen bzw. Organischem Psychosyndrom eher UL (bis zu 200%) als BL behandeln. Nutzen/Risikoabwägung! Behandlungsfrequenz und Dauer der akuten EKT-Serie Die EKT werden üblicherweise 3x pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) durchgeführt. Die Behandlung 2x wöchentlich ist im stationären Setting unüblich, weil mehr Zeit bis zum Ansprechen vergeht. Übli- cherweise werden insgesamt 7 bis 12 Behandlungen anberaumt, um eine Besserung oder Remission der schweren Krankheitsepisode zu erzielen. Im klinischen Alltag zeigt sich meist nach der 6. bis 8. Behandlung ein Therapieerfolg. Folgender Therapieplan in Abhängigkeit von der Response ist sinnvoll: Im positiven Fall (Response): - Bei fortschreitender Besserung → Behandlung bis zur Remission - Bei gebessertem Zustand ohne weiteren Aufwärtstrend → insgesamt 10 bis 12 EKT durchführen (hochdosiert UL oder BL) Im ungünstigen Fall (Non-Response): - Spätestens ab der 8. EKT entweder UL hochdosiert (>100%) oder – weil besser wirksam – BL behandeln. Beendigung nach 12–14 Stimuli. Erhaltungs-EKT Im Anschluss an eine Besserung durch EKT entwickeln 50% der Patienten (Rabheru, 2012) neuerlich eine depressive Episode innerhalb von 6 Monaten. Die Erhaltungs-EKT (E-EKT) ist indiziert zur Fortführung einer erfolgreichen (!) EKT-Behandlung bei remittierten oder zumindest auf zufriedenstellendem Niveau stabilisierten Patienten, um das Wiederauftreten neuerlicher schwerer Krankheitsepisoden zu verhindern bzw. um den psychischen Zustand eines Patienten langfristig zu stabilisieren. Nach Beendigung der akuten EKT-Serie wird die E-EKT in den ersten beiden Monaten alle 2–3 Wochen durchgeführt, danach über längere Zeit 1x monatlich. Die Elektrodenplatzierung (UL oder BL) und die Stimulusdosis können für die E-EKT so gewählt werden, wie für die letzte EKT im Verlauf der akuten Serie. Biologische Befunde zur EKT Der primäre Angriffspunkt der EKT ist unbekannt. Es gibt eine Vielzahl von Tierstudien (electroconvulsive shock, ECS) und mittlerweile in zunehmender Zahl auch Humanstudien bei Patienten zur Wirkung der EKT auf den zerebralen Blutfluss und den Glukosemetabolismus (Cave: regionale Unterschiede), die Neurogenese (z.B. BDNF-Erhöhung) und synaptische Plastizität sowie die Neurotransmittersysteme (Baldinger et al., 2014). Auch das Serotoninsystem spielt eine wichtige Rolle im Wirkmechanismus der EKT. Präklinische Daten bei Ratten (Verhaltensexperimente, in vivo-Mikrodialyse, Autoradiographie, elektrophysiologische Messungen, Genexpression, Rezeptor-Bindungsstudien) weisen auf erhöhte serotonerge (5-HT) Neurotransmission hin. In der Mehrzahl dieser Tierstudien finden sich die 5-HT1A- und 5-HT1A-Rezeptoren hochreguliert. In den drei derzeit publizierten PET-Studien bei Menschen ist das Gegenteil der Fall; das Bindungspotential an 5-HT1A-(Lanzenberger et al., 2013) und 5-HT1A-Rezeptoren nimmt im Zuge einer EKT-Serie ab, analog zu den vorliegenden Befunden für Antidepressiva. Im dopaminergen System sprechen die Daten für eine erhöhte Neurotransmission durch EKT. Literatur Baldinger P, Lotan A, Frey R, Kasper S, Lerer B, Lanzenberger R. Neurotransmitters and electroconvulsive therapy. J ECT 2014:30(2):116-21 Conca A, Hinterhuber H, Prapotnik M, Geretsegger C, Frey R, et al. Die Elektrokrampftherapie: Theorie und Praxis. Offizielles EKT-Konsensuspapier der ÖGPP. Neuropsychiatrie 2004;18:1-17 Frey R, Schreinzer D, Heiden A and Kasper S. Use of electroconvulsive therapy in psychiatry. Nervenarzt 2001;72:661-676 Hoyer C, Kranaster L, Janke C, Sartorius A. Impact of the anesthetic agents ketamine, etomidate, thiopental, and propofol on seizure parameters and seizure quality in electroconvulsive therapy: a retrospective study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2014;264(3):255-61 Lanzenberger R, Baldinger P, Hahn A, Ungersboeck J, Mitterhauser M. Global decrease of serotonin-1A receptor binding after electroconvulsive therapy in major depression measured by PET. Mol Psychiatry 2013;18:93-100 Prudic J, Haskett RF, Mulsant B, Malone KM, Pettinati HM, Stephens S, Greenberg R, Rifas SL, Sackeim HA. Resistance to antidepressant medications and short-term clinical response to ECT. Am J Psychiatry 1996;153(8):985-92 Rabheru K. Maintenance electroconvulsive therapy (M-ECT) after acute response: examining the evidence for who, what, when, and how? J ECT 2012;28(1):39-47 Sackeim HA, Prudic J, Devanand DP, Kiersky JE, Fitzsimons L, et al. Effects of stimulus intensity and electrode placement on the efficacy and cognitive effects of electroconvulsive therapy. N Engl J Med 1993;328:839-846 Semkovska M, McLoughlin DM. Objective cognitive performance associated with electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and metaanalysis. Biol Psychiatry 2010;68(6):568-77 27 Schmerzentstehung, Verarbeitung und Behandlung Univ.Prof. Priv.Doz. Dr. Michael Bach APR Salzburg – Ambulante psychosoziale Rehabilitation, Salzburg 28 1. Einleitung Schmerz ist ein komplexes bio-psycho-soziales Phänomen, das zum Erfahrungsschatz nahezu jedes Menschen zählt. Jeder Schmerz hinterlässt eine Erlebnisspur, die spätere Schmerzerfahrungen beeinflusst. Wie bei anderen Erfahrungen auch, versucht der Mensch seinen Schmerz in einen Sinnzusammenhang mit seinem Denken und Fühlen zu stellen, eingebettet in den individuellen soziokulturellen Bedeutungszusammenhang und das jeweils vorherrschende Schmerzverständnis. Vermutlich das erste multidimensionale Schmerzmodell, in dem biologische und psychologische Mechanismen zu einer einheitlichen Theorie zusammengefasst wurden, stellt die Gate-Control-Theorie (Melzack & Wall, 1965) dar. Zentrale Aussage dieser Schmerzmodulationstheorie ist die Formulierung eines neuronalen Tormechanismus im Hinterhorn (Substantia gelatinosa) des Rückenmarks, der die Übertragung einlangender Schmerzimpulse von den peripheren Schmerzbahnen (A-Delta- und C-Fasern) auf Bahnen des Rückenmarks steuert. Das ZNS erlangt dabei eine umfassende aktive Rolle in der Modulation des nozizeptiven Erregungsmusters durch deszendierende anti-nozizeptive Kontrollmechanismen. Große Bedeutung erlangte diese Theorie weiters durch die Berücksichtigung zentralnervöser Netzwerke – unter anderem subkortikaler Motivations- und Emotionssysteme – für die Schmerzverarbeitung. Unsere gegenwärtige Auffassung von kompetitiven aszendierenden und deszendierenden Schmerzmodulationsmechanismen lässt uns somit die Schmerzverarbeitung bis hin zur bewussten Wahrnehmung nicht mehr als „Alles-oder-nichts“-Vorgang begreifen, sondern als komplexes Geschehen, in das auch steuernd eingegriffen werden kann: Hier öffnet sich der Weg zur modernen (pharmakologischen, invasiven oder psychologisch-psychotherapeutischen) Schmerztherapie. Die frühere Dichotomisierung zwischen „körperlichen“ und „seelischen“ Schmerzen kommt zwar dem Bedürfnis nach klar abgrenzbaren klinischen Entitäten nahe, ist jedoch aus der Sicht der modernen klinischen und neurobiologischen Schmerzforschung heute nicht mehr sinnvoll. Anstelle eines „Entweder-oder“ stellt sich nun die Frage, wie biologische und psychosoziale Faktoren individuell pathogenetisch bzw. pathoplastisch wirksam werden können. 2. Schmerzentstehung und Schmerzchronifizierung Akuter Schmerz ist in der Regel kurz andauernd und üblicherweise somatisch ausgelöst. Grundsätzlich werden zwei Schmerzentitäten unterschieden: Nozizeptive Schmerzen entstehen durch eine (physiologische) Stimulation von Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren) durch mechanische, thermische, chemische oder elektrische Reize. Beispiele sind: Verletzungen, Entzündungen, postoperativer Schmerz, Ischämieschmerzen (z.B. beim Myokardinfarkt) oder Metastasen. Demgegenüber entstehen neuropathische Schmerzen als direkte Folge einer Schädigung oder Läsion im somatosensorischen System (Treede et al., 2008, Haanpää et al., 2011, IASP SIG on Neuropathic Pain). Beispiele sind: Mono- und Polyneuropathien, Plexopathien, Radikulopathien, zentraler Schmerz (z.B. Thalamus-Schmerzsyndrome) oder Phantomschmerz. Daneben wird diskutiert, inwieweit viszerale Schmerzen oder sympathisch vermittelte Schmerzen (z.B. beim CRPS) eigenständige Schmerzentitäten darstellen. Auch Mischformen von nozizeptiven und neuropathischen Schmerzkomponenten werden angenommen, z.B. beim Postdiskektomie-Syndrom oder beim (chronischen) Rückenschmerz. Akute Schmerzen besitzen eine biologische Warnfunktion, indem sie auf zugrunde liegende (organ-)pathologische Prozesse hinweisen und zu einer unmittelbaren Begrenzung der potentiellen Gewebsschädigung führen (z.B. Entfernen der Hand von der heißen Herdplatte). Gleichzeitig haben akute Schmerzen eine rehabilitative Funktion, indem sie (z.B. bei Unfällen oder Entzündungen) zur Ruhe und Schonung zwingen. Mit zunehmender Schmerzdauer finden auf somatischer und psychosozialer Ebene Chronifizierungsvorgänge statt, die eine sekundäre Kausalkette für die weitere Aufrechterhaltung des Schmerzes darstellen. Der chronische Schmerz „verselbständigt“ sich zunehmend von seiner ursprünglich auslösenden Ursache und verliert somit seine biologische Warnfunktion; er ist nicht mehr Hinweis auf eine zugrunde liegende Verletzung oder Erkrankung, sondern ist selbst zu einer eigenständigen Erkrankung geworden (ab einer Schmerzdauer von mehr als 3 Monaten wird von chronischem Schmerz gesprochen). Während bei akuten Schmerzzuständen häufig den somatischen Faktoren eine zentrale Rolle zukommt, gewinnen mit zunehmender Chronifi- zierung die psychosozialen Aspekte des Schmerzerlebens und der Schmerzverarbeitung an Bedeutung. Bei vielen Betroffenen ist das Ausmaß erlebter Schmerzen und die subjektive Beeinträchtigung bzw. Behinderung durch die Schmerzen (sog. „pain disability“) nicht progressiv linear zum organmedizinischen Befund. Die fehlende Berücksichtigung psychosozialer Aspekte bei der Schmerzdiagnostik und Therapieplanung insbesondere bei chronischem Schmerz führt daher fälschlicherweise zu einer einseitig medizinischen Sichtweise von subjektivem Leiden (Bach et al., 2001). 3. Bausteine einer multimodalen Schmerztherapie Ausgehend von einem mehrdimensionalen Schmerzverständnis ist in der Therapie von chronischen Schmerzen auf ganzheitliche, multimodale Behandlungskonzepte zu achten. Folgende Behandlungsansätze sind hier maßgeblich wirksam: 3.1. Medikamentöse Verfahren Die Grundlagen der medikamentösen Schmerztherapie leiten sich aus den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab. Das „WHO-Stufenschema“ hat zu einem strukturierten Einsatz von Analgetika (Non-Opioid-Analgetika und Opioide) und Co-Analgetika (in erster Linie Antidepressiva und Antikonvulsiva) bei chronischen Schmerzen geführt. Die wichtigsten Grundregeln nach diesem Schema sind (McMahon & Koltzenburg, 2005): So einfach wie möglich – vorzugsweise orale Anwendung, dadurch Unabhängigkeit der Patienten Regelmäßige Einnahme nach Zeitschema (antizipative Einnahme, bevor Schmerzen eskalieren) Individuelle Dosierung und kontrollierte Dosisanpassung (zur Minimierung des Suchtrisikos) Prophylaxe von Nebenwirkungen, ev. durch Begleitmedikation Grundsätzlich werden folgende Analgetikagruppen unterschieden: Non-Opioid-Analgetika (WHO-Stufe 1): Wirken überwiegend peripher (d.h. am Ort der Entstehung von nozizeptiven Schmerzen) als Cyclooxygenase-Hemmer. Einige dieser Medikamente besitzen neben ihrer schmerzlindernden Wirkung auch gute entzündungshemmende und fiebersenkende Eigenschaften. Zu dieser Gruppe zählen die NSAR und Coxibe (COX-2-Hemmer). Im Gegensatz dazu haben die ebenfalls den Non-Opioid-Analgetika zugeordneten Präparate Paracetamol und Metamizol einen primär zentral-nervösen Wirkmechanismus. Opioide: Sie wirken überwiegend als Agonisten an den m- und/oder k-Rezeptoren vorwiegend im ZNS. Es werden schwach-wirksame (WHO-Stufe 2, z.B. Tramadol und Codidol) und stark-wirksame (WHO-Stufe 3) Opioide unterschieden. In der Schmerztherapie werden Opioide in retardierter Form oral oder transdermal (Fentanyl und Buprenorphin) eingesetzt. Neben den retardierten Formen existieren rasch wirksame, zeitlimitiert wirksame Opioide als sog. „Rescue“-Medikation gegen Schmerzspitzen. Je nach (vermuteter) Ätiologie der Schmerzen gelangen die einzelnen Substanzgruppen mit unterschiedlicher Präferenz zum Einsatz: Bei primär nozizeptiven Schmerzen hat das WHO-Stufenschema bis heute seinen Stellenwert erhalten (d.h. Gabe von Non-Opioid-Analgetika, z.B. NSAR, später Kombination mit niederpotenten, später höherpotenten Opioiden, McQuay & Moore, 2005). Im Gegensatz dazu wird gegenwärtig in der Tumorschmerztherapie ein frühzeitiger Einsatz von Opioiden aufgrund der besseren analgetischen Potenz bei insgesamt günstigerem Nebenwirkungsprofil gefordert (Tölle et al., 2009). Hingegen weisen Analgetika bei primär neuropathischen Schmerzen (Diabetische Neuropathie, Post-Zoster-Neuralgie, Fibromyalgie-Syndrom etc.) sowie Schmerzen im Rahmen von psychiatrischen Störungen (Somatoforme Störungen, Depressive Störungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, etc.) in der Regel eine geringere antinozizeptive Effektivität auf als Antidepressiva und Antikonvulsiva. Die beiden letzteren Substanzgruppen werden daher in diesen Indikationen als primäre Schmerztherapie und nicht – wie im WHO-Stufenplan suggeriert – als CoAnalgetika empfohlen (Feuerstein, 1997; Finnerup et al., 2010). Die analgetische Wirkung der Antidepressiva wird heute als weitgehend unabhängig von der antidepressiven Wirkung dieser Medikamente angesehen. Neben dem direkt analgetischen Effekt besteht der Vorteil einer (zusätzlichen) Gabe von Antidepressiva in einer effizienten Behandlungsform für die häufig in Komorbidität vorliegenden Depressiven Störungen, Angststörungen oder Schlafstörungen (jeweils Prävalenzraten von ca. 50% bei chronischem Schmerz). Folgende analgetische Wirkmechanismen der Antidepressiva finden sich in der Literatur: Wirkungsverstärkung deszendierender schmerzhemmender Bahnen (Locus coeruleus, Nucleus raphe medianus) durch Wiederaufnahmehemmung von Serotonin und Noradrenalin 29 Antagonisierung vermehrt exprimierter nozizeptiver NMDA-Rezeptoren (Antagonisierung der neuronalen Sensibilisierung) Indirekte Aktivierung der Opioid-induzierten Antinozizeption Membranstabilisierung durch Natriumkanalblockade Erhöhung der affektiven Schmerztoleranz (Schmerzdistanzierung) im Gyrus cinguli Überblickt man die bisherigen Effektivitätsstudien, so zeigen dual (serotonerg-noradrenerg) wirksame Antidepressiva eine bessere analgetische Wirkung als selektive (serotonerge oder noradrenerge) Substanzen. Eine Erklärung dafür ist die gleichzeitige modulierende Wirkung auf beide Transmittersysteme im Bereich des deszendierenden schmerzhemmenden Systems im Rückenmark, das auf segmentaler Ebene die Weiterleitung des nozizeptiven Inputs dämpfen kann. Beurteilt man die derzeitige Studienlage streng nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin, so weisen die klassischen Trizyklika – nicht zuletzt aufgrund der langjährigen und reichhaltigen Daten – die beste Studienevidenz auf, sodass sie in der Indikation chronischer Schmerz weiterhin als Substanzen 1. Wahl gelten. In den letzten Jahren wurden für einzelne Schmerzsyndrome auch vergleichbare Studienergebnisse für die SNRI Duloxetin, Venlafaxin und Milnacipran veröffentlicht. Antikonvulsiva eignen sich aufgrund ihrer membranstabilisierenden Wirkung auch zur Behandlung von primär neuropathischen Schmerzen und anderen zentralen Schmerzsyndromen. Sie wirken durch direkte GABAerge Modulation sowie durch Blockade spannungsensitiver Natrium-Kanäle oder α2δ-Kalziumkanäle. Weitere Substanzgruppen mit belegter analgetischer Wirkpotenz sind (alphabetisch): Capsaicin, Corticosteroide, Lokalanästhetika (z.B. Lidocain auch als Pflaster), Muskelrelaxantien, NMDA-Rezeptor-Antagonisten, Spasmolytika, Triptane, Ziconitide, und andere. Wichtig vor dem Einsatz dieser Substanzgruppen ist die genaue Kenntnis der pathogenetischen Schmerzmechanismen sowie mögliche Interaktionseffekte bzw. Warnhinweise bei unterschiedlichen Medikamentenkombinationen. 30 3.2. Klinisch-psychologische und psychotherapeutische Verfahren In den letzten Jahren wurden eine Reihe klinisch-psychologischer und psychotherapeutischer Behandlungsansätze für chronische Schmerzpatienten entwickelt. Das Spektrum der Methoden reicht von klassisch verhaltenstherapeutischen (operanten) Verfahren und kognitiv-behavioralen Ansätzen über psychodynamisch ausgerichtete Interventionen und humanistischen Therapieverfahren bis hin zu künstlerischen Therapien (Kröner-Herwig et al.. 2007). Hauptanliegen der symptombezogenen Interventionen (sog. „Schmerzbewältigungs-verfahren“) ist die Förderung der Eigenaktivität und Selbstkompetenz der Patienten im Umgang mit den Schmerzen und deren Folgen, sodass diese nicht passiv-leidend und hilflos ihren Schmerzen ausgeliefert sind, sondern aktiv und bewußt in das Schmerzgeschehen eingreifen können. Ein weiterer Behandlungsschwerpunkt ist der Aufbau gesundheitsbezogener Maßnahmen (z.B. Reduktion des Analgetikakonsums, gestufter Aktivitätsaufbau, psychosoziale Rehabilitation und Reintegration) mit dem Ziel einer Förderung von Lebensqualität trotz chronischer Schmerzen. Daneben sind symptomübergreifende (konfliktzentrierte, erlebnisorientierte, interaktionelle) Interventionsmaßnahmen zu erwähnen. Diese sind indiziert, wenn die Schmerzsymptomatik in Zusammenhang steht mit tiefgreifenden Störungen der Affektregulation (z.B. im Rahmen von Persönlichkeitsstörungen), traumatischen Erfahrungen (wie z.B. schwerwiegender Misshandlung oder Missbrauch), akuten lebensverändernden Ereignissen (häufig im Rahmen von Verlusterfahrungen, wie z.B. Trennung, Tod, Migration) oder einer Dekompensierung infolge chronischer Überlastungssituationen. In den meisten psychologisch-psychotherapeutischen Behandlungskonzepten nehmen jene Interventionen einen großen Stellenwert ein, die auf psychophysiologischer Ebene ansetzen, wie beispielsweise Entspannungsverfahren (Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training, Applied Relaxation) und Biofeedback-Verfahren, teils kombiniert mit Imaginations- und Suggestionstechniken bzw. Hypnose zur Aufmerksamkeitslenkung. 3.3. Körperorientierte und komplementäre Verfahren Die physikalische Therapie stellt neben den Medikamenten und den psychologisch-psychotherapeutischen Verfahren die dritte Säule der Schmerztherapie dar – noch vor den invasiven und neurodestruktiven Verfahren. Bewährt haben sich hierbei folgende Verfahren: Bewegungstherapie und medizinische Trainingstherapie, Massagen, Lymphdrainagen, Medikomechanik, Thermotherapie, Elektrotherapie (z.B. TENS), Ultraschall und radiale Stoßwelle. Ergänzt werden diese Therapien häufig durch Komplementärmedizinische Verfahren, wie z.B. Akupunktur, Neuraltherapie oder Homöopathie. 3.4. Invasive nicht-destruktive und neurodestruktive Verfahren Durch die Entwicklung moderner medikamentöser Verfahren und die Berücksichtigung ganzheitlicher, multimodaler Behandlungskonzepte besitzen die invasiven Verfahren wie Symapthicus-Blockaden und neuromodulative Verfahren ihren Stellenwert bei spezieller Indikationsstellung (Linderoth et al., 2005). Die neurodestruktiven Verfahren gelten heute vielfach als Randbereiche der medizinischen Schmerztherapie. 4. Zusammenfassung Zahlreiche Effektivitätsstudien und Metaanalysen belegen für die Behandlung chronischer Schmerzen zeigen eine signifikante Überlegenheit einer mehrdimensionalen Schmerztherapie gegenüber eindimensionalen Behandlungen (Flor et al., 1992). Neben ätiopathogenetischen Überlegungen sollte dabei v.a. der biopsycho-sozialen Komplexität des chronischen Schmerzes Rechnung getragen werden. Literatur Bach M, Aigner M, Bankier B (Hrsg.) Schmerzen ohne Ursache – Schmerzen ohne Ende. Konzepte – Diagnostik – Therapie. Facultas-Verlag, Wien 2001. Flor H, Fydrich T, Turk DC. Efficacy of multidisciplinary pain treatment centers: a meta-analyic review. Pain 1992;49:221-230 Feuerstein TL. Antidepressiva zur Therapie chronischer Schmerz – Metaanalyse. Der Schmerz 1997;11:213-226 Finnerup NB, Sindrup SH, Jensen TS. The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain. Pain 2010;150(3):573-581 Kröner-Herwig B, Frettlöh J, Klinger R, Nilges P (Hrsg.). Schmerzpsychotherapie. Grundlagen – Diagnostik – Krankheitsbilder – Behandlung, 6. Auflage. Springer Verlag, 2007 Linderoth B, Simpson BA, Myerson BA. Spinal Cord and Brain Stimulation. In: McMahon S, Koltzenburg M (Eds.) Wall and Melzack’s Textbook of Pain. Fifth Edition. Philadelphia: Elsevier/Churchill-Livingstone, 2005; Section 3, Chapter 37 McMahon S, Koltzenburg M (Eds.). Wall and Melzack’s Textbook of Pain. Fifth Edition. Philadelphia: Elsevier/Churchill-Livingstone, 2005 McQuay HJ, Moore RA. NSAIDS and Coxibs: Clinical Use. In: McMahon S, Koltzenburg M (Eds.) Wall and Melzack’s Textbook of Pain. Fifth Edition. Philadelphia: Elsevier/Churchill-Livingstone, 2005; Section 3, Chapter 30 Tölle RT, Treede RD, Zenz M. Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerzen (LONTS), Der Schmerz 2009;23:437439 31 Schlaf, Schmerz und Depression Prof. Dr. med. Edith Holsboer-Trachsler Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK), Basel Schlafbeschwerden, chronische Schmerzen und depressive Erkrankungen sind häufig, reduzieren erheblich die Lebensqualität, belasten das Gesundheitssystem und treten oft gemeinsam auf. Bis zu 90% der Patienten mit chronischen Schmerzen berichten über Schlafstörungen, und bis zu drei Viertel der Patienten mit neuropathischen Schmerzen leiden an depressiven Störungen (Choprak, Arora, 2014). Sowohl chronische Schlafstörungen wie auch chronische Schmerzen erhöhen das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Viele primär depressive Patienten leiden an Schmerzsyndromen wie Kopf-, Bauch-, Gelenk-, Rückenund Unterbauchschmerzen. Der alte Begriff der „larvierten Depression“ von Kielholz dokumentiert die diagnostische Herausforderung, denn die meisten depressiven Patienten präsentieren sich in der Arztpraxis mit körperlichen Beschwerden (Kroenke et al. 1994). Für die Ätiopathogenese werden verschiedene neurobiologische Zusammenhänge diskutiert. Die Schmerzverarbeitung zeigt einen direkten Einfluss auf die Schlafqualität und wird durch kognitiv-emotionale Prozesse wie Depressivität und Lebensqualität mitbeeinflusst (Brand et al. 2010). Die Trias Schmerz–Insomnie und Depression ist für die Fibromyalgie am besten untersucht. Hier finden sich ähnlich wie bei Depression nicht nur subjektive Schlafbeschwerden, sondern auch charakteristische Veränderungen der Schlafstruktur. Neben den biogenen Aminen Serotonin, Noradrenalin und Dopamin bei Schmerz und Depression spielt vor allem die Dysfunktion des Hypothalamus–Hypophysen–Nebennierenrindensystems eine Rolle für die Komorbidität und gegenseitige Risikoerhöhung. Strukturelle Untersuchungen mit Bildgebung weisen ebenfalls auf einen engen Zusammenhang zwischen Arealen im zentralen Nervensystem, die sowohl bei der Integration der Schmerzwahrnehmung als auch der Affektregulation beteiligt sind. 32 Die syndromorientierte Therapie ist von entscheidender Bedeutung, denn die Linderung der körperlichen Symptome ist mit einer höheren Remissionsrate der depressiven Störungen assoziiert (Fava, 2004; Hatzinger et al., 2004). Für eine angemessene Therapie gilt es, die komplexen Interaktionen zwischen Schmerz-Schlaf und Depression zu beachten. Neben kognitiver Verhaltenstherapie und Aufbau körperlicher Aktivität bestehen unterschiedliche Evidenzen für die psychopharmakologische Behandlung mit den dual wirksamen Antidepressiva und analgetisch wirksamen Substanzen (Stanley, 2012). Literatur Brand S, Gerber M, Pühse U, Holsboer-Trachsler E. The relation between sleep and pain among a non-clinical sample of young adults. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2010; 260:543-551 Choprak K, Arora V. An intricate relationship between pain and depression: clinical cor-relates, coactivation factors and therapeutic targets. Exp Opin 2014;18(2):159-176 Fava M, Mallinckrodt CH, Detke MJ, Watkin JG, Wohlreich MM. The effect of duloxe-tine on painful physical symptoms in depressed patients: do improvements in these symp-toms result in higher remission rates? J Clin Psychiatry 2004;65(4):521-530 Hatzinger M, Hemmeter UM, Brand S, Ising M, Holsboer-Trachsler E. Electroencephalographic (EEG) sleep profiles in treatment course and long-term outcome of major depression: association with DEX/CRH-test response. J Psychiatric Res 2004;38:453-465 Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, Linzer M, Hahn SR, deGruy FV 3rd, Brody D. Physical symptoms in primary care. Predictors of psychiatric disorders and functional impair-ment Arch Fam Med 1994;;3(9):774-779 Stanley N. Importance of sleep in neuropathic pain. Somnologie 2012;16(1):17-19 Einsatz von Antidepressiva im Spektrum von Endokrinologie und Onkologie Prim. Dr. Andreas Walter Stabstelle Psychiatrie, Pflegewohnhaus Donaustadt (PDO), SMZ-Ost, Wien Depression, endokrinologische und onkologische Erkrankungen stehen in einem komplexen, sich wechselseitig bedingenden Kausalgefüge zueinander. Mit zunehmendem Wissen über jenes Zusammenspiel erhöhen sich auch die Ansatzpunkte gezielter Interventionen. So lässt sich das überzufällig häufige Vorkommen von Diabetes bei depressiven Patienten mittlerweile direkt über die durch die Depression bedingte hormonelle Entgleisung des HPA-Systems erklären, was diverse Optionen in salutogenetisch orientierten Maßnahmen eröffnet. Tabelle 1 Diabetes, Depression, Lifestyle • Problematik: Diabetes macht aktive, gesunde Lebensgestaltung notwendig • Jedoch typisch für depressive Patienten ist ein reduzierter Antrieb • So wirkt sich die Depression drastisch auf die Folgen der Diabetes-Erkrankung aus! - Erhöhtes Auftreten von Retinopathie, Neuropathie, makrovaskulären Komplikationen sowie sexueller Dysfunktion de Groot et al., 2001 33 Tabelle 2 HPA-Achse als Bindeglied zwischen Depresssion und Diabetes Depressionen führen zu einer Hyperaktivität der HPA-Achse mit daraus resultierender Hypercortisolämie sowie erhöhten Spiegeln von Katecholaminen und Entzündungsmarkern. Dies wiederum führt zu - erhöhtem Blutzuckerspiegel - erhöhtem Insulinspiegel - verringertem hGH-Spiegel --> Vermehrte Bildung von viszeralem Fett, Insulinresistenz, Adipositas, Hyperinsulinämie, später mit Hyperglykämie • Die Diagnose Typ-2-Diabetes ist oftmals mkit Bewältigungs- und Zukunftsängsten verbunden. • Stressreaktion kann die diabetische Stoffwechsellage verstärken Depression & Krebs Tabelle 3 Depression und diabetische Neuropathie Ad maskierte Depression: • Depressionen v.a. bei älteren Patienten eher in somatischen Beschwerden manifest • Zahlreiche Fälle diabetisch-neuropathischen Schmerzen zumindest teilweise Ausdruck einer latenten Depression • Selbst bei unsicherer DD: sowohl Depression als auch reine Neuropathie mit TCA oder besser mit SNRI behandelbar Turkington, 1980 Tabelle 4 Was tun bei Diabetes & Depression? • Depression erkennen & behandeln! --> reduziert Komplikationen des Diabetes und erhöht die Lebensqualität • Pharmakologisch immer zuerst Versuch mit SNRI wie z.B. Milnacipran oder Duloxetin - Duale Wirkkomponenten wie früher TCA - Wirksam bei etwaigen neuropathischen Schmerzen • Psychotherapie empfehlen - Solide Effektstärken v.a. bei schweren Depressionen, Kombination mit Medikation - Verbessert Motivation zur aktiven Lebensgestaltung 34 Auch Neoplasien tragen nicht nur in Form kritischer Lebensereignisse zu Erhöhung der Vulnerabilität für Depressionen bei, sondern haben je nach ihrer Lokalisation direkte kausale Einflüsse auf deren Prävalenz. Darüber hinaus wirken depressive Symptome als Moderatorvariablen des Outcomes oben genannter Erkrankungen. Neben diesen mittlerweile gut bekannten kausalen Wechselwirkungen gilt es jedoch auch, althergebrachte Annahmen über die Zusammenhänge dieser komplexen Störungen kritisch neu zu überdenken. So muss unter Rücksichtnahme auf das Diathese-Stress-Modell die Annahme monokausal durch eine somatische Erkrankung verursachte Depression neu reflektiert werden. In der Praxis lässt sich oft Tabelle 5 nur nach sorgfältigster längsschnittlicher DiagnosDepression & Krebs tik sowie Angehörigengesprächen schließen, ob eine etwaige Depression als direkte Folge oder als Differentialdiagnosen: „Beiläufer“ einer chronischen somatischen Erkran• Fatigue-Syndrom kung entstanden ist. Der Aufwand einer solchen • Kognitive Störungen als Folge der Therapie detaillierten Ursachenforschung macht sich jedoch „Chemo Brain“ in präziseren Interventionsempfehlungen bezahlt: • Delir So kann bei somatisch verursachten Depressionen • Hirnmetastasen von kürzeren Verläufen mit geringeren Rezidivra• Hypothyreose ten ausgegangen werden. Im Falle einer durch die (CAVE: Therapie mit Sunitinib) sich häufenden Belastungen entstandenen Depres• Anämien sion muss jedoch ein klassischerer Verlauf ange• Infektionen nommen und somit auch ein längerfristiger • Insomnien Behandlungsplan erdacht werden. Tabelle 6 Probleme der Patienten mit Krebs (n= 2.776: meistgenannte Probleme) Fatigue Schmerz Emotionen Depression Angst 48,5% 26,4% 24,8% 24% 24% Ansehen Aussehen Bewältigung Sexualität Finanzen 22,8% 20,6% 13,5% 12,9% 11,8% Carlson et al., 2004 Tabelle 7 Prävalenz der Depression bei Krebspatienten Kopf/Hirn Pankreas Mamma Lunge Colon Gynäkologisch Lymphom 41–93% 33–50% 4,5–37% 11–44% 13–25% 12–23% 8–19% Die Prävalenz hängt von der Lokalisation ab Massie et al., 2010 Prävalenz der Depression bei Krebspatienten Bei Krebspatienten sind Depresionen 2–3-mal häufiger als im Durchschnitt (Reich, 2010). 12,9% der Krebspatienten haben klinische und 16,5% subklinische Symptome einer Depression (Linden et al., 2012). Beinahe 25% der Krebspatienten leiden während ihrer Krankheit an einem depressiven Angst-Syndrom und bei 5–6% aller Fälle tritt eine depressive Episode auf (Reich, 2010). Im Vortrag werden zudem die Möglichkeiten einer gezielten antidepressiven Therapie unter Berücksichtigung der Nebenwirkungen und Interaktionen von Antidepressiva bei somatischen Erkrankungen präsentiert. Literatur Carlson LE, Angen M, Cullum J, et al.. High levels of untreated distress and fatigue in cancer patients. Br J Cancer 2004;90(12):2297-304 de Groot M, Anderson R, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. Association of depression and diabetes complications: a meta-analysis. Psychosom Med 2001;63(4):619-30 Linden W, Vodermaier A, Mackenzie R, Greig D. Anxiety and depression after cancer diagnosis: prevalence rates by cancer type, gender, and age. J Affect Disord 2012;141(2-3):343-51 Reich M. La dépression en oncologie. Cancer/Radiotherapie 2010;14:535-538 Turkington RW. Depression masquerading as diabetic neuropathy. JAMA 1980;243(11):1147-50 35 Bipolare Erkrankungen – ein Update Prim. Priv.Doz. Dr. Andreas Erfurth 6. Psychiatrische Abteilung, Otto-Wagner-Spital, Wien 36 Bipolare affektive Störungen stellen ein wichtiges psychiatrisches Krankheitsbild dar. Auf dem Weg hin zum DSM-5 haben sich diagnostische Neuerungen durchgesetzt, so der dimensionale Zugang im Sinne eines bipolaren Spektrums mit der neuen Diagnose einer unipolaren Depression mit gemischten Merkmalen (1,2). Waren im DSM-IV (und sind im ICD-10) affektive Mischzustände ausschließlich bei bipolaren Störungen diagnostizierbar, so kennt das DSM-5 nun die Major Depression mit gemischten Merkmalen (mixed features). Das DSM-5 hält diesbezüglich fest (S. 249): „Beachte: Gemischte Merkmale in Verbindung mit einer Episode einer Major Depression sind ein signifikanter Risikofaktor für die Entwicklung einer Bipolar-I- oder Bipolar-II-Störung. Daher ist es klinisch sinnvoll, diese Zusatzcodierung zur Planung der Behandlung und Kontrolle des Therapieerfolgs festzuhalten.“ Des Weiteren haben in den letzten 20 Jahren neue Behandlungsstrategien die Therapie der bipolaren Störung nachhaltig verändert (3): Neben dem Lithium haben sich weitere Stimmungsstabilisierer etabliert, die alten Neuroleptika (etwa Haloperidol i.v. und i.m., Laevomepromazin, Zuclopenthixol-Acetat) sind in der Behandlung der akuten Manie durch Strategien mit relevant weniger unerwünschten Arzneimittelwirkungen abgelöst worden (4-7). Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Wirksamkeit von Asenapin (4) bei gemischten Manien, einem besonders herausfordernden Zustandsbild (8). Mittels einem Modul des M.I.N.I. kann die gemischte Manie auch in der klinischen Praxis gut erfasst werden (9). Aripiprazol ist in der i.m.-Applikation ein wichtiger Baustein der Akutbehandlung der bipolaren Manie. Die Substanz ist in dieser Darreichungsform ein wirksamer Dopamin-D2-Blocker, der in der klinischen Praxis deutlich weniger Nebenwirkungen aufweist als vergleichbar potente Substanzen wie Haloperidol (vor allem bezüglich dem Risiko einer QTc-Verlängerung sowie extrapyramidal motorischer Nebenwirkungen). Nach der amerikanischen FDA 2012 hat auch die europäische Zulassungsbehörde EMA Loxapin (6) als erstes inhalatives Antipsychotikum für die schnelle Kontrolle leichter bis moderater Agitiertheit bei Erwachsenen mit Schizophrenie oder bipolarer Störung zugelassen. Hiermit steht für bipolare Patientinnen und Patienten eine innovative, nicht-invasive Strategie zur Verfügung, die eine ebenso rasche Wirkung wie eine intravenöse Gabe eines Pharmakons verspricht; zum Vergleich: Die maximale Plasmakonzentration (Cmax) von 25mg Loxapin oral liegt bei 20ng/ml nach 2 Stunden, die maximale Plasmakonzentration von 20mg Loxapin intramuskulär liegt bei 17,8ng/ml nach einer Stunde, 10mg inhaliertes Loxapin erreichen eine Cmax von 135ng/ml bereits nach 2 Minuten (10). Das verdeutlicht die besondere Wertigkeit der Inhalations-Route für die Akutbehandlung der bipolaren Störung. Literatur (1) Erfurth A, Sachs G. Mischzustände, Mischbilder und die depressive Episode mit gemischten Merkmalen. psychopraxis. neuropraxis 2015, 18(2): 38-43. (2) Erfurth A, Sachs G, Perugi G, Tondo L. Athanasios Koukopoulos (1931-2013). Zum Verlauf manisch-depressiver Erkrankungen. psychopraxis. neuropraxis 2014; 17:5-8. (3) Kasper S, Kapfhammer HP, Bach M, Butterfield-Meissl C, Erfurth A, Haring C, Hausmann A, Hofmann P, Kalousek M, Klier C, Marksteiner J, Mühlbacher M, Oberlerchner H, Psota G, Rados C, Sachs GM, Windhager E, Winkler J, Wrobel M. Bipolare Störungen. KonsensusStatement - State of the art 2013. CliniCum neuropsy Sonderausgabe November 2013:3-18. (4) Grande I, Hidalgo-Mazzei D, Nieto E, Mur M, Sàez C, Forcada I, Vieta E. Asenapine prescribing patterns in the treatment of manic inand outpatients: Results from the MANACOR study. Eur Psychiatry 2015 Feb 11. Epub ahead of print. (5) Brown R, Taylor MJ, Geddes J. Aripiprazole alone or in combination for acute mania. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 17. (6) Popovic D, Nuss P, Vieta E. Revisiting loxapine: a systematic review. Ann Gen Psychiatry. 2015 Apr 1;14:15. (7) Kasper S, Baranyi A, Eisenburger P, Erfurth A, Ertl M, Frey R, Hausmann A, Kapfhammer HP, Roitner-Vitzthum E, Winkler D. Konsensus-Statement: Die Behandlung der Agitation beim psychiatrischen Notfall. CliniCum neuropsy Sonderausgabe November 2013:3-15. (8) Vieta E, Grunze H, Azorin JM, Fagiolini A. Phenomenology of manic episodes according to the presence or absence of depressive features as defined in DSM-5: Results from the IMPACT self-reported online survey. Journal of Affective Disorders 2014, 156, 206-213. (9) Hergueta T, Weiller E. Evaluating depressive symptoms in hypomanic and manic episodes using a structured diagnostic tool: validation of a new Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) module for the DSM-5 'With Mixed Features’ specifier. International Journal of Bipolar Disorders 2013, 1:21 (10) Spyker DA, Munzar P, Cassella JV. Pharmacokinetics of loxapine following inhalation of a thermally generated aerosol in healthy volunteers. J Clin Pharmacol. 2010 Feb;50(2):169-79 Psychopharmaka im Alter Priv.Doz. OA Dr. Michael Rainer Memory Klinik und Karl Landsteiner Institut für Gedächtnis- und Alzheimerforschung im SMZ-Ost Da bereits 20% der Bevölkerung über 65 Jahre alt sind und davon ca. 25% wegen psychischer Probleme therapiebedürftig erscheinen, steigt auch die Notwendigkeit, Psychopharmaka bei Älteren einzusetzen, ständig an. Eine aktuelle Untersuchung in Vorarlberger Pflegeheimen von Fr. Dr. Mann im Jahre 2009 dokumentiere, dass 45,9% der Bewohner mit Antipsychotika, 36.8% mit Antidepressiva, 22,2% mit Anxiolytika und 13,3% mit Hypnotika behandelt werden. Diese Zahlen stimmen in etwa mit den Ergebnissen der Berliner Altersheimstudie sehr gut überein. Ganz allgemein nehmen Psychopharmakaverschreibungen im höheren Alter deutlich zu. Entsprechend dem deutschen Arzneiverordnungsreport aus dem Jahr 2012 (Schwabe und Paffrath) wird 80–84-Jährigen 3–4-mal so viele Psychopharmaka verordnet wie 40–45-Jährigen und ca. 10-mal so viel wie 20–30-Jährigen. Die Polypharmazie ist eines der größten Probleme im Alter. In Deutschland werden dadurch 10.000–60.000 Arzneimitteltote pro Jahr geschätzt, in den USA ca. 100.000 Arzneimitteltote. Bisher gibt es auch keine Studien, die die Wirksamkeit von zusätzlichen Medikamenten bei z.B. 8 vorangegangenen Medikamenten nachweisen. Interessant erscheint hierbei ein Vorschlag eines neues Wertungssystems für Arzneimittel in Bezug auf ihre Alterstauglichkeit: „Fit for the Aged“ (FORTA). Dadurch werden die Extreme des Spektrums berücksichtigt: Welche sind die ungünstigsten Arzneimittel, und welche sind unverzichtbar? Neben dem Wissen um Guidelines, Nebenwirkungsstärken und Dosierungsschemata erfordert die Psychopharmakaverordnung auch Intuition, Integrationsbereitschaft und Kreativität. Antidepressiva (AD) im Alter Bei schweren Depressionen ist die Wirksamkeit von AD in klinischen Studien belegt, jedoch gilt dies nicht für leichte und subsyndromale Depressionen. Die AD-Verschreibung muss immer von psychosozialen und psychotherapeutischen Maßnahmen begleitet sein Bei schweren therapieresistenten Depressionen ist die Wirksamkeit von einer Elektrokrampftherapie gut belegt, und diese sollte nicht erst als Ultima Ratio bei Depressionen mit psychotischen Symptomen, therapieresistenten schweren Depressionen, fortgesetzter Suizidalität und bedrohlicher Malnutrition wegen Nahrungs- und Flüssigkeitsverweigerung eingesetzt werden. Da die Psychopharmakagabe im Alter nebenwirkungsgeleitet ist, müssen Komorbiditäten, Interaktionen und mögliche Kontraindikationen ganz besonders berücksichtigt werden. Für die Wirksamkeit gilt, dass keine der unterschiedlichen Stoffgruppen einen eindeutigen Überlegenheitsnachweis erzielt haben. SSRI’s werden jedoch von den meisten Autoren wegen ihrer guten Verträglichkeit als erste Wahl angesehen. Am häufigsten werden die hochselektiv serotonerg wirkenden Substanzen Citalopram und das S-Enantiomer Escitalopram und Sertralin, das auch noch leicht dopaminerg wirkt, verordnet. In der zuvor erwähnten FORTA-Wertung schneiden diese 3 Substanzen am günstigsten ab, was ihre Alterstauglichkeit betrifft. Dafür verantwortlich ist das äußert geringe Interaktionsrisiko. An Nebenwirkungen sind vor allem gastrointestinale Unverträglichkeiten, Unruhe, Cephalea, Vertigo und Dyssomnie sowie sexuelle Inappetenz und Erektionsstörungen zu erwähnen. Das gefährliche Serotoninsyndrom kommt äußerst selten vor und dann zumeist nur bei Kombinationstherapie (CAVE: MAO-Hemmer und Lithium). Eine häufige Nebenwirkung stellt die Hyponatriämie dar, die bei allen SSRIs auftritt und durch Diuretikagabe verstärkt wird. Von der Gruppe der trizyklischen AD, die zwar gut wirksam sind, aber wegen ihrer Nebenwirkungen nur Medikamente zweiter Wahl darstellen, ist Nortriptylin noch das Trizyklikum mit der besten Verträglichkeit. Von den selektiven Serotonin und Noradrenalin-Reuptake-Hemmern (SNRIs) weisen alle 3 Vertreter bestimmte Vorteile auf. Venlafaxin ist am längsten verfügbar und die Erfahrung am höchsten, Duloxetin konnte sich bei begleitenden Schmerzsyndromen gut etablieren, und Milnacipran wird wegen seines nicht vorhandenen Interaktionspotenzials gerne bei Polypharmazie, Rauchern und Diabetikern verordnet. An Nebenwirkungen der SNRIs sind vegetative Störungen, gastrointestinale Symptomatik, innere Unruhe, Agitiertheit und Cephalea hervorzuheben. Wegen der häufig vorkommenden Schlafstörungen wird gerne auf Mirtazapin, ein noradrenerg und spezifisch serotonerges AD mit einer Alpha2-Adrenozeptor-antagonistischen Wirkung zurückgegriffen. Sexuelle Funktionsstörungen sind nicht beschrieben, und auch agitiert-depressive PatientInnen können von einer Verordnung profitieren. Häufig kommt es zur Appetit- und Gewichtszunahme, sehr selten zu einer reversiblen Knochenmarkdepres- 37 Tabelle 1 Relative Nebenwirkungsstärke selektiver Antidepressiva beim älteren Patienten Substanzgruppe Wirkstoff Anticholinerge Sedierung Wirkung Insomnie/ Agitation Orthostase SSRI Citalopram Fluoxetin Paroxetin Sertralin 0,5 0 2 0 ASRI Escitalopram SNRI Duloxetin Milnacipran Venlafaxin retard Andere TCA EKGGITVeränderung Störung Gewichtszunahme SexualStörung 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1,5 3 3 3 0 0 0–0,5 0 2 3 3 2 0,5 0,5 0,5 0 0 1 0 2 0,51 0,51 0,51 0 0 0,5 2 2 2 0 0 0 0,5 0,5 0,5 2 2 3 0 0 0 1 0 1 Agomelatin Bupropion Mirtazapin Trazodon Venlafaxin 0 0 0,5–1 0 0,5 0 0 4 3 0,5 0 2 0,5 0 2 0 0 0,5 2 0 0 0,5 0 1 0,5 22 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 Amitriptylin Nortriptylin 4 1 4 2 0,5 0,5 4 1 3 2 0,5 0,5 4 2 2 2 1) Pseudocholinerge noradrenerge Wirkung (Mundtrockenheit, Obstipation, Schwitzen); 2) Transaminasenerhöhung Legende: 0=nicht vorhanden; 0,5=minimal; 1=mäßig; 1,5=mittelmäßig; 2=signifikant; 3=mäßig erhoht; 4=hoch Quelle: Rainer & Anditsch, 2005 38 sion. Wegen orthostatischen Dysregulationen kann eine Anfangsdosis von 7,5 bis 15mg sinnvoll sein. Auch der Serotoninantagonist und Reuptake Hemmer Trazodon (SARI) wird sehr gerne wegen seiner Wirkung sowohl bei Schlafstörungen und gegen Agitation als auch seiner anxiolytischen Wirkung aufgrund des 5HT2CAntagonismus und in höherer Dosierung zur Behandlung von Depressionen im Alter eingesetzt. Trazodon ist auch für die meisten neuropsychiatrischen Symptome bei Demenz wirksam und wird von der österreichischen Alzheimergesellschaft empfohlen. Bei anhedonen und depressiv gehemmten, sowie antriebsgestörten AlterspatientInnen hat sich auch der kombinierte selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer Bupropion bewährt. An Nebenwirkungen sind Agitation, Dyssomnie, Blutdruckanstiege und Senkung der cerebralen Krampfschwelle zu erwähnen. Epileptische Anfälle sind eine relative Kontraindikation, ebenso schwere Leber- und Nierenfunktionsstörungen. Der MAO-Hemmer Moclobemid weist auch bei älteren PatientInnen im Allgemeinen eine gute Verträglichkeit auf, und Blutdruckspitzen sind nicht so wie bei älteren MAO-Hemmern (z.B. Tranylcypromin) zu erwarten. Die diätetischen Einschränkungen gelten für Europa kaum. Die Kombination mit SSRI’s oder Sumatriptan ist wegen eines gesteigerten Serotoninsyndromrisikos zu meiden. Die melatonerge Substanz Agomelatonin ist sehr gut verträglich und kann auch bei älteren PatientInnen gut eingesetzt werden. Interessant ist die innovative, multimodal wirkende Substanz Vortioxetin. Vortioxetin vereint zwei Wirkmechanismen und wirkt an sechs pharmakologischen Zielstrukturen. Es wirkt hemmend am Serotonintransporter mit einem Agonismus am 5HT1A-Rezeptor, zeigt einen partiell agonistischen Effekt am 5HT1B-Rezeptor und einen Antagonismus an weiteren drei 5HT-Rezeptoren. Neben der guten Akut- und Langzeitwirkung dürfte eine gute Verträglichkeit vorliegen. Besonders interessant wird dieses AD durch die Verbesserung der so häufig anzutreffenden kognitiven Störungen. Für die Langzeitprognose ist vor allem die Verbesserung der Kognition beim Alterspatienten wesentlich. Zurzeit liegen allerdings noch zu wenig praktische Erfahrungen mit Vortioxetin vor. An Fehlern bei der AD-Therapie im Alter seien eine zögerliche Initiierung, zu niedrige Dosierung, zu frühe Umstellungen, sich widersprechende Kombinationstherapien, Nichteinsatz von psychosozialen Maßnahmen und das Nicht-Erkennen von Demenzerkrankungen, sowie der unkritische Einsatz von Benzodiazepinen erwähnt. Sollten Benzodiazepine unbedingt benötigt werden, so werden wegen der linearen Pharmakokine- tik Lorazepam und Oxazepam bevorzugt. Für Schlafstörungen kommen die neueren Hypnotika mit geringerem Suchtpotenzial wie z.B. Zolpidem und Zopiclon in Frage. Indikationen für Benzodiazepine sind vor allem Suizidalität und sehr stark agitierte Depressionen. Häufig sind Depressionen auch mit Angststörungen kombiniert. Dies ist oftmals eine Indikation für Pregabalin. Zumeist wird Pregabalin in der Dosis von 75mg pro Tag initiiert und nach einer Woche auf 150mg pro Tag gesteigert. Augmentationstherapien kommen bei Versagen einer Initialtherapie und einer adäquaten Dosissteigerung, nach Serumkonzentrationsmessungen und Versagen einer anderen Therapiestrategie in Frage. Die Lithiumaugmentation ist bei Jüngeren gut belegt, bei Älteren müssen unbedingt die Kontraindikationen wie Schilddrüsenerkrankungen, Diuretika und Niereninsuffizienz beachtet werden. Das Therapiemonitoring muss engmaschiger erfolgen. Als Alternative hat sich zuletzt Lamotrigin gut bewährt. Nachteil bei älteren PatientInnen ist die kaum vorhandene Datenlage und die lange Aufdosierungsdauer, bis die Zieldosis von 200mg pro Tag erreicht wird. Die Augmentation mit Pregabalin ist vor allem bei begleitender Angstsymptomatik und bei Insomnie sinnvoll. Die Höchstdosis beträgt im Allgemeinen 225mg pro Tag. Auch an die vorsichtige Verordnung von Thyroxin und Modasomil kann gedacht werden. AD dürfen nicht zu schnell abgesetzt werden, generell gilt der Grundsatz „One must be patient with the patient“. Auch bei Remission sollte die Therapie über mindestens 1 Jahr weitergeführt werden. Liegen mehrere depressive Episoden vor, so werden mehr als 3 Jahre angeraten. Bei bipolar-affektiven Störungen ist auch im Alter Lithium das Mittel erster Wahl. Durch die vielen Kontraindikationen ist Lithium allerdings deutlich limitiert. Gute Alternativen sind Quetiapin (Zieldosis 200mg pro Tag), Lamotrigin (200mg pro Tag) und Valproinsäure (1000mg pro Tag). Carbamazepin ist durch sein Nebenwirkungsspektrum, die hepatische Enzyminduktion und Kognitionsbeeinträchtigungen nur Mittel zweiter Wahl. Antipsychotika (AP) im Alter 1. AP bei Demenz Bereits vor 10 Jahren gab es durch die FDA eine spezielle Warnung vor breiter Anwendung von atypischen Antipsychotika bei Demenz. In 17 randomisierten klinischen Studien wurde ein erhöhtes Mortalitätsrisiko 39 Tabelle 2 Antipsychotika: Dosierungsempfehlungen bei Älteren Substanz Einsatz bei Demenz Einsatz bei Schizophrenie Startdosis (mg/d) Zieldosis (mg/d) Dosis (mg/d) Risperidon (1. Wahl) 0,25 bis 2 1,5 bis 2 1,25 bis 3,5 Olanzapin (2. Wahl) 1,25 bis 5 10 7,5 bis 15 Quetiapin (2. Wahl) 12,5 bis 50 200 bis 300 100 bis 300 Aripiprazol (2. Wahl) 5 15 15 bis 30 Clozapin 12,5 75 bis 100 Keine generelle Empfehlung Haloperidol 0,25 bis 0,5 2 Keine generelle Empfehlung nach APA, 2007 & Prof. Leuner, 2013 Tabelle 3 Antipsychotika: Dosierungsempfehlungen bei Älteren Substanz Bei Delir Dosierung (mg/d) Kommentar Bei Depression mit psychotischen Symptomen Dosierung (mg/d) Bei Manie Dosierung (mg/d) Risperidon 1 bis 2x 0,25 bis 1mg Off-Label-Use erhöhte kardiovaskuläre Mortalität 0,75 bis 2,25mg (1. Wahl) 1,25 bis 3mg Olanzapin 1x 2,5 bis 5mg idem 5 bis 10mg (2. Wahl) 5 bis 15mg (1. Wahl) Quetiapin 1 bis 2x 25 bis 50mg idem 50 bis 200mg 50 bis 250mg Haloperidol 2 bis 4x 0,5 bis 1mg peroral, Peak-Effekt nach 4 bis 6 Stunden, 1x 0,5 bis 1mg i.m. Peak-Effekt nach 20 bis 40 Minuten Zugelassen, vorteilhaft bei unklarer Delirursache oder unklarer Vorerkrankung nach APA, 2007 & Prof. Leuner, 2013 40 gegenüber Placebo um den Faktor 1,6 bis 1,7 dokumentiert. Auch die konventionellen Antipsychotika weisen eine erhöhte Mortalitätsrate auf. Vor allem Pneumonien in der ersten Woche der Behandlung und kardiovaskuläre Erkrankungen, wie Herzversagen und plötzlicher Herztod, sowie Infektionen sind die Haupttodesursachen. Die sich bei der Antipsychotikagabe oft entwickelnde Immobilität trägt sehr zur erhöhten Infektionsneigung und Pneumoniebereitschaft bei. QTc-Zeitverlängerungen können zu Herzrhythmusstörungen führen. In der Cathie-AD-Studie (Clinical Antipsychotic trial of Intervention effectivity) wurden atypische Antipsychotika im Hinblick auf die Hirnleistungsfähigkeit bei Alzheimerpatienten überprüft. Hierbei zeigten sowohl Risperidon, als auch Quetiapin und Olanzapin einen erhöhten Hirnleistungsabbau. Andererseits konnten sowohl für Risperidon, Olanzapin, Quetiapin und für Aripiprazol in mehreren klinischen Studien signifikante Wirksamkeiten gegen Agitation und Aggressivität nachgewiesen werden. Die Agitation verschlechtert häufig den Gesamtzustand bei einzelnen Demenzformen, und deshalb sind atypische Antipsychotika effektiv – auch wenn ihre Verwendung Off-Label erfolgt. Nur Risperidon ist für schwere Verhaltensstörungen bei Demenz für einen kurzen Zeitraum von max. 6 Wochen zugelassen. Danach sollte bei allen Antipsychotika immer wieder ein Reduktions- oder Absetzversuch durchgeführt werden. Ein 2012 durchgeführtes Review der Wirksamkeit von atypischen Antipsychotika bei Demenz stellte fest, dass sowohl Olanzapin, Aripiprazol und Risperidon eine mittelgradige bis hohe Effizienz bei Agitation zeigten. Die Wirksamkeit gegen ständiges Wandern, stereotype Bewegungsmuster, Schreien und Apathie ist unzureichend. Interessant ist der Blick auf die Effektstärke. Antipsychotika-behandelte Patienten verbesserten sich in 48–65%. Placebo-behandelte Patienten in 30–48%. Die Effektstärke ist mit einem mittleren Behandlungseffekt von 18% und einer Number needed to treat (NTT) von 5-14% gering. Auf der anderen Seite stehen die bekannten Nebenwirkungen wie erhöhte zerebrovaskuläre Ereignisse, extrapyramidal-motorische Symptomatik, metabolisches Syndrom, erhöhte Sturzneigung und QTc-Zeitverlängerungen. 2. AP bei Delir Delirien und wahnhafte Störungen begleiten oftmals Demenzsyndrome. Lange Zeit war dafür Haloperidol das geeignete Antipsychotikum. Wegen der neurologischen Nebenwirkungen wie z.B. Rigor und Schluck- störungen, werden Atypika bevorzugt. Risperidon, Olanzapin und Quetiapin zeigen das gleiche Effizienzprofil wie Haloperidol, ohne die typischen Nebenwirkungen aufzuweisen. Auch an Aripriprazol kann gedacht werden. Für Ziprasidon ist ein erhöhtes Risiko von Arrhythmien dokumentiert. Für die Behandlung der Parkinson-Psychose eignen sich am besten Quetiapin und Clozapin. Clozapin sollte jedoch nur von Spezialisten verordnet werden, da schwerwiegende Nebenwirkungen, wie Agranulozytose und Myokarditiden beschrieben sind und strenge Verschreibungsrichtlinien bestehen. Als Alternative zu Antipsychotika kommen Antidepressiva wie z.B. Citalopram, das in einer aktuellen Studie von Porsteinson eine 40%-ige Agitationsverminderung bewirkte und Antiepileptika wie Carbamazepin und Valproinsäure in Frage. Deren erhöhtes Interaktionsrisiko und Nebenwirkungen limitieren jedoch wieder eine allgemeine Empfehlung. Nur bei therapierefraktärer Aggressivität sollte Carbamazepin eingesetzt werden. Ca. 30% der über 65ig-Jährigen erleiden nach einer stationären Aufnahme durch einen Schlaganfall, Infektionen oder nach Operationen ein Delir. Manchmal ist eine Polypharmazie die Ursache, oft bleibt die Ursache aber ungeklärt. Das häufige anticholinerge Delir sollte durch Absetzen von anticholinerg wirkenden Medikamenten ersttherapiert werden. Können die Ursachen nicht beseitigt werden, kommen Antipsychotika zum Einsatz. In einem Cochrane-Review zeigten die Substanzen Risperidon und Olanzapin gegenüber Haloperidol einen leichten, aber nicht signifikanten Vorteil. Durch die erhöhte EPS-Gefahr von Haloperidol wird den Atypika der Vorzug gegeben. Risperidon ist meistens das Mittel der ersten Wahl, gefolgt von Olanzapin und Aripiprazol. In der Spitalspraxis wird Haloperidol noch immer wegen der fehlenden anticholinergen Nebenwirkungen, des schnellen Anflutens und der guten Steuerbarkeit eingesetzt. Die i.v.-Gabe ist allerdings mit einem erhöhten Tachyarrhythmierisiko verbunden und sollte vermieden werden. Eine gute Alternative könnte hier Benperidol sein. 3. AP bei Schizophrenie Es liegen für die Behandlung von Spätschizophrenie mehrere Experten-Konsensus-Guidelines vor. Risperidon in einer Dosierung von 1,25mg bis 3,25mg pro Tag gilt als Therapie der ersten Wahl für die Spätschizophrenie. Auch Quetiapin (100–300mg pro Tag), Olanzapin (7,5–15mg) pro Tag und Aripiprazol (15–30mg pro Tag) sind günstige Behandlungsalternativen. Bei Diabetes, Dyslipidämie oder Adipositas sollten Olanzapin und Clozapin aber unbedingt vermieden werden. Risperidon ist am besten dokumentiert. Dieses sollte zuerst oral in einer Dosierung von 0,5mg–3mg pro Tag verordnet werden. Es gilt als sicher und effektiv bei Patienten mit Schizophrenie und schizoaffektiver Störungen. Der positive Effekt auf die Hirnleistungsfähigkeit ist durch das Nichtvorhandensein einer antimuskarinergen Aktivität belegt. Auch Olanzapin in der Dosierungshöhe von 25mg pro Tag wird im Allgemeinen gut vertragen. Quetiapin wird sehr gerne wegen des günstigen Nebenwirkungsspektrums und der fehlenden cerebrovaskulären Nebenwirkungen verschrieben. Es liegt allerdings eine limitierte Effizienz gegen die psychotische Symptomatik im Vergleich zu Placebo vor. Auch muss die alpha-1-blockierende Wirkung, und eine dadurch erhöhte Sturzgefahr, vor allem in Kombination mit anderen zentral wirkenden Substanzen erwähnt werden. Sehr günstig ist Quetiapin bei Patienten mit Parkinson-Psychose. Ziprasidon kann oral und intramuskulär verabreicht werden und zeigte seine Effektivität sowohl auf die Positiv- als auch Negativsymptomatik. Auch Aripiprazol zeigte in Studien eine deutliche Wirksamkeit gegen Positiv- und Negativsymptomatik und erhöhte die Zeit bis zu einem Rückfall. In dieser Studie wurden 15mg Aripiprazol pro Tag verwendet. Paliperidon ist eine neue antipsychotische Substanz. In einer placebokontrollierten 6-Monatsstudie bei 70-jährigen Patienten zeigte sich eine gute Sicherheit und Toleranz. Clozapin wird zumeist nur bei therapieresistenter Schizophrenie oder als Mittel der letzten Wahl wegen seiner vorzüglichen antipsychotischen Wirkung verwendet. 4. AP bei affektiven Störungen Schwere depressive Episoden sind bei ca. 20% von Psychosen begleitet. Hierbei ist die Monotherapie mit einem Antidepressivum nicht ausreichend und deshalb nicht empfehlenswert. Eine Kombinationstherapie aus Antidepressivum und Antipsychotikum ist indiziert. Als erste Wahl kommt Risperidon in Frage, zweite Wahl sind Olanzapin und Quetiapin. Auch Aripiprazol konnte in einer kleinen Studie in der Dosierungshöhe 2,5–15mg die Depression signifikant verbessern. In einer anderen Studie zeigte die Kombination Olanzapin und Sertralin eine höhere Remissionsrate gegenüber Olanzapin und Placebo nach 12 Wochen (42% vs. 24%). Die Gewichtszunahme und Hyperglykämie waren typische Nebenwirkungen bei jüngeren Patienten. Für eine Augmentationstherapie kommt auch Aripiprazol in Frage. Die Hinzugabe von Aripiprazol 5mg 41 zeigte signifikante Reduktionen der depressiven und manischen Symptomatik bei Patienten mit Bipolar-IStörung. Die manische Symptomatik konnte bei älteren bipolar gestörten Patienten durch eine Monotherapie mit Quetiapin (400–800mg pro Tag) signifikant reduziert werden. Ist die Anamnese zu einer bipolaren Störung negativ und tritt die manische Symptomatik erstmals im höheren Alter auf, so sollte man primär an eine Frontalhirndemenz oder an eine substanzinduzierte Manie denken. Bei Hirnorganizität muss die Antipsychotikagabe dementsprechend vorsichtiger erfolgen. Bei manischer Symptomatik mit psychotischem Erleben basierend auf einer bipolaren Störung können sowohl Risperidon, als auch Olanzapin in Kombination mit einem Mood-Stabilizer, wie Valproinsäure empfohlen werden. Manien und depressive Episoden ohne psychotisches Erleben, die im Rahmen von bipolaren Störungen auftreten, sollten nur mit einem Stimmungsstabilisierer in Monotherapie behandelt werden. Zur Rezidivprophylaxe manischer Episoden sind neben Quetiapin auch Olanzapin und Aripiprazol in der Behandlung zugelassen. Quetiapin dient auch zur Vorbeugung depressiver Episoden. Allerdings ist die Wirksamkeit derartiger Antipsychotika bei älteren Patienten nicht nachgewiesen. In der Prophylaxe von depressiven Episoden wird neben Valproinsäure und Lamotrigin nur Olanzapin als Mittel der ersten Wahl empfohlen. Für ältere Patienten mit bipolaren Störungen haben sich Aripiprazol, Quetiapin und in letzter Zeit auch Asenapine als effektiv erwiesen. 42 Abschließend sollte noch einmal betont werden, dass gerade ältere Patienten ein erhöhtes Risiko für antipsychotikabedingte Nebenwirkungen aufweisen. Der Grund dafür sind die altersbedingten Veränderungen der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, die begleitende medizinische Co-Morbidität, die Polypharmazie sowie die zahlreichen potenziellen Medikamentenwechselwirkungen. Deshalb bestand die FDA in den USA bereits vor 10 Jahren auf eine Black-Box-Warning, die für alle Antipsychotika das potenzielle Risiko für cerebrovaskuläre Ereignisse und eine erhöhte Mortalität unterstreicht. Auch die metabolischen Nebenwirkungen sind extrem gefährlich. Verbunden sind diese mit einer erhöhten Adipositas, reduzierter Insulinsensitivität und einem veränderten Plasma-, Glukose- und Lipidspiegel. Clozapin und Olanzapin führten hierbei zu der höchsten signifikanten Gewichtszunahme. Hingegen zeigten Risperidon, Quetiapin, Amisulprid und Zotepin nur geringe Gewichtszunahmen. Die kombinierte Gabe mit Cholinesterasehemmern zeigte ein leicht erhöhtes Risiko für Myokardinfarkte, das allerdings zeitlich limitiert war. QTc-Verlängerungen und Hypotonie waren abhängig von der Antipsychotikaklasse, der Dosierung und den Interaktionen mit anderen Medikamenten. Auch, vor allem in der ersten Woche, auftretende Pneumonien, tiefe Beinvenenthrombosen und Blutbildveränderungen zählen zu den potenziellen Risiken einer Antipsychotikabehandlung. Die Behandlung mit atypischen Antipsychotika ist auch für ältere Patienten sehr wichtig, jedoch sollte die Verschreibung mit der niedrigsten effektivsten Dosierung über die kürzest mögliche Zeitdauer erfolgen, sowie eine vernünftige Balance zwischen den Vorteilen und Risiken hergestellt werden, die Patienten engmaschig monitoriert werden und die Lebensqualität von Patienten und Betreuern stets im Auge behalten werden, da der Erfolg mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten oft sehr bescheiden ist. Quellen (Auszug) Jacobson S, et al. Clinical Manual of Geriatric Psychopharmacology, Am. Psych. Publishing, 2007. Kasper S, Rainer M, et al. Psychopharmakotherapie beim älteren und hochbetagten Mensch, Konsensus-Statement-State of the Art 2014, Clinicum Neuropsy. Wehling M, Burkhardt H. Arzneitherapie für Ältere, Springer, 2011 Transgender Projekt am AKH: Der Einfluss von gegengeschlechtlicherHormontherapie auf die Struktur und Funktion des Gehirns Marie Spies, Georg Kranz, Siegfried Kasper, Rupert Lanzenberger Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Abteilung für Biologische Psychiatrie Einleitung Klinische Studien zeigen eindeutige Geschlechtsunterschiede in der Häufigkeit, Ausprägung, Symptomatik und Therapie verschiedener psychiatrischer Erkrankungen. Zum Bespiel konnte gezeigt werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern ein zweifach erhöhtes Risiko aufweisen, an einer Angststörung zu erkranken. Weiters sind depressive Erkrankungen bei Frauen häufiger, während Männer öfters an Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis oder an der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung leiden [1]. Geschlechtsunterschiede in der klinischen Manifestation psychiatrischer Erkrankungen werden, neben genetischen und sozialen Einflüssen, auf die Wirkung von Geschlechtshormonen auf das Gehirn zurückgeführt. Ein ausführliches Verständnis für die Einflüsse von Geschlechtshormonen auf psychiatrische Symptome stellt auch eine Grundlage für mögliche therapeutische Interventionen dar. Zum Beispiel weisen die Ergebnisse von Tierstudien und Studien am Menschen auf eine antidepressive Wirkung von Östrogenen als auch Androgenen hin [2]. Die Psychoendokrinologie, insbesondere die Erforschung der Einflüsse von Geschlechtshormonen auf das menschliche Gehirn, ist somit ein zukunftsträchtiges Forschungsgebiet mit einem hohen Potential für klinische Anwendbarkeit. Bisher konnten neurowissenschaftliche Studien einen Einfluss von Östrogen auf Verhaltenskorrelate neurobiologischer Funktionen, unter anderem auf Sensorik [3], Emotionsverarbeitung und Gesichtererkennung [4], visuelle Gedächtnisleistung [5] und sprachliche Leistung [6] nachweisen. Ein Einfluss von Testosteron auf das räumliche Vorstellungsvermögen ist ebenfalls bekannt [7]. Die Magnetresonanztomographie (MRT) erlaubt neben strukturellen Messungen auch die Erfassung funktioneller Daten, die Rückschlüsse auf Gehirnaktivität und funktionelle Konnektivität von Gehirnregionen ermöglichen. Um die neuronalen Aktivierungsmuster, die spezifischen kognitiven und emotionalen Funktionen zugrunde liegen, zu untersuchen, werden von den untersuchten Individuen während der funktionellen MRT (fMRT) spezifische Paradigmen durchgeführt. Geschlechtshormone beeinflussen auch die Aktivierungsmuster verschiedener kognitiver und emotionaler Prozesse. Zum Beispiel konnte ein Einfluss des Progesteronspiegels auf Amygdala-Aktivierung während einer emotionalen Gesichtererkennungsaufgabe in gesunden jungen Frauen gezeigt werden [8]. Eine andere Studie zeigte bei Frauen im mittleren Lebensalter einen Einfluss von Testosteron auf emotionsbezogene Amygdala-Aktivität [9]. Es gibt eine Vielzahl von Studien zum Einfluss von Geschlechtshormonen auf die Struktur und Funktion des Gerhirns, die Ergebnisse sind jedoch teilweise widersprüchlich. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass zusätzlich zu dem Geschlecht und den Geschlechtshormonen auch geschlechtsassoziierte Faktoren wie soziale Einflüsse, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, die jeweilige Studienaussage beeinflussen können. Bei Transgender-Personen die eine gegengeschlechtliche Hormontherapie bekommen sind diese Faktoren teilweise diskordant. Eine derartige Probandengruppe ermöglicht es, den Einfluss von Geschlechtshormonen, Geschlecht, und anderen assoziierten Faktoren differenziert zu untersuchen. Studie An der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie wurde eine Studie durchgeführt, in der mittels MRT der Einfluss von gegengeschlechtlichen Hormonen auf das menschliche Gehirn bei TransgenderPersonen untersucht wurde. Untersucht wurden Mann-zu-Frau (MzF)- und Frau-zu-Mann (FzM)-Transgender-Personen sowie Kontrollprobanden. Im Rahmen des Studieneinschlusses erfolgte eine umfassende Screening-Untersuchung zum Ausschluss internistischer oder neurologischer Erkrankungen. Neben einer sorgfältigen körperlichen und apparativen Untersuchung sowie einer Blutabnahme wurde auch eine neuropsychologische Testung durchgeführt. Diese bestand aus einem standardisierten klinischen Interview nach DSM-IV (SCID-I, SCID-II) zur Erfassung psychiatrischer Erkrankungen. Aufgrund der hohen Lebens- 43 zeitprävalenz von Depression und Angsterkrankungen bei Transgender-Personen wurde eine frühere derartige Symptomatik nicht als Ausschlussgrund gewertet. Weitere Tests dienten der Erfassung von emotionalen und sozialen Faktoren wie Empathie und Affekt und von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Entsprechende Parameter wurden in die Auswertung mit einbezogen. Transgender wird, um Stigmatisierung zu minimieren, von DSM-V als Geschlechts-Dysphorie bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch den anhaltenden und starken Wunsch, als das andere Geschlecht zu leben und akzeptiert zu werden (ICD-10). Dieser Wunsch ist häufig mit einem starken Leidensdruck verbunden. Transgender-Individuen streben daher Therapien an, die den Körper an das Wunschgeschlecht anpassen. Hierzu gehört unter anderem die gegengeschlechtliche Hormontherapie. In Rahmen unserer Studie erhielten die Transgender-Teilnehmer eine den internationalen Empfehlungen angepasste gegengeschlechtliche Hormontherapie. MzF erhielten Estradiol/Estradiolhemihydrat und/oder ein GnRH-Analogon (Triptorelinacetat oder Leuprorelinacetat). MzF Teilnehmer konnten auch einen 5-Alpha-Reduktase Hemmer (Finasterid), der dem Haarverlust durch den therapieassozierten Androgenabfall entgegenwirken soll, einnehmen. FzM-Teilnehmer erhielten Testosteron oder Testosteronundecanoat. Um ein Sistieren der Menstruation zu unterstützen, konnte zu Beginn ein Gestagen (Lynestrenol oder Desogestrel) eingenommen werden. Die Therapie wurde von der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie der Univ.Klinik für Frauenheilkunde betreut. Die Studie bestand aus insgesamt drei MRT-Untersuchungen. Die erste Messung erfolgte vor Beginn der gegengeschlechtlichen Hormontherapie, die zweite und dritte jeweils vier Wochen und vier Monate nach Beginn der Hormontherapie. Im Rahmen der Bildgebung wurden strukturelle Untersuchungen durchgeführt. Zusätzlich wurde bei der Auswertung ein spezielles Augenmerk auf die strukturelle Konnektivität zwischen Gehirnregionen, die aus diffusionsgewichteten Aufnahmen erfasst wird, sowie Veränderungen der grauen Substanz gelegt. Weiters wurden fMRT-Daten erhoben. Es wurden Paradigmen zur Erfassung von neuronaler Aktivität, die mit emotionaler Verarbeitung, Empathie, Risiko und Belohnungsverhalten, Motorik, räumlicher Vorstellungskraft, und Geschlechtsidentifizierung assoziiert ist, durchgeführt. Zu den Untersuchungsterminen wurden Blutabnahmen zur Hormonspiegelbestimmung und neuropsychologische Tests durchgeführt, um Korrelationen mit Bildgebungsdaten zu ermöglichen. 44 Erste Resultate Eine erste Datenauswertung zeigte einen Einfluss von Geschlechtshormonen auf die weiße Substanz. Weibliche Kontrollprobanden zeigten eine signifikant höhere mittlere Diffusivität im Vergleich zu TransgenderPersonen und männlichen Kontrollprobanden, was auf deutliche Gruppenunterschiede in der Mikrostruktur der Faserverbindungen zwischen Hirnregionen hindeutet. [10]. FzM- und MzF-Transgender-Personen nahmen eine Mittelstellung zwischen beiden Kontrollgruppen ein. Diese Ergebnis unterstützt frühere Studien, die postulieren, dass die Entwicklung der weißen Substanz vom prä- und unmittelbar postnatalen hormonellen Milieu beeinflusst wird [11]. Weiters konnte in einer longitudinalen Auswertung gezeigt werden, dass es durch Testosterongabe im Rahmen der gegengeschlechtlichen Hormontherapie zu Veränderungen der grauen Substanz von Spracharealen und der Verbindungen zwischen diesen Regionen kommt. Diese Studie gibt Hinweise auf einen Einfluss von Testosteron auf neuroplastische Prozesse auch im Erwachsenenalter [12]. Details und Literatur zum Projekt sind beim Studienleiter Assoc.Prof. PD Dr.med. Rupert Lanzenberger erhältlich: http://www.meduniwien.ac.at/neuroimaging/ Literatur 1. Young LJ, Pfaff DW. Sex differences in neurological and psychiatric disorders. Frontiers in neuroendocrinology, 2014:35(3):253‐4 2. Joffe RT. Hormone treatment of depression. Dialogues Clin Neurosci 2011;13(1):127-38 3.Akar Y, Yucel I, Akar ME, et al. Menstrual cycle-dependent changes in visual field analysis of healthy women. Ophthalmologica 2005;219(1):305 4. Derntl B, Windischberger C, Robinson S, et al. Facial emotion recognition and amygdala activation are associated with menstrual cycle phase. Psychoneuroendocrinology 2008;33(8):1031-40 5. Phillips SM, Sherwin BB. Variations in memory function and sex steroid hormones across the menstrual cycle. Psychoneuroendocrinology 1992;17(5):497-506 6. Rosenberg L, Park S. Verbal and spatial functions across the menstrual cycle in healthy young women. Psychoneuroendocrinology 2002;27(7):83541 7. Martin DM, Wittert G, Burns NR, McPherson J. Endogenous testosterone levels,mental rotation performance, and constituent abilities in middle-to-older aged men. Horm Behav 2008;53(3):431-41 8. van Wingen GA, van Broekhoven F, Verkes RJ, et al. Progesterone selectively increases amygdala reactivity in women. Mol Psychiatry. 2008;13(3):325-33 9. van Wingen GA, Zylicz SA, Pieters S, Mattern C, Verkes RJ, Buitelaar JK, Fernández G. Testosterone increases amygdala reactivity in middle-aged women to a young adulthood level. Neuropsychopharmacology 2009;34(3):539-47 10. Soares, J.M., Marques P, Alves V, Sousa N. A hitchhiker's guide to diffusion tensor imaging. Front Neurosci. 2013;7:31 11. Kranz GS, Hahn A, Kaufmann U, et al. White matter microstructure in transsexuals and controls investigated by diffusion tensor imaging. J Neurosci 2014;34(46):15466-75 12. Hahn, et al., Testosterone affects language areas of the adult human brain. In submission. 45 Non-invasive Hirnstimulation in der Therapie psychiatrischer Erkrankungen Mag. Dr. Georg S. Kranz Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, MedUni Wien Einleitung: TMS in der Psychiatrie Die Transkranielle Magnetstimulation (TMS) hat in den letzten Jahren in der Psychiatrie zusehends an Bedeutung gewonnen. War sie zu Beginn ihrer Entwicklung Mitte der 1980-er Jahre noch vorwiegend als diagnostisches Instrument der Neurologie eingesetzt, so wurde ihr therapeutischer Nutzen bereits wenige Jahre später im psychiatrischen Kontext erprobt [1, 2]. Seit 2014 liegen nun ausreichend Daten vor, die es einer europäischen Expertengruppe erlaubten, konkrete Empfehlungen für die Verwendung von TMS bei den wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen auszusprechen [3]. Angesichts der hohen Prävalenzraten – neuesten Schätzungen zufolge leiden jedes Jahr knapp 40% der EU-Population (das entspricht 164 Millionen Menschen) an einer psychiatrischen Erkrankung [4] – ist die TMS eine willkommene und langersehnte Behandlungsalternative im Fundus psychiatrischer Therapiestrategien. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der TMS in der Psychiatrie, widmet sich der Vortrag im Wesentlichen der Bedeutung von repetitiver TMS (rTMS) bei Majorer Depression und Symptomen der Schizophrenie, wobei auf die jeweils zugrunde liegenden neurobiologischen Erklärungsmodelle der Erkrankungen und ihrer Behandlung, sowie der spezifischen Behandlungsparameter Bezug genommen wird. 46 I. TMS-Grundlagen Ein TMS-Gerät besteht aus einem Stromimpulsgenerator, der in der Lage ist, Strom von mehreren Tausend Amper zu produzieren, und einer Spule, durch welche der Strom fließt und damit kurze Impulse von bis zu 3 Tesla magnetischer Flussdichte generiert. Platziert über dem Kopf, wird ein elektrisches Feld induziert, welches ausreicht, um oberflächliche Axone zu depolarisieren und neuronale Netze des Kortex zu aktivieren. Die Wirkung des so generierten Stromflusses auf das neuronale Substrat wird durch eine Reihe von physikalischen und biologischen Parametern bestimmt. Einflussgrößen stellen etwa die Art und Orientierung der verwendeten Spule dar, die Distanz zwischen Spule und Hirn, die Wellenform des magnetischen Impulses, die Intensität, Frequenz und das Muster der Stimulation, sowie die Orientierung und Struktur des angeregten neuronalen Gewebes. Repetitive TMS mit einer Frequenz ≤ 1 Hz hemmt das neuronale Gewebe, während Frequenzen >1 Hz in der Regel zu einer Fazilitation der Nervenzellen führen. Mittlerweile existiert eine Reihe von TMS-Paradigmen zur Modifikation der kortikalen Erregbarkeit, die sich durch Variationen der Stimulationsintensität, sowie Anzahl und Dauer der applizierten Impulse unterscheiden. II. rTMS bei Depression Die Majore Depression stellt mit über 30 Millionen Betroffenen pro Jahr eine der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen in Europa dar [4]. Eine Vielzahl biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren, sowie Kombinationen und Interaktionen dieser Einflussgrößen werden als Ursache der Depression diskutiert. Auf biologischer Seite – und für die TMS-Behandlung grundlegend – steht die Annahme einer reduzierten kognitiven Kontrolle emotionsverarbeitender limbischer Strukturen durch den linken präfrontalen Kortex. Unzureichende präfrontale Aktivität bei Depression, besonders des dorsolateralen präfrontalen Kortex (DLPFC), konnte durch mehrere Studien untermauert werden, etwa anhand reduzierten Glucose- und Sauerstoffverbrauchs, oder in Form eines verringerten zerebralen Blutflusses. TMS-Forscher versprachen sich daher positive Resultate einer hochfrequenten und damit „exzitatorischen“ rTMS über dieser Hirnregion. In der Tat weisen Meta-Analysen auf positive und klinisch relevante antidepressive Effekte hin (z.B. 5, 6), und rTMS ist über dem linken DLPFC bei behandlungsresistenter Depression bereits seit 2008 durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. Basierend auf dem Konzept der frontalen Asymmetrie kortikaler Aktivität bei Depression wurde neben hochfrequenter rTMS über dem linken DLPFC auch die Anwendung niederfrequenter rTMS über dem rechten DLPFC untersucht. Die überwiegende Mehrzahl an positiven klinischen Resultaten liegt allerdings für hochfrequente linkshemisphärische rTMS vor, sodass deren Wirksamkeit mit einer Effektstärke von 0.87 bei unipolarer Depression heute als gesichert angesehen wird (Empfehlungsstufe A) [3]. Typische Behandlungsparameter für linksseitige rTMS sind 20–40 minütige Einheiten pro Wochentag über einen Zeitraum von 3–8 Wochen, in denen mit einer Stromstärke von ≥ 100% der motorischen Schwelle 3000–6000 Pulse pro Tag mit einer Frequenz von 10–20 Hz appliziert werden. Allerdings fehlen klare Richtlinien zur Wahl der Stimulationsart, und die Datenlage bezüglich spezifischer Stimulationsparameter ist uneinheitlich. Höhere Erfolgsraten sind in der Regel bei jüngeren Patienten und bei Anwendung während akuter depressiver Episoden zu erwarten. In bislang zwei durchgeführten Vergleichsstudien konnten keine signifikanten Unterschiede in der Effektivität zwischen rTMS und einer psychopharmakologischen Behandlung mit Fluoxetin oder Venlafaxin gefunden werden. III. rTMS bei Schizophrenie Im Rahmen psychotischer Erkrankungen wird rTMS bei der Behandlung auditorischer Halluzinationen, sowie negativer Symptome untersucht. Bildgebungsstudien weisen auf eine Hyperaktivität in Spracharealen während auditorischer Halluzinationen hin. Die Hemmung der Erregbarkeit dieser Regionen durch niederfrequente rTMS gilt daher als erfolgsversprechende Strategie bei behandlungsresistenten auditorischen Halluzinationen. Trotz relativ uneinheitlicher Datenlage konnten einige Meta-Analysen einen signifikanten Effekt von niederfrequenter rTMS über dem linken temporoparietalen Kortex finden, der aber mit zunehmender Aufnahme großer Studien abzunehmen scheint [7]. Derzeit wird daher lediglich von einem möglichen positiven Effekt ausgegangen (Empfehlungsstufe C) [3]. Typische Stimulationsparameter sind niederfrequente Stimulationen von 1 Hz mit einer Stärke von 90% der motorischen Ruheschwelle über einen Zeitraum von ein- bis zwei Wochen. Basierend auf der Annahme einer präfrontalen Dysfunktion als biologische Basis negativer Symptome wurde vorgeschlagen, die kortikale Aktivität mittels hochfrequenter rTMS über dem DLPFC zu erhöhen. Über die kortikale Modulation subkortikaler Strukturen könnte dies zu einer erhöhten Dopaminausschüttung im ventralen Striatum führen. Allerdings zeigen randomisierte klinische Studien (RCTs) ein eher uneinheitliches Bild, sodass die Effektivität von rTMS bei negativen Symptomen bis heute nicht gänzlich gesichert ist. Vor allem angesichts der starken Heterogenität der Patientenprofile wird von einem zwar signifikanten Effekt ausgegangen, dessen klinische Relevanz aber als gering angesehen wird. Nichtsdestotrotz wird wegen der sehr geringen Nebenwirkungen von rTMS und dem derzeitigen Mangel an therapeutischen Optionen für negative Symptome eine Empfehlung der Stufe B ausgesprochen, d.h. von einem wahrscheinlichen positiven Effekt ausgegangen [3]. Übliche Behandlungsparameter sind hochfrequente Stimulationen (1000-2000 Pulse) von 10 Hz mit einer Stärke von ≥ 100% der motorischen Ruheschwelle über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen. IV. Weitere Behandlungsfelder: Angststörungen, Zwangsstörung, Substanzabhängigkeit Zu weiteren Behandlungsfeldern, in denen der Effekt von rTMS experimentell erprobt wird, zählen Angststörungen wie die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD), die Panikstörung und Generalisierte Angststörung, ferner Zwangsstörungen, Substanzabhängigkeit und Craving. Für Angsterkrankungen liegt eine evidenzbasierte Wirksamkeit für die Verwendung von Antidepressiva und der Anwendung Kognitiver Verhaltenstherapie vor. rTMS könnte hier als potentielle Strategie für residuale Angstsymptome zur Anwendung kommen. Für PTSD liegen bis heute lediglich drei RCTs vor, die zwar alle einen positiven Effekt von hochfrequenter rTMS über dem rechten DLPFC brachten, sich aber in methodischen Merkmalen stark unterschieden. Auch wegen der sehr geringen Anzahl an Studien und eingeschlossenen Samples wird daher bis dato lediglich von einem möglichen Effekt (Empfehlungsstufe C) ausgegangen. Für weitere Angststörungen, sowie für Zwangsstörungen liegen mangels ausreichender Studienanzahl derzeit keine Empfehlungen vor. Allerdings scheinen erste Studien mit niederfrequenter rTMS über dem orbitofrontalen Kortex bei Zwangserkrankungen erfolgsversprechend [8]. Für Substanzmissbrauch, Abhängigkeit und Craving, schließlich, wird hochfrequente rTMS über dem DLPFC als Behandlungsstrategie angedacht. Diese Überlegung beruht auf der Hypothese einer fehlenden Top-down-Hemmung bzw. Kontrolle von Belohnungsmechanismen bei Substanzabhängigkeit. Allerdings fehlen bislang eindeutige Befunde, und die Anzahl durchgeführter Studien ist gering. Vereinzelt zeigen Studien positive Effekte von rTMS (10-20Hz) über dem linken DLPFC bei Zigarettencraving und Nikotinabhängigkeit. Durch die geringe Studienanzahl und methodische Heterogenität wird allerdings nur eine Empfehlungsstufe C (mögliche Effektivität) ausgesprochen. 47 Zusammenfassung Der therapeutische Nutzen von rTMS kann mit heutigem Forschungsstand für die Majore Depression als gesichert angesehen werden. Für weitere psychiatrische Erkrankungen liegt lediglich Evidenz für eine mögliche bzw. wahrscheinliche positive Wirkung vor. Aufgrund des geringen Nebenwirkungsprofils von TMS und der oft mangelnden Behandlungsalternativen, sollte die Aufnahme von rTMS als ernstzunehmende Therapiestrategie in das Methodenrepertoire von Psychiatern angedacht werden. Literatur 1. Hoflich G, et al., Application of Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment of Drug-Resistant Major Depression - a Report of 2 Cases. Human Psychopharmacology-Clinical and Experimental 1993;8(5):361-365 2. Kolbinger, H.M., et al., Transcranial Magnetic Stimulation (Tms) in the Treatment of Major Depression - a Pilot-Study. Human Psychopharmacology-Clinical and Experimental 1995;10(4):305-310 3. Lefaucheur JP, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Clin Neurophysiol 2014;125(11):2150-206 4. Wittchen HU, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol, 2011:21(9):655-79. 5. Gaynes BN, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry 2014:75(5):477-89 6. Berlim MT, et al. Response, remission and drop-out rates following high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for treating major depression: a systematic review and meta-analysis of randomized, double-blind and sham-controlled trials. Psychol Med, 2014:44(2):225-3 7. Slotema CW, et al. Meta-analysis of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of auditory verbal hallucinations: update and effects after one month. Schizophr Res 2012:142(1-3)40-5 48 8. Berlim MT, Neufeld HH, Van den Eynde F. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for obsessive-compulsive disorder (OCD): an exploratory meta-analysis of randomized and sham-controlled trials. J Psychiatr Res 2013:47(8):999-1006 State of the Art differentielle Psychotherapie Assoc.Prof. Dr. Henriette Löffler-Stastka Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien Die Forschungsstrategien zur Evidenzbasierung der Psychotherapie (vgl. Chambless, 1998) lieferten durch Meta-Analysen, Outcome-Studien und RCT-Designs ein solides Wissen über allgemeine und spezifische Wirkfaktoren in der Psychotherapie (vgl. Lambert, 2013). Seit Verlautbarung des „Äquivalenzparadoxon“ („All must have prizes“, Elliot, 1993) wurde die konventionelle Wirksamkeitsforschung durch Prozess-OutcomeForschung ergänzt, die komparativen Studien durch konsequente (Mikro)Prozessforschung und durch Ausdifferenzierung diesbezüglicher Untersuchungsmethoden bereichert. Die aktuellen Entwicklungen der Präzisions-Medizin und personalisierten Medizin kommen dem Gegenstandsbereich der differentiellen Psychotherapie(forschung) entgegen. Forschungsstrategien der differentiellen Psychotherapieforschungsphase Neben forschungsstrategischer Festlegung auf das naturwissenschaftliche Forschungsparadigma („The great psychotherapy debate“, Wampold, 2001) wurden Konzepte und Modelle zur Unterstützung von differentiellen und adaptiven Indikationsentscheidungen entwickelt, sozialwissenschaftliche, qualitative Forschungsmethoden miteinbezogen und durch dismantling-Studien Mediatoren und Moderatoren des Therapie-Ergebnisses herausgearbeitet. Forschungsmethoden, die komplexe Systeme oder eine nichtlineare Dynamik erfassbar machen, bereichern das Feld. Ergänzend kommen Methoden aus der Linguistik, aus dem Forschungsbereich zu Change-Mechanismen (z.B. CCRT, RA etc.), Videoanalysen, computergestützte Textanalysen hinzu. Prozessforschung, phänomenologische Arbeiten, Einzelfallstudien, Feldforschung, Surveys, Versorgungsforschung, praxisorientierte Psychotherapieforschung, wurden genutzt, um den Variablen des „generischen Modells der Psychotherapie“ (Orlinsky, 2009) Validität zu verleihen. Ausgehend von den Ergebnissen, dass 40% der Varianz des Therapieerfolgs durch Patientencharakteristika, 30% durch allgemeine Wirkfaktoren (z.B. therapeutische Beziehung), 15% durch die therapeutische Technik und 15% durch Therapeuteneffekte erklärt werden (Lambert, 2013), widmete sich die differentielle Psychotherapieforschung in den letzten Jahrzehnten der Differenzierung von folgenden Wirkspezifika: Therapeutische Technik Die Prozess-Forschung der letzten Jahre zeigte beispielsweise affektbezogene Interventionen als Mediatoren zum Therapieerfolg, insbesondere die Fokussierung auf (bisher abgewehrte negative) Affekte. Eine Verschiebung der Affekt-Abwehr-Relation von 1:5 zu 1:2 ist für erfolgreiche Therapien charakteristisch. Ebenso hängt die Aktivierung von (insbesondere negativen) Affekten bei PatientInnen sowie deren vertieftes Erleben und Verstehen im therapeutischen Prozess mit dem Therapieerfolg zusammen. Diese Ergebnisse lassen sich sowohl für die Hauptrichtungen der Psychotherapiemethoden als auch für störungsspezifische Verfahren finden. Weiters prognostizieren prototypisch psychoanalytische Interventionen (z.B. einsichtsorientierte Techniken oder die Arbeit an der therapeutischen Beziehung) den Behandlungserfolg, und zwar in allen Verfahren, auch in CBT. Dennoch bleibt – wie manual-geleitete Therapiestudien gezeigt haben, dass durch alleinige technische Kompetenz kein überragender Beitrag zum Therapieerfolg geleistet werden kann. Therapeutenvariable Effektive TherapeutInnen zeigen eine technisch neutrale Haltung, Empathie, affektiv positiv gestaltete zwischenmenschliche Begegnungen und weniger Schwankungen in ihren unterschiedlichen Behandlungen. Je schwerer beeinträchtigt die PatientInnen, umso eher wirkt sich die Kompetenz der PsychotherapeutInnen aus. Beziehungsfähigkeit gilt als die grundlegendste Therapeutenvariable, ein sicherer Bindungstyp befördert diese, ebenso wie eine wohlwollende Introjekt-Affiliation. Kompetenzentwicklung hängt mit kritischen Lebensereignissen, Bindungsangst und der Arbeitsbeziehung „Working Alliance“ zusammen. Die therapeutische Bindung nimmt einen zentralen Platz im Therapie-Prozess ein, da die Interventionen in der PatientIn-TherapeutIn-Zusammenarbeit durch die Bindung und Working Alliance mediiert werden. Letztere sind auch durch Persönlichkeitsmerkmale wie Reflexionsfähigkeit und Ich-Stärke oder Abwehr und Fragilität, die wiederum in Zusammenhang mit institutionellen oder sogenannten „Allegiance“-Faktoren stehen, beeinflusst. 49 Patientenvariablen Da die therapeutInnenspezifischen Wirkfaktoren oftmals keine signifikanten Prädiktoren für den Therapieerfolg darstellten, müssen Moderatoren von Therapieeffekten in Betracht gezogen werden. Es wurde beispielsweise gezeigt, dass Übertragungsdeutungen bei PatientInnen mit einer niedrigen Objektbeziehungsqualität das Therapieergebnis deutlich signifikanter verbesserten als bei PatientInnen mit einer hohen Objektbeziehungsqualität. In diesem Sinne wird die Deutung des dominanten Affekts immer in Zusammenhang mit der jeweils aktivierten Objektbeziehungsdyade vorgeschlagen. Zudem lassen sich für verschiedene Patientenvariablen unterschiedliche Veränderungs-Trajektoren feststellen, beispielsweise profitieren PatientInnen mit einem introjektiven Persönlichkeitsstil eher von einsichtsorientierten Therapien. Neben ebensolchen PatientInneneigenschaften hängt das Therapieergebnis auch von dem frühen Ansprechen auf die Therapie (early responders) ab. Ein weiterer wesentlicher Einfluss auf das Therapieergebnis entsteht durch den Schweregrad der Erkrankung, durch Komorbidität, PatientInnenmotivation, Bindungs- und Coping-Stil, dem Maß an Perfektionismus, Rolleninduktion während der Therapie und aus dem persönlichen Kontext, der Art und Weise des Lebens der PatientInnen außerhalb, vor, während und nach der erfahrenen Therapie, wie sich durch sozioökonomische Untersuchungen zeigen lässt. Differentielle Psychotherapieforschung führte zur Etablierung einer genaueren Fokussierung der jeweiligen Zielsetzung der Therapie allgemein, der akkurateren Definition der Indikationsgebiete für spezifische therapeutische Techniken, zur Diskussion von Dosiseffekten, zur Operationalisierung zentraler psychotherapeutischer Konzepte und zur Etablierung einer konsequenten Ausbildungsforschung, zum Erwerb und der Definition spezifischer Kernkompetenzen von PsychotherapeutInnen. Zentrale Schlüsselkompetenzen betreffen die Reflexionsfähigkeit, therapeutische neutrale Haltung, Moderatorenbewusstsein und ein Lernen, das unbewusste pathways, in denen das Lust/Unlust-Prinzip dominiert, inkludiert. Literatur Chambless DL, Hollon SD. Defining Empirically Supported Therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1998;66,7-18. 50 Elliott R, Stiles WB, Shapiro DA. "Are some psychotherapies more equivalent than others?" In Giles TR (Ed.), Handbook of effective psychotherapy. New York: Plenum Press, 1993;pp. 455-479 Lambert M J. Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, 6th Edition: Wiley New York, 2013 Orlinsky D. The “Generic Model of Psychotherapy” after 25 years: Evolution of a research-based metatheory. Journal of Psychotherapy Integration 200);19:319-339 Wampold, BE. The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Publishers, 2001