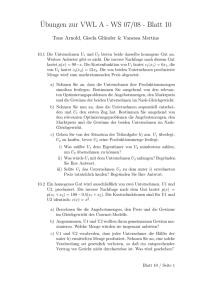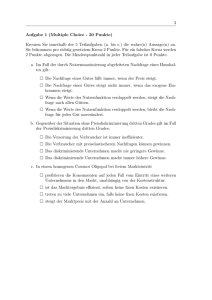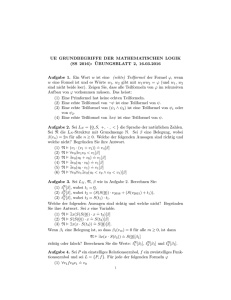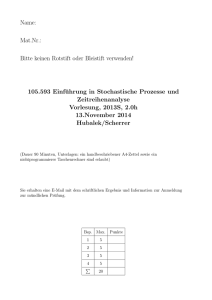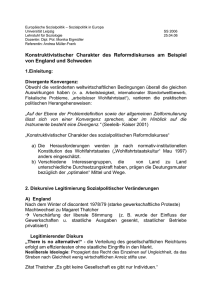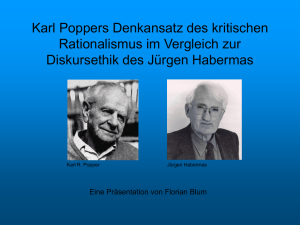Eine Kritik der Apelschen Diskursethik
Werbung
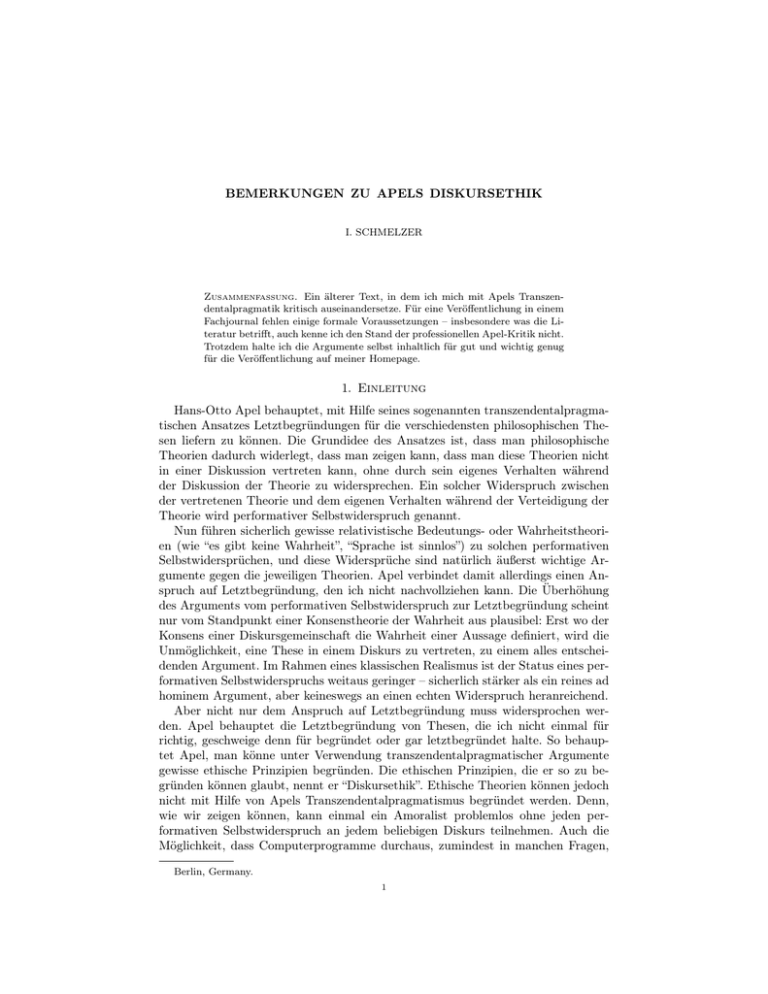
BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK I. SCHMELZER Zusammenfassung. Ein älterer Text, in dem ich mich mit Apels Transzendentalpragmatik kritisch auseinandersetze. Für eine Veröffentlichung in einem Fachjournal fehlen einige formale Voraussetzungen – insbesondere was die Literatur betrifft, auch kenne ich den Stand der professionellen Apel-Kritik nicht. Trotzdem halte ich die Argumente selbst inhaltlich für gut und wichtig genug für die Veröffentlichung auf meiner Homepage. 1. Einleitung Hans-Otto Apel behauptet, mit Hilfe seines sogenannten transzendentalpragmatischen Ansatzes Letztbegründungen für die verschiedensten philosophischen Thesen liefern zu können. Die Grundidee des Ansatzes ist, dass man philosophische Theorien dadurch widerlegt, dass man zeigen kann, dass man diese Theorien nicht in einer Diskussion vertreten kann, ohne durch sein eigenes Verhalten während der Diskussion der Theorie zu widersprechen. Ein solcher Widerspruch zwischen der vertretenen Theorie und dem eigenen Verhalten während der Verteidigung der Theorie wird performativer Selbstwiderspruch genannt. Nun führen sicherlich gewisse relativistische Bedeutungs- oder Wahrheitstheorien (wie “es gibt keine Wahrheit”, “Sprache ist sinnlos”) zu solchen performativen Selbstwidersprüchen, und diese Widersprüche sind natürlich äußerst wichtige Argumente gegen die jeweiligen Theorien. Apel verbindet damit allerdings einen Anspruch auf Letztbegründung, den ich nicht nachvollziehen kann. Die Überhöhung des Arguments vom performativen Selbstwiderspruch zur Letztbegründung scheint nur vom Standpunkt einer Konsenstheorie der Wahrheit aus plausibel: Erst wo der Konsens einer Diskursgemeinschaft die Wahrheit einer Aussage definiert, wird die Unmöglichkeit, eine These in einem Diskurs zu vertreten, zu einem alles entscheidenden Argument. Im Rahmen eines klassischen Realismus ist der Status eines performativen Selbstwiderspruchs weitaus geringer – sicherlich stärker als ein reines ad hominem Argument, aber keineswegs an einen echten Widerspruch heranreichend. Aber nicht nur dem Anspruch auf Letztbegründung muss widersprochen werden. Apel behauptet die Letztbegründung von Thesen, die ich nicht einmal für richtig, geschweige denn für begründet oder gar letztbegründet halte. So behauptet Apel, man könne unter Verwendung transzendentalpragmatischer Argumente gewisse ethische Prinzipien begründen. Die ethischen Prinzipien, die er so zu begründen können glaubt, nennt er “Diskursethik”. Ethische Theorien können jedoch nicht mit Hilfe von Apels Transzendentalpragmatismus begründet werden. Denn, wie wir zeigen können, kann einmal ein Amoralist problemlos ohne jeden performativen Selbstwiderspruch an jedem beliebigen Diskurs teilnehmen. Auch die Möglichkeit, dass Computerprogramme durchaus, zumindest in manchen Fragen, Berlin, Germany. 1 2 I. SCHMELZER Diskussionspartner ersetzen können, ohne dass dadurch ethische Verpflichtungen gegenüber solchen Programmen entstehen würden, lässt wenig Hoffnung für eine gehaltvolle Diskursethik. Das Programm der Letztbegründung der Diskursethik muss also scheitern. Trotzdem bleibt der Grundidee der Ausnutzung performativer Selbstwidersprüche zur Ethikbegründung eine Verführungskraft, die es wert ist, genauer untersucht zu werden. Die Frage wäre zu stellen, wohin sie uns (ver)führt. Apel behauptet, es folge vor allem das Prinzip der Gleichberechtigung der Diskussionspartner: “[Jeder Argumentierende] kann als evident entdecken, dass er mit jedem ernsthaften Argumentationsakt zugleich bereits die prinzipielle Gleichberechtigung aller Mitglieder der realen Kommunikationsgemeinschaft und aller denkbaren Mitglieder einer idealen Kommunikationsgemeinschaft anerkannt hat.” (S. 181). Ist dies wirklich der Fall? Wir versuchen zu zeigen, dass eine “Diskursethik” keineswegs eine Ethik der Gleichberechtigung und des Pluralismus wäre, sondern eher eine Ethik der Ausmerzung aller Schwachen und der Errichtung einer totalitären Weltherrschaft. Eine These, die möglicherweise nicht nur Apels Version der Diskursethik widerlegen könnte. Sie könnte auch einen Teil der Faszination totalitärer Ideologien aus der Verführungskraft der Diskursethik heraus erklären. Kurz zusammengefasst: Apels transzendentalpragmatischer Ansatz liefert weder eine Letztbegründung noch überhaupt eine Begründung seiner Diskursethik. Und das ist auch gut so, da das Begründungsschema der Diskursethik viel plausibler zur Begründung totalitärer Ideologien verwendet werden könnte. 2. Zur Definition von Diskursethik 2.1. Gleichberechtigung für meinen Computer! Eine der ersten Fragen, die sich stellt, wenn man aus der Beteiligung an einer argumentativen Diskussion ethische Schlüsse ziehen will, sollte heutzutage ja wohl die nach ethischen Schlußfolgerungen in Hinsicht auf künstliche Intelligenzen sein. Doch wir müssen gar nicht die Höhen der künstlichen Intelligenz betrachten, im Gegenteil. Wir beschränken uns erst einmal auf die Betrachtung recht primitiver Computerprogramme. (1) Als erstes betrachte ich den Austauch von Texten mit einem Compiler. Ich übergebe dem Compiler einen Text, von dem ich meine, dass er ein syntaktisch korrekter Text in der fraglichen Computersprache (sagen wir Java) ist. Falls dies nicht der Fall ist, liefert mir der Compiler konkrete Fehlermeldungen zurück. Daraufhin korrigiere ich den Ausgangstext solange, bis es keine Fehlermeldungen mehr gibt. (2) Eine Variante dieses Beispiels (wie er sich beispielsweise in der sogenannten “beweisbaren Programmierung” findet) ist eine formale Sprache, in der mathematische Beweise geschrieben werden können. Ein Programm, der Beweisprüfer, ist dann in der Lage, die Richtigkeit des Beweises zu überprüfen. Ist der Beweis nicht korrekt, liefert er eine Fehlermeldung, in der die Lücke im Beweis aufgezeigt wird. Der Austausch von Texten mit solchen Programmen ist natürlich kein Diskurs in der üblichen Bedeutung dieses Wortes. Trotzdem finden sich genügend Gemeinsamkeiten zwischen beiden Tätigkeiten. Welche sind dies? (1) Das, was ausgetauscht wird, kann man als sinnvolle Aussagen oder Fragen betrachten, wie sie auch in Diskussionen zwischen Menschen sinnvoll BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK 3 sind. Das Übergeben eines Textes an den Compiler wäre beispielsweise der Behauptung “Die Datei xxx.java enthält einen syntaktisch Korrekten JavaText” oder der Anfrage “Könntest du in der Datei xxx.java einen Syntaxfehler finden?” äquivalent. Für den Beweis im zweiten Beispiel gilt dies erst recht. (2) Auch die Antwort, die das Programm liefert, entspricht ohne Zweifel einer sinnvollen menschlichen Antwort auf die Behauptungen oder Fragen, die im vorigen Punkt gestellt wurden. (3) Die Reaktion des Programmierers auf diese “Antworten” entspricht genau der, die man von einem ernsthaften Diskussionspartner erwartet. Angesichts der “Gegenargumente” – der Fehler, die in seinen Behauptungen gefunden wurden – korrigiert er seinen “Standpunkt” und liefert eine korrigierte Version seines Programms oder Beweises. Wir können sogar noch weiter gehen. Nehmen wir an, der Programmierer hat gerade einen schlecht eingerichteten Computer, auf dem weder Compiler noch Beweisprüfer vorhanden ist, aber immerhin noch eine Verbindung zu den Newsgroups. Wäre es nicht eine Notlösung für ihn, in einer Newsgroup zu fragen, ob jemand Fehler in seinem Programm oder seinem Beweis findet? Nehmen wir an, jemand antwortet ihm. Könnte unser Programmierer überhaupt herausfinden (wenn wir von Kriterien wie Fehlerfreiheit und Stilfragen mal absehen), ob sein Diskussionspartner die Fehler selbst herausgefunden hat oder einfach nur einen Compiler oder Beweisprüfer auf seinem Computer “befragt” hat? In dieser hypothetischen Situation kann nicht einmal der Programmierer selbst sein Verhalten in der Diskussion mit einem Menschen von der Programmierarbeit mit einem Compiler oder Beweisprüfer unterscheiden. Und insofern ist eines klar: Zwischen einem Programmierer, der mit einem Compiler oder Programmprüfer arbeitet, und dem Teilnehmer an einem Diskurs, in der es um die Korrektheit von Programmen, Algorithmen oder Beweisen geht, gibt es keinerlei performativen Unterschied. Diese Beobachtung schränkt die Folgerungen, die man aus der Performance der Beteiligung an einem Diskurs ziehen kann, erheblich ein. Warum sollte aus meiner Beteiligung an einem Diskurs folgen, dass ich meinen Diskussionspartner ethisch höher bewerten muss als die Programme auf meinem Computer, wenn ich denselben “Diskurs” auch mit den Programmen auf meinem Computer direkt führen kann? Aber gegenüber den Programmen auf meinem Computer habe ich keinerlei ethische Verpflichtungen, nichts, was auch nur entfernt irgendeinem kategorischen Imperativ oder einer Art Gleichberechtigung nahekommen würde. Ich habe lediglich eine ganz normale Klugheitsregel (also einen hypothethischen Imperativ): “Behandle deine Werkzeuge pfleglich, wenn du sie in Zukunft weiterhin benutzen willst”. Hieraus schließen wir die folgende These: Aus der Teilnahme an einem idealen argumentativen Diskurs über Geltungsansprüche zumindest mathematischer Art ergeben sich keinerlei nichttriviale ethische Folgerungen. Insbesondere folgt daraus keinerlei Akzeptanz der Gleichberechtigung der Diskursteilnehmer in irgendeinem ethisch relevanten Sinn. 2.2. Wie weit geht die Compileranalogie? Strenggenommen haben wir die Gegenthese zur Diskursethik, dass aus der Beteiligung an Diskursen keinerlei ethische Schlußfolgerungen gezogen werden können, mit der Compileranalogie nur für 4 I. SCHMELZER einen sehr begrenzten Bereich – den der rein mathematischen Diskurse – in vollem Umfang beweisen können. Man könnte also im Prinzip weiterhin versuchen, aus der Beteiligung an Diskursen anderer (insbesondere rein philosophischer oder ethischer) Art ethische Schlußfolgerungen zu ziehen. Jedoch reicht es dafür natürlich nicht, diese anderen Diskurstypen von den rein mathematischen Diskursen abzugrenzen und dann zu behaupten, aus der Beteiligung an den anderen Diskurstypen würde die Anerkennung ethischer Prinzipien folgen. Dies müsste im Detail begründet werden. Gibt es Anlass, auf eine solche Begründung zu hoffen? Ich sehe wenig Grund dafür. Denn unser Compilerbeispiel gibt auch für andere Typen von Diskursen Hinweise darauf, welche Arten von Argumentation nicht dazu taugen, um ethische Schlußfolgerungen aus der Diskussionsbeteiligung zu ziehen. Dazu stellen wir ein paar qualitative Eigenschaften von unserem “Diskurs mit dem Compiler” fest: (1) Der “Diskurs” ist ernsthaft. Der Programmierer ist eindeutig ernsthaft daran interessiert, Fehler in seinem Programmtext zu finden. (2) Der “Diskurs” ist argumentativ. Die Fehlermeldung ist ein Argument. (3) Der “Diskurs” ist so nahe am idealen Diskurs wie ein realer Diskurs nur sein kann. Viele Schwächen realer zwischenmenschlicher Diskurse entfallen. Insbesondere sind die vom Compiler vorgebrachten “Gegenargumente” (ein fehlerfreier Compiler sei vorausgesetzt) sachlich, richtig, korrekt formuliert, in keiner Weise beleidigend. (4) Der “Diskurs mit dem Beweisprüfer” ist inhaltlich allgemein genug um den gesamten Bereich rein mathematischer Diskurse abzudecken. (5) Als Teilnehmer an diesem “Diskurs” unterwirft man sich Regeln. Diese Regeln – Syntax und Semantik der Computersprache oder der Beweissprache – sind sogar sehr viel schärfer als die Regeln der Umgangssprache in zwischenmenschlichen Diskursen. (6) Der “Diskurs” hat sein erfolgreiches Ende gefunden, wenn zwischen Programmierer und Compiler ein “Konsens” besteht, dass das Programm syntaktisch korrekt ist. Aus all diesen Eigenschaften des “Diskurses mit dem Compiler” folgt ethisch, wie gezeigt, gar nichts. Und daher kann man aus diesen Eigenschaften irgendeines anderen “ernsthaften idealen argumentativen Diskurses”, sagen wir der experimentellen Wissenschaft oder der Ethik, auch keinerlei ethische Schlußfolgerungen ziehen. Eine Argumentation, die aus einer Diskursbeteiligung die Akzeptanz ethischer Regeln folgern will, muss sich auf andere, besondere Aspekte dieses Diskurses beziehen, also Aspekte, die in rein mathematischen Diskussionen gar nicht vorhanden sind. Für den Bereich der wissenschaftlichen Diskussion, bzw. generell Diskussionen über Sachfragen – hier kommen als neues Element im wesentlichen lediglich Berichte über Beobachtungen oder den Ausgang von Experimenten hinzu – sehe ich keinerlei Chance, solche wesentlichen Unterschiede zu finden. Am ehesten kämen ethische Diskurse dafür in Frage. Die Idee, dass eine Beteiligung an einem ethischen Diskurs die Akzeptanz gewisser ethischer Prinzipien unhintergehbar impliziert klänge noch am ehesten plausibel. Trotzdem sind es ja gerade die bereits in unserer Liste vorkommenden Aspekte der Beteiligung an einem Diskurs, die auf ersten Blick die Apelsche Argumentation überhaupt plausibel machen – insbesondere die Unterwerfung unter Regeln, die BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK 5 Verwendung von Argumenten, die Ausrichtung auf einen Konsens. Wenn aus all dem gar nichts mehr folgt, was bleibt dann noch an Plausibilität von der Apelschen Argumentation übrig? 3. Strategische und normative Diskurse Obwohl Apel an einigen Stellen suggeriert, man würde schon mit jeder mathematischen Diskussion die Diskursethik akzeptiert haben, (“Der nichthintergehbare argumentative Diskurs . . . ist prinzipiell nicht als ein kontingentes Projekt vorstellbar, über dessen Zweck man im Lichte möglicher Alternativen diskutieren könnte, sondern er stellt die von jedem, der - welches Problem auch immer – vernünftig diskutiert, . . . ” S.266), nimmt er diesen Anspruch an anderen Stellen zurück und beschränkt ihn auf rein normative Diskussionen (die er allerdings bevorzugt “argumentativ” nennt, als ob es in wissenschaftlichen, mathematischen oder strategischen Diskussionen keine Argumente zu hören gibt). Wir verlassen also im folgenden den Bereich der logisch-mathematischen Diskussion und betrachten ethische Diskurse. Diese stehen bei Apel im Gegensatz zu offen strategischen Diskursen. Als Beispiel für einen offen strategischen Diskurs dient beispielsweise die Aufforderung des Bankräubers “Geld her oder ich schieße.” Und, soviel zumindest ist Apel klar, bedeutet eine solche Aufforderung (und somit eine Beteiligung an einem offen strategischen Diskurs) keine Akzeptanz von irgendwelchen Moralregeln. (Auch wenn der Bankangestellte mit dem Bankräuber Probleme beim Auszahlen, die z.B. mit Zeitschlössern verbunden sind, vernünftig diskutieren könnte.) Der Bereich des Diskurses, aus dem, wenn überhaupt, ethische Regeln folgen könnten, ist sicherlich begrenzt auf ethische Diskussionen. 3.1. Das Verhalten des Amoralisten. Um zu zeigen, dass aus der Beteiligung an ethischen Diskursen irgendetwas ethisch relevantes folgt, muss aufgezeigt werden, dass ein Amoralist sich durch eine solche Beteiligung in einen performativen Selbstwiderspruch verwickelt. Apel hat dieses Problem sehr wohl erkannt. So schreibt er: “Gesetzt den Fall, jemand hat in seiner Adoleszenzkrise Nietzsches genealogische Erklärung des moralischen Gewissens als Krankheit . . . internalisiert und weigert sich aufgrund dieser Überzeugungen, . . . Grundnormen . . . anzuerkennen: sollen wir nun sagen, für ihn seien die . . . Grundnormen nicht rational verbindlich? Mir scheint eine solche Formulierung philosophisch nicht akzeptierbar zu sein; denn sie widerspricht dem, wofür Menschen – d.h. selbst die fiktiv unterstellten Anhänger des Amoralismus – in einer Kommunikationsgemeinschaft performativ widerspruchsfrei argumentieren könnten.” Leider wird hier nicht erläutert, worin denn dieser performative Widerspruch besteht. Man findet lediglich eine Erläuterung: “Empirisch-sozialpsychologisch dürfte dem die Tatsache entsprechen, das Amoralisten ihre ’Weltanschauung’ kaum jemals konsequent praktizieren. Eher schon werden sie – in einer quasi-postkonventionellen Regression auf einen konventionellen Typus der ’Binnenmoral’ – eine den Amoralismus kompensierende Form der elitären Gruppen- oder Bandenmoral vertreten.” Nun, diese “Tatsache” wäre wohl nicht einmal dann ein ernstzunehmendes philosophisches Argument, wenn sie der Wahrheit entsprechen würde. Denn man kann sie bestenfalls dahingehend deuten, dass sich im allgemeinen Verhalten in der Regel ein performativer Widerspruch zeigt. Zu zeigen wäre jedoch, dass er sich auch notwendigerweise zeigen muss, und nicht im allgemeinen Verhalten, sondern im eng begrenzten Teilgebiet der Kommunikation. 6 I. SCHMELZER Die Hauptschwäche dieser Argumentation besteht jedoch darin, dass Apel nicht klar zu sein scheint, wie sich ein rationaler (kluger) Amoralist entsprechend seiner ’Weltanschauung’ verhalten sollte. Was er ablehnt, sind die verschiedensten Pflichten, kategorischen Imperative, die ihm die verschiedensten Moralapostel aufdrängen wollen. Ein Amoralist ist jedoch kein Antimoralist, er ist nicht moralisch verpflichtet, gegen jede Regel der verachteten Moral zu verstoßen. Er ist frei, die Moralregel einzuhalten oder zu brechen. Und dabei richtet er sich nach seinem eigenen Interesse. Insbesondere richtet er sich dabei nach den verschiedensten Klugheitsregeln – also hypothetischen Imperativen. Nun gibt es hinter jeder wichtigen ethischen Regel eine ihr entsprechende Klugheitsregel. Hinter “du sollst nicht lügen” steht die Klugheitsregel “wer einmal lügt, dem glaubt man nicht”, hinter “was du nicht willst, das man dir tu” steht “wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus”, hinter der Pflicht zur Einhaltung von Gesetzen das Vermeiden von Strafe. Solange sich die Amoralisten in der Regel an solche Klugheitsregeln halten, sind sie nicht zu unterscheiden von denen, die sie als unbedingte ethische Regeln akzeptieren und bei der Ausübung ab und zu “schwach werden”. Eine wichtige Folgerung daraus ist, dass kluge Amoralisten sich an ethischen Diskussionen beteiligen können und werden. Und dies in jedem Sinne ernsthaft, also nicht nur in einer nihilistischen Ablehnung der jeweiligen ethischen Argumentation. Denn die Argumente, die in einer solchen konkreten ethischen Diskussion fallen, übersetzen sich für den Amoralisten in einfacher Weise in sinnvolle Argumente einer offen strategischen Diskussion: Aus “mit Handlung X verstößt du gegen Regel Y” wird “mit Handlung X handelst du dir die Risiken und Nebenwirkungen ein, die nach den dir bekannten Klugheitsregeln üblicherweise mit Verstößen gegen die Regel Y einhergehen.” Aus solchen ethischen Argumenten kann unser Amoralist also aus den ihm bereits bekannten Klugheitsregeln neue, abgeleitete Klugheitsregel erhalten. Dies ist für unseren Amoralisten von großer Wichtigkeit, weswegen Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit nicht gerechtfertigt sind. (Ganz abgesehen davon, dass viele ethische Diskussionen voll sind von offen strategischen Argumenten.) Wie auch immer, der Amoralist wird sich in seinem Verhalten nach den von ihm erkannten Klugheitsregeln richten. Und wo immer eine Korrespondenz zwischen Klugheitsregeln und Moralregeln besteht, wird er sich ähnlich verhalten wie ein Moralist. Ein moralisches Verhalten seinerseit stellt also keinerlei performativen Selbstwiderspruch dar. Eher wird ein völlig unmoralisches Verhalten starke Zweifel wecken. In einen performativen Widerspruch gelangt lediglich der Antimoralist, für den der Verstoß gegen alle Moralregeln der etablierten Moral zur eigenen Moral wird. Dies wird in der Tat performativ kaum durchzuhalten sein, da eben ein nicht unerheblicher Teil der etablierten Moral Klugheitsregeln entspricht, und der Antimoralist moralisch verpflichtet wäre, sich dumm zu verhalten, also wider besseres Wissen seinen eigenen Interessen zu schaden. Was wir hier über das Verhalten des Amoralisten im Allgemeinen gesagt haben, gilt natürlich auch für sein Verhalten in Diskursen jeder Art. Er nimmt daran teil, weil es in seinem Interesse ist, weil man dabei etwas lernen kann, weil es also klug ist. Er verhält sich dabei entsprechend den Regeln des höflichen Umgangs und andere Moralregeln der fraglichen Kommunikationsgemeinschaft, weil er nur so Vorteil aus der Kommunikation ziehen kann. Wie aus einem solchen Verhalten BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK 7 ein performativer Selbstwiderspruch hergeleitet werden könnte, bleibt zumindest mir völlig unklar. Aus einem regelkonformen Verhalten folgt eben keinesfalls auch die Anerkennung der Bindungskraft der befolgten Regel. Und somit kann er ohne jeden performativen Selbstwiderspruch bei jeder beliebigen ethischen Regel argumentieren, dass sie als allgemeinverbindliche Regel ungültig, lediglich eine strategische Regel mit begrenztem Gültigkeitsbereich sei, und dies unabhängig davon, ob er sich im Leben nach dieser Regel richtet oder nicht. 3.2. Was ist mit interner Kritik? Im Zusammenhang mit der Diskursethik verlangt eine klassische Form der argumentativen Kritik – die interne Kritik – besondere Aufmerksamkeit. Interne Kritik besteht darin, dass man – for the sake of the argument – die Annahmen der eigentlich für falsch gehaltenen Theorie akzeptiert, und daraus dann Schlußfolgerungen zieht, die entweder gleich zu einem logischen Widerspruch oder doch wenigstens zu mehr oder weniger absurden, inakzeptablen oder unerwünschten Ergebnissen führen. Wir haben hier also eine Situation, in der – innerhalb der gegebenen Argumentation – Thesen akzeptiert werden, die vom Argumentierenden in Wirklichkeit ganz explizit abgelehnt werden. Welche Teile der Argumentation dabei vom Argumentierenden abgelehnt werden, bleibt im Kontext der Diskussion offen. Es kann jede einzelne der verwendeten Thesen sein. Und daher ist auch nicht auszuschließen, dass es die von der Diskursgemeinschaft, in der die Diskussion stattfindet, verwendeten Schlußregeln sind. Eine interne Kritik erfüllt natürlich die für Apel wichtigen Kriterien. Sie ist insbesondere argumentativ, ernstgemeint, legitimer Teil auch von idealen Diskursen, prinzipiell konsensfähig und auf Konsens ausgerichtet. Und offensichtlich stellt es keinen Selbstwiderspruch dar, im Rahmen einer solchen internen Kritik Prinzipien und Schlußweisen zu verwenden, die man selbst nicht akzeptiert. Wie soll man also anhand einer Argumentation überhaupt entscheiden können, dass der Argumentierende, ohne in Selbstwiderspruch zu geraten, irgendwelche ethischen Prinzipien akzeptiert, wenn er, ohne in Selbstwiderspruch zu geraten, bei interner Kritik sogar die von ihm selbst explizit abgelehnten Thesen und Schlußweisen verwenden kann? Erschwerend kommt hinzu, dass – gerade in dem Fall, dass die interne Kritik nicht zu einem expliziten Widerspruch führt, sondern lediglich auf eine auf die eine oder andere Weise unliebsame Folgerung – anhand der Argumentation gar nicht entschieden werden kann, welche Position der Argumentierende selbst einnimmt. Der Argumentierende könnte sehr wohl auch alles akzeptieren, und lediglich seine Genossen auf einige unliebsame Folgerungen vorbereiten. Oder er könnte damit zeigen wollen, dass gewisse Folgen gar nicht bekämpft werden sollten, sondern eben als Notwendigkeit hinzunehmen sind. 4. Diskursethik als Ethik der Ausmerzung aller Schwachen und Etablierung einer totalen Weltherrschaft Nehmen wir einmal an, man könnte tatsächlich unter Zuhilfenahme von performativen Widersprüchen aus der Beteiligung an Diskussionen ethische Schlüsse ziehen. Welche wären dies? Eine offensichtlich inkorrekt gestellte Frage. Aber wenn man die Anforderungen herunterschraubt, den Anspruch auf strenge Begründung 8 I. SCHMELZER (erst recht natürlich auf Letztbegründung) aufgibt, sondern die ethischen Schlüsse aus der Beteiligung an Diskursen lediglich als Analogieschlüsse ohne jede Verbindlichkeit betrachtet, können wir daraus durchaus eine sinnvolle Frage machen. Auch wenn wir es statt mit performativen Selbstwidersprüchen nur mit Scheinwidersprüchen zu tun haben, so kann man trotzdem sinnvoll die Frage stellen, durch welche Ethik die Konsistenz zwischen Verhalten im Diskurs und Verhalten im Leben maximiert und Widersprüche minimiert werden. Eine solche Ethik könnte man dann mit gutem Recht als Diskursethik bezeichnen. Apel zufolge wäre der wichtigste ethische Schluß die Gleichberechtigung aller Diskursteilnehmer. Mir scheint dies jedoch überhaupt nicht plausibel zu sein. Betrachten wir dazu erst einmal das Verhalten von Menschen in realen Diskursen, insbesondere im Fall größerer Teilnehmerzahlen, beispielsweise in Newsgruppen oder Internetforen. Das erste, was man feststellt, ist, dass die Qualität der Beiträge verschiedener Teilnehmer sehr verschieden ist. Insbesondere gibt es immer auch Diskursteilnehmer, deren Argumente man glatt vergessen kann. Andere Teilnehmer hingegen werden – aufgrund der Qualität ihrer Argumente – hoch bewertet und zu Autoritäten. Nach einiger Zeit wird man die Beiträge gewisser Teilnehmer einfach nicht einmal mehr lesen. Jeder Newsreader hat heutzutage dafür extra die technische Möglichkeit geschaffen – das sogenannte Killfile. In diesem File werden diejenigen abgespeichert, deren Beiträge man gar nicht erst angezeigt bekommen möchte. Bereits der Name “Killfile” spricht Bände und deutet an, worauf ich hinaus will. Befindet sich derjenige, der bereits mehrere Leute in seinem Killfile hat, diese Leute aber trotzdem noch draußen lebend rumlaufen lässt, nicht bereits in einem performativen Selbstwiderspruch? “Natürlich nicht!” ist die klare Antwort eines Liberalen. Das ist auch meine Antwort. Aber gibt es nicht genügend Leute, die dies ganz anders sehen? Rein sachlich gesehen: Derjenige, der die Leute umbringt, deren Beiträge zum Diskurs schädlich sind, weil diese, aufgrund ihrer Trivialität und Dummheit, die Gruppe belästigen und “Bandbreite verschwenden”, könnte damit zumindest kurzfristig den ernstgemeinten, argumentativen Diskurs fördern. Dies ist nicht der Zeitpunkt, den liberalen Standpunkt zu begründen. Es geht lediglich darum, dass es eher der Liberale ist, derjenige, der allen Gleichberechtigung zubilligt, aber selbst seine Leichen im Killfile hat, der viel eher in der Gefahr steht, in einen performativen Selbstwiderspruch zu geraten, als der Ausmerzer der geistig Schwachen. Dies fassen wir zur folgenden These zusammen: Wenn sie überhaupt existiert, ist Diskursethik eine Ethik der Ausmerzung aller geistig Schwachen. Der zweite Aspekt ist das Endziel. Das Ziel des Apelschen Diskurses ist, wie Apel auch immer wieder betont, der Konsens. Es ist nicht friedliche Koexistenz verschiedener Wahrheitsformen. Sondern, eben, klar und eindeutig, Konsens. Und solange noch kein Konsens besteht, gibt es ernsthafte, argumentative Auseinandersetzung. Einen gnadenlosen Kampf der Argumente, bis der Konsens erreicht ist. Wer befindet sich also eher im performativen Selbstwiderspruch – der Liberale, der für eine pluralistische Welt eintritt, aber im Diskurs nach einer einzigen Wahrheit sucht, oder der Fundamentalist, der die totale Weltherrschaft derjenigen Theorie herstellen will, deren Wahrheit durch den Konsens in unserem ernsthaften argumentativen Diskurs festgestellt wird? BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK 9 Ich denke, die Antwort ist ziemlich offensichtlich: Wenn sie überhaupt existiert, ist Diskursethik eine Ethik der Etablierung einer totalen Weltherrschaft. Wir können beide Thesen kurz und markant zusammenfassen: Diskursethik wäre eine Ethik des Totalitarismus. Im Gegensatz dazu unterscheidet die liberale Tradition, bis hin zum Paradox, zwischen den Ideen und deren Trägern. Die Ideen werden bekämpft, dem Träger der Ideen billigt man hingegen alle Menschenrechte zu, einschließlich des Rechts, seine Ideen zu verbreiten. Hier besteht ein Konflikt zwischen Verhalten in der Diskussion und im Leben. Auch der Fernsehzuschauer, der erfährt, dass die beiden politischen Kontrahenten, deren scharfe Diskussion er gerade verfolgt hat, nach der Sendung zusammen ein Bier trinken gehen, spürt diesen Konflikt. Er fühlt sich betrogen, die politische Diskussion wird für ihn zur Farce. Und die Anhänger totalitärer Ideologien spüren ihn auch. Und sie nutzen ihn auch aus in ihrer Propaganda, in der sie Liberale als hohle Schwätzer darstellen. Wer wollte Stalin einen performativen Widerspruch unterstellen, wenn er die Angehörigen der laut Theorie aussterbenden Klassen umbringen lässt? Oder Hitler, wenn er dasselbe mit rassisch Minderwertigen macht? Und spüren ihn nicht auch, nur von der anderen Seite aus, die Anhänger relativistischer Wahrheitstheorien? Sind diejenigen, die den Anspruch der westlichen Wissenschaft auf Wahrheit als Dogmatismus, als Teil des Imperialismus ablehnen, nicht einfach nur Opfer desselben diskursethischen Fehlschlusses? Sicher, sie alle sind auf dem Holzweg. Sie alle begehen einen Irrtum. Aus dem Verhalten, was für Diskurse angemessen ist – die Ausmerzung aller falschen Argumente, mit dem allgemeinen Konsens als Ziel – kann man eben keine ethischen Schlüsse auf das Verhalten gegenüber den Vertretern anderer Ideen schließen. Und es ist wichtig, zu begreifen, dass der performative Widerspruch zwischen harter und kompromissloser Diskussion und Toleranz gegenüber dem Opponenten nur ein scheinbarer Widerspruch ist. 4.1. Was ist mit idealen Diskursen? Bevor wir weitergehen, sei noch die Frage betrachtet, inwieweit die Schlüsse dieses Abschnitts dadurch bestritten werden können, dass in der Diskursethik ja ein idealer Diskurs betrachtet werden muss, während wir bisher einen realen Diskurs betrachtet haben. Ich meine, dass sich wichtige Eigenschaften, die wir im realen Diskurs festgestellt haben und die die Grundlage unserer Argumentation bilden, sich auch in einem idealen Diskurs wiederfinden. Zum Teil werden sie sogar in der Idealisierung noch verschärft. Insbesondere ist das Ziel – nämlich das Erreichen des Konsens mit allen Diskussionspartnern – auch im idealen Diskurs vorhanden. Man kann sogar sagen, es ist erst im idealen Diskurs wirklich in aller Schärfe vorhanden. Der Argumentation für die Diktatur der wahren Theorie kann also durch den Übergang zum idealen Diskurs nicht ausgewichen werden. Aber auch die wesentlichen Argumente für die Regel “Tötet alle Dummen” bleiben im idealen Diskurs bestehen. Einerseits ist auch der ideale Diskurs sinnlos, wenn alle dieselben Argumente vertreten. Denn dann ist der Konsens bereits erreicht, und es findet gar keine Diskussion mehr statt. Eine Idealisierung des Diskurses, in der gar kein Diskurs mehr stattfindet, ist sinnlos. Somit werden auch im idealen Diskurs von verschiedenen Teilnehmern verschiedene Argumente vertreten. 10 I. SCHMELZER Andererseits gehört es natürlich auch zu einem idealen Diskurs, dass falsche Argumente widerlegt werden. Dazu ist es aber erforderlich, dass die falschen Argumente auch vorgebracht werden. Somit gehören auch falsche Argumente zu einem idealen Diskurs. Die Teilnehmer am idealen Diskurs bringen also verschiedene Argumente vor, unter ihnen auch falsche Argumente. Und das Ziel ist auch im idealen Diskurs die Ausmerzung der falschen Argumente. Unsere Argumentation lässt sich also durchaus auch auf den idealen Diskurs anwenden – alle Bestandteile der realen Diskurse, die wir brauchen, bleiben auch in allen sinnvollen Idealisierungen des Diskursbegriffs bestehen. 4.2. Welche Rolle spielt der Konsens? Wir hatten bereits den engen Zusammenhang zwischen Diskursethik und Konsenstheorie der Wahrheit erwähnt – ein Zusammenhang, den auch Apel sieht (“so scheint mir gezeigt zu sein, daß die Begriffe . . . der Konsens-Theorie der Wahrheit und der philosophischen Letztbegründung einander nicht ausschließen, sondern fordern.” S. 193). Gibt es einen solchen Zusammenhang auch für unsere totalitäre Variante der Diskursethik? Dies scheint ohne weiteres plausibel. In totalitären Staaten ist wahr, was die Volksgemeinschaft im Konsens vertritt. Zweifellos ist dies eine Banalisierung des philosophischen Konzepts der Konsenstheorie der Wahrheit. Das Ziel, welches hingegen ein Realist verfolgt, ist ein ganz anderes – es ist, in strategischen Diskussionen, das Herausfinden der besten Strategie, oder die Beeinflussung der Entscheidung der anderen Teilnehmer im eigenen Interesse. In wissenschaftlichen Diskussionen ist es die objektive Erkenntnis. Ähnlich wie die ethische Diskussion kann die wissenschaftliche Diskussion auf die strategische zurückgeführt werden: Jeder dürfte schon als Kind gelernt haben, dass es normalerweise klüger ist, auf objektive Fakten zu vertrauen als auf Wunschträume. Die objektiv-wissenschaftliche Frage “hält die Brücke meinen Wagen aus?” ist nun einmal eng verbunden mit der strategischen Frage “sollte ich über diese Brücke fahren?”. Und diese Betrachtung zeigt auch, dass Konsens nicht das Ziel von wissenschaftlichen Diskussionen ist. Jedenfalls nicht für unseren Autofahrer, der vor der Brücke steht. Er neigt zu einem “Ja”, fragt aber vielleicht noch einen Anwohner. Mit Apel sollte man denken, er wäre durch ein “Ja” befriedigt. Schließlich ist damit Konsens erreicht. Aber nicht das “Ja” ist ihm wichtig, sondern die Begründung: “Hier fährt täglich ein Wagen rüber, der doppelt so groß ist wie Ihrer.”, oder “Die Spalte da ist vor 10 Jahren bei einem Erdbeben entstanden und seit dem nicht größer geworden.”. Und hierbei ist nichts davon zu bemerken, dass dem Autofahrer irgendein Konsens wichtig wäre. Die Informationen sind es, die ihm helfen, eine für ihn möglicherweise lebenswichtige Entscheidung zu treffen. Nebenbei hängt der Wert dieser Information nicht davon ab, dass überhaupt ein Diskurs verwendet wurde. Wäre der Autofahrer schon hier gewesen, als der größere Wagen vorbeifuhr, oder gar beim Erdbeben vor 10 Jahren, dann wären die Informationen für ihn nutzlos gewesen – er selbst hätte sie ja schon aus erster Hand und wäre noch viel sicherer in seinen Entscheidungen, denn er müsste nicht überlegen, ob die von ihm Befragten die Wahrheit sagen, oder ob er die Bedeutung ihrer Worte richtig entschlüsselt hat. Ziel ist in unserem einfachen Beispiel also nicht irgendein Konsens, sondern die Gewinnung von objektiv richtigen Informationen. Und unser Autofahrer wird, BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK 11 möglicherweise, einen allgemeinen Konsens der Dorfbewohner ignorieren und einen Umweg wählen. Denn es ist sein Leben, das er riskiert. Auch das Compilerbeispiel ist hier noch einmal wert, betrachtet zu werden. Der Punkt ist, dass man auch im Fall des “Diskurses” mit dem Compiler von einem “Konsens” als Ziel der Kommunikation sprechen könnte. Der “Konsens” besteht darin, dass der Compiler das Programm als syntaktisch korrekt akzeptiert und in Programmcode übersetzt. Allerdings ist das Ziel der Arbeit des Programmierers keineswegs der ”Konsens” mit dem Compiler, sondern ein korrekt arbeitendes Programm. Der ”Konsens” mit dem Compiler ist dabei nur ein Zwischenschritt: Die eigentliche Hauptarbeit kommt erst danach – das Debuggen des Programms. Interessant ist in dieser Hinsicht ein weiterer Aspekt des modernen Sprachdesigns und Compilerbaus. Ziel ist es, Sprachen zu entwickeln und Compiler zu bauen, die sehr viel mehr Fehler finden. Fehler, die man ansonsten im Prozess des Testens finden müsste, sollen möglichst bereits durch den Compiler gefunden werden. Dies läuft darauf hinaus, dass die ”Konsensfindung” mit dem Compiler künstlich erschwert wird. Was soll das? Wenn Konsensfindung das Ziel wäre, hieße das, ich mache mir künstlich das Leben schwer, wenn ich eine moderne Programmiersprache mit modernerem Compiler benutze. Erst wenn man berücksichtigt, dass das Ziel eben nicht Konsensfindung ist, sondern diese nur ein Mittel ist, wird das Verhalten der Sprachdesigner und Compilerbauer verständlich. Und steht dasselbe Ziel nicht auch hinter der Formalisierung, der Mathematisierung, der Einführung von Fachbegriffen in die natürliche Sprache, die den Übergang von natürlicher Sprache zur Wissenschaftssprache kennzeichnen? Wird man bei Verwendung genauerer Sprache nicht viel häufiger auf Widersprüche stoßen, Widersprüche, die in der Alltagssprache einfach untergegangen wären? 5. Welche Grenzen hat die transzendentale Argumentation? Bisher haben wir das grundlegende Argumentationsmuster der Transzendentalpragmatik, die Notwendigkeit der Vermeidung performativer Selbstwidersprüche, unhinterfragt akzeptiert. Nur, wie schwerwiegend ist eigentlich ein performativer Selbstwiderspruch? Gerade wenn ein Verfahren den Anspruch auf Letztbegründung erhebt, müsste ein solcher Widerspruch in jedem Fall fatal sein. Ist er das überhaupt? Vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes aus gesehen muss man hierbei durchaus Unterschiede machen. Wo der Widerspruch auf logischem Gebiet entsteht, wie bei Aussagen vom Typ “Es gibt keine Wahrheit”, wird man die Theorie sicherlich ablehnen. Wenn aus einer empirischen Theorie folgen sollte, dass, beispielsweise, der Vortragende unfähig sein müsste, zu reden, weil beispielsweise der menschliche Kehlkopf zur Rede ungeeignet wäre, hätten wir einen Widerspruch zwischen Voraussage und Experiment, den wir mit anderen Widersprüchen zwischen Voraussage und Experiment auf eine Stufe stellen würden. Aber was ist mit dem hier besonders interessanten Fall einer ethischen Theorie? Der typische performative Widerspruch wäre ein ethisches Schweigegebot, welches man mit der Darstellung oder Begründung der Theorie durchbrechen müsste. Doch ein solches Schweigegebot, zumindest vom Standpunkt des gesunden Menschenverstands aus gesehen, kaum ein ernstzunehmendes Argument gegen eine ethische 12 I. SCHMELZER Theorie. Allerhöchstens ist sie ein pragmatisches Hindernis bei der Weiterverbreitung der Theorie. Ethische Theorien, die Schweigegebote enthalten, finden wir im Alltag häufig. Die Ethik der Wissenschaft ist voll von Betrachtungen darüber, ob wahre wissenschaftliche Theorien, beispielsweise darüber wie man Massenvernichtungswaffen baut, offengelegt werden sollten. Auch bei metaphysischen und ethischen Theorien, wie dass es kein Weiterexistieren nach dem Tod oder keine gottgewollte Moral gibt, kann die Weiterverbreitung als problematisch angesehen werden – sie würden den Menschen den letzten Trost nehmen und könnten zu Chaos und Revolutionen führen. Egal wie man zu solchen Theorien steht – wer würde das Argument ernstnehmen, diese Theorien wären falsch, weil man sie nicht ohne performativen Selbstwiderspruch dem Volk verkünden könne? Ein nettes Beispiel für potentielle performative Selbstwidersprüche findet sich im Recht von Angeklagten und Zeugen, vor Gericht die Aussage zu verweigern, wenn sie sich durch die Aussage selbst belasten müssten – was sie nicht begründen können, ohne zu sagen, womit sie sich selbst belasten würden, wenn sie aussagen würden. Sollte man deswegen diesen Paragraphen abschaffen? Oder wiegen die Gründe für diese Ausnahmeregelung nicht doch schwerer als die Probleme damit, herauszufinden, ob ein Zeuge zu Recht von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen will? Und stehen wir nicht alle irgendwann vor der Frage, ob wir irgendein Geheimnis offenbaren sollen? Eine Frage, bei der die Antwort “nein, behalt es für dich” zu einem performativen Selbstwiderspruch führt? Wieviele Menschen bewegt dies, all ihre Geheimnisse zu offenbaren? Doch warum sind wir in diesen Alltagssituationen geneigt, diese offensichtlichen performativen Widersprüche zu tolerieren? Sollten wir nicht jeden Widerspruch ernst nehmen? Sollten wir nicht, wenn die Wissenschaft, hier die Philosophie, uns Widersprüche in unserem Alltagsverhalten aufzeigt, dieses Verhalten ändern? Nur, verhält sich jemand wirklich selbstwidersprüchlich, wenn er der performativ selbstwidersprüchlichen Regel “behalte für dich, dass du beim Sex an (eigene Phantasien hier einsetzen) denkst” folgt? Oder wenn er sie als ethische Regel akzeptiert? Oder sind solche performativen Selbstwidersprüche doch nur Widersprüche zweiter Klasse? Um das zu entscheiden, brauchen wir eine philosophische Grundlage. Es ist dabei von erheblicher Wichtigkeit, ob wir eine Form des Realismus vertreten, in der die Wahrheit durch Übereinstimmung mit der Realität bestimmt wird, und eine intersubjektive Diskussion nur ein Mittel unter anderen ist, die Theorie zu kritisieren und möglicherweise abzulehnen, oder ob man eine Konsenstheorie der Wahrheit vertritt, in der eine Theorie, die nicht intersubjektiv diskutiert werden kann, gar nicht auf Wahrheit überprüfbar ist. Für den kritischen Rationalisten reicht es vollkommen, dass man die fragliche Theorie selbst durchdenken und dabei eben auch kritisieren kann. Das monologische sprachliche Denken ist für ihn eine vollwertige Methode der Kritik, in keinerlei Hinsicht defizitär oder parasitär. Was durch den performativen Selbstwiderspruch geschieht, ist nichts als das eine andere wichtige Methode – die intersubjektive Diskussion – leider nicht anwendbar ist. Dadurch entgehen uns möglicherweise wichtige Argumente. Aber für die Frage der Richtigkeit der ethischen Theorie ist dies genauso unwesentlich wie die Unmöglichkeit, bestimmte Experimente real durchzuführen, sagen wir Teilchenbeschleuniger mit dem Radius der Milchstraße zu bauen, etwas BEMERKUNGEN ZU APELS DISKURSETHIK 13 über die Wahrheit einer physikalischen Theorie aussagt, die durch solche Experimente widerlegt werden könnte. Diese Betrachtung zeigt, dass die Überzeugungskraft performativer Selbstwidersprüche von den philosophischen Theorien abhängt, die man bei philosophischen Betrachtungen über diese Überzeugungskraft implizit voraussetzt. Womit wir, was sowieso zu erwarten war, feststellen können, dass Versuche von Letztbegründungen scheitern müssen, weil sie regelmäßig irgendetwas implizit voraussetzen müssen und damit bestenfalls normale Begründungen sind, welche auf der Akzeptanz von Voraussetzungen basieren. Aber könnte der Apelsche Transzendentalpragmatismus nicht wenigstens für die Grundlagen der Logik eine Letztbegründung liefern? Ist nicht wenigstens die Theorie “Es gibt keine Wahrheit” durch den notwendigen performativen Selbstwiderspruch widerlegt? Nun, ich sehe keinerlei Grund dafür, dass ein allgemeines Verfahren, welches, wie gezeigt, auf einem Gebiet nur schwache Begründungen liefern kann, auf einem anderen Gebiet plötzlich strenge Letztbegründungen liefern sollte. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Begründung uns nur deswegen plausibel erscheint, weil wir das Ergebnis auch ohne Begründung schon immer akzeptiert haben. In Begründungen, in denen Falsches begründet wird, kann man Fehler durch sukzessive Unterteilung finden: Man braucht sich lediglich zu fragen, ob eine Zwischenthese selbst wahr oder falsch ist, schon weiß man, ob der Fehler danach oder davor passiert. Außerdem weiß man sowieso, dass die Begründung fehlerhaft sein muss. Solch eine Methode zum Finden von Lücken in Begründungen richtiger Aussagen gibt es leider nicht. Außerdem sollte man die Möglichkeiten von Theorien nicht unterschätzen, performative Selbstwidersprüche zu verhindern. “Es gibt keine Wahrheit” könnte immer noch auf einer Theorie beruhen, die den üblichen Wahrheitsbegriff nur als eine Annäherung enthält, ähnlich wie die klassische Mechanik in der Quantentheorie als klassische Näherung überlebt. Mit dieser Näherung zu operieren ist, laut Quantentheorie, in gewissen Bereichen, insbesondere im Alltag, völlig legitim. Warum sollte es in einer Wahrheitstheorie ohne Wahrheit nicht ein ähnliches Gebiet geben, in dem der klassische Wahrheitsbegriff als Näherung anwendbar ist? Warum sollte dieser Bereich nicht alle Diskurse in natürlicher Sprache einschließen können? Natürliche Sprachen zeichnen sich ja schließlich bekanntermaßen durch ihre Unschärfe aus. Sicher, als Anhänger einer höchst klassischen Wahrheitstheorie halte ich von solch alternativen Wahrheitstheorien wenig. Und unter meinen Argumenten gegen viele solcher Theorien haben auch performative Selbstwidersprüche ihren Platz. Nur: Für einen Letztbegründungsanspruch sehe ich auch hier keinerlei Grundlage. 5.1. Voraussetzungen für eine Vertragsgesellschaft. Ein klassisches Problem von Letzbegründungsphilosophien ist die Frage, warum Verträge eingehalten werden sollten. So schreibt Apel: “Die . . . Motive für das Eingehen von Vertragsverhältnissen sind in der Tat äußerst plausibel und sogar ausschlaggebend, wenn die einsehbar notwendige Anerkennung der “Grundnorm” bzw. des Grundprinzips einer kommunikativen Vernunftethik schon vorausgesetzt werden kann. Ohne diese Voraussetzung aber . . . ist die gesamte Begründungskonzeption . . . keineswegs schlüssig.” (S. 243) Was hat Apel gegen eine strategisch-zweckrationale Begründung der Ethik einzuwenden? Einmal dass “. . . jeder strategisch-rational Denkende daran interessiert sein müßte, daß alle anderen sich auf Verträge . . . einlassen und [sie] einhalten, 14 I. SCHMELZER während er selber den Vertrag nur scheinbar (d.h. mit kriminellem Vorbehalt) mitabschließt, um ihn bei passender Gelegenheit (wenn keine Sanktionen zu befürchten sind) zu brechen.” (S.243) Nur hat das Brechen von Verträgen nun einmal erhebliche Risiken und Nebenwirkungen: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und weil unter lauter rational denkenden Menschen alle wissen, dass die Vertragspartner auch ihre kriminellen Vorbehalte haben können, löst man diese Probleme durch die verschiedensten Kontrollmöglichkeiten. Wir brauchen also keinerlei Anerkennung einer “Grundnorm” der Vertragstreue, wenn Vertragsbruch hinreichend bestraft wird. Und dazu ist ausreichend, dass er bekannt wird – schon weil man sich, aus purem Eigeninteresse, nicht auf Verträge mit Vertragsbrechern einlassen wird. Apels zweites Argument läßt mich noch ratloser zurück: “Soll in dieser Situation der sogenannten “rationalen Wahl” das Motiv des parasitären Vorbehalts (des “free riders”) tendenziell ausgeschaltet . . . werden, dann muß der einzelne bei der Beantwortung der post-Aufklärungs-Frage “Warum moralisch sein?” auf eine prinzipiell andere rationale Motivation rekurrieren können als die der utilitaristischen Erwägungen von Vorteilen und Nachteilen im Sinne der strategischen Spieltheorie. Er muß, gerade um die plausiblen Argumente utilitaristischer Kooperationstheorien von vornherein im nichtegoistischen Sinne verstehen und würdigen zu können, schon im vorherein ein deontisches Universalisierungsprinzip im Sinne der Gerechtigkeit oder Fairness als unbedingt verbindlich anerkannt haben (also nicht erst aufgrund der Erwägung von Folgen faktisch anerkennen!).” (S.243) Soll denn? Warum? Vielleicht möchte ja Apel, wie obiger strategisch-rational Denkende, erreichen, dass alle anderen sich an die Verträge ohne kriminellen Vorbehalt halten und dabei ihr eigenes strategisch-rationales Handeln aufgeben? Dann wäre es in der Tat nützlich, wenn alle anderen die Gesetze als unbedingt verbindlich anerkennen. Unser Amoralist kennt jedenfalls keine Gründe für obiges “soll”. Nein, wir brauchen keine Letztbegründung für das Einhalten von Verträgen. Es reicht völlig aus, die Einhaltung von Verträgen so zu überwachen, dass es zur Klugheitsregel wird, Verträge einzuhalten. Sicherlich, es wäre schön, wenn man sich all die Kontrollen sparen könnte, weil alle Menschen ehrlich sind und wir alle uns aus freiwilliger Einsicht in Apels Letztbegründung nach den objektiven Normen seiner Diskursethik richten würden. Nur sind solche Utopien keine Option. Höchstens im Elfenbeinturm der Philosophie mag man damit ganz gut leben können. Literatur [1] Die bibliographische Referenz zu dem Buch von Apel, dem die Zitate entnommen sind, ist mir leider verlorengegangen. E-mail address: [email protected] URL: ilja-schmelzer.de