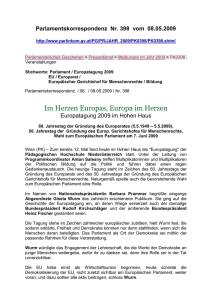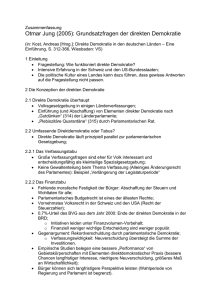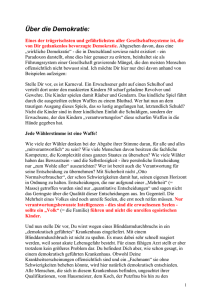Parlamentarismus - Evangelische Akademie Tutzing
Werbung
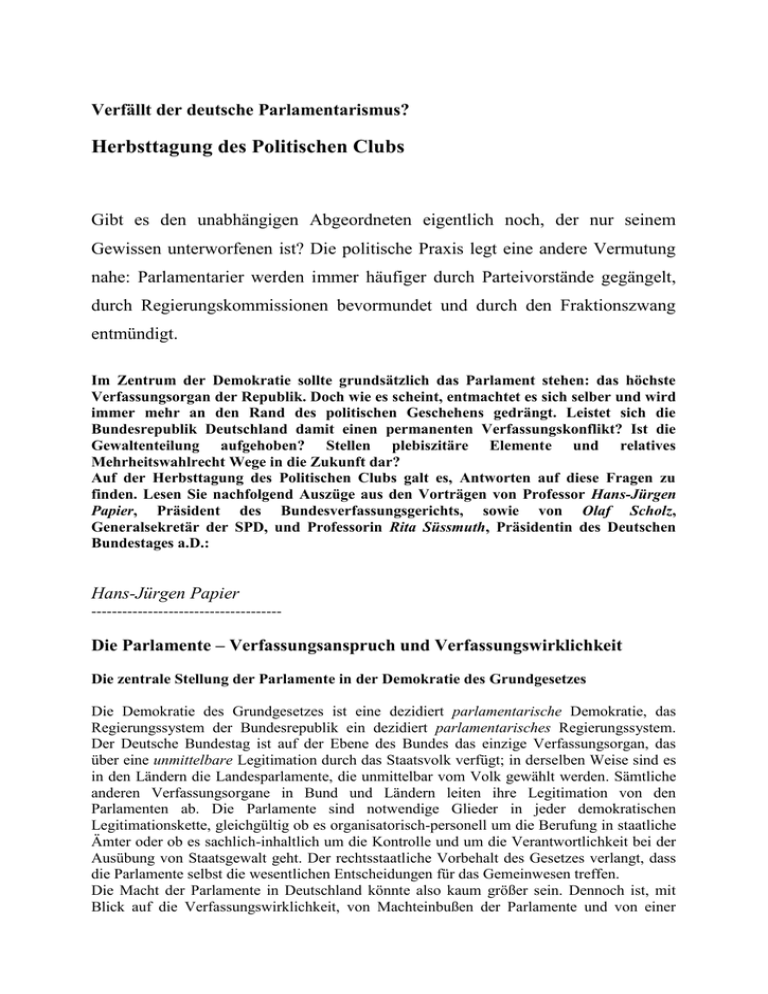
Verfällt der deutsche Parlamentarismus? Herbsttagung des Politischen Clubs Gibt es den unabhängigen Abgeordneten eigentlich noch, der nur seinem Gewissen unterworfenen ist? Die politische Praxis legt eine andere Vermutung nahe: Parlamentarier werden immer häufiger durch Parteivorstände gegängelt, durch Regierungskommissionen bevormundet und durch den Fraktionszwang entmündigt. Im Zentrum der Demokratie sollte grundsätzlich das Parlament stehen: das höchste Verfassungsorgan der Republik. Doch wie es scheint, entmachtet es sich selber und wird immer mehr an den Rand des politischen Geschehens gedrängt. Leistet sich die Bundesrepublik Deutschland damit einen permanenten Verfassungskonflikt? Ist die Gewaltenteilung aufgehoben? Stellen plebiszitäre Elemente und relatives Mehrheitswahlrecht Wege in die Zukunft dar? Auf der Herbsttagung des Politischen Clubs galt es, Antworten auf diese Fragen zu finden. Lesen Sie nachfolgend Auszüge aus den Vorträgen von Professor Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sowie von Olaf Scholz, Generalsekretär der SPD, und Professorin Rita Süssmuth, Präsidentin des Deutschen Bundestages a.D.: Hans-Jürgen Papier ------------------------------------- Die Parlamente – Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit Die zentrale Stellung der Parlamente in der Demokratie des Grundgesetzes Die Demokratie des Grundgesetzes ist eine dezidiert parlamentarische Demokratie, das Regierungssystem der Bundesrepublik ein dezidiert parlamentarisches Regierungssystem. Der Deutsche Bundestag ist auf der Ebene des Bundes das einzige Verfassungsorgan, das über eine unmittelbare Legitimation durch das Staatsvolk verfügt; in derselben Weise sind es in den Ländern die Landesparlamente, die unmittelbar vom Volk gewählt werden. Sämtliche anderen Verfassungsorgane in Bund und Ländern leiten ihre Legitimation von den Parlamenten ab. Die Parlamente sind notwendige Glieder in jeder demokratischen Legitimationskette, gleichgültig ob es organisatorisch-personell um die Berufung in staatliche Ämter oder ob es sachlich-inhaltlich um die Kontrolle und um die Verantwortlichkeit bei der Ausübung von Staatsgewalt geht. Der rechtsstaatliche Vorbehalt des Gesetzes verlangt, dass die Parlamente selbst die wesentlichen Entscheidungen für das Gemeinwesen treffen. Die Macht der Parlamente in Deutschland könnte also kaum größer sein. Dennoch ist, mit Blick auf die Verfassungswirklichkeit, von Machteinbußen der Parlamente und von einer Entparlamentarisierung der Politik die Rede, und das nicht ganz ohne Grund und ohne dass sich heftiger Widerspruch regen würde. Machtzuwachs und Funktionswandel des Bundesrats Das sicherlich auffälligste Phänomen im Spannungsfeld von parlamentarischer Demokratie und Bundesstaatlichkeit bildet der Machtzuwachs des Bundesrats und dessen Wandel zu einer Art „Ersatz-“ oder „Zweit-Opposition“. Der Machtzuwachs spiegelt sich vor allem in einem Anstieg des Anteils zustimmungsbedürftiger Bundesgesetze wider, der seit einiger Zeit bei etwa 60 % liegt; ein Großteil der gesellschaftspolitisch bedeutsamen Gesetzesvorhaben der letzten Jahre fällt hierunter. Allerdings beruht die Machtposition des Bundesrats auch auf einem durchaus eigentümlichen Wahlverhalten. Denn schon seit längerer Zeit bevorzugen die Wähler bei den für die Zusammensetzung des Bundesrats maßgeblichen Wahlen zu den Landesparlamenten diejenigen Parteien, die sie bei der jeweils zurückliegenden Bundestagswahl in die Opposition verwiesen haben. Erst aus diesem Hin- und Her-Pendeln der Wählergunst resultiert letztlich die Schlüsselposition des Bundesrats. In der Öffentlichkeit wird diese Schlüsselposition vielfach als Blockadepotential wahrgenommen. Der Bundesrat fungiert bei politisch brisanten Gesetzesvorhaben des Bundes häufig weniger als Vertretung spezifischer Länderinteressen, sondern nicht selten als parteipolitischer Gegenpart zur Regierungspolitik. Man mag diese Funktionsverschiebung politisch beklagen, verfassungsrechtlich zu beanstanden oder gar zu verhindern ist sie indes im Grundsatz nicht. Wesentliche politische Entscheidungen haben sich jedenfalls aus der parlamentarischen Beratung heraus verlagert in einen Verhandlungsverbund von Regierungsvertretern aus Bund und Ländern. Das Gegenspiel von parlamentarischer Mehrheit und parlamentarischer Opposition ist in gewissem Grade ersetzt durch eine eigengeartete Wechselbeziehung zwischen Bundesregierung einerseits und Bundesratsmehrheit andererseits. Diese schwankt zwischen einer wechselseitigen Blockade im ungünstigen und einer - Bund und Länder übergreifenden - informellen „Großen Koalition“ im günstigen Falle. Entscheidungen sind zumeist nur mehr im Konsens (zumindest) zwischen den beiden großen Volksparteien möglich. Grundlegende Reformen und Richtungsentscheidungen sind unter diesen Bedingungen naturgemäß wesentlich erschwert. Auch Wahlen entscheiden im Grunde weniger über politische Programme und Weichenstellungen als vielmehr über die Verteilung der Karten in künftigen Verhandlungsrunden - manchmal entscheiden sie deshalb auch gar nichts. Korrekturmöglichkeiten und Alternativen Die Verschiebungen in dem Kräftefeld von Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat erscheinen mir als das gravierendste, zugleich aber auch am schwersten lösbare Problem in der Verfassung unseres politischen Systems. Bisherige Reformbemühungen richten sich vor allem auf einen gewissen Rückbau der Zustimmungsrechte des Bundesrats. Doch stößt auch dies auf Grenzen. So ist das Zustimmungsrecht des Bundesrats bei der Gesetzgebung über Steuern, deren Aufkommen ganz oder teilweise den Ländern und Gemeinden zufließt, also insbesondere bei der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer, wohl unverzichtbar. Zu weitgehend erscheint mir auch der Vorschlag, die Grundgesetzbestimmungen zu streichen, wonach Bundesgesetze, die verfahrens- oder organisationsrechtliche Vorschriften enthalten, insgesamt der Zustimmung des Bundesrats bedürfen. Die Verknüpfung von materiellem Recht und Vollzugsregelung kann im Einzelfall politisch durchaus geboten sein, und in einem solchen Fall erfüllt das Erfordernis, dass der Bundesrat dem Gesamtpaket zuzustimmen hat, seinen guten Sinn. Wo es andererseits an einem politisch zwingenden Grund für die Verknüpfung fehlt, dort kann auch schon nach geltendem Verfassungsrecht, wie etwa beim Lebenspartnerschaftsgesetz geschehen, durch eine Aufteilung des Gesetzesinhalts jedenfalls das materielle Regelungsvorhaben gegen einen eventuellen Einspruch des Bundesrats durchgesetzt werden. Dass es dann in den Ländern möglicherweise zu unterschiedlichen Ausführungsregelungen kommt, muss man unter dem Blickwinkel föderalistischer Vielfalt nicht unbedingt als Schaden oder Schönheitsfehler sehen. Eine weitreichende Entflechtung ließe sich meines Erachtens nur erzielen, wenn man den Bundesrat durch einen Senat, ähnlich dem US-amerikanischen Vorbild, ersetzte, also zu einem echten Zwei-Kammer-Parlament überginge. Die Mitglieder eines Senats wären – anders als die Mitglieder des Bundesrats – nicht gleichzeitig Mitglieder einer Landesregierung; die Landesregierungen verlören – umgekehrt – ihren unmittelbaren Einfluss auf die Bundespolitik. Aufgelöst wäre damit zugleich die Verknüpfung zwischen den Länderexekutiven und der Bundesgesetzgebung. Schließlich hätten auch die Wahlen in den Ländern wieder ihren jeweils eindeutigen Bezugspunkt: Landtagswahlen würden unter landespolitischen, Senatswahlen unter bundespolitischen Vorzeichen stehen. Dies könnte zugleich dazu beitragen, den faktischen „Dauerwahlkampf“ etwas abzumildern, der durch die beständige Abfolge der Landtagswahlen entsteht und der sich auf die Gesetzgebungsarbeit im Bund nicht eben förderlich auswirkt. Zudem könnten sich über ein Senatsmodell wieder klarere Mehrheitsverhältnisse und auch eine Stärkung des Persönlichkeitselements ergeben. Gefahren für den Parlamentarismus durch verbändestaatliche Tendenzen Ich meine hiermit die partielle Verlagerung - oder den Versuch der Verlagerung – von wichtigen politischen Entscheidungen aus dem Bereich der staatlichen Institutionen und der verfassungsmäßig vorgesehenen Verfahren heraus in verschiedene Formen einer Kooperation mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verbänden und Interessenvertretungen. Es geht also zum einen um die Satellitenschar von Kommissionen, Räten, Sachverständigengremien, usw., die die Regierung umkreisen und als deren prominenteste Beispiele die Rürup-Kommission, die Hartz-Kommission oder der „Nationale Ethikrat“ stehen bzw. standen. Nicht übersehen werden sollte auch, dass unterhalb der Ebene dieser „Groß-Kommissionen“ zahlreiche weniger auffällige Einrichtungen tagen, wie etwa eine „Task Force“ von Vertretern der Pharmaindustrie, der Gewerkschaften und des Wirtschaftsund Gesundheitsministeriums, die sich mit den Folgen der geplanten Gesundheitsreform befassen soll. Mit in den hier interessierenden Zusammenhang fallen schließlich Verhandlungsrunden – wie etwa das „Bündnis für Arbeit“ – oder Absprachen, wie etwa der bekannte „Atomkonsens“ oder vor einiger Zeit eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller, der sich zur Abwendung eines unbequemen Gesetzesvorhabens bereit erklärte, der Krankenversicherung 400 Millionen DM zur Verfügung zu stellen. Kurz: Das Bedenkliche an der „Kommissionitis“ ist nicht die Inflation des Wortes „Kommission“. Zu beanstanden ist natürlich auch nicht, wenn sich die Politik über Expertengremien externen Sachverstand erschließen will. Es kommt mir dabei auch nicht auf die Anzahl von Kommissionen an, sondern auf deren tatsächlichen und intendierten Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung und auf die Art und Intensität dieses Einflusses. Umgehung der Verfahren und Aushöhlung der Formen Die Gefahr besteht in der Umgehung der Verfahren der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie und in der Aushöhlung ihrer Formen. Denn die Mitglieder von Kommissionen repräsentieren nicht nur Sachverstand, sondern auch eindeutig identifizierbare Interessen von Verbänden, Organisationen und Unternehmen. Problematisch wird es dann, wenn die Artikulation partikularer Interessen in die verfassungsmäßigen Verfahren staatlicher Willensbildung hineinzuwirken und bestimmenden Einfluss auf die dem Parlament vorbehaltene Sachentscheidung zu gewinnen beginnt. Denn viele jener in den letzten Jahren ins Leben gerufenen Kommissionen sollten weniger der informatorischen Ermittlung von Entscheidungsgrundlagen dienen, als vielmehr der maßgeblichen Vorstrukturierung, wenn nicht gar Vorentscheidung der ihnen aufgegebenen Fragen. Damit gewinnt aber ein sehr selektiv bestimmter Kreis von Interessenten einen überproportionalen und in seiner Legitimität fragwürdigen Einfluss auf Entscheidungen und politische Weichenstellungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Entsprechendes gilt für die verschiedenen Formen von Kooperationen und Vereinbarungen. Der eigentlich berufene Bundestag sieht sich dagegen bei derartigen Gestaltungen in die Rolle einer „Ratifikationsinstanz“ gedrängt, die zu einer ihr unterbreiteten Vorlage nur mit „Ja“ oder „Nein“, häufig genug aber eben nur mit „Ja“ antworten kann, weil sie unter dem politischen Druck steht, das mühsam erzielte Verhandlungsergebnis nicht zu gefährden. In solchen Fällen bleibt die Letztentscheidung zwar – formal gesehen – beim Parlament, gleichgültig ob es die Ergebnisse von „Konsensrunden“, den Inhalt von Vereinbarungen oder die Abschlusspapiere von Kommissionen nachvollzieht und als Gesetz verabschiedet. Der Form, die gewahrt bleibt, kann jedoch das materielle Substrat, die Substanz entzogen sein, weil die politischen Weichenstellungen bereits früher und außerhalb des Parlaments erfolgt sind. Die Bedeutung der parlamentarischen Demokratie für den Sozialstaat Der Sozialstaat ist – unjuristisch gesprochen – eine gewaltige Verteilungsmasse, seine Reform ist ein gewaltiger Akt der Um- und Neuverteilung der Gewichte. Wie überall, wo der Staat verteilend und regulierend tätig ist, finden sich auch hier gut organisierte Interessen, die wissen, wie sie über ihre Lobbies die Hebel anzusetzen haben, und auf der anderen Seite wiederum Interessen, die sich nach den Gesetzen der politischen Ökonomie kaum schlagkräftig bündeln lassen und die deshalb leicht unter die Räder geraten. Vor diesem Hintergrund stehen die Parlamente, vor allem der Bundestag, vor einer besonderen Belastungs- und Bewährungsprobe. Denn die parlamentarische Demokratie und das repräsentative Mandat der gewählten Abgeordneten rechtfertigen sich gerade auch dadurch, dass auch den Belangen derer Geltung verschafft werden muss, die nicht von sich allein aus die Kraft und Fähigkeit haben, sich zu artikulieren, sich zu organisieren und sich durchzusetzen. Auftrag des Sozialstaats ist es ferner, zu unterscheiden zwischen den wirklich existenziellen Bedürfnissen und berechtigten Erwartungen auf der einen und bloßer Besitzstandswahrung und überzogenem Anspruchsdenken auf der anderen Seite. Die Fähigkeit zu solcher Unterscheidung setzt eine gewisse Distanz oder Distanziertheit zu den Kräftefeldern des gesellschaftlichen Verteilungskampfes voraus. Das Parlament muss darauf achten, diese Distanz zu wahren, wenn es nicht Gefahr laufen will, zum bloßen verlängerten Arm in diesem Verteilungskampf zu werden. Talkshows als „Ersatzparlamente“? Die Wechselbeziehung von Politik und Medien ist nichts grundlegend Neues. Gerade die Demokratie ist auf die Vermittlung durch die Medien angewiesen; erst die Medien öffnen vielen Bürgern einen Zugang zur Politik, der ihnen sonst verschlossen wäre. Trübsinnig stimmt nur, dass sich in dieser Wechselbeziehung Politik und Medien – und zwar gemeinsam und zum beiderseitigen Schaden – in einer offenbar unentrinnbaren Spirale der Verflachung und Banalisierung bewegen. Man kann das verkürzend wie folgt beschreiben: Der Trend zur Informationsverdünnung, zur Simplifizierung, wenn nicht sogar Unterdrückung jedes halbwegs komplexen Stoffes; die „Verspaßung“ ernsthafter Themen auf der einen und die künstliche Aufregung um Nebensächliches auf der anderen Seite usw. Hat die Symbiose von Politik und Medien aber dazu geführt, dass die politischen Talksshows tatsächlich zu den „Ersatzparlamenten“ der Republik geworden sind? Ich meine, man sollte eher von „Scheinparlamenten“ sprechen. Denn was in den Talkshows und ähnlichen Runden inszeniert wird, ist vielfach eine künstliche Welt. Die immer gleichen medienkompatiblen Politiker führen einen Streit, den die wenigsten wirklich ernst nehmen; Experten geben Ratschläge, auf die keiner hört; Wirtschaftsführer mahnen zur Vernunft und warnen vor dem Abgrund – aber all das bleibt letztendlich doch folgenlos. Und in der nächsten Sendung wird, in thematischer Hinsicht, die nächste Sau durch´s Dorf getrieben. Mehr Distanz zwischen Politik und Medien Nach meinem Dafürhalten täte auch in der Beziehung von Politik und Medien ein Mehr an gegenseitiger Distanz beiden Seiten gut. Denn einerseits hat noch keine Talkshow dazu geführt, dass danach ein Haushaltsdefizit verschwunden oder die Arbeitslosenzahl gesunken wäre. Nach den „Scheinparlamenten“ müssen eben doch die „richtigen“ Parlamente an die Arbeit. Und diese müssen sich nicht nur mit den Sachproblemen in ihrer vollen Komplexität und Schwierigkeit befassen, sondern sie müssen häufig genug auch die falschen Erwartungen korrigieren oder die Verunsicherungen bei den Bürgern beheben, die in den vorangegangenen Medieninszenierungen entstanden sind. Umgekehrt fordert die Nähe zur Politik aber auch auf der Seite der Medien ihren Preis. Man muss sich hier vor Verallgemeinerungen und Übertreibungen hüten, aber ein gewisser Teil der politischen Berichterstattung besteht bereits heute in der schlichten Weitergabe professionell lancierter Pressemitteilungen oder darauf basierender Agenturmeldungen. Statt, wo dies angebracht ist, kritisch nachzufragen oder das Gemeldete kompetent zu bewerten, wird nicht selten ebenso schlicht die entsprechende Pressemitteilung der Gegenseite nachgeschoben. Es sollte nicht so weit kommen, dass sich die Medien letztlich zum bloßen Sprachrohr der Pressesprecher machen und sich von dort die Themen und die Inszenierung ihrer Aufbereitung diktieren lassen. Schlussbemerkung Welches Resumée lässt sich ziehen? Die Gegenüberstellung von Verfassungsanspruch einerseits und Verfassungswirklichkeit andererseits verführt leicht dazu, in die Verfassung zunächst ein idealisierendes Bild des Parlamentarismus zu projizieren, um dann die politische Wirklichkeit in um so dunkleren Farben zeichnen zu können. Das wäre gewiss die falsche Methode. Allerdings weisen das Grundgesetz und die Länderverfassungen den Parlamenten eine zentrale Stellung in unserer demokratischen Staatsordnung zu. Gemessen an diesen normativen, verfassungsrechtlichen Vorgaben wird man sicherlich sagen müssen, dass es gewisse Tendenzen zur Entparlamentarisierung und dass es Gefährdungen des Parlamentarismus gibt. Die Ursachen – das zeigen die drei von mir herausgegriffenen Bereiche des Föderalismus, des Einflusses der Verbände und der Mediendemokratie – sind verschieden geartet und lassen sich nicht über einen Leisten schlagen. Entsprechendes gilt natürlich für die Möglichkeiten der Therapie. In allen drei Bereichen gibt es allerdings Erscheinungsformen der Entparlamentarisierung, deren Ursachen auch in den Parlamenten selbst zu suchen sind. Der Grund für die Kraftlosigkeit und den geringen Gestaltungswillen vieler Landesparlamente liegt jedenfalls nicht in unserer bundesstaatlichen Verfassungsordnung. Die Verlagerung wichtiger politischer Vorentscheidungen in außerparlamentarische Gremien ist ein Politikstil, den ein Parlament hinnehmen, der ihm aber nicht aufgezwungen werden kann. Wenn deshalb von Machtverlusten der Parlamente gesprochen wird, so handelt es sich, jedenfalls in Teilen, auch um selbst verursachte. Und wenn eine Stärkung und Erneuerung des Parlamentarismus gefordert wird, so muss diese auch von den Parlamenten selbst geleistet werden. Olaf Scholz ----------------------------- Politische Parteien und Bundestag Es ist offensichtlich: Unsere Republik befindet sich im Umbruch. Und ebenso klar ist: Dieser Umbruch wirkt sich auch auf den Parlamentarismus und das Parteiensystem in Deutschland aus. Aber wie? Verhindern traditionelle Vorkehrungen und Traditionen die zeitgemäße Modernisierung unserer Republik? Gibt es Wechselwirkungen zwischen dem nun eingeleiteten Umbau unseres Gemeinwesens und seinen institutionellen Mustern? Welche Rollen nehmen Parteien und Bundestag wahr? Was hat sich bereits verändert und was verändert sich weiter? Meine Damen und Herren, „gegängelt“, „bevormundet“, „entmündigt“ - träfen diese Vorwürfe auch nur zur Hälfte zu, dann wäre es in der Tat nicht sehr gut bestellt um den deutschen Parlamentarismus. Und dann wären es, wenn ich die Kritik richtig verstehe, nicht zuletzt die politischen Parteien, die die Schuld an diesem vermeintlichen Verfall des Parlamentarismus tragen. Ich spreche hier vorläufig von „vermeintlichem“ Verfall, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das alles stimmt. Die Rede vom Verfall der Parlamente ist ja nicht so neu. Sie hat den Parlamentarismus begleitet, seit er sich als neuzeitliches Regierungsprinzip in Großbritannien durchsetzte. Gemessen daran jedenfalls hat sich das Parlament als äußerst zählebige Institution erwiesen und seine Stellung im Zentrum der politischen Entscheidungsprozesse zumindest in formeller Hinsicht behauptet. Deshalb muss die These vom Verfall der Parlamente oder des Parlamentarismus ja nicht unbedingt falsch sein. Falsch ist sie allerdings nach meiner Überzeugung in ihrer gängigsten Fassung. Falsch ist nämlich der Vorwurf, in der Bundesrepublik sei die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive heute faktisch aufgehoben, abgeschafft, verloren gegangen. Diesem Vorwurf liegt ein überkommenes, konstitutionalistisches Verständnis von Parlamentarismus zugrunde, das ganz einfach nicht mehr zeitgemäß ist. In diesem Konstitutionalismus, in dem das Parlament als Repräsentant des Volkes der vom Herrscher eingesetzten Regierung als Kontrolleur gegenüberstand, befinden wir uns heute längst nicht mehr. Es ist nicht zu erkennen, wie die parteiendemokratische Frontstellung, also der neue Dualismus zwischen Regierungsmehrheit und Opposition, noch einmal aufgelöst und das klassische, konstitutionelle Gewaltenteilungskonzept doch noch in die Praxis umgesetzt werden könnte. Das ist allerdings kein Schaden. Denn nach einem modernen und zeitgemäßen Verständnis von Parlamentarismus stehen sich Legislative und Exekutive, stehen sich Bundestag und Regierung gerade nicht als Ganze gegenüber. Vielmehr bilden der Kanzler mit dem Kabinett und die Bundestagsmehrheit eine personell ineinander verschränkte politische Aktionseinheit. Dieser Regierungsmehrheit stehen ganz im Sinne der Idee von checks and balances die Fraktionen der parlamentarischen Opposition gegenüber. Erst aus dieser Konstellation ergibt sich im echten parlamentarischen Regierungssystem die Möglichkeit zu einer umfassenden Kontrolle der Exekutive. Parlamentarische Demokratie wird also nicht mehr ausschließlich durch den Gegensatz von Legislative und Exekutive bestimmt, sondern auch durch den Gegensatz von Regierungsmehrheit und Opposition. Dieser neue Parlamentarismus basiert auf dem Prinzip des mehrheitsdemokratischen Parteienwettbewerbs. Diejenigen Parteien, die aus den Wahlen als Sieger hervorgehen, stellen die Regierung. Die Minderheit übernimmt die Rolle der Opposition. Was nun als permanenter Verfassungskonflikt bezeichnet werden könnte, das ist in Wirklichkeit nicht die Folge der Funktionsweise unseres parlamentarischen Systems. Der Konflikt liegt anderswo, nämlich zwischen der tatsächlichen Funktionsweise unseres Parlamentarismus einerseits und dessen öffentlicher Wahrnehmung andererseits. Wie sich in empirischen Untersuchungen gezeigt hat, messen die Bürgerinnen und Bürger unseren Parlamentarismus vielfach an Maßstäben, die gar nicht zu ihm passen. Viel populärer als das parlamentarische Regierungssystem ist das präsidentielle, bei dem das Volk zum einen den tatsächlichen Chef der Regierung wählt, andererseits aber auch ein Parlament, das der Regierung als Ganzes gegenübersteht. Das gibt es auch. Aber das ist nicht das Modell der parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik. Missverständnisse über die reale Funktionsweise unseres Parlamentarismus 1. Zur berechtigten Kritik an den politischen Parteien gibt es sicherlich immer genügend Gründe. Aber wo die Parteiendemokratie zum Übel an sich erklärt wird, da fehlt es in sehr grundsätzlicher Weise an Einsicht in die Funktionsbedingungen moderner Politik. Professor Hennes, bekanntlich seit Jahrzehnten einer der schärfsten Kritiker der deutschen Parteien, hat es folgendermaßen ausgedrückt, ich zitiere: „Dass politische Herrschaft, wenn sie eine demokratische sein will, unter modernen Bedingungen Herrschaft durch Parteien sein muss und soll, das versteht sich von selbst.“ Ich glaube, dass es richtig ist zu dem zurückzukehren, was auch unser Grundgesetz sagt, dass nämlich die Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken und wir nicht eine politische Öffentlichkeit entwickeln, die die Parteien zum Problem der Demokratie erklärt. Wir haben viel zu tun, dieses politische Missverständnis unserer parlamentarischen Demokratie auch wieder in Ordnung zu bringen. 2. Wo nicht erkannt wird, dass es Aufgabe jeder Parlamentsmehrheit ist, die aus ihr hervorgegangene Regierung im Amt zu halten, da herrscht folgerichtig auch Unverständnis darüber, weshalb Koalitions- und Oppositionsfraktion im Parlament meist einheitlich abstimmen. Viele Bürger können sich parlamentarische Mannschaftsdisziplin nur als Ergebnis irgendwelcher Einschüchterungsversuche und Zwangsmaßnahmen durch Partei- und Fraktionsführung vorstellen. Richtig ist, dass es sich hier zweifellos um eine Form der Selbstdisziplinierung handelt, keineswegs aber um eine Selbstentmündigung. Dieses Verhalten ergibt sich absolut folgerichtig aus der parlamentarischen Funktionslogik selbst, denn die parlamentarische Mehrheit hat ein ganz natürliches Interesse daran, die Regierung zu stützen. 3. Erst recht keine Klarheit besteht heute in großen Teilen der Bevölkerung über die Rolle der Abgeordneten. Parlamentarier würden, um die einschlägigen Formulierungen zu wiederholen, von Partei- und Fraktionsführung auf skandalöse Weise gegängelt, bevormundet und entmündigt. Auch dieser Vorwurf verkennt, dass die Abgeordneten selbst auf verschiedenen Ebenen Führungsfunktionen in ihren jeweiligen Parteien bekleiden. Sie sind also in gewisser Weise selbst die Partei. Parlamentarier müssen deshalb in aller Regel eben nicht von irgendwelchen Mächten zur Fraktionsdisziplin gezwungen werden, vielmehr ist Fraktionsdisziplin ein ganz natürlicher Bestandteil dessen, was parlamentarisches Regieren unter Bedingungen von Parteiendemokratie notwendigerweise ausmacht. Tatsächliche Probleme von Parlamentarismus und Parteiendemokratie In der modernen Politikwissenschaft ist die Rede von „Transformation der Demokratie“, von der „Entparlamentarisierung der politischen Systeme“, einige Wissenschaftler sprechen sogar vom „Heraufziehen der postparlamentarischen Demokratie“. Man ist sich also, wie es scheint, unter den wissenschaftlichen Experten heute weitgehend darüber einig, dass die Parlamente an Bedeutung eingebüßt haben und dass sie unter den veränderten Rahmenbedingungen ihre Gesetzgebungs- und Kontrollfunktion nicht mehr ausreichend erfüllen könnten. Wichtige Regulierungen, heißt es, würden zunehmend in innerstaatlichen und internationalen Verhandlungssystemen beschlossen oder doch zumindest so weit vorbereitet, dass die Parlamente nur noch abnicken, was anderswo im Grunde schon beschlossen worden sei. Regierungen, so heißt es weiter, seien immer mehr in Kooperation mit gesellschaftlichen Organisationen und den Regierungen anderer Staaten eingebunden, und sie würden sich damit zunehmend der Kontrolle durch die Parlamente entziehen. Im so genannten kooperativen, auf die ständige Aushandlung zwischen vielfältigen Akteuren angewiesenen Staat erlitten daher die Parlamente einen gravierenden Funktionsverlust. Das hat vielfältige Konsequenzen, gerade auch im Hinblick auf den Parteienwettbewerb. Parteien, die sich gegenüber ihren Wählern als möglichst klar konturierte Alternativen präsentieren müssen, sind im kooperativen Staat immer stärker darauf angewiesen, Kompromisse zu schließen. Grundsätzlich ist es zwar zu begrüßen, wenn zwischen politischen Kontrahenten Kompromisse möglich sind, unbestreitbar ist aber, dass damit die Wahrscheinlichkeit wächst, dass Wählerinnen und Wähler die Verantwortlichkeit für politische Entscheidungen nicht mehr ohne weiteres der Regierung oder der Opposition zuordnen können. Die orientierende Funktion des Parteienwettbewerbs nimmt ab. Wir müssen uns klarmachen, dass wir es mit einer riskanten Entwicklung zu tun haben, wenn sich Bürgerinnen und Bürger angesichts der zunehmenden Unübersichtlichkeit politischer Verfahren ohnmächtig fühlen. Das Vertrauen in Parlament und Abgeordnete schwindet. Die Folge ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger aus den Prozessen der Politik verabschieden, die Wahlbeteiligung sinkt, die Bindungskraft der Parteien lässt nach. Diese Entwicklung wird noch dadurch verstärkt, dass das Parlament - weniger jedenfalls als früher - in der Öffentlichkeit als Bühne der politischen Auseinandersetzung wahrgenommen wird. Als neue Bühne haben sich zum Beispiel unzählige Talkshows etabliert. Diese problematische Entparlamentarisierung des Öffentlichen wird uns noch manches Kopfzerbrechen bereiten. Was ist zu tun? Als Allheilmittel gegen solche Entfremdungstendenzen zwischen Bürger und Politik werden häufig plebiszitäre Verfahren genannt. Die direkte Einflussnahme auf Entscheidungen sei derjenige Mechanismus, mit dem sich eine neue Identifikation mit dem politischen System schaffen lasse. Ich bin da nicht so sicher. Ich glaube nicht, das plebiszitäre Verfahren das Allheilmittel für die Defizite des Parlaments sind. Was diesen Verfahren ganz fehlt, ist das Element des Austauschs von Argumenten in einem überschaubaren Verfahren. Deshalb ist die Überlegenheit direkt demokratischer Verfahren gerade dort zweifelhaft, wo es um Entscheidungen von großer Tragweite geht. Dennoch können plebiszitäre Verfahren eine positive Wirkung dadurch entfalten, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern als Handlungsmöglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Dies könnte einerseits Parlamente und Parteien dazu veranlassen, ihr Handeln oder Nicht-Handeln argumentativ besser als bisher zu unterfüttern. Andererseits könnte die bloße Existenz plebiszitärer Mitwirkungsmöglichkeiten mithelfen, die von Populisten ausbeutbare Vorstellung zu überwinden, derzufolge die Bürger heute den politischen Eliten hilflos ausgeliefert seien. Deshalb sollten wir, davon bin ich fest überzeugt, im Grundgesetz die Möglichkeit direkter Volksgesetzgebung verankern. Es muss uns sehr klar sein, dass sich die Rahmenbedingungen von Parlamentarismus und Parteiendemokratie ändern. Deshalb ist die zugespitzte Leitfrage dieser Tagung „Verfällt der deutsche Parlamentarismus?“ die richtige Frage zur richtigen Zeit, und wir werden noch viel Mühe darauf zu verwenden haben, sie nicht bejahend beantworten zu müssen. Rita Süssmuth ----------------------------------------- Die Ohnmacht des Parlaments Mir liegt heute Nachmittag daran, dass wir den Blick auch auf die handelnden Personen in den Institutionen richten. Dabei schicke ich voraus, dass mich die Frage „Ansehensverlust des Parlaments?“ in all den Jahren umgetrieben hat, zumal dieser sich ständig verstärkt und auch beschleunigt hat. Die empirischen Werte sind immer schlechter geworden und haben sich nicht auf einem bestimmten Niveau stabilisiert. Eine Schwächung des Parlaments ist nicht primär durch entscheidende Veränderungen der Stellung des Parlaments und der im Parlament geltenden Regeln erfolgt, sondern durch eine permanente Aushöhlung, auch durch ein Unterlaufen dessen, was parlamentarische Regeln sein müssten. Dabei hat insbesondere der Bundesrat seit 1989 sehr stark in den Kompetenzen gewonnen, auch in Bezug auf seine europapolitischen Kompetenzen. Die Schwächung des Parlaments schlägt sich nicht nur in der Wahrnehmung der Bürger und Bürgerinnen nieder, sondern in der Wahrnehmung insbesondere all jener, die als Abgeordnete – gleich, welcher Fraktion – zunehmend den Eindruck gewinnen: Wir sind eher Zustimmende als Entscheidende. Das, was für außenpolitische Verträge generell gilt, dass wir nur mit „ja“ oder „nein“ antworten können, gilt für immer mehr Bereiche, die vorentschieden sind. Was ich erlebt habe, ist eine zunehmende Erfahrung von Parlamentariern, keinen Einfluss zu besitzen. Ohnmacht heißt ja, ohne Macht, ohne Einfluss zu sein. In aller Regel kommen die meisten neuen Parlamentarier mit hohen Erwartungen in unser Parlament. Sie haben dann sehr bald zu lernen, dass das Innovative in ihnen, das Lebendige, stark abnimmt. Das nennt man die deformation professionelle, die Anpassung an das System. Und die wird sehr rasch gelernt. Wenn du durchkommen willst, passe dich an. Folglich muss ich sagen: Es hat nicht nur eine wachsende Zahl von Parlamentariern das Gefühl von geringer bis keiner Einflussnahme, sondern es entspricht sich hier etwas. Das Volk sagt, wir sind ohnmächtig und können nichts tun; die Parlamentarier sagen es hingegen nicht, haben aber auch das gleiche Gefühl. Was die Empirie ebenfalls zutage gefördert hat, heißt: So verärgert die Menschen oft über unsere politischen Verhaltensweisen auch sind, aber es wächst der Wunsch nach mehr Beteiligung. Das ist für die Frage „Welche Zukunft hat die Demokratie?“ eine gute Sache. Was hilft mir ein gutes System ohne Menschen, die mitmachen? Das ist aber bei den Parlamentariern eher als eine Art von Bedrohung zu sehen: Wenn die Bürger sich jetzt auch noch mehr beteiligen wollen, wo bleibt denn dann eigentlich unsere Stellung in der repräsentativen Demokratie? Die Umstellungen, die wir für die Zukunft brauchen, auf die gehen wir nicht ein und schimpfen dann auf Kommissionen. Viele unserer parlamentarischen Anhörungen könnten wir uns sparen, weil diejenigen, die daran teilnehmen, schon genau wissen, dass nach dem Schlüssel der Parteien aufgeteilt wird, und am Ende haben sie so gut wie keinen Einfluss auf das Verfahren genommen. Diese Scheinanhörungen können wir uns sparen. Entweder nehmen wir die Anzuhörenden aus Verbänden, der Wissenschaft oder woher auch immer ernst und setzen uns damit auseinander – oder dieses Instrument hat keinen Sinn. Bürgerbeteiligung nutzen Ich nenne das so deutlich beim Namen, weil wir um dieser parlamentarischen Demokratie willen eine Reihe von Umstellungen vornehmen müssen. Lassen Sie mich das Beispiel der Unternehmenskultur anführen. Davon können wir eine Menge lernen. In modernen Unternehmenskulturen wird das getan, was wir dringend vom Parlament aus brauchen: Information, Kommunikation, Transparenz und Beteiligung. Ich kenne inzwischen viele Unternehmen, wo die Beschäftigten Vorschläge unterbreiten, die geprüft werden und auf die sie in aller Regel in vier Wochen eine Antwort bekommen. Was das für die Motivation und Produktivität in einem Unternehmen bedeutet, sagen ihnen die evaluierenden Berichte. Diese Erfahrung machen viele Bürger und Bürgerinnen bei uns nicht, weder auf der kommunalen, noch auf der Länder-, noch auf der Bundesebene. In dieser Ohne-Macht-Situation haben wir gleichzeitig das Phänomen von Unter- und Überschätzung. Worin die Unterschätzung besteht, habe ich soeben dargestellt: Wir können nicht adäquat Einfluss nehmen, obwohl wir in Ausschüssen sind, obwohl wir abstimmen, etc. Die Überschätzung besteht darin: „Also wisst ihr, wir als Politiker und Politikerinnen wissen schon, wie das Ding zu lösen ist.“ Dabei ist es in ganz vielen Fällen so, auch in den schwierigen Reformvorhaben, dass wir noch längst nicht wissen, wie eine Sache adäquat zu lösen ist. Wenn Einzelne sagen, sie hätten die Lösung, dann dauert es lange, bis sie Mehrheiten dafür finden. Deswegen ist es ganz entscheidend, dieses Prozesshafte auch den Bürgern mitzuteilen, dass wir für vieles keine Lösung besitzen und dass wir auch wissen, dass ein beträchtlicher Teil an Lösungsvorschlägen aus der Bürgerschaft selbst kommt. Ich könnte Ihnen das an vielen Beispielen erläutern, gerade im Familien- und Sozialpolitischen, im Gesundheitspolitischen. Gegenwärtig wird das wachsende Engagement der Bürgerschaft maßlos unterschätzt, und wir kritisieren bei 30 Prozent Beteiligung, dass niemand sich engagieren wolle. Die Menschen unseres Landes wollen nicht einfach von oben nach unten Weisungen erhalten; wir könnten unser Bürgerpotenzial weit besser ausschöpfen, als wir das gegenwärtig tun. Zur lebendigen Demokratie gehört dieses. Plebiszite Es gibt Plebiszite, die ich nicht gleich verwerfen würde. Länder, die über europäische Verfassungsveränderungen abstimmen lassen, die haben gar keine schlechten Erfahrungen gemacht, zumal alle politisch Handelnden verpflichtet waren, den Bürgern und Bürgerinnen Sachverhalte zu erklären und dafür zu werben. Die Sache hat also zwei Seiten. Natürlich besitzt das Plebiszit die Gefahr der momentanen, auch unreflektierten Entscheidung. Aber welches Parlament ist denn gesichert vor unreflektierten Entscheidungen? Dort kommen sie auch zustande. Auch von den Argumenten, warum wir in der Bundesrepublik nicht den Bundespräsidenten wählen können, überzeugt mich fast keines. Wir wollen das nicht. Wir wollen die alte Form beibehalten. Aber von all den Ländern, die auch keine Präsidialverfassung haben und die den Präsidenten wählen, weiß ich nicht, wo diese undemokratischer wären oder wo sie Schaden genommen hätten. Wir blockieren uns selbst an verschiedenen Stellen. Denn was wir gegenwärtig in fast allen Bereichen vorfinden, das ist Vertrauensverlust. Und ohne Vertrauen können wir in der Demokratie nicht arbeiten. Wenn Sie das Vertrauen erst einmal verloren haben, dauert es sehr lange, bis Sie es zurückgewinnen. Das können Sie nur durch überzeugende Taten, nicht allein durch institutionelle Reformen. Die Reformen besitzen lediglich eine unterstützende Funktion. Entscheidungen treffen Ein zentrales Problem in unserem politischen System und damit auch im parlamentarischen ist die Entscheidungsscheuheit und Konfliktscheuheit. Also: „Bevor ich die falsche Entscheidung treffe, treffe ich gar keine.“ Und was mag passieren, wenn wir die falsche Entscheidung getroffen haben? Für die muss ich einstehen! Ich kann im parlamentarischpolitischen System nicht handeln, ohne auch Fehler zu machen. Wir möchten zwar alle gleich sein, aber am liebsten immer die Entscheidungen auf einen Verantwortlichen abwälzen, damit die anderen nicht an der Verantwortung teilhaben. Das ist ein maßgeblicher Grund. Und wenn ich dann noch Entscheidungen in Vier-Jahres-Perioden sehe, dann muss ich sagen: Vieles, was in der Politik zu entscheiden oder nicht zu entscheiden ist, wird primär betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Wiederwahl. Oft geht Macht vor Sache. Das erzeugt Widerwillen und Ablehnung und Kritik. Natürlich habe ich darauf zu achten, dass ich in der Demokratie um Zustimmung und Wiederwahl werbe. Aber wenn ich deswegen ganz bestimmte, lange anstehende Probleme nicht löse, habe ich es eigentlich nicht verdient, wieder gewählt zu werden. Deswegen gehört zur parlamentarischen Demokratie: Die Wahrheit ist zumutbar, die Wahrheit ist konkret. Das ständige Beschönigen von Tatbeständen bringt uns nicht weiter. Diskussions- und Streitkultur stärken Wie diskutieren wir miteinander? Ein zentraler Ablehnungsgrund des Parlaments ist die fehlende Parlamentskultur. Es ist die Art und Weise, wie Menschen – und hier die Repräsentanten des Volkes im wichtigsten Forum der Nation - miteinander umgehen. Beobachten Sie Parlamentsdebatten. Sie folgen sehr häufig dem Muster „Wie bringe ich zwischen Mehrheit und Opposition ins Feld, dass der eine der Sieger, der andere der Verlierer ist?“ Die besten Redner sind die mit den meisten Schlagabtauschen. Der Öffentlichkeit wird dadurch der Eindruck vermittelt: Hier herrscht brutale Auseinandersetzung mit dem Wort. Das Muster gilt insbesondere für die Parteien: Wenn du den anderen nicht fertig gemacht hast, warst du kein guter Redner. Das widerspricht allen Regeln, die wir uns gegeben haben in der Frage des respektvollen, fairen, wenn auch harten Umgangs in der Debatte. Wie steht es eigentlich – das gehört ebenfalls zur Parlamentskultur – mit dem Streit, auch in der eigenen Fraktion? Es würde unseren Fraktionen und Parteien gut tun, selbststreitig mitzudiskutieren. Jeder, der in einer Debatte unterliegt, kann zu einem anderen Zeitpunkt dann auch wieder erfolgreich sein. Wir würden gewinnen durch eine gekonnte Streitkultur in Fraktionen und im Parlament. Da ist sehr viel zu lernen. Debatten, in denen unsere Abgeordneten selbst ihre Positionen darstellen können, so genannte freigegebene Debatten, zeigen, dass die Abgeordneten erstens hohe Potenziale besitzen, dass sie sehr verantwortlich mit der Argumentation umgehen und dass wir keinesfalls ein Chaos anrichten. Ich fürchte, dass wir unserer jungen Generation, in der genügend Talente vorhanden sind, wenig Ermunterung gegeben haben, dass eine Demokratie von Engagement und Zivilcourage lebt. Ich gehe davon aus: Ohne die Veränderung der handelnden Personen, ohne politische Überzeugungen und Visionen, nur mit Pragmatismus und Opportunität kann eine Demokratie sich nicht gut entwickeln. (Die vollständigen Vorträge können über das Pressereferat der Akademie bezogen werden.)