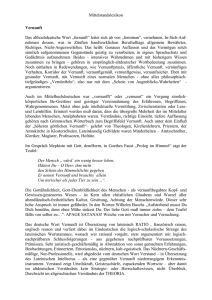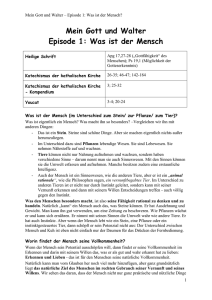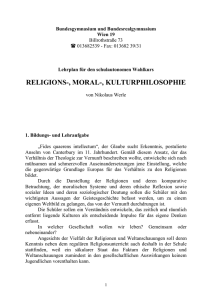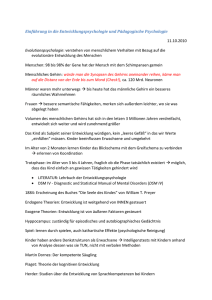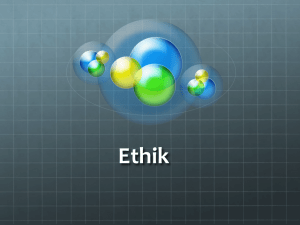vorlesung3.ws.2016-17_649081(2)
Werbung

Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz Die epistemische Koexistenz von Theorie und Wissen - aus wissenschaftstheoretischer Perspektive Vorlesung Ludwig-Maximilians-Universität München WS 2016/17 2 3 Vorlesung 3 (03.11.2016) Die mittelalterliche Phase: Thomas von Aquin Wenn man die Behandlung dieser ganzen Problematik durch Thomas genauer betrachtet, so fällt vor allem sein spezifisches methodisches Verfahren auf, das in die Philosophiegeschichte unter dem Namen „scholastische Methode“ eingegangen ist. Die scholastische Methode, die sowohl beim Verfassen von Texten als auch beim Unterrichten verwendet wurde, kennzeichnen scharfe Fragestellung, klare Begriffe, logische Beweisführung und klare Terminologie. Man könnte fünf Schritte dieser Methode unterscheiden: (1) Lectio (=Vorlesung) – die überlieferten Schriften werden erschlossen durch Erklärungen, die in Kommentaren niedergelegt wurden; (2) Disputation – besteht aus der geregelten Rede und Gegenrede, hier werden die Einzelfragen vertieft; (3) Quaestiones (=Fragen) – es werden die grundlegenden Fragen gesammelt, die sich aus der Disputation ergeben; (4) Entfaltung der positiven Lösung – vollzieht sich auf der Basis der Beantwortung der vorausgehenden Fragen. Die Lösung wird dann begründet; und (5) Die Beantwortung der Einwände – im letzten Schritt werden Einwände beantwortet, welche gegen die positive Lösung erhoben wurden. Zur Entfaltung der scholastischen Methode hat zweifellos Thomas von Aquin maßgeblich beigetragen, weil sein Denken nicht nur durch eine außerordentliche Kraft zur Synthese gekennzeichnet ist, sondern auch durch die Logik der Gedankenführung und die Klarheit der Sprache. Deshalb ist auch die Frage durchaus gerechtfertigt, inwiefern die scholastische Methode die Leistungen der gegenwärtigen Wissenschaftstheorie steigern kann. Zunächst wollen wir uns eine Basis verschaffen, indem wir ein konkretes Beispiel des Thomas von Aquin aus seiner „Summa Theologiae“ darstellen. Erst dann wird diese Frage beantwortet. Als Beispiel wählen wir also die Frage 90 („Das Wesen des Gesetzes“), den Artikel 1 „Ist das Gesetz Sache der Vernunft?“ 4 Thomas fragt also in der Frage 90 nach dem Wesen des Gesetzes. Einleitend gibt er dem Leser zum Nachdenken: Der äußere Seinsgrund, der zum Guten hinbewegt, ist Gott. Er unterweist uns durch das Gesetz und hilft uns durch die Gnade. Zum Gesetz im Allgemeinen ist dreierlei zu untersuchen: das Wesen des Gesetzes, der Unterschied der Gesetze, die Wirkungen des Gesetzes. Wenn es um das Wesen des Gesetzes geht, so stellen sich für Thomas vier Einzelfragen: (1) Ist das Gesetz Sache der Vernunft? (2) Was ist das Ziel des Gesetzes? (3) Was ist seine Ursache? und (4) Ist seine öffentliche Bekanntgabe erforderlich? Die erste Frage, die wir als einzige in diesem Abschnitt paradigmatisch aufgreifen, wird am Ende positiv beantwortet. Zuvor schickt aber Thomas folgende systematische Überlegung voraus: I. Lectio: Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief (7,23): „Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern…“. Nun ist aber nichts von dem, was Sache der Vernunft ist, in den Gliedern; denn die Vernunft ist nicht tätig vermöge eines körperlichen Organs. Also => ist das Gesetz nicht Sache der Vernunft. II. Disputation: Die Vernunft umfasst das Vermögen, das Gehaben, die Tätigkeit, und sonst nichts. Das Gesetz ist aber nicht das Vernunftvermögen, es ist ebenfalls nicht ein Gehaben der Vernunft: denn die Gehaben der Vernunft sind die Tugenden des Verstandes. Das Gesetz ist auch nicht eine Tätigkeit der Vernunft; sonst müsste das Gesetz zu bestehen aufhören, sooft die Vernunft nicht in Tätigkeit ist, wie etwa, wenn der Mensch schläft. Also => ist das Gesetz nicht Sache der Vernunft. III. Quaestiones: Das Gesetz bewegt jene, die ihm unterstellt sind, zum richtigen Handeln. Zum Handeln bewegen ist aber eigentliche Sache des Willens. Also => ist das Gesetz nicht Sache der Vernunft, sondern vielmehr des Willens. IV. Entfaltung der positiven Lösung: Andererseits ist es die Aufgabe des Gesetzes, zu gebieten und verbieten. Gebieten ist aber Sache der Vernunft. Also => ist das Gesetz Sache der Vernunft. Begründung: Das Gesetz ist eine Art Regel und Richtmaß der Tätigkeiten, dem zufolge einer zum Handeln angeleitet oder vom Handeln abgeleitet wird. Gesetz [lex] kommt nämlich vom lateinischen ligare [= binden], weil es für das Handeln verbindlich ist. Denn der Vernunft obliegt es, auf ein Ziel hinzuordnen, das der erste Seinsgrund für das Handeln ist. In jedweder Gattung ist nun das, was Seinsgrund ist, Richtmaß und Regel für diese Gattung, wie die Einheit in 5 der Gattung der Zahl und die erste Bewegung in der Gattung der Bewegungen. Von daher ergibt sich, dass das Gesetz Sache der Vernunft ist. V. Die Beantwortung der Einwände: (1) Da das Gesetz eine Art Regel und Richtmaß ist, kann man auf zweifache Weise sagen, es sei in jemandem: Einmal wie in dem, der misst und regelt; und weil dies die eigentümliche die Aufgabe der Vernunft ist, ist das Gesetz auf diese Weise in der Vernunft allein. Das andere Mal wie in dem, was geregelt und gemessen wird. So ist das Gesetz in allen, die aufgrund eines Gesetzes Neigung zu etwas bekommen. Demzufolge kann jede Neigung, die aus einem Gesetz hervorgeht, Gesetz heißen, nicht zwar dem Wesen nach, aber gleichsam der Teilhabe nach. Und in dieser Weise kann die Geneigtheit der Glieder zur Begierde „Gesetz der Glieder“ genannt werden. (2) Wie in den äußeren Tätigkeiten das Wirken und das Gewirkte, z.B. das Erbauen und das Erbaute, zu beachten ist, so muss in den Werken der Vernunft beachtet werden die Vernunfttätigkeit selbst, die im Einsehen und Schlussfolgern besteht, und das durch diese Tätigkeit Hervorgebrachte. In der auf die Schau gerichteten Vernunft ist das erstens die Begriffsbestimmung, zweitens der Satz, drittens das Schlussverfahren oder der Beweis. Nun bedient sich auch die auf das Tun gerichtete Vernunft im Bereich des Tätigseins einer Art Schlussverfahren; es gibt daher in der auf das Tun gerichteten Vernunft etwas, was sich zu den Tätigkeiten so verhält, wie in der auf die Schau gerichteten Vernunft der Satz sich verhält zu den Schlussfolgerungen. Diese allgemeinen Sätze der auf das Tun gerichteten Vernunft, die auf die Tätigkeiten hingeordnet sind, haben die Bewandtnis des Gesetzes. (3) Die Kraft zu bewegen hat die Vernunft vom Willen. Denn kraft dessen, dass einer ein Ziel will, gebietet die Vernunft hinsichtlich dessen, was zum Ziel hinführt. Damit aber das Wollen die Bewandtnis des Gesetzes annehme, bedarf es in Bezug auf das, was geboten wird, der Regulierung durch einen Vernunftspruch (vgl. STh I/II 90,1). Was ergibt sich also aus dieser systematischen, aus den fünf Schritten bestehenden Überlegung des Thomas für die gegenwärtige Wissenschaftstheorie? Kann die scholastische Methode die Leistung der Wissenschaftstheorie steigern? Es sollen zumindest zwei Dinge hervorgehoben werden: (a) Auch die Wissenschaftstheorie kann viel effizienter agieren, wenn sie beim Entwerfen der Methode, um das Wie-des-Wissens zu erklären, jeweilige thematische Grundlage vor Augen hat. Es muss nicht betont werden, dass die Behandlung verschiedener Themen verschiedene Methoden voraussetzt. Denn 6 wir fragen in erster Linie nach dem Wie-des-Wissens, das immer schon in einem bestimmten Verhältnis zur Wirklichkeit steht. Dabei ist sekundär, inwiefern dieses Verhältnis geklärt ist, bzw. geklärt werden kann. (b) Und das positive, sich der Anwendung der richtigen Methode verdankende Resultat erfordert stets einen entsprechenden Spielraum, um sich zu der Gestalt entfalten zu können, welche ihm „wesenhaft“ zukommt. Das Entstehen eines solchen Spielraums wird dadurch ermöglicht, dass auch Anregungen angesprochen werden, welche sich letzten Endes als untauglich erweisen können. Im Endeffekt tragen sie aber dazu bei, dass das positive Resultat an Schärfe gewinnt. Die neuzeitliche Phase In der Neuzeit gab es noch keine Wissenschaftstheorie im strengen Sinne. Dennoch kann man einige wichtige Impulse finden, die später auch wissenschaftstheoretische Auswirkungen haben werden. Sie alle verdanken sich dem Bruch mit den mittelalterlichen Idealen, von den denen noch die Überlegungen des Thomas getragen waren. Dieser Bruch zeigt sich vor allem auf drei Ebenen (E): der religiösen E, der Kultur-E und der philosophischen E. Diesen Ebenen lassen sich kurzum die folgenden Stichworte zuordnen: Reformation, Renaissance und das neue Verhältnis zwischen Theologie und Philosophie. Für die wissenschaftstheoretischen Auswirkungen ist vor allem Letzteres entscheidend: Die Philosophie wird nicht mehr als die Magd der Theologie betrachtet, auch wenn die großen neuzeitlichen Denker wie Descartes, Locke und Leibniz durchaus religiös sind. Die neuzeitliche Botschaft lautet diesbezüglich: Es gibt zwei unabhängige Forschungsgebiete, welche sich der Lehre von der doppelten Wahrheit verpflichtet fühlen: „Die in der Theologie zu erlangende Wahrheit kann sich in der Philosophie als falsch erweisen, und umgekehrt“. Wissenschaftliche Methode von Descartes? Seine wissenschaftstheoretische Verfahrensweise können wir vor allem anhand seiner Abhandlung „Discourse de la méthode“ verfolgen. Diese Schrift hat einen autobiographischen Charakter und stellt zugleich eine Reihe wissenschaftstheoretischer Anregungen dar. Sie besteht aus sechs Teilen. 7 Im ersten Teil findet sich die These, der gesunde Menschenverstand ist die bestverteilte Sache der Welt, es fehlt nur an der rechten Anwendung, d.h. an der richtigen Methode. Nur die Mathematik scheint sich als zuverlässige Wissenschaft zu erweisen - im Gegensatz zur Philosophie, in der es viele Meinungen gibt. Der zweite Teil beschreibt die berühmte Erleuchtung in einem geheizten Zimmer (wahrscheinlich) in Neuburg an der Donau, wo Descartes beginnt, sein Wissen systematisch neu aufzubauen. Dazu formuliert er folgende vier Regeln (R): (1) R der Evidenz – nur das, was evident ist, darf für wahr gehalten werden; (2) R der Analyse – jedes Problem ist in so viele Teile zu zerlegen, bis eine bessere Lösung möglich ist; (3) R der Zusammensetzung – das Wissen soll aus den einfachsten und am leichtesten zusammengesetzten Bausteinen zusammengesetzt sein; und (4) R der Vollständigkeit – alle Elemente des Wissens sollen vollständig sein. Im dritten Teil wird die sogenannte provisorische Moral dargestellt, bestehend aus vier Maximen (M): M 1 – die Gesetze des Vaterlandes und der Religion sind zu respektieren und keine Verpflichtungen einzugehen; M 2 – verlangt die Entschlossenheit in der konkreten Situation. Im Zweifelsfall soll man der einmal eingeschlagenen Orientierung geradlinig weiter folgen, so wie Verirrte in einem Wald auf alle Fälle immer geradeaus gehen müssen, um wieder aus dem Wald herauszukommen. Dabei spielt die Wahrscheinlichkeit eine Rolle; M 3 – inspiriert durch den stoischen Gedanken besagt, dass es besser sei, sich selbst zu besiegen und seine Wünsche zu ändern, als die Weltordnung ändern zu wollen. Aus jeder Not sollte man sich bemühen, eine Tugend zu machen; und M 4 – stellt die Begründung und Rechtfertigung aller vorangehenden drei Maximen dar. Der vierte Teil von Discourse enthält eine Kurzfassung der wichtigsten Gedanken der „Meditationen“. Hier findet sich auch die berühmte Formulierung „Cogito ergo sum“. Im fünften Teil gibt Descartes einen Abriss seiner Naturtheorie an, die im Prinzip des Mechanismus fundiert ist. Um Menschen von Tieren und Maschinen zu unterscheiden, formuliert er zwei Kriterien: die Sprache und die universale Vernunft, die es möglich macht die Grenzen einer vorprogrammierten Verhaltensweise zu überschreiten. Im sechsten und letzten Teil liefert Descartes Gründe für (und gegen) die Veröffentlichung seiner Gedanken (vgl. Disc. 3f.). 8 Ganz konkret heißt das: (1) Wissenschaft besteht aus sozialen Systemen und Handlungen; (2) Wissenschaft ist geprägt von geistigen Repräsentationen in Form von Strukturen, Modellen, Theorien, Computerprogrammen usw.; (3) Wissenschaft ist an Erfahrung gebunden durch Daten, Experimente usw.; und (4) Wissenschaft ist geprägt von charakteristischen Methoden, die je nach Disziplin und Gegenstand variieren. Induktiv-wissenschaftliche Elemente bei Bacon Zum einen gilt Bacon als einer der Wegbereiter des neuzeitlichen Empirismus, der seine Blüte bei Locke und Hume erlangen soll, zum anderen betont er als erster die Relevanz des methodischen induktiven Verfahrens, um die erkenntnistheoretischen und methodologischen Grundlagen der Erfahrungswissenschaften zu sichern. Dieses induktive Verfahren, das aus beobachteten Einzelfällen ein allgemeines Gesetz gewinnen will, führt Bacon dann zu seiner berühmten Formel „Wissen ist Macht“. Der Gedanke „Wissen ist Macht“ kann man unter anderem im Aphorismus I des Ersten Buches des „Novum organum scientarum“ finden. In dieser Schrift will Bacon eine Methodenlehre der Wissenschaften herausarbeiten. Mit dem großen Respekt für Aristoteles und der Kritik an den scholastischen Reduktionen des aristotelischen Gedankenguts plädiert Bacon für eine empirisch-induktive Neubestimmung des Zwecks und der Methoden der Philosophie. Damit wird deutlich, Ziel der Wissenschaft sei die Naturbeherrschung im Interesse des Fortschritts. Der Mensch kann aber die Natur nur dann beherrschen, wenn er sie kennt. Das Ziel naturwissenschaftlichen Erkennens wird jedoch von den Philosophen bestimmt, die allgemein verbindliche Methoden zu finden haben. Die bisher in der Philosophie geltenden Grundsätze, die der Verstand ohne Rücksicht auf die Natur der Dinge als gegeben voraussetzte, bezeichnet Bacon als „Methode der Antizipation“. Diese Methode muss verworfen und durch die (richtige) „Methode der Interpretation“ ersetzt werden, die auf das genaue und gründliche Verständnis der Natur abzielt. Unser Verstand soll die Natur auslegen wie der gute Interpreter einen Autor, indem er sich bemüht, auf ihren Geist einzugehen. Das lässt sich nicht durch 9 scholastische Verfahren bewältigen, sondern durch die Unterwerfung unter die Natur. Eine solche Unterwerfung besteht darin, dass wir uns vor allem verschiedener Vorurteile entledigen, die Bacon - im Anschluss an Platon – „Idola“ (d.h. Trugbilder) nennt. Um eine wirkliche Einsicht in das Wesen der Dinge zu erlangen, muss sich der erkennende Mensch vorab von allen Trugbildern und Vorurteilen befreien. Wirkliche Erkenntnis ist also die reale Abbildung der Natur. Bacon unterscheidet vier Typen von Idolen: (1) Idola Specus (Höhlen-Trugbilder) – sind diejenigen Täuschungen, die sich aus den dunklen Tiefen des Individuums ergeben. Es ist das Unbewusste in unseren Handlungen und Denkweisen; (2) Idola Theatri (Trugbilder des Theaters/Tradition) – sind Irrtümer aus überlieferten, überzeugend dargelegten Lehrsätzen: Dogmen, Meinungen einer Autorität usf.; (3) Idola Fori (Trugbilder des Marktes) – es handelt sich um diejenigen Irrtümer, für die unser Sprachgebrauch verantwortlich ist. Sie entspringen unseren Gewohnheiten; und (4) Idola Tribus (Trugbilder der Gattung) – sind Fehler unseres Verstandes und am schwierigsten zu erkennen und zu vermeiden. Wir neigen von Natur aus Dinge und Vorgänge aus menschlicher Sicht zu sehen und zu beurteilen. Der belegende Text lautet hier wie folgt: „Die Idole des Stammes sind in der menschlichen Natur selbst, im Stamme selbst oder in der Gattung der Menschen begründet. Es ist nämlich ein Irrtum zu behaupten, der menschliche Sinn sei das Maß aller Dinge, ja, das Gegenteil ist der Fall; alle Wahrnehmungen der Sinne wie des Geistes geschehen nach dem Maß der Natur des Menschen, nicht nach dem des Universums. Der menschliche Verstand gleicht einem Spiegel, der die strahlenden Dinge nicht aus ebener Fläche zurückwirft, sondern seine Natur mit der der Dinge vermischt, sie entstellt und schändet“. Das wissenschaftstheoretische Vorgehen von Bacon können wir also mit dem folgenden Schema zusammenfassen: ↓ (1) Idola Specus Empirismus => INDUKTION ↓ ↓ (2) Idola Theatri (3) Idola Fori ↓ (4) Idola Tribus 10 Die wissenschaftstheoretische Perspektive bei Leibniz Man kann mit Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) – will man seine wissenschaftstheoretische Perspektive bestimmen – in doppelter Weise verfahren: Zum einen kann man ihn systematisch betrachten, dann wäre es denkbar zu sagen, er sei von Bacon beeinflusst gewesen, allerdings in dem Sinne, dass er die von Bacon geforderte neue Bestimmung philosophischen Instrumentariums rationalistisch ausrichtete. Zum anderen kann man ihn methodisch betrachten, was bedeutet, er entscheide sich für den Weg eines Descartes. Die Konsequenz ist, dass wir es mit einer mathematischrationalistischen Position zu tun haben, die unter anderem im SubstanzGedanken aufgeht. Die wissenschaftstheoretische Bedeutung dieses Schrittes bringt Albert Einstein folgendermaßen auf den Punkt: „Keiner, der sich in den Gegenstand wirklich vertieft hat, wird leugnen, dass die Welt der Wahrnehmungen das theoretische System praktisch eindeutig bestimmt, trotzdem kein logischer Weg von den Wahrnehmungen zu den Grundsätzen der Theorie führt. Dies ist es, was Leibniz so glücklich als „prästabilierte Harmonie“ bezeichnete“. (Einstein, A., Mein Weltbild, Frankfurt am Main 1950, 109) Um die „prästabilierte Harmonie“ bei Leibniz zu verstehen, die das perfekt kooperierende Zusammensein von (zwei) Entitäten hervorhebt, ist es erforderlich seine „Monadologie“ kurz darzustellen. Die ganze Wirklichkeit besteht aus nicht-räumlichen, einfachen und unteilbaren individuellen Substanzen, die Leibniz Monaden nennt. Außerdem ist die gesamte Wirklichkeit von lebendigen Wesen erfüllt. Die Monade ist Einheit und Aktivität. Sie ist ein dynamisches und teleologisches Kräftezentrum und unvergänglich. Da Monaden durch die unauflösliche Einheit gekennzeichnet sind, können sie nur durch Schöpfung entstehen. Jede Monade ist ganz sowohl Individuum als auch die Gesamtheit, weil sich in jeder Monade die ganze Welt in einer bestimmten Perspektive spiegelt, d.h. jede Monade repräsentiert von ihrem Standpunkt aus das Universum. Die Monaden sind zudem – und das ist aus wissenschaftstheoretischer Sicht besonders relevant – durch ihre Perzeptionen (Wahrnehmungen) charakterisiert. Die Perzeption vereinigt in einem Individuum, was im Universum vielfältig ist. 11 Beim Perzipieren, wo die Monade ihr eigenes Wesen entfaltet, bleibt sie in sich verschlossen, d.h. „sie hat sozusagen keine Fenster“, mithin weist sie keine Beziehung zu anderen Monaden auf. Die Monaden spiegeln also in ihren Perzeptionen die Welt, wobei sie je nach Position unterschiedlichen „Durchblick“ haben. Die „nackten Monaden“ (die „eigentlichen Atome“ der Welt) haben nur eine Art unbewusstes Verständnis der Welt, die „Seelenmonaden“ (also Menschen) sind fähig zu bewusster, aber beschränkter Wahrnehmung; nur Gott als „Urmonade“ hat ein vollständiges Bild des Universums. Was die Erkenntnis in dem Kontext anbelangt, so ist sie eine Art individuelle Leistung der „Seelenmonaden“. Die Monaden sind wie Uhren, die Gott als Uhrmacher so gestellt hat, dass sie alle gleich ticken. Dabei ist die Welt für Leibniz in einem perfekten Zustand, d.h. in der „prästabilierten Harmonie“, sie ist die beste aller möglichen Welten. Daher schreibt Leibniz über Gott und die Welt Folgendes: „Also ist alleine Gott die allererste oder urständliche Monade, von welcher alle erschaffenen Monaden sind hervorgebracht worden; und diese werden - so zu reden - durch die ununterbrochenen Strahlen […] der Gottheit nach Proportion der eigentümlichen Fähigkeit einer Kreatur, welche ihrem Wesen nach umschränket ist, von einem Augenblick zum andern geboren. Es ist in Gott die Macht, welche den völligen Zusammenhang der Ideen in sich fasset; und endlich der Wille, welcher die Veränderungen oder die Schöpfungs-Werke nach den Regeln der allerbesten und ausbündigsten Ordnung hervorbringet“. (Monadologie, Frankfurt am Main/Leipzig 1996, §§47,48) Was können wir von Leibniz beim Betreiben der Wissenschaftstheorie (WT) heute lernen? Seine mathematisch-rationalistischen Überlegungen heben vor allem die Begriffe (bzw. Prinzipien) der Übereinstimmung, der Identität und der Proportion hervor. Ohne diese Termini hier genauer diskutieren zu wollen, können wir bezugnehmend auf die WT behaupten, jede WT solle sich stets um die Übereinstimmung verschiedener Methoden bemühen, die sie jeweils in Anspruch nimmt.