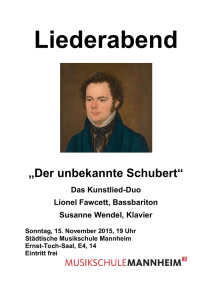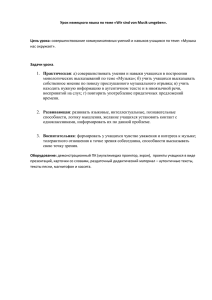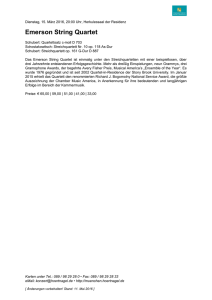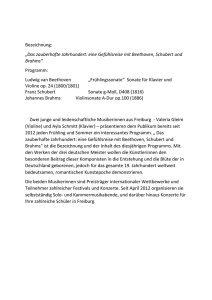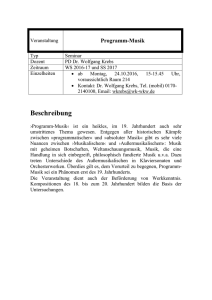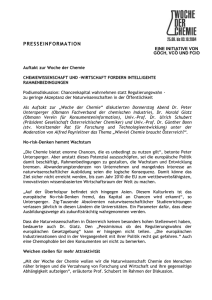Zubin Mehta - Münchner Philharmoniker
Werbung

Zubin Mehta Freitag, 3. Oktober 2014, 19 Uhr Genießen Sie bewegende Konzertabende mit brillanten Juwelen Der Ring mit dem Dre h von Juwelier Fridrich... Fragen Sie nach unseren brillanten limitierten Jubiläums-Editionen! TRAURINGHAUS · SCHMUCK · JUWELEN · UHREN · MEISTERWERKSTÄTTEN J. B. FRIDRICH GMBH & CO. KG · SENDLINGER STRASSE 15 · 80331 MÜNCHEN TELEFON: 089 260 80 38 · WWW.FRIDRICH.DE Franz Schubert Ouver türe zu „Rosamunde, Fürstin von Zypern“ D 797 (ursprünglich: Ouvertüre zu „Die Zauberharfe“ D 644) Symphonie Nr. 7 h-Moll D 759 „Die Unvollendete“ 1. Allegro moderato 2. Andante con moto Symphonie Nr. 8 C-Dur D 94 4 „Die Große“ 1. Andante – Allegro ma non troppo 2. Andante con moto 3. Scherzo: Allegro vivace 4. Allegro vivace Zubin Mehta, Dirigent Freitag, 3. Oktober 2014, 19 Uhr 1. Abonnementkonzert h5 Spielzeit 2014/2015 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant 22 Franz Schubert: Schubert: „Rosamunde“ „Rosamunde“ Franz Das nachgetragene Vorspiel Susanne Stähr Franz Schubert Lebensdaten des Komponisten (1797–1828) Geboren am 31. Januar 1797 im Himmelpfortgrund bei Wien (heute: 9. Wiener Gemeindebezirk / Alsergrund); gestorben am 19. November 1828 in Wien. Ouvertüre zu „Rosamunde, Fürstin von Zypern“ D 797 (historisch korrekt: Ouvertüre zu „Die Zauberharfe“ D 644) Entstehung Schubert komponierte das heute als „Rosamunde“Ouvertüre bekannte und allseits beliebte Werk wahrscheinlich im April oder Mai 1820 als Ouvertüre zu Georg von Hofmanns Zauberspiel mit Musik in drei Akten „Die Zauberharfe“ D 644; Korrekturen an der Partitur nahm er noch bis zum Sommer desselben Jahres vor. Schon 1827 in einer frühen Bearbeitung und erst recht nach Schuberts Tod, als 1854 im Wiener Musikverlag Carl Anton Spina das Werk erstmals in Partitur erschien, betitelte man es als „Ouvertüre zum Drama ‚Rosamunde‘ op. 26“, für das Schubert zwar eine mehrteilige Bühnenmusik, aber keine eigene Ouvertüre geschrieben hatte. Uraufführung Am 19. August 1820 in Wien im Theater an der Wien im Rahmen der Uraufführung des dreiaktigen Melodrams „Die Zauberharfe“, das anschließend noch insgesamt sieben Wiederholungen erlebte. Als Vorspiel zur Bühnenmusik der „Rosamunde“ wurde die „Zauberharfen“-Ouvertüre vermutlich zum ersten Mal am 1. Dezember 1867 in Wien aufgeführt (in einem Konzert der „Gesellschaft der Musikfreunde in Wien“ unter Leitung von Johann Herbeck). 3 Leopold Kupelwieser: Franz Schubert (1821) 4 Franz Schubert: Schubert: „Rosamunde“ „Rosamunde“ Franz Nicht immer kommt es auf den Namen an. Was am heutigen Abend als Ouvertüre zum Romantischen Schauspiel „Rosamunde“ erklingt, war ursprünglich gar nicht als Vorspiel zu Franz Schuberts berühmter Bühnenmusik von 1823 gedacht. Es handelt sich dabei vielmehr um ein drei Jahre älteres Werk, das zunächst als Introduktion zum dreiaktigen Melodram „Die Zauberharfe“ diente. Aber selbst dieser Befund ist nicht rundum zutreffend, denn ein Gutteil der musikalischen Substanz ist noch früheren Datums, bediente sich Schubert doch großzügig bei seiner eigenen „Ouvertüre im italienischen Stil“ D 590, die er bereits 1817 komponiert hatte. Absurdes Theater ? Nein, Musikgeschichte. Unstillbare Theaterleidenschaft Um den Knoten zu lösen, muss man sich in die Lage des 26-jährigen Komponisten hineinversetzen, die sich ihm Ende 1823 stellte. Drei Opern hatte er in den vergangenen beiden Jahren geschrieben, aber weder für „Alfonso und Estrella“ noch für „Die Verschworenen“ und auch nicht für „Fierrabras“ hatte er Abnehmer finden können: Die Partituren warteten nach wie vor auf ihre Uraufführung – keine Bühne erklärte sich bereit, auch nur eines der Werke ins Repertoire zu nehmen. Dabei zog es Schubert unwiderstehlich zum Theater, und so mochte er es als Zeichen des Himmels empfunden haben, als ihn der Dramaturg und Autor Joseph Kupelwieser im Oktober 1823 fragte, ob er nicht kurzfristig eine Bühnenmusik zum neuesten Stück der Dichterin Helmina von Chézy schreiben könne. Diese Anfrage klang nun wirklich verheißungsvoll, denn die 1783 als Tochter eines preußischen Offiziers in Berlin geborene Autorin war seinerzeit eine Zelebrität, wenngleich nicht allein ihrer literarischen Erzeugnisse wegen, sondern auch aufgrund ihres freizügigen Lebenswandels – gleich zweimal ließ sie sich scheiden und beharrte stets auf ihrer Unabhängigkeit. Als 18-jährige war Helmina von Chézy nach Paris gekommen, wo sie als politische Korrespondentin für verschiedene Zeitungen arbeitete und bald eine eigene Zeitschrift herausgab, die „Französischen Miszellen“. Zu ihrem Freundeskreis zählten viele Größen des damaligen Geisteslebens – Friedrich und Dorothea Schlegel etwa, die mit ihr in einer Wohnung zusammenlebten, aber auch Achim von Arnim oder Adelbert von Chamisso, mit dem sie gemeinsam die französischen Vorlesungen August Wilhelm Schlegels ins Deutsche übersetzte. Außerdem veröffentlichte sie Romane, Erzählungen und Novellen, Essays und mehrere Bände mit Lyrik: gewiss zeitgebundene Werke, die jedoch Anklang beim Lesepublikum fanden. Musik des verlorenen Paradieses „Rosamunde, Fürstin von Zypern“ lautete der Titel des Schauspiels, das Kupelwieser bei Helmina von Chézy für das Theater an der Wien in Auftrag gegeben hatte. Doch ehe die Autorin den Text lieferte, war der November schon gekommen; der Uraufführungstermin stand unmittelbar vor der Tür, und Schubert blieb viel zu wenig Zeit, um eine adäquate Bühnenmusik zu komponieren. Einige Quellen sprechen davon, dass es nur fünf Tage gewesen seien, die ihm letztlich zur Verfügung standen; trotzdem gelang es ihm, in dieser extrem kurzen Frist zehn Nummern mit einer Spieldauer von fast einer Stunde zu Papier zu bringen. Und was für eine Musik ! Vor allem der Entr’acte 5 Der Programmzettel der Uraufführung von Schuberts „Zauberharfe“ (1820) 6 Franz Franz Schubert: Schubert: „Rosamunde“ „Rosamunde“ nach dem dritten Aufzug avancierte bald zu einem Emblem seiner Kunst: Er hebt mit einer schlichten, verträumten und bewegenden Melodie an, die mit sanfter Macht ein verlorenes Paradies heraufzubeschwören scheint. Schubert selbst muss diese berührende Weise so sehr geschätzt haben, dass er sie später noch öfters aufgriff: etwa in seinem Streichquartett a-Moll D 804, das deshalb den Beinamen „Rosamunde“ trägt, aber auch als Variationenthema im Impromptu B-Dur D 935 Nr. 3 und in dem „Wiegenlied“ D 867 nach Versen von Johann Gabriel Seidl. Nun hätte man erwarten können, dass diese markante „Signatur“ auch in der Ouvertüre zum Einsatz gelangt. Doch dazu konnte es nicht kommen, weil Schubert die Zeit nicht ausreichte, um ein eigenes Vorspiel zur „Rosamunde“ zu verfassen. In der Not entschied er sich dafür, dem Opus die Einleitung von „Alfonso und Estrella“ voranzustellen: Sie war immerhin eine wirkliche Novität, und wer nicht wusste, dass Schubert hier zu einem Notbehelf gegriffen hatte, wurde bei der Uraufführung am 20. Dezember 1823 gewiss auch nicht stutzig. Ein nachhaltiger Erfolg war dem Werk allerdings nicht vergönnt. Schon nach der zweiten Aufführung wurde es wieder abgesetzt, wobei in erster Linie Helmina von Chézy für das künstlerische Desaster verantwortlich gemacht wurde: Trivial und missglückt sei ihr Text, musste sie sich anhören, ein lächerliches Machwerk der Schauerromantik. Spätes Nachleben im Konzertsaal Mehr als vier Jahrzehnte sollten danach vergehen, ehe Schuberts himmlische Musik wieder zu Gehör gelangte – doch nun mit einer anderen Ouvertüre, mit dem Vorspiel zum dreiaktigen Melodram „Die Zauberharfe“ D 644, das entschieden besser zur Klangwelt der „Rosamunde“ passte. Ob diese Änderung noch auf Schuberts Anregung zurückging, ist nicht überliefert. Allerdings war schon zu seinen Lebzeiten, im Jahr 1827, die „Zauberharfen“-Introduktion in einer Bearbeitung für Klavier zu vier Händen als „Ouvertüre zum Drama ‚Rosamunde‘“ publiziert worden. Diese Adaption stammte vermutlich von dem Schubert-Freund und -Förderer Joseph Hüttenbrenner, und so dürfte es wahrscheinlich sein, dass Schubert die Veröffentlichung kannte und sie womöglich auch billigte. Grundsätzlich nahm man es damals nicht so genau mit den Ouvertüren, die doch vor allem dazu dienen sollten, die geneigten Hörer aus dem Alltag zu holen und sie auf den Abend einzustimmen. Dies gilt auch für das Vorspiel zur „Zauberharfe“: Denn sieht man einmal von den ehernen, mottohaften Einleitungsakkorden ab, die im weiteren Verlauf des Melodrams wiederkehren, ist ein konkreter Bezug zur Handlung und Psychologie dieses Bühnenwerks kaum zu erkennen. Vielleicht kommt es also gar nicht auf das korrekte Etikett an, sondern eher auf die Funktion. Wie auch immer die Ouvertüre genannt werden soll, die Zubin Mehta am heutigen Abend dirigiert: Die melancholischen Kantilenen ihrer langsamen Einleitung, der schwungvolle, tänzerisch betonte Hauptteil und die schmissige Coda lassen sie zu einem Musikstück werden, das seine Autonomie im Konzertsaal längst behauptet hat. Franz Schubert: 7. Symphonie h-Moll 7 Vollendetes Fragment Peter Andraschke Franz Schubert (1797–1828) Symphonie Nr. 7 h-Moll D 759 „Die Unvollendete“ 1. Allegro moderato 2. Andante con moto Lebensdaten des Komponisten Geboren am 31. Januar 1797 im Himmelpfortgrund bei Wien (heute: 9. Wiener Gemeindebezirk / Alser­ grund); gestorben am 19. November 1828 in Wien. Entstehung Im Herbst 1822 in Wien; Beginn der Niederschrift des Partiturautographs am 30. Oktober: „Sinfonia in H moll von Franz Schubert mpia [manu propria] Wien, den 30. Octob. 1822“. Schubert scheint eine Ergänzung der zwei ab- geschlossenen Symphoniesätze eine Zeit lang ernstlich erwogen zu haben, da sich Fragmente eines 3. Satzes (Scherzo) fanden, der in der Skizze 128 Takte umfasst. Er schickte aber, was die End­ gültigkeit einer 2-sätzigen Formanlage zu bestätigen scheint, sein Manuskript 1823 nach Graz – wohl als Dank für die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im „Steiermärkischen Musik­ verein“, die er im Jahr zuvor erhalten hatte. Schuberts Freund und Mitschüler bei Antonio Salieri, Anselm Hüttenbrenner, damaliger Direktor des Steiermärkischen Musikvereins, bewahrte die Dankesgabe allerdings bei sich privat auf, wo sie der Wiener Hofkapellmeister Johann Herbeck, der über Hüttenbrenners Bruder Joseph Einzelheiten der Schenkung erfahren hatte, am 30. April 1865 auffand. 1867 erfolgte die Drucklegung der Symphonie im Wiener Musikverlag C. A. Spina. Uraufführung Am 17. Dezember 1865 in Wien im Großen Redoutensaal der Wiener Hofburg (Orchester der „Gesellschaft der Musikfreunde in Wien“ unter Leitung von Johann Herbeck); um das Fragment zu „vervollständigen“, wurde es mit dem Finale von Schuberts 3. Symphonie (!) zu einem halbwegs gattungskonformen Ganzen komplettiert. Der Wiener Kritikerpapst Eduard Hanslick schrieb in seiner Uraufführungskritik: „Wir zählen das neu aufgefundene Sinfonie-Fragment von Schubert zu seinen schönsten Instrumentalwerken !“ 8 Franz Schubert: 7. Symphonie h-Moll Schuberts h-Moll-Symphonie ist uns als „Die Unvollendete“ bekannt. Vielfältige Überlegungen wurden immer wieder darüber angestellt, warum Schubert diese Komposition abgebrochen hat und ob er sie wirklich weiterführen wollte. Auch wenn der Beiname nicht von Schubert stammt, so war doch die Norm des viersätzigen Symphoniezyklus, wie sie noch für Beethoven gegolten hat, zunächst auch für Schubert so sehr Verpflichtung, dass er als 3. Satz ein Scherzo begann, dem selbstverständlich ein Finale folgen musste. Er hat sein Bemühen allerdings nach 128 Takten abgebrochen. Uns erscheint die „Unvollendete“ heute nicht als Torso, sondern als individuelle Tondichtung in zwei Sätzen von ausgewogenem Gleich­gewicht. Rätsel des Fragmentarischen Möglicherweise hat das „Unvollendete“ der Symphonie mit dem Anspruch eines Komponisten an sich selbst zu tun, der in der unmittelbaren Nachfolge Beethovens wirkte und doch etwas Eigenes verwirklichen wollte. „Du hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört“, hatte sich noch Johannes Brahms während der Komposition seiner 1. Symphonie gegenüber dem Dirigenten Hermann Levi beklagt. Ähnlich schrieb Schubert nach Fertigstellung der beiden Sätze der 7. Symphonie an seinen Freund, den Maler Leopold Kupel­w ieser, über seine schöpferische Situation in dieser Zeit: „In Liedern habe ich wenig Neues gemacht, dagegen versuchte ich mich in mehreren Instrumental-Sachen, denn ich componirte 2 Quartette für Violinen, Viola und Vi- oloncelle und ein Octett, und will noch ein Quartetto schreiben, überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen. Das Neueste in Wien ist, dass Beethoven ein Concert gibt, in welchem er seine neue Sinfonie, 3 Stücke aus der neuen Messe, und eine neue Ouverture produciren läßt. Wenn Gott will, so bin auch ich gesonnen, künftiges Jahr ein ähnliches Concert zu geben.“ Der Wunsch, ein umfangreiches symphonisches Werk von überpersönlicher Bedeutung zu schaffen, ließ Schubert sogleich an Beethoven denken. Die Musik des großen, in Wien lebenden Zeitgenossen, den er rückhaltlos bewunderte, war für ihn Herausforderung und Hemmnis zugleich. Die dadurch ausgelöste Krise im symphonischen Schaffen zeigt sich in verschiedener Weise. Über vier Jahre liegen zwischen der 6. und der Partiturniederschrift dieser 7. Symphonie. Dazwischen gab es nur Entwürfe. Zugleich veränderte sich Schuberts Arbeitsweise. Während er früher meist rasch und direkt in Partitur komponierte, wurde er nun in hohem Maße selbstkritisch und unsicher. Er entwarf zunächst Klavierskizzen, die er erst in einem zweiten Arbeitsgang instrumentierte. Entdeckung mit Hindernissen Die späte Uraufführung, lange nach Schuberts Tod, erklärt sich dadurch, dass Anselm Hüttenbrenner, ein unbedeutender Komponist aus dem Schubert-Kreis, und sein Bruder Joseph das Autograph rund 40 Jahre so strikt unter Verschluss hielten, dass es als verschollen galt. Der Annahme, dass Schubert es Hüttenbrenner zur Weitergabe an den Grazer „Steiermärki- 9 Oben: Letzte Partiturseite des 2. Satzes („Andante con moto“) in Schuberts Handschrift Unten: Erste Partiturseite des nach 128 Takten abbrechenden 3. Satzes („Allegro“) 10 Franz Schubert: 7. Symphonie h-Moll schen Musikverein“ übergeben habe, und zwar als Dank dafür, dass er 1823 zum „auswärtigen Ehrenmitglied“ erklärt wurde, steht gegenüber, dass Hüttenbrenner das Manuskript bei sich privat aufbewahrte. Erwiesen ist jedoch, dass der Dirigent Johann Herbeck dem Verbleib der Partitur auf die Spur gekommen war, nach Graz reiste und die Noten für eine erste Aufführung erhielt. Allerdings unter einer Bedingung: Er hatte in diesem Konzert auch Anselm Hüttenbrenners „Ouverture in cMoll“ zu dirigieren. Auf dem Plakat steht ausdrücklich vermerkt: „Herr Anselm Hüttenbrenner in Graz war so freundlich, das Original Manuscript des 1. und 2. Satzes der H-Moll Sinfonie, welche Schubert im October 1822 und zwar nur bis zum Anfang des 3. Satzes componirt hat, freundlichst zu überlassen.“ Joseph indessen glaubte seinen Bruder übervorteilt: „Anselm hat durchaus gefehlt“, bemerkte er in einem Brief vom 11. Februar 1867, „die Sinfonie herauszugeben; erst wenn sie 10 Ouvertüren von ihm gegeben haben und eine Sinfonie, dann hätte er herausrücken sollen !“ „Schubertfreunde“ in der Kritik Die Umstände der späten Entdeckung waren selbstverständlich in der Wiener Kulturszene Gesprächsstoff. Der renommierte Musikkritiker Eduard Hanslick geht in seiner Besprechung des Konzerts genüsslich darauf ein: „Unter den sogenannten ‚Schubertfreunden‘ par excellence stechen zwei charakteristische Gruppen hervor: die Sorglosen und die Hartnäckigen. Die ersteren lassen ruhig Schubert’s Manuscripte nach allen Weltgegenden zerflattern; sie wissen oder wußten genau von irgend einer noch vorhandenen Oper oder Symphonie (sie haben sie ja entstehen sehen ! ), aber es stört ihre Seelenruhe nicht im mindesten, wenn diese Schätze um ein paar Gulden einem amerikanischen Sammler, oder noch billiger, einem Käsehändler zufallen. Die Hartnäckigen hingegen haben zwei oder drei Perlen aus Schubert’s Nachlaß in’s Trockene gebracht, halten sie aber vor lauter Freundschaft für den Verewigten und lauter Verachtung für die Lebenden in irgend einem Koffer verschlossen, mit dessen Schlüssel sie sich zu Bette legen. Wir wollen Herrn Anselm Hüttenbrenner, den Freund Schubert’s, seit gestern nicht mehr zu der zweiten Klasse zählen, da er schließlich der Belham’schen Beredthsamkeit und Artigkeit des Hofcapellmeisters Herbeck nicht widerstand, der eigens nach Graz abgereist war, um eine Hüttenbrenner’sche Partitur für die Gesellschafts-Concerte zu acquirieren, und bei dieser Gelegenheit – wie seltsam ! – auch ein lang gesuchtes Schubert’sches Manuscript mitbrachte. Wir können nicht entscheiden, welche von den beiden Compositionen die Angel und welche der Fisch war, genug, dass Schubert und Hüttenbrenner wie im Leben so auf dem Programm des letzten ‚Gesellschafts-Concertes‘ einträchtig nebeneinander hergingen. Hüttenbrenner, der bekanntlich zur Berühmtheit des Schubert’schen Erlkönigs viel beigetragen hat, nämlich eine Partie ‚Erlkönig-Walzer‘, eröffnete das Concert mit einer Ouverture in C-moll, welcher man eine gewisse Tüchtigkeit der Arbeit nicht absprechen kann.“ Franz Schubert: 7. Symphonie h-Moll 11 Josef Teltscher: Franz Schubert mit seinen Freunden Johann Baptist Jenger (links) und Anselm Hüttenbrenner (Mitte), portraitiert anlässlich von Schuberts Besuch in Graz (1827) Das unerhört(e) Neue Die „Unvollendete“ ist seit ihrer späten Uraufführung von der Kritik begeistert aufgenommen worden. So schätzte sie auch Hugo Wolf in ­einer Rezension aus dem Jahre 1889 wegen ihrer konzentrierten Formgestaltung und dem individuell ausgeprägten Schubert’schen Ton der Musik besonders hoch ein: „Die H-MollSymphonie ist nicht nur knapper, einheitlicher als die C-Dur; in ihren Themen spricht auch der pathetische Schubert ebenso überzeugend, als der elegisch träumerische. Er gibt sich in ihr so vollständig als in seinen Liedern, in denen er freilich das höchste geleistet.“ Die Wertschätzung der Symphonie gründet sich auf eine Musiksprache, die radikal anders ist als die von Beethoven und der von ihm beeinflussten Tradition. Eine Fülle von sanglichen Themen wird ausgebreitet: aber sie werden weniger entwickelt und verarbeitet als wiederholt, und so prägen sie sich dem Hörer ein. Die Einheitlichkeit der Stimmung wird nicht durch breit ausgeführte dramatische Verläufe und Konflikte gestört, die Lösungen fordern und erlangen. Doch gehören zu ihr auch leidenschaftliche Ausbrüche und jähe Ausdruckswechsel. Diese Risse, die psychische Urgründe auftun oder ahnen lassen, sind bedeutsam und geben Schuberts Musik jene entscheidende Dimension, die für 12 Franz Schubert: 7. Symphonie h-Moll Komponisten unseres Jahrhunderts, etwa für Wolfgang Rihm, der Grund war, sich mit Schubert schöpferisch auseinanderzusetzen. Innovative Tonartensymbolik Die in einer Symphonie bis dahin wohl noch nie verwendete Tonart h-Moll des 1. Satzes enthält bereits den Keim des Außergewöhnlichen und Einmaligen dieser Komposition, deren Besonderheit Schuberts kompositorische Entwicklung zuvor nicht ahnen lässt. Es ist nicht leicht, den Charakter der Tonart h-Moll zu bestimmen. Bekannte Vertonungen können ihn einkreisen, z. B. von Johann Sebastian Bach die h-Moll-Messe, die Arie „Blute nur, du liebes Herz“ aus der „Matthäus-Passion“ oder die Arie „Es ist vollbracht“ aus der „Johannes-Passion“. Auch die Texte der wenigen Lieder Schuberts in h-Moll kennzeichnen sie als Tonart der Trauer, Trost­ losigkeit und Sehnsucht, etwa „Abschied“ (D 578), das „Grablied für die Mutter“ (D 616), „Nur wer die Sehnsucht kennt“ (D 877/1), „Einsamkeit“ (D 911/12) aus der „Winterreise“ oder „Der Doppelgänger“ (D 957/13). Beethoven notierte in den Skizzen zur Cellosonate op. 102 Nr. 2: „H-Moll schwarze Tonart“. Und Daniel Friedrich Schubart deutete sie in seiner 1806 posthum erschienenen „Ästhetik der Tonkunst“ als „Ton der Geduld, der stillen Erwartung seines Schicksals, und der Ergebung in die göttliche Fügung. Darum ist seine Klage so sanft, ohne jehmals in beleidigendes Murren, oder Wimmern auszubrechen.“ Auch der langsame 2. Satz ist durch den Charakter seiner Tonart E-Dur bestimmt, die gerade in langsamen Stücken Erhabenheit und fei- erlichen Ernst ausdrückt – man denke an das einzige E-Dur-Stück in Mozarts „Zauberflöte“, die Arie des Sarastro „In diesen heil’gen Hallen“. Die Tonart findet sich bei Schubert aber auch in idyllischen und lieblichen Liedern wie „Des Baches Wiegenlied“ (D 795/20) oder „Lindenbaum“ (D 911/5), mit denen die Stimmung des „Andante con moto“ der „Unvollendeten“ verwandt ist. Musik und Tiefenpsychologie Das bereits durch die Tonart vorgegebene semantische Umfeld der beiden Sätze könnte die Überlegung von Arnold Schering stützen, dass die Musik der „Unvollendeten“ in ihrer Stimmung mit Schuberts kleiner allegorischer Erzählung „Mein Traum“ assoziiert werden kann, die er am 3. Juli 1822 schrieb. Mithin stünde die berührende und tief bewegende Musik des 1. Satzes mit Gedanken an die Vergänglichkeit des Daseins in Verbindung. Schubert träumte nämlich, dass er von seinem Vater verstoßen wurde: „Mit einem Herzen voll unendlicher Liebe für die, welche sie verschmähten, wanderte ich in ferne Gegend. Jahre lang fühlte ich den größten Schmerz und die größte Liebe mich zertheilen.“ Er hörte vom Tode seiner Mutter, eilte nach Hause und geleitete sie zu Grab. Bald wurde er wieder vom Vater verstoßen: „Und zum zweytenmahl wanderte ich abermals in ferne Gegend. Lieder sang ich nun lange, lange Jahre. Wollte ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollte ich wieder Schmerz nur singen, ward er mir zur Liebe.“ Der zweite Teil der Erzählung könnte auf die Stimmung des 2. Satzes verweisen. Hier re- Franz Schubert: 7. Symphonie h-Moll flektiert Schubert über das Leben nach dem Tod, „in dem viele Jünglinge und Greise auf ewig wie in Seligkeiten wandelten. Da sehnte ich mich sehr, auch da zu wandeln, und ehe ich es wähnte, war ich in dem Kreis, der einen wunderlieblichen Ton von sich gab; und ich fühlte die ewige Seligkeit wie in einen Augenblick zusammengedrängt. Auch meinen Vater sah ich versöhnt und liebend. Er schloß mich in seine Arme und weinte. Noch mehr aber ich.“ Uraufführung mit Ereignis­ charakter Die erste Aufführung von Schuberts „Unvollendeter“ muss einer musikalischen Sensation gleichgekommen sein. Hanslick, erklärter Gegner der „neudeutschen“ Richtung in der damals zeitgenössischen Musik, wie sie von Wagner, Liszt und Bruckner repräsentiert wurde, berichtete in einer liebevoll-begeisterten Kritik über die unmittelbare Faszination der „Schubert’schen Novität, die einen außerordentlichen Enthusiasmus erregte“ und beschrieb sie mit erstaunlicher Detailkenntnis der Partitur, die auf eine gewissenhafte Vorbereitung auf die Uraufführung schließen lässt: „Wir müssen uns mit den zwei Sätzen zufrieden geben, die, von Herbeck zu neuem Leben erweckt, auch neues Leben in unsere Concert­s äle bringen. Wenn nach den paar einleitenden Takten Clarinette und Oboe einstimmig ihren süßen Gesang über dem ruhigen Gemurmel der Geigen anstimmen, da kennt auch jedes Kind den Componisten, und der halbunterdrückte Ausruf ‚Schubert !‘ summt flüsternd durch den Saal. Er ist noch kaum eingetreten, aber es ist, als 13 kennte man ihn am Tritt, an seiner Art, die Thürklinke zu öffnen. Erklingt nun gar auf je­nen sehnsüchtigen Mollgesang das contrastirende G-dur-Thema der Violoncelle, ein reizender Liedsatz von fast ländlerartiger Behaglichkeit, da jauchzt jede Brust, als stände Er nach langer Entfernung leibhaftig mitten unter uns. Dieser ganze Satz ist ein süßer Melodienstrom – bei aller Kraft und Genialität krystallhell. Und überall dieselbe Wärme, derselbe goldene, blättertreibende Sonnenschein ! Breiter und größer entfaltet sich das Andante. Töne der Klage oder des Zornes fallen nur vereinzelt in diesen Gesang voll Innigkeit und ruhigen Glückes; mehr effectvolle, musikalische Gewitterwolken, als gefährliche der Leidenschaft. Als könnte er sich nicht trennen von dem eigenen süßen Gesang, schiebt der Componist den Abschluß des Adagios weit, ja allzu weit hinaus. Man kennt diese Eigenthymlichkeit Schubert’s, die den Total­ eindruck mancher seiner Tondichtungen abschwächt. Auch am Schlusse dieses Andantes scheint sein Flug sich in’s Unabsehbare zu verlieren, aber man hört doch noch immer das Rauschen seiner Flügel. Bezaubernd ist die Klangschönheit der beiden Sätze. Mit einigen Horngängen, hie und da einem kurzen Clarinett- oder Oboesolo auf der einfachsten, natürlichsten Orchester-Grundlage gewinnt Schubert Klangwirkungen, die kein Raffinement der Wagner’schen Instrumentierung erreicht…!“ 14 Franz Franz Schubert: Schubert: 8. 8. Symphonie Symphonie C-Dur C-Dur Schatzfinderlohn Wolfgang Stähr Franz Schubert (1797–1828) Symphonie Nr. 8 C-Dur D 944 „Die Große“ 1. Andante – Allegro ma non troppo 2. Andante con moto 3. Scherzo: Allegro vivace 4. Allegro vivace mutlich im Frühjahr 1825 in Angriff nahm und bis zum Herbst 1826 vollendet haben dürfte, als er die C-Dur-Symphonie D 944 der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde zur Widmung antrug. Auf der ersten Seite der autographen Partitur ist allerdings das Datum „März 1828“ zu lesen – und bereitet bis heute der Schubert-Forschung erhebliches Kopfzerbrechen. Widmung In einem Brief vom Oktober 1826 an die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien schreibt Franz Schubert: „Von der edeln Absicht des österreich. Musik-Vereins, jedes Streben nach Kunst auf die möglichste Weise zu unterstützen, überzeugt, wage ich es, als ein vaterländischer Künstler, diese meine Sinfonie demselben zu widmen und sie seinem Schutz höflichst anzuempfehlen.“ Uraufführung Lebensdaten des Komponisten Geboren am 31. Januar 1797 im Himmelpfortgrund bei Wien (heute: 9. Wiener Gemeindebezirk / Alsergrund); gestorben am 19. November 1828 in Wien. Entstehung Die genaue Entstehungszeit liegt im Dunkeln. Bereits 1824 spricht Schubert über das ambitionierte Projekt einer „großen Symphonie“, die er ver- Doch trotz dieser vertrauensvollen Zueignung brachte die Gesellschaft der Musikfreunde einstweilen keine öffentliche Aufführung zustande. Erst nachdem Robert Schumann bei Schuberts Bruder Ferdinand eine Abschrift der weithin unbekannten Symphonie entdeckt hatte, fand über zehn Jahre nach dem Tod des Komponisten die öffentliche Uraufführung statt: Am 21. März 1839 in Leipzig im Großen Saal des Leipziger Gewandhauses (Gewandhaus-Orchester Leip zig unter Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy). 15 Anton Felix Depauly: Franz Schubert (1827) 16 Franz Schubert: Schubert: 8. 8. Symphonie Symphonie C-Dur C-Dur Franz 15 Nie ein Mozart oder Haydn ? Mit Pietät bewahrt „Bei aller Bewunderung, die ich dem Teuren seit Jahren schenke“, bekannte Schuberts Freund Josef von Spaun, „bin ich doch der Meinung, daß wir in Instrumental- und Kirchenkompositionen nie einen Mozart oder Haydn aus ihm machen werden, wogegen er im Liede unübertroffen dasteht. Ich glaube daher, daß Schubert von seinem Biographen als Liederkompositeur aufgegriffen werden müsse.“ Lange Zeit hat sich die Nachwelt, aus Unkenntnis, Gleichgültigkeit und Vorurteil, dieser Auffassung angeschlossen und Franz Schubert als einen begnadeten Miniaturisten gewürdigt, um ihm zugleich die Berufung für die großen und traditionsreichen Formen abzusprechen. Als Ende 1839 in Wien die ersten beiden Sätze aus der C-Dur-Symphonie D 944 aufgeführt wurden, schob man zur Auflockerung eine Arie aus „Lucia di Lammermoor“ dazwischen, und später wurde in der Presse bemerkt, „es wäre besser gewesen, dieses Werk ganz ruhen zu lassen“ ! Denn insbesondere die Bewertung der sechs frühen, im Zeitraum von 1813 bis 1818 entstandenen Symphonien Franz Schuberts neigte (im Grunde bis heute) zur Unterschätzung dieser Jugend werke. Johannes Brahms etwa, der in der Alten Gesamtausgabe bei Breitkopf & Härtel die Symphonien-Bände betreute, erklärte im März 1884: „Ich meine, derartige Arbeiten oder Vorarbeiten sollten nicht veröffentlicht werden, sondern nur mit Pietät bewahrt und vielleicht durch Abschriften Mehreren zugänglich gemacht werden. Eine eigentliche und schönste Freude daran hat doch nur der Künstler, der sie in ihrer Verborgenheit sieht und – mit welcher Lust – studiert !“ Zugunsten dieser merkwürdig paradoxen, wohlwollenden Geringschätzung ließe sich immerhin ein berühmter Brief anführen, den Schubert am 31. März 1824 an den Maler Leopold Kupelwieser in Rom richtete und in dem es heißt: „In Liedern habe ich wenig Neues gemacht, dagegen versuchte ich mich in mehreren Instrumental-Sachen, denn ich componirte 2 Quartetten für Violinen, Viola u. Violoncelle u. ein Octett, u. will noch ein Quartetto schreiben, überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen.“ Schuberts Mitteilung lässt sich nicht anders verstehen, als dass er, nachdem sich seine kompositorischen Ansprüche radikal gewandelt hatten, den frühen Symphonien offenbar nicht einmal mehr den Status von „Vorarbeiten“ zuerkannte: Den Weg zur „großen Symphonie“ ebnen nicht sie, seine ersten sechs Gattungsbeiträge, sondern die Streichquartette in a-Moll D 804 und d-Moll D 810 und das Oktett in F-Dur D 803, mit In jenen Gattungen, die der als „Liederfürst“ gefeierte Komponist selbst als das „Höchste“ betrachtet hatte, sollte ihm noch auf lange Sicht die Anerkennung versagt bleiben. So dauerte es Jahre und Jahrzehnte, ehe Schuberts Symphonien zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gespielt wurden. Seine „Vierte“ in c-Moll beispielsweise erlebte ihre Uraufführung am 19. November 1849, an Schuberts 21. Todestag, in Leipzig. Seine 1. und 3. Symphonie fanden sogar erst 1881, im Rahmen der von August Manns geleiteten ersten zyklischen Gesamtaufführung sämtlicher SchubertSymphonien im Londoner Crystal Palace, den Weg in den Konzertsaal. 16 Franz Franz Schubert: Schubert: 8. 8. Symphonie Symphonie C-Dur C-Dur denen der Instrumental-Komponist Schubert in der Tat neue Maßstäbe gesetzt hatte. 1813 hieß es in der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung, es sei „beynahe unmöglich, noch etwas durchaus Neues“ auf dem Gebiet der Symphonik zu schaffen: „Versuche, hierin eine neue Bahn brechen zu wollen, möchten daher wol für jeden, der nicht an Genie und Kenntnis zugleich grösser ist, als jene Männer, (und wer ist das jetzt ?), eben so schwierig, als gefährlich seyn. Es ist daher sehr natürlich, dass neuere Componisten in diesem Fache, die nicht von Dünkel und Sucht nach erkünstelter Originalität eingenommen sind, hierin der Bahn jener trefflichen Vorbilder zu folgen suchen.“ Der jun ge Franz Schubert hat diesen Grundsatz ganz selbstverständlich beachtet, und das Studium der Kompositionen Haydns und Mozarts ist in seinen frühen Symphonien nicht zu überhören – wie sollte es auch anders sein ! Und doch fallen zugleich die eigenen, charakteristischen, oft schon unverwechselbaren Wesenszüge seiner Musik auf, die auch in der „Bahn jener trefflichen Vorbilder“ niemals epigonal und unoriginell geriet. Die Unvollendeten Mit der „Sechsten“, die Schubert in einem letzten Akt der Unbefangenheit noch als „Große Sinfonie in C“ bezeichnet, reißt im Februar 1818 die Serie der frühen Symphonien jäh ab: Schubert gerät – wie zeitgleich auch bei seiner Auseinandersetzung mit dem Streichquartett und der Klaviersonate – in eine tiefe Schaffenskrise. Acht Jahre müssen ins Land gehen, ehe es ihm wie- 17 der gelingt, mit seiner nun wahrhaft „Großen Symphonie“ in C-Dur D 944 ein Werk dieser so anspruchsvollen wie repräsentativen Gattung zu einem Ende zu bringen. In der Zwischenzeit schreibt er vier unvollendete Sympho nien, von denen eine allerdings gleichwohl (oder vielleicht gerade wegen ihres Torso-Charakters ?) seine berühmteste geworden ist. Schon im Mai 1818, also nur wenige Wochen nach der „Sechsten“, skizziert Schubert zwei Sätze einer D-Dur-Symphonie (D 615), ein „Allegro moderato“ mit einer harmonisch außergewöhnlich kühnen „Adagio“-Introduktion und einen Satz im 2/4-Takt ohne Tempoangabe. Er bricht dieses kompositorische Vorhaben bald ab, nimmt aber im Frühsommer 1821 erneut eine D-Dur-Symphonie (D 708 A) in Angriff, für die er schon sämtliche Sätze weitgehend entworfen hat, als er auch dieses Projekt wieder aufgibt, um noch im August desselben Jahres mit der Komposition einer Symphonie in E-Dur D 729 zu beginnen. Schubert hat alle vier Sätze restlos skizziert und die ersten 110 Takte des Kopfsatzes überdies auch schon instrumentiert (für die größte Orchesterbesetzung unter allen seinen Symphonien) – aber dann resigniert er doch wieder angesichts der offenbar noch übermächtigen Herausforderung. Über seine Beweggründe ließe sich endlos spekulieren. Wahrscheinlich war es der Entwurf zum Schlusssatz, der seiner strengen bis destruktiven Selbstkritik nicht genügen konnte, und man darf vermuten, dass auch seine nächste, die h-Moll-Symphonie D 759, unvollendet blieb, weil Schubert vergeblich nach einer Idee, einer Konzeption für das Finale suchte: für ein Finale wohlgemerkt, das den ersten 18 Franz Franz Schubert: Schubert: 8. 8. Symphonie Symphonie C-Dur C-Dur beiden, in jeder Hinsicht des Wortes vollendeten Sätzen angemessen wäre. „Man muß Wien kennen…“ Am 31. März 1824, in seinem Brief an Leopold Kupelwieser, kündigt Schubert nicht nur an, dass er sich mit seinem Oktett und seinen Streichquartetten in a-Moll und d-Moll den „Weg zur großen Sinfonie bahnen“ wolle; er spricht zugleich von einem ambitionierten Konzertprojekt: „Das Neueste in Wien ist, daß Beethoven [am 7. Mai 1824] ein Concert gibt, in welchem er seine neue Sinfonie [Nr. 9 d-Moll op. 125], 3 Stücke aus der neuen Messe [Kyrie, Credo und Agnus Dei aus der Missa solemnis op. 123], u. eine neue Ouverture [„Die Weihe des Hauses“ op. 124] produciren läßt. – Wenn Gott will, so bin auch ich gesonnen, künftiges Jahr ein ähnliches Concert zu geben.“ Dieser Plan blieb vorläufig unrealisiert, und dennoch war, wie sich aus dem Brief an Kupelwieser herauslesen lässt, die „große Symphonie“ von Anfang an untrennbar mit Schuberts Wunsch und Willen verknüpft, sich als Komponist eines aufsehenerregenden Werkes der Öffentlichkeit zu stellen. Insofern wurde das künstlerische Glücks- und Hochgefühl, mit der 1825/26 entstandenen Symphonie in C-Dur im fünften Anlauf das angestrebte Hauptwerk großen Stils vollendet zu haben, bald wieder von einer schweren Enttäuschung überschattet. Schubert widmete die Symphonie der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde, die sich 1827 auch tatsächlich an eine Einstudierung wagte, die Stimmen ausschreiben und die Komposition bei den Orchesterübungen des Konservatoriums probieren ließ – um schließlich doch von einer öffentlichen Wiedergabe der Symphonie „wegen ihrer Länge und Schwierigkeit“ abzusehen. Die Uraufführung fand dann überhaupt nicht in Wien statt, sondern – unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy – am 21. März 1839 im Leipziger Gewandhaus: über ein Jahrzehnt nach Schuberts Tod. Bei dessen Bruder Ferdinand hatte Robert Schumann die von den Wienern gleichgültig vergessene C-Dur-Symphonie in einer Abschrift vorgefunden, neben anderen ungehobenen Schätzen: „Der Reichthum, der hier aufgehäuft lag“, berichtete Schumann, „machte mich freudeschauernd; wo zuerst hingreifen, wo aufhören ! Unter andern wies er [Ferdinand Schubert] mir die Partituren mehrer Symphonien, von denen viele noch gar nicht gehört worden sind, ja oft vorgenommen, als zu schwierig und schwülstig zurückgelegt wurden. Man muß Wien kennen, die eigenen Concertverhältnisse, die Schwierigkeiten, die Mittel zu größeren Aufführungen zusammenzufügen, um es zu verzeihen, daß man da, wo Schubert gelebt und gewirkt, außer seinen Liedern von seinen größeren Instrumentalwerken wenig oder gar nichts zu hören bekommt. Wer weiß wie lange auch die Symphonie, von der wir heute sprechen [D 944], verstäubt und im Dunkel liegen geblieben wäre, hätte ich mich nicht bald mit Ferdinand Sch. verständigt, sie nach Leipzig zu schicken.“ „Die ist Dir nicht zu beschreiben“ Die „Große C-Dur-Symphonie“: Wie einst für Schubert selbst wurde sie nun auch für Robert Schumann zu einem befreienden Erlebnis, war sie doch 19 Ferdinand Georg Waldmüller: Schubert beim Musizieren seiner Lieder zwischen Josephine Fröhlich und Johann Michael Vogl (1827) 20 Franz Schubert: Schubert: 8. 8. Symphonie Symphonie C-Dur C-Dur Franz der tönende Beweis, dass es nach und trotz Beethoven noch eine Symphonik eigenen Rechts geben konnte. „Die völlige Unabhängigkeit, in der die Symphonie zu denen Beethoven’s steht, ist ein anderes Zeichen ihres männlichen Ursprungs“, urteilte Schumann in seiner Neuen Zeitschrift für Musik. „Hier sehe man, wie richtig und weise Schubert’s Genius sich offenbart. Die grotesken Formen, die kühnen Verhältnisse nachzuahmen, wie wir sie in Beethoven’s spätern Werken antreffen, vermeidet er im Bewußtsein seiner bescheideneren Kräfte; er gibt uns ein Werk in anmuthvollster Form, und trotz dem in neu verschlungener Weise, nirgends zu weit vom Mittelpunct wegführend, immer wieder zu ihm zurückkehrend.“ Offener, persönlicher noch äußerte sich Schumann am 11. Dezember 1839, als Mendelssohn das Werk zum zweiten Mal einstudierte, in einem Brief an Clara Wieck: „Heute war ich selig. In der Probe wurde eine Symphonie von Franz Schubert gespielt. Wärst Du da gewesen. Die ist Dir nicht zu beschreiben; das sind Menschenstimmen, alle Instrumente, und geistreich über die Maßen, und diese Ins trumentation trotz Beethoven – auch diese Länge, diese himmlische Länge, wie ein Roman in vier Bänden, länger als die 9te Symphonie. Ich war ganz glücklich, und wünschte nichts, als Du wärest meine Frau und ich könnte auch solche Symphonien schreiben.“ Beide Wünsche sollten sich, wie wir wissen, schon bald erfüllen. In seinen letzten Lebenswochen war Schubert noch einmal mit Entwürfen für eine Symphonie in D-Dur (D 936 A) beschäftigt. Aber sein Tod am 19. November 1828 beendete das kurze, dennoch ertragreiche, jedenfalls unvergleichliche Kapitel, das Franz Schubert in der Geschichte der sympho- 19 nischen Musik geschrieben hat. Am 14. Dezember 1828 wurde in einem Abonnementskonzert der Gesellschaft der Musikfreunde erstmals eine seiner Symphonien öffentlich gespielt: die „Sechste“, die „kleine“ C-Dur-Symphonie. Diese Aufführung war, wie die meisten im 19. Jahrhundert, ein isoliertes Ereignis. Der „Liederkompositeur“ Schubert wurde zur Legende, der Symphoniker aber blieb noch für Generationen eine unbekannte Größe. 20 Die über Glosse Richard Strauss Franz Schubert 21 „Glücklicher Schubert !“ Richard Strauss Ich sitze ahnungslos beim Frühstück, öffne ein Telegramm: „Bitten Sie zur Neujahrsnummer einen Artikel über Franz Schubert zu schreiben. Neue Freie Presse.“ Ich bekam einen solchen Schreck, dass mir der Artikel eines deutschen Jusprofessors im roten „Tag“, der früher schon über die Fabrikation künstlichen Düngers, über deutsche Kunst in Neu-Guinea, Der Beginn der C-Dur-Symphonie in Schuberts Handschrift über die schädliche Einwirkung moderner Musik auf die Sittlichkeit unserer braven Feldgrauen gekohlt hatte, zur Hälfte im Hals stecken blieb. Ein Musiker soll über Musik schreiben ? Ja, seit wann ist das üblich ? Erster Eindruck: die ehrenvolle Einladung der „Neuen Freien Presse“ wegen absoluter Unwürdigkeit ablehnen ! Dann mahnte die Vernunft: der „Neuen Freien Presse“ ein Refus geben ? Geht nicht. Das hieße eine schlimme 22 Dieüber Glosse Richard Strauss Franz Schubert Kritik des Vaters Korngold1 bei der nächsten Direktion eines Wohltätigkeitskonzertes in Wien heraufbeschwören. Also drum einmal nachgedacht ! Bei näherem Nachdenken kam mir die Erkenntnis, dass ich über Franz Schubert überhaupt kaum jemals ernstlich nachgedacht hatte. Wenn ich melodienhungrig war, hatte ich mir wohl so und so oft ein Dutzend Schubert’scher Lieder durchgespielt, wenn ich mir einen besonderen Feiertag vergönnte, die C-Dur-Symphonie dirigiert. À propos C-Dur-Symphonie ! Doch, über die hatte ich einmal wirklich nachgedacht, als ich mir sagen musste, von dieser göttlich unbefangenen, im ungehindertsten Erfinderleichtsinn geborenen Suite stammen die ganzen modernen Musiziersymphonien Schumanns, Brahms’, Tschaikowskys, Goldmarks, Bruckners ab – nicht von den neun Tondichtungen Beethovens, von welchen die direkte Linie über den von der Zunft heute immer noch unerkannten Franz Liszt bis zu meiner Wenigkeit geht. Auch bei der „Wanderer-Phantasie“ machte ich einmal nachdenklich halt, um die Erfindung des Leitmotivs einer näheren Untersuchung zu unterziehen, aber sonst – nachgedacht hatte ich noch nicht über Schubert, wirklich nicht – nur ihn angebetet, gespielt und gesungen und bewundert ! Ja beneidet: das ist’s ! Glücklicher Schubert ! Er konnte komponieren, was er wollte, wozu ihn sein Genius trieb. Da gab’s noch keine Kunstgelehrten, die bei jedem Werke prophezeiten, wie die nächsten Werke aussehen müssten. Oder die jedes neue Werk mit vor zehn Jahren geschriebenen Werken, die sie seinerzeit ebenso in Grund und Boden hinein 21 umstritten hatten, tot schlugen. Hat nicht Ihr Hanslick 2 , der beim Erscheinen den „Lohengrin“ als bar jeglicher Melodie erklärt hatte, bei den „Meistersingern“ erklärt, die große Erfindungskraft, die im „Lohengrin“ waltete, sei nunmehr völlig versiegt ? Glücklicher Schubert ! Bei der ersten Aufführung der C-Dur-Symphonie konnte kein hochnäsiger Kritiker nach bloßem Durchlesen der Partitur das Werk zerschmettern, weil die Partitur damals noch gar nicht gedruckt war ! Anmerkungen: 1 Julius Korngold (1860–1945), Musikkritiker der „Neuen Freien Presse“, Vater des Komponisten Erich Wolfgang Korngold (1897–1957). 2 Eduard Hanslick (1825–1904), Vorgänger von Julius Korngold als Musikkritiker der „Neuen Freien Presse“, erbitterter Gegner Richard Wagners. Aus dem Nachlass des Komponisten mitgeteilt von Stephan Kohler 20 Die Künstler Der 23 Zubin Mehta Dirigent Angeles Philharmonic Orchestra (1962–1978). 1977 wurde Zubin Mehta Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra, das ihn 1981 zum Music Director auf Lebenszeit ernannte, 1978 des New York Philharmonic Orchestra, dem er insgesamt 13 Jahre als Music Director vorstand, und 1985 des Musikfestivals „Maggio Musicale Fiorentino“, wo er regelmäßig Opernproduktionen und Konzerte dirigiert. Sein Debüt als Operndirigent hatte Zubin Mehta bereits 1964 in Montreal gegeben; seitdem dirigierte er u. a. an der Metropolitan Opera New York, an der Wiener Staatsoper, am Londoner Royal Opera House Covent Garden, am Mailänder Teatro alla Scala und bei den Salzburger Festspielen. 1998 bis 2006 war Zubin Mehta Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, deren Ehrenmitglied er heute ist. Zubin Mehta wurde 1936 in Bombay / Indien geboren und wuchs in einer musikalischen Familie auf. Nach zwei Semestern Medizinstudium konzentrierte er sich ganz auf die Musik und nahm bei Hans Swarowsky an der Wiener Musikhochschule Dirigierunterricht; in der Folge gewann er den Dirigierwettbewerb von Liverpool und den Sergej Koussewitzky-Wettbewerb in Tanglewood. Im Alter von 25 Jahren hatte Zubin Mehta bereits die Wiener und Berliner Philharmoniker dirigiert; außerdem war er Music Director des Montreal Symphony Orchestra (1961–1967) und des Los Zubin Mehta trägt den „Arthur Nikisch-Ring“ und den Ehrenring der Wiener Philharmoniker; in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste um die Münchner Philharmoniker ernannte ihn das Orchester 2004 zum ersten Ehrendirigenten seiner Geschichte. e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 24 Auftakt Dirigenten Die Kolumne von Elke Heidenreich Meine erste Kolumne für diese Programmhefte schrieb ich vor genau zwei Jahren über den Antritt von Lorin Maazel als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, und ich hörte sein grandioses Antrittskonzert mit Mahlers Symphonie Nr. 9. Was für ein Meister stand da am Pult, und wie leuchtete das Orchester! Nun ist Lorin Maazel im Juli gestorben und hinterlässt eine Lücke, die andere Dirigenten natürlich füllen können, aber seinen ganz speziellen Stil, seine immense Erfahrung kann so schnell keiner ersetzen, denn jeder Dirigent ist einzigartig – darum haben wir ja alle unsere Vorlieben und Abneigungen bei diesem Thema. Das zeigt letztlich nur, wie lebendig die Musikszene ist, was alles möglich ist. „Um einem Missverständnis vorzubeugen: aus der Spitze des Taktstockes ist noch nie ein Ton herausgekommen.“ Mit diesem Satz leitet der Musikkritiker Wolfgang Schreiber sein Buch über Große Dirigenten ein. Wenn aber aus dem Taktstock nichts herauskommt – wie machen die das dann, fragt er. Hypnotisieren sie das Orchester? Haben sie alles im Kopf und in den Händen? Wozu das magische Stöckchen? Und was genau ist das Geheimnis eines großen Dirigenten? Dasselbe, was auch das Geheimnis aller großer Komponisten, Maler, Schriftsteller ist: die Mischung aus Talent und Kraft, Charisma, Zielstrebigkeit, Fleiß, Disziplin. Zuallererst aber: Talent. Und dann gibt es die Klangmagier, die Perfektionisten, die Genießer, es gibt die Exzentriker, die Schweigsamen, die Kommunikationsgenies, die kleinen Diktatoren. Der italienische Filmregisseur Federico Fellini, der Musik so liebte, setzte dem Maestro in seinem Film „Orchesterprobe“ von 1979 ein Denkmal und sagte augenzwinkernd: „Hochgewachsen soll er sein, der ideale Dirigent, bleich, schön, gebieterisch, geheimnisvoll, magnetisch, das Antlitz geprägt von edlem Leid.“ Ein Dirigent wie Lorin Maazel, der dirigierte, seit er 11 Jahre alt war, kannte alle Musik, und er kannte sie in allen denkbaren Variationen. Dazwischen noch den eigenen Stil, das eigene Tempo, die eigene Handschrift zu finden, ist etwas, das ich immer wieder zutiefst bewundere und auch an ihm bewundert habe. Auch Toscanini, Sanderling, Karajan standen oder saßen noch mit über 80 Jahren am Pult und leisteten Grandioses. Und man kann den Stil einzelner Dirigenten noch so sehr analysieren, ein Orchester noch so sehr unter die Lupe nehmen – letztlich ist das Zusammenwirken von Dirigent und Orchester ein Mysterium, ein Rest unbegreiflicher Rätselhaftigkeit, die das Glück der Zuhörer ausmacht. Wir werden dieses großartige Orchester in dieser Saison unter fast dreißig verschiedenen Dirigenten erleben, von denen der älteste 1935 und der jüngste 1984 geboren wurde – und wir werden hören, wie bekannte Klänge sich verändern und verwandeln. Auch Maazel hätte es so gewollt: dass wir der Musik treu bleiben und auch offen gegenüber allen möglichen Interpretationen. Ph Eine Broschüre mit den neuen Konzertprogrammen für die Spielzeit 2014/15 ist ab sofort in den Auslagen im Foyer des Gasteigs erhältlich. Allen Abonnenten wurde im Vorfeld der Saison eine Broschüre mit den Programmen nach Abo-Reihen zugeschickt. Sollten Sie kein Exemplar erhalten haben, bedienen Sie sich bitte an den Auslagen oder wenden Sie sich bitte an unser Abo-Büro. Abschied (I) Unsere Hornistin Maria Teiwes wechselt zu den Bamberger Symphonikern und tritt dort die Stelle als Solo-Hornistin an. Abschied (II) Barbara Kehrig hat die Stelle als Kontrafagottistin beim Konzerthausorchester Berlin gewonnen, die sie zum Start der Saison 2014/15 antreten wird. Herzlich willkommen (I) Wir begrüßen bei den Philharmonikern Floris Mijnders (Solo-Cello), Fora Baltacigil (Solo-Kontrabass), Teresa Zimmermann (Solo-Harfe) und Mia Aselmeyer (Horn). Sie treten zum Beginn der neuen Spielzeit ihre Stellen und das damit verbundene Probejahr an. Ein Kurzportrait finden Sie auf den folgenden Seiten. Herzlich willkommen (II) Ebenso herzlich heißen wir Sigrid Berwanger, Jiweon Moon und Laura Mead (2. Violinen), Christa Jardine und Julie Risbet (Bratschen), 25 Johannes Hofbauer (Fagott) sowie Thiemo Besch (Horn) willkommen. Sie haben einen Zeitvertrag für die Saison 2014/15 erhalten. Kampala, Uganda Zu Gast in der Kampala Music School in Uganda. Im August reisten zum ersten Mal Mitglieder des Orchesters in die ugandische Hauptstadt Kampala, um dort mit Kindern und Musikern der Musikschule in Workshops gemeinsam zu musizieren und Konzerte zu geben. Die Eindrücke in diesem tollen ostafrikanischen Land mit unglaublichen Menschen, die Shengni Guo, Traudl Reich und Maria Teiwes dort erlebten, können Sie in unserem Blog nachlesen bei facebook. com/spielfeldklassik. Fußball Eine höchst unglückliche Niederlage beim Fußballspiel gegen das Team des Bayerischen Staatsorchesters musste der FC Philharmoniker verzeichnen. Stark ersatzgeschwächt – sechs Stammkräfte mussten verletzungsbedingt kurzfristig absagen – und trotz drückender spielerischer Überlegenheit mit ansehnlichen Ballstaffetten nutzten selbst klarste Elfmeterchancen nichts: das Spiel ging mit 0:1 verloren. Wir gratulieren dem Staatsorchester und freuen uns auf das nächste Match. Wie es noch besser geht, erlebten dann beide Mannschaften beim WM-Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich – das Spiel schauten sich alle in kollegialer Eintracht beim gemeinsamen Grillen an. e Konzertübersicht 2014/15 ch is on m er ar ätt ilh Bl Philharmonische Notizen e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph Wir begrüßen... 26 Mia Aselmeyer Teresa Zimmermann Instrument: Horn Instrument: Harfe Mia Aselmeyer wuchs in ihrem Geburtsort Bonn auf und war Jungstudentin an der Kölner Musikhochschule bei Paul van Zelm. Während des Studiums an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Ab Koster war sie Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie und Stipendiatin der Orchesterakademien des Schleswig-Holstein Musikfestivals und der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Für die vergangene Saison erhielt sie bereits einen Zeitvertrag bei den Münchner Philharmonikern, nach ihrem erfolgreichem Probespiel tritt sie nun ihr Probejahr zur festen Stelle an. „Mit der Stelle bei den Münchner Philharmonikern erfüllt sich mir ein Lebenstraum. Ich bin gespannt darauf mit dem Orchester an die unterschiedlichsten Orte zu reisen und der Welt somit die Stadt München ein Stück näher zu bringen“, bekennt Mia Aselmeyer, die in ihrer Freizeit gerne München und das Umland entdeckt und ihre Häkel- und Backtechniken verfeinert. Teresa Zimmermann erhielt ihren ersten Harfenunterricht in ihrer Heimatstadt Hannover mit sechs Jahren. 2008 schloss sie ihr Studium bei Maria Graf an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin mit Auszeichnung in der Solistenklasse ab. Sie erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei allen bedeutenden internationalen Wettbewerben für Harfe. Seit Jahren konzertiert sie als Gast bei renommierten europäischen Orchestern und war seit 2013 Solo-Harfenistin des Philharmonia Orchestra London. Solokonzerte gab sie unter anderem mit den Duisburger Philharmonikern, dem Warschauer Sinfonieorchester und dem Konzerthausorchester Berlin. 2011 wurde sie von ARTE unter der Moderation von Rolando Villàzon für die Sendung „Stars von morgen“ aufgenommen. Seit Dezember 2011 unterrichtet sie als Dozentin für Harfe eine Hauptfachklasse an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. „Ich habe noch nie in Süddeutschland gelebt und bin gespannt, was mich erwartet“, erzählt sie. „Als begeisterte Sportlerin freue ich mich sehr auf die viele Natur und die gute Luft!“ Ph ch is on m er ar ätt ilh Bl 27 Fora Baltacigil Floris Mijnders Instrument: Bass Instrument: Cello Fora Baltacigil, geboren in Istanbul, erhielt ab dem Alter von neun Jahren Bass-Unterricht von seinem Vater, dem Solo-Kontrabassisten des Istanbul State Symphony Orchestra. Später studierte er bis zum Jahr 2002 am Istanbul University Conservatory und erhielt 2006 sein künstlerisches Diplom am Curtis Institute of Music in Philadelphia, wo er Schüler Hal Robinsons und Edgar Meyers war. Fora Baltacigil war Mitglied der Berliner Philharmoniker und Solo-Bassist des Minnesota Orchestra und des New York Philharmonic Orchestras. Als Solist spielte er mit dem Minnesota Orchestra John Harbisons „Concerto for Bass Viol“ und trat zusammen mit seinem Bruder Efe, dem Solo-Cellisten des Seattle Symphony Orchestras, mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle auf (Programm: Giovanni Bottesinis „Grand Duo Concertante“). Seine Freizeit verbringt Fora Baltacigil – wenn er nicht gerade als Hobby-Koch am Herd steht und neue Rezepte ausprobiert – gerne als begeisterter Segler und Taucher in bzw. auf dem Wasser. Floris Mijnders, geboren in Den Haag, bekam als Achtjähriger den ersten Cellounterricht von seinem Vater. Ab 1984 studierte er bei Jean Decroos am Royal Conservatory Den Haag. Während seines Studiums spielte er im European Youth Orchestra und besuchte Meisterklassen bei Heinrich Schiff und Mstislav Rostropovich. Mijnders wurde 1990, kurz nach Studienende, 1. Solo-Cellist im Gelders Orkest in Arnhem. Nicht viel später wechselte er in gleicher Position zum Radio Filharmonisch Orkest. Seit 2001 war er 1. Solo-Cellist des Rotterdam Philharmonic Orchestra und wurde als Solo-Cellist von zahlreichen renommierten europäischen Orchestern eingeladen. Als Solist trat er mit vielen europäischen Orchestern auf, unter anderem mehrmals mit dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam und dem Radio Filharmonisch Orkest. Floris Mijnders ist Professor für Violoncello am Sweelinck Concervatorium Amsterdam. Neben der Musik ist Kochen Floris Mijnders Leidenschaft. Er freut sich auf die Zeit in München und darauf, die schöne Natur Bayerns genießen und im Winter Schlittschuhlaufen gehen zu können. e Wir begrüßen... e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 28 Über die Schulter geschaut Im Dienste der Musik – die Notenarchivare der Münchner Philharmoniker Christian Beuke Gefragt nach einem typigerne arbeiten die beiden schen Arbeitstag, fällt ihre Archivare für den EhrenAntwort kurz, prägnant und dirigenten, Zubin Mehta. mit einem Schmunzeln aus: Denn pünktlicher als er ist „Den gibt es nicht.“ Thomas niemand. „Von ihm kommt Lang und Georg Haider ardie Quinte mindestens drei beiten seit zehn bzw. fünf Monate vor der ersten ProJahren als Notenarchivare be. Mehr als ausreichend Zeit, damit wir die fertigen bei den Münchner Philharmonikern. Vor allem sind sie Stimmen pünktlich an die dafür verantwortlich, dass Thomas Lang und Georg Haider (von links auf dem Foto) Orchestermusiker überdie Striche – die Auf- und arbeiten seit zehn bzw. fünf Jahren als Notenarchivare geben und sie die ProAbstriche der Streicher – gramme vorbereiten könkorrekt in jede Stimme und nach den Wünschen des nen. Unser Anspruch ist es, immer zwei bis drei Dirigenten eingetragen sind. „Manche Maestri Projekte voraus zu sein“, erläutert Georg Haider. schicken uns eine sogenannte „Quinte“ – die ein„Treten Programmänderungen auf, hat die Aktualigerichteten Striche von je einer 1. und 2. Geige, tät natürlich immer Vorrang.“ Bratsche, Cello und Bass“, erklärt Georg Haider. Was sich auf den ersten Blick simpel anhört, ist Durch ihre Hände wandern mitunter wahre Schätbei genauerem Hinsehen wesentlich komplexer. ze. Gustavo Dudamel war sofort Feuer und Flamme Jeder Maestro hat unterschiedliche Erwartungen: als er hörte, dass es bei den Münchner Philharmoder eine bevorzugt das Notenmaterial eines benikern noch alte Noten gebe, die von Celibidache stimmten Verlags, weil er mit diesen Noten schon eingerichtet wurden und aus denen er dirigiert hat. seit Jahren arbeitet. „Lorin Maazel hat dank seines „Er fragte, ob er nach einer Probe kurz bei uns vorfotografischen Gedächtnisses sofort erkannt, ob es bei kommen dürfe, um sich Partituren genauer an„sein“ Material war“, erinnert sich Thomas Lang. zusehen“, berichtet Thomas Lang. „Fast eine Stun„Diese Stelle war doch bisher immer oben links auf de war er da“ – eine Ausnahme, wie er gerne offen zugibt. „Mit offenem Mund hat er zugehört als dieser Seite. Es ist ein wenig ungewohnt, wenn sie auf einmal woanders auftaucht“, so der Kommentar ich ihm sagte, dass die Münchner Philharmoniker des Maestros. Andere Dirigenten sind dagegen fast alle Orchesterwerke Richard Strauss’ vom sehr an den neuesten Ausgaben interessiert, die Komponisten selbst geschenkt bekommen haben.“ erst ganz frisch herausgekommen sind. Besonders In der Tat eine absolute Besonderheit. Ph Auch ein guter Draht zu den Musikern des Orchesters ist für Thomas Lang und Georg Haider selbstverständlich. Wünsche einzelner Kollegen werden sofort erfüllt, sei es die Vergrößerung von Stimmen, das Übertragen kurzer Passagen in einen anderen Notenschlüssel oder die Bereitstellung von Stimmen auch mal früher als normalerweise üblich. Wolfgang Berg, Bratscher und Erfinder des 29 Odeonjugendorchesters, fragt regelmäßig für das Patenorchester nach einer Quinte, damit die jungen Musiker die Striche in ihr gekauftes Material übertragen können. Gleiches gilt für das Abonnentenorchester. Und unlesbare Stimmen, im letzten Falle waren das zwei Soloviolinen, die in einem Notensystem – „für das menschliche Auge kaum mehr wahrnehmbar“ – zusammengefasst waren, werden fein säuberlich getrennt neu notiert. Für das beste künstlerische Ergebnis. Georg Haider hat u.a. Komposition studiert. Bevor er bei den Münchner Philharmonikern anfing, war er als freischaffender Komponist tätig. Erst kürzlich hat er mit einem außergewöhnlichen Projekt von sich Reden gemacht: dem Klangbuch „Der Dritte Mann“, nach dem Roman von Orson Welles. Die Musik für vier Zithern, Posaune und Schlagzeug hat er ursprünglich für ein Zitherfestival komponiert. Gemeinsam mit dem Sprecher Norbert Gastell, mit verstellter Stimme als Synchronstimme von Homer Simpson bekannt, ist ein Melodram entstanden, das der Mandelbaumverlag herausgebracht hat. Deutschlandradio Kultur rezensiert: „Dieser „Dritte Mann“ ist kein Futter für das Autoradio, kein Unterhaltungskrimi, kein Auffrischen einer bereits bekannten Erzählung. Georg Haiders „Der Dritte Mann – Orson Welles’ Schatten“ ist uneasy listening, faszinierend-verstörende Hörkunst, die bewusstes Hören erfordert. Und nachdem man diesen Stoff mit anderen Ohren gehört hat, wird man vermutlich auch den Film mit anderen Augen sehen.“ Stets im Dienste der Musik eben. e In der Regel aber wird das Notenmaterial eingekauft. Bedingung für den Erwerb ist, dass die Rechte der Komponisten an den Werken freigeworden sind. In Deutschland ist das 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten der Fall. Richard Strauss zum Beispiel ist also noch bis zum 1.1.2020 geschützt. In Asien oder auch in Amerika gelten hingegen andere Regeln. So war in den USA bis vor kurzem jedes Werk 50 Jahre nach dem Erscheinen des jeweiligen Erstdrucks geschützt. Wann werden welche Werke frei? Welche neuen Urtexte gibt es? Fragen, die die beiden Archivare aus dem Stand beantworten können. Ein guter Draht zu den Musikverlagen ist dabei mehr als hilfreich, ja geradezu Voraussetzung. Thomas Lang hat viele Jahre in einem großen Notenverlag gearbeitet, er kennt auch die andere Seite bestens und hat schon die eine oder andere kritische Situation still und einvernehmlich gelöst. Vorher war er als Dramaturg an verschiedenen Theatern in Deutschland tätig. Kein Wunder, dass seine große Liebe der Oper gilt, genauer gesagt der unentdeckten Oper. Mehr als 600 verschiedene Opern hat er bereits gesehen, dafür reist er durch ganz Deutschland, wann immer es die Zeit zulässt. Besonders angetan ist er von den zahlreichen Raritäten, die das Stadttheater Gießen schon seit Jahren ausgräbt. ch is on m er ar ätt ilh Bl Über die Schulter geschaut e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 30 Orchestergeschichte Ein außergewöhnliches Konzert mit Gustav Mahlers nachgelassenem Adagiosatz Gabriele E. Meyer Am 17. Dezember 1931 stellte der Konzertverein in Verbindung mit der 1927 von Fritz Büchtger gegründeten „Vereinigung für zeitgenössische Musik“ vier für München ganz neue und „gegensätzliche“ Werke vor. Am Pult der Münchner Philharmoniker stand Hermann Scherchen, zeit seines Lebens unbeirrbarer Förderer der neuen Musik und Freund vieler Komponisten. Mit Feuereifer erarbeiteten die Musiker Gustav Mahlers Adagio aus dessen unvollendet gebliebener zehnten Symphonie sowie Paul Hindemiths 1930 für das Bostoner Symphonieorchester komponierte „Konzertmusik für Streichorchester und Bläser“ op. 50, Arthur Honeggers Symphonie Nr. 1 (1930) und Wladimir Vogels „Zwei Orchester-Etüden“, ebenfalls aus dem Jahre 1930. Schon in der Ankündigung zu dem Konzert machten die „Münchner Neuesten Nachrichten“ auf die schwierige musikgeschichtliche Stellung des damals noch kontrovers diskutierten österreichischen Komponisten aufmerksam. „Mahler ist oft als einer der Väter der sogenannten neuen Musik bezeichnet worden, wenn auch diese Beziehung sehr problematisch ist und man eher ihn als den Ausklang der Romantik bezeichnen kann.“ Das Echo auf diesen Konzertabend aber war enorm, wobei gerade Mahlers Adagiosatz den größten Eindruck hinterließ. So wurden die „innere Konzentration“ und die „ergreifende Ausdruckskraft des breit in schmerzlicher Schönheit hinströmenden Gesanges“ ebenso vermerkt wie die „Spannung weiter Intervalle“. Ein anderer Rezensent sah den Satz als „erschütternden Ausklang einer um die letzten Dinge wissenden Seele“. Interessant, notabene, ist hier auch der Hinweis auf Brucknersche Gedankengänge. Es scheint, als ob die Logik des Zerfalls, das musikalische Bild des Todes, das Mahler hier komponiert hat, geradezu hervorragend getroffen wurde. Wie nun Hermann Scherchen die Werke des ganzen Abends „musikalisch und geistig, aber auch dirigiertechnisch vermittelt hat, war“, nach übereinstimmender Meinung, „wieder im höchsten Grade bewunderungswürdig. Aber auch die Münchner Philharmoniker zeigten sich an diesem Abend auf der vollen Höhe ihrer Leistungsfähigkeit. Sie spielten glänzend.“ Ein besonderes Lob erhielten die Blechbläser, die wahrlich keinen leichten Abend hatten. Der schönste Dank aber kam von Scherchen selbst. In einem offenen Brief an die Philharmoniker würdigte er deren großartigen Einsatz. „Nicht nur, daß Sie ein exzeptionell schwieriges Programm virtuos bewältigten, haben Sie auch vermocht, vier ganz gegensätzliche Stile scharf profiliert darzustellen und dies auf Grund von relativ knappster Probenarbeit. Ich habe bewundert, mit welch persönlichem Interesse Sie sich schnell zu den Ihnen ganz fremden Werken in Beziehung zu bringen vermocht haben und ich war glücklich und Ihnen restlos dankbar, daß Ihr künstlerisches Verantwortungsgefühl es mir ermöglicht hat, noch am Abend unmittelbar vorm Konzert zu probieren und so in hohem Maße der Kunst dienen zu können.“ Ph ch is on m er ar ätt ilh Bl 31 Ehrenamt in Kampala Jutta Sistemich, über 10 Jahre tätig im „Spielfeld Klassik“-Team und Gründerin des Mädchenheims SUNRISE HOME OF KAMPALA in Uganda Uganda zählt zu den kinderreichsten, ärmsten Ländern Afrikas. 2 Millionen Waisen sind dort registriert, ca. die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 16 Jahre. Für viele Kinder dort bedeutet dies keine vielversprechenden Zukunftsaussichten, wenig Hoffnung auf eine gute Schulausbildung und ausreichende medizinische Versorgung. Gleich bei meinem ersten Aufenthalt in Kampala im April 2011 entstand die Idee, ein Heim für Mädchen einzurichten, die dort ein neues zu Hause bekommen und die Chance auf eine gute Ausbildung erhalten. Im September 2012 gründete ich gemeinsam mit meiner Tochter Viola und meiner Freundin Leilah Nassozi (siehe Foto), das SUNRISE HOME OF KAMPALA, das heute 20 Kinder beherbergt. Unsere Projekte sollen vielen Kindern helfen – z.B. durch unsere Tanzgruppe, in der auch viele Kinder der Nachbarschaft mittanzen und einige Schulgelder von uns erhalten. Oder die geplante Nähschule, um Bewohnern der Dorfgemeinschaft eine Ausbildungsmöglichkeit zu geben. Da auch die klassische musikalische Förderung einen Schwerpunkt bildet, lag es nahe, den Kontakt zur Kampala Music School (KMS), dem Zentrum für klassische Musik und Jazz in Uganda, zu suchen und die Idee der Kooperation anzuregen. Fred Kiggundu Musoke, Leiter der KMS, war direkt begeistert und so entwickelten wir verschiedene Szenarien, von denen wir den ersten Schritt im Juli diesen Jahres realisierten. Die Musikerinnen Traudel Reich, Maria Teiwes und Shengni Guo reisten zusammen mit Simone Siwek, der Leiterin von „Spielfeld Klassik“, nach Kampala. Workshops mit Lehrern und Schülern standen auf dem Programm, gemeinsames Musizieren und ein Konzert. Der gegenseitige Austausch stand im Vordergrund, wobei Schüler und Lehrer der Musikschule mit großer Begeisterung dabei waren. Natürlich sind die Gegebenheiten vor Ort nicht mit denen in Deutschland zu vergleichen. Kurzfristige Änderungen von Plänen sind üblich und lange Wartezeiten keine Seltenheit. Dennoch: Dank gutem Willen, Improvisationstalent und viel Enthusiasmus aller Beteiligten wurde der erste Besuch der MPhil-Delegation ein voller Erfolg. Wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen möchten – Ihre Hilfe erreicht unsere Kinder direkt. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie unter www.empologoma.org. e Das letzte Wort hat... 32 Sa. 01.11.2014, 19:00 2. Abo d So. 02.11.2014, 11:00 1. Abo m Mo. 03.11.2014, 20:00 1. Abo e5 Joseph Haydn Symphonie Nr. 88 G-Dur Hob. I:88 Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier und ­O rchester Nr. 3 c-Moll op. 37 Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 Vorschau Mo. 10.11.2014, 20:00 2. Abo f Mi. 12.11.2014, 20:00 2. Abo a Ottorino Respighi „Fontane di Roma“ Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21 Do. 13.11.2014, 19:00 1. JuKo Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21 Claude Debussy „Images“ Alan Gilbert, Dirigent Claude Debussy „Images“ Alan Gilbert, Dirigent Thomas Dausgaard, Dirigent Leif Ove Andsnes, Klavier Impressum Herausgeber Direktion der Münchner ­P hilharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4, 81667 München Lektorat: Stephan Kohler Corporate Design: Graphik: dm druckmedien gmbh, München Druck: Color Offset GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt. Textnachweise Susanne Stähr, Peter Andraschke, Wolfgang Stähr, Elke Heidenreich, Christian Beuke, Gabriele E. Meyer und Jutta Sistemich schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler verfasste die lexikalischen Angaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken und redigierte die Schubert-Glosse aus dem Nachlass von Richard Strauss. Künstlerbiographie Mehta: Agenturtext. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Bildnachweise Abbildungen zu Franz Schubert: Joseph Wechsberg, Schubert – Sein Leben, sein Werk, seine Zeit, München 1978; Cedric Dumont, Franz Schubert – Wan­derer zwischen den Zeiten, Braunschweig 1978; Ernst Hilmar, Schubert, Akademische Druckund Verlagsanstalt, Graz 1989. Künstlerphotographien: Wilfried Hösl (Mehta); Leonie von Kleist (Heidenreich); Privat (Aselmeyer, Zimmermann, Baltacigil, Mijnders); Simone Siwek (Sistemich). Thomas Dausgaard Dirigent Leif Ove Andsnes Klavier Joseph Haydn Symphonie Nr. 88 G-Dur Hob. I:88 Samstag, 01.11.2014, 19 Uhr Sonntag, 02.11.2014, 11 Uhr Montag, 03.11.2014, 20 Uhr Ludwig van Beethoven Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll op. 37 Philharmonie im Gasteig Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 Karten € 61 / 51,50 / 45 / 36,90 / 31,20 / 18,10 / 12,30 Informationen und Karten über München Ticket KlassikLine 089 / 54 81 81 400 und unter mphil.de 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant