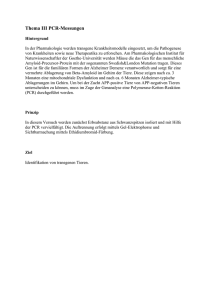Lernen aus Sicht des Gehirns
Werbung

Prof. Dr. Ulrich Herrmann, Tübingen Neurodidaktik – die Kooperation von Neurowissenschaften und Didaktik Gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht getan, getan ist noch nicht beibehalten. Die aktuelle Kontroverse Schon die Bezeichnung „Neurodidaktik“ ist kontrovers. Eingeführt wurde sie aufgrund von erfolgreichen Erfahrungen mit einem neuen methodischen Vorgehen bei Schülern mit Lern- und Verständnisschwierigkeiten (Friedrich 1995; Preiß 1996). Dieses Vorgehen beruht kognitionspsychologisch-konstruktivistisch darauf, „Holzwege“ im Denken und Verstehen bzw. „Fehler“ nicht durch wiederholende Instruktion zu beheben (und womöglich durch Wiederholung noch zu verfestigen!), sondern zu umgehen bzw. dadurch zu beheben, dass andere gedankliche Operationen – in unserem Zusammenhang genauer gesagt: durch Bahnung bzw. Nutzung anderer neuronaler Netzwerke – zu dem ursprünglich gewünschten, zunächst aber verfehlten Ergebnis führen (siehe „die Geschichte von Ilona“ bei Friedrich 2009). Die Bezeichnung Neurodidaktik war vielleicht nicht glücklich gewählt (aber sie ist nun mal eingeführt), weil es sich eher um eine modifizierte Methodik des Lehrens und Lernens handelt. Traditionell wird nämlich unterschieden zwischen Didaktik als Begründung der Auswahl und Anordnung der Lehrinhalte und Methodik als Lehre von den Lernverfahren (Terhart 2009a, S. 351), es handelt sich also um die Unterscheidung von Was und Wie (was bereichsspezifisch nicht immer exakt getrennt werden kann). Die neue neurodidaktische Sicht besteht – vereinfacht gesagt – darin, dass Begünstigungen und Widrigkeiten beim organisierten schulisch-unterrichtlichen Lernen in ihren Voraussetzungen und Strukturen, Prozessen und Ergebnissen aus neurowissenschaftlicher Sicht interpretiert und aufgrund neurowissenschaftlicher Einsichten modifiziert werden (Gasser 2008; Herrmann 2009a). Beiträge dazu finden sich auch in der Biopsychologie, der Neurophysiologie und vor allem in der Neuropsychologie. In Analogie zur bildungstheoretischen, konstruktivistischen, lerntheoretischen, kommunikativen, integrativen usw. Didaktik wäre „neuropsychologische Didaktik“ angemessen, aber dann wäre immer auch darauf hinzuweisen, die biologischen und physiologischen, die bioelektrischen und biochemischen Aspekte nicht zu übersehen. So wie sich die Sammelbezeichnung „Neurowissenschaften“ für diesen gesamten Gegenstandsbereich eingebürgert hat, könnte sich dies ganz analog im Laufe der Zeit auch für „Neurodidaktik“ als nützlich erweisen (Arnold 2002; Herrmann 2009a). Begriffe müssen präzise sein, Bezeichnungen sind Konventionen, und ihre Unschärfe ist in der Regel ein Vorteil: sie bringen unter einen Hut, wo allzu leicht akademisches Streben nach „Originalität“ dazu verführt, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen… Inzwischen ist auch „Neuropädagogik“ ins Spiel gebracht worden (Gyseler 2006), verbunden mit dem Vorschlag, besser von „neurowissenschaftlichen Grundlagen der Pädagogik“ zu sprechen. Diskutiert werden dann aber doch wieder lernpsychologische Aspekte und weniger genuin pädagogische, die jetzt von Neurowissenschaftlern, die explizit an (schul-)pädagogischen Problemen arbeiten, ins Spiel gebracht werden: etwa „Beziehung“, „Atmosphäre“ und „Wertschätzung“ als Dimensionen gelingender pädagogischer Kommunikation und Interaktion (Hüther 2009b; Bauer 2006, 2007, 2008, 2009). Neurodidaktik ist zunächst und vor allem eine neue Sicht auf Voraussetzungen, Strukturen und Prozesse von Lernen und Gedächtnis (i. S. von Informationsaufnahme, -verarbeitung, speicherung und -wiedergabe), nicht aber von höheren kognitiven Verstehens- und Denkprozessen; eine neurowissenschaftliche Interpretation von Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik (Aebli 2006) wäre hier höchst aufschlussreich. Neurodidaktik geht davon aus, dass natürliches („privilegiertes“) Lernen und organisiertes Lernen auf identischen neuronalen Prozessen beruhen, denn das Gehirn kann nur auf eine Weise in seinen intra- und interzellulären Prozessen „Erleben in Biologie verwandeln“ (Joachim Bauer). Dass diese Transformationsprozesse immer auch zugleich kulturell geformte sind, muss nicht eigens betont werden (Tomasello 2002), wird aber als Defizit der Neurodidaktik gern gegen sie ins Feld geführt (Müller 2007). Lernen als Verarbeitung von Informationen im Gehirn ist Gegenstand gemeinsamer Interessen von Neurowissenschaftlern, Lernforschern und Didaktikern, jedoch mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Wie genau das Gehirn Informationen so organisiert und speichert, dass sie als Sinnzusammenhänge wieder abrufbar sind, haben Neurowissenschaftler bisher nicht herausgefunden (vielleicht können sie es auch mit ihren Vorgehensweisen nicht oder unsere bisherigen Modellvorstellungen vom Funktionieren des Gehirns sind schlicht zu simpel; zum Stand des Wissens vgl. Roth 1997; Blakemore/Frith 2006; Brand/Markowitsch 2006, 2009). Lernpsychologen erforschen auf der Verhaltensdimension natürliches und organisiertes Lernen auf der Suche nach zielerreichenden Lernstrategien. Didaktiker/Lehrkräfte entwerfen und praktizieren Lehr-Lern-Arrangements – Lehren und Lernen als organisiertes Herbeiführen (Vermitteln und Aneignen) von Lern-, Gedächtnis- und Verstehensleistungen aufgrund von Selbst- und FremdInstruktion –, orientiert an institutionellen Vorgaben und individuellen Erfahrungen, nur sehr selten aufgrund von Befunden aus der Empirischen Unterrichtsforschung, mit entsprechenden Unsicherheiten hinsichtlich der erreichten Ziele (die sie in der Regel mit den erreichten Leistungstestergebnissen gleichsetzen [müssen]). Dass Neurowissenschaftler und Kognitions- bzw. Lernpsychologen keine Inhaltsfragen beantworten können – Was soll wann, warum, wozu gelernt werden? –, liegt auf der Hand. Im übrigen tut dies die Empirische Erziehungswissenschaft auch nicht, denn diese Fragen werden immer nur durch Konvention und Erfahrung, Konsens und Entscheidung normativ entschieden, nicht durch Wissenschaft, denn diese kann immer nur sagen, was geschehen kann, nicht aber, was geschehen soll (Max Weber); sie kann bestenfalls sagen, was möglich, nicht aber, was erforderlich oder wünschenswert ist oder sein sollte. – Unter der Überschrift „Das Verhältnis von Theorie und Praxis“ wird häufig abgehandelt, wie der Weg von der Grundlagen-forschung zur Anwendung/Umsetzung aussehen könnte. Es gibt ihn gar nicht: theorie-orientierte Forschung sucht Antworten auf Fragen, die nicht die der Praktiker sind. Wie Lernen im Gehirn abläuft ist eine grundsätzlich andere Frage als die, wie sich bestimmte Lernergebnisse durch instruktive Anleitung („Unterricht“) erzielen lassen. Praxis ist immer eine experimentelle Situation – auch bei gut begründeten Erfolgserwartungen – mit ungewissem Ausgang. – Dass Wissenschaftler wie andere Fachleute auch aufgrund ihrer allgemeinen Expertise Praktiker beraten können (so der Beitrag von Hille in diesem Band), steht auf einem andern Blatt und hat mit einem Theorie-Praxis-Transfer nichts zu tun: es handelt sich nämlich um Wissenstransfer, der das Handeln des Praktikers unter Umständen nicht nur nicht anleitet, sondern dessen eigenes Räsonnement zu einer Unterlassung führt! – Weinert (1996, auch bei Herrmann 2009, S. 166ff.) hat gezeigt, dass die „allgemeinen“ Einsichten und Prinzipien der Lernpsychologie für die Gestaltung konkreter Lernprozesse ungeeignet sind, nicht zuletzt deswegen, weil die Verallgemeinerungen von Laborbefunden gegenüber der situativen Spezifizierung von Alltagssituationen holistisch und damit realitätsfremd sind. 2. Notwendige Vorbemerkungen 2.1 Was wir (nicht) wissen Im Folgenden geht es nicht um Neurologie, Neuroanatomie oder Neurobiologie des Gehirns oder die Neurochemie der Stoffwechselprozesse der Hirnzellen (vgl. den Beitrag von Prof. Scheich in diesem Band), sondern um eine funktionale Betrachtungsweise: nicht um Hirn als Substanz (Nervenzellen), sondern Gehirn als Organ. Von diesem Organ, mit dem wir eine überlieferte Umgangserfahrung hinsichtlich seiner Leistungen und Möglichkeiten seit den frühesten Dokumenten menschlicher geistiger Tätigkeit haben – also seit einigen tausend Jahren und vor allem seit der Frühzeit der griechischen Philosophie – wissen wir manches, das allermeiste allerdings gar nicht: • Wie dasjenige, was wir Lernen nennen, in den Hirnzellen und ihren Verknüpfungen funktioniert, wissen wir nicht – nur dass und wann es geschieht • Wie Informationen abrufbar gespeichert werden, ist ebenso unbekannt wie der Prozess ihrer Verknüpfung zu „Sinnstrukturen“ („neuronale Repräsentationen“). • Wie höhere kognitive Leistungen des Gehirns (beispielsweise Begriffe bilden) zustande kommen, ist unbekannt, aber wir können es. Einige Voraussetzungen sind in der Tradition der Pädagogik und der Pädagogischen Psychologie seit etwa 200 Jahren bekannt (s.u.); Neuromodulatoren erklären nicht die kognitive Einsicht in den Satz des Pythagoras oder in den Dreisatz – aber ohne sie sind u.U. keine gehirninternen Voraussetzungen für die Gewinnung dieser Einsichten gegeben gewesen. – Die Neurowissenschaften können sich als Wissenschaften der Physiologie, Biochemie, der Biophysik/-elektrik derzeit lediglich konzentrieren auf die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Wahrnehmungsimpulsen (Informationen), auf Memorieren und Gedächtnis. (Aus den Kurven eines EEG lässt sich nicht ablesen, was – wenn! – da jemand gedacht hat...) Die kognitiven Wissenschaften gehen von da aus weiter zu den „höheren“ Leistungen des Organs: von der Information zur Verknüpfung zu (bewusst kontrollierten) Wissen, von dort zu Einsichten/Verstehen und weiter zur Begriffsbildung/zum Denken. Und sie können das deshalb, weil nicht nur von außen Sinneseindrücke unser Gehirn in Tätigkeit versetzt, sondern weil wir bewusst etwas machen (und auch unterlassen!) können: Gedanken! (Ein Denkmal heißt Denkmal, weil seine Botschaft lautet: Denk mal!) • Es ist in Ansätzen experimentell überprüft, dass und zum Teil auch wodurch Informationsaufnahme und -verarbeitung durch bestimmte Umstände unterbunden, erschwert oder begünstigt werden kann. • Lernen verändert die Struktur des Gehirns; das Gehirn ist ein „soziales Organ“ (Frith 2009). • Natürliches Lernen – vor allem durch Nachahmen – geht sehr langsam, in der Regel aber auch sehr erfolgreich vor sich; das Gelernte wird erst nach vielen Wiederholungen im Langzeitgedächtnis dauerhaft verfügbar gehalten. • Details ohne Bedeutungskontexte vergisst das Gehirn rasch, abgesehen von Einmalereignissen, die deshalb auch „unvergesslich“ genannt werden: eine besondere Überraschung, „das erste Mal“, eine Verletzung. Muster und Bilder speichert es hingegen sehr lange, weil sie für die Erkennung und Bewertung neuer Informationen unerlässlich sind. • Das unterrichtlich-organisierte Lernen geht wie das natürliche langsam vor sich und ist in der individuellen und kaum beeinflussbaren Informationsverarbeitung und Bedeutungsgenerierung hinsichtlich einer normierten Zielerreichung höchst störanfällig. Deshalb müssen wir uns als Lehrende und Lernende nicht entmutigen lassen: Bis wir stehen und gehen, sehen und sprechen, Mimik interpretieren und mit unseren Gefühlsregungen andere Menschen beeinflussen konnten, hatten wir eine lange, aber in der Regel eine hoffentlich erfolgreiche Lerngeschichte hinter uns, die sich ins Gehirn tief eingegraben hat, unter anderem so: „Wenn Du es magst – probier es!“ „Wenn Du es nicht willst, lass es! Denn was soll’s?“ „Wenn’s nicht klappt – es gibt Hilfestellung! Wenn nicht? Kommt Zeit, kommt Rat!“ „Übung macht den Meister!“ 2.2 Was wir seit dem 18. Jahrhundert wissen Als im ausgehenden 18. Jahrhundert – dem „pädagogischen“, wie es sich selber nannte – aufgrund von Erfahrung und Beobachtung von Reformpädagogen zusammenfassend formulierte wurde, wie Kinder am besten lernen, kamen vor allem die folgenden Aspekte zusammen: • • • • • • • • Es muss eine praktische Herausforderung bestehen, die bewältigbar ist und subjektiv Sinn macht. Lernen beruht auf Selbsttätigkeit. Gelernt wird, was getan wird, am besten mit hoher Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit. Es dürfen keine Entmutigungen eintreten beim Versuch, etwas zu bewältigen bzw. ein Problem zu lösen; dieser Versuch sollte von positiven Gefühlen begleitet sein. In einer Gruppe verläuft das Probieren und Experimentieren als Lernprozess stabiler als in einer Situation der Vereinzelung. Es muss viel wiederholt und geübt werden für Sicherheit und Erfolgsgewissheit; „Übung macht den Meister“. Lernen bedarf eines Wechsels von Anspannung und Entspannung. Anforderungen müssen individuell zugemessen werden: Unterforderung bewirkt Lernverdruss durch Langeweile, Überforderung mindert durch Druck Lernfähigkeit oder bewirkt durch fortgesetzte Misserfolge Lernunwilligkeit. Lernende müssen ihre Arbeits- als Lernzeiten individuell bestimmen können; Zeitdruck (Stress) erzeugt Versagensangst, das Gehirn wird „blockiert“. Erfolgreiche Lerngeschichten beruhen auf der Erfahrung von Zutrauen zu sich selbst, das aus Vertrauen auf Unterstützung durch andere erwächst; auf Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die aus Erfolgserlebnissen erwachsen; auf Sich-einlassen auf Herausforderungen (coping), weil frühere „Fehlleistungen“ erfolgreiche neue Lern- und Reflexionsgelegenheiten waren. Aus alle dem ergab sich „Spaß“: Kinder begleiten erfolgreiches Lernen mit Lachen und Klatschen, Hüpfen und Lärm. „Still sitzen“ oder „still zuhören“, „bitte keine Unruhe“ kann daher von Kindern, die in die („normale“) Schule kommen, aufgrund ihrer Lerngeschichte nur als Signal interpretiert werden, dass es hier im bisherigen Sinne offensichtlich kaum noch um Lernen geht… 2.4 Neues vom Gehirn Die neurowissenschaftliche pädagogisch relevante Lernforschung steht noch ganz am Anfang (Stern u.a. 2005; das deutsche NIL-Programm enthält keine schulisch-unterrichtlich relevanten Projekte mehr; unterrichtsbezogene Forschungen des ZNL Ulm wurden nach einigen vergeblichen Anläufen eingestellt, s. dort Katrin Hille auf der Hompage). Jedoch haben neuartige Untersuchungs- und Analysemöglichkeiten besonders von Stoffwechselprozessen und der Wirkungsweisen von Botenstoffen im Gehirn sowie die bildgebenden Verfahren in den letzten zwei Jahrzehnten zu Entdeckungen und Einsichten geführt, die unser Verständnis vom Funktionieren des Gehirns grundlegend verändert haben und die für die Neurodidaktik nicht folgenlos sind (Damasio 2002; Roth 2003; Kandel 2006; Förstl 2007; Ledoux 2004; Spitzer 2009). Dazu gehören vor allem: • • • • das limbische System der Bewertung von Informationen (neu/bekannt, wichtig/unwichtig, angenehm/zu vermeiden usw.) und der dadurch ausgelösten autonomen Gehirnaktivitäten (Roth 2009), die allerdings im wesentliche noch unverstanden sind (Roth 1997) die Spiegelneurone als Grundlage des Lernens am Modell sowie des Verständnisses des Gehirns als eines „sozialen Organs“ (Bauer 2009) auch wenige Wochen alte Babys „denken“ (Pauen 2007); denn ganz offensichtlich verfügen sie über angeborene bzw. pränatal erworbene Fähigkeiten z.B. zum „Verständnis“ physikalischer Sachverhalte, und ihre Wahrnehmungsfähigkeiten lassen sich im Hinblick auf Diskrimierungsfähigkeiten sehr rasch „habituieren“, so dass sie „unmögliche“ Sachverhalte als solche alsbald registrieren (Intensität einer Blickfixierung als ÜberraschungsIndikator) die Strukturierung des Gehirns und seiner Gehirnfunktionen in Abhängigkeit von ihrer Nutzung sowie von Erfahrungen (Hüther 2009a) • • der Umbau des Gehirns während der Pubertät und die funktionale Inbetriebnahme des Präfrontalkortex, der Region des differenzierten Denkens (Strauch 2007) „soziale Resonanz“ (Beachtung, Zuwendung, Anerkennung) als notwendiges Überlebensmittel des Menschen und das dabei entstehende Zusammenspiel von motivationswirksamen Neuromodulatoren (Dopamin, endogene Opioide, Oxytozin) im körpereigenen „Belohnungssystems“ (Bauer 2009). Aufgrund dieser Befunde sind einige pädagogisch bzw. didaktisch relevante Schlussfolgerungen nahe liegend: • • • • Wenn die Bewertung einer ankommenden Information negativ ausfällt, können keine neuromodulatorisch gestützten zellulären Prozesse angestoßen werden, die Lernen ermöglichen. Wenn jemand etwas lernen soll, muss ihm ermöglicht werden, mit dieser Anforderung positive Bewertungen zu verbinden. Wenn sich das Gehirn in Abhängigkeit von Erfahrung und Benutzung strukturiert, muss es schulisch-unterrichtlich erst einmal um vielfältige Erfahrungs- und Nutzungsangebote gehen und erst dann um „Fordern und Fördern“: das „Füttern“ kommt zuerst! Wenn sich der funktionale Gehirnumbau so darstellt, dass der Präfrontalkortex erst mit Ende der Pubertät voll in Funktion ist, macht es neurowissenschaftlich keinen Sinn, Schülerinnen und Schüler testbasiert auf Schulformen zu verteilen, bevor sie überhaupt ihre volle kognitive Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnten. Der Faktor „Beziehung“ ist kein vordergründiger „Wohlfühlfaktor“, sondern - neurowissenschaftlich gesehen – der Motivations-Motor, der durch das körpereigene Belohnungssystem am Laufen gehalten wird. 2.3 Didaktisch relevante Einsichten der Neurowissenschaften Der Magdeburger Hirnforscher Henning Scheich (2003) hat es so formuliert: Einstweilen habe die Hirnforschung nicht mehr zutage gefördert, als was erfahrene Pädagogen nicht schon gewusst haben, aber die Hirnforschung kann jetzt begründen, warum sie Recht hatten. Worum handelt es sich? • • • Das Gehirn ist kein Datenspeicher, sondern ein Datengenerator durch die autonome Organisation der Speicherung und Verknüpfung von Informationen und deren Bedeutungen. Wissen kann nicht übertragen werden, sondern muss in jedem Gehirn neu erzeugt werden. Am besten gelernt wird unter leichter Anspannung, leichtem Stress, aber das Arbeitsergebnis muss etwas besser sein als erwartet. Zu hoher Stress bzw. Versagensangst blockiert oder mindert die erwünschten Gehirnleistungen. „Leistung unter Druck“ erbringt nur das in diesem Moment unter diesen Bedingungen mögliche Ergebnis, sagt aber nichts über die dieser Leistung zugrunde liegende „Kompeten- • • • • • • • zen“ (Weinert). Neugier wird geweckt z.B. durch den Faktor „überraschende Neuigkeit“, „erklärungsbedürftiger Sachverhalt“, „unerwartetes Ereignis“, damit Aufmerksamkeit sich fokussieren kann. Durch Entmutigung entsteht entweder Motivationsverlust oder gar Vermeidungsverhalten, in krassen Fällen als psychische Verletzung auch Leistungsverweigerung. Das Gehirn ist ein „soziales Organ“ und sucht beständig nach Kooperationen: förderliche Beziehungen und freundliche Atmosphäre (Hüther 2009a,b; Bauer 2006, 2007, 2009). Neuronale Netze müssen durch häufigen Gebrauch (Üben, Wiederholen) stabilisiert werden, so entsteht Gedächtnis. Lernen ist ein sehr langsamer Prozess, wie jeder weiß, der es auf einem Gebiet zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hat. Gedächtnis als verfügbares Vorwissen ist die beste Voraussetzung für das Lernen des Neuen. Sicheres abrufbares Vorwissen ist die wohl wichtigste Voraussetzung z.B. für Problemlösungen unter Stressbedingungen (Tests). Nachhaltige Informationsverarbeitung ist auf Überprüfungs- und Sicherungszeiten angewiesen, d.h. auf einen zeitlichen Wechsel von Informationsaufnahme (Anspannung) und Informationssicherung (Entspannung, Konsolidierung) im Kontext bisheriger Informationsbestände. Jedes Gehirn hat als Organ seine individuelle erfahrungsgeschichtliche Prägung. Jedes Gehirn schreibt daher neuen Informationen (Erfahrungen) zunächst einmal seine lebensgeschichtlich individuellen Bedeutungen zu. 3. Was bedeutet „gehirngerechtes Lehren und Lernen“? Die Formulierung „gehirngerechtes Lehren und Lernen“ möchte auf folgendes aufmerksam machen: (1) gehirngerecht: Jedes Gehirn lernt individuell auf seine jeweilige Weise, und dieser Vorgang – vor allem die Übernahme von Informationen aus dem Kurz- ins Langzeitgedächtnis – ist unserer willentlichen Beeinflussung im wesentlichen entzogen. Hingegen können externe Begleitumstände der Initiierung und des Verlaufs hinderlich oder förderlich gestaltet und damit auch das Ergebnis beeinflusst werden. Optimale Ergebniserreichung setzt mithin Beachtung der gehirneigenen Verfahrensweisen voraus, denn die externen Begleitumstände können aber auch derart sein – Stress, Angst usw. –, dass sie gehirninterne Abläufe in einer Weise disponieren, dass die gewünschte Gehirnleistung – Lernen, Gedächtnis, Erinnerung, Leistungsbereitschaft usw. – nicht oder nur sehr eingeschränkt eintritt. (2) Lehren und Lernen: Mögen sich Lernforscher, welcher Provenienz auch immer, isolierten Lernprozessen zuwenden (wie das für Tierversuche im Labor charakteristisch ist), besteht das Interesse der Lehrkräfte (als Didaktiker und Methodiker) jedoch darin, den Zusammenhang von Lehren und Lernen zum Zwecke der Optimierung des Lehr-Lern-Arrangements aufzuklären. Diese Fragestellung begleitet die Organisation von Schule und Unterricht seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, als die damalige Pädagogik-Reform die Bedeutung der Lehrer-SchülerBeziehung entdeckte (Hinweise bei Herrmann 2009b, S. 173ff.); der „pädagogische Bezug“ (Herman Nohl) wurde eines der grundlegenden Theoreme der Reformpädagogik am Beginn des 20. Jahrhunderts. Neurowissenschaftler wie Bauer und Hüther nehmen diesen Faden im Hinblick auf Persönlichkeits-, Beziehungs- und Motivationspsychologie wieder auf. „Gehirngerechtes Lehren und Lernen“ meint also grade keine behavioristische Verkürzung des Lernens (Müller 2007), sondern im Gegenteil die Beachtung von genuin pädagogischen Postulaten, vor allem: Individualisierung des Lernens, Schaffung einer förderlichen Atmosphäre für Lernen und Leisten, erfolgbasierte Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Angstfreiheit, Vermeiden von Demütigung und Entmutigung. Wenn der Neurodidaktik entgegengehalten wird (zuletzt Terhart 2009b), sie habe sich nicht durch eigene Forschungen (was zutreffend ist) und nicht durch eigene „didaktische Empfehlungen“ (was unzutreffend ist, vgl. vor allem Schirp 2003, bes. S. 306, 309, 312, zit. auch bei Herrmann 2009b; Gasser 2008, S. 51-58, 263-268) ausgewiesen, dann ist dies vor allem darauf zurückzuführen, dass diese Postulate zwar allgemein anerkannt, in der vorherrschenden Betriebsförmigkeit von Schule und Unterricht an den staatlichen öffentlichen Schulen nicht eingelöst werden können (vor allem: zu große Klassen, Lehrplanvorgaben, Zwang zur Selektion, Standardisierung von Anforderungen und Bewertungen), was zugleich das Forschungsdefizit erklärt. Ausnahmen bilden die staatlichen Grundschulen sowie die reformpädagogisch arbeitenden Schulen und – in methodischer Hinsicht – das Konzept des Selbstorganisierten Lernens (Herold/Landherr 2003). 4. Konstruktive Vorschläge Es wurde schon erwähnt, dass und warum es bislang in Deutschland keine auf Lernen und Unterricht bezogene Forschungsarbeiten in Alltags- und eben nicht in Laborsituationen gibt, die die Frage der Optimierung von Lehr-Lern-Arrangements mit Hilfe neurowissenschaftlicher Methoden (soweit sie dies zu leisten vermögen) untersucht, z. B. (1) der zeitliche Umfang der Lernarbeit ♣ pro Tag insgesamt und Arbeitseinheiten innerhalb eines Tages, deren zeitliche Platzierung zeitliche Variationen, Auswirkungen auf: Konzentration und Lernerfolg, Aufmerksamkeit und Ermüdung, Ergebnisse bei Leistungsfeststellungen ♣ Wirkung von Unterbrechungen und Störungen, von Pausen und Entspannungen: Auswirkungen auf Gedächtnis und Lernerfolg (2) Einbettung in den Tages- und Wochenrhythmus ♣ Anstrengung und Entspannung ♣ körperliche Betätigung, Schlaf ♣ Freizeitaktivitäten, Fernsehen zeitliche Variationen, Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit (3) Umfang des anzueignenden Wissens ♣ bei Einführungen oder bei eigenen Explorationen ♣ bei Übungen und Vertiefungen ♣ bei Anwendungen und Übertragungen Welche Gedächtnisformen werden erstrebt und erreicht? Vom „Erlebnis“ zur „Struktur“? Thematische Blöcke, Sequentialisierung? (4) Formen der Vermittlung und Aneignung ♣ Fremd-/Selbstvermittlung, angeleitete Selbsttätigkeit, Selbstorganisiertes Lernen ♣ allein/in Arbeitsgruppen Effektivität welcher Medien? Differenzen der Motivation und der Leistungsbereitschaft/fähigkeit; Nutzung von Neugierverhalten; Wohlbefinden im Gehirn (5) Initiierung, Stimulierung und Stabilisierung von Lernzuwachs • • Impulse, Anregungen Wirkungsnachweis der advance organizer Musikerleben, körperliche Betätigung in Lernkontexten (Schauspieler lernen ihre Rollen sich bewegend!) ein-/mehrkanalige Sinneseindrücke (visuell, akustisch, haptisch, motorisch usw.) ihre Wirkungen auf Lernen und Gedächtnis (6) Gedächtnis ♣ unterschiedliche Gedächtnisformen ♣ Konsolidierungszeiten ♣ Verzweigungen ♣ Trainingsformen ♣ Fremdsprachenerwerb experimentell prüfen, variierend erproben; Umfänge, zeitliche Intervalle (7) Leistung ♣ Leistungskontrolle, Fehlerrückmeldung Variation der Kontroll- und Rückmeldeformen und Auswirkungen auf Stress, Versagensangst ♣ Leistungserbringung, -messung, -bewertung Variation der Situationen und Messinstrumente für Fremd- und Selbstbeurteilung 5. Aspekte erfolgreichen Lernens und neurowissenschaftliche Impulse • Das limbische System bewertet Informationen nach den Kritierien wichtig/unwichtig, wünschenswert/nicht wünschenswert, angenehm/unangenehm und ermöglicht ihre Speicherung in unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Sollen neue Informationen wirksam aufgenommen und weiterverarbeitet werden, dann müssen sie wichtig, wünschenswert (nützlich) und möglichst von angenehmen Gefühlen begleitet sein: „Es wird euch Spaß machen, was Ihr jetzt zu sehen und zum Knobeln bekommt!“ „Altbekanntes in neuem Gewand: Erster Preis … für die Erklärung!“ • Neugierverhalten als die Suche nach bedeutungsvollen Erfahrungen ist angeboren und erlahmt bei bedeutungslosen oder nicht erklärungsbedürftigen Sachverhalten. Das Nachlassen der Neugier als Lust auf Lernen wird durch selbstbestimmtes Erkunden und Aneignen vermieden: „Bearbeite einen dir wichtig erscheinenden Aspekt innerhalb des Rahmenthemas!“ „Versuche herauszufinden, wie Wasser in die Spitze der Bäume kommt – und wo es dann bleibt!“ „Wozu braucht ein Auto Stoßdämpfer: für den Fahrkomfort und/oder für die Fahrsicherheit?“ Ausgangspunkt sollte ein überraschender erklärungsbedürftiger Sachverhalt sein, so dass die Schüler/innen ihre „Forscherstunden“ in Gang setzen können (Ansari 2009). • Entspannte Atmosphäre und Spiel sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass sich Neugier und damit Kreativität entfalten kann; ohne Leistungsstress und ohne Versagensängste. „Probier mal herum und protokolliere sorgfältig, was du bemerkst!“ Für Maria Montessori war selbstvergessenes Spiel eines kleinen Kindes die Schlüsselszene für ihr pädagogisch-psychologisches Verständnis vom selbstbestimmten kindlichen Lernen. • Sich einlassen auf Neugier setzt Vertrauen voraus: Nicht nur keine Furcht vor Misserfolg, vor Fehlern, vor Entmutigung durch negative Konsequenzen (Noten!), sondern die Erwartung auf Erfolg stärken, Suchbewegungen mit offenem Ausgang bekräftigen, die Hoffnung auf Belohnung wecken, das Selbstbewusst- sein und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken. „Du kannst ruhig zeigen, was du noch nicht kannst: Wie soll ich dir sonst helfen können?“ „Man kann nicht immer beim ersten Anlauf Erfolg haben.“ „Lass dich nicht entmutigen! Du schaffst es schon!“ (Oser / Spychiger 2005) • Entspannung für Gedächtniskonsolidierung während des Lernens ist eine wichtige Maßnahme, dem Gehirn die notwendige Zeit für die Speicherung von Informationen und Verknüpfung zu Bedeutungszusammenhängen zu geben (Theuerl 2009). Der optimale Rhythmus von Anspannung und Entspannung ist nicht möglich in einem lehrerzentrierten Frontalunterricht, wo alle Gehirne im Gleichschritt funktionieren sollen, was sie gar nicht können. Beim Lernen in der Schule sind die unablässigen Lehrerfragen ein Störfaktor! • Emotion und Kognition: Das Gehirn kann bei einem elektro-chemischen Impuls Inhalt und Bedeutung nicht von einander trennen und entschlüsselt die subjekt relevanten Bedeutungen erst nachträglich durch Abgleich mit Vorwissen. Eine intendierte Bedeutsamkeit muss durch die Intensität des Impulses signalisiert werden. Ein Erlebnis als bleibende Erfahrung ist durch eine besondere emotionale Intensität ausgezeichnet. Die innere aktive Beteiligung der Schüler an ihrem Tun verstärkt deren Interesse und Engagement und führt dadurch zu besseren und nachhaltigeren Arbeits- und Lernergebnissen. • Belohnung und „Spaß“ bewirken, dass das Gehirn umso besser funktioniert, je attraktiver die Lernsituation empfunden wird, und die Attraktivität bemisst sich – wie könnte es anders sein – an der Abschätzung des zu erwartenden Erfolgs. Sobald die Rahmenbedingungen für Erfolg besonders mit Rücksicht auf die großen individuellen Unterschiede bei den Lernbefähigungen und Lernleistungen von den Schülern selbst gestaltet werden können, stellen sich generell erhöhte Lernbereits chaft und M otivation ein. D as gehirneigene „Belohnungssystem“ bleibt intakt durch Spaß am Gelingen als Leistung. Nichts ist daher erfolgreicher als eine neurodidaktisch argumentierte „Spaßpädagogik“: eine lust- und spaßbesetzte Leistungsherausforderung, die Erfolgserlebnisse vermittelt! • Ordnungen von Informationen, von Wissen und Bedeutungen: Das Gehirn praktiziert verschiedene Verfahren, Gedächtnisinhalte zu ordnen: das deklarative Gedächtnis für Fakten, das semantische für Bedeutungen, das prozedurale für Routinen, Abläufe und Fertigkeiten, das emotionale für Gefühle. Sie bilden einen Funktionszusammenhang, das heißt sie stützen sich gegenseitig. Lehren im Sinne von angeleitetem Lernen soll den Funktionszusammenhang aller Gedächtnisformen aktivieren: Fakten werden eingebettet in einen Bedeutungsrahmen und in Verlaufsgeschichten mit emotional wirksamen Bedeutungsträgern. Geschichte muss in Geschichten übersetzt werden und ein „Gesicht“ bekommen: Kaiser und Papst – „Canossa“; Völkermord – „Las Casas vor Karl V.“; Reformation – „Luther in Worms“; gewaltloser Widerstand – „Mahatma Gandhi“; Aufstand des Gewissens – „Die Weiße Rose“; Holocaust – „Anne Frank“. • Musterwahrnehmung und -erzeugung sind die Form der Wahrnehmung und des Erinnerns von Gesamtheiten und Teilen und deren regelgerechter Ergänzung zu (auch neuen bedeutungsvollen) Gesamtheiten. Kinder lernen die Muttersprache durch Hören und Nachsprechen, zugleich generiert ihr Gehirn die grammatischen Regeln, nach denen diese Sprache verfährt. Nachhaltige Prozesse der Vermittlung und Aneignung geschehen am besten auf der Grundlage des Angebots und der Aneignung von Mustern (Schemata): „Frankreich ist sechseckig“, „Sizilien ist dreieckig“, „Italien ist ein Stiefel“ (so schon Aebli 2006 „Anschauen und Beobachten“ S. 91ff, „Handlungsablauf“ S.188, „innerer Aufbau eines Begriffs“ S. 253ff). • Vertiefendes Lehren und Lernen sollte mit der Differenzierung und Generierung von Mustern bzw. Begriffen einhergehen (wie seit Herbart, bes. Aebli, 1994), weil dadurch unterschiedliche Bedeutungen von Wissensinhalten durch unterschiedliche neuronale Repräsentationen zugänglich werden, wodurch „träges Wissen“ vermieden wird. Die intellektuelle Förderung etwa durch Schachspielen beruht auf der Herausforderung, in den jeweils aktuellen Figurenkonstellationen bestimmte Muster für mögliche Züge für erfolgreiche neue Konstellationen zu antizipieren. • Kommunikatives Handeln und Leistungsverstärkung im Schülerarbeitsalltag bedingen sich gegenseitig, weil ein junger Mensch weder nur „Intelligenz“ und auch nicht nur „Gehirn“ ist, sondern eine Person, für deren Leben und Überleben, Lernen und Leisten sozial-emotionale Beziehungen unabdingbar sind. Die Reformpädagogik geht daher von der Isolierung des Schülers in der Sitzordnung und bei der Leistungserbringung ab, und die Kooperation beim Lernen in Gruppen erbringt einen Zugewinn an Wohlbefinden und damit an Leistungsbereitschaft und -fähigkeit. Beziehungen stiften muss daher ein Kerngeschäft des Lehrens sein, weil Beziehungslosigkeit und Nichtbeachtung als psychische Verletzung vom menschlichen Gehirn registriert werden – genau wie physischer Schmerz. Nichtbeachtung lähmt das Motivationssystem und erhöht das Aggressionspotenzial. So tritt auf einen Blick zutage, mit welchen Problemen Schulen mit großen Klassen (zu viele unbeachtete Schüler) und einem durch Gewinner und Verlierer auf Auslese getrimmten Betriebssystem (durch Noten und Sitzenbleiben gedemütigte Schüler) zu kämpfen haben. 6. Eine Erweiterung der Perspektive auf Persönlichkeitsbildung – Entwicklungsneurologie als Bildungstheorie? Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth hat in seinem Buch „Bildung braucht Persönlichkeit“ (2011) eine Entwicklungstheorie aus neurowissenschaftlicher Sicht vorgelegt, die für ihn vor allem die Hintergrundfolie abgibt sowohl für eine Einbettung von Lernen in Selbstentwicklung bzw. Selbstbildung als auch für eine weitergehende Schulkritik: dass nämlich die Organisation des schulischen Lernens in der Regel die Schülerpersönlichkeit außer acht lasse. Roth setzt in Beziehung (1) die Kernkompetenzen der Persönlichkeit Stressverarbeitung und Frustrationstoleranz Selbstbewertung und Motivation Impulskontrolle und Impulshemmung Bindung und Empathie Realitätssinn und Risikowahrnehmung • • • • • und (2) die neurobiologisch-psychischen Grundsysteme und ihre Neuromodulatoren, mit Hilfe derer sich diese Kernkompetenzen aufbauen. Es liegt auf der Hand, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht gelernt haben, mit Stress umzugehen, mit Ängstlichkeit und Bedrohtheitsgefühl, die Entmutigungen in Demotivation umsetzen und keine realitätsgerechte Selbsteinschätzung zustande bringen – dass diese Schülerinnen und Schüler ganz unabhängig von ihren tatsächlichen Kompetenzen in unserem schulischen Leistungsfeststellungs- und Auslesesystem eher scheitern müssen. 7. Neurowissenschaft und Lernen – wie weiter? Die Voraussetzungen und Prozesse erfolgreichen Lernens gelten in gleicher Weise im natürlichen wie im schulischen Lernen. Um diesen Befund der Neurowissenschaften darf sich die Neuropsychologie und Neurodidaktik schulischer Lehr-Lern-Arrangements nicht drücken. Der Weg von der Anschauung zum Begriff (so schon Herbart in seiner Formalstufenlehre der intellektuellen Operationen von Lernen und Unterrichten) kann nur langsam zurückgelegt werden; das Erlernen einer Fremdsprache in der Schule gelingt allemal nur mäßig und nur durch sprechendes Üben und Wiederholen, Wiederholen und Üben. Übung macht den Meister, heißt es bekanntlich (und nicht Intelligenz!). Wo dafür keine Zeitfenster und keine Sprechpartner vorgesehen sind, helfen auch keine methodisch-didaktischen Kniffs weiter, und das Lehren und Lernen wird durch seine erfolgsarme Mühsal zum entmotivierenden Ärgernis. Ein besonderes Desiderat ist die neurowissenschaftlich-neuropädagogische Erforschung der Übergangsphase Pubertät von der Kindheit in die Jugendzeit, wo ganze Hirnregionen – für das logische Denken, für Sprache und Gefühle – umgebaut werden (Eliot 2003). Da erst in diesem Prozess der Frontalcortex seine volle Funktion aufnimmt, erscheint es absolut widersinnig, Schüler vor dem Ende dieses Prozesses aufgrund ihrer aktuellen Schulleistungen auf verschiedene Schulformen zu verteilen, da ihre tatsächlichen Potentiale kaum und im Zweifelsfall gar nicht bekannt sein können. Und ausgerechnet am Ende dieses Prozesses, bei den 15jährigen, werden vergleichende Schulleistungstests gemacht (PISA), also zu einem Zeitpunkt – worauf Schulpraktiker immer wieder hinweisen –, an dem die meisten Jugendlichen gerade erst aus ihrem schulbezogenen Interessen- und Leistungs-„Tief“ wieder auftauchen. Es ist offensichtlich, dass an den staatlichen öffentlichen Schulen in Deutschland die üblichen Strukturen und Prozesse schulischen Lernens und die dort geltenden Vorschriften und Formen der Leistungserbringung und -bewertung allen grundlegenden Einsichten der Neurowissenschaften widersprechen, wie sie seit einem Jahrhundert von reformpädagogischen, alternativen und freien Schulen erfolgreich praktiziert werden – auch ohne Kenntnisse von Botenstoffen, sondern auf der Grundlage der subtilen Beobachtung der lernenden Kinder und Schüler. Neurowissenschaftler und Instruktionspädagogen müssen vorrangig nicht gemeinsam ins Lernlabor, sondern vor allem in die alltäglichen Lernwerkstätten: Sandkasten und Leseecke, PC und Rollenspiel, Chor und Theater, Labor und Atelier, Frontalunterricht, Freiarbeit und Hausaufgaben. Dort muss die künftige gemeinsame Lernforschung ansetzen, wo Pädagogen stimulieren und inszenieren, was im Gehirn durch das Gehirn in Gang gesetzt werden soll. Zusammen mit Neurowissenschaftlern kann jeder mit seinen Methoden und Fragestellungen nachprüfen, was eine Intervention bewirkt hat – oder eben auch nicht: Der eine schaut nach Prozessen und Effekten im Gehirn, der andere untersucht, wie Schüler ihre erfolgreiche Lernarbeit gestaltet haben. Nur gemeinsames Forschen eröffnet die Chance, das Geheimnis von Lernen, Denken und Verstehen weiter zu lüften. Literatur Aebli, H. (1994, zuerst 1981): Denken: Ordnen des Tuns. Bd. II: Denkprozesse. 2. Aufl., Stuttgart. Aebli, H. (2006, zuerst 1983): Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. 13. Aufl., Stuttgart. Ansari, S. (2009): Schule des Staunens. Lernen und Forschen mit Kindern. Heidelberg. Arnold, M. (2002): Aspekte einer modernen Neurodidaktik. Emotionen und Kognitionen im Lernprozess. München. Bauer, J. (2006): Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. Hamburg. Bauer, J. (2007): Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Hamburg. Bauer, J. (2008, zuerst 2005): Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone. 9. Aufl., München. Bauer, J. (2009): Erziehung als Spiegelung. Die pädagogische Beziehung aus dem Blickwinkel der Hirnforschung. In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 109-115. Blakemore, S.-J./ Firth, U. (2006, zuerst Engl. 2005): Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiß. München. Brand, M./Markowitsch, H.J. (2006): Was weiß die Hirnforschung über Lernen? In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9, 5. Beiheft, S. 21-42. Brand, M./Markowitsch, H.J. (2009): Lernen und Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Perspektive. Konsequenzen für die gestaltung des Schulunterrichts. In: Herrmann (Hrsg.) (2009), S. 69-85. Damasio, A.R. (2002, zuerst Amerikan. 1999): Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewussteins. 3. Aufl., München. Eliot, L. (2003, zuerst Engl. 1999): Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren. 4. Aufl., Berlin. Förstl, H. (Hrsg.) (2007): Theory of Mind. Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhal tens. Heidelberg. Friedrich, G. (1995): Die Praktikabilität der Neurodidaktik. Ein Analyse- und Bewertungsinstrument für die Fachdidaktik. Frankfurt/M. Friedrich, G. (2009): „Neurodidaktik“ – Eine neue Didaktik? In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 272- 285. Frith, U. (2009): „Lernen ist ein kommunikativer Akt.“ In: Gehirn & Geist 9/2009, S. 20-22. Gasser, P. (2008): Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens. Bern. Gyseler, D. (2006): Problemfall Neuropädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik, 52, H. 4, S. 555-570. Helmke, A. (1992): Selbstvertrauen und schulische Leistungen. Göttingen. Helmke, A./Weinert, F.E. (1997): Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen. In: F.E. Wei nert (Hrsg.): Psychologie des Unterrichts und der Schule. (Enzyklopädie der Psychologie, Serie Päd. Psychol., Bd. 3) Göttingen, S. 71-176. Herold, M./Landherr, B. (2003): Selbstorganisiertes Lernen. 2. Aufl., Hohengehren. Herrmann, U. (Hrsg.) (2009a, zuerst 2006): Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. 2. erweiterte Aufl., Weinheim/Basel. Herrmann, U. (2009b): Gehirnforschung und die neurodidaktische Revision des schulisch organisierten Lehrens und Lernens. In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 148-181. Hüther, G. (2009a): Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturentwicklung des menschlichen Gehirns. In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 41-48. Hüther, G. (2009b): Für eine neue Kultur der Anerkennung. Plädoyer für einen Paradigmen wechsel in der Schule. In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 199-206. Kandel, E. (2006, aus dem Amerikan.): Auf der Suche nach dem Gedächtnis. Die Entstehung einer neuen Wissenschaft des Geistes. Berlin. Ledoux, J. (2004, zuerst Amerikan. 1996): Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen. München. Müller, Th. (2007): Lernende Gehirne. Anthropologische und pädagogische Implikationen neurobiologischer Forschungspraxis. In: Zeitschrift für Pädagogik, 53, 52. Beiheft, S. 202-219. Oser, F./Spychiger, M. (2005): Lernen ist schmerzhaft. Zur Theorie des Negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur. Weinheim/Basel. Pauen, S. (2007, zuerst 2006): Was Babys denken. Eine Geschichte des ersten Lebensjahres. 2. Aufl., München. Preiß, G. (Hrsg.) (1996): Neurodidaktik. Theoretische und praktische Beiträge. Pfaffenweiler. Roth, G. (1997, zuerst 1994): Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. 5. Aufl., Frankfurt/M. Roth, G. (2003, zuerst 2001): Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. 2. überarb. Aufl., Frankfurt/M. Roth, G. (2009, zuerst 2004): Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 58-68. Roth, G. (2011): Bildung braucht Persönlichkeit. Wie lernen gelingt. Stuttgart. Scheich, H. (2003): Lernen unter der Dopamindusche. In: DIE ZEIT, Nr. 39, 18.9., S. 38. Schirp, H. (2003): Neurowissenschaften und Lernen. Was können neurobiologische Forschungsergebnisse zur Unterrichtsgestaltung beitragen? In: Die Deutsche Schule, 95, S. 304-316. Spitzer, M. (2009, zuerst 2002): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg/Berlin. Stern, E., u.a. (2005): Lehr-Lern-Forschung und Neurowissenschaften – Erwartungen, Befun de, Forschungsperspektiven. (Bildungsreform, Bd. 13) Bonn: BMBF. Strauch, B. (2007, zuerst Engl. 2003): Warum sie so seltsam sind. Gehirnentwicklung bei Teenagern. 2. Aufl., Berlin. Terhart, E. (2009a): Methodik des Unterrichts. In: G. Mertens, u.a. (Hrsg.): Handbuch der Erziehungswissenschaft. Bd. II/2: Erwachsenenbildung – Weiterbildung. Paderborn, S. 351-366. Terhart, E. (2009b): Didaktik. Eine Einführung. Stuttgart. Theuerl, P. (2009): „Lernen unter Selbstkontrolle.“ Entspannung und Kontemplation in Schule und Unterricht. In: Herrmann (Hrsg.) (2009a), S. 261-271. Tomasello, M. (2002, zuerst Engl. 1999): Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition. Frankfurt/M. Weinert, F. E. (1996): Lerntheorien und Instruktionsmodelle. In: Ders. (Hrsg.): Psychologie des Lernens und der Instruktion. (Enzyklopädie der Psychologie, Bd. D I 2) Göttingen, S. 1-48. Weinert, F.E. (Hrsg.)(2002): Leistungsmessungen in Schulen. 2. Aufl., Weinheim/Basel. Autor: Prof. Dr. Ulrich Herrmann Engelfriedshalde 101, 72076 Tübingen Tel. 07071/61876 [email protected] www.medienfakten.de/uherrmann