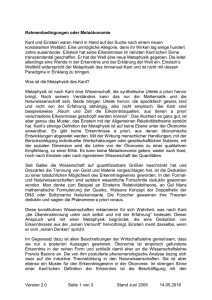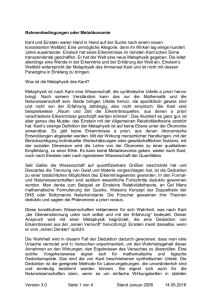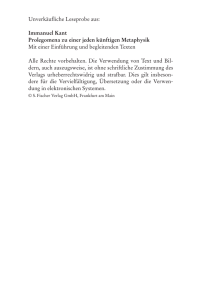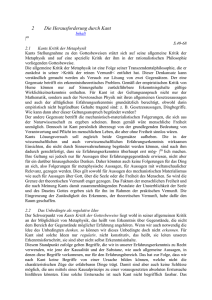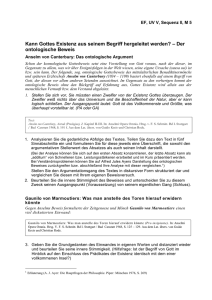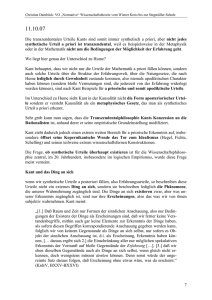1 die grenzen der vernunft. immanuel kants kritik der
Werbung

1 DIE GRENZEN DER VERNUNFT. IMMANUEL KANTS KRITIK DER TRADITIONELLEN METAPHYSIK BERND LUDWIG RINGVORLESUNG „DIE GRENZEN DES GEISTES“ (GÖTTINGEN, 23.11.2011) ~60 MIN I Die Grenzen des Geistes sind beileibe kein neues Thema für die Philosophie, und sucht man einen griffigen Beleg, an dem man das zeigen kann, dann wird man kaum einen besseren Text finden, als John Lockes An Essay Concerning Human Understanding aus dem Jahre 1690: Wie weit die Erkenntnis der Menschen auch hinter einer universalen und vollkommenen Erfahrung dessen, was es auch immer sei, zurückbleiben mag, so sind ihre wichtigsten Interessen doch dadurch gewahrt, dass das Licht, das sie haben, ausreicht, um sie zur Erkenntnis ihres Schöpfers und zu einem Einblick in ihre Pflichten zu verhelfen. […] Wir werden nicht viel Grund haben, uns über die Beschränktheit unseres Geistes (narrowness our Minds) zu beklagen, wenn wir ihn nur zu den Dingen gebrauchen, die für uns von Nutzen sein können. […] The candle that is set up in us shines bright enough for all our purposes. (John Locke, Essay, Introduction § 5). Grenzen des Geistes, Narrowness of our Minds. Geschenkt! Doch schon der Heilige Petrus habe zu Recht festgestellt, dass Gott uns mit der Erkenntnis all dessen ausgestattet habe, was für ein angenehmes und tugendhaftes Leben nötig ist. Wir müssen nur, so Locke weiter, „unsere eigenen [geistigen] Kräfte prüfen“, mit dem Zweck, dabei „Ursprung, Gewissheit und Umfang der menschlichen Erkenntnis“ (original, certainty and extend of human knowledge) zu bestimmen. Mit dieser Lockeschen Phrase sind wir mitten hineingesprungen in Kants fast 100 Jahre später erschienene Kritik der reinen Vernunft, über die er selbst in der Vorrede zur ersten Auflage von 1781 mit deutlichen Reminiszenzen an Locke das Folgende schreibt: Ich verstehe aber hierunter [d.i. unter der Kritik der reinen Vernunft] nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie unabhängig von aller Erfahrung streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen, als des Umfanges und der Gränzen derselben, alles aber aus Principien. (KrV, A XII) Aus Lockes „original, certainty and extend of human knowledge“ sind bei Kant hier “Quellen, Umfang und Gränzen“ der Metaphysik geworden: Die „Gewissheit“ ist durch die „Gränzen“ ersetzt – Kant scheint hier mehr am Außen Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 2 als am Innen der menschlichen Erkenntnis interessiert zu sein. Aber wichtiger ist freilich, dass Kant nun die Aufgabe präziser bestimmt: Nicht „Human Knowledge“ als solches steht auf dem Prüfstand, sondern nur eine besondere Sparte desselben: Die Metaphysik. Der kritische Wind hatte sich offenkundig gedreht. Während Locke noch versuchte, die Erfahrung als exklusive Grundlage allen menschlichen Erkennens auszuweisen und damit das gesamte mögliche Wissen des Menschen ausnahmslos (ganz wie Descartes) einer Kritik und Neufundierung zuzuführen, hat Kant offensichtlich ein gänzlich anderes Problem: Ich schmeichle mir, auf [meinem Weg] die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien Gebrauche mit sich selbst entzweiet hatten. Ich bin ihren Fragen nicht dadurch etwa ausgewichen, daß ich mich mit dem Unvermögen der menschlichen Vernunft entschuldigte; sondern ich habe sie nach Principien vollständig specificirt und, nachdem ich den Punkt des Mißverstandes der Vernunft mit ihr selbst entdeckt hatte, sie zu ihrer völligen Befriedigung aufgelöst. (ebd.) Seit Lockes Essay hatte sich nämlich einiges getan. Weit entfernt davon, einem Skeptizismus in Bezug auf unsere Sinne, unsere Erfahrung und die darauf aufbauenden Wissenschaften zu verfallen, steht nun offenkundig etwas ganz anderes im Mittelpunkt: Der Siegeszug der modernen Naturwissenschaften, eingeläutet durch Galileos „experimentelle Methode“ (wie Kant sie nennt) und bereitet von Isaak Newtons Principia mathematica philosophiae naturalis von 1687 – von deren zukünftiger Bedeutung Locke noch nichts ahnen konnte. Die Principia hatten bereits nach wenigen Jahren alle frühneuzeitlichen Zweifel am Forschritt der scholastischen Wissenschaften gegenstandslos gemacht. Eine gleichsam neue Wissenschaft eroberte das Feld – und damit trat eine gegenteilige Herausforderung auf den Plan (und hier dürfte uns die Geschichte heutzutage höchst vertraut vorkommen): Der Newtonianismus mit seinem allem Anschein nach unendlichen explanatorischen und prognostischen Potenzial löst nicht nur die Ansprüche der scholastischen Natur-Wissenschaft ab. Er untergräbt auch noch – so scheint es nun – die Ansprüche der Metaphysik, der Vernunfterkenntnis des Übersinnlichen, des nicht-empirischen, d.i.: aller Erkenntnis jenseits der Welt der Erfahrung. Was insbesondere bedroht zu sein scheint, ist vor allem die vernünftige Rede über die drei Themen, die spätestens seit Descartes’ Meditationen über die erste Philosophie im Zentrum der europäischen Metaphysik des 17. und 18. Jahrhundert standen: Unsterblichkeit, Gott und die menschliche Freiheit (s. Meditationen 2, 3 und 4). II Die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele, waren eben nicht nur die Grundpfeiler christlich-abendländischer Religion, sie bildeten auch den Gegenstand von rationaler Theologie und rationaler Psychologie in der Metaphysik, einer und von der Offenbarung unabhängigen, nicht-empirischen Gottes- und Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 3 Seelenlehre. Aber das eigentliche Problem bildete seinerzeit freilich die menschliche Freiheit, die – nicht weniger als Gott und Unsterblichkeit – den empirischen Wissenschaften unzugänglich ist und damit epistemisch prekär zu werden drohte: Woher wissen wir von unserer Freiheit, woher von der Existenz Gottes und der Unsterblichkeit der Seele. Gerade die Freiheit scheint vor dem Hintergrund des in der Newtonschen Physik lauernden vollständigen Determinismus des Naturgeschehens sogar grundsätzlich unmöglich zu werden: In einem Newtonschen Universum (so erscheint es im 18. Jahrhundert) gibt es keinen Platz für die menschliche Freiheit, denn alles, von tiefster Vergangenheit bis in die fernste Zukunft, ist durchgängig naturgesetzlich bestimmt. Und das gilt auch und gerade für das menschliche Handeln, welches sich letztlich in Bewegungen des Körpers im Raume äußert. Das sind freilich nicht bloß-akademische Fragen: Christian Wolff, der LeibnizSchüler und berühmteste deutsche Philosoph der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, wurde 1723 mittels Androhung der Todesstrafe aus dem pietistischen Halle vertrieben (er wurde dann in Marburg freudig aufgenommen), weil seine gewissermaßen der Newtonschen Physik Rechnung tragende Philosophie den Naturdeterminismus propagierte und damit – zumindest aus der Sicht der Hallensischen Pietisten – die menschliche Freiheit leugnete und so dem Fatalismus Vorschub leistete. Was bei der Leugnung der Freiheit auch uns heutzutage noch unmittelbar einzuleuchten scheint, gilt im 18. Jhdt. grundsätzlich auch für die Leugnung von Gott und Unsterblichkeit: Sie untergräbt die Moral: Ohne Freiheit keine Zurechenbarkeit der Handlungen und daher weder Schuld noch Verdienst. Ohne Gott kein Strafgericht dort, wo die öffentliche Gewalt nicht hinreicht, und ohne Unsterblichkeit der Seele nicht die Hoffnung auf die ewige Glückseligkeit für die Guten und ewige Höllenstrafen für die Bösen, kurz: Ohne diese drei fehlen den Menschen sowohl die Möglichkeit, in eigener Verantwortung das Gute zu tun und das Böse zu lassen, als auch die Beweggründe dazu. Damit steht die philosophische Aufgabe der Metaphysik in der Mitte des 18. Jahrhunderts fest: Die Rettung der vernünftigen Rede über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit im Angesicht der Herausforderung der explanatorisch- und prognostischerfolgreichen neuen Wissenschaften. Es kommt etwas Zweites hinzu, was diese Aufgabe zusätzlich erschwert, und was Kant in der Kritik der reinen Vernunft ganz in den Vordergrund rückt: Die Lehren vom Übersinnlichen, von dem, was jenseits der Erfahrung liegt, kurz die Metaphysik, befindet sich immer noch in einem beklagenswerten Zustand. Die übrigen Wissenschaften hatten ihre Gründerväter, die den Übergang vom bloßen Herumtappen zu einer Wissenschaft im vollen Wortsinne gestiftet haben bereits seit längerem gefunden. Für Mathematik und Logik finden sich diese Heroen bereits in der Antike. Ihre Leistung führte zu einer Revolution Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 4 der Denkart, die dann in der Neuzeit von Galileo durch die Erfindung der experimentellen Methode auch in den Naturwissenschaften stattgefunden hat. Der Metaphysik hingegen „ist das Schicksal bisher noch nicht so günstig gewesen, dass sie den Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte“ (B XIV). Den Grund für diese traurige Schicksal, dass nun freilich erstmals 1781, durch das Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, gewendet werden soll, findet Kant in einer durch die frühen Erfolge der Mathematik ausgelösten Täuschung: Die ersten und ältesten Schritte in der Metaphysik wurden nicht etwa als bedenkliche Versuche blos gewagt, sondern geschahen mit völliger Zuversicht, ohne vorher über die Möglichkeit der Erkenntnisse a priori sorgsame Untersuchungen anzustellen. Was war die Ursache von diesem Vertrauen der Vernunft zu sich selbst? Das vermeynte Gelingen. Denn in der Mathematik gelang es der Vernunft, die Beschaffenheit der Dinge a priori zu erkennen, über alle Erwartung der Philosophen vortrefflich; warum sollte es nicht eben so gut in der Philosophie gelingen? (Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibnizens und Wolf’s Zeiten [~1793]; XX, 262) Natürlich gelang das nicht, und die Geschichte der Metaphysik erweist sich folglich als ein endloses Hin-und-Her zwischen einem solchem erkenntnisoptimistischen Dogmatismus und einem totalen Skeptizismus hinsichtlich ihrer Möglichkeit überhaupt. Worin aber zeigte sich der Misserfolg einer erfahrungsüberschreitenden Wissenschaft? Nun, an der Erfahrung kann sie voraussetzungsgemäß nicht scheitern – woran aber dann? Nur daran, dass sie sich in Widersprüche verwickelt, und das geschieht, weil in unserer Vernunft Prinzipien liegen, welche jedem erweiternden Satz über diese Gegenstände einen, dem Ansehen nach, ebenso gründlichen Gegensatz entgegen stellen, und die Vernunft ihre Versuche selbst zernichtet. (KrV, A 263) Und das ist für Kant kein Zufall, sondern in der Struktur unserer Vernunft angelegt. Daher heißt es auch in den ersten Zeilen der Vorrede von 1781: Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer[!] Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. Und: In diese Verlegenheit geräth sie ohne ihre Schuld. (A, V) Denn sie beginnt mit Grundsätzen – man nehme hier einfach einmal das Kausalprinzip als ein Beispiel –, die sich in der Erfahrung bewährt haben und für diese, wie Kant betont, sogar unentbehrlich sind. Nun steigt sie – ihrer Natur nach unvermeidlich – zu immer höheren und entfernteren Bedingungen auf und wird dabei gewahr, dass kein Ende abzusehen ist. Am Beispiel des Begriffs der Verursachung: Zu einer gegebenen Wirkung suche ich eine Ursache auf, die Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 5 ich nun aber ihrerseits wiederum als eine Wirkung begreifen muss, zu der ich dann erneut eine Ursache suchen kann, die ihrerseits verursacht sein muss usw. Hierfür mache ich gleichsam jeweils nur einen lokalen Gebraucht vom Kausalprinzip (ich suche stets für nur eine Wirkung eine Ursache) – Kant nennt das den Verstandes-Gebrauch der Kategorie der Kausalität in Gestalt eines (Kausal-)Urteils. Dieser Gebrauch führt aber notwendig auf die Frage nach der Fortsetzung der so angestoßenen Reihe und letztlich auf die Frage nach deren möglichen Ende. Hier sieht nun die Vernunft sich angesichts ihrer fortgesetzten Schlüsse – so Kant – genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichermaßen so unverdächtig scheinen, dass auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse steht. (ebd.) Da solche Grundsätze selbst unmöglich durch die Erfahrung gerechtfertigt werden können, weil sie ja gerade über das Erfahrbare hinausweisen, kennen sie ihrerseits keinen, wie Kant es nennt, „Probierstein“ mehr und stehen – wie es sich im Einzelnen erweist – miteinander in Widerspruch. Hier zwei solcher konfligierenden Grundsätze, auch wieder am Beispiel der Kausalität: Eine Kausalität nach Naturgesetzen kann nicht die einzige sein, denn ohne eine Ursache, die selbst unverursacht ist (eine absolute Spontaneität) würden die Kausalketten rückwärts in Unendliche laufen, also letztlich unverursacht sein (was nicht geht). Aber: Eine Kausalität die von selbst zu handeln anfängt (eine absolute Spontaneität) ist blind und würde den Leitfaden der Regeln abreißen lassen, an welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Natur-Erfahrung möglich ist. Das ist die für unseren hiesigen Zweck formulierte Version von Kants dritter Antinomie, bzw. vom sogenannten Dritten Widerstreit in der Antinomie der reinen Vernunft: Eine absolute Spontaneität anzunehmen ist einerseits notwendig, andererseits aber auch unmöglich. Nicht nur in der Frage der Kausalität, sondern auch bei der Frage nach der Erstreckung des Raum-Zeit-Kontinuums als Ganzem sowie bei der Zusammensetzung des Ganzen der Erscheinung, sowie bei der Frage nach der Notwendigkeit der Existenz der Welt als Ganzer treten Kant zufolge entsprechende Antinomien auf. Ich werde das hier nicht im Einzelnen vorstellen, sondern will nur den Kern der Kantischen Diagnose referieren. Wir können jetzt kurz innehalten und uns noch einmal die Frage nach der Situation der Metaphysik zur Zeit der Kritik der reinen Vernunft – und aus deren Sicht – stellen. Zwei wichtige Merkmale der Krise der Metaphysik hat Kant herausgestellt. Zum einen die zuletzt vorgestellten internen Schwierigkeiten: Die menschliche Vernunft führt notwendig auf die Fragen der Metaphysik, Fragen, die sie aber aus eigenen Ressourcen offenbar nicht beantworten kann, weshalb sie sich Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 6 mangels empirischer „Prüfsteine“ beim Versuch der Beantwortung notwendig in Widersprüche verstrickt. Zum anderen die zuvor festgestellten externen Probleme: Die Gegenstände der Metaphysik: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit drohen von der neuen Wissenschaft usurpiert zu werden. Der Naturdeterminismus scheint die menschliche Freiheit aufzuheben, führt in den Fatalismus („Es kommt wie es kommen muss!“) und untergräbt damit die das Selbstverständnis des Menschen als eines für sein Tun verantwortlichen Wesens – und damit die Moral. Gott und Unsterblichkeit verlieren in der Folge die praktische Bedeutung für den Menschen. Kurz: Es steht schlecht um die (Gegenstände der) Metaphysik. III Und es wird noch schlimmer, wenn wir die folgenden Fragen stellen: Welche Gestalt hätte ein mögliches Wissen auf dem Felde der Metaphysik eigentlich? Welche Art von Sätzen oder Urteilen könnten zum Bestand der Metaphysik gehören? Kants Antwort: Die Urteile der Metaphysik müssten, wenn sie uns überhaupt etwas sagen sollten, synthetische Urteile a priori sein. Was bedeutet das? Urteile der Form „S ist P“ (also: einem Subjekt S wird ein Prädikat P zugeschrieben), z. B.: Die Seele (S) ist unsterblich (P), können in zweifacher Hinsicht klassifiziert werden. (1) Einige von ihnen können nur mit Rekurs auf Erfahrung gerechtfertigt werden, wie etwa: „Metalle dehnen sich bei Erwärmung aus“, andere bedürfen zu ihrer Rechtfertigung nicht der Erfahrung: „Körper sind ausgedehnt“. Die ersten sind Urteile a posteriori, die zweiten a priori, und diese Klassifikation ist vollständig, denn: tertium non datur. Zum anderen (2) können wir Urteile der Form „S ist P“ auch dahingehend unterscheiden, ob das dem Subjekt im Urteil zugewiesene Prädikat zu jenen Merkmalen gehört, anhand deren wir einen Gegenstand unter den jeweiligen Begriff subsumieren oder nicht. „Alle Körper sind ausgedehnt“, ist deshalb wahr, weil Ausdehnung zu jenen Merkmalen gehört, die in jenem Begriff gedacht werden, den wir mit dem Wort „Körper“ verbinden (das macht gerade unsere Sprachgemeinschaft aus, in der man über Körper verbindlich reden kann). Es ist keine Einsicht über Körper, sondern über unsere Begriffe und deren Zusammenhang mit den Worten unserer Sprache, hier: mit dem Wort „Körper“. Kant nennt diese Urteile analytisch. Sie dienen allein der Erläuterung unserer Begriffe, nicht der Erkenntnis der Dinge. Der Satz „Alle Körper sind ausgedehnt.“ wäre eben auch dann wahr, wenn es keine Körper gäbe. Wer ihn als falsch ansieht, verbindet mit dem Wort „Körper“ schlicht einen anderen Begriff (d.i., einen anderen Merkmalskomplex; vgl. Lockes „nominal substances“) als der, der ihn als wahr ansieht. – Alle nicht-analytischen Urteile werden „synthetisch“ genannt. Trägt man beiden Unterscheidungen Rechnung dann versteht es sich gleichsam von selbst, dass substanzielle metaphysische Urteile sowohl synthetisch als auch Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 7 a priori sein müssen: Da sie keine Erfahrungsurteile sind, können sie nicht a posteriori sein. Und wenn wir nicht nur etwas über unsere Sprache/Begriffe lernen wollen, dann dürfen sie nicht analytisch sein. Kurz: Wenn Metaphysik etwas Substanzielles behaupten will, dann müssen metaphysische Urteile synthetische Urteile a priori sein. Sind synthetische Urteile a priori überhaupt möglich? Das ist seit Kants Einführung der genannten Unterscheidungen die Gretchenfrage der Metaphysik. Für Kant ist die allgemeine Frage nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori Erstens durch die Existenz der Mathematik beantwortet: Das Merkmal der Notwendigkeit mathematischer Urteile schließt aus, dass diese bloße Erfahrungsurteile, d.i., a posteriori sind. Und die Tatsache, dass sie nicht allein durch die Analyse unserer Begriffe zustande kommen, schließt aus, dass sie analytisch sind: Ein Dreieck ist eine geschlossene Figur aus drei Geraden. Dass die Summe der eingeschlossenen Winkel die von zwei rechten ist gehört offenkundig nicht zu den Merkmalen jenes Begriffs, den wir mit dem Wort „Dreieck“ verbinden, ist aber trotzdem notwendig. Also müssen mathematische Urteile synthetische Urteile a priori sein. Nicht nur diese: Zweitens ist für Kant unbestritten, dass auch unserer Erfahrungserkenntnis synthetische Urteile a priori zugrunde liegen: Das Kausalprinzip, der Substanzsatz, das Prinzip der Wechselwirkung u. v. a. mehr sind Prinzipien, ohne die (1) Erfahrungserkenntnis unmöglich wäre, und die als allgemeine Prinzipien ihrerseits (2) nicht wiederum aus der Erfahrung gerechtfertigt werden können. Ferner sind sie (3) auch nicht analytisch, denn sie sind nicht durch bloße Erläuterung der Begriffe zu gewinnen. Alle drei Aspekte hatte bereits David Hume 1784 in seiner Enquiry Concerning Human Understanding (Sect. IV) in Bezug speziell auf das Kausalprinzip herausgestellt (was Kant nachweislich tief beeindruckt hatte), ohne aber mit der Möglichkeit gerechnet zu haben, dass dieses ein synthetisches Urteil a priori sein könnte (für Hume waren Urteile eben entweder analytisch oder a posteriori – tertium non datur). Kant greift Humes Einsichten bezüglich des Kausalprinzips auf und stellt diesem Grundsatz nun aber noch 11 weitere, von ihm so genannte synthetische Grundsätze des reinen Verstandes zur Seite, die vollständig in einem an seiner Kategorientafel orientierten Schema vorgestellt werden können: Zu jeder der 12 Kategorien, d. i. zu jedem reinen Verstandesbegriff, gibt es genau einen synthetischen Grundsatz a priori, der diesen Begriff zugeordnet ist, und alle diese Grundsätze liegen unserem Erfahrungsgebrauch notwendig zu Grunde. Die Frage, wie das genau zu denken ist, woher die Kategorientafel kommt &c. müssen wir hier zunächst vertagen. Es geht jetzt erst einmal darum, die zugrundeliegende Konzeption und deren Funktion für die Frage nach der Möglichkeit der Metaphysik zu erfassen. Exemplarisch: Die Kategorie der Inhärenz (Substanz) ist verbunden mit dem Grundsatz, dass bei allem Wechsel der Erscheinungen die Substanz beharrt. Die KategoRingvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 8 rie der Kausalität mit dem Grundsatz, dass alle Veränderungen nach dem Gesetz der Verknüpfung der Ursache und Wirkung geschehen, die Kategorien der Quantität (Einheit/Vielheit/Allheit) mit dem Grundsatz, dass alle Anschauungen extensive Größen sind und so weiter. Das Interesse an der Applikationen unserer Kategorien auf die Gegenstände unseres Denkens besteht freilich darin, dass wir dann, wenn wir die Gegenstände unter eine oder mehrere der Kategorien subsumieren können, wir die korrespondierenden Grundsätze auf sie anwenden dürfen, und somit Erkenntnisse über die Gegenstände gewinnen: Kann ich einen Gegenstand unter die Kategorie der Substanz subsumieren, dann weiß ich um seine Beharrlichkeit, fällt er unter die Kategorie der Quantität, dann kann ich auf ihn die Sätze der reinen Mathematik anwenden usw. Und das sind – so Kant – für unseren Erfahrungsgebrauch unentbehrliche synthetische Urteile a priori. Nun stellt sich freilich die Frage: Unter welchen Bedingungen bin ich berechtigt, einen solchen Gebrauch von den Kategorien zu machen, der mich dann befähigt, über die darunter subsumierten Gegenstände im Sinne der korrespondierenden Grundsätze zu urteilen? Kurz: Unter welchen Bedingungen folgt z.B. daraus, dass ich etwas als Substanz vorstelle, dass dieses dann tatsächlich beharrt? Schon lange vor der Kritik der reinen Vernunft war sich Kant darüber im Klaren, dass dies das zentrale Problem für die Metaphysik sein muss. In dem berühmten Brief an Marcus Herz vom 21. 2. 1772 heißt es: Ich frug mich nemlich selbst: auf welchem Grunde beruhet die Beziehung desienigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegenstand? Enthält die Vorstellung nur die Art, wie das subiect von dem Gegenstande afficirt wird, so ists leicht einzusehen, wie er diesem als eine Wirkung seiner Ursache gemäß sey und wie diese Bestimmung unsres Gemüths etwas vorstellen d.i. einen Gegenstand haben könne. Die passive oder sinnliche Vorstellungen haben also eine begreifliche Beziehung auf Gegenstände, und die Grundsätze, welche aus der Natur unsrer Seele entlehnt werden, haben eine begreifliche Gültigkeit vor alle Dinge in so fern sie Gegenstände der Sinne seyn sollen. Was für Kant also ausdrücklich als unproblematisch gilt, ist der Gebrauch unserer Verstandesbegriffe und Grundsätze in Bezug auf die Gegenstände, die uns durch die Sinne gegeben, gleichsam eingeprägt werden, kurz: Für die Gegenstände unserer Erfahrung. Auch in einem zweiten Falle wäre der Gebrauch von Verstandesbegriffen und die Anwendung der korrespondierenden Grundsätze ganz unproblematisch: Wenn wir die Gegenstände nach unserem eigenen Entwurf hervorbrächten (so wie wir es uns vom Göttlichen Verstand vorstellen, der die Welt kennt, weil er sie gemacht hat). Kant fasst diese beiden Möglichkeiten zusammen: Es ist also die Möglichkeit so wohl des intellectus archetypi, auf dessen Anschauung die Sachen selbst sich gründen, als des intellectus ectypi, der die data seiner logischen Behandlung aus der sinnlichen Anschauung der Sachen schöpft, zum wenigsten [lies: zumindest] verständlich. Allein unser Verstand ist durch seine Vorstellungen weder die Ursache des Gegenstandes, noch der Gegenstand die Ursache der Verstandesvorstellungen (in sensu reali). Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 9 Das heißt: Wenn wir uns etwa fragen, ob unsere Seele im gegebenen Falle „Ursache der Verstandsvorstellung“ Substanz ist und deshalb beharrlich (also unsterblich), dann müssen wir zunächst einmal zugestehen, dass unsere Seele uns weder als ein Gegenstand der Erfahrung gegeben ist, noch von uns nach eigenem Entwurf hervorgebracht wurde. Warum können wir dann aber daraus, dass wir uns die Seele als Substanz vorstellen, schließen, dass sie eine Substanz ist (also eine „Verstandesvorstellung in sensu reali“) – und damit dann auch dem entsprechenden Grundsatz der Beharrlichkeit unterworfen? Kant sieht hierin das zentrale Rätsel der Möglichkeit der Metaphysik, d.i. der Erweiterung unserer Vernunfterkenntnis über das Feld der Sinnlichkeit hinaus. Wodurch aber werden uns denn diese Dinge gegeben, wenn sie es nicht durch die Art werden, womit sie uns afficiren[. U]nd wenn solche intellectuale Vorstellungen auf unsrer innern Thätigkeit beruhen, woher komt die Übereinstimmung die sie mit Gegenständen haben sollen, die doch dadurch nicht etwa hervorgebracht werden Kurz: Die Metaphysik handelt von Gegenständen, die uns nicht gegeben werden (das werden uns nur Erfahrungsgegenstände) und die wir auch nicht selbst erzeugen (wir sind nicht deren Schöpfer). Woher können wir dann aber wissen, dass unsere entsprechenden Vorstellungen die Vorstellungen von solchen Gegenständen sind, über die wir gemäß den Grundsätzen des Verstandes urteilen können? In einer anderen Ausdrucksweise: Woher wissen wir, dass unsere Begriffe von ihnen „objektive Realität“ haben – und nicht etwas bloße „Hirngespinste“ sind? Die Antwort ist für Kant kurz und bündig, und lautet zunächst einmal: „Gar nicht!“ Wenn Metaphysik die Vernunfterkenntnis des Übersinnlichen sein soll, dann ist sie als Wissenschaft folglich unmöglich. Das zu zeigen, ist die zentrale Aufgabe der Kritik der reinen Vernunft, indem sie „Quellen, Umfang und Gränzen“ der Metaphysik untersucht. Auf den ersten Blick verträgt sich das schlecht mit dem Anspruch, den Kant unübersehbar im diesem Buch vorträgt: Nämlich die Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori zu klären. Wenn die Metaphysik – wie oben gezeigt – eine Doktrin von synthetischen Urteilen a priori sein muss (denn weder mit Urteilen a posteriori noch mit analytischen kann man das Übersinnliche erkennen), dann scheint der Nachweis der Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori prima facie der Nachweis der Möglichkeit der Metaphysik zu sein. Ein solcher Nachweis aber wäre freilich der Versuch Eulen nach Athen tragen, denn die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori ist für Kant doch durch deren Wirklichkeit in Mathematik und Naturwissenschaften bereits gesichert – und sie garantiert gerade deren Erfolg (wie Kant unablässig betont). IV Kants Frage heißt daher nicht: „Sind synthetische Urteile a priori möglich?“ (die kurze Antwort ist „Ja!“), sondern „Wie sind synthetische Urteile a priori Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 10 möglich?“ – und die gar nicht kurze Antwort der ersten Hälfte der Kritik der reinen Vernunft, in Aesthetik und Analytik, besteht in dem Nachweis, dass die Möglichkeit synthetischer Urteile a priori unter Bedingungen steht, die zwar in Mathematik und Erfahrungserkenntnis geben sind, aber gerade nicht in einer vermeintlichen Metaphysik als Wissenschaft. Und in der zweiten Hälfte des Buches, die den Namen einer „Dialektik“ trägt, zeigt Kant auf, dass der elende Zustand der bisherigen Metaphysik sich der Tatsache verdankt, dass man genau das bislang nicht zur Kenntnis genommen hat. Dogmatismus und Skeptizismus bezüglich der Metaphysik haben dieselbe Wurzel: Die Assimilierung der Metaphysik an solche Wissenschaften, deren sicherer Gang sich der Tatsache verdankt, dass ihre Gegenstände in besonderer Weise gegeben sind: Als Resultate von sog. Konstruktionen in der Mathematik oder als Gegenstände möglicher Erfahrung. Erst wenn dies durchschaut ist, kann es eine kritische Metaphysik geben, die deren besonderen Gegenständen, d. i. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, am Ende doch noch gerecht werden kann. Kants berühmtes Diktum in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1787 lautet mit Blick auf genau diese drei Gegenstände: Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen [nicht: „dem Glauben Platz zu machen“!], und der Dogmatism der Metaphysik, d.i. das Vorurtheil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. (KrV, B XXX) Bevor ich auf die positive Konzeption einer praktisch-dogmatischen Metaphysik bei Kant zu sprechen komme, möchte die Grundgedanken der Kantischen Lehre von der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori zumindest in dem Umfang vorstellen, der einen ersten Eindruck davon vermittelt, warum synthetischen Urteile a priori in Bezug auf das Übersinnliche nicht möglich sind. Dabei lasse ich Kants Theorie der Mathematik aus und wende mich nur den Kategorien, den Verstandesbegriffen und den ihnen korrespondierenden Grundsätzen des Verstandes zu. Wenn wir den oben zitierten Fall des „intellectus ectypi, der die data seiner logischen Behandlung aus der sinnlichen Anschauung der Sachen schöpft“ betrachten (Herz-Brief), so ist es offenkundig, dass alles, was ein solcher Geist seine Vorstellungen nennt – und was damit möglicher Gegenstand seines Bewusstseins ist –, voraussetzungsgemäß irgendwann zu diesem Bewusstsein hinzugekommen sein muss und mit ihm vereinigt wurde. Dieses Hinzukommen müssen wir jeweils als einen Akt des Verbindens denken, der seinerseits nur als eine Handlung meines Verstandes gedacht werden kann, die die einzelnen Vorstellungen untereinander verknüpft und damit sukzessive zu meinem Bewusstsein hinzufügt, Kant schreibt: indem ich eine zu der anderen hinzusetzte und mir der Synthesis derselben [lies: der Synthesis der einen mit der anderen] bewusst bin. (KrV, B 133) Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 11 Diese Verknüpfung der Vorstellungen mit- und damit untereinander geschieht nun den verschiedenen Funktionen des Verstandes gemäß, und diese Funktionen werden von Kant vorgestellt unter den Titeln der 12 Kategorien. Welche 12 es sind, und warum es genau 12 sind, lasse ich hier offen, Substanz, Kausalität und Einheit hatte ich oben exemplarisch genannt. Alles also, was in einem solchen Bewusstsein vorgestellt wird, dem das Mannigfaltige seiner Vorstellungen gegeben wird (und ein solches ist das unsere), ist notwendig den Einheitsfunktionen der Kategorien unterworfen und steht somit notwendig unter den korrespondierenden Grundsätzen des reinen Verstandes. Tragen wir nun noch der Tatsache Rechnung, dass dem Menschen die Gegenstände unter den besonderen Formen seiner sinnlichen Anschauung, d. i. in Raum und Zeit gegeben werden, so lässt sich absehen, dass der Gehalt der Grundsätze wesentlich durch Raum-Zeitbestimmungen spezifiziert werden muss. In der Terminologie der Kritik der reinen Vernunft heißt das: Erst die durch Raum- und Zeitbestimmungen schematisierten Kategorien erlauben es, die ihnen entsprechenden Grundsätze auf das Gegebene anzuwenden. Auch wenn diese Skizze beinahe alles das auslässt, was Kant zu einem interessanten Philosophen macht, dürfte zumindest deutlich geworden sein, dass seine Antwort auf die Frage: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ zur Folge hat, dass Metaphysik als Wissenschaft nicht möglich ist – zumindest nicht in Gestalt jenes Dogmatismus, der mit den für den Erfahrungsgebrauch notwendigen und nur für diesen Gebrauch gegenstandskonstitutiven Kategorien im Übersinnlichen herumschwärmen will, um dort von den entsprechenden Grundsätzen des Verstandes Gebrauch machen zu können („die Seele ist Substanz und somit unvergänglich“). Plato ist für Kant das Vorbild jener schlechten Metaphysik: Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft theilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, daß es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Eben so verließ Plato die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so vielfältige Hindernisse legt, und wagte sich jenseit derselben auf den Flügeln der Ideen in den leeren Raum des reinen Verstandes. (KrV, A 4) Das, was dem dogmatischen Metaphysiker als bloßes Hindernis des Kategoriengebrauchs erscheint, erweist sich bei kritischer Prüfung gerade als deren Geltungsbedingung: der Bezug auf in der Sinnlichkeit Gegebenes, d.i., auf die Erfahrung. Wenn ich also den in der Anschauung, d.h., in Raum und Zeit, gegebenen Tisch als Substanz bestimme, und dessen Farbe als Akzidenz erkenne, dann folgt daraus, dass der Tisch beharren kann, während seine Farbe wechselt. Wenn ich hingegen meine Seele als Substanz nur vorstelle (denn sie ist mir ja nicht in der raum-zeitlichen Anschauung gegeben), dann folgt daraus nichts – und schon gar nicht ihre Unsterblichkeit: Das ist das Ende jeder dogmatischen Metaphysik. Um hier nicht in Missverständnisse hineinzugeraten muss man sich klar machen, dass Kant den Ausdruck „Metaphysik“ seit der Kritik der reinen Vernunft in zwei unterschiedliche Bedeutungen verwendet: Einmal im Sinne der KlassiRingvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 12 schen Metaphysik als einer Lehre vom Übersinnlichen, die traditionell die Lehre von Gott Freiheit und Unsterblichkeit ist. Zum anderen bezeichnet „Metaphysik“ nun aber auch einen Schatz von synthetischen Urteilen a priori, von „Grundsätzen des reinen Verstandes“ die wir auf die Welt unserer Erfahrung anwenden können. In diesem zweiten Sinne (d.i. als Transzendentalphilosophie) ist Metaphysik als Wissenschaft offenkundig weiterhin möglich, gleichsam als eine paradoxe „Metaphysik der Erfahrung“ – und deshalb gibt es bei Kant dann auch eine „Metaphysik der Natur“, bzw. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften (1786). V Was ist angesichts dieser Destruktion der Klassischen Metaphysik, der Wissenschaft vom Übersinnlichen, nun aber der Nutzen einer kritischen Philosophie für die tradierten Gegenstände der Klassischen Metaphysik, für die Fragen nach Gott, Freiheit und Unsterblichkeit? Es ist kein Zufall, dass Kant in einem der Entwürfe seiner späten, dann aber nicht fertig gestellten Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik nachdrücklich auf die systematische Wichtigkeit gerade der Freiheitsfrage für seine kritische Philosophie, den Transzendentalen Idealismus, hinweist: "Ursprung der critischen Philosophie ist Moral, in Ansehung der Zurechnungsfähigkeit der Handlungen. Hierüber unaufhorlicher Streit. Alle Philosophien sind im Wesentlichen nicht unterschieden bis auf die critische." (Fortschritte; XX 335) Mit der Zurechnungsfähigkeit, der Imputabilität und der Moral steht selbstredend die Freiheit auf dem Plan, und schon in der Kritik der reinen Vernunft von 1781 hieß es, Die absolute Spontaneität der Handlung als de[r] eigentlichen Grund der Imputabilität derselben, ist aber […] der eigentliche Stein des Anstoßes für die Philosophie, welche unüberwindliche Schwierigkeiten findet, dergleichen Art von unbedingter Causalität einzuräumen (KrV, A 448) Wollte man es auf die Spitze treiben, so dient die Philosophie, und das heißt bei Kant hier: Die Reflexion über die Metaphysik, vornehmlich dem Zweck, die Freiheit des Menschen und mit ihr die Moral vor den Anmaßungen einer theoretisch-dogmatischen Erkenntnis zu retten die – wie wir sahen: auch für Kant völlig zu Recht – einen lückenlosen kausalen Zusammenhang der gesamten Natur unterstellt. Das ist freilich symbolisch als eine späte Reaktion auf die Vertreibung Wolffs aus Halle zu sehen: Eine Philosophie, die sich dem Naturalismus der neuen Naturwissenschaften ausliefert, und damit den Geist des Menschen nicht aus dem Netz des Natur-Determinismus befreien kann, zerstört die Grundlagen der Moral und der Sittlichkeit. Wie kann also der Transzendentale Idealismus die Freiheit gleichsam retten, ohne in eine dogmatische Metaphysik zurückzufallen? Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 13 Die Rettung ruht auf einem doppelten Fundament, zum einen auf einer Auflösung der eingangs genannten dritten Antinomie im Weltbegriffe im Rahmen der Kritik der reinen Vernunft von 1781 und zum anderen auf Kants Lehre von „Faktum der reinen praktischen Vernunft“, der er im Jahre 1788 eine eigene Kritik der praktischen Vernunft widmet. Orientieren wir uns zunächst kurz an dieser zweiten Schrift und nähern uns der Auflösung der Dritten Antinomie und dem Beitrag der Kritik der reinen Vernunft für die Rettung der Freiheit sodann gleichsam von hinten, aus der Perspektive ihres Ergebnisses: Was ist die Aufgabe der Kritik der praktischen Vernunft? Die Antwort steht gleich am Beginn der Vorrede: Sie soll blos darthun, daß es reine praktische Vernunft gebe, und kritisirt in dieser Absicht ihr ganzes praktisches Vermögen. Wenn […] sie als reine Vernunft wirklich praktisch ist, so beweiset sie ihre und ihrer Begriffe Realität durch die That, und alles Vernünfteln wider die Möglichkeit, es zu sein, ist vergeblich. Mit diesem Vermögen steht auch die transscendentale Freiheit nunmehr fest. (KpV, V, 3) Was ist reine praktische Vernunft? Sie ist nichts anderes, als das Vermögen der menschlichen Vernunft, für sich selbst praktisch zu sein, und das heißt einfach: ein Sollen (eine praktische Nötigung) auszudrücken, welches sich nicht als Folge vorgängiger Neigungen und Interessen, Absichten oder Wünsche begreifen lässt (wie es etwa bei der praktischen Nötigung zum Üben der Fall wäre, wenn ich ein Pianist werden wollte). Kant erkennt ein solches kategorisches Sollen dort, wo der Mensch sich unabweisbar den Forderungen des Sittengesetzes ausgesetzt erfährt: Dass ich etwa ein Versprechen halten soll, versteht sich von selbst. Auch nach Abzug alles möglichen Interesses an der Einlösung des Versprechens (man will den Freund nicht enttäuschen, man fürchtet seine Missgunst, hat Angst, das Vertrauen der anderen zu verlieren usw.), so Kant, bleibt das Bewusstsein bestehen, dass man es halten soll (und dass dieses Sollen allenfalls durch ein erlösendes Wort desjenigen, dem man etwas versprochen hat, verschwinden könnte). Ein Mensch kann also auf die Frage „Warum hast Du Dein Versprechen gehalten?“ mitunter die Antwort geben: „Weil ich es gegeben habe!“ und darauf bestehen, dass damit bereits alles gesagt ist. Wer ihm das nicht glaubt, zweifelt an seiner moralischen Integrität – was wir gemeinhin als einen schweren Vorwurf betrachten. Was ich hier nur am Versprechen erläutert habe, gilt Kant zufolge für alle Verpflichtungen, die sich aus dem Kategorischen Imperativ „Handle so, dass die Maxime Deiner Handlungen ein allgemeines Gesetz abgeben könne!“ ableiten lassen. Nun zeigt Kant (was ich hier nicht erläutern kann), dass ein Wille, der sich vom Kategorischen Imperativ bestimmen lassen kann (der menschliche eben), ein freier Wille ist, d i. ein solcher, den wir notwendig als absolute Spontaneität denken. Kurz: Der menschliche Wille muss um unseres Bewusst- Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 14 seins der Verpflichtung durch das Sittengesetz willen als frei angenommen werden. Daher hieß es: „Mit diesem Vermögen steht die Transzendentale Freiheit nunmehro fest“ (ich hatte es schon zitiert, aber dann geht es weiter): und zwar in derjenigen absoluten Bedeutung genommen, worin die speculative Vernunft beim Gebrauche des Begriffs der Causalität sie bedurfte, um sich wider die Antinomie zu retten, darin sie unvermeidlich geräth, wenn sie in der Reihe der Causalverbindung sich das Unbedingte denken will. (ebd.) Hier greifen nun Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der reinen Vernunft ineinander: Die Freiheit, die wir uns angesichts unseres Bewusstseins des Sittengesetzes1 unausweichlich zuschreiben müssen, ist nämlich genau jene, deren grundsätzlicher Möglichkeit die Theoretische Vernunft „bedurfte“, um sich „wider die Antinomie zu retten“. Wir erinnern uns – hoffentlich – an die eingangs vorgestellte dritte Antinomie: Eine absolute Spontaneität muss möglich sein, weil die Kausalketten sich sonst rückwärts ins Unendliche verlören. Eine solche absolute Spontaneität kann aber nicht in der Natur gedacht werden, denn als eine solche würde sie den (von den Wissenschaften stets unterstellten) durchgängigen Naturzusammenhang aufheben. Will die theoretische Vernunft sich nicht in Widersprüche verwickeln, so muss sie folglich eine nicht-natürliche, eine transzendentale Freiheit annehmen, die als eine Ursache ihrerseits — und dass ist nun die Pointe des Transzendentalen Idealismus –, weil sie nicht in der Natur auftritt, auch nicht wieder unter Zeitbestimmungen stehen kann, und damit auch nicht in Widerspruch zur Naturkausalität, das heißt zum Praedeterminismus, gerät, das heißt: Mit der vollständigen Bestimmtheit des Weltgeschehens durch einen früheren Zustand konfligiert. Der Mensch muss sich als frei begreifen, weil er nur so die unbedingte Forderung des Sittengesetzes denken kann (Kritik der praktischen Vernunft), und er kann sich als frei begreifen, weil er seine Freiheit als eine transzendentale denken kann, die nicht mit dem Determinismus der Natur in Konflikt gerät (Kritik der reinen Vernunft). Und diese transzendentale Freiheit – das ist gleichsam die diabolische Dimension der Pointe von Kants kritischer Lehre – kann ausgerechnet von denen nicht geleugnet werden, die die durchgängige gesetzliche Bestimmtheit des Naturgeschehens gegen die Möglichkeit menschlicher Freiheit ins Feld 1 Zur Vermeidung von möglichen Irritationen sei hier darauf hingewiesen, dass Kant 1781 (1. Auflage der KrV, s. A 546f.) und 1785 (Grundlegung, s. IV, 451f.) noch anders argumentiert: Die für die Zuschreibung transzendentaler Freiheit notwendig vorauszusetzende Teilhabe des Menschen am Intelligiblen soll sich dort nicht erst am Bewusstsein des Sittengesetzes, sondern bereits am Selbstbewusstsein zeigen. 1786 wurde Kant in einer Rezension der Grundlegung darauf hingewiesen, dass letzteres mit den Erkenntnisrestriktionen des Transzendentalen Idealismus unvereinbar ist. Das führt zu einer (nach der Hälfte allerdings unvermittelt abgebrochenen) Überarbeitung der KrV (2. Auflage von 1787) und zur Auslagerung der Freiheitslehre in eine KpV (für die Selbst-Kritik an Grundlegung III: vgl. etwa V, 31 Zeile 29f. mit IV, 447 Zeile 8f. und 452 Zeile 35ff.). Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 15 führen wollen: Denn die dafür herangezogene Gesetzlichkeit und Naturnotwendigkeit selbst lassen sich – so Kant – nicht widerspruchsfrei explizieren, ohne dafür eine transzendentale Freiheit vorauszusetzen. Wenn wir so die menschliche Freiheit für eine (von Kant in den 1790er Jahren so genannte) praktisch-dogmatische Metaphysik gerettet haben, dann – so versichert uns Kant – werden wir auch für die Rede von Gott und Unsterblichkeit ein solches Fundament finden – worauf ich hier nicht mehr eingehen kann. Was ist nun damit über die Grenzen des Geistes, die die Grenzen der Vernunft sein sollen, gesagt? Wenn man die Kantische Lehre aus ihrem historischen Kontext heraus so begreift, wie ich es hier vorgeführt habe, dann ist die Botschaft eine zweifache: Zu einen ist die menschliche Vernunft als das Organ unserer empirischen Forschung de facto unbeschränkt, „schrankenlos“, denn die Grenzen unserer Vernunft sind die Grenzen unserer Welt, und an diese Grenzen werden wir in unserer Erfahrung niemals stoßen – ja, wir können sie nicht einmal in Gedanken überschreiten. Nur im Bewusstsein unserer Freiheit erschließt sich uns, wie Kant es nennt, die „herrliche Eröffnung“ der Welt des Über-Sinnlichen, in der allein sich der Mensch als ein der Zurechnung fähiges Wesen begreifen kann. Was die klassische Metaphysik als eine solche Welt behandeln wollte, die wir in derselben Weise (nämlich durch dieselben Kategorien nebst den korrespondierenden Grundsätzen) erkennen können, wie die Sinnenwelt, wird bei Kant nun in einer völlig neuen Weise zum Gegenstand: Ich hatte es schon oben zitiert: Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatism der Metaphysik, d.i. das Vorurtheil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. Als frei können wir uns nicht erkennen – und dasselbe gilt für die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit unserer Seele. Ins Übersinnliche führen nämlich keine Wege der Theorie: Diesbezügliche Träume sind seit 1781 ausgeträumt: Wer glaubt, moralische Güter und Normen müssten in demselben Sinne wirklich oder objektiv sein, wie es die Gegenstände und Gesetze der Erfahrungswelt sind, ist philosophisch auf dem Stand der Mitte des 18. Jahrhunderts stehen geblieben. Angesichts des unleugbaren Bewusstseins unserer Verpflichtungen müssen wir uns aber als frei behaupten. Und wir können uns – im Rahmen des Transzendentalen Idealismus – als frei behaupten, ohne dadurch in Widerspruch mit der Vernunft (und der Wissenschaft) zu geraten. Unsere Freiheit ist etwas, was wir nicht erkennen, was wir uns aber notwendig zuschreiben, wenn wir uns als verpflichtete und Andere verpflichten-könnende Wesen begreifen. Insofern kann Kant in der Kritik der praktischen Vernunft behaupten, die Begriffe von Gott Freiheit und Unsterblichkeit haben „Objektivität“ – wenn auch nur praktische Objektivität: Die Annahme, dass sie Begriffe von Etwas sind (und nicht bloße „Hirngespinste“), ist damit keine Frage des Beliebens. Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012 16 Von der theoretischen Vernunft (und damit freilich auch von den empirischen Wissenschaften) ist, so die Botschaft der Kritik der reinen Vernunft, ist kein begründeter Einwand gegen die Freiheit des Menschen zu erwarten: Das ist die für Kant einzige Grenze der Vernunft, mit der wir uns abfinden müssen, wenn wir uns Menschen als Personen behaupten wollen. Ringvorl. WS 2011/12 Unkorrigiertes Manuskript – nur zum internen Gebrauch für das GpK12! – vers. v. 04.04.2012