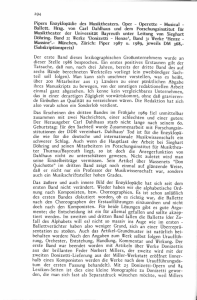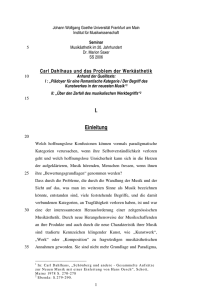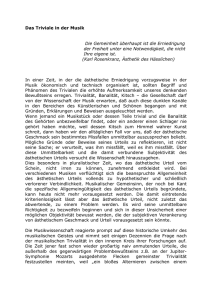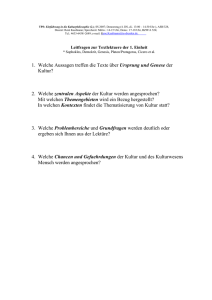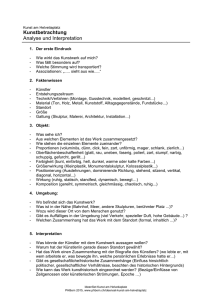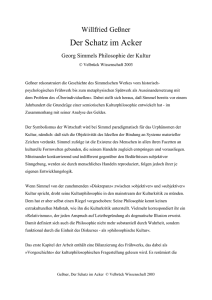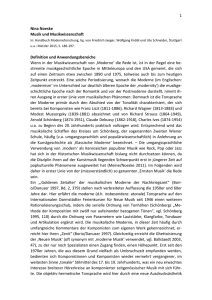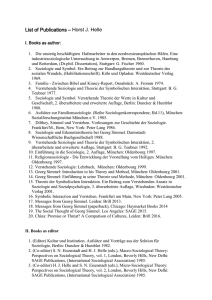„Tragödie der Kultur“ revisited: Carl Dahlhaus` Konzeption des
Werbung
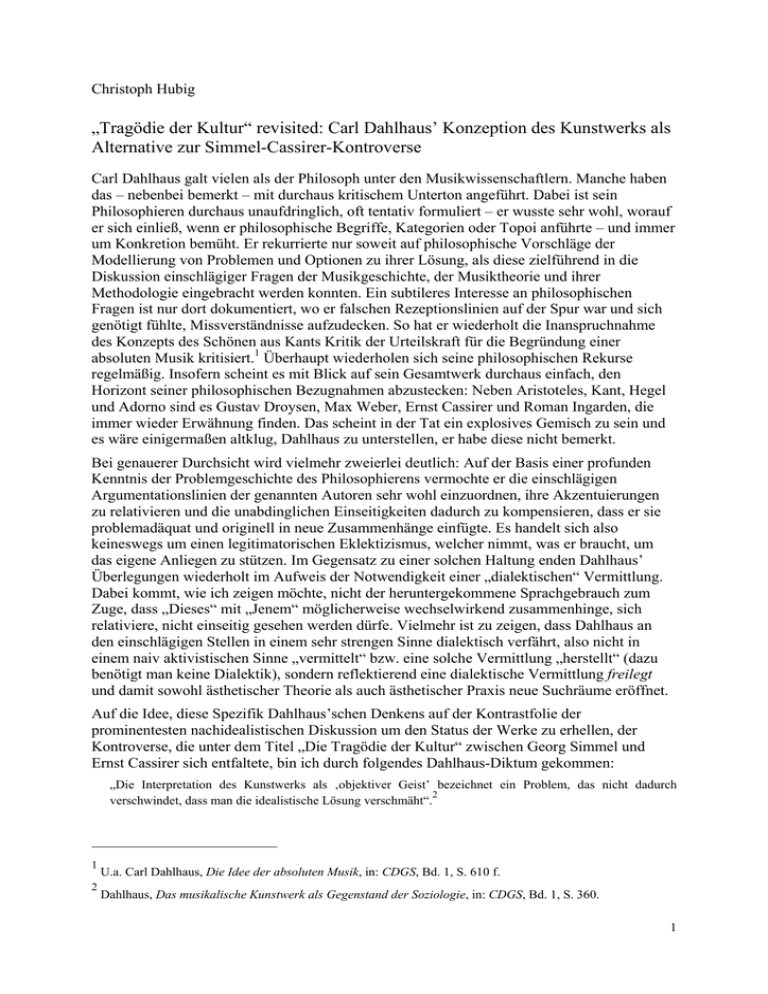
Christoph Hubig „Tragödie der Kultur“ revisited: Carl Dahlhaus’ Konzeption des Kunstwerks als Alternative zur Simmel-Cassirer-Kontroverse Carl Dahlhaus galt vielen als der Philosoph unter den Musikwissenschaftlern. Manche haben das – nebenbei bemerkt – mit durchaus kritischem Unterton angeführt. Dabei ist sein Philosophieren durchaus unaufdringlich, oft tentativ formuliert – er wusste sehr wohl, worauf er sich einließ, wenn er philosophische Begriffe, Kategorien oder Topoi anführte – und immer um Konkretion bemüht. Er rekurrierte nur soweit auf philosophische Vorschläge der Modellierung von Problemen und Optionen zu ihrer Lösung, als diese zielführend in die Diskussion einschlägiger Fragen der Musikgeschichte, der Musiktheorie und ihrer Methodologie eingebracht werden konnten. Ein subtileres Interesse an philosophischen Fragen ist nur dort dokumentiert, wo er falschen Rezeptionslinien auf der Spur war und sich genötigt fühlte, Missverständnisse aufzudecken. So hat er wiederholt die Inanspruchnahme des Konzepts des Schönen aus Kants Kritik der Urteilskraft für die Begründung einer absoluten Musik kritisiert.1 Überhaupt wiederholen sich seine philosophischen Rekurse regelmäßig. Insofern scheint es mit Blick auf sein Gesamtwerk durchaus einfach, den Horizont seiner philosophischen Bezugnahmen abzustecken: Neben Aristoteles, Kant, Hegel und Adorno sind es Gustav Droysen, Max Weber, Ernst Cassirer und Roman Ingarden, die immer wieder Erwähnung finden. Das scheint in der Tat ein explosives Gemisch zu sein und es wäre einigermaßen altklug, Dahlhaus zu unterstellen, er habe diese nicht bemerkt. Bei genauerer Durchsicht wird vielmehr zweierlei deutlich: Auf der Basis einer profunden Kenntnis der Problemgeschichte des Philosophierens vermochte er die einschlägigen Argumentationslinien der genannten Autoren sehr wohl einzuordnen, ihre Akzentuierungen zu relativieren und die unabdinglichen Einseitigkeiten dadurch zu kompensieren, dass er sie problemadäquat und originell in neue Zusammenhänge einfügte. Es handelt sich also keineswegs um einen legitimatorischen Eklektizismus, welcher nimmt, was er braucht, um das eigene Anliegen zu stützen. Im Gegensatz zu einer solchen Haltung enden Dahlhaus’ Überlegungen wiederholt im Aufweis der Notwendigkeit einer „dialektischen“ Vermittlung. Dabei kommt, wie ich zeigen möchte, nicht der heruntergekommene Sprachgebrauch zum Zuge, dass „Dieses“ mit „Jenem“ möglicherweise wechselwirkend zusammenhinge, sich relativiere, nicht einseitig gesehen werden dürfe. Vielmehr ist zu zeigen, dass Dahlhaus an den einschlägigen Stellen in einem sehr strengen Sinne dialektisch verfährt, also nicht in einem naiv aktivistischen Sinne „vermittelt“ bzw. eine solche Vermittlung „herstellt“ (dazu benötigt man keine Dialektik), sondern reflektierend eine dialektische Vermittlung freilegt und damit sowohl ästhetischer Theorie als auch ästhetischer Praxis neue Suchräume eröffnet. Auf die Idee, diese Spezifik Dahlhaus’schen Denkens auf der Kontrastfolie der prominentesten nachidealistischen Diskussion um den Status der Werke zu erhellen, der Kontroverse, die unter dem Titel „Die Tragödie der Kultur“ zwischen Georg Simmel und Ernst Cassirer sich entfaltete, bin ich durch folgendes Dahlhaus-Diktum gekommen: „Die Interpretation des Kunstwerks als ‚objektiver Geist’ bezeichnet ein Problem, das nicht dadurch 2 verschwindet, dass man die idealistische Lösung verschmäht“. 1 2 U.a. Carl Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, in: CDGS, Bd. 1, S. 610 f. Dahlhaus, Das musikalische Kunstwerk als Gegenstand der Soziologie, in: CDGS, Bd. 1, S. 360. 1 Für sich gesehen erscheint diese Formulierung wenig sinnvoll: Was heißt denn „idealistische Lösung“? Gemeint sein kann ja nicht einerseits die Fichtesche Lösung, die Jean Paul, der als einer der ersten Hegels Phänomenologie des Geistes verstanden hat, unüberbietbar karikiert hat in der Formulierung Schoppes aus dem Titan „[…] sie sind ganz jener betrunkene Kerl, der sein Wasser in einen Springbrunnen hineinließ und die ganze Nacht davor stehen blieb, weil er kein Aufhören hörte und mithin alles, was er fort vernahm, auf seine Rechnung 3 schrieb“. Andererseits kann auch nicht die Hegelsche Fassung gemeint sein, denn die Bildung eines Werkes gehört dort zum subjektiven Geist, der seine Möglichkeit, sein An-sich, im Werk zu verwirklichen sucht und sich als „gehemmter Begierde“ seiner selbst bewusst 4 wird, während der objektive Geist des Rechts und der Sittlichkeit, Bildung, Moralität und Religion die Verbindlichkeit und Gültigkeit jener Freiheitsäußerung regelt und damit garantiert, also die in der subjektiven Freiheit angelegte Notwendigkeit im Unterschied zur subjektiven Willkür verwirklicht. In keinem Falle wäre also in idealistischer Perspektive ein Kunstwerk per se als „objektiver Geist“ zu interpretieren, allenfalls, wenn man ihm in normativer Absicht klassischen Status einräumte. Das ist aber hier nicht gemeint. Sinn erhält jenes Zitat nur, wenn man es auf dem Hintergrund liest, den Dahlhaus wohl im Auge hatte, und den ich hier ausbreiten will: der postidealistischen Problematik, dass Werke unter dem Anspruch stehen, objektiver Ausdruck eines subjektiven Lebens zu sein, das auf diese Weise sich auf den Weg „von sich selbst zu sich selbst“ begebe5 als Weg der Kultivierung, wie ihn Georg Simmel charakterisiert.6 Dabei jedoch müsse die „subjektivseelische Energie eine objektive, von dem schöpferischen Lebensprozeß fürderhin unabhängige Gestalt gewinnen“7 und zur Hervorbringung dieser Gestalt sich den Sachgesetzlichkeiten der Mittel unterwerfen. In diesem Kontext spricht Ernst Cassirer ebenfalls davon, dass subjektiver Geist und objektiver Geist „auseinander“ fielen und attestiert Simmel, dass er dies scharfsinnig analysiert habe.8 Jenes Thema der sogenannten „Tragödie der Kultur“ schien Dahlhaus im Auge zu haben, als er das unzureichende einer idealistischen Lösung (als Negieren jener Tragödie) erwähnt. Verweilen wir noch einen Moment bei dieser Kontroverse selbst, bevor wir uns dem Dahlhaus’schen Lösungsansatz zuwenden. 1. Georg Simmel: Objektivierung des Geistes Dahlhaus hatte in seiner Rezension zu Kurt Blaukopfs „Musik im Wandel der Gesellschaft“ hervorgehoben, dass dieser – neben anderem – auch und gerade Georg Simmel berücksichtigt habe.9 Mit Blick auf die neuzeitliche geschlossene Konzeption des Kunstwerks hatte Blaukopf bereits in seiner „Musiksoziologie“ bemerkt, dass die „rahmenlose“ Kunst im 3 Jean Paul, Titan, in: Werke, hrsg. von Norbert Miller, München: Carl Hanser, 1961, Bd. 3, S. 767. 4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, hrsg. von Johannes Hoffmeister, Hamburg: Meiner, 1957, S. 147. 5 Georg Simmel, Der Begriff und die Tragödie der Kultur, in: Georg Simmel Gesamtausgabe (= GSG), Bd. 14, hrsg. von Rüdiger Kramme und Otthein Rammstedt, , Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1996, S. 385, 388, 405. 6 Georg Simmel, Vom Wesen der Kultur, in: GSG, hrsg. von Alessandro Cavalli u.a., Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993, Bd. 8, S. 365. 7 GSG, Bd. 14, S. 405. 8 Ernst Cassirer, Die Tragödie der Kultur, in: Zur Logik der Kulturwissenschaften, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 61994, S. 105 ff. 9 2 CDGS, Bd. 9, S. 401. Kapitalismus keinen Platz habe: „Die Gesellschaft der Neuzeit verlangt jene Distanzierung von Kunstkonsumenten und Kunstproduzenten, die dann dinglich in der Distanz zwischen Bild und Beschauer, Konzert und Publikum zur Ausdruck kommt“. Und Blaukopf zitiert dann aus Simmels „Philosophie der Kunst“ von 1922: „Was der Rahmen dem Kunstwerk leistet, ist, daß er diese Doppelfunktion seiner Grenze symbolisiert und verstärkt. Er schließt alle Umgebung und also auch den Betrachter vom Kunstwerk aus und hilft dadurch, es in die Distanz zu stellen“.10 Seinen Grund hat dies im allgemeinen Prinzip der Kultur, dem das Kunstwerk als apotheotische Lösung erscheinen muss: „Mit der Vergegenständlichung des Geistes ist die Form gewonnen, die ein Konservieren und Aufhäufen der Bewußtseinsarbeit gestattet“.11 Es entstehen dabei „Gebilde des in der geschichtlichen Gattungsarbeit objektivierten Geistes“.12 Genau dies machte aber für Simmel das Problem aus. Dessen Formulierung vom objektivierten Geist nimmt Dahlhaus an vielen Stellen auf, und wir werden sehen, dass er den Unterschied eines objektivierten Geistes von einem objektiven Geist, den Simmel nicht ausarbeitet, zum eigenen Ansatzpunkt nimmt. (Die Verflachung dieses Unterschieds bei Simmel verdankt sich seiner Hegel-Rezeption, die über die Völkerpsychologie lief und für differenzierte Darstellungen keinen Raum ließ.) Nach Simmel nun gewinnen jene objektiven Gebilde eine problematische „Autonomie“, da sie einzig der „immanenten Logik“13 eines objektiven sogenannten „Sachzwangs“ gehorchen. Das gelte sowohl für die Kunst wie für die Wissenschaft oder für die Wirtschaft, da die Auswahl der jeweiligen Mittel zu einer zweckdienlichen Herstellung und einer einträglichen Verwertung den Bedingungen der Systeme unterlägen. Die objektive Kultur gewänne die Oberhand über die subjektive, und zwar zwangläufig, insofern als Tragödie, da die unter dem Ideal der Kultivierung nötige „Re-Subjektivierung“14 der Gebilde misslinge – ihre Autoren erkennen sich nicht mehr in den Werken – und eine „Entfremdung der Subjekte von sich selbst“ stattfände. Mit der Zerstörung der Subjektivität vollziehe sich ein Schicksal, das im Subjekt selbst angelegt und sozusagen die logische Entwicklung eben der Struktur ist, „mit der das Wesen seine eigene Positivität aufgebaut hat“.15 Das sei der „Selbstwiderspruch der Kultur“, allerdings unter einer Bedingung, die Hegel bereits verworfen hatte: Dieser hatte nämlich betont, dass, wer in seinen Werken sich erkennen wolle, sich bereits selbst „verloren“ habe.16 (Und Hegel verwirft entsprechend das christliche Diktum, dass man „sie an ihren Früchten erkennen“ könne.) Denn das Tun selbst erkennt man nicht an den Werken, weil diese ein „Auch von Eigenschaften“ aufweisen, das für Hegel explizit die Definition von „Medium“ ist, welches in seinen Eigenschaften sich in den Werken fortschreibt.17 Soweit war Simmel freilich nicht gekommen. Entsprechend erscheinen ihm die Formen der Kulturgebilde als „starre Gehäuse“18, eine Formulierung, die bei Max Weber in dessen Charakterisierung des 10 11 12 13 14 15 16 Kurt Blaukopf, Musiksoziologie, Niederteufen (CH): Arthur Niggli, 21972, S. 91. Georg Simmel, GSG, Bd. 14, S. 392. Bd. 14, S. 417. Ebd., S. 403. Ebd., S. 408. Ebd., S. 411, 414. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 289. 17 Ebd., S. 91. Das Thema „Medialität“ und „Spur“ fährt, wie wir im Abschn. 3.2 sehen werden, bei Carl Dahlhaus eine gegenüber der geläufigen Diskussion charakteristische (Um-)Wendung. 18 GSG, Bd. 16., hrgs. von Gregor Fitzi und Otthein Rammstedt, Frankfurt/M: Suhrkamp, 1999, S. 183. 3 Kapitalismus als „stahlhartem Gehäuse“ wiederkehrt19 und ebenfalls von Ernst Cassirer aufgenommen wird als „harte Schale“, zu der die Kunstprodukte würden, eine Schale, die „sich immer dichter um sie herumlegt und sich immer weniger sprengen lässt“.20 Die Lösung, die Simmel anbietet und die Cassirers Kritik finden wird, ist diese: Das Subjekt könne seine unverstellte Authentizität, die es in den Werken verloren habe, nur in einem „Angriff auf das Prinzip der Form“ wieder erlangen, als „Immunreaktion auf die Pathologie der [objektiven] Kultur“.21 Simmel differenziert dabei explizit nicht zwischen Formen und Werken; sofern letztere eine „Geschlossenheit in sich selbst und einen Anspruch auf Dauer, ja auf Zeitlosigkeit tragen, so sind sie Formen, in die dieses Leben sich kleidet, als die notwendige Art, ohne die es nicht in die Erscheinung treten, ohne die es nicht geistiges Leben sein kann“.22 Das „ruhelos weiterströmende Leben“ vermag sich nur in jenem Angriff auf die Form zu äußern, und die Apotheose dieses Angriffs – man hört Ernst Jünger – sei der Krieg. Dort versinke der „ganze Apparat der Kultur“23 und der Mensch trete wieder in ein lebendiges Verhältnis zu den Mitteln, die er nutzt, Mitteln, die nun in einer ursprünglichen, existenziellen, quasi archaischen Situation wieder „authentisch“ einsetzbar würden. Bezogen auf die Kunst klingt hier die naive Variante einer Destruktion der Werke an, wie sie unüberbietbar in der ersten Phase des Teufelsgespräches von Thomas Manns Doktor Faustus Erwähnung findet: Wo die Kunst, bloß noch „eine Wallfahrt auf Erbsen, die Lahm- und Schüchternheit, die keuschen Skrupel und Zweifel zum Teufel gehen“ lassen muss und „nicht mehr das Klassische“, sondern „das Archaische, das Urfrühe, das längst nicht mehr Erprobte“ erfahren lasse, die urtümliche Begeisterung, die sich nicht mehr mit einer Dialektik von Freiheit und Konstruktion herumschlagen müsse.24 Denn in dieser Phase des Gespräches tritt der Teufel nicht, wie später, als Adorno auf, sondern als Zuhälter, der performativ klar macht, dass sein Appell an das Ursprüngliche, Strömende, Triebhafte und Archaische nichts weiter ist als ein Element der Kulturindustrie, die er managt. 2. Ernst Cassirer: Die „potentielle Energie“ des Werkes Gegen jenen naiven Ansatz einer Kritik am Werkbegriff und seine ebenso naive Alternative richtet sich die Kritik Ernst Cassirers, den Dahlhaus – nebenbei bemerkt – allerdings nur dort explizit geltend macht, wo er gegen falsche und unhistorische Ontologisierungen dessen Konzept der Funktionsbegriffe gegen die Substanzbegriffe ausspielt. Allerdings finden sich in der hiesigen Argumentation Cassirers gegen Simmel derart offenkundig Argumentationslinien, die Dahlhaus später weiterführt und modifiziert, dass mit guten Gründen unterstellt werden kann, dass hier eine wesentliche Wurzel der Dahlhaus’schen Konzeption des Kunstwerks liegt. Cassirer monierte an Simmel, dass dessen Sichtweise einseitig auf das schaffende Individuum fokussiert sei. Ausschließlich vom Standpunkt des Individuums entstehe die Enttäuschung, die der „Künstler, der Forscher, der Religionsstifter“ verspürt, nämlich dass „das fertige Werk […], so bald es einmal vor ihnen steht […], hinter 19 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1988, S. 205 f. 20 21 22 23 24 4 Cassirer, Tragödie der Kultur, S. 105. GSG, Bd. 16, S. 185 [Erg. C.H.]. Ebd., S. 183 f. Ebd., S. 40. Thomas Mann, Doktor Faustus, Frankfurt/M.: Fischer, 1967, S. 239. der ursprünglichen Intuition, aus der es stammt“, zurücksteht und die „begrenzte Wirklichkeit, in der es dasteht […] der Fülle der Möglichkeiten, die diese Intuition ideell in sich barg“, widerspreche. Aus der Perspektive des „Aufnehmenden“, des Rezipienten dagegen befinde sich anstelle jenes „Ungenügens“, das der Künstler seinem Werk gegenüber empfinde, der „Eindruck einer unerschöpflichen Fülle“. Dies initiiere einen lebendigen Prozess, in dem Produktion und Rezeption, schaffendes Ich und aufnehmendes Du in einer dynamischen Wechselwirkung aufeinander bezogen seien.25 Das aufnehmende Du sei nämlich gerade nicht in ein Geschehen „bloßer Rezeption“ eingebunden, sondern zeichne sich auch und gerade durch „Spontanität“ aus, durch aktives Gestalten. Dadurch entfalte sich eine „historische Dialektik“ der Kulturentwicklung, die „durchaus keinen Widerspruch in sich“ berge, sondern als „ständiger Wechsel von Bindung und Lösung“ verlaufe. Kultur sei, so gesehen, eine beständige Transformation. Die geschichtlich verfestigten Formen würden so immer neu aktualisiert; sie seien keine „trägen Massen“, die der kulturelle Produktionsvorgang hinterlasse, sondern seien eine „Zusammenballung gewaltiger potentieller Energien“, die „nur auf den Augenblick harren, in welchem sie wieder hervortreten und sich in neuen Wirkungen bekunden sollen“.26 Damit nahm Cassirer den zentralen Topos der Rezeptionsästhetik vorweg, die – in den Werken von Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser – die „Repotentialisierung“ als Merkmal des Rezeptionsaktes herausstellte.27 Die Iteration unterschiedlicher Rezeptionsakte sollte diesen Effekt zeitigen, als Erschließung bzw. Wiedererschließung von Möglichkeiten, wie sie Schleiermacher und Dilthey als Ziel des Verstehens erachteten,28 für das das Verstehen des Autors ein Mittel, nicht der Zweck ist – wie Schleiermacher, entgegen der Auffassung unserer Deutschlehrer, betonte.29 Die Kulturentwicklung erscheint dabei als Pendelbewegung zwischen objektivierender Verfestigung und subjektivierender Dynamisierung; der Gegensatz von „Formkonstanz“ und „Modifizierbarkeit der Form“ ist eben nicht ein unauflösbarer Gegensatz von zwei Wirklichkeiten, sondern ein Gegensatz von einer Wirklichkeit und einer Möglichkeit (als Modifizierbarkeit), die dieser Wirklichkeit bedarf, einer Wirklichkeit, die die Möglichkeit als Möglichkeit negiert („dialektischer Widerspruch“). Es handelt sich, so Cassirer fast wieder hegelianisch, um zwei „Momente“,30 deren Spannung dafür maßgeblich sei, dass die Kulturentwicklung nicht zwangsläufig zur Tragödie eskaliert, sondern den Charakter eines Dramas mit immer währenden Krisen und ihrer punktuellen Auflösung aufweise. Zum Kern dieser Dialektik ist allerdings Cassirer nicht vorgedrungen, wenngleich er mit seiner Formulierung von zwei „Momenten“ diesem schon sehr nahe ist. Er arbeitet nämlich jenes Modalverhältnis, welches für jede strenge Dialektik charakteristisch ist, nicht weiter aus. . 25 26 Cassirer, Tragödie der Kultur, S. 110 ff. Ebd., S. 112 f. 27 Vgl. hierzu: Christoph Hubig, Rezeption und Interpretation als Handlungen. Zum Verhältnis von Rezeptionsästhetik und Hermeneutik, in: Rezeptionsästhetik und Rezeptionsgeschichte in der Musikwissenschaft, hrsg. von Hermann Danuser und Friedhelm Krummacher, Laaber: Laaber Verlag, 1991, S. 37-56. 28 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, hrsg. von Manfred Frank, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977, S. 340; Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften ( GS VIII) , hrsg. von Bernhard Groethuysen, Stuttgart: Teubner, 1958, S. 215. 29 30 Schleiermacher, Hermeneutik, S. 328, 235. Cassirer, Tragödie der Kultur, S. 122. 5 3. Carl Dahlhaus Hören wir dazu nun Carl Dahlhaus, zunächst in der für ihn typischen vorsichtigen Art: „Die Diskussion über den Werkbegriff, oder genauer: über das Verhältnis zwischen dem Werk als objektivierter Arbeit und den Kategorien „Kommunikation“ und „Interaktion“, die zu Schlagworten zur Polemik gegen den Werkbegriff geworden sind, ist jedoch seltsam vertrackt […]. Kommunikation braucht offenbar, um substantiell zu sein, ein Objekt, das die Interaktion zwischen den Subjekten, die Kommunikation suchen, vermittelt; und durch gemeinsame Konzentration auf eine Sache, und zwar eine Sache, die die Anstrengung lohnt, ist eine Intersubjektivität, die dann auch dem Subjekt als Person und nicht als bloßem Funktionsträger gerecht wird, eher erreichbar als durch die Bemühung, sie in objektloser Unmittelbarkeit herzustellen. Sie aber erfüllt den Sinn, als vermittelnde Instanz zu dienen, umso genauer, je weniger sie sich darauf einläßt, um des Zwecks Willen ihre internen Ansprüche zu lockern oder gar zu suspendieren: pädagogische Anpassung richtet immer auch pädagogisch, nicht allein sachlich, Schaden 31 an“. Das Werk zur einzigen Instanz einer adäquaten Rezeption zu erklären, berge die Gefahr, dass der Text als toter Buchstabe des Werkes zum Anlass subjektiver Projektionen würde, die sich als objektivierter Geist des Werkes missverständen. Diese Gefahr sei nicht gering angesichts der Tatsache, dass „ästhetische Wahrnehmung, so unbefangen sie sich dünkt, in einer kaum kontrollierbaren Form immer schon vorstrukturiert“32 ist. Das Dialogmodell einer Schleiermacherschen Hermeneutik lässt immerhin „die Chance offen, dass die Momente, die der Rezipierende von sich aus mitbringt, mit jenen, die ihm aus dem Werk entgegentreten, in eine Wechselwirkung gebracht werden“. […] „Geht man […] davon aus, daß ein nicht-entfremdeter Werkbegriff, der die Möglichkeit einer Rezeption nach dem Dialogmodell offen läßt, und ein konkreter Kommunikationsbegriff, der die Fallstricke der Abstraktion vermeidet und die Notwendigkeit einer Vermittlung von Interaktion durch eine gemeinsame Sache prinzipiell gelten läßt, sich nicht ausschließen, sondern ergänzen“, so soll damit das „Verhältnis zwischen der restituierten Werk- und der dennoch nicht preisgegebenen Kommunikationsidee“ umschrieben sein.33 Was ist aber nun jene „gemeinsame Sache“, die eine Interaktion „vermittelt“ als „Wechselwirkung“ zwischen Momenten des Rezipierenden und Momenten des Werkes? Das Werk selber kann es ja nicht sein, denn es ist ja Moment dieser Wechselwirkung. Im Vorgriff sei Dahlhaus’ Lösung angekündigt: Es ist das, was er schlicht als „Objekt“ bezeichnet, genauer: „objektivierte Arbeit“, während er für den Werkbegriff den Begriff des „intentionalen Gegenstandes“ vorhält. Auf diese Weise will er der Alternative vorbeugen, dass Kunst entweder nur noch als bloße Praxis begriffen bzw. in Praxis aufgelöst wird, oder ein emphatischer Werkbegriff unter einem überkommenen Konzept der Poiesis als obsoleter Träger des Scheins von Vollkommenheit und Abgeschlossenheit erachtet wird. 3.1 Werk als intentionaler Gegenstand Mit seiner Formulierung vom „nicht-entfremdeten Werkbegriff“ markiert Dahlhaus das Gegenkonzept zum Werkbegriff Simmels, und mit der Rede von einer durch die gemeinsame Sache vermittelten Interaktion knüpft er an Cassirer an. Wie ist aber dann der Status des Werkes zu begreifen? Wiederholt greift Dahlhaus auf die Benjaminsche Formulierung von der „höchsten Wirklichkeit der Kunst“ im „isolierten, geschlossenen Werk“ zurück.34 31 Dahlhaus, Abkehr vom Materialdenken, in: CDGS, Bd. 8, S. 492 f. 32 Ebd., S. 494. 33 .Ebd. 34 Dahlhaus, Musik als Text und Werk, in: CDGS, Bd. 1, S. 457; ders., Ästhetik und Musikästhetik, in:CDGS, Bd. 1, S. 599; vgl. auch ders., Der Versuch einen faulen Frieden zu stören, in: CDGS, Bd. 1, S. 210. 6 Angesichts der Zeitstruktur der Musik, die Zeit sowohl „pointiert“ als auch als „tönende Architektur“ aufhebt, ist ein Werk weder einseitig eine sich geschichtlich verändernde „Substanz“, deren Gehalt in der Interpretations- und Rezeptionsgeschichte hervorgetrieben oder destruiert wird, noch ein für alle Mal feststehender „idealer Gegenstand“.35 Seine sogenannte Abgeschlossenheit ist vielmehr diejenige eines „intentionalen Gegenstandes“,36 der sich weder im Text, noch im akustischen Substrat der Interpretation noch in der subjektiven Reaktion des einzelnen Hörers erschöpfe.37 Mit der Aufnahme der phänomenologischen Kategorie des intentionalen Gegenstandes eröffnet sich Dahlhaus einen neuen Raum, innerhalb dessen er Cassirers Andeutungen konkretisieren und zugleich die Diskussion über ihre rein phänomenologische Version hinaus weiterführen kann. Mit „intentionalem Gegenstand“ ist eben gemeint, dass nicht zwei Sachen, nämlich der Gegenstand eines intentionalen Bezugs und dieser intentionale Bezug selbst voneinander zu scheiden wären (was Edmund Husserl an Franz von Brentano kritisiert hatte), sondern es ist die einheitliche Präsenz eines Erlebnisses gemeint, welches den Charakter einer Intention hat. Diese ist geprägt durch Erwartung (Protention) und Erinnerung (Retention), welche den Horizont ausmachen, in dem das Erlebnis seine Spezifik erhält. Dieser Horizont ist nicht der eines allein gelassenen Subjekts, sondern seinerseits eingebettet, wie der späte Husserl herausgearbeitet hat, in den „Horizont von Horizonten“, die Lebenswelt“.38 Für Carl Dahlhaus ist diese freilich zu recht eine historische. Doch zunächst zurück zum intentionalen Gegenstand: Mit Dahlhaus’ Worten wird die Zeit in der Musik „pointiert“ durch ihren teleologischen Zug, die Suche und die Erwartung nach einer Fortsetzung – „Protention“; „aufgehoben“ wird die Zeit dadurch, „daß nicht jeder Augenblick den gerade vergangenen auslöscht, sondern der Hörer sich zunächst die Abschnitte und zuletzt das gesamte Werk als ein ‚Ganzes’ zu vergegenwärtigen vermag“ – Husserls „Retention“. Die Benjaminsche „Abgeschlossenheit“ ist also eine intentionale. Sie konkurriert daher keineswegs mit der Herderschen Charakterisierung der Musik als energeia, explizit nicht derjenigen als „ergon“.39 „Die Identität [des Kunstwerks], die nicht als Unveränderlichkeit mißverstanden werden darf, ist als ‚Intention’ bestimmbar“.40 Doch welche Intention und wessen Intention? An dieser Stelle hat Dahlhaus einen Raum der Reflexion erschlossen, der weit über das Husserlsche Konzept des intentionalen Gegenstandes hinausweist und die historische Dimension mit einzubeziehen vermag. Zwar zitiert er wiederholt Roman Ingarden, über den er Husserl rezipiert hat, mit dessen Unterscheidung zwischen dem Kunstwerk und dem ästhetischen intentionalen Gegenstand. Die Ausführung dieser Unterscheidung bei Ingarden ist aber höchst unbefriedigend und inkonsistent. So verweist Ingarden einerseits darauf, dass das Kunstwerk als schematisches Gebilde viele Unbestimmtheitsstellen enthält, deren Aktualisierung und Bestimmung den Übergang vom Kunstwerk zum ästhetischen Gegenstand vollziehe.41 Daher dürfe die sogenannte Wertantwort der Rezeption die dem ästhetischen 35 36 37 Dahlhaus, Ästhetik und Musikästhetik, in: CDGS, Bd. 1, S. 601. Ebd. Ebd. S. 602. 38 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, hrsg. von Walter Biemel (Husserliana, Bd. VI), Haag: Marinus Nijhoff, 1954, S. 163. f. 39 40 41 Dahlhaus, Musik als Text und Werk, in: CDGS, Bd. 1, S. 455. Dahlhaus, Das musikalische Kunstwerk als Gegenstand der Soziologie, in: CDGS, Bd. 1, S. 364 [Erg. C.H.]. Roman Ingarden, Erlebnis, Kunstwerk und Welt, Tübingen: Max Niemeyer, 1969, S. 20. 7 Gegenstand anhaftenden Werte nicht dem Kunstwerk selbst zuschreiben. Andererseits fordert er, dass eine „getreue“ Konkretisation die dem Kunstwerk zukommenden eindeutigen und aktuellen Bestimmtheiten enthalten müsse.42 Im anderen Fall hafte dem ästhetischen Gegenstand ein „Unwert“ an.43 Dahlhaus argumentiert hier differenzierter: Zum einen müssten Eigenschaften des Werkes im historischen Kontext identifiziert werden – hierauf werden wir später noch näher eingehen. Es spiele hier eine Rolle, wie sich die Form zur Struktur verhalte, wobei die „flüchtigste historische Reflexion“ genüge, um zu erkennen, dass hier für die alte wie für die neue Musik, im Unterschied zum Formkonzept der großen klassischen Werke, andere Verhältnisse bestanden.44 Entscheidende historische Unterschiede sind hier gegeben, die sich auf den Status der Intention des Komponisten, des Interpreten und des Hörers beziehen. Diese Unterschiede begreift Dahlhaus mit Max Weber als Idealtypen, als ideale Handlungsschemata, deren Sinn in unterschiedlichen Wertideen fundiert ist. So verweist er darauf, dass auch für neue Musik mit ihren offenen Formen gelte, dass sie sich in die europäische Musikgeschichte fortschreitender Objektivierung eingliedere. „Gerade Stücke, deren Teile austauschbar sind und sich einerseits schroff, durch jähe Generalpausen oder Kontraste, voneinander abheben und andererseits entwicklungslos in sich selbst zu kreisen scheinen, werden in besonderem Maße gegenständlich wahrgenommen“.45 Und weiter: „Von der Wahl zwischen dem Gesichtspunkt des Komponisten und dem des Hörers aber ist es abhängig, ob die Kategorie des Kunstwerks noch eine Funktion erfüllt oder zur Bedeutungslosigkeit schrumpft. […] Der Zerfall der geschlossenen Formen in offene, die Betonung des Musik-Machens […]: alle die Momente, die zur Aushöhlung des Werkbegriffes führen, sind nur unter dem Gesichtspunkt des Komponisten verständlich. Für den Hörer ist gerade umgekehrt der Entstehungsvorgang, die Genesis eines Werkes, im Resultat aufgehoben; er begreift Musik als Gebilde, das zu überdauern vermag; und eine offene, variable Form erscheint ihm als geschlossene und feste, weil er unfähig ist, die Version, die er gerade hört, auf mögliche andere zu beziehen, die der Interpret hätte wählen können, aber nicht gewählt hat. Dem Werk als Werk die 46 Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die der Komponist ihm vorenthält, ist Sache des Hörers“. Erst durch eine Objektivierung, die über eine Realisierung als bloßer Vorgang und Vollzug hinausgehe, erhalte Musik Werkcharakter. Diese Objektivierung dürfe nicht umstandslos als Verdinglichung oder Entfremdung begriffen und verdächtigt werden. Bedeutende Interpretationen würden, indem sie ein Werk gleichsam nachkomponieren und ihm gerade dadurch als Werk gerecht werden, seine Erstarrung zu einem Text aufheben.47 Das Nachkomponieren in der Interpretation verhalte sich aber zur Intention des Komponisten, und analog verhalt sich die Intention des Hörers zu derjenigen der Interpretation. Im ästhetischen intentionalen Gegenstand sind also drei Intentionen einschließlich ihrer Retentionen/Erinnerungen und Protentionen/Erwartungen miteinander vermittelt. Diese Vermittlung könnte nun – folgen wir einmal Roman Ingarden – adäquat oder nichtadäquat sein. Was heißt aber adäquat? Abwegig wäre es, die bereits erwähnte alte hermeneutische Idee, dass der Nachvollzug der Autorenintention nur ein Mittel, nicht ein Ziel der Interpretation ist, als Freibrief für eine 42 43 44 Ebd., S. 24. Ebd. Dahlhaus, Über offene und latente Traditionen in der neuesten Musik, in: CDGS, Bd. 8, S. 120 f. 45 Dahlhaus, Plädoyer für eine romantische Kategorie. Der Begriff des Kunstwerks in der neuesten Musik, in: CDGS, Bd. 8, S. 219. 46 47 8 Ebd., S. 224. Dahlhaus, Über den Zerfall des musikalischen Werkbegriffs, in: CDGS, Bd. 8, S. 236. Interpretation zu verstehen, die die Rezeption der Willkürherrschaft des Rezipienten unterstellt. Vielmehr soll sie die „Totalität des Möglichen“ (Schleiermacher) wieder erschließen, die „in der Wirklichkeit verlorenen Möglichkeiten wieder zugänglich macht“ (Dilthey, s.o.), die „Repotentialisierung“ (Jauß, Iser) realisiert. Für eine freigesetzte Rezeption dagegen, genauso wie für eine völlig freigestellte Improvisation, gelte vielmehr, so Dahlhaus, dass, je schwächer der Zusammenhang zu einer Werkstruktur oder einer Werkform ausgeprägt ist, umso geringer die Chance sei, Neues zu erfahren; „denn Neuheit ist weniger eine Qualität des Momentanen als des Kontextes, in dem es steht“.48 Damit wäre die erstrebte Wiedererschließung von neuen Möglichkeiten als Ziel des Verstehens eben gerade vertan. Was ist aber dieser Kontext, der Berücksichtigung finden muss? 3.2 Carl Dahlhaus’ Dialektik Der platte Verweis auf den historischen Kontext genügt hier nicht, weil dessen Validität ja gerade in Frage steht. Die Dahlhaus’sche nun wahrhaft dialektische Sicht dieses Kontextes wird meines Erachtens am besten ersichtlich in seiner Auseinandersetzung mit Adornos Konzept des musikalischen Materials. Dessen Satz, dass das Material „sedimentierter Geist sei“, legt den Akzent auf die musikalischen Mittel statt auf das Resultat, die Werke. Als Träger des „objektivierten“ Geistes erscheinen weniger „die musikalischen Gebilde, als der Stoff, aus dem sie geformt sind, und die Technik, mit der sie realisiert wurden“, so Dahlhaus’ Einschätzung des Adornoschen Konzepts.49 Die spezifischen Züge des Materials sind nach Adorno „Male des geschichtlichen Prozesses. Sie führen die historische Notwendigkeit umso vollkommener mit sich, je weniger sie mehr unmittelbar als historische Charaktere lesbar sind […]. Als ihrer selbst vergessene vormalige Subjektivität hat solcher objektiver Geist des Materials seine eigenen Bewegungsgesetze“.50 Das hätte auch Simmel schreiben können. Nebenbei bemerkt: Auf solche Bewegungsgesetze hebt auch ein ganz anderer ab, der das Aufgabenlösen in der Komposition mit mathematischen Problemen und ihrer Lösung vergleicht, mit Ableitungen und Projektionen unter bestimmten Regeln,und entsprechenden Fehlern in musikalischen Abfolgen sinnhafter Elemente, wie das auch für mathematische Argumente gelte. Entsprechend könnte man auch Fehler in den Themen selbst suchen, so Ludwig Wittgenstein, der solche Argumente gegen Mahlers Symphonien vorbringt.51 Das zeigt, so belustigend dieser Hinweis sein mag, dass man über entsprechende Bewegungsgesetze durchaus streiten kann. Ein Klassizismus oder ein Neoklassizismus lässt sich eben nicht so einfach wie im Teufelsgespräch des Doktor Faustus mit der Bemerkung abqualifizieren, dass er das Langweilige wieder interessant mache, weil das Interessante langweilig geworden sei. An dieser Stelle bietet Dahlhaus ein Gegen-Konzept, welches wie alle großen Konzepte in seiner Selbstverständlichkeit überraschen mag, dessen Nicht-Selbstverständlichkeit jedoch gerade im Blick auf die aktuellen Diskussionen zur Medialität der Kunst offenkundig ist: Er verweist lapidar darauf, dass „der Stand des Materials, Adornos ästhetischkompositionstechnische Berufungsinstanz, nichts anderes [ist] als der Inbegriff der Spuren früherer Werke in den Zusammenhängen, in denen sich das musikalische Denken eines 48 49 Ebd., S. 235. Dahlhaus, Adornos Begriff des musikalischen Materials, in: CDGS, Bd. 8, S. 278. 50 Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, in: Gesammelte Schriften, Bd. 7, hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1975, S. 38 f. 51 Ludwig, Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen (Werksausgabe, Bd. 8), Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984, S. 544 f. 9 Komponisten bewegt“. Das ist der gesuchte „historische Kontext“. Und weiter: „Die 52 Erfahrung mit Werken bestimmt dann den Charakter des Materials, nicht umgekehrt“. Dies gelte sowohl für den Komponisten als auch für den Interpreten und den Rezipienten. Diese Einsicht ist einer dialektischen Reflexion im strengen Sinne verpflichtet, und sie ist konträr zu den geläufigen medientheoretischen Ansätzen. Dialektisch ist sie insofern, als das Anliegen dialektischer Theorie darin liegt, aufzuweisen, wie eine reale Möglichkeit durch ihre notwendigerweise einseitige Verwirklichung negiert wird und damit auch andere Verwirklichungsoptionen negiert, und inwieweit eine Reflexion diesen dialektischen Widerspruch (der mit einem logischen nichts zu tun hat) aufhebt, indem sie ihn als Widerspruch aufweist, und die wiedererschlossene Möglichkeit zu einem neuen Thema eines theoretischen und praktischen Umgangs macht. In Dahlhaus’ Formulierung: dass in der Rede von einer „Tendenz“ des musikalischen Materials als Inbegriff der kompositionstechnischen Mittel manifestierte Vergessen ihrer ursprünglichen objektivierten Intentionen und der dadurch eingetretenen Entfremdung sei durch historische Reflexion aufzuheben, mithin das Insgeheime des „insgeheim gesellschaftlichen“ Geistes des Materials.53 Entsprechend verwahrt sich Dahlhaus gegenüber der Unterscheidung zwischen „dialektischen“ und gleichsam „toten Widersprüchen“ in der Entwicklung der kompositorischen Technik54 nach Maßgabe der Wirkung, die bestimmte Werke zeitigen. Er verwahrt sich gegenüber klassifizierenden Begriffen, wie sie auch Adorno in kunstrichterlicher Absicht einsetzt. Vielmehr fordert er den Einsatz „dialektischer Kategorien“,55 die geschichtliche Entwicklungen differenzierter rekonstruieren: indem sie Eigenschaften des musikalischen Materials und der Kompositionstechniken mit Blick auf die Spuren früherer Werke in ihnen untersuchen, also diese Eigenschaften als Resultate von Verwirklichungen und nicht als disponible Möglichkeiten weiteren Vorgehens erachten. Gerade daraus aber entspringt eine neue Möglichkeit des Verfügenkönnens, die daraus resultiert, dass man sich über das Material zu anderen Werken in einen Bezug setzt und im eigenen Werk mithin mit anderen Werken umgeht.56 Dies gilt nun nicht bloß für den Komponisten, sondern auch für die Interpreten und Rezipienten. Das „Wiedererschließen von Möglichkeiten“ (Dilthey) als Ziel des Verstehens ist nichts anderes als ein sich in Bezug setzen zu anderen Werken. Das hat letztlich zur Konsequenz, dass nicht die Verschiedenheit des Standes eines musikalischen Materials, sondern der Materialbegriff selbst in seiner Verschiedenheit ersichtlich wird,57 und zwar in seiner historisch unterschiedlichen Relation zu anderen Instanzen wie Technik, Sprache und Struktur, die jeweils als Differenz oder Indifferenz erscheint. „Material“ sei daher nicht terminologisch zu untersuchen, seine Definition müsse sich in Geschichtsschreibung auflösen. Je nach den Spuren, die die Werke hinterlassen, verändern sich die Kategorien der Technik, der Sprache, der Struktur, der Form, des Stils etc. Diese Einsicht setzt einen Kontrapunkt zum Mainstream der medientheoretischen Ansätze in der Ästhetik. Denn diese gehen davon aus, dass technische Medien analog zu den natürlichen Medien strukturierte Möglichkeitsräume darstellen, innerhalb derer konkrete Artefakte 52 53 54 55 56 57 10 Dahlhaus, Adornos Begriff des musikalischen Materials, in: CDGS, Bd. 8, S. 279 [Herv. C.H.]. Ebd., S. 281. Ebd. Ebd. Vgl. den Beitrag von Wolfgang Rihm in diesem Band. Dahlhaus, Adornos Begriff des musikalischen Materials, in: CDGS, Bd. 8, S. 283. realisiert werden. In den durch diese Artefakte realisierten Zwecken hinterlassen die Medien ihre Spuren, über die wir die Eigenschaften der Medien genauer kennenlernen, sei es im Zuge unvollständiger Realisierung unserer Zwecke, sei es im Zuge von überraschenden positiven Eigenschaften, mit denen wir konfrontiert werden. Analog zur Verfasstheit des natürlichen Mediums Luft, das in einer konkreten akustischen Kommunikation seine Spuren hinterlässt, führt die mediale Verfasstheit unserer technischen Medien zu Spuren in unseren realisierten Zwecken, die diese Zwecke mitprägen. Wir haben hier also ein klares Gefälle von der Möglichkeit, die die Medien bereitstellen, zu den Werken, die diese Möglichkeiten verwirklichen.58 Die Übertragung dieser Einsicht für den Bereich technischer Welterschließung auf den Bereich künstlerischen Schaffens ist jedoch unzulässig. Denn die Wirkung eines Kunstwerks ist nicht von seiner Deutung zu trennen (was, nebenbei bemerkt, für etliche virulente technische Wirkungen ebenfalls gilt). Die Deutung wiederum ist nicht die des Werkes selbst, sondern eben die des intentionalen ästhetischen Gegenstandes, der mit dieser Deutung zusammenfällt im Horizont von Erinnerung und Erwartung, von Retention und Protention, die von den Erfahrungen und vom Umgang mit bisherigen Werken lebt und von diesem Umgang geprägt ist. Während in der technischen Welterschließung die Medien ihre Spuren in den Werken hinterlassen, hinterlassen in der ästhetischen Erfahrung die Werke ihre Spuren in den Medien. Dieser alten hermeneutischen Einsicht hat Dahlhaus zu neuer Geltung verholfen. Aus genau diesem Grund wehrt sich Dahlhaus gegen einen arbeitsteiligen „faulen Frieden“ zwischen einer Werkästhetik mit ihrem Verfahren immanenter Analyse, einer sozialgeschichtlich fundierten soziologischen Deutung von Werken sowie einer empirisch gefassten Rezeptionsforschung auf psychologischer Basis. Objektivierter Geist dürfe nicht als Inbegriff von „über den Menschen thronender Kunstgebilde“ erachtet werden. Umgekehrt dürfe eine sozialgeschichtlich fundierte Pragmatik nicht einseitig die Situation, in der Werke wahrgenommen werden, bei der Auslegung in den Vordergrund rücken, wobei Werke bloß noch als Dokumente zum Gegenstand bloßer Sachurteile gemacht werden. Schließlich dürfe sich eine Rezeptionsforschung erst recht nicht einzig als Aufweis oder Auflistung der psychischen Erlebnisse sowie der Wahrnehmungsstereotype der Hörer begreifen.59 Unterschiedliche Formen vorgeschlagener „Arbeitsteiligkeit“, auf denen ein „fauler Friede“ zwischen diesen Zugangswegen zu etablieren wäre, scheitern, so etwa die Zuordnung der Trivialmusik oder als Trivialmusik eingesetzter klassischer Werke zu den soziologischen Verfahren, oder der Kunstmusik zu ästhetischer Interpretation und ästhetischer Kontemplation. Denn die soziologischen Verfahren müssten die gesamte Musikkultur im Auge behalten, und die Etikettierung von Trivialmusik setzt ästhetische Analyse und ästhetisches Urteil voraus. Brüchig wird der faule Friede auch mit Blick auf die großen Editionsunternehmungen, wenn es darum geht, Werksummen als Gesamtwerke zu strukturieren und darzustellen. Die Vorstellung eines Gesamtwerks als Lebenswerk ist nämlich ihrerseits eine in historischen Grenzen. Das führt uns zum Abschluss nochmals zu Hegel und zu Dahlhaus’ Dialektik zurück: Wir finden sowohl beim Komponieren mit seinen Techniken, als auch beim Interpretieren oder Nachkomponieren, als auch in der Pragmatik mit ihren sozialhistorischen Zusammenhängen sowie in den Wahrnehmungsstereotypen aller Orten Schranken und Barrieren. Sie als Grenzen herauszuarbeiten, ist bereits Ergebnis 58 Vgl. Christoph Hubig, Die Kunst des Möglichen, Bielefeld: Transcript, 2006, Bd. 1, S. 148-155. 59 Dahlhaus, Der Versuch, einen faulen Frieden zu stören. Der Zufall des musikalischen Werkbegriffes. Die Wissenschaft von der Musik im Spannungsfeld von Ästhetik und Sozialgeschichte, in: CDGS, Bd. I, S. 209-232. 11 historischer Reflexion, denn jede Grenze verweist auf ein Jenseitiges, auf ein AndersMögliches, um dessen Willen wir uns überhaupt mit Kunst beschäftigen.60 60 Vgl. hierzu Grenzen und Grenzüberschreitungen (XIX. Deutscher Kongress für Philosophie), hrsg. von Wolfram Hogrebe, Berlin: Akademie-Verlag, 2004, Kap. 17. 12