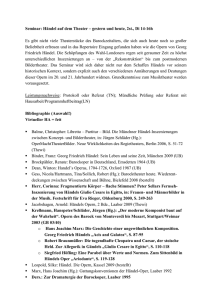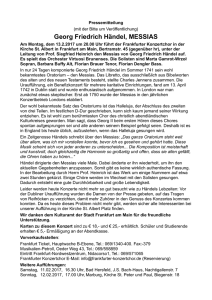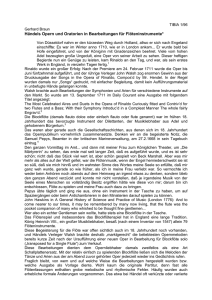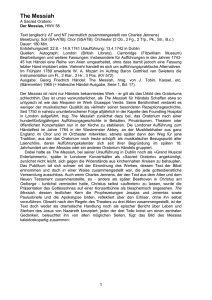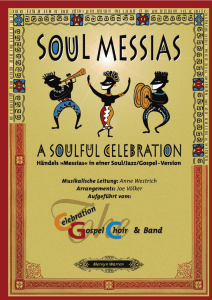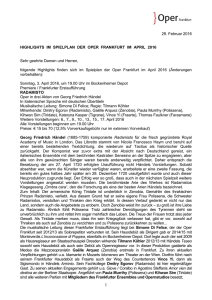Händel, Georg Friedrich
Werbung
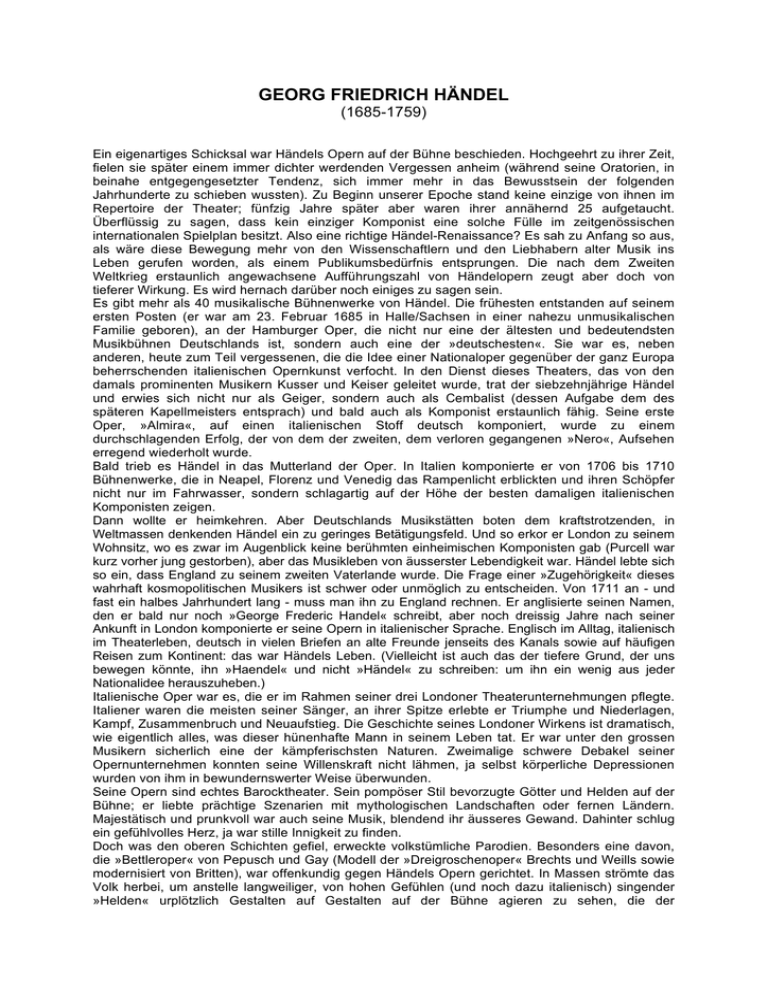
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759) Ein eigenartiges Schicksal war Händels Opern auf der Bühne beschieden. Hochgeehrt zu ihrer Zeit, fielen sie später einem immer dichter werdenden Vergessen anheim (während seine Oratorien, in beinahe entgegengesetzter Tendenz, sich immer mehr in das Bewusstsein der folgenden Jahrhunderte zu schieben wussten). Zu Beginn unserer Epoche stand keine einzige von ihnen im Repertoire der Theater; fünfzig Jahre später aber waren ihrer annähernd 25 aufgetaucht. Überflüssig zu sagen, dass kein einziger Komponist eine solche Fülle im zeitgenössischen internationalen Spielplan besitzt. Also eine richtige Händel-Renaissance? Es sah zu Anfang so aus, als wäre diese Bewegung mehr von den Wissenschaftlern und den Liebhabern alter Musik ins Leben gerufen worden, als einem Publikumsbedürfnis entsprungen. Die nach dem Zweiten Weltkrieg erstaunlich angewachsene Aufführungszahl von Händelopern zeugt aber doch von tieferer Wirkung. Es wird hernach darüber noch einiges zu sagen sein. Es gibt mehr als 40 musikalische Bühnenwerke von Händel. Die frühesten entstanden auf seinem ersten Posten (er war am 23. Februar 1685 in Halle/Sachsen in einer nahezu unmusikalischen Familie geboren), an der Hamburger Oper, die nicht nur eine der ältesten und bedeutendsten Musikbühnen Deutschlands ist, sondern auch eine der »deutschesten«. Sie war es, neben anderen, heute zum Teil vergessenen, die die Idee einer Nationaloper gegenüber der ganz Europa beherrschenden italienischen Opernkunst verfocht. In den Dienst dieses Theaters, das von den damals prominenten Musikern Kusser und Keiser geleitet wurde, trat der siebzehnjährige Händel und erwies sich nicht nur als Geiger, sondern auch als Cembalist (dessen Aufgabe dem des späteren Kapellmeisters entsprach) und bald auch als Komponist erstaunlich fähig. Seine erste Oper, »Almira«, auf einen italienischen Stoff deutsch komponiert, wurde zu einem durchschlagenden Erfolg, der von dem der zweiten, dem verloren gegangenen »Nero«, Aufsehen erregend wiederholt wurde. Bald trieb es Händel in das Mutterland der Oper. In Italien komponierte er von 1706 bis 1710 Bühnenwerke, die in Neapel, Florenz und Venedig das Rampenlicht erblickten und ihren Schöpfer nicht nur im Fahrwasser, sondern schlagartig auf der Höhe der besten damaligen italienischen Komponisten zeigen. Dann wollte er heimkehren. Aber Deutschlands Musikstätten boten dem kraftstrotzenden, in Weltmassen denkenden Händel ein zu geringes Betätigungsfeld. Und so erkor er London zu seinem Wohnsitz, wo es zwar im Augenblick keine berühmten einheimischen Komponisten gab (Purcell war kurz vorher jung gestorben), aber das Musikleben von äusserster Lebendigkeit war. Händel lebte sich so ein, dass England zu seinem zweiten Vaterlande wurde. Die Frage einer »Zugehörigkeit« dieses wahrhaft kosmopolitischen Musikers ist schwer oder unmöglich zu entscheiden. Von 1711 an - und fast ein halbes Jahrhundert lang - muss man ihn zu England rechnen. Er anglisierte seinen Namen, den er bald nur noch »George Frederic Handel« schreibt, aber noch dreissig Jahre nach seiner Ankunft in London komponierte er seine Opern in italienischer Sprache. Englisch im Alltag, italienisch im Theaterleben, deutsch in vielen Briefen an alte Freunde jenseits des Kanals sowie auf häufigen Reisen zum Kontinent: das war Händels Leben. (Vielleicht ist auch das der tiefere Grund, der uns bewegen könnte, ihn »Haendel« und nicht »Händel« zu schreiben: um ihn ein wenig aus jeder Nationalidee herauszuheben.) Italienische Oper war es, die er im Rahmen seiner drei Londoner Theaterunternehmungen pflegte. Italiener waren die meisten seiner Sänger, an ihrer Spitze erlebte er Triumphe und Niederlagen, Kampf, Zusammenbruch und Neuaufstieg. Die Geschichte seines Londoner Wirkens ist dramatisch, wie eigentlich alles, was dieser hünenhafte Mann in seinem Leben tat. Er war unter den grossen Musikern sicherlich eine der kämpferischsten Naturen. Zweimalige schwere Debakel seiner Opernunternehmen konnten seine Willenskraft nicht lähmen, ja selbst körperliche Depressionen wurden von ihm in bewundernswerter Weise überwunden. Seine Opern sind echtes Barocktheater. Sein pompöser Stil bevorzugte Götter und Helden auf der Bühne; er liebte prächtige Szenarien mit mythologischen Landschaften oder fernen Ländern. Majestätisch und prunkvoll war auch seine Musik, blendend ihr äusseres Gewand. Dahinter schlug ein gefühlvolles Herz, ja war stille Innigkeit zu finden. Doch was den oberen Schichten gefiel, erweckte volkstümliche Parodien. Besonders eine davon, die »Bettleroper« von Pepusch und Gay (Modell der »Dreigroschenoper« Brechts und Weills sowie modernisiert von Britten), war offenkundig gegen Händels Opern gerichtet. In Massen strömte das Volk herbei, um anstelle langweiliger, von hohen Gefühlen (und noch dazu italienisch) singender »Helden« urplötzlich Gestalten auf Gestalten auf der Bühne agieren zu sehen, die der Polizeichronik zu entsteigen schienen und die genau die Sprache sprachen, die ihr Publikum verstand. Da wurden Dinge verhandelt, die sich bei Tag und bei Nacht im gegenwärtigen London (und nicht in des König Xerxes oder Kleopatras Ägypten) abspielten. Und als zuletzt gar »des Königs reitender Bote« erschien, um dem Erzverbrecher ein Vermögen sowie die Erhebung in den erblichen Adelstand anzubieten, da brüllte das Haus vor Lachen, auf Kosten der oberen Klassen, aber auch auf Kosten Händels, dessen Theater - es lag in unmittelbarer Nähe - Bankrott machte. Doch das konnte einen eisenharten Mann wie diesen nicht erschrecken. Mit neuen Kräften stürzte er sich in den Kampf, schuf Oper auf Oper - mehrmals drei oder vier im gleichen Jahr! -, studierte sie ein, dirigierte sie und erlebte neuerlich alle Phasen, die im Theaterleben zwischen Sieg und Niederlage liegen. Doch im Jahre 1741 setzte er selbst und freiwillig einen Schlusspunkt unter sein Opernschaffen. Von nun an widmete er sich ganz dem Oratorium, was zugleich seine Lösung aus der italienischen Kunstwelt und sein endgültiges Aufgehen im Englischen bedeutete. Mit dem »Messias« gelang ihm bekanntlich eines der ewigen Gipfelwerke der Gattung. Stilistisch bedeutete der Wechsel von Oper zu Oratorium in jenem Augenblick viel weniger als zu Ende des gleichen oder gar im 19. Jahrhundert. Im Grunde genommen handelte es sich um sehr eng verwandte Genres, die einen Austausch ohne weiteres zuliessen; und in Barockzeiten war zwar (genau wie heute) die Bühnentechnik hoch entwickelt und gestaltete wahre Wunderdinge von höchster Eindringlichkeit, aber die Oper war doch ein weitgehend »statisches« Kunstwerk, in dem die Szenen weit eher bildhaft als dramatisch dargestellt wurden. Lange und schwierige Arien liessen nur ein Minimum an Bewegung zu. Das »Geschehen« wirkte oftmals wie äusserliche Zutat: Göttererscheinungen erfolgten mit fast unglaublicher Wirksamkeit aus Wolkenhöhe, Vulkanausbrüche, tobende Gewitter, Feuersbrünste wurden dank komplizierter Maschinen zu überwältigenden Schauspielen, aber die wahre Dramatik lag in Wort und Musik und konnte daher im unbewegten Oratorium geradeso zum Ausdruck kommen wie bei bühnenmässiger Darstellung. Gerade heute ist die Lage wiederum ähnlich: die Oper des 20. Jahrhunderts ähnelt zum Teil jener Händels, vor allem darin, dass auch sie (»Oedipus Rex«, »Johanna auf dem Scheiterhaufen«, »Atlantida« usw.) innerliche Dramatik der äusseren vorzieht und nahezu »statisch«, also oratorienhaft, wiedergegeben werden kann. Sicherlich erklärt diese augenfällige Parallelität zwischen Ideen des 18. und unseres Jahrhunderts einen Teil der Händel-Renaissance, wie überhaupt die ständige »Wiederkehr« von Kunstwerken in einem bestimmten (und vielleicht gesetzmässig zu bestimmenden) Rhythmus. Mehr als zweihundert Jahre nach seinem Tode (er starb in London am 14. April 1759) ergreift, erschüttert uns vieles am Werke Händels, wie nur ein ewiges Kunstwerk es kann. »Agrippina« wurde Händels entscheidender Erfolg während seiner italienischen Lehr- und Wanderjahre. Die Uraufführung fand in Venedig, an einem der letzten Tage des Jahres 1709, statt. Der 24jährige Komponist zeigte eine bewundernswerte Stilbeherrschung, melodische Ausdruckskraft und interessante Harmonik. Das Textbuch stammt von Kardinal Grimani (Kirchenfürsten in dieser Art von Beschäftigungen waren damals nichts Aussergewöhnliches) und schildert, nach Art der neapolitanischen Intrigenopern, den Kampf Agrippinas und Poppeas, von denen erstere ihren Sohn Nero, letztere ihren Geliebten Ottone auf den römischen Kaiserthron bringen will. »Rinaldo« leitet Händels englische Tätigkeit ein. Wie gewöhnlich arbeitete der Komponist mit unglaublicher Geschwindigkeit: in vierzehn Tagen entstand die Partitur, der die Armida-Episode aus Torquato Tassos »Befreitem Jerusalem« zugrunde liegt (die später, unter vielen anderen, auch Gluck zu einer Oper inspirierte). Die Uraufführung fand am 24. Februar 1711 in London statt. Das (italienische) Textbuch stammt von Giacomo Rossi, nach einem Entwurf von Aaron Hill, Direktor des Queen's Theatre am Haymarket, der einer der interessantesten Männer des damaligen London und ein begeisterter Förderer Händels war. Wie weit die damalige Bühnentechnik gediehen war, möge eine zeitgenössische Beschreibung der »Rinaldo«-Premiere zeigen: »Ein erschrecklicher Anblick eines entsetzlich hohen Berges, der von der Front der Bühne zur höchsten Höhe des alleräussersten rückwärtigen Teiles des Theaters ansteigt. Man erblickt Felszacken, Höhlen und Wasserfälle auf dem Berghang, und auf der Spitze erscheinen die leuchtenden Mauern des Zauberschlosses (Armidas), bewacht von einer grossen Zahl von Geistern in unterschiedlicher Gestalt. Inmitten der Mauer sieht man ein Tor mit verschiedenen Bögen, die von Pfeilern aus Kristall, Azur, Smaragden und kostbarem Gestein aller Art getragen werden. Am Fusse des Berges entdeckt man die Höhle des Magiers ...« »Radamisto« stellt ebenfalls einen Meilenstein auf dem Londoner Weg Händels dar. Er kehrte, nach einer Reise auf den Kontinent, im November 1719 nach London zurück, wo ihm die Leitung der neuen »Royal Academy of Music« übertragen worden war. Er eröffnete sie mit einem Werk des italienischen Komponisten Porta, liess aber gleich darauf - am 27. April 1720 - seinen eigenen »Radamisto« spielen, der stärkstens einschlug, was sich in der (damals hohen) Ziffer von zehn Aufführungen sowie Wiederaufführungen in späteren Spielzeiten dokumentierte. Die Grundidee des von Nicolo Haym verfassten Textbuches ist die Verherrlichung treuer Gattenliebe. Die Motive der Handlung der heroischen Oper, wie dies am leuchtendsten wohl in Beethovens »Fidelio« zutage tritt. Die Motive der Handlung sind den Machtkämpfen der römischen Weltherrschaft in ihrer grössten Ausdehnung entnommen, und das Zeitkolorit spiegelt die Epoche der Partherkriege (5863 n. Chr.) wider. Die Handlung ist, der Barockoper gemäss, voll von Figuren, von Ereignissen, die allerdings zumeist zwischen den Szenen geschehen und von denen auf der Bühne nur berichtet wird. Händels Musik verleiht jeder Gestalt ein scharf umrissenes Profil und erhebt die damaligen sehr wortreichen, aber oft phrasenhaften Texte zu künstlerischer Höhe. »Ottone«, in deutschen Aufführungen zumeist »Otto und Theophano« genannt, entstammt - wie viele Opern Händels der Londoner Zeit - der Feder Nicolo Hayms, der von 1679 bis 1729 lebte. Es handelt sich um ein sehr gutes Libretto, dem eine frühere Fassung des italienischen Dichters Pallavicini (unter dem Titel »Theophano«) zugrunde liegt. Es war damals durchaus üblich, dass mehrere Komponisten sich an den gleichen Stoff wagten, ja sogar das gleiche Textbuch benutzten, manchmal, wie hier, eine Neufassung desselben, das andere Wesenszüge der Personen und unterschiedliche Szenen in den Vordergrund stellte. Händel hatte seinen »Ottone« wohl schon zu Beginn des Jahres 1722 komponiert, bewahrte ihn aber auf, um ihn mit der damals berühmtesten Sopranistin Francesca Cuzzoni herauszubringen. Die Primadonna langte Ende dieses Jahres in London an, zeigte sich aber Händels Musik gegenüber ablehnend; Komponist und Sängerin, beide von erregbarem Temperament, hatten schwere Zusammenstösse, die als oft zitierte Anekdoten in die Literatur eingegangen sind. So soll er, ein Hüne an Kräften, die Primadonna einmal so lange aus dem Fenster des Probenzimmers gehalten haben, bis sie sich seinen Anweisungen zu fügen versprach. Die Premiere fand am 12. Januar 1723 statt und gestaltete sich zu einem wahren Triumph Händels und der Cuzzoni. Ein damaliger englischer Musikschriftsteller vermerkte: »Die Händelschen Melodien werden zur musikalischen Sprache der Nation!« Die Ouvertüre des »Ottone« fand starke Verbreitung, und ebenso nahezu alle Arien des Werkes. Den Hintergrund der Handlung bietet der italienisch-germanische Hegemoniestreit des 10. und 11. Jahrhunderts. Er wird hier verklärt, wie es sowohl der absolutistischen Zeit, als auch der damaligen Operngewohnheit entsprach (während es in Wahrheit bedeutend weniger idealistisch zuging). Kaiser Otto II. ist mit der ihm persönlich unbekannten Tochter des Kaisers von Byzanz verlobt, die sich aber von ihm betrogen glaubt. Erst nach einer Entführung durch Seeräuber kommt es zur Vereinigung mit dem (in Wirklichkeit treuen) Bräutigam. Händels Musik rechtfertigt die Neuaufnahme des Werkes in unserer Zeit. Mit nur unwesentlichen Retuschen der Handlung und einer sinngemäss-dramatischen Wiedergabe kann der Erfolg nicht ausbleiben, sofern Sänger hoher Klasse zur Stelle sind. »Julius Cäsar« (im italienischen Original »Giulio Cesare«, deutsch auch manchmal unter dem Titel »Cäsar in Ägypten« aufgeführt) ist Händels verbreitetstes Opernwerk. Als Verfasser des italienischen Textbuches zeichnet wieder Nicolo Haym. Cäsars Gestalt, und besonders seine ägyptischen Abenteuer - der Zusammenprall zweier Rassen, die Liebe zu Kleopatra, der faszinierendsten Frau der damaligen Welt -, sind oftmals Gegenstand opernmässiger Behandlung geworden, doch keine der Cäsar-Opern hielt sich im Repertoire, aber auch die Oper Händels nur vorübergehend, trotz vieler Versuche im Lauf zweier Jahrhunderte. Jetzt kehrt sie, voll neuen Lebens, auf die Opernbühne zurück. Gerade am Falle dieses Werkes wäre es vielleicht angezeigt, über die Notwendigkeit, aber auch die Grenzen der Neubearbeitungen zu sprechen, denen Händels (und seiner Zeitgenossen) Bühnenwerke unterworfen werden, um sie unserer Epoche nahe zu bringen. Sie beziehen sich in erster Linie auf dramaturgische Raffungen und Neutextierungen, aus denen symbolische Anspielungen - an denen das Barocktheater überreich war - entfernt werden. Das Drama jener Zeit schweifte gerne von der Handlung ab, um aktuelle Huldigungen anzubringen oder allgemeine mythologische oder philosophische Betrachtungen anzustellen. Die Bearbeiter des 20. Jahrhunderts hingegen suchen den historischen Ablauf sicherzustellen und den Text ganz auf dramatische Wirkung zu stellen. Sie müssen allerdings das wichtigste Stilmerkmal unangetastet lassen: den Kontrast zwischen den vorwärtstreibenden, rezitativischen und den betrachtenden, lyrischen, das heisst ariosen Teilen. Für den heutigen Opernfreund ergibt sich so eine im tiefsten Grunde als »undramatisch« empfundene Spaltung, die aber durch musikalische Schönheiten in den ariosen, statischen Teilen aufgewogen wird. Erst das 19. Jahrhundert trachtete danach, diese Zweiteilung zu beseitigen; im deutschen Musikdrama proklamierte Wagner diese Forderung, in der italienischen Oper gelangte Verdi in seinem langen, folgerichtigen Entwicklungsgange zum gleichen Ergebnis. Unsere Zeit, die ein musikalisches Gut von mehreren Jahrhunderten lebendig zu erhalten trachtet, weiss auch der »alten« Oper Geschmack abzugewinnen, trotz ihrer Spaltung in dramatische und ariose Teile, der regiemässig beizukommen sehr schwierig ist, doch immerhin eine lohnende Aufgabe darstellt. Händel komponierte »Julius Cäsar« zu Ende des Jahres 1723; die Premiere fand am 20. Februar 1724 im Haymarket-Theater in London statt, wo der Komponist nicht nur Direktor, sondern auch Unternehmer (Impresario) und natürlich Dirigent war. Die Hauptrollen waren mit der Cuzzoni und Senesino, zwei ersten Sängern der Zeit, besetzt. Die Handlung setzt in dem Augenblick ein, in dem Cäsar ägyptischen Boden betritt und von Ptolemäus ein grauenhaftes Geschenk übersandt erhält: das abgeschlagene Haupt seines Widersachers Pompejus. Cäsar wäre kein Römer gewesen, hätte er einem Ägypter gestattet, eine solche Tat an irgend einem Vertreter jenes Weltreiches, sei es auch sein Todfeind, zu verüben. Huldvoll nimmt er die schöne Witwe des Ermordeten und den Sohn auf. Es ist der junge Sextus, der Rache für den Tod seines Vaters schwört. Die nächsten Szenen versetzen uns an den ägyptischen Hof, wo Ptolemäus und seine Schwester Kleopatra um die Macht kämpfen. Cäsars Eintreffen steht bevor: Ptolemäus erfährt aus dem Munde seines Abgesandten, mit welcher Empörung Cäsar seine Tat aufgenommen hat. Da stürzt Sextus herein, um den Ägypter zu töten, aber auf dessen Wink wird er von Bewaffneten gefangen genommen. Kleopatra, die beschlossen hat, den römischen Feldherrn zum Bundesgenossen für ihre Thronansprüche zu gewinnen, reist ihm entgegen und sucht - als »Lydia« verkleidet - das Herz Cäsars zu entflammen. Bei seinem Einzug in der ägyptischen Hauptstadt empfängt sie ihn, nun in ihrer wahren Gestalt, mit einem Liebesfest in ihrem Palast. Hier hat Händel eines der schönsten Musikstücke eingestreut, die Sopranarie, die in deutscher Nachdichtung mit den Worten »Es blaut die Nacht ... « beginnt. (1) Cäsar ist wie geblendet und bereit, seine Macht und sein Leben der herrlichen Ägypterin zu Füssen zu legen. Doch Schwerterklirren, Feldgeschrei unterbricht die Szene - feindliche Massen dringen ein und zwingen den römischen Feldherrn, zuerst im Kampfe, dann durch einen kühnen Sprung von der Terrasse ins Meer, sein Leben zu verteidigen und zu retten. Während er für tot gehalten wird, setzt Ptolemäus seine Schwester gefangen und gerät mit seinem Minister und Ratgeber Achillas in Streit um Cornelia, die Witwe des Pompejus. In tödlichem Hass verbündet dieser sich mit dem Römer Sextus, beide vom gleichen Drang beseelt, den ägyptischen König zu ermorden. Die Rückkehr Cäsars, aus den Fluten gerettet, ändert die Lage. Dem im Kampfe tödlich verwundeten Achillas nimmt Cäsar den Ring des Befehlshabers vom Finger und entscheidet die entbrennende Schlacht zu seinen Gunsten. Sextus rächt den Tod seines Vaters an Ptolemäus. In einem Freudenfest setzt Cäsar Kleopatra zur Königin Ägyptens ein und besiegelt seinen eigenen Liebesbund mit ihr. »Tamerlan« (Tamerlano) folgte 1724. Die wie »Julius Cäsar« von N. Haym textierte Oper bringt abermals einen Stoff mit exotischen Schauplätzen: den Konflikt zwischen dem Tatarenfürsten Tamerlan (Timur Lenk) und dem türkischen Herrscher Bajazet. Viele tragische Konflikte sind in die Handlung verwoben, hoch lodern die Leidenschaften, Bajazet verübt Selbstmord, um die von dem grausamen Tamerlan seiner Tochter zugedachte Schmach nicht zu überleben. Doch die edle Haltung des Türkenfürsten und seiner Tochter Asteria bringen den als Musterbeispiel der Unmenschlichkeit in die Geschichte eingegangenen Tataren zur Einsicht und zum Entschluss, in Zukunft gerecht zu regieren. »Rodelinde« wurde am 20. Januar 1725 in London erstmalig gegeben. Wieder hatte Haym das Libretto verfasst. Bertarich (Bertarido), König der Langobarden, wurde von dem Tyrannen Grimwald (Grimoaldo) vertrieben. Seine Gattin Rodelinde (Rodelinda) hält ihm höchste Treue, obwohl sie ihn tot glaubt und von Grimwald aufs heftigste bedrängt wird. Bertarich kehrt heimlich zurück, fühlt sich aber von Rodelinde verraten. Nach einer grossen Erkennungsszene wird der König von dem Usurpator in den Kerker geworfen. Hier kommt es zu einer musikalisch bedeutungsvollen Arie Bertarichs, die gemeinsam mit einem Sicilianorhythmus stehenden Stück Grimwalds, »Pastorello d'un povero armento« Höhepunkt der Partitur ist. Bertarich rettet seinem Feinde das Leben, worauf dieser endgültig auf Rodelinde verzichtet und dem rechtmässigen König Krone und Reich zurückgibt. Wieder hat hier Händel die Gattentreue besungen und wieder ist ihm eine schöne Frauengestalt gelungen. Zu den edelsten Höhepunkten der Musik gehört das Vorspiel zum dritten Akt, in dem ein stimmungsvolles Stück aus Händels Concerto grosso in g-moll verarbeitet ist. 1726 vertonte Händel das Textbuch P. Rollis zur Oper »Scipione«. Die Handlung ist sehr einfach, ihre Durchführung aber, wie stets in der Barockoper, gespickt mit Komplikationen. Der römische Feldherr Scipio kehrt aus dem Kriege siegreich heim; als Beute bringt er zwei Frauen des besiegten Stammes zurück. In deren eine, Berenice, hat er sich verliebt, prallt aber mit ihrem Bräutigam Lucejo zusammen, der verkleidet bis zur Gefangenen vorzudringen wusste. Erst nach heftigem inneren Kampf verzichtet der Römer zugunsten der älteren Rechte des Fremden. »Alexander« (Alessandro) wurde am 5. Mai 1726 uraufgeführt, nachdem die Partitur am 11. April des gleichen Jahres abgeschlossen worden war. (Wie unglaublich kurz sind zu jenen Zeiten nicht nur die Fristen der Komposition, sondern auch die der Einstudierung! Sinfoniekonzerte fast ohne Proben sind sogar noch zu Beethovens Zeiten an der Tagesordnung. Opernpremieren mit vierzehntägiger Vorbereitungszeit alltägliche Erscheinungen!) Auch die Gestalt Alexanders des Grossen ist, ebenso wie die Cäsars, keineswegs auf das Opernwerk Händels beschränkt geblieben. Der Librettist P. Rolli hatte den Einfall, zwei grosse Frauenrollen einzuschliessen, was zum sensationellen gemeinsamen Auftreten der beiden berühmten Primadonnen Cuzzoni und Bordoni führte, aber auch zu der nicht vorgesehenen Schimpf- und Prügelszene zwischen den beiden Starsängerinnen, für die Händel ein Werk mit zwei Frauengestalten bestellt und vertont hatte; sie stellten Rossana (Roxana) und Lisaura dar, die den grossen Eroberer lieben und schliesslich sogar bereit sind, sich ohne Eifersucht in seinen »Besitz« zu teilen, was zu einem prachtvollen Terzett mit Chor als Abschluss einer schönen Oper führt. »Admetos« (»Admeto«) nimmt den Alkeste-Mythos als Grundlage, den Euripides wahrscheinlich erstmalig dramatisiert hat. (Gluck greift in seiner »Alceste« auf ihn zurück.) Die eigentliche Quelle für Händels Oper bildet das Drama »L'Antigona delusa d'Alceste«, das der italienische Dichter Aurelio Aureli im Jahre 1664 veröffentlichte; wer der Autor des Librettos war, ist ungewiss, es kann Haym oder Rolli, aber auch ein heute nicht mehr festzustellender Textdichter gewesen sein. Er übernahm von Aureli die für das Barocktheater typische Mischung von antiker Sage und »moderner« Intrigengeschichte. Es geht um den Thessalierkönig Admet, dem das Orakel den Tod verkündet, sofern sich nicht ein ihm nahestehender Mensch für ihn opfert; seine Gattin Alceste ist dazu bereit und steigt in die Unterwelt hinab. Sie wird von Herkules befreit, aber erst nach zahlreichen Verwicklungen finden sich die Gatten neuerdings in Liebe. »Siroe« entstand in einer schweren Zeit Händels, da er versuchte, den drohenden Zusammenbruch seines Opernunternehmens durch vermehrtes Schaffen aufzuhalten. In einer einzigen Saison (1727/ 28) brachte er nicht weniger als drei eigene Opern zur Uraufführung: »Riccardo I« (die in England beheimatete und populäre Gestalt Richard Löwenherz'), »Siroe« und »Tolomeo«. Für »Siroe« (im Deutschen als Cyrus bekannt) verwendete er das vier Jahre früher erfolgreich von Leonardo Vinci vertonte Textbuch des jungen Pietro Metastasio, dem eine blendende Laufbahn als Dichter sowie vor allem als Librettist Hunderter von seinerzeit hochberühmten Opern bevorstand. Der römische Literat (1698-1782), der seinen ursprünglichen Familiennamen Trapassi in Metastasio hellenisierte, wurde zum Urbild des Barockschriftstellers. Er wurde 1730 Hofdichter in Wien - als Nachfolger des ebenfalls bedeutenden Apostolo Zeno - und spielte ein halbes Jahrhundert lang eine zentrale Rolle im Geistesleben der Epoche. Es gibt kaum einen Barockkomponisten, der sich für Bühne und Oratorium keines Textbuches Metastasios bedient hätte. Goldoni ergeht sich in Lobeshymnen über ihn, rühmt ihm »grösstmögliche Vollkommenheit, reinen, eleganten Stil, flüssige, wohlklingende Verse, bewunderswerte Klarheit der Gefühle« usw. nach, was nicht verhinderte, dass ihn bereits die nächste Generation als »unecht«, als »hohl, bombastisch, gekünstelt« empfand. Der »Siroe«-Text behandelt die Geschichte des historischen Prinzen Cyrus von Persien in seinem Kampf um die ihm zustehende Thronfolge und um die Liebe Emiras und bringt, nach Barockart, eine Fülle von Intrigen und Verwicklungen bis zum guten Ende. Zwischen dieser Oper und der folgenden, die wir besprechen wollen - da sie in unserer Zeit erneut auf der Bühne aufgetaucht ist -, liegt der Zusammenbruch und Neubeginn von Händels Londoner Operunternehmen. »Poros« (»Poro«) verwendet wieder die Gestalt Alexander des Grossen, nach einem Textbuch des täglich berühmter werdenden Pietro Metastasio, das unter anderen von Vinci und Hasse komponiert worden war. Die Händelsche Oper errang, ihres exotischen Milieus und ihrer glänzenden Musik wegen, am 2. Februar 1731 einen starken Erfolg. Metastasio gibt als Grundzüge der Handlung folgende an: »Das Hauptthema des Dramas ist der Edelmut, den, wie bekannt, Alexander der Grosse gegen Poros übte, den König eines Teils von Indien, dem er als wiederholt Besiegtem und Gefangenem das Reich und die Freiheit schenkte. Als Episoden sind eingefügt die Umtriebe der Cleofide, Königin eines anderen Teils von Indien, die, obschon in Poros verliebt, dennoch das Genie Alexanders für sich zu gewinnen wusste, um sich den Thron zu sichern ... « Es sei noch erwähnt, dass auch dieses Werk (wie das früher besprochene Drama »Alexander«) unter dem Namen »Alexander in Indien« aufgetaucht ist. »Ezio« (1732) bringt, ebenfalls nach einem Libretto Metastasios, die Kämpfe des siegreichen Ezio, Feldherr des Tyrannen Valentinian von Rom, gegen seinen düsteren Gegenspieler Massimo. Wieder gibt es eine Fülle von Verleumdungen, Verwirrungen, Gefahren für Unschuldige, bis zum Triumph der Wahrheit, die in der Barockoper stets siegt. Über die oft recht schablonenmässigen Texte hinaus ist Händels Musik von echtem Feuer durchpulst und enthält Bruchstücke, die Beethovens Ausspruch, Händel sei der grösste Komponist aller Zeiten, verständlich machen. »Acis und Galathea« müsste hier eingeschoben werden, da die dritte (und endgültige) Fassung aus dem Jahre 1732 stammt. Händel hatte die Sage, die zuerst bei dem in Sizilien geborenen griechischen Dichter Theokrit erscheint und dann von Ovid in seinen berühmten »Metamorphosen« aufgegriffen wurde, gleich zu Beginn seiner italienischen Lehrjahre kennengelernt. So entstand sein Spiel »Aci, Galatea e Polifemo«, das 1709 in Neapel aufgeführt wurde. Als er dann nach England kam, bearbeitete er das Werk und führte es in englischer Sprache auf. (Möglicherweise im Jahre 1720 auf Schloss Cannons bei London.) Abermals einige Jahre später scheint er gefühlt zu haben, dass die »grosse«, die Ausstattungs-, die Helden- und Götteroper, zu der er bereits so viele Werke beigesteuert hatte, an einem kritischen Punkt angelangt war und dem Publikum stets weniger sagte. Da ging er an eine dritte Bearbeitung von »Acis und Galathea« - wieder italienisch dieses Mal - in der die lieblich-tragische Hirtengeschichte eine dichterisch und musikalisch gleich schöne Fassung erfährt. Acis' und Galatheas Liebesstunde wird durch das Einbrechen des wilden Riesen Polyphem gestört. In einem Zweikampf tötet dieser Acis, worüber alle Hirten und Nymphen, ja die Natur selbst in Klage ausbrechen. Da verwandeln die Götter den toten Acis in einen Quell, der von nun an seine lebensspendende, liebevolle Mission im ganzen Tal ausübt. »Orlando« gehört zur letzten Opernperiode Händels. Nicht dass sein Leben oder Schaffen sich dem Ende näherte, er hatte nur das Oratorium mit seinen ihn besonders fesselnden musikalischen Möglichkeiten entdeckt und intensiv zu kultivieren begonnen. Bereits waren »Esther« und »Deborah« erschienen, das »Alexanderfest« liess nicht mehr lange auf sich warten. Langsam, aber immer bestimmter wendete er sich von der Oper ab, vielleicht mehr aus Enttäuschung über den Wandel des Publikums und seines Geschmacks als über die Kunstgattung der Barockoper selbst. In »Orlando«, dessen Textbuch von dem Italiener Grazio Draccioli stammt, wird der von Ariost überlieferte Stoff des Zauberers Zoroaster behandelt, ein von zahlreichen Opernkomponisten bevorzugtes Thema (Vivaldi, Karl Heinrich Graun, Piccini, Steffani, Domenico Scarlatti usw.). Die verworrene Handlung bietet musikalisch reiche Möglichkeiten, da Händel seine aussergewöhnliche Fähigkeit zur Schilderung arkadischer Idylle, von inneren Kämpfen zwischen Liebe und Pflicht, Liebe und Tatendurst, ja sogar von geistiger Umnachtung (einem beliebten, aber schwierigen Opernthema) beweisen kann. Er malt letztere hier durch den damals noch äusserst seltenen 5/8Takt, der gewissermassen zum Ausdruck des Ungleichmässigen, Labilen wird. Die Uraufführung fand in London am 27. Januar 1733 statt, weitere fünfzehn Aufführungen folgten, dann fand auch Händels drittes Opernunternehmen ein Ende. Das Jahr 1735 brachte Händel zwei bedeutende Opernwerke, »Ariodante« und »Alcina«. Beide Themen stammen aus Ariosts »Orlando furioso«. In »Ariodante« stehen wir einer recht komplizierten Handlung gegenüber, in der vermeintliche Untreue einer Braut, Verkleidungen, Zweikämpfe, die als eine Art Gottesurteil angesehen werden, Intrigen eine ziemlich verworrene Rolle spielen, vor allem aber eine Hinneigung Händels zu stärkerer Chor- und Ballettverwendung zu spüren ist. »Alcina« gehört zu den in unserer Zeit am öftesten »wiedererweckten« Opern Händels. Ihre prachtvolle Musik rechtfertigt das erneute Interesse stärker als die sehr »barocke« Handlung, zu deren wahrem Verständnis es unserer Zeit wohl vor allem an echtem Gefühl für die Antike mangelt. Alcina ist eine mächtige Zauberin, der es gelungen ist, das Liebespaar Ruggerio und Bradamante zu entzweien. Nach langwierigen Kämpfen kommt es, wie in der damaligen Oper unumgänglich, zum glücklichen Ende. Eine Reihe grossartiger Arien und Ensembles, von Tänzen - die in mehreren vorkommenden »Neubearbeitungen« variieren können - krönen diese Zauberoper, der adäquate Inszenierungen auch heute noch zu starker Wirkung verhelfen können. »Xerxes« (»Serse«) ist eine der letzten, aber auch eine der lebensfähigsten Opern Händels. Sie wurde am 14. Februar 1738 in London erstmalig gegeben. In ihr findet sich die Melodie, die wahrscheinlich vor allen anderen im reichen Schaffen dieses Komponisten die verbreitetste genannt zu werden verdient: das sogenannte »Largo«, das mit den Worten »Ombra mai fù« anhebt. Was um sie herum geschieht, ist wieder echte Barockoper und als solche kaum dazu angetan, uns menschlich besonders nahe zu gehen. Es gibt Intrigen in Menge, aufgefangene Briefe, Verkleidungen, Liebe, Rache und ein »Happy-End«. Weder der geschichtlich bedeutende Perserkönig Xerxes (485 bis 465 v. Chr.), der mit einem gewaltigen Heer versuchte, Griechenland zu unterwerfen, noch der von Äschylos geschilderte geschlagene Feldherr sind in der Xerxesgestalt zu finden, die Händel vertont hat (und die von einem unbekannten Librettisten, wahrscheinlich nach einem bereits mehr als achtzigjährigen Textbuch von Nicolo Minato verfasst wurde), sondern der verliebte Herrscher, der seine Braut zugunsten der seines Bruders aufgeben möchte. Er will durch ein Machtwort zur Erfüllung seiner Wünsche kommen. Doch seine Braut, die, als Hauptmann verkleidet, soeben aus einem Feldzug zurückkehrt, vereitelt seine Pläne. Zuletzt finden sich die Paare wie vorgesehen. Händel schlägt hier einen heiteren Ton an, ist lieblich, berückend in Melodie und Wohllaut, lächelnd und anmutsvoll wie selten. Das berühmte »Largo« wird von Xerxes gleich zu Beginn der Oper angestimmt, da er träumend unter einer Platane liegt. (Dass es sich eigentlich um ein »Larghetto« - also um ein etwas weniger langsames Zeitmass - handelt, wird der verdienten Popularität des Stückes und des Namens, unter dem es bekannt wurde, keinen Abbruch tun.) »Deidamia« schliesst die lange Reihe Händelscher Opernwerke. Er komponierte das Werk im Oktober und November 1740 und führte es am 10. Januar 1741 in London erstmalig auf. Es waren böse Zeiten für den Komponisten, dem Feinde, Neider und Gleichgültige zusetzten. Seine Lust, Opern zu schaffen, konnte vermindert, ja gebrochen werden, nicht aber seine titanische Schaffenskraft und seine unversiegbare Inspiration. Mit »Deidamia« verabschiedet er sich, nach mehr als vierzig Werken, endgültig von der Bühne; das Werk entstand, als sechste Gemeinschaftsarbeit, mit dem Dichter Paolo Antonio Rolli und schildert eine Episode aus dem Trojanischen Krieg, beziehungsweise aus dessen Vorbereitung. Das Orakel hat verkündet, dass der Kampf nur mit Hilfe des Achilles gewonnen werden könne, und so machen drei griechische Fürsten sich auf, den Helden für den Feldzug zu werben. Bevor er mit dem Heer die Fahrt nach Troja antritt, wird seine Vermählung mit Deidamia, der Tochter des Königs von Skyros feierlich vollzogen. Der »listenreiche« Ulisse (Odysseus) - wie Homer ihn bekanntlich nennt - verzichtet auf die auch von ihm geliebte Prinzessin und gemeinsam ziehen die Helden (nicht ohne eine Reihe kämpferischer Arien) in den historischen, unzählige Male geschilderten und vertonten Krieg. Händels Musik fliesst reich und edel; sie wird es nunmehr vor allem im Oratorium und in der Instrumentalmusik tun und ihrem Schöpfer so den führenden Platz sichern, an dem bis heute nicht gerüttelt wurde. Mit den angeführten Werken ist die Zahl jener noch nicht erschöpft, die in den verschiedenen Wellen der Händel-Renaissance unseres Jahrhunderts - zumeist vorübergehend - auf den Bühnen erscheinen. Hier müsste etwa auch »Belsazar« genannt werden. Händel hat ihn ausdrücklich als Oratorium bezeichnet, aber seine dramatische Handlung hat immer wieder Theaterleute zu szenischer Darstellung gereizt. Hier erleben wir die aus der Bibel bekannte Geschichte des Königs der Babylonier, der sich im Machtrausch für unbesiegbar hält und die gefangenen Juden durch Entweihung ihres Gottes schmäht. Inmitten seines wüsten Festes erscheint die geheimnisvolle Zauberschrift an der Wand, die seine Gelehrten und Sterndeuter nicht zu lesen vermögen. Nur Daniel, ein junger jüdischer Sklave, erkennt ihren Sinn und bringt ihn dem König zu Gehör: Mene, mene tekel, upharsin, das bedeute: Des Reiches Tage sind gezählt, du warst gewogen und zu leicht befunden, dein Reich wird geteilt unter deine Feinde, Perser und Meder. Und so geschieht es noch in dieser gleichen Nacht. Auszug aus „Oper der Welt“ von Prof. Dr. Kurt Pahlen. ACS-Reisen AG