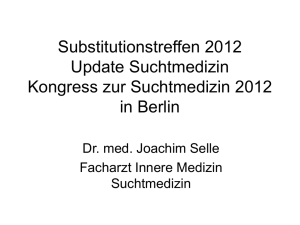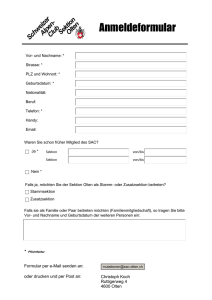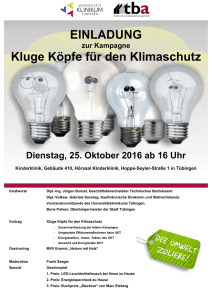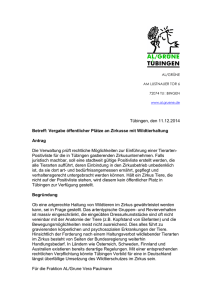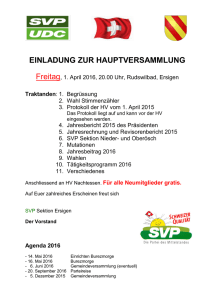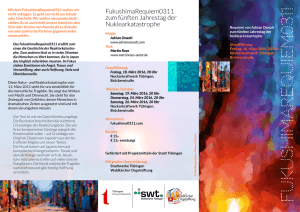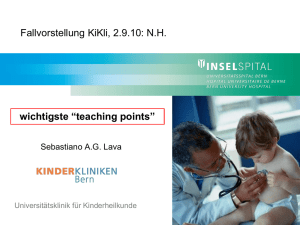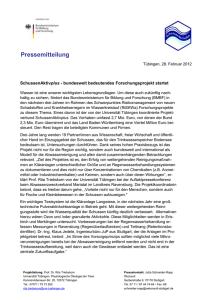Diagnostik - Landesstelle für Suchtfragen
Werbung

Menschen mit Doppeldiagnosen Wechselwirkungen, Diagnostik und Behandlungsansätze, Fortschritte der Psychotherapie 30. Landestagung der Landesstelle für Suchtfragen 17. Juni 2010 Prof. Dr. A. Batra Sektion Sucht am UKT Tübingen Agenda Konzeptualisierung und Bedeutung der Sucht Comorbidität und Multimorbidität ● Daten aus einer baden-württembergischen Studie Diagnostik Behandlungsempfehlungen ● Leitlinien ... und dann? Psychotherapeutische, störungsspezifische Optimierungen ● ● Kognitive VT CRA, CRAFT, DF-T, DBT Strukturelle Optimierungen ● ● Tageskliniken und Ambulanzen Suchthilfenetzwerke Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Seit wann gibt es den Begriff der „komorbiden Störung? „In der Tat lehrt die klinische Erfahrung, dass die meisten Säufer geborene Psychopathen sind und außer ihrer Trunksucht noch andere Zeichen einer nervösen Anlage aufweisen.“ „Immerhin lassen sich gewisse gemeinsame Züge bei fast allen Trinkern feststellen …“ „Geisteskrankheiten, 1942“ Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Ein-Jahres Prävalenz psych. Störungen www.gbe-bund.de Diagnosenverteilung (2004) www.gbe-bund.de Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen www.gbe-bund.de Ausfalltage/ Monat www.gbe-bund.de Verdacht: … der Anteil suchtkranker Menschen steigt an … der Anteil schwerkranker suchtkranker Menschen steigt an … Suchtpatienten bringen immer häufiger eine weitere psychiatrische Erkrankung mit ... die Behandlung wird immer schwieriger Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Chronisch mehrfach beeinträchtigte Suchtkranke Schwere körperliche Schädigungen Kognitive Einschränkungen Kritikfähigkeit Emotionalität Minderwertigkeitsgefühle Kontaktschwäche Vereinsamung Banger et al. 2009 Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Chronisch mehrfach beeinträchtigte Suchtkranke erleben ● kognitive ● emotionale und ● psychosoziale Einschränkungen werden zu suchtkranken Menschen mit komorbiden Störungen Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Häufigkeit substanzbezogener Störungen bei Patienten mit schizophrenen oder affektiven Störungsbildern NIMH Epidemiological Catchment Area Study (N=20.291) (Regier et al. 1990) Lebenszeitprävalenzen affektiver Störungen ● ● ● 13,5% für Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol 26,4% für Missbrauch oder Abhängigkeit von Drogen 6,1% für andere Substanzen Schizophrene Patienten ● ● ● 47% Missbrauch und Abhängigkeit, davon 33,7% für Alkoholmissbrauch-/abhängigkeit und 27,5% Missbrauch/Abhängigkeit von anderen psychoaktiven Substanzen. Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Häufigkeit substanzbezogener Störungen bei Patienten mit schizophrenen oder affektiven Störungsbildern NIMH Epidemiological Catchment Area Study (N=20.291) (Regier et al. 1990) Patienten mit primärer Diagnosen Alkoholmissbrauch/Abhängigkeit ● 3,8% Schizophrenie Patienten mit primärer Diagnosen Missbrauch/Abhängigkeit anderer Substanz ● 6,8% Schizophrenie somit leicht erhöhte Raten von schizophrenen Psychosen im Vergleich zur Allgemeinbev. Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Häufigkeit substanzbezogener Störungen bei Patienten mit schizophrenen oder affektiven Störungsbildern NIMH Epidemiological Catchment Area Study (N=20.291) (Regier et al. 1990) Patienten mit primärer Depression / Angststörung: ● Hohe Komorbidität Bipolare affektive Erkrankungen und Substanzmissbrauch sind gekennzeichnet durch den höchsten Anteil psychiatrischer Komorbidität (bis 71%) Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Schlussfolgerungen Störungen zu psychotropen Substanzen sind ● häufig ● einer der Schwerpunkte in der psychiatrischen Versorgung ● ökonomisch bedeutsam ● häufig gepaart mit anderen psychiatrischen Störungen Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Psychiatrische Komorbidität Alkohol: Depression, Soziale Phobie, Angststörungen, Schizophrenie, kognitive Störungen ● 20 – 40% Illegale Drogen: Persönlichkeitsstörungen, Psychosen, Affektive Störungen ● 25-60% Einfluss auf Schwere und Verlauf der Erkrankung, somatische Komorbidität, soziale Integration Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Kausale Beziehungen Sucht Psychose: Psychose-Induktion durch Cannabis, Psychostimulantien (Khantzian 1985, 1997) Psychose Sucht: Affektregulation durch Alkohol, Benzodiazepine, Nikotin (Farrell et al. 2002) Genetik Psychose und Sucht: geringe Evidenz (Goldstein & Volkow 2002, Abdolmaleky et al. 2006) Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Weiterentwicklung ätiologischer Konzepte Kulturelle Verfügbarkeit und Permissivität Cognitiv-Behavioral: ● Gelerntes, erworbenes Verhalten ● Funktionales oder maladaptives Verhalten (Stress-, Emotionsregulation) Komplikationen in sozialer Entwicklung Neurobiologische Vulnerabiltät (Dopamin und Serotonin-Hypothese) Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Diagnostik Primär Psychose: ● Europ-ASI ● Laborparameter Primär Sucht: ● ● ● ● ● Psychiatrisches Interview BDI, HAMD STAI, HAMA SCL-90 R SCID I und II Diagnostik sollte Standard in jeder Therapie sein! Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Suchtmedizinische Ziele (APA 2002) Einstellungsänderung Herstellung einer Änderungskompetenz Aufbau und Erhalt eines therapeutischen Bündnisses Überwachung des Gesamtbehandlungsplans und seiner Umsetzung Kontinuierliche Überwachung des klinischen Zustandes des Patienten Psychoedukation Psychologisch-psychotherapeutische Techniken zur Behandlung der Abhängigkeit Stärkung der Kompetenzen der Persönlichkeit Erkennung und Behandlung komorbider Störungen Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Suchtmedizinische Ziele (APA 2002) Einstellungsänderung Herstellung einer Änderungskompetenz Aufbau und Erhalt eines therapeutischen Bündnisses Überwachung des Gesamtbehandlungsplans und seiner Umsetzung Kontinuierliche Überwachung des klinischen Zustandes des Patienten Psychoedukation Psychologisch-psychotherapeutische Techniken zur Behandlung der Abhängigkeit Stärkung der Kompetenzen der Persönlichkeit Erkennung und Behandlung komorbider Störungen Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Effektivität Langzeitbehandlungen in Deutschland Studie Anzahl Patienten Therapiedauer Katamnesedauer Gebessert Küfner 1989 1410 4-6 Monate 8 Monate 67 % Zemlin 1999 3060 4-6 Monate 8 Monate 60 % Mann & Batra 1993 790 12 Monate 68 % Mann 1996 212 6 Wochen + 1 Jahr 6 Wochen + 1 Jahr 12 Monate 67 % Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Langzeiterfolge im internationalen Vergleich Studie Anzahl Patienten Montero Pérez 162 Barquero et al. 2001 Powell et al. 1998 Katamnesedauer Ausschöp- Mortalität fung 10 Jahre 71% 34,6% 99,2% 26,4% 360 Männer 10 Jahre dauerhaft Abstinente 13,6% Finney & Moos 1992 113 10 Jahre 72,6% 18% Längle 1990 96 10 Jahre 94% 21,9% 26% Cross et al. 1990 200 10 Jahre 79% 27% 40,5% Edwards et al. 1988 99 10 Jahre 86,9% 18% 3% Smith et al. 1983 100 Frauen 11 Jahre 97% 31% 17% Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen PSYCHIATRISCHE KOMORBIDITÄT >20% aller Alkoholabhängigen leiden unter schweren psychiatrischen Störungen, in den meisten Fällen unter Depressionen oder Angststörungen Psychosoziale Probleme und wiederkehrende Episoden depressiver Störungen stellen eine der Herausforderungen in der Behandlung dar. Die Akutbehandlung sollte durch eine ambulante Nachsorge und ein Case-Management ergänzt werden. Geyer, Batra et al., SUCHT, 2006 Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Psychiatrische Komorbidität Sowohl die Suchterkrankung als auch die psychiatrische Störung sind durch ihren chronischen Charakter und Rückfallgefahr bzw. hohe Rezidivhäufigkeit gekennzeichnet. Langzeitbehandlungen sind unerlässlich. Ein gleichzeitige Behandlung beider Störungen wäre optimal, um einen Erfolg zu sichern. Ein Rezidiv der einen Störung birgt ein hohes Rezidivrisiko für das andere Problem. Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Moderne Konzeption der Sucht Funktionalität der Störung Interaktion von Mensch, Umwelt und Droge ● Einbeziehung von Familie, Kommune, sozialer Sicherung Bio-Psycho-Soziales Konzept der Behandlung Stärkung von Ressourcen Kompensation von individuellen Kompetenzdefiziten Soziale Verankerung Beachtung psychiatrischer Komorbidität Berücksichtigung neurobiologischer Grundlagen Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Behandlungsprinzipien Die Behandlung von Suchterkrankungen und anderen psychischen Störungen kann erfolgen: ● ● ● Vorteile der integrierten Behandlung: ● ● Parallel: Simultane, zeitgleiche Behandlung an verschiedenen Orten Sequentiell: Behandlung der Suchterkrankung vor der Behandlung der psychiatrischen Störung Integriert: Simultane Behandlung beider Störungen in einer Einrichtung Einfacherer Zugang zu den Patienten Kommunikation zwischen Störungsspezialisten und Methodenspezialisten Behandlungen sollten sein: langfristig, vernetzt und integriert Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Neue(re) Psychotherapeutische Verfahren Alternativverhalten - Voraussetzungen Verständnis der Problemverhaltens Definition von „Zufriedenheit“ Aufbau einer positiven Motivation Fertigkeiten zur ● ● ● ● Problemlösung Frustrationstoleranz Bedürfniswahrnehmung Bedürfnisbefriedigung Kommunikationstraining Problemlösetraining Ablehnungstraining Aufbau von Alltagsgestaltung Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen CRA – Was und Wozu? Community-Reinforcement Approach (CRA) verhaltenstherapeutisches Konzept zur Behandlung substanzbezogener Probleme Aus dem aufkommenden verhaltenstherapeutischen Verständnis der Suchterkrankungen der 70er Jahre Stete Weiterentwicklung bis in die letzten Jahre ● Azrin / Hunt … Myers / Smith Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Die Kunst der Umsetzung Schrittweiser Veränderungsaufbau Bindung an das Therapieprogramm Strategie der kleinen Schritte Zunehmende soziale Einbindung Soziale Einbindung ist soziale Verstärkung! Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Erfolge der Behandlungsstrategie CRA ist im ambulanten und stationären Rahmen erfolgreich (Hunt und Azrin 1973, Azrin et al. 1982). 1973 erste Studie zur Effektivität von CRA bei stationär behandelten Alkoholabhängigen (Hunt und Azarin 1973). 1997 CRA zur Behandlung opiatabhängiger Patienten: 53 % der CRA-Gruppe schloss Behandlung ab, in Vergleichsgruppe nur 20 % (Bickel et al. 1997) Bei opiodabhängigen Patienten in Methadonsubstitutionsprogramm mehr drogenfreie Befunde in der CRA Gruppe (Abbott et al. 1998). Größere Wirksamkeit, wenn CRA vor oder nach Abschluss einer stationären Behandlung angewendet wird. Daten in der Behandlung der Opiatabhängigkeit noch unzureichend (Roozen et al. 2004) CRA ist geeignet, die in der Rehabilitation übliche Beteiligung verschiedener Personen, Behörden und Interessen zu nutzen. Einbeziehung aller therapeutisch Beteiligten unterschiedlicher Professionen Transparenz der theoretischen Fundierung. Das Vorgehen nach dem CRA kann Patienten gut vermittelt werden und wird von diesen als hilfreich erlebt. Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen CRAFT Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen CRAFT Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) Concerned Significant Others (CSOs) Methoden: ● Verstärkung ● Skills zur Verhaltensbeeinflussung und Lenkung in Richtung Therapie N=62 CSOs Compliance: 87% 6-Monats-Katamnese: ● 74% erfolgreiche Vermittlung in Therapie ● 100% CSOs berichten eine Besserung bzgl. Depression, Angst, oder somat. Symptomen Myers et al, 1998 Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Kognitive Therapie Neue Erkenntnisse zur Suchttherapie und den Grundlagen der Abhängigkeit Gehäufteres Auftreten komorbider Störungen i. R. der stationären Behandlung i. d. letzten Jahren Veränderte therapeutische Behandlungskonzepte - Kognitives Modell der Sucht (Marlatt, 1985) - Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 1991) - Modell zur Veränderungsmotivation (Prochaska & DiClemente, 1992) - Kognitive Therapie der Sucht (Beck, 1997) Peukert, Mänz 2005 Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Behandlungsmodule i. R. der 6-wöchigen stationären Behandlung KVT - Gruppe (Kognitive Verhaltenstherapie) Sozial-Emotionales Kommunikationstraining Psychoedukationsgruppe Angehörigengruppe Expositionstherapie (Cue-exposure) Raucherentwöhnung Weitere Angebote : • Diagnostische Abklärung und ggf. medikamentöse sowie psychotherapeutische Einzelbehandlung der komorbiden Störung • Ggf. Vermittlung einer ambulanten Psychotherapie • Physio- und Ergotherapie • Entspannungstraining (PMR / AT) Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Persönlichkeitsstörungen und Sucht Suchtkranke Patienten weisen gehäuft ● antisoziale ● narzisstische ● emotional-instabile Persönlichkeitsstörungen auf z.B. MIDAS-Studie (Zimmermann et al. 2005) Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen „Dual Focus“ Therapien bei Sucht und Persönlichkeitsstörungen Dual Focus Schema Therapy (DFTS) Sucht: Rückfallprävention Persönlichkeitsstörung: Schema-fokussierte Techniken Bei Opiatabhängigen wirksame Ergänzung im Verlauf von 6 Monaten Ball, 1998 Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen „Dual Focus“ Therapien bei Sucht und Persönlichkeitsstörungen Dialektisch Behaviorale Therapy (DBT-S) Sucht: Motivationsaufbau, Verstärkung, Abstinenzorientierung Persönlichkeitsstörung: zusätzliche Skills, dialektischer Umgang mit Suchterkrankung Bei Alkoholabhängigen wirksame und akzeptierte Therapie nach 12 und 14 Linehan et al. 1991 Monaten Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen DBT – Sucht (Dimeff & Linehan 2008) Ursprünglich als Therapie für chronisch suizidale BL-Patienten mit Suchtproblemen konzipiert. ● Positive Studienlage (N=2; Linehan et al. 1999, 2002) Therapeutischer Ansatz: ● ● Akzeptanz und Veränderung Gestörte Affektregulation und dysfunktionale Verhaltensmuster Prävalenz bei Sucht: 65%! (Trull et al. 2000) - 15% (Bohus et al. 2006) Prävalenz Sucht bei BL: 26 – 84 % (Kienast et al. 2009) Klinisch zeigt sich eine Wirksamkeit auch bei Suchtpatienten, die andere psychische Störungen aufweisen und bisher keinen therapeutischen Erfolg hatten. ● Effektivitätsstudien fehlen noch! Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen DBT - S Inhalte Förderung der Therapiemotivation des Patienten Stärkung der Selbstverpflichtung des Patienten zur Abstinenz Erwerb und die Anwendung von funktionellen Fertigkeiten (Skills) zur Ablösung dysfunktionaler Bewältigungsmethoden Erarbeiten von individuellen Methoden zur Verminderung des Konsums bzw. zur Einhaltung der Abstinenz bei Abhängigkeit Trainieren und Automatisieren von neu gelernten Verhaltensweisen Verminderung von entzugs- oder abstinenzinduzierten Beeinträchtigungen der Lebensqualität Veränderung der Alltagsrituale und des Umfelds der Betroffenen Erhaltung der Motivation des Therapeuten und die Vermeidung von „Burn-out“ Kienast et al. 2009 Reduktion des Alkohol- und Drogenverlangens Aufbau von abstinenzunterstützenden Kontakten Reduktion von Reizexpositionen im Alltag Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen Was brauchen wir? Störungsspezifische Suchttherapien: ● Depression: kognitive VT, antidepressive Behandlung ● Psychosen: Psychoedukation, Psychoedukation, … , antipsychotische Behandlung ● Angststörungen: Expositionsbehandlung, Angstbewältigungstraining ● Persönlichkeitsstörungen: DBT-S, DF-T Prof. Dr. A. Batra, Sektion Suchtmedizin und Suchtforschung – Universitätsklinik Tübingen