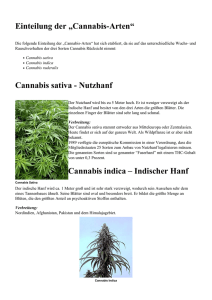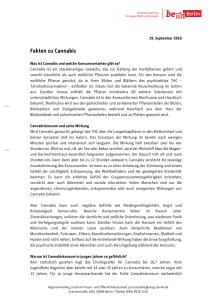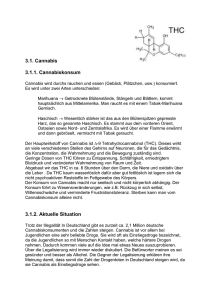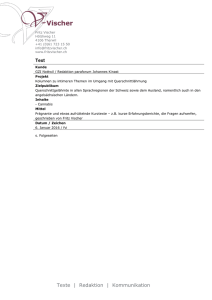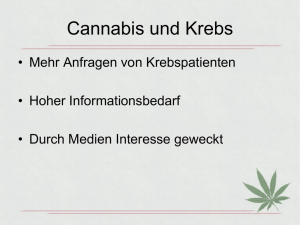Impulsreferat Dr. med. Herbert Scheiblich
Werbung
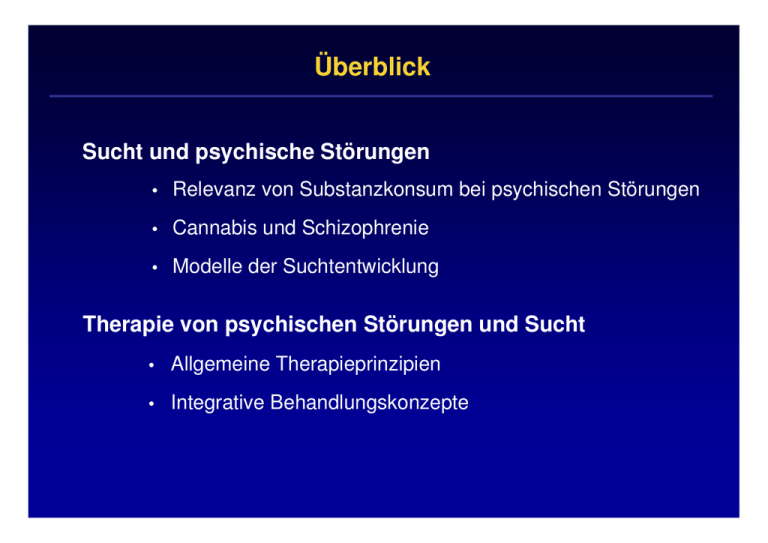
Überblick Sucht und psychische Störungen • Relevanz von Substanzkonsum bei psychischen Störungen • Cannabis und Schizophrenie • Modelle der Suchtentwicklung Therapie von psychischen Störungen und Sucht • Allgemeine Therapieprinzipien • Integrative Behandlungskonzepte Häufigkeit von Substanzkonsum bei psychischen Störungen Lebenszeit Vorkommen Substanzmissbrauch bzw. Abhängigkeit bei psychischen Störungen: Schizophrene Störungen 48%, bipolare Störungen 56% versus 17% Allgemeinbevölkerung (ECA, N=20291, Regier et al. 1990). 25-35% Substanzmissbrauch in den letzten 6 Monaten (u.a. Mueser, 1995) Besonders häufig ist Cannabiskonsum bei Ersterkrankten bzw. jungen schizophrenen Patienten (z.B. Cantwell et al. 1999, Häfner et al. 2002) Charakteristika von Patienten mit Substanzmissbrauch und psychischen Störungen Charakteristika vergleichbar mit der Allgemeinbevölkerung: • Die am häufigsten gebrauchten Substanzen sind Tabak, Alkohol und Cannabis • Substanzmissbrauch/-abhängigkeit ist assoziiert mit männlichem Geschlecht, Jugend, Partnerlosigkeit, Ausbildungsstatus, Substanzmissbrauch in der Familie. Spezifisch bei psychiatrischen Störungen: • Erhöhte Sensitivität gegenüber psychotropen Substanzen. • Geringerer Anteil eines kontrollierten Konsums, ohne negative psychische oder soziale Konsequenzen (<5%). (z.B. Mueser et al. 1998) Probleme bei betroffenen Patienten Symptomatik und Verlauf: • Früherer Beginn psychiatrischer Symptome (z.B Kovasznay et al. 1997) • Symptomverschlechterung und häufigere Rückfälle (z.B. Linszen et al., 1994) • Assoziation mit sexueller u. körperlicher Viktimisierung (z.B. Alexander 1996) • Mehr aggressives und gewalttätiges Verhalten (z.B. Smith und Hucker, 1994) • Erhöhtes Risiko für körperliche Folgeerkrankungen (z.B. Maslin, 2001) Soziale Folgen: • Verschlechterung von Funktionsniveau/Arbeitssituation (z.B. Caspari, 1998) • Reduktion sozialer Kontakte, finanzielle Probleme, Obdachlosigkeit (z.B. Drake et al. 1991) Probleme in der Therapie: • Gesteigerte Inanspruchnahme von Versorgung (z.B Hipwell et al. 2000) • Geringere Behandlungsadherence (z.B. Owen et al. 1996) Hypothesen zum Zusammenhang von Cannabis und Psychose 1. Nur scheinbare Zusammenhänge zwischen Cannabis und Psychose (z.B. gemeinsame Risikofaktoren) 2. Cannabis führt zur Entstehung von Psychosen 3. Cannabis beschleunigt das Auftreten von Psychosen bei vulnerablen Individuen („Sensitivitätshypothese“) 4. Psychotische Störungen führen zu einem gesteigerten Konsum („Sekundäre Suchtentwicklung“) 5. Cannabis wirkt sich negativ auf den Verlauf psychotischer Störungen aus (Thornicroft 1990, Degenhardt & Hall 2002) Modelle der „sekundären Suchtentwicklung“ Psychische Erkrankungen können die Wahrscheinlichkeit für Substanzkonsum erhöhen: Empfänglichkeit gegenüber Einflüssen der „Peers“, stärkere Orientierung in Richtung von „Subkulturen“, Selbstkonzept des „Drogen-users“ akzeptabler als das des „psychisch Kranken“ (e.g. Baigent et al. 1995). „Selbstmedikationshypothese“: Patienten setzten Substanzen ein um Symptome bzw. Medikamenteneffekte zu beeinflussen (Khantzian 1985, Schneier & Siris 1987). Studien zur Konsummotivation • Differenzierte individuelle Erwartungen an die Substanzwirkung (Mueser et al. 1995). • Teilweise ähnlich der Motivation in der Allgemeinbevölkerung: „Spannungsreduktion“, „Erleichterung von Sozialkontakten“ (Dixon et al. 1991, Mueser et al. 1992). Diese Effekte können bei psychiatrischen Patienten eine andere Wertigkeit haben. In verschiedene Studien auf individueller Ebene explizite „Selbstmedikation“, z.B. von Positivsymptomen (z.B. Dixon et al. 1991). Therapie von psychischen Störungen und Sucht Behandlungsmodelle Traditionell: Entweder Entzugsbehandlung bzw. psychiatrische Behandlung Schwierigkeit: Ansätze jeweils nicht ausreichend, bzw. nicht angemessen Parallel/Sequentiell: Behandlungen der beiden Problembereiche getrennt voneinander in jeweils spezialisierten Einrichtungen Schwierigkeit: Integration der unterschiedlichen Ansätze muss von Patienten selbst geleistet werden, Patienten „fallen durchs Netz“ Integrativ: Sucht- und psychiatrische Behandlung durch dieselben Professionellen als Therapie der Wahl Schwierigkeit: Gratwanderung, individuelle Therapie, Angebot Welches Setting ist günstig? Begrenzte Effektivität kurzfristiger intensiver Programme. Nötig ist langzeitorientierter Behandlungsansatz mit Schwerpunkt im ambulanten Bereich: niedrigschwellige, wohnortnahe Behandlung über mehrere Jahre Settingübergreifende Beziehungs- und Behandlungskontinuität Gerade für Doppeldiagnosepatienten ist es schwer, „KommStrukturen“ für sich zu nutzen: Nachgehende Betreuung („home treatment“-Konzepte) Allgemeine Therapieprinzipien Therapieprogramm muss auf den individuellen Patienten Abgestimmt und die Behandlung dem jeweiligen Motivationsstadium angepasst sein Veränderungsmotivation als sich dynamisch verändernde Größe, Therapieziele müssen als vorläufig verstanden werden Hohes Maß an Flexibilität! Eher fordernde und eher stützende Elemente müssen flexibel gewichtet werden. „Harm Reduction“ Ansatz, Abstinenz keine Behandlungsvoraussetzung Komponenten der Behandlung Aus aktueller Sicht sollten erfolgversprechende Programme Kombinationen darstellen aus: Elementen der Motivationsbehandlung (MET) Psychoedukation Verhaltenstherapeutischen Ansätzen Familieninterventionen Psychopharmakotherapie Selbsthilfe (?) Phasengerechte Behandlung Absichtslosigkeit Absichtsbildung Umgang mit Rückfällen Aufrechterhaltung Vorbereitung Handlung Behandlung von Psychose und Sucht: Motivierende Gespächsführung Grundprinzipien der therapeutischen Haltung zur Förderung der intrinsischen Abstinenzmotivation Express empathy: Zuhören, offene Kritik vermeiden, Verständnis ausdrücken, Willen respektieren Develop Discrepancy: Diskrepanz zwischen aktueller Situation und Zielen aufdecken Avoid argumenation: kein Versuch den Patienten mit Argumenten zu überzeugen, dass er ein Suchtproblem hat. Roll with resistance: Widerstand erkennen, nicht benennen und umschiffen. Support self-efficacy: Realistischen Optimismus stärken Wichtig: Berücksichtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit und sozialen Situation Psychoedukation bei Doppeldiagnosepatienten Inhalte von Psychoedukationsprogrammen z.B. bei Psychosen : Psychosen: Ursachen, Frühwarnzeichen, Akutsymptome, Prognose (Pharmakotherapie und Nebenwirkungen) Wirkung von Suchtstoffen, Entzug Wechselwirkungen zwischen psychischer Störung und Suchtstoffen Verhaltenstherapeutische Interventionen Generell: Schwerpunkt auf verhaltensbezogenen, weniger komplexen kognitiven Verfahren Aufbau und Festigung von Alternativverhalten, Fertigkeiten zur Problembewältigung und Rückfallprävention Stressbewältigung und Ressourcenaufbau Training allgemeiner sozialer Fertigkeiten Familieninterventionen Einbezug so früh wie möglich sollte angestrebt werden (cave: Überforderung), Informationsvermittlung, Psychoedukation: Entlastung der Familie (bzw. des Systems) Verständnis für die Erkrankung, Förderung einer konstruktiven Kommunikation, Motivation zu emotionaler und u.U. praktischer Unterstützung (z.B. finanziell,...) Compliance, Unterstützung der Behandlung durch das Familiensystem wird erhöht Pharmakotherapie allgemein bei komorbidem Substanzkonsum Substanzmissbrauch wird häufig zur Beeinflussung verschiedener Symptome genutzt. Diese Symptome sollten ein wesentliches Ziel der pharmakologischen Behandlung sein (Krystal, 1999) Zusätzlicher Einsatz von Antidepressiva empfohlen, da häufig depressive Symptome mit Substanzkonsum einhergehen (Ziedonis et al., 1992) Individuelle Kombination mit Substanzspezifischer Behandlung ggf. Substitution von Opiaten u. Benzodiazepinen (Day, 2001) “Psychoedukatives Training für Patienten mit der Doppeldiagnose Psychose und Sucht (PTDD)” Grundwissen zu Psychosen (Ätiologie, Frühwarnzeichen, ...) wird vorausgesetzt Insgesamt 6 Sitzungen, anwendbar in verschiedenen Settings Anhand bestimmter Substanzen (Alkohol/Benzos, Cannabis, Amphatemine/MDMA) wird Wissen über Wirkungen, Motivation, positive bzw. negative Verhaltenskonsequenzen vermittelt Insgesamt starke Betonung auf Wissensvermittlung und dabei wiederum auf „Problemen und Gefahren“, Verhaltensalternativen werden benannt aber wenig ausführlich erarbeitet (Gouzoulis-Mayfrank 2003) “Gesund und ohne Abhängigkeit leben (GOAL)” Grundwissen zu Psychosen (Ätiologie, Frühwarnzeichen, ...) wird vorausgesetzt Nicht substanzspezifisch, aber nicht geeignet, wenn Opioid- oder Alkoholabhängigkeit im Vordergrund 12 Sitzungen, 2x/Woche, 6-8 Teilnehmer 2 Blöcke, ermöglicht Einstieg nach drei Wochen (halboffen), Vermittlung von Wissen, Erarbeitung von Risikosituationen, stärkerer Akzent auf Alternativstrategien und Ressourcen (Vertraute Person, „Notfallkarte“,...) (D‘Amelio et al. 2002) Die Theorie von der „Cannabispsychose“ Durch Cannabis „de novo“ induziert (z.B. Ghodse 1986). Soll sich von substanzinduzierten psychotischen Störungen nach Cannabiskonsum (Auftreten innerhalb von 48 Stunden, kurze Dauer) unterscheiden. Soll sich von der Schizophrenie und anderen psychotischen Störungen unterscheiden: Kürzere Dauer der Episoden, weniger Denkstörungen,... (z.B. Thacore et al. 1976, Basu et al. 1999). „Cannabispsychose“: Welche Evidenz ? Konzept nicht durch wissenschaftliche Befunde untermauert (Thornicroft 1990, McGuire 1994). In „Follow-up“-Studien zeigten sich keine Symptomunterschiede bei Patienten mit und ohne Cannabisgebrauch vor Aufnahme (Mathers & Ghodse 1992). In einer neueren Studie erhielten von 73 ersterkrankten Patienten mit der Diagnose einer „substanz-induzierten psychotischen Störung“ 94% nach 1,5 Jahren die Diagnosen einer Schizophrenie oder Bipolaren Störung (Lambert et al. 2002). Die „Sensitivitätshypothese“ Laut der „Sensitivitätshypothese“ kann Cannabis bei vulnerablen Individuen den Ausbruch von psychotischen Störungen beschleunigen (z.B. Hall 1998). Bei jungen Konsumenten mit positiver Familienanamnese für psychotische Störungen 6-fach erhöhtes Risiko für Psychosen verglichen mit Kontrollgruppe (Miller et al. 2001). Jüngeres Alter bei Konsumenten verglichen mit anderen Patienten (Mathers et al. 1991, Linszen et al. 1994). Aber: Evtl. lediglich Abbild der Verteilung von Konsumenten in der Allgemeinbevölkerung. Pharmakotherapie: Ergebnisse zu Wirksamkeit und Verträglichkeit von Antipsychotika Hinweise, dass komorbide Patienten schlechter auf typische Antipsychotika ansprechen (Bowers, 1990) Zahlreiche Hinweise, dass alkoholmissbrauchende Schizophrene ein höheres Risiko haben EPMS zu entwickeln (Olivera, 1990) Hinweise, dass Amphetaminmissbrauchende Schizophrene in der Akuttherapie höhere Antipsychotika Dosen benötigen, höheres Risiko für EPMS und dysphorische NW Viele Berichte zur guten Wirksamkeit und Verträglichkeit von Clozapin – aber wenige kontrollierte Studien (u.a. Buckley et al., 1994) Empfehlung: Niedrige Dosierungen, frühzeitiger Einsatz von atypische Antipsychotika und Anticholinergika hallo