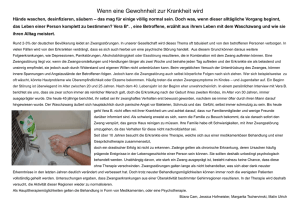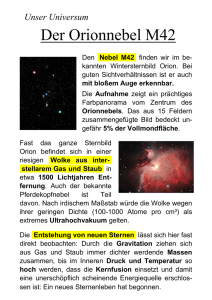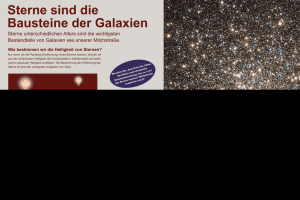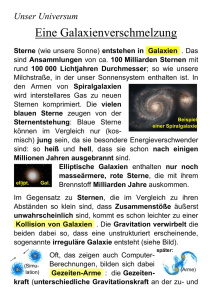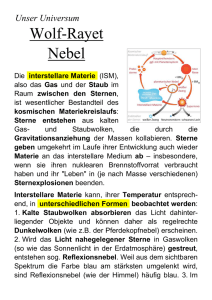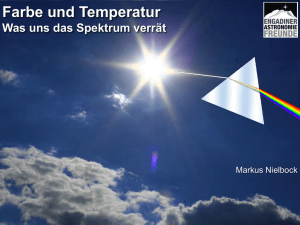Pulsierende Sterne - Institut für Theoretische Astrophysik
Werbung

Vorlesung im SS 2012 Institut für Theoretische Astrophysik, Universität Heidelberg H.-P. Gail und andere Veränderliche Pulsierende Sterne • Helioseismologie • Das η Car Problem • Pulsation und Massenverlust • Hüllen langperiodischer Veränderlicher • Atmosphären pulsierender Sterne • Modellrechnungen zur Pulsation • Theorie der Pulsation • Veränderliche Sterne: Das Beobachtungsmaterial Plan der Vorlesung Seite: 0.1 Seite: 1.1 Abbildung 1.1: Hertzsprung-Russell Diagramm mit den Positionen von veränderlichen Sternen, deren Leuchtkraft und Effektivtemperatur gut bekannt ist, sowie Entwicklungswege von Sternen unterschiedlicher Masse. Veränderliche Sterne im HR-Diagramm Seite: 1.2 Abbildung 1.2: Lichtkurve von Mira Ceti für den Zeitraum vom Jahr 1596 bis zum Jahr 2000. Eine durchgehende Lichtkurve existiert ab dem Jahr 1850. Lichtkurve eines veränderlichen Sterns Seite: 1.3 Bei den meisten Sternen sind deren Zustandsgrößen, speziell ihre Helligkeit, über sehr lange Zeiträume unveränderlich. Nur ein Teil aller Sterne zeigen teils regelmäßige, teils unregelmäßige Schwankungen ihrer Helligkeit über Zeiträume, die von raschen Änderungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume bis zu Variationen, die sich erst nach jahrzehnteoder jahrhundertelanger Beobachtung nachweisen lassen, reichen. Unter Helligkeit wird dabei diejenige im visuellen Spektralbereich verstanden. In früheren Jahrhunderten war das ohnehin die einzige mögliche Beobachtungsgröße. Heutzutage sind auch in anderen Spektralbereichen Beobachtungen möglich, aber mit wenigen Ausnahmen macht sich eine Veränderlichkeit auch immer im optischen Bereich bemerkbar, und zur Klassifikation der Phänomene wird deswegen fast nur dieser Spektralbereich verwendet. 1 Veränderliche Sterne Seite: 1.4 Bei der heute erreichbaren Genauigkeit von Intensitätsmessungen (besser als 10−3 Größenklassen) zeigt praktisch jeder Stern in irgendeiner Form eine gewisse Variabilität auf geringem Niveau. Diese geringen Helligkeitsschwankungen hängen aber meistens mit instationären Vorgängen in den Oberflächenschichten oder der Umgebung des Sterns zusammen, und nicht mit Vorgängen im ganzen Stern. Für diese Art Phänomene interessiert man sich in anderen Bereichen der Astronomie; sie sind aber nicht das, was man eigentlich unter Veränderlichkeit eines Sterns verstehen möchte. Das Ausmaß der Helligkeitsänderungen bei einem Stern kann sehr unterschiedlich sein: Von drastischen Helligkeitsvariationen über viele Größenklassen, bis zu minimalsten Veränderungen. Wenn nur Helligkeitsänderungen von mindestens 0.1 Größenklassen berücksichtigt werden, die in früheren Jahrhunderten der unteren Grenze der damals sicher bestimmbaren Helligkeitsänderung entsprach, dann sind nur wenige Sterne Veränderliche. Von den mit bloßem Auge sichtbaren Sternen erweisen sich in diesem Sinne nur ca. 3% als Veränderliche. Veränderliche Sterne Seite: 1.5 Der Begriff der Veränderlichkeit eines Sterns ist deswegen nur schwer eindeutig festzulegen. Man interessiert sich für solche Phänomene, die mit bestimmten physikalischen Ursachen in Zusammenhang gebracht werden können, die den Stern als ganzes betreffen. Das hat im Laufe der Zeit zur Abgrenzung einer Reihe von Gruppen geführt, die durch spezielle Eigenschaften ihrer Veränderlichkeit charakterisiert werden, und deren Helligkeitsvariationen mit Veränderungen der Zustandsgrößen der Sterne in Zusammenhang stehen. Die Mitglieder dieser Gruppen sind es, die als veränderliche Sterne aufgefaßt werden. Der Begriff der Veränderlichkeit wird im Grunde genommen also nur durch eine Aufzählung der Gruppen und ihrer Eigenschaften, die zu den veränderlichen Sternen gezählt werden, definiert. Neue Gruppen könnten sich jederzeit bei Untersuchungen von Helligkeitsvariationen von Sternen herauskristallisieren. Veränderliche Sterne Seite: 1.6 Bei einer kleinen, aber auffälligen, Gruppe beobachtet man ein plötzliches Aufleuchten und ein nachfolgendes langsames Abklingen der Helligkeit eines Sterns. Ein solcher Ausbruch wird fast immer nur einmal beobachtet. Die Ursachen der Variabilität dieser als eruptive Veränderliche bezeichneten Objekte sind meistens explosive Vorgänge in Einzelsternen (z.B. Supernovae) oder in Doppelsternsystemen (z.B. Novae). Diese Art der Helligkeitsänderungen beruht ebenfalls auf inneren Eigenschaften der Sterne und der Art ihrer Entwicklung. Bei einer großen Gruppe veränderlicher Sterne pulsieren die Sterne und modulieren ihre Oberflächenhelligkeit im Rhythmus der Pulsation. Bei diesen Pulsationsveränderlichen liegt die Ursache ihrer Veränderlichkeit in Besonderheiten ihres inneren Aufbaus begründet. Diese Veränderlichen sind eine der Hauptgruppen aller veränderlichen Sterne, und speziell die verschiedenen Typen pulsierender Sterne, die Ursache ihrer Variabilität und deren Eigenschaften, werden hier betrachtet. Bei den Objekten, die zu den veränderlichen Sternen gezählt werden, sind einige grundsätzlich verschiedene Hauptgruppen zu unterscheiden. Veränderliche Sterne Seite: 1.7 Bei einer anderen großen Gruppe ist die Ursache einer Helligkeitsschwankung die Tatsache, daß das untersuchte Objekt ein Doppelsternsystem ist. In einem Teil der Fälle ist dessen Bahnebene relativ zur Sichtlinie nur wenig geneigt, sodaß es von Zeit zu Zeit zu einer gegenseitigen Bedeckung beider Sterne kommt. Die Sterne selbst sind in diesem Fall also gar nicht veränderlich; die Veränderlichkeit der empfangenen Lichtmenge bei diesen sog. Bedeckungsveränderlichen wird nur durch eine Abschattung bewirkt. Es hat in der Vergangenheit relativ lange gedauert, bis man gelernt hat, die wechselseitige Bedeckung zweier Sterne von der Pulsation eines Einzelsterns zu unterscheiden. Veränderliche Sterne Seite: 1.8 Bei wieder einer anderen Gruppe ist die Helligkeit ungleichmäßig über die Oberfläche verteilt und die Sterne rotieren, präsentieren dem Beobachter also wechselnd helle Teile der Oberfläche. In diesem Fall ist der Stern eigentlich nicht veränderlich. Seine Variabilität ist auch hier ein rein geometrisch bedingt. In einem Teil der Fällen kommt es in einem Doppelsternsystem durch Wechselwirkung der Komponenten (z.B. durch Massentransfer) aber auch zu einer echten zeitlich veränderlichen Emission. Mehrere unterschiedliche Gruppen veränderlicher Sterne verdankt ihre Existenz der Wechselwirkung der Sterne in engen Doppelsternsystemen. Veränderliche Sterne Seite: 1.9 Am 13. August 1596 wurde von David Fabricius bemerkt, daß die Helligkeit eines Sterns im Sternbild Walfisch (Cetus) kontinuierlich abnahm. Im Oktober des Jahres verschwand er dann völlig. Tatsächlich ist der Stern im Maximum von 2ter Größenklasse, im Minimum von 9ter Größenklasse und damit mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Deswegen bezeichnet Fabricius den Stern in Schriften als res mira“. ” Die regelmäßige Veränderlichkeit wurde durch Johann Ph. Holwarda 1638 bemerkt und eine Periode von etwa 11 Monaten bestimmt. Der Stern wird nach Johannes Hevelius allgemein als Mira“, die Wunder” same, bezeichnet. Dies war die erste Entdeckung eines Sterns, der sich später als Pulsationsveränderlicher erwies. 1.1 Historisches Seite: 1.10 Abbildung 1.1: Lichtkurve von Mira Ceti für den Zeitraum vom Jahr 1596 bis zum Jahr 2000. Eine durchgehende Lichtkurve existiert ab dem Jahr 1850. Lichtkurve eines veränderlichen Sterns Seite: 1.11 Bei Algol wurde eine Veränderlichkeit im Jahr 1669 durch Montanari festgestellt und 1789 durch Goodricke die Periode bestimmt. Es ist möglich das die Helligkeitsschwankungen schon in der Antike bemerkt wurden. Auch der Name, der aus dem Arabischen stammt und soviel wie Dämon“ bedeutet, scheint darauf hinzudeuten. Dies war die erste ” Entdeckung eines Sterns, der sich als Bedeckungsveränderlicher erwies. Historisches Fabricius Montanari G. Kirch Maraldi Koch Pigott Goodricke Goodricke W. Herschel Pigott Pigott Harding Harding Fritsch Harding Harding Schwerd J. Herschel o Ceti (Mira) β Persei (Algol) χ Cygni R Hydrae R Leonis η Aquilae β Lyrae δ Cephei α Herculis R Coronae Borealis R Scuti R Virginis R Aquarii Aurigae R Serpentis S Sepentis R Cancri α Orionis Nach Hoffmeister (1970) Entdecker Stern 1639 1669 1687 1704 1782 1784 1784 1784 1795 1795 1795 1809 1810 1821 1826 1828 1829 1836 Mira Algol Mira Mira Mira δ Cep β Lyr δ Cep SRc R CrB RV Tauri Mira Mira Algol Mira Mira Mira SRc Jahr Typ 331.2 2.867 408. 1 388.9 309.9 7.177 12.91 5.366 irr. irr 146.5 145.6 390.0 9984 182.1 356.4 371.8 361.6 Periode [d] Doppelstern 3-fach Doppelstern Seite: 1.12 Tabelle 1.1: Die im Jahre 1844 bekannten Veränderlichen, mit ihren heutigen Bezeichnungen, Variablentypen und Perioden. Historisches Seite: 1.13 Die Entdeckung weiterer Veränderlicher kam nur schleppend in Gang. Bis zum Jahr 1844 waren erst 18 veränderliche Objekte bekannt, die in Tabelle 1 aufgelistet sind. Dies ist eine korrigierte Auflistung der von Fr. Argelander 1844 in einem Artikel genannten Veränderlichen (2 heute als nicht variabel eingestufte Sterne gestrichen, zwei von Fr. Argelander übersehene Entdeckungen ergänzt). In diesem Artikel beschrieb er, was damals über stellare Variabilität bekannt war und gab detailliert eine Methode zur Beobachtung von Variabilität an, die auch von Amateuren mit einfachen Hilfsmitteln angewendet werden kann. Historisches Chalmers Müller & Hartwig Prager Kukarkin, 1. Aufl. Kukarkin, 2. Aufl. Kukarkin, 3. Aufl. Kukarkin, 4. Aufl. GCVS (Samus ++) 1865 1916 1937 1948 1958 1970 1981 2012 113 1986 6968 10 912 14 708 20 448 28 457 40 835 Anzahl Seite: 1.14 Diese Zahlenangaben beziehen sich auf bestätigte Veränderliche in der Milchstraße. Zusätzlich gibt es zahlreiche Objekte, die vermutlich veränderlich sind, bei denen eine Bestätigung dessen aber noch aussteht, sowie zahlreiche extragalaktische Objekte, vor allem in den Magellanschen Wolken, die jeweils in separaten Katalogen erfaßt sind. Katalog Jahr Das hat die Beobachtung von Veränderlichen stark beflügelt und die Anzahl der entdeckten Veränderlichen stieg danach rapide an: Historisches Seite: 1.15 Eine völlig andere Art von Veränderlichkeit stellt das einmalige helle Aufleuchten eines Sterns dar, der für eine gewisse Zeit sichtbar bleibt und dann nach allmählicher Helligkeitsabnahme nach einiger Zeit zu schwach wird, um noch weiter beobachtet werden zu können. Solche Ereignisse sind bereits aus antiken europäischen Quellen und aus alten chinesischen und japanischen Quellen überliefert. Es handelt sich dabei um Novae oder Supernovae. Wegen des plötzlichen Erscheinens des Sterns an einer Position am Himmel, an der vorher kein Stern beobachtet wurde, sprach Brahe in der Beschreibung der von ihm entdeckten Supernova von stella nova“ und diese Bezeichnung (obwohl eigentlich ” nicht korrekt) wird seit dem für dieses Phänomen verwendet. Historisches China China China China China T. Brahe J. Kepler Flamstedt viele 185 386 1006 1054 1181 1572 1604 1667 1987 Centaurus Scorpius Lupus Taurus Cassiopeia Cassiopeia Ophiuchus Cassiopeia LMC Konstellation 20 Monate 8 Monate 24 Monate 24 Monate 6 Monate 18 Monate 12 Monate — Visuell sichtbar Seite: 1.16 Es gibt noch weitere mögliche Beobachtungen, aber da sind die historischen Quellen nicht ganz eindeutig. Von zahlreichen weiteren Supernovae sind heute die Überreste im Radiobereich und im Röntgenbereich gefunden. Die meisten galaktischen Supernovae sind wegen der Staubabsorption optisch nicht sichtbar. Entdecker Jahr Die historischen Supernovae sind: Historisches Entdecker Scheiner Anthelm Richer Hevelius d’Agelet — Hind Tebbutt Birmingham Jahr 1612 1670 1673 1678 1783 1843 1848 1862 1866 Leo Vulpecula Leo Puppis Sagittarius Carina Ophiuchus Scorpius Corona Borealis Konstellation 4.0 Magn. 2.6 Magn. 3.0 Magn. 6.0 Magn. 6.0 Magn. -0.8 Magn. 2.0 Magn. 5.0 Magn. 2.0 Magn. Visuell sichtbar Die mit bloßem Auge sichtbaren historischen Novae waren: Historisches Seite: 1.17 Seite: 1.18 An der Entdeckung von Veränderlichen Sternen hat die Arbeit zahlreicher Amateurastronomen eine sehr verdienstvolle Rolle gespielt. Die Langzeitüberwachung von Sternen mit teilweise sehr langen Perioden kann von der professionellen Astronomie nicht geleistet werden und bietet Amateuren ein reiches Betätigungsfeld, zumal hierfür nicht unbedingt große Instrumente erforderlich sind. Historisches Seite: 1.19 Zur Orientierung am Nachthimmel werden seit dem Altertum die Sternbilder oder Konstellationen verwendet. Die Himmelskugel wird in Areale eingeteilt, in denen jeweils auffällige Sterngruppen, meistens besonders helle Sterne, zu sog. Sternbildern zusammengefaßt werden. Diese Gruppen werden mit bestimmten Namen belegt und geben dem betreffenden Areal am Himmel seinen Namen. Dieses aus der Antike überkommene Schema dient auch heute noch zu einer raschen Orientierung am Sternenhimmel. 1.2 Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.20 Nach einem Beschluß der Internationalen Astronomischen Union von 1930 sollen in der astronomischen Wissenschaft die lateinischen Bezeichnungen verwendet werden, um Unklarheiten oder Mißverständnisse zu vermeiden, die durch bei Verwendung unterschiedlicher Bezeichnungen der Sternbilder in unterschiedlichen Sprachen entstehen können. Am nördlichen Sternhimmel werden im wesentlichen die Namen verwendet, die bereits Ptolemäus in seinem Verzeichnis von 150 n. Chr. verwendet hat. Sie entstammen meist der antiken Mythologie. Die Namen am südliche Himmel wurden durch die frühen europäischen Seefahrer geprägt und beziehen sich vielfach auf Begriffe aus der Seefahrt. Die Grenzen der einzelnen Himmelsareale sind durch Konventionen festgelegt. Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.21 Helle Sterne am Himmel oder solche, die in irgendeiner Weise auffällig sind, werden mit individuellen Namen bezeichnet. Die meisten dieser Namen sind arabischen, griechischen oder lateinischen Ursprungs. Um auch weniger auffällige Sterne am Himmel eindeutig zu charakterisieren, führte Johannes Bayer 1603 in seinem Sternverzeichnis folgende Bezeichnungsweise ein: Die Sterne im Feld eines Sternbildes werden mit kleinen griechischen Buchstaben (α, β, γ, . . . ; falls diese nicht ausreichen, dann weiter mit kleinen und bei Bedarf mit großen lateinischen Buchstaben) bezeichnet und dieser dem Genitiv des Namens des Sternbildes vorangestellt. Beispielsweise wird Sirius, der hellste Stern am Himmel und im Sternbild Canis Major, nach diesem Schema als α Canis Majoris bezeichnet, oder, unter Verwendung der Abkürzung für das Sternbild, kürzer als α CMa bezeichnet. Einige der hellsten Sterne mit ihren Bezeichnungen entsprechend diesem Schema sind in Tabelle 1.2 gelistet. Wenn ein Stern einen individuellen Namen trägt, dann wird häufig diesem Namen gegenüber der Bayerschen Bezeichnung der Vorzug gegeben; die Praxis ist hier aber etwas uneinheitlich. Beispielsweise findet man Mira nur relativ selten unter der Bayer-Bezeichnung o Ceti, während Beteigeuze meistens mit der Bayer-Bezeichnung α Orionis benannt wird. Bezeichnung veränderlicher Sterne Bayer Bezeichnung α Canis Majoris α Carinea α Centauri α Bootis α Lyrae α Aurigae β Orionis α Canis Minoris α Eridani β Centauri α Orionis α Aquilae α Tauri α Crucis α Virginis α Scorpii β Geminorum α Piscis Austrini α Cygni β Crucis α Leonis Canis Majoris α Geminorum Name Sirius Canopus — Arcturus Wega Capella Rigel Prokyon Achernar — Beteigeuze Atair Aldebaran — Spica Antares Pollux Formalhaut Deneb — Regulus — Castor -0.7 -0.3 -0.3 -0.1 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 Größenklasse Tabelle 1.2: Die hellsten Sterne und ihre Bezeichnung Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.22 Seite: 1.23 Später wurden dann Sternkataloge erstellt, in denen alle Sterne bis zu einer gewissen Größenklasse möglichst vollständig erfaßt und zusammen mit genäherten Positionen gelistet wurden. Nach Vorläufern in früheren Jahrhunderten wurde in der von Argelander und Schönfeld organisierten sog. Bonner Durchmusterung Mitte des 19. Jahrhunderts der erste große systematische Katalog des nördlichen Sternenhimmels angelegt, der später durch argentinische Astronomen mit der sog. Cordoba Durchmusterung auf den südlichen Sternenhimmel ausgedehnt wurde. Diese Erstellung von Sternkatalogen wird mit immer verbesserten Methoden bis heute bis zu immer lichtschwächeren Objekten fortgesetzt. Spezielle Sterne werden in der astronomischen Literatur dann meistens mit ihren Bezeichnungen in einem der gängigen Katalogen charakterisiert. Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.24 Für veränderliche Sterne wurde ein eigenes Bezeichnungssystem eingeführt. Durch Argelander wurde im Zusammenhang mit der Bonner Durchmusterung folgendes Schema für die Bezeichnung von Veränderlichen eingeführt: Da nach dem Bayer-Schema die Buchstaben R bis Z bei keinem Sternbild verwendet wurden, bezeichnete Argelander die Variablen in einem Sternbild in der Reihenfolge ihrer Entdeckung mit großen lateinischen Buchstaben ab R bis Z, die entsprechend dem BayerSchema dem Genitiv des Namens des Sternbildes vorangestellt wurden. Hiefür gibt es neun Möglichkeiten. Niemand rechnete zu dem Zeitpunkt der Einführung dieser Bezeichnungsweise mit der Entdeckung von mehr als neun Veränderlichen in einem einzigen Sternbild. Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.25 Auch das erwies sich schnell als nicht ausreichend und man begann eine neue Serie nach dem Schema AA, AB, . . . , AZ, dann BB, BC, . . . , BZ und so fort bis QQ, . . . , QZ, wobei der Buchstabe J ausgelassen wird, um Verwechslungen mit I zu vermeiden. Das liefert 271 weitere Möglichkeiten, sodaß mit dieser Bezeichnungsweise insgesamt 334 Veränderliche in jedem der 88 Sternbilder bezeichnet werden können. Das erwies sich aber schnell als unzutreffend. Das System wurde deswegen dadurch erweitert, daß man nach Ausschöpfung der ersten neun Möglichkeiten mit Doppelbuchstaben von RR, RS, . . . bis RZ die Benennung fortführte. Nachdem auch diese Kombinationen ausgeschöpft waren, setzte man die Serie mit SS, . . . , SZ, dann TT, . . . , TZ fort, usw. bis ZZ. Kombinationen, die Vertauschung der Reihenfolge der Buchstaben entsprechen (z.B. SR), wurden nicht verwendet, um eventuellen Verwechslungen vorzubeugen. Das ergab 54 weitere Möglichkeiten zur Bezeichnung von veränderlichen Sternen. Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.26 Die rasch fortschreitende Beobachtungstechnik ließ die Anzahl der Variablen in einige Sternbildern schon Ende des 19. Jahrhunderts an die Grenze der Möglichkeiten dieses Bezeichnungssystems stoßen. Nach einem Vorschlag von Charles Andrè bezeichnet man die Variablen in einem Sternbild in der Reihenfolge ihrer Entdeckung einfach mit mit V1, V2, . . . und setzt dies vor den Genitiv des Namens des Sternbildes. Dieses System der Bezeichnung ist im Prinzip nicht mehr nach oben begrenzt. Für die ersten 334 Variablen beließ man es aber bei der bisherigen Bezeichnung, weil diese Bezeichnungen der betreffenden veränderlichen Sterne in der Literatur seit Jahrzehnten verwendet wurden und viele Klassen von Variablen nach der Bezeichnung bestimmter Prototypen benannt wurden (Z.B. RR Lyrae). Eine Umbenennung hätte nur Verwirrung gestiftet. Man setzt die Reihe deswegen erst nach QZ mit der digitalen Bezeichnung V335 fort. Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.27 Die meisten veränderlichen Sterne, die in der astronomischen Forschung immer wieder untersucht werden, haben Bezeichnungen nach der Bayerschen Bezeichnung der hellsten Sterne oder Bezeichnungen nach dem Schema mit ein oder zwei Buchstaben. Der Grund ist einfach der, daß die hellsten Sterne sich leicht und mit hoher Genauigkeit beobachten lassen und aus diesem Grund ihre Variabilität bereits frühzeitig erkannt wurde, als das ältere Schema der Bezeichnung noch nicht ausgeschöpft war. Bezeichnung veränderlicher Sterne Seite: 1.28 Die Beobachtungen veränderlicher Sterne erstrecken sich oft über Jahre, manchmal Jahrzehnte, und in einigen Fällen über Jahrhunderte. Es ergibt sich die Notwendigkeit, die einzelnen Beobachtungen auf ein einfaches einheitliches Zeitmaß zu beziehen. Hierfür eignet sich das von Joseph Justus Scalinger im Jahr 1581 vorgeschlagene System, das sog. Julianische Datum. In diesem System werden alle Tage fortlaufend numeriert, beginnend ab einem willkrlich festgesetzten Tag, der die Nummer Null erhält. Zeitpunkte innerhalb eines Tages werden als Bruchteile des Tages angegeben. Als Anfangspunkt ist (relativ willkürlich) das Datum des 1. Januar 4713 v. Chr. festgesetzt worden. Der este Tag des Jahres 2000 hatte beispielsweise das Julianische Datum JD 2 451 544. 1.3 Julianisches Datum Seite: 1.29 Wenn Beobachtungszeitpunkte in Julianischen Daten angegeben werden, dann kann durch Auftragen von Messungen gegen das Julianische Datum leicht die Variabilität von Sternen untersucht werden und durch einfache Differenzbildung der zeitliche Abstand zweier Beobachtungen ermittelt werden. Darin liegt der Vorteil dieser Art der Zeitangaben. Die Umrechnung von Kalenderdatum und Uhrzeit der Messung in Julianisches Datum fällt nur einmal bei der Auswertung der Messungen an. Die Umrechnung geschieht am einfachsten mit Hilfe von Tabellen oder heute meist mittels Computerprogrammen. Julianische Daten werden mit JD (von Julianus dies) und der Nummer des Tages in der fortlaufenden Zählung bezeichnet. Dann folgt ein Punkt und darauf der Zeitpunkt innerhalb des Tages in Dezimalbruchteilen. Der Beginn eines Tages ist auf den mittleren Mittag des Nullmeridians festgesetzt. Dies wurde ursprünglich eingeführt, damit es nicht während der Beobachtungszeit europäischer Astronomen (nachts) zu einem Wechsel des Julianischen Datums kommt. Julianisches Datum Seite: 1.30 Solche Lichtkurven können äußerst komplex sein. Teils deuten sich sehr regelmäßige Helligkeitsvariationen an, teils starke Variationen ohne jedes Kennzeichen einer Regelmäßigkeit, teils auch wechselnde Phasen von deutlicher Variabilität mit dazwischen liegenden Phasen ohne jede erkennbare Veränderlichkeit. Es zeigte sich, nachdem Ende des 19. Jahrhunderts eine systematische Untersuchung der veränderlichen Sterne begonnen hatte, daß Sterne mit bestimmten Merkmalen ihrer Lichtkurven oft gehäuft auftreten. Die veränderlichen Sterne wurden dann nach bestimmten Merkmalen ihrer Lichtkurven zunächst rein phänomenologisch in unterschiedliche Klassen eingeteilt, die meistens nach dem ersten bekannt gewordenen Vertreter der Klasse oder nach einem besonders typischen Vertreter benannt wurden und werden. Wenn die beobachtete Helligkeit eines Sterns gegen den Zeitpunkt (in JD) der Beobachtung aufgetragen wird, dann erhält man die Lichtkurve. Genauer erhält man eine Folge von Punkten, die, wenn sie genügend dicht ist, sich, abgesehen von gewissen Streuungen, für das Auge längs einer Kurve anzuordnen scheinen, oft aber auch völlig regellos angeordnet erscheinen. 1.4 Lichtkurven Seite: 1.31 Damit ein Stern als periodischer Veränderlicher bezeichnet wird, muß der Abstand aufeinander folgender Maxima (oder Minima) für alle solche Perioden nicht völlig gleich sein. Abweichungen um bis zu 30% lässt man noch gelten. Erst wenn die Variation der Periodenlängen diese Grenze überschreitet, oder wenn in der Lichtkurve sich wiederkehrenden Maxima und Minima nicht eindeutig identifiziert werden können, oder wenn das periodische Verhalten zeitweilig unterbrochen und später wieder fortgesetzt wird, dann spricht man von halbregelmäßigen Veränderlichen. Wenn die Lichtkurve eine Reihe von Maxima und Minima erkennen läßt, die sich in annähernd gleichen Zeitabständen wiederholen, dann spricht man von einem periodischen Veränderlichen. Die Abstände zweier aufeinander folgender Maxima wird als Periode des veränderlichen Sterns bezeichnet, der Helligkeitsunterschied zwischen Maximum und darauf folgendem Minimum als Amplitude der Veränderlichkeit. Die Lichtkurve muß zwischen Maximum und Minimum und zwischen Minimum und darauf folgendem Maximum nicht unbedingt monoton verlaufen. Es kommen recht komplizierte periodische Lichtkurven vor, die auch Nebenmaxima oder Nebenminima aufweisen. Lichtkurven Seite: 1.32 Eine eindeutige Charakterisierung der Veränderlichkeit als regelmäßig, halbregelmäßig oder unregelmäßig erfordert, daß die Punktfolge der beobachteten Lichtkurve die Merkmale der Lichtkurve genügend dicht überdeckt. Eine Unregelmäßigkeit in der Veränderlichkeit kann beispielsweise bei einem periodischen Veränderlichen vorgetäuscht werden, wenn nur wenige Daten vorliegen, die sehr ungleichmäßig über weit auseinanderliegende Perioden verteilt sind. Eine solchen Daten zugrunde liegende Periode kann aber mit ausfeilten numerischen Methoden festgestellt werden. Ist keinerlei irgendwie geartete Wiederholung im Lichtwechsel der Sterne zu erkennen, dann spricht man von einem unregelmäßig Veränderlichen. Lichtkurven Seite: 1.33 Wenn die Periodenlängen nicht sehr stark variieren, dann kann man die Beobachtungen aus verschiedenen Zyklen der Variation zu einer mittleren Lichtkurve vereinigen, indem man für jede Beobachtung die zeitliche Differenz zu dem letzten vorausgegangenen Maximum (oder Minimum) bildet, diese durch die angenommene Periode dividiert, und die Beobachtungsdaten über dieser sogenannten Phase aufträgt. Diese Phase, üblicherweise mit φ bezeichnet, variiert nach Definition zwischen null und eins. Lichtkurven