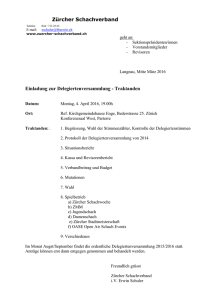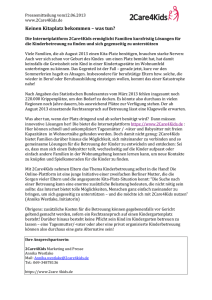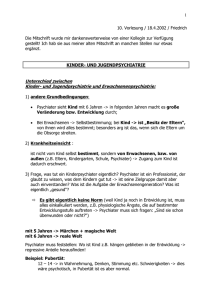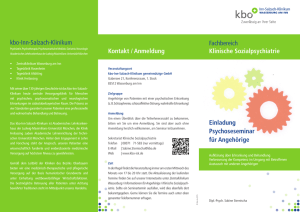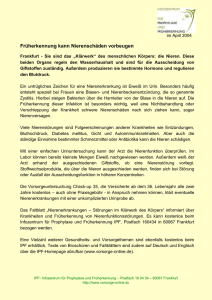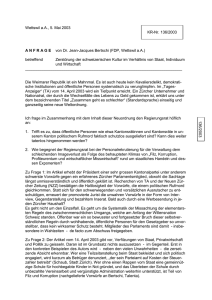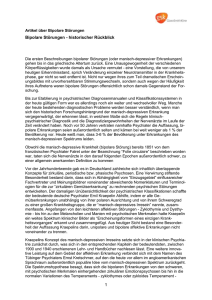Psychische Leiden möglichst früh behandeln
Werbung

40 Tages-Anzeiger – Donnerstag, 8. November 2012 Wissen Wissen im Bild Der grösste Rotor der Welt Diese Hälfte eines gigantischen Rotorblattes gehört zum grössten Flügel einer Offshore-Windanlage, der je gebaut wurde. Er ist mit 75 Metern beinahe so lang wie die Tragfläche eines Airbus 380. Die Windturbine besteht aus drei solchen Rotorblättern. Im Juni waren sie noch in einer Halle im dänischen Aalborg gelagert. Nun werden sie im dänischen Osterild getestet und treiben dabei eine 6-Megawatt-Turbine an. Damit kann ein einziges «Windrad» laut dem Hersteller Siemens den Strom produzieren, der den Jahresbedarf von 6000 Haushalten deckt. Bei solchen Dimensionen ist Ingenieurkunst gefragt. Wären die Rotorblätter laut Siemens nach herkömmlicher Technologie gebaut worden, würden sie 10 bis 20 Prozent mehr wiegen. Die Entwickler verwendeten jedoch leichte Glasfasern und konstruierten hälftig die Rotorblätter aus einem Guss ohne Leimfugen. Das macht sie trotz dem leichten Material stabil. Glasfasern sind verhältnismässig kostengünstig und robust genug, um den gigantischen Kräften des Windes zu widerstehen. Je leichter die Rotoren sind, desto weniger Material braucht es für die gesamte Anlage, vom Maschinenraum über den Turm bis hin zum Fundament. Das wirkt sich deutlich auf die Kosten aus. Die Megawindanlage ist ein grosser Fortschritt. Die erste Siemens-Turbine hatte vor dreissig Jahren eine Leistung, die 200-mal geringer war. (ml) Foto: PD Psychische Leiden möglichst früh behandeln Nachrichten Energietechnik Fortschritt bei Stromnetzen für Windenergie Zürcher Psychiater arbeiten an einer Studie zur Früherkennung von Schizophrenie und manisch-depressiven Störungen bei Jugendlichen. Von Felix Straumann Annika* weiss genau, dass sie ihn gesehen hat: den Mann, der mit seinem Kopf unter dem Arm die Strasse überquerte. Nicht nur einmal, sondern immer wieder an verschiedenen Tagen. Im nächsten Augenblick war der Geist jeweils wieder verschwunden, ohne dass ihn ausser dem 13-jährigen Mädchen jemand gesehen hätte. Sie will deshalb auch niemandem davon erzählen, obwohl die Erscheinungen sie beunruhigen. Später spricht Annika trotzdem über die Geister – mit Miriam Gerstenberg, Assistenzärztin beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) des Kantons Zürich. «Solche Wahrnehmungsstörungen sind in dem Alter relativ häufig», sagt die Psychiaterin. Das Problem sei, dass die Wahrnehmungen oft sehr subtil und schwer fassbar seien. Etwa der Eindruck, dass sich ein Bilderrahmen für kurze Zeit verschiebt oder das Gesicht der Lehrerin vorübergehend entstellt ist. Man müsse deshalb sehr genau nachfragen. Annika gilt als Risikopatientin. Ihre Wahrnehmungsstörungen könnten sich zu einer schweren psychischen Erkrankung entwickeln, glauben Psychiater. Das Mädchen ist deshalb unter den 91 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren, bei denen Zürcher Forscher die Früherkennung von schizophrenen Psychosen und manisch-depressiven, auch bipolar genannten Störung untersuchen. Die Studie, an der auch Miriam Gerstenberg beteiligt ist, findet im Rahmen des Zürcher Impulsprogramms zur nach­ haltigen Entwicklung der Psychiatrie (ZInEP) statt. Sie gehört zu den weltweit ersten Untersuchungen, die das Thema Früherkennung bei Kindern und Jugendlichen bearbeitet. Grosse Vorbehalte Die Früherkennung hat sich seit einigen Jahren zu einer der Hauptrichtungen in der Psychiatrie entwickelt, insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dies nachdem man bei Erwachsenen festgestellt hat, dass bei den meisten von Psychose Betroffenen erste Symptome bereits in der Kinder- und Jugendzeit auftraten. Ob Essstörungen, Autismus, Persönlichkeitsstörungen oder das Zappelphilipp-Syndrom ADHS – psychische Leiden sollen möglichst vorzeitig erkannt werden. «Je früher wir behandeln, umso besser ist der Verlauf und die Prognose für die Betroffenen», sagt Susanne Walitza, Ärztliche Direktorin des KJPD des Kantons Zürich. Allerdings stossen die Bemühungen der Psychiater auf grosse Vorbehalte. Die Befürchtung: Unangepasste Kinder werden zu Unrecht als psychisch krank oder zu Risikofällen erklärt und psychiatrisiert. Solche Kritik wurde beispielsweise auch vor einigen Jahren beim grossen Nationalen Forschungsprogramm Sesam laut. Dieses wollte die psychische Entwicklung von 3000 Kindern ab der Schwangerschaft systematisch erforschen, musste unter anderem deshalb 2008 aber in einem frühen Stadium abgebrochen werden. In der Praxis scheinen solche Befürchtungen allerdings unbegründet. Eher das Gegenteil ist das Problem: «Therapeuten fürchten sich davor, dass sie ihre Patienten voreilig als psychisch krank abstempeln könnten», sagt Gerstenberg. Dies sei ein grosses Dilemma, denn das führe dazu, dass ein Arzt sich selbst bei schweren Fällen davor scheue, die korrekte Diagnose und damit zum Teil auch die entscheidenden Weichen für die spezifische Behandlung zu stellen. «Im Mittel dauert es bei Kindern und Jugendlichen vom Auftreten erster Symptome bis zur Diagnosestellung sechs Jahre und selbst nach Ausbruch einer Psychose mit voller Symptomatik noch sechs Monate.» Patienten entlastet Annika und die anderen in der Zürcher Studie litten bereits unter ihrem Zustand, bevor sie fachliche Hilfe in Anspruch nahmen. So auch die Jugend­ lichen, welche die vor einigen Jahren eingerichtete Früherkennungssprechstunde des KJPD aufsuchen. «Sie kommen, weil sie nicht verstehen, was bei ihnen passiert», sagt Maurizia Franscini, welche die Sprechstunde leitet und an der Studie beteiligt ist. Dies passt zu den Ergebnissen einer noch unveröffentlich- ten Studie der Universität Bern, die feststellte, dass bei Erwachsenen mit Psychose-Risikosymptomen mehr als die Hälfte bereits von sich aus Hilfe gesucht hat (Text unten). Bereits das Gespräch mit dem Therapeuten entlastet die Patienten. Sie merken, dass sie nicht die einzigen sind. «Indem sie über ihre Probleme sprechen können, wird ein Tabu gebrochen», sagt Franscini. Die Folge ist das Gegenteil der verbreiteten Befürchtungen: weniger Stigma und Abstempelung. Zudem lernen die Jugendlichen, dass ihr Schicksal trotz Psychosefrühsymptomen nicht besiegelt ist. Franscini: «Bei Erwachsenen Kritiker befürchten, dass unangepasste Kinder voreilig als psychisch krank erklärt und psychiatrisiert werden. erkrankt rund ein Viertel derjenigen mit hohem Psychoserisiko tatsächlich.» Bei Jugendlichen sei dies noch nicht klar. Die erste Phase der Studie, die seit zweieinhalb Jahren läuft, ist nun abgeschlossen, und es werden keine neue Studienteilnehmer mehr aufgenommen. Am vergangenen Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (SGKJPP) in Zürich stellte Miriam Gerstenberg erste Resultate vor. «Es ist erstaunlich, in welche Richtung sich die Jugendlichen entwickeln», sagt sie. So hätten Jugendliche im Vergleich zu Erwachsenen häufig unspezifischere Symptome. Dazu zählen zum Beispiel Gedanken, die durcheinandergeraten oder von anderen Gedanken unterbrochen werden, sozia- Häufigkeit Drei Prozent leiden unter Risikosymptomen Rund ein Prozent der Bevölkerung ist oder war bereits von einer Psychose betroffen, gehäuft im jungen Erwachsenenalter zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Allein im Kanton Zürich erkranken jedes Jahr gegen 700 Erwachsene neu, bei Jugendlichen sind keine genauen Zahlen bekannt. In ähnlicher Grössenordnung bewegt sich die Häufigkeit der manisch-depressiven, auch bipolar genannten Störung, wobei die Angaben widersprüchlich sind. Viele sind bereits vor dem 25. Lebensjahr zum ersten Mal betroffen. Früherkennungsprojekte laufen an verschiedenen Orten in der Schweiz. Neben jener in Zürich widmet sich an der Universität Bern eine zweite grössere Schweizer Studie auch Kindern und Jugendlichen. Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (SGKJPP) präsentierten Berner Forscher erste Zahlen zur Verbreitung von Psychose-Risikosymptomen bei 16 bis 40-Jährigen. Von 1200 zufällig ausgewählten Personen waren in den letzten drei Monaten 2,8 Prozent davon betroffen. Die Hälfte davon litt an einer zusätzlichen psychischen Störung. Ähnlich viele haben wegen ihrer Beschwerden bereits Hilfe gesucht. (fes) ler Rückzug oder Gefühle von Unwirklichkeit («alles fühlt sich an wie im Film») – häufig verbunden mit einem Leistungsknick in der Schule. Die Geister verschwinden Für die Studie mussten Annika und die anderen Jugendlichen umfangreiche Interviews und neuropsychologische Tests absolvieren. Hinzu kamen Blutuntersuchungen und Aufnahmen des ­Gehirns der Jugendlichen. Ausserdem wollen die Forscher künftig mittels Genanalysen den Einfluss der Vererbung analysieren. Wie stabil sich die Symptome bei den Jugendlichen entwickeln, muss noch ausgewertet werden. Es deutet sich jedoch an, dass Risikosymptome für eine Psychose insbesondere bei Jugendlichen häufig wieder verschwinden. So auch bei Annika. Ein halbes Jahr später, als sie erneut bei der Therapeutin ist, erwähnt sie die Geister nicht mehr. Sie erinnert sich nicht einmal mehr daran, diese jemals gesehen zu haben. Dennoch bleibt sie Risikopatientin. Ihr machen Stimmungsschwankungen zu schaffen, und sie musste zwischenzeitlich wegen einer Depression zur Therapie in eine Klinik. Für die kommenden Jahre erwarten die Forscher zahlreiche weitere Ergebnisse. Auch zu möglichen präventiven Therapien, die sie ebenfalls im Rahmen der Studie untersuchen. Die Zürcher Psychiater bieten den Betroffenen zurzeit ein sogenanntes Gruppentraining zur Vorbeugung von psychischen Krisen an. Darin lernen die Jugendlichen vor allem einen besseren Umgang mit Stress und Gefühlen, etwa durch eine andere Interpretation von Lebenssituationen. «Wahnvorstellungen und auch Depressionen werden häufig durch falsche Annahmen oder Fehlinterpretationen der Umwelt verstärkt», erklärt Franscini. Auch Medikamente wie Antidepressiva oder Antipsychotika sind bei starken Symptomen ebenfalls ein Thema. Allerdings ist über den Nutzen bei einer Frühbehandlung wenig bekannt, und es gibt für Kinder und Jugendliche keine offiziellen Richtlinien. «Es ist daher wichtig, eine möglichst geringe Dosis zu finden, die ausreichend auf die Zielsymptomatik wirkt», so Franscini. Annika hat die frühe Intervention wahrscheinlich tatsächlich geholfen. So kann sie wieder zur Schule gehen und ist dort gut gestartet. Gerstenberg: «Das Psychoserisiko und der Leidensdruck haben sich inzwischen klar vermindert.» * Name geändert Ingenieure des Elektrokonzerns ABB haben es laut dem Unternehmen geschafft, eine Sicherung für HochspannungsGleichstrom-Übertragungsnetze (HGÜ) zu entwickeln. Damit können lange Stromtrassen – wie etwa von Windparks der Nordsee in den Süden – stabiler betrieben werden. Schutzschalter waren bisher das fehlende Glied für einen ­flächendeckenden Durchbruch dieser Technik. Bei der Gleichstromübertragung sind die Verluste im Gegensatz zum gängigen Wechselstrom-Transfer auf langen Strecken geringer. Damit liessen sich die Stromverluste um bis zu 50 Prozent senken. Die neuen Schutzschalter lösen ein Kernproblem der HGÜ. Bislang wurden die Verbindungen meist genutzt, um zwei Punkte miteinander zu verbinden. Nun können mehrere Verbraucher wie etwa Industriebetriebe angeschlossen werden. (SDA) Gesundheit Dosierung von Medikamenten für Kinder online prüfen Welches Medikament in welcher Dosierung für ein Kind passt, ist manchmal schwierig zu bestimmen. Das Kinderspital Zürich hat deshalb eine Datenbank lanciert, welche Ärzten, Apothekern und Kinderspitälern gratis Auskunft gibt. Abrufbar sind Informationen des jeweiligen Herstellers, Forschungserkenntnisse und Erfahrungen aus der klinischen Praxis des Kinderspitals. (SDA) www.kinderdosierungen.ch Zoologie Urbanisation verändert Verhalten der Vögel Stadtvögel verändern im Gegensatz zu ihren Verwandten auf dem Land ihre Überlebensstrategien. Eine internationale Studie in der Fachzeitschrift «Ani­ mal Behaviour» zeigt, dass sich der Respekt vor Feinden bei Vögeln in Stadt­ gebieten mit wechselnder Umgebung verändert. So passen sie sich neuen Bedrohungen wie etwa Katzen an, und die üblichen Feinde wie Greifvögel werden nebensächlich. Urbanisation hat demnach einen direkten Einfluss auf das Verhalten der Vögel. (ml) Stadtvögel wie die Amsel passen sich den Bedrohungen in der Stadt an. Foto: PD