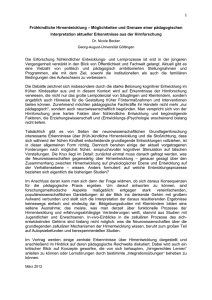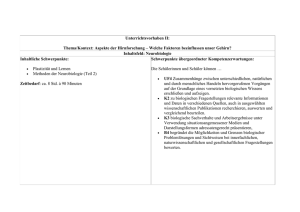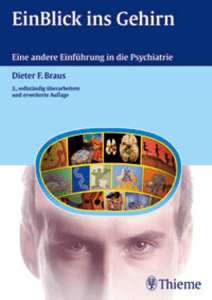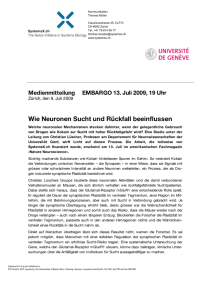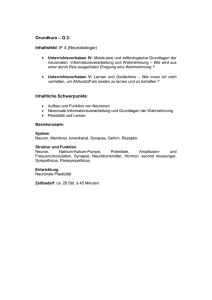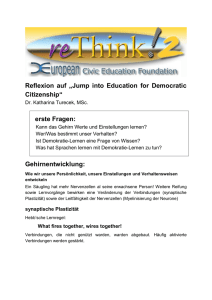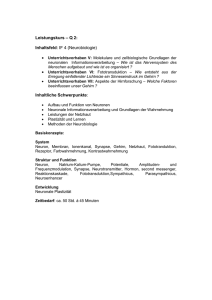Frühkindliche Hirnentwicklung – Möglichkeiten und Grenzen einer
Werbung

Frühkindliche Hirnentwicklung – Möglichkeiten und Grenzen einer pädagogischen Interpretation aktueller Erkenntnisse aus der Hirnforschung Dr. Nicole Becker Georg-August-Universität Göttingen 1. Die Forderung nach Frühförderung – Ausgangssituation Erst seitdem vor rund zehn Jahren internationale und nationale Leistungsvergleichsstudien in einigen Teilen Europas eine intensive Bildungsdiskussion ausgelöst haben, ist auch die Erforschung frühkindlicher Entwicklungs- und Lernprozesse stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Sowohl die Öffentlichkeit als auch die Fachwelt interessieren sich seither verstärkt für Möglichkeiten der frühkindlichen Förderung und meistens geht es dabei insbesondere um intellektuelle Förderung, eine frühe und intensive Vorbereitung auf den Schulstart, die – das glaubt man jedenfalls – um so einfacher gelingt, je jünger das Kind ist. Zur Begründung werden dabei gerne Erkenntnisse der Hirnforschung herangezogen, die nicht nur das große Lernpotenzial von Säuglingen und Kleinkindern, sondern auch die Angemessenheit früher Fördermaßnahmen und Interventionen angeblich empirisch belegen können (vgl. Becker 2006, 84 ff.). Zunehmend versuchen deshalb auch pädagogische Fachkräfte, ihr Handeln nicht „bloß“ pädagogisch, sondern auch neurowissenschaftlich zu begründen. Man verspricht sich von der Hirnforschung offenkundig jene harten Fakten über frühkindliche Entwicklung und begünstigende Faktoren, die Erziehungswissenschaft und (Entwicklungs-)Psychologie anscheinend bislang nicht liefern. Tatsächlich gibt es von Seiten der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung interessante Erkenntnisse über (früh-)kindliche Hirnentwicklung und die Stoßrichtung, dass sich während der frühen Kindheit entscheidende grundlegende Entwicklungen vollziehen, ist in dieser allgemeinen Form richtig. Dennoch beruhen einige der aktuell vorgetragenen Forderungen nach möglichst früher, anspruchsvoller kognitiver Stimulation auf falschen Vorstellungen. Die Krux liegt im Detail: zunächst einmal muss danach gefragt werden, was die Neurowissenschaften gegenwärtig über Hirnentwicklung – genauer gesagt über den Zusammenhang zwischen Hirnentwicklung auf physiologischer Ebene und Entwicklung auf der Verhaltensebene – wissen. Anders formuliert: auf welche Entwicklungsprozesse beziehen sich eigentlich die bisherigen Studien? Erst im zweiten Schritt kann man sich dann der Frage widmen, ob sich daraus Konsequenzen für die pädagogische Praxis ergeben. Um darauf antworten zu können, und auch um Aussagen über künftige Forschungsmöglichkeiten treffen zu können, sind forschungsmethodische Aspekte maßgeblich: entgegen stark vereinfachenden, populärwissenschaftlichen Darstellungen ist der Blick ins denkende Gehirn mit großem Aufwand verbunden und stellt sich die Interpretation der daraus resultierenden Ergebnisse 1 keineswegs einfach und eindeutig dar (vgl. Becker 2006, 18 ff.). Bildgebungsstudien mit Kleinkindern bilden eine seltene Ausnahme, zum einen, da die Versuchspersonen in solchen Studien möglichst regungslos liegen müssen, zum anderen, weil viele der kognitiven Aufgaben für Kleinkinder nicht kompatibel sind (vgl. Goswami 2004). Das meiste, was man derzeit über funktionelle Prozesse der Hirnentwicklung und erfahrungsabhängige Veränderungen weiß, stammt aus Studien mit Jugendlichen und Erwachsenen. In-vivoEinblicke in die zellulären Prozesse des sich-entwickelnden Gehirns sind bislang nicht möglich: was die Neurowissenschaften über die grundlegenden zellulären Mechanismen der Hirnentwicklung wissen, beruht zum großen Teil auf Autopsiebefunden und tierexperimentellen Studien (vgl. Huttenlocher 2002). Im Folgenden möchte ich einige zentrale Erkenntnisse über Hirnentwicklung darstellen und diese anschließend im Hinblick auf deren pädagogische Reichweite diskutiert. 2. Neuronale Plastizität als Grundlage von Lernprozessen Über neuronale Plastizität ist in den vergangenen Jahrzehnten viel geforscht worden (vgl. im Überblick: Huttenlocher 2002, Rapoport/Gogtay 2008). Im allgemeinem Sinne bedeutet Plastizität Veränderbarkeit und bezieht sich auf die Organisation von Hirnregionen, die sich beispielsweise durch die Art, die Anzahl und die Stärke der Verbindungen von Nervenzellen beschreiben lässt. Die Architektur der Verbindung zwischen Nervenzellen stellt gewissermaßen „das Programm“ für die Funktionsabläufe im Gehirn dar. Wesentliche strukturelle Merkmale dieser Architektur sind bei der Geburt bereits entwickelt, während viele funktionelle Merkmale sich erst im Laufe der Zeit in Interaktion mit der Umwelt herausbilden: „jeder Lern- bzw. Vergessensvorgang, jede Programmänderung also, bedingt entsprechend eine Modifikation dieser funktionellen Architektur. Das Wissen eines Nervensystems ist somit in seiner strukturellen und funktionellen Organisation verankert.“ (Singer 2002, 120) Neuronale Plastizität stellt lebenslang die Grundlage für Lernprozesse dar und das menschliche Gehirn weist demnach weder bei der Geburt noch im Erwachsenenalter eine ein für alle Mal abgeschlossene neuronale Organisation auf. Der anatomische „Bauplan“ des Gehirns ist ebenso genetisch prädisponiert wie die Migration bestimmter Neuronen in bestimmte Regionen und viele andere neurophysiologische Prozesse, die während früher Phasen der Hirnentwicklung ablaufen. Bei der Geburt enthält das menschliche Gehirn etwa 1 Milliarde Nervenzellen und die Anzahl synaptischer Verbindungen ist gegen Ende des ersten Lebensjahres etwa doppelt so hoch wie im späteren Erwachsenengehirn (Huttenlocher 2002, 41). Während der Kindheit findet ein „nutzungsabhängiger“, das bedeutet funktionsbedingter Abbau synaptischer Verbindungen statt (vgl. ebd., 276). Dieser Prozess, der in der englischsprachigen Fachliteratur als „pruning“ bezeichnet wird (was so viel wie Auslese bedeutet), wird in der 2 populärwissenschaftlichen Debatte über „hirngerechte Frühförderung“ häufig falsch interpretiert: die Eliminierung von (nicht-funktionellen) synaptischen Verbindungen ist ein adaptiver und biologisch notwendiger Prozess, der nicht mit einem qualitativen Verlust geistiger Fähigkeiten einhergeht. Vielmehr werden komplexe kognitive Leistungen erst durch Selektion, Stabilisierung und Spezialisierung neuronaler Schaltkreise möglich. Unterschiedliche Hirnregionen weisen zu verschiedenen Zeiten ein unterschiedliches Maß an neuronaler Plastizität auf. Als allgemeine Regel gilt, dass sich basale Funktionen, insbesondere solche der sensorischen Verarbeitung und der motorischen Steuerung, relativ früh in der kindlichen Hirnentwicklung herausbilden, während komplexe kognitive Leistungen einen größeren Zeitraum beanspruchen (Goswami 2004, 3; Rapoport/Gogtay 2008, 182). Dementsprechend weisen Hirnregionen, die mit der Verarbeitung sensorischer Reize befasst sind, zu einem frühen Zeitpunkt ein sehr hohes Maß an Plastizität auf, während Hirnregionen, die mit sogenannten exekutiven Funktionen (z.B. Planung, Entscheidungsfindung, Aufmerksamkeitssteuerung) befasst sind, vergleichsweise lange plastisch bleiben. Diese Unterscheidung ist zum Verständnis von Hirnentwicklung grundlegend und deren Nicht-Beachtung ist in der pädagogischen Diskussion die Quelle zahlreicher Irrtümer und deshalb möchte ich darauf ausführlicher eingehen: 3. Das Konzept kritischer und sensitiver Phasen der Hirnentwicklung Durch Beobachtungen über die Folgen frühkindlicher Deprivation weiß man seit langem, dass das Ausbleiben bestimmter Erfahrungen während der Entwicklung zu nachhaltigen Schäden führen kann. Während man für die Folgen sozialer Deprivation und die daraus resultierenden psychischen Schäden bislang keine exakten neuronalen Korrelate bestimmen kann, konnten die neuronalen Folgen sensorischer Deprivation am Tiermodell und im klinischen Kontext auch bei Menschen untersucht werden (Kandel 2008, 47 ff.; Kandel/Jessell 1996, 489 ff.). Bereits in den 1930er Jahren lagen Untersuchungen über die Auswirkungen sensorischer Deprivation vor: Kinder, die mit grauem Star auf die Welt kamen und erst sehr viel später (im Alter zwischen 10 und 20 Jahren) behandelt wurden, konnten nur noch sehr begrenzt lernen, Muster zu erkennen und Formen zu differenzieren. Rund drei Jahrzehnte später lieferten tierexperimentelle Studien Hinweise darauf, welche neuronalen Mechanismen dafür verantwortlich waren. In Experimenten mit neugeborenen Katzen und Affen untersuchten die Neurobiologen David H. Hubel und Torsten N. Wiesel die Auswirkungen früher sensorischer Deprivation. Sie stellten beispielsweise fest, dass ein Affe, der von der Geburt bis zu seinem 3. Lebensmonat mit einem zugenähten Augenlid aufwächst, auf diesem Auge nach Öffnen der Naht für immer blind bleibt, während eine vergleichbare Deprivation bei einem erwachsenen Affen keine Auswirkungen auf dessen Sehvermögen hat (vgl. Kandel 2008, 3 49). Hubel & Wiesel konnten zeigen, dass eine frühe sensorische Deprivation auf hirnphysiologischer Ebene nachhaltige Folgen hat: die neuronalen Strukturen, die für der Verarbeitung visueller Reize zuständig sind, werden bei ausbleibenden Inputs teils abgebaut, teils umgewidmet (vgl. ebd., 49 f.). Daraus zogen die Forscher den Schluss, dass einige neuronale Strukturen während bestimmter Phasen auf Stimulation angewiesen sind, um ihre Funktionen normal ausbilden zu können. Bleiben die Stimuli aus, können sich die Funktionen (hier der Sehsinn) nicht ausreichend entwickeln. Diese Beobachtung beschreibt im Kern das Konzept der kritischen Phasen (vgl. Singer 2006, 14). Beim Menschen sind kritische Phasen für die Entwicklung des visuellen und des auditorischen Systems belegt. Die kritische Phase für die Entwicklung des visuellen Systems reicht beim Menschen etwa bis zum Ende des ersten Lebensjahres (Singer 2006, 15). Parallel dazu erreicht die synaptische Dichte im visuellen Cortex zwischen dem 4-12 Lebensmonat mit etwa 150% der späteren Dichte im Erwachsenengehirn ihren Höhepunkt. Etwa im Alter zwischen 2 bis 4 Jahren entspricht die synaptische Dicht dann sowohl im visuellen, als auch im auditorischen Cortex der im erwachsenen Gehirn (vgl. Goswami 2004, 3). Auch für die Entwicklung des Hörsinns (auditorischen Systems) existieren kritische Phasen. So weiß man beispielsweise, dass Cochlea-Implantate das Ertauben von Kindern nur dann aufhalten können, wenn sie vor dem 7. Lebensjahr eingesetzt werden (Rapoport/Gogtay 2008, 182). Während der Terminus kritische Phase im Sinne vergleichsweise eng eingegrenzter Zeiträume für die Entwicklung von Seh- und Hörsinn berechtigt scheint, ist er für die Entwicklung anderer, insbesondere höherer kognitiver Funktionen durchaus umstritten. Viele Neurowissenschaftler sprechen deshalb in Bezug auf die Entwicklung höherer kognitiver Funktionen von sensitiven Phasen und bringen damit zum Ausdruck, dass es zwar auch für deren Erwerb besonders geeignete Zeiträume gibt, dass sie in aller Regel aber länger andauern und eine nicht optimale Nutzung dieser Phasen nicht zwangsläufig zu irreversiblen Schäden führt (vgl. Goswami 2004, 11; Knudsen 2004, 1412) Außerdem betonen sie, dass die besonders hohe Plastizität des kindlichen Gehirns nicht nur in einer speziellen Offenheit für bestimmte Lernerfahrungen resultiere, sondern auch in einer erhöhten Fähigkeit zur Kompensation. Rapoport & Gogtay (2008, 183) unterscheiden deshalb zwischen einer adaptiven Plastizität und einer kompensatorischen Plastizität. Die adaptive Plastizität ermöglicht die Anpassung an die je vorgefundene Umwelt. Menschen werden beispielsweise mit neuronalen Strukturen geboren, die Spracherwerb ermöglichen, doch da das Gehirn nicht im Voraus „wissen“ kann, welche Sprache seine Bezugspersonen sprechen, müssen diese Strukturen anpassungsfähig sein. Auch spätere Lern- und Wissenszuwächse beruhen auf dieser Form der Plastizität. Die kompensatorische Plastizität erfüllt vermutlich zweierlei Funktionen: 4 1. Zum einen ermöglicht sie eine Umweltanpassung auch dann, wenn auf der Ebene von Hirnstrukturen unerwartete (im Sinne genetisch nicht vorgesehener) Entwicklungen auftreten. Das visuelle System „erwartet“ Input aus beiden Augen. Erhält es jedoch nur Informationen aus einem Auge, weil das andere geschädigt ist oder beispielsweise in tierexperimentellen Studien gezielt reizdepriviert wird, so reagiert das Gehirn durch eine veränderte neuronale Organisation. Visuelle Zentren, die nicht entwickelt werden, verkümmern nicht einfach, sondern können für andere Funktionen genutzt werden. Studien mit Blinden zeigen, dass diejenigen Hirnregionen, die bei Sehenden mit der Verarbeitung visueller Informationen befasst sind, bei ihnen für das Lesen von Brailleschrift genutzt werden. Darüber hinaus verarbeiten sie auditorische Informationen schneller als Sehende. Umgekehrt verarbeiten taube Erwachsene visuelle Informationen schneller als hörende (vgl. Goswami 2004, 3 f.). Kompensation bedeutet in diesem Sinne, dass ausbleibende Stimuli zwar in Funktionseinschränkungen resultieren, die dadurch entstandenen Einbußen jedoch gewissermaßen durch die stärkere Entwicklung anderer Funktionen ausgeglichen, sprich: kompensiert werden. 2. Sie ermöglicht eine zeitliche Flexibilisierung im Falle ausbleibender Stimulierung. Tierexperimentelle Studien zeigen, dass die komplette Abwesenheit von Stimulierung, z.B. wenn Tiere während der ersten Lebenswochen in einem vollkommen dunklen Raum aufgezogen werden, zu einer Verlängerung kritischer Phasen führen kann (Knudsen 2004, 1419 f.). Die Versuchstiere konnten die entsprechenden Entwicklungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Eine komplette sensorische oder auditorische Deprivation verlängert demnach die kritische Phase, während die Deprivation nur eines Auges dazu führt, dass sich das andere Auge normal entwickelt, während das verschlossene für immer erblindet. Es ist unklar, in wie weit diese in Studien mit Affen, Ratten und Frettchen gewonnenen Befunde auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns übertragbar sind. Ihre Bedeutung liegt in der Tatsache, dass in den Gehirnen von Säugetieren offenbar Mechanismen existieren, die bestimmte Hirnentwicklungsprozesse unter widrigen Bedingungen verzögern können, was aus evolutionsbiologischer Perspektive einen Anpassungsvorteil hätte. Während einige Hirnregionen lebenslang adaptive Plastizität aufweisen und sie für andere, insbesondere solche, die für exekutive Funktionen zuständig sind, zumindest bis ins junge Erwachsenenalter erhalten bleibt, ist die kompensatorische Plastizität tatsächlich während der frühkindlichen Hirnentwicklung besonders ausgeprägt und nimmt danach rapide ab. Belegt ist dies am Beispiel von Läsionen sprachrelevanter Bereiche der linken Hirnhälfte, die bei Erwachsenen zu gravierenden Sprachstörungen (Aphasien) führen, bei Kindern jedoch, wenn auch nicht immer vollständig, so doch im Durchschnitt wesentlich besser kompensiert werden können (vgl. Rapoport/Gogtay 2008, 182). 5 Die hohe kompensatorische Plastizität verweist jedoch nicht auf eine erhöhte unspezifische Lernbereitschaft des kindlichen Gehirns, sondern vielmehr auf eine spezifisch erhöhte Bereitschaft, grundlegende sensorische und motorische Fähigkeiten während dieser Phase selbst unter ungünstigen Umständen zu erlernen. Aus biologischer Sicht ist das ein adaptiver Mechanismus, denn die Entwicklung primärer sensorischer und motorischer Zentren ist früher abgeschlossen, als die Entwicklung assoziativer Zentren; viele dieser Zentren sind aber ihrerseits auf grundlegende sensorische Funktionen angewiesen. Alles was ich bisher gesagt habe, bezog sich auf zwei Bereiche der Entwicklung: zum einen auf die Entwicklung sensorischer Funktionen und zum anderen auf die Entwicklung höherer kognitiver Funktionen. Aber was ist mit den Emotionen? Und welche Bedeutung haben die frühen Interaktionspartner von Kindern für deren emotionale Entwicklung? Das ist eine gute Frage und Sie werden dazu in der populären Neuroliteratur jede Menge Aussagen finden, von denen leider ziemlich viele eher einen Wahrscheinlichkeitscharakter haben, als dass es sich um gesicherte Erkenntnisse handeln würde. Es ist nicht so, dass die Hirnforschung in den vergangenen Jahren nicht viel über Emotionen herausgefunden hätte, ganz im Gegenteil. Aber auch hier beziehen sich die allermeisten Studien auf Erwachsene – man will aber etwas über die emotionale Entwicklung bei Kindern wissen. Viele Neurowissenschaftler sagen, dass die moderne Hirnforschung die Befunde der Bindungsforschung stützt, nach denen eine stabile und positive emotionale Bindung zu einer Bezugsperson eine wichtige Grundlage sowohl für eine gute emotionale als auch für eine gute intellektuelle Entwicklung ist. So plausibel solche Aussagen auch klingen mögen, muss man doch einige Relativierungen vornehmen: was im kindlichen Gehirn bei der Interaktion mit einem Gegenüber vorgeht, kann man nicht messen. Deshalb beziehen sich viele solcher Aussagen auf tierexperimentelle Studien: beim Rattenjungen kann man einige hirnphysiologische Parameter erheben, während ihm seine Mutter das Fell leckt, bei der menschlichen Mutter-Kind-Interaktion ist das in der Form nicht möglich. Es ist zwar wahrscheinlich, dass auch hier das positive emotionale Erleben zur Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter führt, die dann wiederum andere Funktionen positiv beeinflussen, aber gemessen hat das noch niemand. Anders sieht das in Bezug auf die Folgen frühkindlicher Traumatisierung aus, denn hierzu gibt es Befunde und die sprechen eine klare Sprache: Schwere Traumatisierung oder Misshandlungserfahrungen üben einen nachhaltigen Einfluss auf Hirnentwicklung aus, der sich in subjektiv empfundenem Leid und psychischen Problemen ausdrückt, und den man später nicht immer qua Therapie beheben kann. Die dadurch ausgelösten hirnphysiologischen Veränderungen lassen sich in einigen Strukturen nachweisen, die für die Verarbeitung emotionaler Stimuli zuständig sind und auf der Ebene einige Neurotransmitter bzw. der Rezeptoren zeigen. Es ist daher wahrscheinlich, dass es auch für die emotionale 6 Entwicklung kritische oder zumindest sensitive Phasen gibt, doch die Forschung hierüber steckt noch in den Anfängen. Ich habe bislang keinen erziehungswissenschaftlichen Beitrag gelesen, der sich intensiver mit diesem Thema beschäftigt hätte, dabei muss man ganz klar sagen, dass es sich hier um die – pädagogisch äußerst relevante – Kehrseite der Hirnplastizität handelt. Hirnplastizität dient zwar der optimalen Anpassung an die Umwelt, doch um den Preis, dass sich Gehirne auch an nicht-optimale Umwelten anpassen. Und vermutlich gestalten sich viele pädagogische, sozialpädagogische und schließlich psychotherapeutische Prozesse unter anderem deswegen so schwierig, weil es eben auch für emotionale Entwicklung so etwas wie sensitive Phasen gibt, während der nachhaltige Prägungen stattfinden, die später nur mühsam, vielleicht auch gar nicht verändert werden können. Solche Aussagen trüben allerdings den pädagogischen Optimismus und vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass man sich lieber der aktuellen Euphorie rund um das Thema „Frühkindliche Bildung“ – mit Rekurs auf Hirnplastizität - anschließt, als die Probleme desaströser Erziehungs- und Sozialisationserfahrungen besser verstehen zu wollen. Schon jetzt gibt es Bemühungen, die Auswirkungen von therapeutischen Verfahren auf hirnfunktionelle Prozesse nachzuweisen. Ähnliches wäre auch im Hinblick auf pädagogische Interventionen denkbar, aber hier fehlt der Pädagogik wohl derzeit noch das Problembewusstsein. 4. Befunde über Hirnentwicklung als pädagogische Argumentationshilfe? Ich habe Ihnen nun einige grundlegende neurowissenschaftliche Aussagen über Hirnentwicklung zusammengetragen und einige zentrale Begriffe erläutert. Bevor diese Befunde im Hinblick auf deren pädagogische Relevanz diskutiert werden, möchte ich die wichtigsten Aussagen nochmals kurz zusammenfassen: Hirnentwicklung beruht auf Plastizität: in Wechselwirkung mit der Umwelt bildet sich im Gehirn die neuronale Architektur, auf der sämtliche Leistungen des Gehirns beruhen. Bestimmte Regionen des Gehirns, vor allem solche der Großhirnrinde, bleiben lebenslang in gewissem Umfang plastisch, während sich in anderen Regionen die Plastizität auf die (frühe) Kindheit beschränkt. Man unterscheidet zwischen adaptiver und kompensatorischer Plastizität. Adaptive Plastizität ist lebenslang wirksam, während kompensatorische Plastizität in der Kindheit besonders ausgeprägt ist und anschließend abnimmt. Es gibt bestimmte Hirnfunktionen, die sich während zeitlich begrenzter Phasen entwickeln müssen, weil sie ansonsten irreversibel geschädigt werden. Dazu benötigen sie entsprechende Stimulation von Seiten der Umwelt. Solche kritischen Phasen sind 7 beim Menschen insbesondere für die Entwicklung sensorischer Funktionen nachgewiesen. Das Konzept der sensitiven Phasen besagt, dass es zwar auch für den Erwerb sogenannter höherer kognitiver Funktionen vermutlich besonders günstige Zeiträume gibt, doch im Gegensatz zu kritischen Phasen sind diese zeitlich nicht eng eingrenzbar und es drohen keine irreversiblen Schäden, wenn die Erfahrungen nicht innerhalb dieser Zeitspanne gemacht werden. Für einige der beobachtbaren kognitiven und emotionalen Entwicklungen lassen sich, zumindest bei älteren Kindern und Jugendlichen, neuronale Korrelate aufzeigen. Die zellulären Mechanismen solcher Korrelate sind unbekannt. Einsichten in die zellulären Mechanismen der Hirnentwicklung stammen aus Autopsiebefunden und tierexperimentellen Studien. Bildgebende Verfahren wie MRT und fMRT können bei Säuglingen und Kleinkindern nur begrenzt angewandt werden. Studien, die beispielsweise erfahrungsabhängige Veränderungen neuronaler Aktivierungsmuster nachweisen, werden überwiegend mit Erwachsenen durchgeführt. Unterm Strich ist das gesicherte Wissen über Hirnentwicklung während der frühen Kindheit, insbesondere aufgrund forschungsmethodischer Ursachen, nicht sehr umfangreich. Dementsprechend sind die Äußerungen von Hirnforschern, die sich für eine Verbesserung von elterlichen und institutionellen Erziehungspraxen aussprechen, so gerechtfertigt sie aus ethischer Perspektive sein mögen, häufig geprägt durch persönliche Überzeugungen und eben nicht durch empirische Belege aus der neurowissenschaftlichen Forschung (vgl. z.B. Hüther 2004). Allzu oft wird das Konzept der kritischen Phasen in solchen Diskussionen fälschlicherweise auf Hirnentwicklung generell übertragen und werden aus Deprivationsstudien, die eigentlich nur Aussagen über das zulassen, was man vermeiden sollte, Umkehrschlüsse über die Gestaltung optimaler Umwelten gezogen (vgl. z.B. Braun/Meier 2004). Das Konzept sensitiver Phasen, das solchen Generalisierungen und Fehlschlüssen entgegen wirken möchte, stellt sich dem gegenüber zwar theoretisch plausibel, aber inhaltlich unpräzise dar. Solange sich sensitive Phasen für den Erwerb bestimmter kognitiver oder emotionaler Fähigkeiten nicht einmal annähernd bestimmen lassen, ist auch dieses Konzept als pädagogische Argumentationshilfe unbrauchbar. Im Gegensatz zur hiesigen populären Diskussion über Hirnforschung und Pädagogik stellt sich die Diskussion im anglo-amerikanischen Raum mittlerweile eher zurückhaltend dar (vgl. Becker 2006, 226 ff.). Nach einer intensiven Phase der Politisierung äußern sich Hirnforscher, nicht zuletzt aufgrund einiger einflussreicher kritischer Darstellungen (vgl. z.B. Bruer 2000), eher zurückhaltend über die pädagogische Relevanz ihrer bisherigen Forschung. Im Hinblick auf frühkindliche Hirnentwicklung bilanziert die 8 Neurowissenschaftlerin Usha Goswami: „In fact, there seem to be almost no cognitive capacities that can be ,lost’ at an early age“ (Goswami 2004, 11). Die Phase der frühen Kindheit spielt zwar ohne Frage eine besondere Rolle bei der Hirnentwicklung, doch die bisherigen Studien eignen sich weder zur argumentativen Stützung bildungspolitischer Forderungen, noch zur inhaltlichen Gestaltung pädagogischer Programme. So bleibt am Ende ein kleinster gemeinsamer Nenner der Diskussion, der in etwa lauten könnte: Kinder sollten von Anfang an umfassend umsorgt, unterstützt und kognitiv gefördert werden, um ihnen eine gute Entwicklung zu ermöglichen. Auf die Frage, wie optimale Förderung zu welchem Zeitpunkt aussehen sollte, können die Neurowissenschaften bis dato keine Antworten liefern. Längerfristig wird es auch bei jüngeren Kindern möglich sein, neuronale Korrelate für kognitive Leistungen zu identifizieren. neurowissenschaftlicher Forschungsmethoden pädagogisch wo relevant, es um Die werden neuronale m.E. Anwendungsmöglichkeiten künftig Entsprechungen besonders dort zu und Lern- Verhaltensstörungen bis hin zu psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geht. Gegenwärtig existieren beispielsweise Studien zu Dyslexie, Dyskalkulie, ADHS, Autismus und Schizophrenie, die bestimmte strukturelle oder funktionelle Abweichungen identifizieren (vgl. Shaywitz et al. 2003, dies. 2004; Rubia 2002; Rapoport/Gogtay 2008). Zur Diagnose von Störungen oder Erkrankungen sind die bildgebenden Verfahren allein zwar bislang ungeeignet, doch sie liefern hirnphysiologische Einsichten in Phänomene, die man bisher lediglich auf der Verhaltensebene beschreiben konnte. Künftig sind Interventionsstudien, wie sie aktuell etwa im Bereich Psychotherapie durchgeführt werden, deshalb auch für den pädagogischen Bereich denkbar. Zitierte und weiterführende Literatur: Aeberli, Christian L. (2004): „Was Hänschen nicht lernt…“ Über die wissenschaftlich begründeten Vorzüge einer früheren Einschulung. In: Neue Zürcher Zeitung am 29.06.2004. Andersen SL, Teicher MH: Delayed effects of early stress on hippocampal development. Neuropsychopharmacology 2004; 29(11):1988-93 Anderson, S. W., et al.: Impairment of social and moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex. In: Nature Neuroscience, 2 (1999) 11. S. 1032-1037. Becker, Nicole (2006): Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Braun, A. K./Meier, M. (2004): Wie Gehirne laufen lernen oder: ,Früh übt sich, wer ein Meister werden will!’ In: Zeitschrift für Pädagogik, 50. Jg., H. 4, S. 507-520. 9 Bruer, John T. (2000): Der Mythos der ersten drei Jahre. Warum wir lebenslang lernen. Weinheim: Beltz. Cascio C. J., Gerig G., Piven J. (2007). Diffusion tensor imaging: application to the study of the developing brain. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46: 213–223. Fthenakis, Wassilios E. et al. (2007): Auf den Anfang kommt es an. Perspektiven für eine Neuorientierung frühkindlicher Bildung. Bildungsforschung Band 16. Bonn; Berlin: BMBF. Goswami, Usha (2004): Neuroscience and education. In: British Journal of Educational Psychology, 74. Jg., H.1, S. 1-14. Hüther, Gerald (2004): Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturierung des menschlichen Gehirns. Welche sozialen Beziehungen brauchen Schüler und Lehrer? In: Zeitschrift für Pädagogik, 50. Jg., H. 4., S. 487-495. Huttenlocher, Peter R. (2002): Neural plasticity. The effects of environment on the development of the cerebral cortex. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. Kandel, Eric R. (2008): Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Kandel, Eric R. /Schwartz, J. H./Jessell, T. M. (Hrsg.): Neurowissenschaften. Eine Einführung. Heidelberg: Spektrum. Kandel, Eric R./ Jessell, T. (1996): Sensorische Erfahrung und die Entstehung visueller Schaltkreise. In: Kandel, Eric R. /Schwartz, J. H./Jessell, T. M. (Hrsg.): Neurowissenschaften. Eine Einführung. Heidelberg: Spektrum. S. 489-493. Knudsen El (2004). Sensitive periods in the development of the brain and behavior. Journal of Cognitive Neuroscience 16, pp. 1412–1425. Nagy, Zoltan/ Westerberg, Helena/Klingberg Torkel (2004): Maturation of White Matter is Associated with the Development of Cognitive Functions during Childhood. In: Journal of Cognitive Neuroscience, Vol. 16, Number 7, pp. 1227-1233. Navalta CP, Polcari A, Webster DM, Boghossian A, Teicher MH: Effects of childhood sexual abuse on neuropsychological and cognitive function of college females. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2005 Passingham, Richard: Brain development and IQ. In: Nature 440, 619-620 (30 March 2006) Rapoport, Judith L./ Gogtay, Nitin (2008): Brain Neuroplasticity in Healthy, Hyperactive and Psychotic Children: Insights from Neuroimaging. Neuropsychopharmacology Reviews (2008) 33, pp. 181–197 Rubia, Katya (2002): The dynamic approach to neurodevelopmental psychiatric disorders: use of fMRI combined with neuropsychology to elucidate the dynamics of psychiatric disorders, exemplified in ADHD and schizophrenia. In: Behavioral Brain Research 130, pp. 47-56. 10 Shaw, Philip et al. (2006): Intellectual ability and cortical development in children and adolescents. In: Nature, Vol. 440, 30 March 2006, pp. 676-679. Shaywitz, B. A. et al. (2004): Development of Left Occipitotemporal Systems for Skilled Reading in Children After a Phonologically-Based Intervention. In: Biological Psychiatry, 55, S. 926-933. Shaywitz, Sally E. et al. (2003): Neural Systems for Compensation and Persistence: Young Adult Outcome of Childhood Reading Disability. In: Biological Psychiatry 54, S. 25-33. Singer, Wolf (2002): Hirnentwicklung oder die Suche nach Kohärenz. Determinanten der Hirnentwicklung. In: Ders. Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung. Frankfurt am Main. S. 120- 143. Singer, Wolf: Brain Development and Education. In: Scheunpflug, Annette; Wulf, Christoph (2006): Biowissenschaft und Erziehungswissenschaft. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Beiheft, 5. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. S. 11-22. Stiles, Joan (2008): The fundamentals of brain development. Integrating nature and nurture. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. Teicher, Martin H. et al. (2003): The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment In: Neuroscience and Biobehavioral Reviews 27, pp. 33–44. 11