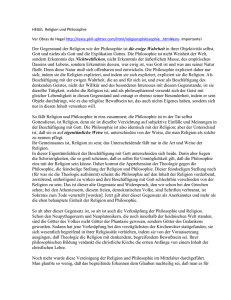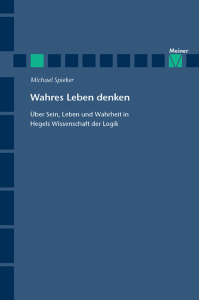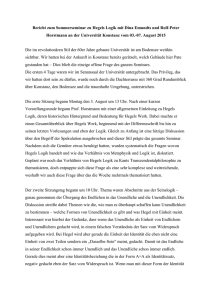Dieter Henrich - Stadt Stuttgart
Werbung

Volker Gerhardt Das Subjekt ist die Substanz Laudatio auf Dieter Henrich Zur Verleihung des Hegel-Preises der Stadt Stuttgart am 26. November 2003 1. Endlich. Im Sommer diesen Jahres, in einer Beratung über die Stiftung eines neuen deutschen Preises für Philosophie machte ein Teilnehmer die beiläufige Bemerkung, dass Dieter Henrich den diesjährigen Hegel-Preis der Stadt Stuttgart erhalten solle. Die kontroverse Debatte, in der wir gerade befangen waren, ließ mir keine Zeit, die Mitteilung zu bedenken. Wir stritten, ob Auszeichnungen eher konventionelle oder innovative Effekte haben, und da ich diese oder andere Bewertungen nicht primär mit dem Preis, sondern vorrangig mit der personellen Entscheidung der Juroren verknüpfe, dachte ich nur, dass es eine geradezu sensationelle Wirkung haben könne, ein und denselben Preis ein und derselben Person ein zweites Mal zu verleihen. Meine Unterstellung war, dass Dieter Henrich den Preis schon einmal erhalten habe und dass seine Verdienste um die Deutung Hegels, um die Erschließung des gedanklichen Vorlaufs von Kant über Jacobi, Reinhold, Fichte und Schelling, um die Erkundung der historischen Bedingungen des Deutschen Idealismus, um die epochale Rolle Hölderlins, um die Internationale HegelVereinigung und damit auch um die Stadt Stuttgart so einzigartig sind, dass man ihm den Preis einfach ein zweites Mal verleihen müsse. Mutig, dachte mein Hirn, während mein Mund irgendetwas anderes sprach. Er verteidigte die Institution der Preisverleihung, sagte aber nichts davon, dass eine Innovation mitunter schon darin liegt, eine Regel mit guten Gründen zu durchbrechen. Hier und heute ist es, wie wir wissen, anders. Dieter Henrich erhält den Preis im Jahre 2003 zum ersten Mal. Trotzdem ist die Entscheidung nicht falsch. Sie war nur eben schon seit vielen Jahren fällig und kommt, Gott sei Dank, jetzt nicht zu spät. Sie ehrt einen Denker, der sich in einem inzwischen kaum noch vorstellbaren Umfang und in einer unerhörten Eindringlichkeit um Werk und Wirkung Hegels verdient gemacht hat. 1 2. Der Preis als Zu-sich-selbst-Kommen des Geistes. Alle Kundigen wissen das. Und der Preisträger weiß es auch. Deshalb will ich ihn mit einer Aufzählung des ihm Wohlbekannten verschonen. Zwar kann die Erinnerung die Vielfalt und Größe seines Lebenswerks anschaulich vor Augen führen, kann an persönliche Verbindlichkeiten, politische Ansprüche, historische Aufgaben und systematische Ziele des Philosophierens erinnern; doch im Einzelnen wie im Ganzen würde sie uns nur kenntlich machen, wie groß der Abstand zwischen dieser Lebensleistung und unserer eigenen ist. Um aus dieser Einsicht, die Henrich niemandem erspart, einen Anspruch an das Philosophieren zu machen, wage ich es, seine Lebensleistung zu erörtern. Das geht nicht ohne Kritik an der deutschen Nachkriegsphilosophie, in der sich der spät Geehrte als Solitär zu behaupten hatte. Ihr schicke ich das Unbestrittene und Unbestreitbare voraus, nämlich den Dank an die Stadt Stuttgart, dass sie uns diese glückliche Stunde gewährt und den Preis in diesem Jahr seiner denkbar besten Bestimmung zuführt. Mit dieser Verleihung im Namen Hegels geben die Verantwortlichen der Stadt auf praktisch-politische Weise zu erkennen, was mit Hegels zentraler Gedankenfigur des Zu-sich-selbst-Kommens des Geistes auch gemeint sein kann. Wenn es in den Bestimmungen für die Preisverleihung heißt, die Würdigung solle „im Wechsel an einen Theoretiker aus dem Bereich der Kultur- und Geisteswissenschaften und [an] einen Philosophen“ vergeben werden, so haben wir in Dieter Henrich ohne Übertreibung beides: Den Philosophen von Rang und den Geisteswissenschaftler erster Provenienz, der den Geist aus sich heraus in seiner a priori herausragenden Rolle sichtbar macht, ohne es jemals nötig gehabt zu haben, die Geisteswissenschaften nach Art territorialstaatlicher Selbstbehauptung gegen die Naturwissenschaften abzugrenzen. Hätte Hegel als der schlechterdings unüberbietbare Philosoph des Geistes die Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu evaluieren gehabt, so hätte er, da bin ich sicher, zuerst und vor allem anderen die „Aufhebung“ dieses Unterschieds empfohlen.1 Die Aufmerksamkeit der Wissenschaft hat den Phänomenen und den mit ihnen verbundenen Problemen zu gelten. Dabei ist es von Vorteil, wenn wir nicht nur unterschiedliche, sondern auch Zu den Kuriositäten des Begriffsgeschichte der Geisteswissenschaften gehört denn auch, dass der Terminus in Abgrenzung gegen den Philosophen des Geistes in Umlauf kam, obgleich Dilthey von Hegel gewiss nicht unabhängig war. Jacob Burckhardt nennt den Geistbegriff Hegels „vermessen“ und bringt damit die Stimmung zum Ausdruck, die zum reduzierten Verständnis von Geist geführt hat, der dann maßgeblich für den Terminus der Geisteswissenschaften wurde. Dazu: J. Ritter, Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft (1963), in: Subjektivität, Frankfurt a. M. 1974, 105 – 140, 126. Ritter stützt sich wesentlich auf: E. Rothacker, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Tübingen 1920; ders., Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, Bonn 1947. 1 2 gegensätzliche Interessen einbeziehen, möglichst viele Perspektiven anlegen und verschiedene Methoden verfolgen. Aber da eine Erkenntnis längst nicht mehr nur alle nachfolgenden Erkenntnisse betreffen, sondern auch praktische Auswirkung auf alle Menschen haben kann, geht sie alle Disziplinen etwas an. Die Unterscheidung zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften ist daher ein schönes, der Gerechtigkeit dienendes Hilfsmittel für eine Preisverleihung, sie mag auch pragmatische Vorteile bei der großflächigen Organisation und Förderung der Wissenschaften haben; mit Blick auf den realen, der Problemexposition und Problemreduktion dienenden Prozess der Wissenschaft aber ist sie überholt. 3. Weltweit für den Weltgeist. Die Prädestination von Preis und Person im Jahre 2003 lässt uns natürlich nicht vergessen, dass es auch in den Jahren zuvor bedeutende Preisträger gegeben hat. Anderthalb Jahre nach seinem Tod denken wir zunächst an Hans-Georg Gadamer, den 1979 ausgezeichneten vierten Preisträger, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Marxismus sein zeitweiliges Monopol auf die Hegel-Deutung verlor. Mit Gadamer wurde die Internationale Hegel-Vereinigung aus dem Stand zu einer europäischen Einrichtung. Damit war die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Erinnerung an Hegel auch in seiner Vaterstadt so weltläufig wurde, wie es sich für einen Denker gehört, der den „Weltgeist“ zu denken versuchte. Wer wirklich meinen sollte, die sogenannte „Globalisierung“ sei ein neues Phänomen, das uns erst im 21. Jahrhundert ereilt, der lese nach, wie Hegel bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts die „Weltgeschichte“ konzipiert und dabei keinen Zweifel daran läßt, dass die Wendung zum weltumspannenden, menschheitlichen Denken und Handeln spätestens im Zeitalter des Perikles erfolgt. Deshalb war es nur konsequent, dass Dieter Henrich, als er Gadamer in der Präsidentschaft der Hegel-Vereinigung folgte, den internationalen Anspruch eingelöst und die Hegel-Kongresse zum wichtigsten Forum der Debatte zwischen kontinentalen und analytischen Ansätzen gemacht hat. Durch seine guten Verbindungen in einige Domänen des sowjetischen Imperiums hat er überdies dafür gesorgt, dass die Diskussionen hüben wie drüben Beachtung fanden. Seine Vortragsreisen in Fernost haben Hegels Begriff des Wissens selbst den Kulturen erschlossen, die sich bis dahin primär an der Weisheit zu orientieren suchten. Die praktizierte Internationalität, deren Exklusivität in seinen lange Zeit von Heidelberg aus turnusmäßig wahrgenommenen Professuren zunächst an der Columbia-, dann an der Harvard-University zum Aussruck kommt, hat Henrich nicht daran gehindert, nach 1989 in bewegenden Aufsätzen für die deutsche 3 Einheit zu werben.2 Dabei hat er gern auf die provinziellen Wurzeln des universellen Geistes verwiesen, die dem protestantischen Pfarrhaus einen Stellenwert in der intellektuellen Genealogie der Globalität verleihen. Wer glaubt, das Bewusstsein der Herkunft aus den anfangs immer zu engen Verhältnissen der Region und der Tradition stehe zur ergriffenen Mitwirkung an den anfangs immer zu großen Erwartungen des Neuen im Widerspruch, der lese seine Reflexionen auf den Glücksfall der deutschen Einheit, den wir einer Entwicklung verdanken, die gar nicht anders als global genannt werden kann. Sie fordert zwar eine nationale Anstrengung heraus; aber wer ihr nur eine nationale Perspektive geben wollte, der hat schon den Vorgang des Mauerfalls nicht begriffen. 4. Grenzüberschreitung der Philosophie im Namen Hegels. Der Intention des Preises folgend, wurden auch einige höchst beachtliche analytische und systematische Köpfe aus Philosophie und Soziologie geehrt. Ich erinnere nur an die in den Jahren 1988 und 1991 aufeinander folgenden Extreme, die mit Donald Davidson (1991) auf der einen und Niklas Luhmann (1988) auf der anderen Seite bezeichnet sind. Beide Entscheidungen haben das Renomee des Preises noch einmal erhöht und an die Spannweite erinnert, die sich bei Hegel noch innerhalb der Philosophie entfalten konnte, heute jedoch auf verschiedene Disziplinen der Wissenschaften oder auf vollkommen unterschiedlich erscheinende Ansätze des Philosophierens verteilt ist. Bei Henrich ist sie erneut in einer Person trägfähig gemacht. Seine Zuständigkeit ist auch gegeben, wenn wir das Spektrum erweitern und die Theorie der Künste, für die Ernst Gombrich, der Preisträger des Jahres 1976, steht,3 und die Theorie des Rechts hinzunehmen, die Noberto Bobbio, der Preisträger aus dem Jahr 2000, repräsentiert.4 Wenn wir sehen, wie stark sich Henrich vor allem in den letzten Jahren auf die Parallele zwischen Hegel und Platon bezieht und wie sehr die Antike in seiner Deutung Hölderlins gegenwärtig ist, gibt es auch eine Verbindung zum ersten Preisträger, dem Altphilologen Bruno Snell. Schließlich ist auch das mit der nachfolgenden Auszeichnung von Jürgen Habermas, dem Preisträger von 1973, gesetzte politische Zeichen für den philosophischen Weg von Dieter Henrich nicht ohne Bedeutung. Wer heute noch immer die Legende flicht, in der philosophischen Tradition der Deutschen könnten politische Interessen nicht zu poetischen Optionen finden, wird in der Sache durch Henrichs Arbeiten über Hölderlin widerlegt.5 Aber auch in seiner eigenen Orientierung ist die literarische Aufmerksamkeit spätes2 Gesammelt in: Eine Republik Deutschland, Frankfurt a. M. 1990. Henrichs Preisrede auf Gombrich, in Hegel-Preis-Reden 1977, Stuttgart 1977 (wieder in: Fixpunkte, 2003). 4 Ich verweise hier nur auf D. Henrich/R.-P. Horstmann (Hg.), Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik, Stuttgart 1982. 3 4 tens mit seinen Beiträgen zu den Kolloquien über Poetik und Hermeneutik dokumentiert.6 Seinen an Georg Simmel anschließenden Versuch über Kunst und Leben7 sowie seine jüngsten Fixpunkte mit Abhandlungen und Essays zur Theorie der Kunst8 stellen seine ästhetischen Interessen außer Zweifel. 5. Soziologischer Vorlauf. Die mit dem Hinweis auf Luhmann in Anspruch genommene Parallele zur Gesellschaftstheorie, namentlich zur Soziologie, könnte hingegen befremden, denn hier hat Henrich im Gang seiner Entwicklung eine Distanz aufgebaut, die ihresgleichen sucht: In seiner Dissertation über Max Weber hat er noch sehr nahe am Wasser des soziologischen Grundstroms der Nachkriegsphilosophie gebaut, obgleich er die methodologische Frage nach der Einheit der Wissenschaft in den Vordergrund rückt.9 1945 brach eine Kultur zusammen, die schon diesen Namen nicht mehr verdiente. Was danach an produktiven Kräften des Denkens übrig geblieben war, suchte den Weg ins Offene, vornehmlich durch Annäherung an die Soziologie, die eine gesellschaftliche Aufklärung auch über die Gründe des Grauens versprach. Plessner, Gehlen oder René König – später auch Dahrendorf – wollten nur noch Soziologen sein; Schelsky gelang es, als bloßer Soziologe zu erscheinen; er nahm aber über das ihm erkennbar nahe, aristotelisch anmutende, in Wahrheit aber durch und durch moderne Werk Joachim Ritters enormen Einfluss auf die Philosophie der fünfziger und sechziger Jahre. Die Frankfurter Schule (der Münsteraner Ritter-Schule viel näher, als beide Seiten glaubten)10 machte aus der Soziologie ihr bis heute fortwirkendes Programm „kritischer Gesellschaftstheorie“. Es zeigt uns in seiner geschichtlichen Entwicklung, wie nahe sich philosophische und soziologische Interessen in Deutschland geblieben sind. Dabei passt der kritische Impuls des Philosophierens mitunter 5 Vor allem: Der Gang des Andenkens. Beobachtungen und Gedanken zu Hölderlins Gedicht, Stuttgart 1986; ferner: Der Grund im Bewußtsein. Untersuchungen zu Hölderlins Denken 1794 – 1795, Stuttgart 1992. 6 Siehe dazu nur den Band: Funktionen des Fiktiven, hrsg. von D. Henrich/W. Iser, München 1983. Der darin enthaltene Text über Rahmenbedingungen der Rationalität findet sich wieder in: Fixpunkte. Abhandlungen und Essays zur Theorie der Kunst, Frankfurt a. M., 2003. Darin auch der Text: Marginalien über Komik, aus: Das Komische, hrsg. v. W. Preisendanz/R. Warning, München 1976. 7 Versuch über Kunst und Leben. Subjektivität – Weltverstehen – Kunst, München 2001. 8 Fixpunkte. Abhandlungen und Essays zur Theorie der Kunst, Frankfurt a. M. 2003. Hier sind auch die zwischen 1966 und 1982 erschienenen Aufsätze über Hegels Ästhetik versammelt. 9 Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers, Tübingen 1952. 10 Das gilt insbesondere für die Aufgeschlossenheit gegenüber der Moderne, für die soziologische Orientierung, für das Verlangen nach politischer Einflussnahme und das Interesse an Hegel. Die Unterschiede fallen ins Auge, wenn man die Stellung zur Antike, die Ansprüche an die philologische Pünktlichkeit sowie die Bemühung um die Begriffsgeschichte ins Auge fasst. Der früher für so wichtig genommene Unterschied zwischen eher „revolutionären“ und eher „konservativen“ Empfehlungen ebnet sich im Rückblick ein. 5 schlecht zu der Überzeugung, dass die vernünftigen Gründe soziologische Ursachen haben müssen. 6. Geschichte als Vorübung des Denkens. Henrich hätte ebenfalls, wie seine Dissertation belegt, den Weg soziologischer Aufklärung gehen können. Wie sehr sein Talent ihm auch dies ermöglicht hätte, bezeugen seine zeitgeschichtlichen Einlassungen sowie seine verschiedentlichen Erinnerungen an Max Weber und Karl Jaspers.11 In seiner Ethik zum nuklearen Frieden gibt er diesem Hang wohl am weitesten nach.12 In der Hauptsache aber scheint er den Pfad einzuschlagen, der der durch Nazismus, Krieg und Teilung innerlich zerrütteten Philosophie einen allein durch den Abstand gesicherten Ausweg bot: den der historischen Forschung. Hier haben seine Arbeiten auch neben denen anderer Preisträger wie Jacques Le Goff (1994) Bestand. Doch anders als bei älteren, gleichaltrigen und jüngeren Zeitgenossen bedeutet die Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie für Henrich weder einen Rückzug aus der Aktualität noch aus der Arbeit an den systematischen Fragen. Er lässt sich nicht auf das beliebte Verfahren ein, die herbeizitierten Autoritäten sagen zu lassen, was man selber zu sagen sich nicht mehr traut.13 Zwei Beispiele müssen genügen: Die in Deutschland lange Zeit beliebte Selbstbeschreibung der Neuzeit ist für Henrich nur eine Nebenbeschäftigung, und seine frühe, in allen späteren Werken präsente Untersuchung über den ontologischen Gottesbeweis dient dem Aufweis eines Arguments, das es erlaubt, die innere Einheit des Wirklichen zu denken. 11 Siehe dazu: Denken im Blick auf Max Weber. Eine Einführung, in: Karl Jaspers, Max Weber. Eine Gedenkrede (1920), München 1988, 7 – 31; ferner: Die deutsche Philosophie nach zwei Weltkriegen (1970), in: D. Henrich, Konzepte. Essays zur Philosophie in der Zeit, Frankfurt a. M. 1987, 44 – 65. Ich stütze mich auch auf die noch nicht publizierte Selbstinterpretation Henrichs im Licht der Jaspers‘schen Existenzphilosophie in einem Vortrag auf der Baseler Jaspers-Konferenz im Oktober 2002. 12 Ethik zum nuklearen Frieden, Frankfurt a. M. 1990. Das aus Anlass der Nachrüstungsdebatte Anfang der achtziger Jahre entstandene Buch ist angesichts des Irak-Konflikts zur Lektüre besonders zu empfehlen. Der globale „Imperativ zur Kooperation“ über Konkurrenz und Konfrontation hinweg (222) wird eindringlich begründet, auch deshalb, weil die Realität der nuklearen Waffen nicht zu leugnen ist. Gleichwohl bleibt die gebotene Friedensordnung an eine Bedingung gebunden, deren aktuelle Bedeutung wohl am besten in einer schönen, für Henrich typischen Wendung auf den Punkt gebracht wird: „Mit kulturellem Relativismus ist die Rede von den Menschenrechten durchaus nicht vereinbar.“ (314). – Weitere politische Aufsätze sind gesammelt in: Konzepte. Essays zur Philosophie in der Zeit, Frankfurt a. M. 1987. 13 Hier steht er Paul Ricœur und Charles Taylor, den Preisträgern der Jahre 1985 und 1997, nahe. 6 Beide Untersuchungen befriedigen die höchsten Ansprüche an einen souveränen Umgang mit dem historischen Material – mehr noch: Sie setzen neue Maßstäbe der Genauigkeit in der Rekonstruktion theoretischer Leistungen. Doch Henrich macht aus alledem ein Instrument des philosophischen Gedankens. Die Dialektik von Herr und Knecht wird von ihm nicht auf das Verhältnis von Philosophie und Methode angewandt. Das gilt auch für einen hochspeziellen Bereich des jüngeren Denkens: Henrich ist ein Sprachanalytiker avant la lettre. Die Methoden der Rekonstruktion von Texten und Argumenten handhabt er virtuos, längst bevor sie zum Schibboleth des Philosophierens avancieren. Seine analytische Kompetenz ist gänzlich unabhängig von dem angeblichen Paradigmenwechsel des linguistic turn, mit dem sie dem Zeitgeist empfohlen wurde. Wie man weiß, gibt es inzwischen schon wieder einen anderen Dreh, der eine weitere antike Einsicht als neueste Erfindung reklamiert: den pragmatic turn. Und man ahnt, dass auf diese beiden turns die Pirouette einer präplatonischen Mantik folgen wird, die dann womöglich in einen postepikureischen Neuroatomismus übergeht. Angesichts der abgegriffenen Oberflächen der Philosophie könnte man sich zum Glauben an die ewige Wiederkehr des Gleichen verführen lassen, wäre da nicht die Bedingung, dass man von der Wiederkehr nichts wissen darf, um an sie zu glauben. 7. Der Außenseiter im Zentrum. Bei Dieter Henrich braucht man nicht auf sein historisches Wissen zu rekurrieren, um zu erklären, warum er nicht zum Modernisten und, trotz höchster Begabung, auch nicht zum Analytiker wurde: Ihm hat schon sein Scharfsinn verboten, das Zerlegen der Alltagssprache für eine Epochenwende zu halten. Was hätten wir denn gelernt, wenn die Analysen zu schlüssigen Ergebnissen kämen? Gewiss, wir könnten den Informatikern helfen, ihre Programme zu schreiben. Das ist gute angewandte Philosophie, die wir schätzen und fördern. Aber mit Blick auf unsere Selbst- und Welterkenntnis, erst recht unter dem Anspruch eigener Lebensführung im Bewusstsein der den Menschen bildenden Tradition stehen dem Analytiker der Sprache alle philosophischen Lektionen noch bevor. Und die Nabelschau der Moderne macht uns auch nicht klüger.14 14 Ich gestehe, dass ich anfangs selbst auf begriffliche und terminologische Klärungen durch die analytische Philosophie gesetzt habe. Sie ist bei einzelnen Denkern wie Quine, Davidson, Putnam, Thomas Nagel oder Harry Frankfurt auch zu finden, kann aber nicht „der“ analytischen Philosophie gutgeschrieben werden. Die hat sich vielmehr im Streit der Schulen und durch eine hemmungslose Interessenvertretung um ihren wissenschaftspolitischen Kredit gebracht. 7 Das wusste Henrich von Anfang an, obgleich es manchem seiner analytisch festgestellten Schüler entging. Einer von ihnen behauptete 1982, nachdem er selbst zum Professor geworden war, die Fluchtlinien15 machten jedem klar, was er selber natürlich schon seit langem wisse: Henrich sei „religiös“ geworden: Von dem sei philosophisch nichts mehr zu erwarten. Der junge Kollege hatte damals noch nicht begriffen, dass „Lebensführung“, „Glück“ oder, „Dankbarkeit“ ebenso originäre philosophische Themen sind wie „Grund“ oder „Abschluss“, „Gang“ oder „Grenze“ und dass, auch wenn man die Metaphysik kritisch behandelt, die Frage nach Gott nicht zu umgehen ist. Tröstlich ist, dass der enttäuschte Schüler in der gesuchten Distanz zum Lehrer eben diese Einsicht allmählich selbst gewonnen hat er. Er schreibt nun selber über diese Fragen und ihre lebenspraktische Bedeutung. Das aus sprachanalytischer und modernitätstheoretischer Befangenheit resultierende Missverständnis der Jüngeren wäre keiner Erwähnung wert, wenn ihm nicht auch ein bedeutender Hegel-Preisträger zum Opfer gefallen wäre. Er machte seinem Kollegen den Vorwurf, ein Denker der bloßen Innerlichkeit zu sein; damit sinke er auf das Niveau eines seichten Dichters herab, von dem der Kritiker mit sichtlicher Verachtung sprach.16 In einer Feierstunde tut es nichts zur Sache, wer der Kritiker war und welchen Dichter er meinte. Von philosophischer Bedeutung ist allein die Einsicht, dass es gerade die „Innerlichkeit“ des Henrich’schen Ansatzes ist, die ihm den denkbar sichersten Platz in der äußeren Welt verschafft. Sie ist es überdies, die uns den besten Zugang zu den uns in und mit der Welt tragenden Gründen eröffnet. Seine explizit gemachte Position im alles implizierenden Bewusstsein hat Dieter Henrich von Anfang an vor jenen Kurzschlüssen bewahrt, auf welche die Philosophie des 20. Jahrhunderts ihre Schulen zu gründen suchte. Deshalb war es ihm auch versagt, in der Logik der Forschung, im Aufbau einer Protosprache, in Fluchtlinien, Frankfurt a. M. 1982. Henrichs Antwort auf die 1985 von Jürgen Habermas im Merkur 439/440 unter der eindeutig beantworteten Frage „Rückkehr zur Metaphysik?“ vorgetragene Kritik findet sich unter dem Titel: Was ist Metaphysik – was Moderne? Zwölf Thesen gegen Jürgen Habermas, in: D. Henrich, Konzepte. Essays zur Philosophie in der Zeit, Frankfurt a. M. 1987, 11 – 43. In der Fußnote kann an den Vergleich auch namentlich erinnert werden: „Mit solchen der Metaphysik entlehnten Formulierungen meldet Henrich einen Anspruch an, der zur ‚modernen Bewußtseinslage‘ dissonant ist. Wer den Fallibilismus der Wissenschaften durch ein nicht fehlgehen könnendes, auf die Traditionsformen der Lehre angewiesenes Wissen ergänzen und gleichsam heilen will; wer sich dabei zutraut, Lebensformen im ganzen normativ auszuzeichnen und in eine objektive Rangfolge zu bringen, der tritt mit großer Prätention auf – am Ende nicht weniger prätentiös als Peter Handtke, der sich inzwischen anschickt, der Dichtung die Qualität eines verkündenden Gesangs, des Seherischen zurückzugeben. Es besteht eine Verwandtschaft der Gesten.“ (903) Siehe dazu auch: V. Gerhardt, Metaphysik und ihre Kritik. Die Metaphysikdebatte zwischen Jürgen Habermas und Dieter Henrich, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 42, 1988, 45 – 70. 15 16 8 der Apotheose der Hermeneutik, in der Kompensation der Abstraktion, in der bloßen Erzählung oder in einer Theorie der Kommunikation einen neuen Grund für den sicheren Gang des Erkennens zu vermuten. Dies waren und sind noch die ernsthaften Vorhaben seiner philosophierenden Zeitgenossen; von den bunten Perlen der bloßen Differenz, die uns unablässig als modernes Surrogat der Wahrheit feilgeboten werden, wollen wir erst gar nicht sprechen. Dieter Henrich schweigt in diesen Dingen ja auch. Und wenn er doch einmal das ihm entgegenstimmende „unisono“ in der Vielfalt der Schulund Stilrichtungen bis hin zu den „Spektren der neueren Phänomenologie und Gesellschaftsphilosophie“ erwähnt, dann erfolgt die Abgrenzung in einer unnachahmlichen Umkehrung der Wertung, die erkennen lässt, dass bei diesem Denker schon die Reflexion eine voll ausgebildete Praxis ist: Angesichts der allgemeinen „Verwerfung“ der von ihm beharrlich festgehaltenen Subjektivität, „durfte man“, so sagt er, „die Rollen des Außenseiters und zudem des ewig Gestrigen nicht scheuen“17. 8. Die Aufhebung der Polemik. Welche Ironie in Henrichs Bescheidenheit wirklich liegt, wird erst im Kontrast zu Hegel deutlich. Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, wie sich der Namensgeber des heute vergebenen Preises in vergleichbarer Lage verhalten hat. Vor allem mit Blick auf jene, die von der Wahrheit nichts mehr wissen wollen (und die es schon damals reichlich gab), sitzt Hegels Polemik locker: Sie seien „Heerführer der Seichtigkeit“; sie ließen sich alles Vernünftige „schlafend“ geben, um es dann in den „Brei des Herzens“ zusammenfließen zu lassen.18 Anderen bescheinigt Hegel kurzerhand einen „völligen Mangel an Gedanken“.19 Hegel war derart überzeugt, sich selbst auf dem Hauptweg der Philosophie zu befinden, dass er für die Abweichler nur Verachtung übrig hatte. Er stellte sie ins „Abseits“ und sich ins Zentrum: Mit ihm rückte auch seine Zeit in den Fokus des Geschehens. So erklärte er die Berliner Universität am Tag seiner ersten Vorlesung zur „Universität des Mittelpunkts“.20 Das mag uns heute vermessen erscheinen; angesichts des Bankrotts der Berliner Wissenschaftspolitik käme nur eine Satire heraus, wollte man die Formel wiederbeleben. Gleichwohl spricht ein Vertrauen in die eigene Gegenwart und in die eigenen Kräfte daraus, das wir uns und unseren Zeitgenossen schon Subjektivität als Prinzip, in: Bewußtes Leben, Stuttgart 1999, 49 – 73, 53. Rechtsphilosophie, Vorrede WW 7, 19 f. 19 Rechtsphilosophie, § 258, Anm., 7, 402. 20 Konzept der Rede beim Antritt des philosophischen Lehramtes an der Universität Berlin am 22. Oktober 1818; WW 10, 399 – 417, 400; dazu: Volker Gerhardt, Zur philosophischen Tradition der Humboldt-Universität. Akademische Vorträge der Humboldt-Universität, Heft 1, Berlin 1993, 1 – 37; siehe auch: V. Gerhardt/R. Mehring/J. Rindert, Berliner Geist. Eine Geschichte der Berliner Universitätsphilosophie, Berlin 1999. 17 18 9 deshalb empfehlen möchten, weil wir anderes als die eigenen Kräfte in der eigenen Zeit ohnehin nicht haben. Das Vertrauen kann aber nur so lange tragfähig sein, als es aus der tätigen Bewältigung der Gegenwart erwächst und sich nicht, nach der üblichen Generalabrechnung mit dem Bestehenden, gänzlich auf die Zukunft wirft. Das ist einer der großen Unterschied zwischen Hegel und Marx.21 Der Marxismus, mehr braucht hier über diesen Gewaltstreich des Denkens nicht gesagt zu werden, hat eigentlich nur den polemischen Umgang mit dem Gegner von Hegel übernommen. In dem Versuch, sich die intellektuelle Autorität der Philosophie dialektisch einzuverleiben, ist bloßer Stoffwechsel (mit den zugehörigen Abfallprodukten) übrig geblieben. Vielleicht erklärt die geschichtliche Verselbstständigung der bloßen Polemik, warum Dieter Henrich die Haltung des unendlichen Verstehens kultiviert und selbst den unzureichenden Alternativen Argumente abgewinnt, die er jederzeit bereitwillig verbessert – auch und gerade, wenn sie gegen ihn zu sprechen scheinen. 9. Systematik und Schulverzicht. Die glückliche Vereinigung seiner historischen und analytischen Begabung hat Henrich zum natürlichen Vermittler zwischen analytischer Philosophie und kontinentaler Theoriebildung werden lassen. Noch vor Gadamer (und mit stärkerem philosophischen Akzent als der darin besonders eindrucksvolle Jürgen Habermas) ist er zum Diplomaten seiner Disziplin geworden. Das hat es ihm ermöglicht, die Attraktivität der begrifflichen Präsenz seines Denkens durch eine Aura des Neuen zu erhöhen, das ihm durch seine internationale Erfahrung wie von selbst zufiel. So kam es, dass sich Aktualität und Solidität bei ihm nicht wechselseitig ausgeschlossen haben, was einmal mehr erklärt, warum sich in seinen Seminaren die besten Köpfe versammelten. Und da die besten Köpfe sich auch am stärksten zu unterscheiden pflegen, hat Henrich zwar die größte je in Deutschland gezählte Schar hochbegabter Schüler um sich versammelt.22 Aber er stand nie in der Gefahr, eine Schule zu gründen. Sobald eine philosophische Schule mehr leistet, als die Anfänger auszubilden und die Fortgeschrittenen auf ihren eigenen Weg zu bringen, wird sie zum Widerspruch in sich.23 Zu seiner unvergleichlichen Attraktivität als Autor und Lehrer gehört, dass Henrich die analytische Intelligenz in gleichem Maße anzuziehen verstand wie Siehe dazu: D. Henrich, Karl Marx als Schüler Hegels (1961), in: Hegel im Kontext, Frankfurt a. M. 1971, 187 – 207. 22 Ich darf das sagen, denn ich gehöre nicht dazu. 23 Man muss hinzufügen, dass nicht alle philosophischen Schulen unter diesem Widerspruch stehen, weil ihnen der Titel einer Schule vornehmlich von ihren Gegnern verliehen worden ist und sich nur dadurch eingebürgert hat. So ist es bei der „Ritter-Schule“ oder bei der „Heidelberger Schule“, der Henrich gelegentlich zugerechnet wird. 21 10 die spekulative Vernunft und zugleich jenen reichlich bot, die sich in der Geschichte der ältesten Kulturwissenschaft der Welt, nämlich der Philosophie, heimisch machen wollten. Worin ihnen der Lehrer aber bis heute sämtlich überlegen ist, das ist die Ausbildung eines tragenden Gedankens, durch den die Philosophie erst wird, was sie ist: nämlich die Vergegenwärtigung der Welt, zu der sie selbst gehört, so dass es möglich wird, sie als Ordnung des Ganzen zu denken und ihr mit eigenen Gründen zu begegnen. Das macht einmal mehr verständlich, warum die historische Forschung, obgleich sie mitunter seine ganzen Kräfte bindet, für Dieter Henrich nie mehr als ein Mittel zum Zweck sein konnte: Im Strukturwandel der Gottesbeweise wie auch in der Karriere des Theorems der Selbsterhaltung sucht er nach dem Grund, aus dem sich das Erkennen – gerade in der modernen Verabsolutierung der Relativität – dennoch widerspruchsfrei verstehen kann. Die gegenwärtig von einigen extrem verspätetenen Romantikern erneut in Umlauf gebrachte These, die Philosophie habe sich im Umgang mit ihrer eigenen Geschichte zu erschöpfen, wird nirgendwo eindrucksvoller widerlegt als in der akribischen Subtilität der Philosophiegeschichtsschreibung Dieter Henrichs. Er kann es sich erlauben, den Soziologismen und Historismen der Moderne weit entgegenzugehen. Denn er lässt sich auch noch im Detail von den großen Fragen leiten, die den Grund und den Abschluss des Denkens, also den Sinn unseres Tuns betreffen. Der gegen die Epochenfixierung seiner Zeitgenossen so gleichgültige Denker hat es deshalb auch nie nötig gehabt, die Metaphysik zu verwerfen.24 So kann er jederzeit deutlich machen, dass Tradition und Empirie der Philosophie bedeutende Zugänge eröffnen. Mehr aber nicht! In ihren eigenen Einsichten führt die Philosophie weit über ihre kulturellen und szientifischen Anlässe hinaus. Wohin? In die reflexive Existenz des Einzelnen: Das Subjekt versteht sich „notwendig als ein Einzelnes“. Darin aber liegt beschlossen, „dass es den Gedanken von möglichen anderen Subjekten, folglich aber [...] den Gedanken einer Ordnung denken muss, in der solche Subjekte voneinander verschieden sind“.25 Der Gedanke einer solchen Ordnung ist das älteste Thema der Philosophie. Henrich führt vor Augen, dass es auch heute noch das wichtigste Problem darstellt, wenn man nicht nur dem Namen nach philosophiert. 10. „Die Macht des Geistes“. Damit bin ich beim zentralen Punkt meiner Lobrede, der mich zu der Überzeugung bringt, dass der Hegel-Preis, wenn es ihn nicht schon gäbe, für Dieter Henrich hätte gestiftet werden müssen: Er hat die Einsicht in die Bedingungen unseres Erkennens derart präzisiert, dass es nun24 25 Siehe dazu: Warum Metaphysik? in: Bewußtes Leben, Stuttgart 1999, 74 – 84. Subjektivität als Prinzip (1999), in: Bewußtes Leben, Stuttgart 1999, 49 – 73, 70. 11 mehr als erwiesenermaßen unmöglich gelten kann, das Selbst- und Weltverhältnis des Menschen auf physiologische, evolutionäre oder soziohistorische Tatsachen zurückzuführen. Selbst die Sprache, mit der ihr zugrunde liegenden Fähigkeit der Selbstbezeichnung ihrer Sprecher, reicht dazu nicht aus. Der Grund für diese Unmöglichkeit liegt in der reflexiven Vorgängigkeit des Geistes. Die gattungs- und die individualgeschichtlichen Indizien für seine Entstehung aus und in der Natur sind offenkundig; es ist noch nicht einmal zu leugnen, dass man den Geist weitgehend als Natur, nämlich als ihr Organ rekonstruieren kann; schließlich ist seine materiale Bindung an die stimulierenden und kontrollierenden Formen und Gehalte des kulturellen Lebens eine wesentliche Bedingung seiner Funktion. Und dennoch sichert er sich in eben diesen Funktionen einen immer wieder neu erreichten spontanen Vorsprung, der in jeder Naturerklärung wirksam wird, so dass er prinzipiell uneinholbar ist. Was immer dem Selbstbewusstsein vorausliegt, muss in dieser Funktion von ihm erkannt sein. Damit ist auch gesagt, dass es das Bewusstsein ist, das sich um die Erkenntnis bemüht, mit der es sich eliminieren möchte. Es ist der Geist selbst, der sich zu hintergehen versucht. Dies kann ihm a priori nicht gelingen – schon gar nicht, wenn er die Natur an seine Stelle zu setzen sucht. Denn auch diese Operation bleibt dem Geist nicht erspart, wenn er alles auf Natur zurückführt: Es ist nichts und niemand anderes als das menschliche Selbstbewusstsein, das die Natur erst denken muss, ehe es sich, in einem törichten Akt der Selbstverleugnung, restlos in sie zu überführen sucht. Nun könnte der Ausschluss einer Ableitung des Selbstbewusstseins aus externen Gründen immerhin hoffen lassen, dass es sich aus einem internen Grund seiner Funktionsweise herleiten lässt. Darauf hatte zumindest Fichte in seiner „ursprünglichen Einsicht“ gehofft; Schelling und Hegel hatten sich von dieser Erwartung leiten lassen. Doch Dieter Henrich hat uns darüber aufgeklärt, dass auch dies als ausgeschlossen gelten muss.26 Sein Nachweis ist so originell wie definitiv: Denn der alles Erkennen tragende Akt des Selbstbewusstseins ist kein gleichsinniger Impuls, so als würde mit ihm das innere Licht der Aufmerksamkeit angedreht, das dann als die eine Quelle für alles gelten kann, was wir als Empfindung und Gefühl, als Wahrnehmung und Denken an uns selbst erleben. Schon das bloße Haben des Selbstbewusstseins ist ein reflexiver Vorgang, an dem mehrere Momente – die Ausrichtung auf einen Inhalt, die Gegenwärtigkeit des sich ausrichtenden Selbst wie auch die uno actu stattfindende Rückwendung des Selbst auf sich – beteiligt sind. Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt a. M. 1967; ferner der Aufsatz: Fichtes „Ich“, in: Selbstverhältnisse. Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der klassischen deutschen Philosophie, Stuttgart 1982, 57 – 82. 26 12 Keines dieser einzelnen Momente kann eine Priorität beanspruchen, so dass keines aus sich heraus die Kraft haben kann, die anderen zu begründen. Auch ihr vollkommenes Zusammenspiel ist so sehr an das in ihm vorab wirkende, sich in ihm jedoch zugleich entziehende Selbst gebunden, dass es auch in seiner integralen Einheit nicht ausreicht, um als erster Grund aller Akte des selbstbewussten Wissens anerkannt zu werden. Also hat man sich einzugestehen, dass Selbstbewusstsein nicht selbstexplikativ ist. Es versteht sich nicht von selbst. Aus dieser unerhörten Einsicht, die seit Nietzsche als fortwirkende geistige Erschütterung präsent ist, gewinnt Henrich den nüchternen Einstieg in eine Metaphysik von äußerster Reichweite. 11. Das Subjekt ist Substanz. Im Ausgangspunkt dieser kritischen Metaphysik haben wir eine paradoxe Lage: Das Selbstbewusstsein des Menschen kann nicht aus äußeren Bedingungen abgeleitet werden, es lässt sich aber auch nicht aus seiner selbstbewussten Selbstbezüglichkeit rekonstruieren. Die Subjektivität ist für sich; sie entsteht „spontan“, und ihr „eigentlicher Grund“ ist, wie Henrich sagt, „ganz und gar endogen“.27 Das wäre ein großartiges Angebot an die Neurobiologen, die derzeit so versessen an der endogenen Herleitung der zenralnervösen Leistungen des Bewusstseins arbeiten, dass sie dem Idealismus näher sind als alle Philosophen, die man als Idealisten abtut. Doch Henrich zeigt, dass sich die endogene Subjektivität selber nicht genügt. Sie ist gerade in ihrer ganz aus sich stammenden Funktion auf etwas verwiesen, was exogen erzeugt und ihr tatsächlich gegenüberstehen muss. Das Selbstbewusstsein ist nämlich in seinen eigenen Vollzügen auf eine Ordnung angewiesen, die es mit den Dingen, ihren wechselseitigen Relationen und dem Selbstbewusstsein der anderen teilt. Die so genannte Innenwelt der Subjektivität befindet sich nicht nur in einer Strukturanalogie zur so genannten äußeren Welt, sie teilt sich mit ihr vielmehr das, was ihr selber wesentlich ist, nämlich ihre „Verkörperung“.28 Also ragt sie wirksam in die Welt hinein, in der sie sich so erkennt, dass sie von ihrer Verbindung mit der Welt nur in einem reflexiven Akt künstlich absehen kann, um sich in ihm der Einheit mit ihr zu versichern. Damit wird das denkende Subjekt, das von sich nur weiß, weil es erlebendes Subjekt ist, das aber nur erleben kann, weil es sinnlich ist, das aber Sinnlichkeit nur hat, weil es körperlich ist, das aber nur verkörpert sein kann, weil es Körper in der Ordnung der Körper ist, die – als Ordnung – aber nur denkend vergegenwärtigt werden kann, zum alles vermittelnden Träger von Differenz und KonseSubjektivität als Prinzip, a.a.O., 62. Ebd., 70. Vgl. ferner: Versuch über Kunst und Leben. Subjektivität – Weltverstehen – Kunst, München 2001. 27 28 13 quenz.. Also ist das sich so wirksam in der Welt bewährende Subjekt nichts anderes als die Substanz, aus der heraus wir die Welt begreifen. 12. Die Aufhebung Hegels. Zu den Gemeinplätzen, an denen der Zeitgeist selbst über seine verschiedenen Moden hinweg beharrlich festgehalten hat, gehört die Überzeugung, dass es keine „Substanz“ mehr gebe. Der „Antiessenzialismus“ vereint sie alle, die sich als modern (oder als mehr als das) empfehlen, ganz gleich ob sie sich als Genealogen oder historische Analisten, als Strukturalisten oder Sprachanalytiker, als Anwälte der Funktion oder des Systems, der negativen Dialektik oder der kommunikativen Diskurse, der bloßen Tatsachen, der reinen Kultur oder der Medien (als der neuen Dinge an sich) verstehen. Die Postmodernen machten aus dem Verzicht auf die Substanz sogar die Substanz ihres Programms, dessen Wahrheit darin bestand, dass sie mit der Substanz auch das Subjekt zu verabschieden hatten. Von alledem hat Dieter Henrich sich frei gehalten. Er steht an der zwar historisch gebildeten, aber sachlich ausgerichteten Front des Gedankens, ohne es nötig zu haben, ältere Epochen des Denkens abzuwerten. Es gelingt ihm, der Realität ein selbstbewusstes Fundament zu geben, das weder dem Idealismus noch dem Materialismus zugerechnet werden kann. Er legt die Stellung frei, in der das Subjekt mit allen seinen bewussten Leistungen zu sich, zu anderen Subjekten und zu objektiven Verhältnissen steht, und entdeckt in ihm den Grund, der auf mögliche Gründe für alles und jedes verweist. So kommt das von vielen schon verabschiedete Subjekt in die Rolle der von nahezu allen preisgegebenen Substanz, der dieser Name deshalb gebührt, weil sie Träger aller Funktionen des Begründens ist. Der „Grund im Bewusstsein“ kann nicht das Bewusstsein selber sein; aber es kommt nur ein Grund in Frage, den es im Bewusstsein gibt.29 So erhält Hegels Logik, deren Programm es ist, „die Substanz als Subjekt“ zu denken,30 eine Fassung, die weder den Begriff des Geistes noch den des Absoluten aufgeben muss und die dennoch der lebendigen Individualität angemessen ist. Wie ist Dieter Henrich auf diese in ihrer systematischen Reichweite erst noch zu entdeckende Lösung gekommen? Die Antwort fällt mir an dieser Stelle und bei dieser Gelegenheit besonders leicht: Durch eine Hegel-Lektüre im Kontext.31 Er hat Hegel nicht nur in seinem historischen, sondern auch in seinem inneren geDer Grund im Bewusstsein. Untersuchungen zu Hölderlins Denken (1794 – 1795), Stuttgart 1992. 30 Siehe dazu: Hegels Logik der Reflexion, in: Hegel im Kontext, Frankfurt a. M. 1971, 95 – 156, 105. 31 Vgl. die Aufsätze in: Hegel im Kontext, Frankfurt a. M. 1971; neuerdings dazu auch: D. Henrich, Between Kant and Hegel. Lectures on German Idealism, ed. by David S. Pacini, Cambridge 2003 (Harvard Univ. Pr.). 29 14 danklichen Zusammenhang ernst genommen. Dabei hat er ihn gerade nicht historisiert. Er hat auch der Versuchung widerstanden, einzelne Elemente herauszubrechen und Hegel als den Bewahrer selbstverständlicher Sittlichkeit, als negativen Theologen, als kommunitaristischen Denker der Gesellschaft, als Evolutions-, System- oder Anerkennungstheoretiker oder, wie zuletzt, als Pragmatisten projektfähig zu machen. Es blitzt Polemik auf, wenn er dieses von seinen Zeitgenossen praktizierte Verfahren als Arbeit im „Steinbruch“ oder, etwas freundlicher, als „Goldwäscherei“ bezeichnet.32 Er hingegen versucht, Hegel als den Philosophen zu lesen, der im Ganzen die Wahrheit sucht, und den man daher nur von diesem auf das Ganze der menschlichen Erkenntnis bezogenen Anspruch her verstehen kann. Dabei, so scheint mir, ist es Henrich gelungen, wirklich über Hegel hinauszukommen. Hegel-Schüler der ersten Generation haben noch die Überwindung des Lehrers propagiert. Deren Nachfolger hatten schon nicht mehr die Kraft zu solchen Vorsätzen. Auch Henrich hat nichts proklamiert; er wollte Hegel weder revolutionieren noch modularisieren. Er hat lediglich dessen Ausgangsproblem von seinem Ursprung her neu durchdacht und hat es unter die verschärften Kriterien logischer Konsistenz gestellt. Dabei hat er sowohl an dem Anspruch auf das Ganze wie an dem Vorrang der Einzelnen festgehalten. Die Wahrheit der hegelschen Dialektik ist dabei auf höchst konsequente Weise hervorgetreten: Sie muss sich nämlich auch darin beweisen, dass sie sich auf Hegel selber anwenden lässt. Also darf Hegels eigenes Denken von der Bewegung der Aufhebung nicht ausgenommen sein. Und eben dies ist Henrichs Verdienst: „Es steht bei uns, ob wir es vermögen, das spekulative Denken mehr noch als Hegel in unsere Lebenswirklichkeit einzubringen und selbst zu einer Lebenswirklichkeit zu machen, ohne Hegelianer zu sein oder es noch eigentlich werden zu müssen.“33 Der im Ganzen neu durchdachte Hegel hebt sich selber auf. Henrich spricht von einer „Permutation“. Wer aus Hegel ein sakrosanktes Schuloberhaupt macht, wird bezweifeln, ob jemand für die Aufhebung Hegels den Hegel-Preis erhalten darf. Ich hingegen sehe durch diese Leistung zwingend begründet, dass er ihn ein zweites Mal verdient. Doch darüber ist heute nicht zu befinden. Deshalb beglückwünsche ich Dieter Henrich als den Preisträger des Jahres 2003 und zeige mich höchst befriedigt, dass er als zwölfter in einer ehrenvollen Reihe den apostolischen Abschluss macht. Damit ist für die Zukunft alles offen. 32 33 Erkundung im Zugzwang (2002), unveröffentlichtes Manuskript, 28. Erkundung im Zugzwang, a.a.O., 30. 15 Volker Gerhardt Humboldt Universität zu Berlin 16