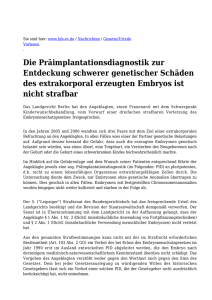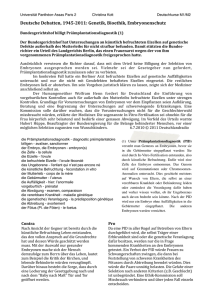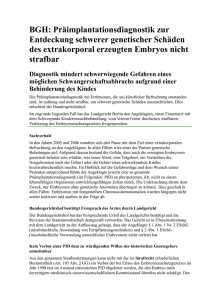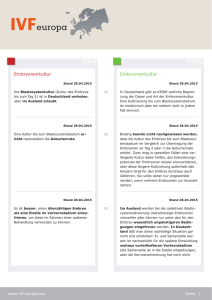Menschen werden nicht einfach auf die Welt gestellt, sondern sie
Werbung

Tristram’s Welt Über einige Folgen der neuen Fortpflanzungstechnologien* Frank Mathwig 1. Ethik im Konjunktiv «Ich wünschte, entweder mein Vater oder meine Mutter, oder fürwahr alle beide, denn von Rechts wegen oblag die Pflicht ihn beiden zu gleichen Teilen, hätten bedacht, was sie taten, als sie mich zeugten.»1 Mit diesen Worten beginnt Tristram Shandy’s Klage über seine Geburt in dem avantgardistischen Roman von Laurence Sterne. Der Protagonist hadert mit seinem Schicksal, dass er lebenslang die Folgen einer kurzen Ablenkung des Vaters beim Zeugungsakt zu tragen habe, dem er seine Existenz verdankt. Immerhin gibt ihm der naturwissenschaftlich versierte Vater darin recht: «Meines Tristram’s Unglück begann ja neun Monate bevor er überhaupt zur Welt kam.»2 Die Schwierigkeiten, an denen sich die Romanfigur vor 250 Jahren abarbeitet, bilden auch das Zentrum der bioethischen Kontroversen heute. Zugespitzt geht es um zwei unbequeme Einsichten: 1. Das menschliche Leben beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern bereits ab ovo, mit der Zeugung. Daraus folgt 2. Für das Leben eines Menschen ist es von erheblicher Wichtigkeit, wie es ihm als Embryo ergangen ist. So sehr Embryonen im Zentrum des öffentlichen und politischen Interesses stehen, so befremdlich klingt der Gedanke von der biographischen (nicht nur biologischen) Verbindung zwischen dem Embryo und dem seine eigenen Anfänge reflektierenden Subjekt. Der Einwand liegt nahe: Es handelt sich lediglich um die provozierende Phantasie eines Schriftstellers aus der Zeit der Aufklärung. Natürlich ist es eine amüsante Spinnerei, wenn sich Tristram in die Lage des Spermiums seines Vaters auf dem Weg zur Eizelle der Mutter versetzt – und erinnert an Woody Allens mitleidige Rolle als ängstliche Samenzelle in Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Tatsächlich geht es um Vorstellungen – nicht nur im Blick auf die künstlerische Aufarbeitung des Themas, sondern auch bei der Sache selbst. Daran hat sich seither grundsätzlich wenig geändert. Aber weil wir aktuell daran sind, sehr fundamentale Verschiebungen vorzunehmen, kommen wir – zumindest aus ethischer Sicht – nicht darum herum, uns auf solche Vorstellungen einzulassen. Denn wir sind momentan daran, die künstlerischen Phantasien technologische Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Blick auf die aktuellen Debatten zeigt: Den Herausforderungen dieser Vorstellungswelt sind Öffentlichkeit, Politik und Ethik nicht gewachsen. Die Ethik beschäftigt sich seit ihren systematischen Anfängen bei Aristoteles mit dem beobachtbaren Verhalten von Menschen. Dieses unterzieht sie einer kritischen Reflexion im Blick auf das zu erstrebende Gute und Gerechte. Erst die technologischen Entwicklungen der vergangenen 50 Jahre nötigten die * 1 2 Vortrag anlässlich der Tagung ‹Kind – Geschenk oder Strategie. Brennende Fragen zu medizinisch unterLaurence Sterne, Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman, Frankfurt/M. o.J., I,9. Die vieldeutigen Einsichten Tristram’s stehen am Beginn der instruktiven Untersuchung von Anja Karnein, Zukünftige Personen. Eine Theorie des ungeborenen Lebens von der künstlichen Befruchtung bis zur genetischen Manipulation, Berlin 2013, 10f. Sterne, Leben, a.a.O., I,15 1 Frank Mathwig, Tristram’s Welt Disziplin zu einem Umdenken. Plötzlich sah sie sich genötigt, neue Handlungsoptionen auf ihre möglichen, zukünftigen Wirkungen hin zu befragen. Aus Ethik wurde eine Art Zukunftsforschung, mit allen Unwägbarkeiten die damit – diesseits von Glaskugeln und Kaffeesatz – verbunden sind. Aus der Not unserer notorischen Zukunftsblindheit machte Hans Jonas Ende der 1970er Jahre eine epochale Tugend. Für die Beurteilung der Folgen des Einsatzes neuer Technologien empfahl er das Prinzip: «in dubio pro malo – wenn im Zweifel, gib der schlimmeren Prognose vor der besseren Gehör, denn die Einsätze sind zu gross geworden für das Spiel».3 Im Zweifelsfall soll also die schlechte Prognose als Entscheidungsgrundlage gewählt werden. Als «erste Pflicht der Zukunftsethik» fordert der Philosoph die sorgfältige «Beschaffung der Vorstellung von den Fernwirkungen» neuer Technologien.4 Es geht also nicht um eine – heute hoch im Kurs stehende – Technikfolgenbewertung, sondern um die Entwicklung und Reflexion von Vorstellungen möglicher Technologiefolgen. Ein solches Vorgehen setzt dreierlei voraus: 1. Anerkannt wird, dass es solche Folgen noch nicht gibt. Das Nachdenken darüber entzieht sich empirischer Überprüfbarkeit. 2. Es geht auch nicht um zukünftig eintretende Folgen. Angesichts der Reichweite der Folgen moderner Technologien kann nicht abgewartet werden, ob das Kind in den Brunnen fällt oder nicht. 3. Ausschlaggebend ist allein der begründete Verdacht, dass bestimmte unerwünschte Folgen eintreten könnten. Die begründete Vorstellung reicht aus, um auf eine neue Technologie zu verzichten. Gefordert ist also eine Ethik im Konjunktiv, die ethische Reflexion von Möglichkeiten, im Blick darauf, ob sie wirklich werden sollen. Auch die ethische Diskussion über die Präimplantationsdiagnostik kommt ohne den Konjunktiv nicht aus. Das ist kein Mangel, sondern eine schlichte Notwendigkeit. Man kann sich dem Nachdenken im Konjunktiv nicht mit dem Argument entziehen, dass zuerst die Folgen abgewartet werden müssten, um über eine verlässliche Datenbasis zu verfügen. Vielmehr gilt umgekehrt: Liegen die Fakten erst einmal auf dem Tisch, erübrigt sich das Räsonieren darüber, ob sie tatsächlich gewollt waren. Denn dann sind sie die Realität! Die Frage der Folgen taucht in der aktuellen PID-Debatte nur ganz am Rand auf. Das ist kein Zufall, sondern beruht auf einer ethisch-rechtlichen Vorentscheidung: Die auf den Weg gebrachte liberale Regelung der PID gründet in dem Recht auf reproduktive Autonomie, also der elterlichen resp. mütterlichen Freiheit zur Wahrnehmung weitreichender persönlicher Interessen im Blick auf das eigene Kind. Das klingt fast wie die Einlösung der Forderung Tristram Shandy’s, die Eltern sollten gefälligst bedenken, was sie tun, wenn sie ein Kind zeugen. Heute haben Eltern und Mütter bis zur Geburt des Kindes eine Kaskade von Entscheidungssituationen durchlaufen. Allerdings denkt dabei niemand an Tristram’s Problem – das in unsere Zeit übersetzt etwa so lautet: Wie denken Eltern über ihr Kind vor der Geburt nach oder wie sollten Eltern darüber nachdenken? Wie gehen Eltern mit ihren Entscheidun3 4 Hans Jonas, Technik, Medizin und Ethik. Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt/M. 1985, 67. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt/M. 1979, 74. 2 Frank Mathwig, Tristram’s Welt gen um, nachdem das Kind geboren ist und wie das Kind mit den Überlegungen seiner Eltern, vor dessen Geburt? Diese Fragen klingen – zugegeben – reichlich fremd. Aber genauso befremdlich wird es in unserer Gesellschaft zugehen, wenn Kinder dazugehören, die Anlass haben und geben, diese Fragen zu stellen. Immerhin geht die NZZ auf der rechtlichen Grundlage des Ständeratsentscheides von rund 6000 Anwendungsfällen für PID pro Jahr aus.5 Wir sind auf dem Weg in die Tristram-Welt, also höchste Zeit, sich mit ihr vertraut zu machen. 2. Tristram’s Welt In Tristram’s Welt gibt es keine bioethischen Kontroversen. Alles dreht sich ausschliesslich um die Frage nach der Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern von der Zeugung bis zum Zeitpunkt seines Nachdenkens darüber. Diese Welt unterscheidet sich nur in einem wesentlichen Punkt von der unsrigen: Die Lebensgeschichte der Bewohner fängt – nicht nur biologisch, sondern auch biographisch – mit der Zeugung an. So wie Tristram‘s Vater feststellte, dass das Unglück seines Sohnes bereits neun Monate vor dessen Geburt begonnen hatte. Natürlich sind Embryonen auch in Tristram’s Welt gefühllos, aber der Umgang mit ihnen hat Auswirkungen auf das spätere Leben, wenn sie – prä- und postnatal – fähig geworden sind, Glück und Unglück zu empfinden. In Tristram’s Welt gibt es auch eine Ethik. Die Philosophin Anja Karnein hat mit ihrer «Theorie des ungeborenen Lebens» eine massgeschneiderte Tristram-Ethik entwickelt. Sie besteht im Kern aus zwei Grundsätzen: «Erstens ist es für Personen relevant, was mit den Embryonen geschah, aus denen sie sich entwickelt haben, und zweitens ist es für niemanden aus der Perspektive der ersten Person relevant, was mit Embryonen geschieht, die sich nicht zu Personen entwickeln.»6 Beide Thesen haben es in sich. Die erste These zielt auf Tristram’s Unglück und lässt sich in die ethische Frage umformulieren: «Wie sollen wir Embryonen, die sich zu Personen entwickeln, behandeln, damit den Personen, zu denen sie werden, durch unser Verhalten kein Unrecht geschieht?»7 Die zweite These markiert die Grenzen von Tristram’s Welt. Wie in unserer Welt, leben auch dort nur geborene Menschen. Die Ausdehnung der ethischen Frage auf die embryonale Phase erfolgt retrospektiv: Embryonen verdienen unsere ethische Aufmerksamkeit und Achtung nur, sofern sie tatsächlich geboren werden. Diese Beschränkung ergibt sich aus der Tristram’s Perspektive, der ja auch erst als Geborener die mangelnde Aufmerksamkeit der Eltern bei seiner Zeugung beklagt. Ethische Verpflichtungen gibt es danach nur gegenüber solchen Embryonen, die diese später auch (retrospektiv) einfordern können. Etwas salopp formuliert: Nur wer sich im Licht der Welt beschweren kann, hat auch pränatal einen Anspruch auf Achtung. Diese Ethik erscheint auf den ersten Blick ernüchternd. Sind wir damit nicht genau dort angekommen, wo die aktuelle Diskussion schon steht: Sicher kann mensch sich erst dann fühlen, wenn sie oder er geboren ist. Ja und nein! Denn immerhin sind wir nun mit der Frage konfrontiert, was wir Embryonen schulden. 5 6 7 Politische Kehrtwende bei Embryo-Tests, in: NZZ vom 8.9.2014. Karnein, Zukünftige Personen, a.a.O., 11. Karnein, Zukünftige Personen, a.a.O., 13. 3 Frank Mathwig, Tristram’s Welt 3. Ein Argument gegen Tristram‘s-Welt Die ethische Frage, was wir Embryonen schulden, sorgt in der Bioethik regelmässig für Nervosität. Deshalb wird viel Energie darauf verwendet, die Frage zurückzuweisen. Die Standardimmunisierungsstrategie ist simpel und besteht in dem Hinweis auf die straffreie Praxis des Schwangerschaftsabbruchs: Wenn es erlaubt ist, einen bis zu 12 Wochen alten Fötus abzutreiben, wäre es widersprüchlich, Embryonen in einem weitaus früheren Entwicklungsstadium nicht verwerfen zu dürfen. Bei dem Analogieschluss werden Handlungsfolgen aufeinander bezogen: Dem Abort entspricht die Entsorgung überzähliger Embryonen. Allerdings sitzt das Argument einem Äpfel-Birnen-Vergleich auf. Karnein bemerkt: «Das Recht einer Frau, ihre Schwangerschaft zu beenden, konnte stets verteidigt werden, indem man sich auf ihr Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Integrität berief. Im Falle von Embryonen, die ausserhalb des weiblichen Organismus erzeugt werden, also Embryonen in vitro, gibt es allerdings kein ähnlich zwingendes Interesse, an das wir appellieren könnten.»8 Beim Schwangerschaftsabbruch geht es um das leibliche Betroffensein der Mutter. Ihr leiblicher Zustand als Schwangere ist der – einzige – Grund, warum ihrem Leben Priorität gegenüber dem Leben des Kindes eingeräumt wird. Die Begründung lautet also nicht, dass es bis zu einer bestimmten Entwicklungsstufe erlaubt sei, über das Leben von Kindern frei zu verfügen. Vielmehr wird die Tötung eines Fötus nur als Folge der Absicht, Leben und körperliche Integrität der Mutter zu schützen, in Kauf genommen. Der Fehlschluss von dem Schwangerschaftsabbruch auf die PID ist ein dreifacher mit einer verblüffenden Pointe: 1. Bei der PID gibt es gar keine Leben-gegen-Leben-Konstellation und damit keine entsprechende Güterabwägung. 2. Unter der sachlich unzutreffenden Fokussierung auf die Handlungsfolgen – abgetriebener Fötus = verworfene Embryos – wandelt sich die Frage nach dem Schutz der Mutter (beim Schwangerschaftsabbruch) in die Frage nach der elterlichen Freiheit bei der Wahl ihres Kindes (bei der PID). 3. Aus der korrekten Perspektive der Schutzabsichten zeigt sich dagegen eine für die PID-Debatte überraschende Konsequenz: Weil die Frau von der PID nicht leiblich betroffen ist und deshalb ihre Selbstbestimmung und körperliche Integrität nicht in Gefahr sind, fehlt jeder legitimierende Anlass für eine Embryonenselektion. Gegen den Mehrheitsirrtum gilt: Die rechtliche Regelung der Schwangerschaftsabbruchs liefert der PID keine Legitimation, sondern – im Gegenteil – Embryonen in vitro einen komfortablen Schutz. Die Legitimation des Schwangerschaftsabbruchs bietet ein starkes Argument für die Unantastbarkeit von Embryonen in vitro. Umgekehrt formuliert: Embryonen-Selektion kann sich nicht auf die Gründe berufen, die einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen. Tristram’s Frage danach, was wir Embryonen schulden, ist damit nicht geklärt, aber einen wichtigen Schritt vorangekommen. Der Analogieschluss vom Schwangerschaftsabbruch auf die PID funktioniert nicht und damit auch nicht die Zurückweisung oder Relativierung des Embryonenschutzes. Natürlich könnte eingewendet werden, dass ein Embryo in vitro etwas völlig anderes ist, als ein Fötus in vivo. Aber erstens stammt die Idee der Analogie nicht von mir, sondern von den PID-Befürwortern und zweitens müsste andernfalls der unterschiedliche Umgang mit Embryonen und Föten präzise bestimmt und ethisch begründet werden. Ei8 Karnein, Zukünftige Personen, a.a.O., 12. 4 Frank Mathwig, Tristram’s Welt ne solche Unterscheidung ist schwierig. Schwerer wiegt aber die Tatsache, dass wir die Welt eben mit unseren Augen sehen und nicht mit den Augen Tristram Shandy’s. Dazu eine kleine Fallstudie. 4. Wer entscheidet für oder über wen? Die aktuellen PID-Diskussionen sehen die ethische Frage danach, was wir Embryonen schulden nicht vor, wie die Begründungen in der Botschaft des Bundesrates vom Sommer 2013 über die Zielsetzung einer Verfassungsrevision und einer Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes zeigen: «Der zentrale Zweck dieser Technik besteht darin sicherzustellen, dass das zukünftige Kind nicht unter einer bestimmten, genetisch bedingten Erkrankung, deren Veranlagung die Eltern tragen, leiden wird».9 Kinder sollen davor bewahrt werden, ein vermeidbares Leiden zu erdulden. Dahinter stehen die allgemeinen elterlichen Sorgepflichten für ihr Kind. «Die PID ist eine Präventivmassnahme und kann aus Sicht von betroffenen Eltern als Ausdruck dieser elterlichen moralischen Pflicht gegenüber den Kindern aufgefasst werden.»10 Warum und wem gegenüber besteht eine solche moralische Pflicht? Natürlich gegenüber dem Kind und seinem prognostizierten Leiden. Keine Frage! Eltern sollen, wenn immer möglich, Leid von ihren Kindern abwenden und für ihren Schutz sorgen. So weit, so gut. Aber was können Eltern konkret tun? Sie sollen im Interesse des Kindes dessen Geburt verhindern. Die Zerstörung von Embryonen wird mit der elterlichen Fürsorgepflicht begründet und als Leidvermeidungsstrategie für das Kind empfohlen. Natürlich führt – aus einer utilitaristisch-bilanzierenden Sicht – die Vernichtung eines genetisch auffälligen Embryos zu einer quantitativen Leidverminderung in der Welt, weil ein potentieller Leidenskandidat gar nicht zur Welt kommen würde. Das scheint – Sie erinnern sich – der zweiten These von Tristram’s-Welt-Ethik zu entsprechen, nach der «es für niemanden aus der Perspektive der ersten Person relevant [sei], was mit Embryonen geschieht, die sich nicht zu Personen entwickeln».11 Das klingt nach einem philosophischen Taschenspielertrick, dem der Philosoph Jürgen Habermas die unbequeme Frage entgegenhält: «Wird diese Interpretation nicht stets mit der Zweideutigkeit des altruistischen Deckmantels für die Egozentrik eines von vornherein konditionierten Wunsches behaftet bleiben?»12 Anders formuliert: Versteckt sich hinter der angeblichen Pflicht der Leidvermeidung nicht vielmehr die elterliche Verweigerung gegenüber einem solchen Kind? Tatsächlich ändert auch der Bundesrat 30 Seiten später seine ursprüngliche Haltung: «Die Eltern können ihren Wunsch nach einem leiblichen Kind erfüllen, ohne befürchten zu müssen, dass eine genetische Erkrankung dieses Kindes ihre Belastbarkeit überfordern könnte. 9 10 11 12 13.051 Botschaft zur Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich (Art. 119 BV) sowie des Fortpflanzungsmedizingesetzes (Präimplantationsdiagnostik) vom 7. Juni 2013, 5854. NEK, Präimplantationsdiagnostik II. Spezielle Fragen zur gesetzlichen Regelung und zur HLA-Typisierung Stellungnahme Nr. 14/2007, Bern, November 2007, 7. Karnein, Zukünftige Personen, a.a.O., 11. Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt/M. 2005, 160. 5 Frank Mathwig, Tristram’s Welt Aus dieser Perspektive sind denn auch die Eltern die hauptsächlichen Nutzniesser des Verfahrens. Dieses ist nicht etwa anzuwenden, um dem Kind selbst ein unzumutbares Leben zu ersparen».13 Auch die nationale Ethikkommission gibt zu bedenken: «Realistisch betrachtet ist der Grund zur Durchführung der Pränataldiagnostik (PND) und auch der Präimplantationsdiagnostik (PID) die Belastung der Eltern und nicht die zu erwartende Krankheit des Kindes. Man kann nicht vorwegnehmen, dass es ein Kind vorziehen würde, nicht zu leben.»14 Allerdings hat der Bundesrat nicht nur die betroffenen Eltern im Blick. Die «unzumutbare Belastungssituation» bestehe nicht nur in der seelischen Belastung, «sondern insbesondere auch [in den] grossen Einschränkungen und Beanspruchungen, die die Eltern zumindest in den ersten Lebensjahren des Kindes überwiegend allein zu tragen haben. Der Wunsch der Eltern, eine solche Situation möglichst zu vermeiden, wird grundsätzlich als Legitimation für die PID und die Hinnahme ihrer Gefahren und Nachteile anerkannt.»15 Diese Bemerkungen erinnern an eine Beobachtung des Psychoanalytikers und Philosophen Slavoj Žižek im Zusammenhang unserer Wahrnehmung von Fremden.16 Wir neigen dazu, Menschen nach einer verbreiteten Marktstrategie zu behandeln. Es gibt immer mehr Produkte, deren negative oder gefährliche Eigenschaften herausgefiltert werden: Kaffee ohne Koffein, Rahm ohne Fett, Bier ohne Alkohol. Nach dem gleichen Schema designen wir das menschliche Leben. So entsteht der entkoffeinierte Mensch: ohne Makel geboren und ohne Siechtum wieder verschwunden. Er bleibt natürlich Mensch, aber sozusagen ohne Nebenwirkungen für die Gesellschaft. Ich habe ausführlicher aus der Botschft zitiert, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die argumentative Rutschpartie des Bundesrates nachzuschlittern. Die Äusserungen entfernen sich immer weiter vom ursprünglichen Zweck, dem Kindeswohl: Es geht weder um das zukünftige Kind, noch – jedenfalls nicht ausschliesslich – um den Wunsch der Eltern nach einem Kind, dem das Schicksal erspart bleibt, das ihnen selbst beschieden ist. Vielmehr sollen solche Krankheits- oder Behinderungsfolgen des Kindes vermieden werden, die mit «vitale[n] Interessen» der Eltern «konkurrieren».17. Das – irrtümliche – aber starke Kriterium des Kindeswohls wird immer weiter ermässigt und endet bei einer Kompatiblitätsprüfung des Kindes mit den elterlichen Lebensentwürfen. Unter diesen Bedingungen hätte Tristram wohl keine Chance gehabt, das Licht der Welt zu erblicken. Wer will schon ein unglückliches Kind, erst recht eines, dessen Unglück schon mit der Zeugung besiegelt ist? Nun könnte an dieser Stelle auf die zweite These der Tristram’s Welt-Ethik verwiesen werden, nach der es einen Embryo, der nicht weiss (weil er niemals geboren wurde), auch nicht heiss macht, was seine Eltern überlegt und entschieden haben. Aber die Rechnung geht nicht auf, denn mit dem Verzicht auf ein Kind wegen Unzumutbarkeit ist das Unzumutbarkeitsproblem für Eltern nicht aus der Welt – im Gegenteil. 13 14 15 16 17 Bundesrat, Botschaft 2013, 5884. NEK, Präimplantationsdiagnostik II, a.a.O., 21. Bundesrat, Botschaft 2013, 5920. Slavoj Žižek, Liberal multiculturalism masks an old barbarism with a human face», in: The Guardian, 03.10.2010. Ebd. 6 Frank Mathwig, Tristram’s Welt 5. Das Kind unter Unzumutbarkeitsverdacht Die Begründung der PID mit der Unzumutbarkeit eines behinderten oder schwerkranken Kindes für die elterliche Lebenssituation suggeriert schlicht eine falsche heile Welt. Es handelt sich ja nicht um eine medizinische Unzumutbarkeit, sondern um eine soziale, die sich für die Familie ergibt – also etwa: erhöhter Betreuungsbedarf, gesellschaftliche Stigmatisierung, Einschränkung der elterlichen Berufspläne, finanzielle Belastungen, der zerstörte Traum vom erfolgreichen Kind, gekränkter Elternstolz, die Aussicht auf permanente Unterstützungsbedürftigkeit des Kindes, die Sorge, das Kind hätte in unserer Souveränitätsgesellschaft keine echten Chancen etc. Im Blick auf diese ‹Bürden› ist von der «Unzumutbarkeit» die Rede. Unterstellen wir einmal, das wäre so. Mein Bruder wurde gesund geboren. Im frühesten Kindesalter erlitt er eine Hirnhautentzündung. Seither ist er geistig und körperlich so schwer behindert, dass ungefähr alle eben genannten Unzumutbarkeits-Kriterien auf sein Leben zutreffen. Das passiert auch heute – und viel häufiger als die im Vordergrund stehenden PIDIndikationen. Was nun? Die Unzumutbarkeiten sind offensichtlich – aber das Kind ist längst geboren... Wenn das Unzumutbarkeits-Argument sticht, dann beschränkt es sich nicht auf eine vorgeburtliche Selektion, denn Unzumutbarkeiten gibt es nur für Geborene und die Wünsche von Eltern gegenüber ihrem Kind enden bekanntlich nicht mit der Geburt. Anders formuliert: Es spielt keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt die Eltern mit den Ursachen der Unzumutbarkeit konfrontiert werden. Wäre es da nicht nur konsequent, auch in Fällen, wie dem meines Bruders, die Eltern vor den entstandenen Unzumutbarkeiten zu schützen? Das mag zynisch klingen. Tatsache ist, dass die Frage an Virulenz zunimmt in einem biopolitischen Klima, das Eltern mit immer differenzierten Selektionstechnologien ein gesundes Kind in Aussicht stellt. Tristram’s Antwort – sozusagen als Unglücksexperte ab ovo – auf diesen Heile-WeltFehlschluss wäre wohl die Wiederholung des Wunsches an seine Eltern: Sie hätten doch nachdenken sollen, was sie taten, als sie ihn zeugten. Damit wollte er gewiss nicht den elterlichen Sex mit familienprognostischen Gedankenspielen anreichern. Die Pointe seines Wunsches steckt in der Zeitdimension. Das Abwägen kann nicht beliebig ausgedehnt werden. Vor 250 Jahren waren für die meisten Paare die Würfel unmittelbar nach dem Liebesakt gefallen. Die moderne reproduktionstechnologische Abkopplung von Sex und Fortpflanzung erlaubt es dagegen, die Entscheidung – durch Konservierungstechniken, Samen-, Eizellenspenden und Leihmutterschaft – prinzipiell zeitlich unbegrenzt in der Schwebe zu halten. Technologisch verfügen wir damit über eine Entscheidungsoffenheit in die Zukunft, die unsere Lebensrealitäten weit hinter sich lässt. Die moralische Kollision zwischen der Unzumutbarkeit eines ungeborenen und geborenen Menschen ist nur ein Symptom für die systematische Abkopplung von Schwangerschaft, Mutterschaft und Elternschaft. In Tristram’s Welt gibt es keine Schwelle, die das Unglück vor der Geburt von demjenigen nach der Geburt trennt. Deshalb gibt es auch keine ethische Schwelle, die die lockereren moralischen Daumenschrauben nach der Geburt fester anzieht. Die tiefere Einsicht aus Tristram’s Welt liegt darin, dass sich die Massstäbe, die PID- und PND-Entscheidungen zugrunde lagen, nach der Geburt des Kindes nicht in Luft auflösen. Die elterlichen Massstäbe galten ja zu jedem Zeitpunkt dem gleichen Zweck: ihrem Kind. Sie haften sozusagen an dem Kind, weil seine Existenz das präzise Ergebnis jener massstabskonformen Entscheidungen der Eltern dar7 Frank Mathwig, Tristram’s Welt stellt. Zugespitzt: Das Kind ist nicht nur – im günstigen Fall – massstabsgetreu geboren worden, ihm wird damit – zumindest implizit – auch die permanente Verpflichtung zur Massstabstreue auferlegt. Dem gegenüber steht die Bürde der elterlichen Wahl in dem bleibenden Wissen, selbst gewählt zu haben. 6. Kritik der Natalitätscorrectness Tristram Shandy hat – wie Sie bemerkt haben – eine verblüffende Begabung, unsere Denkgewohnheiten gegen den Strich zu bürsten. Er reibt uns immer wieder zwei zweifelhafte Haltungen unter die Nase: Einerseits unsere – durch nichts als unser Geborensein begründete – Arroganz gegenüber den Ungeborenen und andererseits die Last der Zuständigkeitsanmassungen, die wir nur aushalten, indem wir sie notorisch ausblenden. Die Arroganz ist pikanter Weise eine moralische und besteht darin, alles unserer persönlichen Freiheit und Verantwortung unterwerfen zu wollen. Dieses Markenzeichen liberaler Gesellschaften ist allerdings nicht frei von Widersprüchen. Anja Karnein hat auf einen solchen Widerspruch hingewiesen, den ich stellvertretend erwähne, weil er perfekt zu den politischen Entscheiden in dieser Woche passt: «Die Ironie besteht darin, dass Liberale klassischerweise danach verlangen, von Einmischungen durch ihre Mitmenschen oder Regierungen frei zu sein, insbesondere dann, wenn es um ihre Intimsphäre geht. Doch auf einmal, mit dem Auftauchen der neuen reprogenetischen Technologien, treten viele von ihnen dafür ein, dass gegenwärtig lebende Personen das Recht besitzen, ausgesprochen invasive Eingriffe in die Genome zukünftiger Personen vorzunehmen.»18 Aus aktuellem Anlass wäre hinzuzufügen: Die liberale Gesinnung traut der Pluralität der Ungeborenen nicht über den Weg und sichert sich deshalb die Autorität der eigenen Vorstellungen über die zukünftigen Generationen rechtlich ab. Die Arroganz besteht darin, dass sich die Geborenen Eingriffe gegenüber der Generation der noch nicht Geborenen erlauben, die sie gegenüber Ihresgleichen strikt zurückweisen. In Tristram’s Welt wäre es völlig unverständlich, «weshalb es uns, falls wir es als falsch ansehen, Personen der willkürlichen Herrschaft ihrer Zeitgenossen auszusetzen, gestattet sein sollte, zukünftige Personen der willkürlichen Herrschaft ihrer Vorfahren zu unterwerfen».19 Tristram Shandy hätte wohl völlig selbstverständlich die Achtung seiner Unabhängigkeit als zukünftig Geborener gegenüber den schon Geborenen eingefordert. Mindestens ebenso schwer wiegt die Bürde dieser ganz neuen intergenerativen Verantwortung. Ihr Gewicht zeigt sich erst vor dem Hintergrund jener anderen Einsicht, die nun zur Disposition steht: die Einsicht vom «Diktat der Geburt»20 oder mit den Worten Hannah Arendts dem «Faktum der Natalität».21 Es ist die Geburtlichkeit, «kraft derer jeder Mensch einmal als ein einzigartig Neues in der Welt erschienen ist. Wegen dieser Einzigartigkeit, die mit der Tatsache der Geburt gegeben ist, ist es, als würde in jedem Menschen noch einmal der Schöpfungsakt Gottes wiederholt und bestätigt». Dadurch ist der einzelne Mensch nicht nur «aller Absehbarkeit und Berechenbarkeit» entzogen. Vielmehr hat jeder Mensch damit auch Anteil an der Generativität der gesamten Menschheit, wie die Philosophin mit dem 18 19 20 21 Karnein, Zukünftige Personen, a.a.O., 211. Ebd. Ludger Lütkehaus, Natalität. Philosophie der Geburt, Kusterdingen 2006, 66. Zum Folgenden Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1981, 167. 8 Frank Mathwig, Tristram’s Welt Hinweis auf die Schöpfung betont. Aus der Tristram Shandy Perspektive gilt es, die Tatsachen anzuerkennen, «dass die Menschen ohne ihre Einwilligung, wenngleich nicht gegen ihren Willen geboren werden: Jede Geburt ist eine unerbetene, wann auch nicht verbetene Gabe.» 22 Das Faktum der Geburtlichkeit ist jeder Wahl entzogen. Hier liegt die Stärke von Tristram’s Welt gegenüber der unsrigen: Weil seine Welt keine Asymmetrien zwischen Geborenen und Ungeboren zulässt, folgt aus der Erfahrung, dass jedem Menschen die Wahl seiner eigenen Existenz entzogen war, die Einsicht, dass jedem Menschen auch die Wahl der Existenz eines anderen Menschen entzogen bleiben muss. In diesem Sinne ist jedes Leben leibhaftige Gabe, deren Pointe darin besteht, dass sie uns von einer Verantwortung befreit, die als Verursacherprinzip auftritt. Die Philosophin Christina Schües hat ein solches Gegenszenario entworfen: «Der Wissenschaftler ist rechenschaftspflichtig für das ‹wohlgeratene menschliche Leben› so wie jedes Warenprodukt auch einer Qualitätskontrolle unterliegt. Ein so gemachter Mensch kann sich glücklich schätzen, dass er die Qualitätsprüfung seines Materials überlebt hat. Galt für den Menschen die Nichtverhandelbarkeit seines Status als Geborener, so hat der ‹künstliche› Mensch ein ‹Leben auf Probe› hinter sich, das dem medizinischen Blick genügt hat. Aus diesem Szenario folgt, dass die Kinder Anspruchsrechte gegenüber ihren Eltern oder Ärzten geltend machen können und die Eltern ihre Pflichten nicht mehr als Gabe für ihre auf-dieWelt-gebrachten Kinder betrachten dürfen, sondern Verantwortungspflichten bezüglich des Materials, das sich als ‹menschliches Leben› entwickelt, haben. Im Zweifelsfalle sollen sie ‹verantwortungsvoll› im Sinne des Ungeborenen für den Abort entscheiden.»23 Und selbst dann sind die Risiken der Elternschaft – wie das Beispiel meines Bruders zeigt – nicht gebannt. Wer Eltern wird, muss mit allem rechnen – das ist seit Menschen Gedenken die einzige Strategie, für den in jedem Augenblick geforderten, tatsächlich blinden Mut zur Elternschaft. Auch ohne klischeehafte Idealisierungen ist elterliche Liebe durch bedingungslose Erwartungsoffenheit gegenüber dem eigenen Kind ausgezeichnet. Bedingungslosigkeit und Offenheit prägen nicht nur die Einzigartigkeit der Eltern-Kind-Bindung, sie geben ihr auch ihre Unerschütterlichkeit und Stärke. Ist Elternschaft nicht eine Zumutung, grenzenlose Risikobereitschaft, ein Einlassen ohne Wenn und Aber? Und sind diese Haltungen – so negativ sie aus einer Risikooptik erscheinen – nicht elterliche Begabungen, die alle anderen Empathiegefühle zu denen Menschen sonst noch fähig sind, in den Schatten stellen? Was wird aus dieser Eindeutigkeit, wenn das Eltern-Kind-Verhältnis bereits mit einem nur noch bedingten ‹Ja› zum Kind beginnt? Unter welchen Vorbehalten steht die weitere Beziehungsgeschichte? Wie können die späteren Enttäuschungen und Krisen bewältigt werden, wenn keine Ausstiegsszenarien zur Verfügung stehen? Ist der Gedanke wirklich so abwegig, dass sich ein Kind in dem Wissen, das Ergebnis einer elterlichen Wahl zu sein, fragt, was aus ihm geworden wäre, hätten sich die Eltern damals anders entschieden oder gravierender noch die Frage, ob die Eltern auch in den Beziehungskonflikten nach wie vor zu ihrer früheren Entscheidung stehen? Es gehört zum familiären Alltag, dass Eltern an ihren Kindern und Kinder an ihren Eltern zweifeln. Aber die Selbstverständlichkeit ihrer Zusammengehörigkeit 22 23 Lütkehaus, Natalität, a.a.O., 67f. Christina Schües, Philosophie des Geborenseins, Freiburg/Br., München 2008, 478f. 9 Frank Mathwig, Tristram’s Welt ist über jeden Zweifel erhaben. Wird aus dieser Natalitätsbindung eine Wahlverwandtschaft, ändern sich die Voraussetzungen. Dann schützt nichts mehr vor den bohrenden Fragen der Eltern, ob sie damals tatsächlich richtig entschieden haben oder des Kindes, ob die Eltern ihre Entscheidung nicht längst bereuen. Weil die Eltern-Kind-Beziehung auf Entscheidungen gründet, in denen der elterliche Willen zum Ausdruck kommt, muss sie im Zweifel durch Begründungen gestützt werden. Natalitätsbindungen sind dagegen fatalistisch in dem Sinne, dass sie gegenüber Begründungen und Willensbestätigungen immun bleiben und ganz auf die wechselseitige Liebe und Achtung angewiesen sind. Bezeichnenderweise fehlen diese Aspekte von Elternschaft in den gegenwärtigen Debatten vollständig. Stattdessen wird mit Verweis auf individuelle Selbstbestimmungsrechte einer Natalitätscorrectness Vorschub geleistet, deren Freiheitsdialektik sich allein darin zeigt, dass sie spontane Vielfalt durch medizinische Normierung ersetzt. Dabei wird übersehen: Im Zentrum der Liberalität steht die von Immanuel Kant bis Rosa Luxemburg geprägte Einsicht, dass Freiheit nur unter der Bedingung der Anerkennung der Freiheit der Andersdenkenden zu haben ist. Heute muss dieser Grundsatz erweitert werden: Freiheit gibt es nur im Angesicht der Freiheit derjenigen, die anders sein werden, als wir sie gerne hätten. _____ Prof. Dr. Frank Mathwig Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund [email protected] 10 Frank Mathwig, Tristram’s Welt