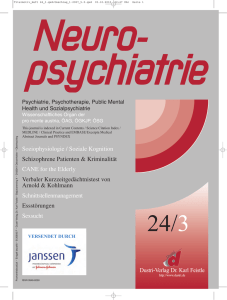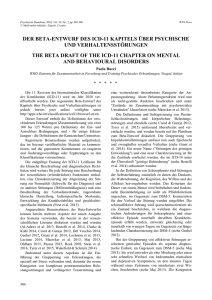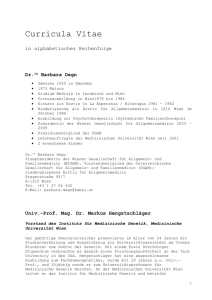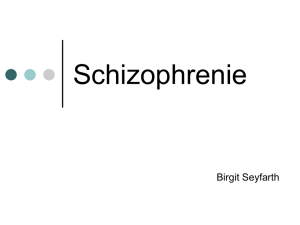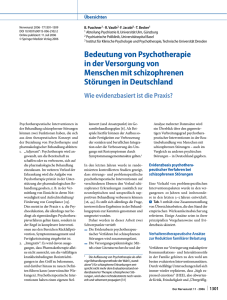Band 24 Ausgabe 3 / 2010
Werbung

Titelmotiv_Heft 24_3.qxd:Umschlag_1-2007_5.0.qxd 03.10.2010 22:47 Uhr Seite 1 Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – B 20695 F – Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle – Bajuwarenring 4 – D-82041 Deisenhofen – Oberhaching Wissenschaftliches Organ der pro mente austria, ÖAG, ÖGKJP, ÖSG This journal is indexed in Current Contents / Science Citation Index / MEDLINE / Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Soziophysiologie / Soziale Kognition Schizophrene Patienten & Kriminalität CANE for the Elderly Verbaler Kurzzeitgedächtnistest von Arnold & Kohlmann Schnittstellenmanagement Essstörungen Sexsucht VERSENDET DURCH ISSN 0948-6259 24/3 Band 24 Nummer 3 – 2010 Übersicht Volume 24 Number 3 – 2010 Schizophysiologie: Grundlegende Prozesse der Emphathiefähigkeit H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler 151 Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen A. Hofer, F. Biedermann, N. Yalcin, W. W. Fleischhacker 161 Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge der Psychiatriereform? H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda 170 Review Soziophysiology: basic processes of empathy H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Neurocognition and social cognition in patients with schizophrenia or mood disorders A. Hofer, F. Biedermann, N. Yalcin, W. W. Fleischhacker Increasing criminality in patients with schizophrenia: fiction, logical consequence or avoidable side effect of the mental health reforms? H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda Zeitungsgründer 3 10 Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Originalarbeit Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels Camberwell Assessment of Need (CANE) for the Elderly G. Kaiser, A. Unger, B. Marquart, M. Weiss, M. Freidl, J. Wancata Der verbale Kurzzeitgedächtnistest von Arnold & Kohlmann – ein zu Unrecht in Vergessenheit geratenes Diagnostikum in der Psychiatrie? K. Stürz, M. Kopp, A. Moser, V. ­Günther Kurze Originalarbeit Zum Schnittstellenmanagment zwischen einem psychiatrischen Krankenhaus und einem gemeindepsychiatrischem Dienst St. Frühwald, A. Karner, M.-E. Seyringer, T. Skribe, P. Frottier, A. Entenfellner Original 182 190 195 The German language version of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) among dementia patients G. Kaiser, A. Unger, B. Marquart, M. Weiss, M. Freidl, J. Wancata The psychometric value of the Verbal Short-Term Memory Scale by Arnold & Kohlmann in psychiatry K. Stürz, M. Kopp, A. Moser, V. ­Günther Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Short Original Quality assurance of take-over from in-patient to out-patient care: experiences in Lower Austria St. Frühwald, A. Karner, M.-E. Seyringer, T. Skribe, P. Frottier, A. Entenfellner Dustri-Verlag Dr. Dustri-Verlag Dr. Karl Karl Feistle Feistle http://www.durstri.de http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 0948-6259 ISSN I Kritisches Essay Sind Essstörungen Suchterkrankungen? J. F. Kinzl, W. Biebl „Sexsucht“: Chimäre oder klinisches Syndrom? Plädoyer für eine klinische Konzeptualisierung R. Wölfle In Memoriam Chefarzt Prof. Dr. Stephan Rudas G. Psota Univ.-Prof. Dr. Hans Georg Zapotoczky H. Hinterhuber 200 209 Critical Essay Are eating disorders addictions? J. F. Kinzl, W. Biebl Sexual addiction: chimera or clinical syndrom? A plea for a clinical conceptualization R. Wölfle Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie 217 219 Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † 3 10 Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 II Zeitungsgründer Franz Gerstenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Herausgeber Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck (geschäftsführend) Johannes Wancata, Wien Wissenschaftlicher Beirat Hans Förstl, München Andreas Heinz, Berlin Wulf Rössler, Zürich Günter Klug, Graz Katharina Purtscher, Graz Reinhold Schmidt, Graz Werner Schöny, Linz Erweiterter wissenschaftlicher Beirat Josef Aldenhoff, Kiel Michaela Amering, Wien Jules Angst, Zürich Christian Bancher, Horn Ernst Berger, Wien Karl Dantendorfer, Wien Peter Falkai, Göttingen Max Friedrich, Wien Christian Haring, Hall i. T. Armand Hausmann, Innsbruck Wolfgang Gaebel, Düsseldorf Verena Günther, Innsbruck Reinhard Haller, Frastanz Ulrich Hegerl, Leipzig Isabella Heuser, Berlin Florian Holsboer, München Christian Humpel, Innsbruck Kurt Jellinger, Wien Hans Peter Kapfhammer, Graz Siegfried Kasper, Wien Heinz Katschnig, Wien Ilse Kryspin-Exner, Wien Wolfgang Maier, Bonn Karl Mann, Mannheim Josef Marksteiner, Rankweil Hans-Jürgen Möller, München Heidi Möller, Kassel Walter Pieringer, Graz Roger Psycha, Bruneck Anita Riecher-Rössler, Basel Peter Riederer, Würzburg Hans Rittmannsberger, Linz Wolfgang Rutz, Uppsala Hans-Joachim Salize, Mannheim Alois Saria, Innsbruck Norman Sartorius, Genf Heinrich Sauer, Jena Gerhard Schüssler, Innsbruck Josef Schwitzer, Brixen Ingrid Sibitz, Wien Christian Simhandl, Wien Gernot Sonneck, Wien Marianne Springer-Kremser, Wien Thomas Stompe, Wien Gabriela Stoppe, Basel Elisabeth M. Weiss, Graz Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ Redaktionsadresse Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-24284, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected] Lizenz für die österreichische Ausgabe VIP-Verlag Integrative Psychiatrie Innsbruck Anton-Rauch-Straße 8 c, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] www.vip-verlag.com – Tel. +43 (0) 664 / 38 19 488 • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Postfach 1351, © 2010 Jörg Feistle. D-82032 München-Deisenhofen, Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle. Tel. +49 (0) 89 61 38 61-0, Telefax +49 (0) 89 6 13 54 12 ISSN 0948-6259 Email: [email protected] Regulary indexed in Current Contents/Science Citation Index/MEDLINE/Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht das Ver­lagsrecht für alle Sprachen und Länder einschließlich des Rechts der photomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfäl­ tigung an den Verlag über. benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen wird vom Verlag keine Gewähr übernommen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Die Neuro­ psychiatrie erscheint vierteljährlich. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß sol­che Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be­trachten wären und daher von jedermann Bezugspreis jährlich € 84,–. Preis des Einzelheftes € 23,– zusätzlich € 6,– Versandgebühr, inkl. Mehrwertsteuer. Einbanddecken sind lieferbar. Bezug durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis 4 Wochen vor Jahresende erfolgt. Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 IV Hinweise für AutorInnen: Sämtliche Manuskripte unterliegen der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtung durch Schriftleitung und Reviewer. Allgemeines: Bitte die Texte unformatiert im Flattersatz (Ausnahme: Überschrift und Zwischenüberschriften, Hervorhebungen) und keine Trennungen verwenden! Manuskripte – verfasst im Word – sind am besten per Email an die Redaktion (Adresse ­siehe ­unten) zu übermitteln. Sie können auch elektronisch auf CD oder Diskette an die Redaktions­adresse ­gesandt werden. Die Zahl der Abbildungen und Tabellen sollte sich auf maximal 5 beschränken. Manuskriptgestaltung: • Länge der Arbeiten (bitte beachten): - Übersichtsarbeiten: bis ca. 50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Originalarbeiten: bis ca. 35.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Kasuistiken, Berichte, Editorials: bis ca. 12.000 Zeichen inkl. Leerzeichen • Titelseite: (erste Manuskriptseite) - Titel der Arbeit: - Namen der Autoren (vollständiger Vorname vorangestellt) - Klinik(en) oder Institution(en), an denen die Autoren tätig sind - Anschrift des federführenden Autors (inkl. Email-Adresse) • Zusammenfassung: (zweite Manuskriptseite) - Sollte 15 Schreibmaschinenzeilen nicht übersteigen - Gliederung nach: Anliegen; Methode; Ergebnisse; Schlussfolgerungen; - Schlüsselwörter (mindestens 3) gesondert angeben • Titel und Abstract in englischer Sprache (3. Manuskriptseite) - Kann ausführlicher als die deutsche Zusammenfassung sein - Gliederung nach: Objective; Methods; Results; Conclusions - Keywords: (mindestens 3) gesondert angeben • Text: (ab 4. Manuskriptseite) Für wissenschaftliche Texte Gliederung wenn möglich in Einleitung, Material und Methode, Ergebnisse, Diskussion, evtl. Schlussfolgerungen, evtl. Danksagung, evtl. Interessenskonflikt • Literaturverzeichnis: (mit eigener Manuskriptseite beginnen) - Literaturangaben sollen auf etwas 20 grundlegende Werke und Übersichtsarbeiten beschränkt werden. Das Literaturverzeichnis soll nach Autoren alphabetisch geordnet werden und fortlaufend mit arabischen Zahlen, die in [eckige Klammern] gestellt sind, nummeriert sein. - Im Text die Verweiszahlen in [eckiger Klammer] an der entsprechenden Stelle einfügen. Beispiele: Arbeiten, die in Zeitschriften erschienen sind: [1] Rittmannsberger H., Sonnleitner W., Kölbl J., Schöny W.: Plan und Wirklichkeit in der ­psychiatrischen Versorgung. Ergebnisse der Linzer Wohnplatzerhebung. Neuropsychiatr 15, 5-9 (2001). (Abkürzung Neuropsychiatr) Bücher: [2] Hinterhuber H., Fleischhacker W.: Lehrbuch der Psychiatrie. Thieme, Stuttgart 1997. Beiträge in Büchern: [3] Albers M.: Kosten und Nutzen der tagesklinischen Behandlung. In: Eikelmann B., Reker T., Albers M.: Die psychiatrische Tagesklinik. Thieme, Stuttgart 1999. • Abbildungen und Tabellen: (jeweils auf eigener Manuskriptseite - Jede Abbildung und jede Tabelle sollte mit einer kurzen Legende versehen sein. - Verwendete Abkürzungen und Zeichen sollten erklärt werden. - Die Platzierung von Abbildungen und Tabellen sollte im Text durch eine Anmerkung markiert werden („etwa hier Abbildung 1 einfügen“). - Abbildungen und Grafiken sollten als separate Dateien gespeichert werden und nicht in den Text eingebunden werden! - Folgende Dateiformate können verwendet werden: Für Farb-/Graustufenabbildungen: .tiff, .jpg, (Auflösung: 300 dpi); für Grafiken/Strichabbildungen (Auflösung: 800 dpi) Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Johannes Wancata, Wien Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Ethische Aspekte: Vergewissern Sie sich bitte, dass bei allen Untersuchungen, in die Patienten involviert sind, die Zustimmung der zuständigen Ethikkommission beachtet worden ist. Besteht ein Interessenskonflikt gemäß den Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors, muss dieser gesondert am Ende des Artikels ausgewiesen werden. Korrekturabzüge: Nach Anfertigung des Satzes erhält der verantwortliche Autor einen Fahnenabzug des Artikels elektronisch als pdf-Datei übermittelt. Die auf Druckfehler und sachliche Fehler durchgesehenen Korrekturfahnen sollten auf dem Postweg an die Verlagsadresse zurückgesandt werden. Manuskript-Einreichung: Ausserhalb von Österreich: Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] Innerhalb von Österreich: Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Wien, Währingergürtel 18-20, A-1090 Wien, Email: [email protected] Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 VI I Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 151–160 Soziophysiologie: Grundlegende Prozesse der Empathiefähigkeit Helene Haker, Jenny Schimansky und Wulf Rössler Forschungsbereich Klinische und Soziale Psychiatrie, Psychiatrische Universitäts­ klinik Zürich Schlüsselwörter: Autismus – Resonanz – Schizophrenie – Spiegelneuronensystem – Zweit-Personen-Perspektive Keywords: autism – resonance – schizophrenia – mirror neuron system – second person perspective Soziophysiologie: Grundlegende Prozes­se der Empathiefähigkeit Diese Übersicht beschreibt Prozesse, welche dem komplexen Phänomen der menschlichen Empathie zugrunde liegen. Automatische, reflexartige Prozesse wie physiologische Ansteckung und Handlungsspiegelung werden über das Spiegelneuronensystem vermittelt und stellen eine Grundlage für die Weiterverarbeitung sozialer Signale dar. Im sozialen Kontakt entsteht damit auf der körperlichen Ebene eine direkte Verbindung zweier Individuen. Diese Verbindung besteht auf der gleichzeitigen Aktivierung gemeinsamer motorischer Repräsentationen. Auf implizite Art werden die so geteilten Eindrücke durch individuelle Assoziationen im limbischen und vegetativen System zu einem affektiven Zustand. Die hier beschriebenen Prozesse werden Soziophysiologie genannt. Durch kontrolliert-reflektierende, selbst-referentielle, d.h. © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 auf die persönliche Innenwelt gerichtete (Weiter-)Verarbeitung solcher sozialen Signale, entstehen schliesslich explizite Repräsentationen des Bewusstseins von Anderen. Diese höhergradigen Prozesse nennen wir soziale Kognition. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse entsteht das Phänomen der menschlichen Empathiefähigkeit. Sociophysiology: basic processes of empathy The aim of this review is to describe sociophysiological and social cognitive processes that underlie the complex phenomenon of human empathy. Automatic reflexive processes such as physiological contagion and action mirroring are mediated by the mirror neuron system. They are a basis for further processing of social signals and a physiological link between two individuals. This link comprises simultaneous activation of shared motor representations. Shared representations lead implicitly via individual associations in the limbic and vegetative system to a shared affective state. These processes are called sociophysiology. Further controled-reflective, self-referential processesing of those social signals leads to explicit, conscious representations of others’ minds. Those higher-order processes are called social cognition. The interaction of physiological and cognitve social processes lets arise the phenomenon of human empathy. Abkürzungen MNS Mirror neuron system (Spiegelneuronensystem) ToM Theory of Mind 1. Einleitung Die menschliche Empathiefähigkeit ist ein komplexes Phänomen, welches im letzten Jahrzehnt Fokus der sozialen Neurowissenschaften geworden ist. Die Wahrnehmung und Verarbeitung sozialer Signale, die sogenannte soziale Kognition bildete die Ausgangslage der Erforschung der Empathiefähigkeit. Das Erkennen und Deuten von sozialen Stimuli wie Gesichtsausdrücken oder das Nachdenken über mentale Zustände Anderer (Theory of Mind) wurden Schwerpunkte sozialkognitiver Untersuchungen. Psychische Erkrankungen, die Veränderungen der sozialen Interaktion als Kernsymptom haben, so z.B. die Schizophrenie oder der Autismus, boten sich als Modelle an, diese Phänomene zu untersuchen [3, 34, 70]. Es zeigte sich, dass bei den beiden genannten Krankheiten sozialkognitive Beeinträchtigungen messbar sind. So ist die Fähigkeit, die Individualität menschlicher Gesichter oder derer emotionaler Ausdruck zu erkennen bei beiden Erkrankungen vermindert. Auch die Theory of Mind (ToM), die Fähigkeit, mentale Zustände von Anderen (z.B. deren Absichten) zu erkennen, ist bei beiden Erkrankungen eingeschränkt. Diese Defizite werden als (Mit-)Ursache für H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler die soziale Behinderung bei beiden Krankheitsbildern betrachtet. Die Auseinandersetzung mit mentalen Zuständen Anderer kann abstrakt, d.h. ohne direkten Kontakt zum Anderen erfolgen. Dies nennen wir die Dritt-Personen-Perspektive [14]. Die meisten sozial-kognitiven Paradigmen beruhen auf der SubjektObjekt-Sichtweise. Es handelt sich um die bewusste Auseinandersetzung mit sozialen Inhalten als Objekt, das sich in jemanden Hineindenken. Findet die Wahrnehmung und der Austausch sozialer Informationen im direkten Kontakt zweier Lebewesen statt, entsteht die sogenannte ZweitPersonen-Perspektive oder SubjektSubjekt-Perspektive [14, 61]. Die Zweit-Personen-Perspektive ermöglicht neben dem Austausch kognitiver Objektinformationen das Teilen von affektiven Zuständen, welche das Hineindenken um ein Hineinfühlen oder Mitfühlen ergänzen. Das Teilen von affektiven Zuständen beruht auf der gleichzeitigen Aktivierung physiologischer Regungen. Dieser Bereich sozialer Prozesse wird deshalb als Soziophysiologie bezeichnet. Das Zusammenwirken komplexer sozialkognitiver und soziophysiologischer Prozesse resultiert in der Fähigkeit zur Empathie. Es handelt sich dabei um ein wenig scharf umrissenes Konzept, welches die verschiedenen bekannten sozialen Prozesse vereint und zu einem ganzheitlichen sich in einen anderen Hineindenken und Hinein- und Mitfühlen führt [24, 26, 74]. In dieser Übersichtsarbeit möchten wir nach einer entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung die grundlegenden Unterschied der beiden Arten des Prozessierens des sich Hineindenkens (sozialkognitiv) und des sich Hineinfühlens (soziophysiologisch) erläutern und dann den Fokus auf die noch weniger erforschten, soziophysiologischen Prozesse der Zweit-Personen-Perspektive legen. In einem weiteren Teil beleuchten wir dann diese Phänomene aus einem klinischen Blickwinkel und zeigen Be- 152 sonderheiten empathischer Prozesse bei psychischen Störungen auf. 2. Entwicklungsgeschicht­ liche Betrachtung Aus evolutionärer Perspektive sind sozialkognitive Prozesse junge Phänomene [17]. Das Leben in grösseren, sozial komplexen Gruppen, wie es sich z.B. bei Primaten entwickelt hat, stellte neue evolutionäre Anforderungen an das Gehirn, soziale Interaktionen zu verarbeiten und für sich nutzbar zu machen [29]. Das Leben in Gruppen bietet viele Vorteile: Am offensichtlichsten ist die Minimierung des Risikos, selber zur Beute zu werden durch erhöhte Vigilanz mehrerer Individuen und Verteilung des Risikos auf mehrere Gruppenmitglieder. Ein weiterer Vorteil ist die Zunahme der Nahrungsmenge durch Kooperation beim Jagen und Sammeln. Auf der anderen Seite der Gleichung entsteht für das Individuum innerhalb der Gruppe ein Wettbewerb um die Ressourcen. Die Entwicklung, das Befinden und Bestreben eines Artgenossen zu verstehen, dient dem Mitglied einer sozialen Gruppe, die Vorteile des Gruppenlebens zu nutzen und die potentiellen Risiken zu minimieren. Die phylogenetisch späte Entwicklung der Verarbeitung sozialer Signale widerspiegelt sich in der menschlichen Ontogenese. Die empathischen Fähigkeiten sind erst im Erwachsenenalter voll ausgebildet. Die ersten Schritte eines Neugeborenen, Kontakt zu seiner sozialen Umwelt aufzunehmen ist der direkte Blickkontakt [31, 35, 64, 66]. Die Fähigkeit zur Imitation ermöglicht es einem Neugeborenen, die wahrgenommenen Gesichtsausdrücke mit den entsprechenden eigenen affektiven Zuständen zur Deckung zu bringen und als Gefühlsrepräsentationen abzuspeichern [65]. Dies erlaubt dem Kind eigenes Befinden und das Verhalten eines Gegenübers zu verstehen, eine wesent- liche Voraussetzung zur Entwicklung der Emotionsregulation [74]. Mit 18 Monaten entwickelt sich schrittweise eine triadische Repräsentation (Kind, Gegenüber und Objekt) und die Selbsterkennung im Spiegel [10, 77, 78]. In verschiedenen Schritten erlernt das Kind bis zum Alter von 4-5 Jahren die Fähigkeit, in Grundzügen über geistige Vorgänge einer anderen Person nachzudenken, deren Intentionen und Bedürfnisse zu verstehen und sich gedanklich in die Situation dieser Person zu versetzen (Theory of Mind) [1, 34]. Damit beginnt ein Kind zwischen seinem eigenen Wissen, seinen eigenen Annahmen und Absichten und denjenigen Anderer zu differenzieren [3, 23, 39]. Mit 67 Jahren entwickeln sich sogenannte zweitgradige Repräsentationen (das Wissen, dass ein Anderer weiss, dass ein Dritter weiss), was wiederum die Grundlage bildet, zwischen Witz, Lüge und Ironie unterscheiden zu können. Die Fähigkeit einen Fauxpas zu erkennen, also ob jemand in ein ‚Fettnäpfchen‘ getreten ist, reift erst ab dem Alter von 9-11 Jahren, da es die gleichzeitige Repräsentation zweier fremder mentaler Zustände erfordert, und zwar den mentalen Zustand der Person, die den Fauxpas begeht und der „geschädigten“ Person [1, 35]. Das feine Zusammenspiel dieser Prozesse reift in wechselnden sozialen Umgebungen über die Pubertät hinaus, und ist in einer ständigen Entwicklung bis ins hohe Alter begriffen. Im Alter zeigt sich bei den empathischen Prozessen wie bei den meisten neurodegenerativen Prozessen zuerst ein Abbau der höher entwickelten, komplexeren Funktionen: In einer eigenen Untersuchung konnten wir zeigen, dass bei älteren Menschen die sozialkognitiven Funktionen Einschränkungen zeigen können, noch bevor die ontogenetisch ältere Prozesse der Empathie wie Ansteckung durch Gähnen oder Lachen Anderer (s.u.) beeinträchtigt sind [45]. Soziophysiologie: Grundlegende Prozesse der Empathiefähigkeit 3. Zwei Kernprozesse der Verarbeitung sozialer Sig­ nale Die beiden grundlegenden Verarbeitungsmodi sozialer Information, Hineindenken (sozialkognitiv) und Hineinfühlen (soziophysiologisch) werden im Gehirn in zwei anatomisch trennbaren Netzwerken auf unterschiedliche Weise prozessiert [56, 91]. Das Hineinfühlen erfolgt auf eine schnelle, reflexartige, automatische Weise, das Hineindenken auf eine langsamere, reflektierende, kontrollierte Weise [62, 84]. Wir beschreiben die beiden Modi sozialer Verarbeitung anhand der Dualität von automatisch-reflexartigen vs. kontrolliert-reflektierenden Prozessen entsprechend der Übersicht von Satpute & Lieberman [84], s. Tabelle 1. vante Stimuli sind physische, sichtbare Merkmale und Bewegungen anderer Lebewesen. Aktivität in diesem System wurde unter anderem beim Erkennen von Gesichtern oder der Identifikation biologischer Bewegungen nachgewiesen [12, 13]. Aber auch komplexere automatische Prozesse wie die intuitive Zuschreibung von Eigenschaften (Stigmatisierung) wird in diesem Netzwerk verarbeitet [57]. Einen Teil der Areale dieses Netzwerks bezeichnet man als Spiegelneuronensystem („mirror neuron system“, MNS, s. Abschnitt 4). 3.2. Kontrolliert-reflektierende Prozesse Das evolutionär jüngere System der kontrolliert-reflektierenden Prozesse umfasst den lateralen und medialen automatisch, reflexartig kontrolliert, reflektierend phylogenetisch alt phylogenetisch jung schnell langsam parallel seriell z.T. unbewusst bewusst nonverbal verbal spontan intendiert erlebt als „von aussen gegeben“ erlebt als „selbst generiert“ Repräsentation symmetrischer Beziehungen: Subjekt – Subjekt Repräsentation asymmetrischer Beziehungen: Subjekt – Objekt Tabelle 1: Duale Prozess-Struktur: Vergleich der Prozessarten 3.1. Automatische, reflexarti­ge Prozesse Das evolutionär ältere System automatischer, reflexartiger Prozesse umfasst ein fronto-parietales Netzwerk einschliesslich Bereiche des temporalen Kortex und der Basalganglien mit Efferenzen über die Insel ins limbische System zur Amygdala und über das anteriore Cingulum zum Hypothalamus ins vegetative System [62]. Dieses System verarbeitet die Stimuli schnell, automatisch, reflexartig und unbewusst. Es ist die Grundlage soziophysiologischer Prozesse. Rele- präfrontalen Kortex, den posterioren parietalen Kortex, sowie das rostrale und Teile des anterioren Cingulums [91]. Die von diesem System bearbeiteten Prozesse verlaufen kontrolliert, langsam und intentional, und fokussieren auf mentale Aspekte des Selbst und Anderer. Es ist die Grundlage sozial-kognitiver Prozesse [92]. Bisher konnte Aktivitäten in diesem System beim Beobachten sozialer Interak­ tionen [52, 54] bei ToM-Prozessen [12, 34], bei der Bewertung eigener Annahmen und Meinungen und bei selbst-referenziellen z.B. autobiogra- 153 phischen Gedächtnisprozessen [54] nachgewiesen werden. 4. Soziophysiologie 4.1. Das Spiegelneuronensys­ tem Anfang der 1990er Jahre wurden bei Einzelzellableitungen im prämotorischen Kortex (Areal F5) bei Makaken Zellen registriert, die über ihre Projektion in primär motorische Areale der eigenen Bewegungsinitiierung dienten, die aber auch bei der blossen Beobachtung der gleichen Bewegung eines Artgenossen Aktivität zeigten [28, 40, 41, 76]. Diese Zellen spiegeln nicht nur die Handlungsplanung eines Artgenossen (daher die Bezeichnung als Spiegelneurone), sondern sie dienen auch der Koppelung des sensorischen (hauptsächlich visuellen) Reizes mit dem dazugehörigen motorischen Mustern. In der englischen Terminologie werden für dieses Phänomen die Begriffe „observation-execution“- oder „perception-action“-Mechanismus verwendet [74], das Spiegelneuronensystem wird „mirror neuron system“ genannt, kurz: MNS. Spiegelneurone stellen auf einer körperlichen Ebene eine Verbindung zwischen eigenen motorischen Repräsentationen und solchen eines Gegenübers her, sogenannte „shared representations“. Es wird zwischen strikt kongruenten und breit kongruenten Spiegelneuronen unterschieden. Erstere sind nur bei absoluter Übereinstimmung von beobachteter Bewegung und eigenem motorischem Muster aktiv; letztere, welche den weitaus grösseren Teil ausmachen, werden auch aktiviert, wenn die beobachtete Bewegung nicht vollkommen kongruent zur eigenen Bewegungsplanung ist, oder nur ein Teil einer Bewegung beobachtet wird, diese jedoch das gleiche Ziel der geplanten Handlung hat [50]. So dient der Mechanismus der Wahrnehmungs-Bewegungs-Spiegelung im direkten Kontakt mit einer Zweit- H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler person über die simple BewegungsWahrnehmung hinaus der intuitiven Antizipation der Handlung eines Anderen und damit dem intuitiven Verstehen der Handlung oder sogar dem Verstehen der Handlungs-Absicht eines Gegenübers. Begünstigt wird das Einordnen einer Bewegung in ein Handlungskonzept und damit das Deuten der Absicht durch die Überschneidung des beobachteten mit eigenem motorischem Repertoire [15, 72, 89]. Dieses kann durch Übung differenziert und damit die Spiegelneuronenaktivität moduliert werden [20, 32]. Eine grosse Anzahl von Studien hat gezeigt, dass auch Menschen über ein MNS verfügen [75]. Dieses Netz umspannt – hauptsächlich durch visuelle Afferenzen, d.h. okzipital gespeist – den mittleren temporalen Gyrus und superioren temporalen Sulcus (Gesichtererkennung und Detektion biologischer Bewegungen) den inferiorem frontalen Gyrus (senso-motorische Koppelung) und den inferioren parietalen Lobulus (Unterscheidung zwischen eigen- und fremd-initiierter motorischer Aktivität sowie Erkennung des Ziels der Handlung) [21, 58, 73]. 4.2. Mimetische Prozesse: Mi­ mikry und Emulation Die durch das MNS vermittelten Prozesse des Nachahmens – sogenannte mimetische Prozesse – führen zu einer Abstimmung des Verhaltens zwischen Beobachter und Gegenüber. Dieser Weg dient nicht nur dem intuitiven Verstehen sondern auch dem sozial vermittelten Lernen. Die im Folgenden beschriebene Reihe mimetischer Prozesse, Mimikry, Imitation und Emulation sind kontinuierliche Prozesse zunehmender Komplexität, die evolutionär auseinander hervorgingen [50, 94]. Die Verarbeitung visueller sozialer Signale durch das MNS kann mittels eines zwei-Weg-Modells beschrieben werden: Die Aktivität sekundär-visueller Areale im mittleren Temporallappen (mittlerer temporaler Gyrus 154 und superiorer temporaler Sulcus) kann ohne weitere Prozessierung über das prämotorische Zentrum des MNS (inferiorer frontaler Gyrus) eine motorische Antwort generieren. Dieses automatische, reflexartige motorische Imitationsprodukt wird Mimikry genannt. Am anderen Ende des Spektrums mimetischen Verhaltens steht die Emulation, bei welcher ein Individuum zuerst im inferioren Parietallappen ein teleologisches Verständnis einer Handlung gewinnt, d.h. deren Ziel erkennt, um dieses Ziel unabhängig vom beobachteten Weg, mit eigenen Mitteln auf bewusste Weise nachzuahmen [53]. Auch im Kontinuum mimetischer Prozesse entdecken wir wieder die Polarität der automatisch-reflexartigen vs. kontrolliert-reflektierenden Prozesse. Der Begriff Mimikry oder Nachahmung stammt aus dem Tierreich. In diesem Kontext bezeichnet man damit die äusserliche Anpassung eines Tieres an seine nicht-soziale Umwelt, dass es vom Feind nicht mehr erkannt und seine Überlebenschance erhöht wird. In der Sozialpsychologie wird mit diesem Begriff das automatische und unbewusste Nachahmen von bedeutungslosen kinematischen Mustern oder Gesten bezeichnet. Chartrand und Bargh prägten für dieses Phänomen den Begriff des Chamäleon-Effekts [22]. Wir kennen diesen Effekt aus dem Alltag, wenn wir in einem Gespräch unbewusst die Sitzposition des Gegenübers einnehmen, seine Haltungsänderungen übernehmen und seinen Tonfall annehmen oder einzelne Worte mitsprechen. Im Gegensatz zur relativ unspezifischen Anpassung an die Umgebungsbedingungen beim eben beschriebenen Effekt des Mimikry, dient bei der Ansteckung ein spezifischer Reiz eines Individuums als konkreter Stimulus für eine identische, mehr oder weniger stereotype Reaktion seines Gegenübers. Ansteckung durch Lachen oder Gähnen sind alltägliche Beispiele für dieses Phänomen [60]. Bereits Scheflen [85] hatte auf die Bedeutsamkeit von übereinstim- menden Körperpositionen innerhalb einer sozialen Situation hingewiesen als ein typisches Gruppenphänomen, welches einem Beobachter die Ähnlichkeit oder Übereinstimmung hinsichtlich Ansichten oder Rollen zwischen Teilnehmern aufzeigen kann. In den 1980er Jahren untersuchten eine Reihe von naturalistischen Studien die Folgen von Mimikry. Sie zeigten auf, dass kongruente Körperhaltungen und Gesten zwischen Individuen mit erhöhten Gefühlen von Nähe einhergingen [6] Chartrand & Bargh führten 1999 eine der ersten experimentellen Studien zu Mimikry durch. Ihre Ergebnisse machten deutlich, dass Mimikry auch unter einander unbekannten Individuen auftritt, ohne den Individuen bewusst zu werden, und dass die Art des nachzuahmenden Verhaltens keine Rolle spielt. Auf diesem Weg erhöhen sich die sozialen Bande bei der gemeinsamen Aktivierung kinematischer Muster (z. B. Tanzen), ohne ein eigentliches Ziel zu haben. Individuen mit hoher selbsteingeschätzter Empathie zeigen mehr Mimikry als andere. Und Individuen, die viel Mimikry zeigen, werden vom Gegenüber als angenehmer und sympathischer und die Konversation als reibungsloser eingeschätzt [22, 59, 88, 93]. Die Imitation ist die bewusste Nachahmung einer Handlung. Es handelt sich dabei um einen sozialen Lernprozess, in dem ein Individuum ein Teil des ihm zuvor unbekannten Verhaltensrepertoires eines Gegenübers nachmacht und dadurch erlernt [16, 18, 65, 66]. Diese Funktion ist nur bei wenigen, hoch entwickelten Tierarten zu beobachten. Die zu imitierenden Handlungen sind auf einem Kontinuum angesiedelt und reichen von sehr einfachem Verhalten bis hin zu hochkomplexen Verhaltenssequenzen. Als Emulation bezeichnet man die auf ein gleiches Ziel gerichtete Nachahmung eines Verhaltens, wobei die Art der Erreichung des Ziels mit der beim Modell beobachteten Vorgehensweise nicht identisch sein muss (beispielsweise Greifen von Essen mit Soziophysiologie: Grundlegende Prozesse der Empathiefähigkeit der Hand oder mit einem Werkzeug) [19, 90]. Im Gegensatz zur Mimikry, welches über eine direkte Verbindung von visuellem Stimulus und entsprechendem motorischen Muster zustande kommt, benötigt die Emulation das Erkennen des intendierten Ziels, was dessen vorbestehende Repräsentation erfordert, und plant darauf eine neue Handlung zu dessen Erreichung [46]. Die Koppelung zwischen Erkennen und Handeln erfolgt bei der Mimikry auf kinematischer Ebene (passendes motorisches Muster), bei der Emulation auf der Ebene des Verständnisses des durch die beobachtete Handlung intendierten Ziels. Entsprechend der oben genannten Dualität von ProzessArten, entspricht die Mimikry einem automatischen, reflexartigen Prozess, die Emulation einem kontrollierten, reflektierenden Prozess innerhalb der soziophysiologischen Prozesse. Von klinischer Signifikanz ist die Unterscheidung dieser beiden Pole mimetischer Prozesse beim Autismus. Autistische Kinder zeigen Defizite bei spontaner sozialer Mimikry, also beim unspezifischen Übernehmen kinematischer Muster. Es gibt jedoch Hinweise dafür, dass sie bei der intellektuell gesteuerten Form der Nachahmung, der Emulation, durchaus soziale Nachahmung zeigen. Wie immer, wenn defizitäre automatische Prozesse durch kontrollierte ersetzt werden, mögen diese der Zielerreichung dienen, gehen jedoch üblicherweise mit erhöhtem Energie- und Zeitaufwand einher [46]. 5. Emphatie Das Phänomen, sich in ein Gegenüber hineinversetzen zu können, seine affektiven Zustände mit zu erleben (Hineinfühlen) und seine subjektive Situation mit zu verstehen (Hinein- 155 denken), nennen wir in der Umgangssprache Empathie. Wie eingangs angedeutet, handelt es sich dabei um ein Produkt aus dem Einsatz verschiedener kognitiver und physiologischer Fähigkeiten [25, 86]. Verschiedene Forschungsansätze betrachten unterschiedliche empathische Fähigkeiten und gewichten diese unterschiedlich [11]. In einem möglichst umfassenden Modell möchten wir diese verschiedenen Funktionsbereiche in ihrem Zusammenhang aufzeigen. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen funktionellen Domänen, die zum Produkt Empathie beitragen: Soziophysiologische Prozesse, vermittelt durch das MNS, bilden einen sogenannten „bottom up“ Eingang für soziale Signale, welche den Affekt über das limbische und das vegetative System beeinflussen. Gleichzeitig können diese beiden Systeme auch von sozialkognitven Prozessen „top down“ moduliert werden. Die einzel- Abbildung 1: Die verschiedenen Komponenten der menschlichen Empathifähigkeit und ihre anatomischen Korrelate. H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler nen Komponenten der empathischen Reaktion können motorische, vegetative, emotionale, affektive (d.h. Kombination aus emotionaler und vegetativer Empathie) und kognitive Empathie genannt werden [1, 11]. Entsprechend unserem Fokus auf die soziophysiologischen Prozesse erläutern wir im Folgenden die soziophysiologischen empathischen Prozesse etwas mehr im Detail. 5.1. Motorische Empathie oder Resonanz Wie bereits oben erwähnt, dient der Mechanismus der automatischen Wahrnehmungs-Bewegungs-Spiegelung im MNS über die simple Bewegungs-Wahrnehmung hinaus der intuitiven Antizipation der Handlung eines Anderen und damit dem intuitiven Verstehen der Handlung oder sogar dem Verstehen der Handlungsabsicht eines Gegenübers [37]. Die Efferenzen des MNS über die Insel zum anterioren Cingulum und über den Hypothalamus ins vegetative System vermitteln als Assoziationen zu motorischen Mustern entsprechende körperliche Empfindungen, wie z.B. Schmerz [87], Ekel [95] oder Müdigkeit bei der Ansteckung durch Gähnen [60]. Efferenzen ins limbische System zur Amygdala und dem Gyrus parahippocampalis erlauben, durch eine Zweitperson aktivierte motorische Repräsentationen mit entsprechenden eigenen Erinnerungen und deren emotionalen Valenzen zu assoziieren. Mittels dieser Efferenzen ins limbische und vegetative System können neben den rein motorischen und handlungsbasierten Inhalten auch komplexere affektive Zustände gespiegelt, mit dem Gegenüber geteilt werden. Diesen motorischen Effekt, der sich auf vegetatives und emotionales Empfinden ausweitet, nennen wir motorische Empathie oder Resonanz [11, 27, 44]. Diese Fähigkeit affektive Zustände anderer Menschen zu spiegeln bildet eine Grundlage, Zustände andere Menschen nachvollziehen 156 und in ihrem Kontext verstehen zu ­können. So geht heute eine Theorie – die sogenannte Simulations-Theorie – da­von aus, dass die Resonanz eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von sozialkognitiven Funktionen wie z.B. der ToM ist. Diese Simulations-Theorie beschreibt die Entstehung sozialer Metarepräsentation über den Mechanismus der inneren Simulation mittels senso-motorischer Koppelung, wie sie im MNS entsteht [5, 38]. Die entgegengesetzte Theorie-Theorie geht davon aus, dass die soziale Metarepräsentation auf dem Boden eines genuinen theoretischen Verständnisses sozialer Situationen, einer Fähigkeit zur Metarepräsentation, also a priori „top down“, entsteht [2, 67]. Tatsache ist, dass im Alltag, sowohl direkter sozialer Kontakt mit der Möglichkeit den affektiven Ausdruck (z.B. Mimik) eines Gegenübers direkt wahrzunehmen („bottom up“) , als auch das reine Nachdenken („top down“) über eine Person in ihrer besonderen Situation zum Endprodukt der Empathie führen kann. Das heisst, dass sämtliche empathische Funktionen sowohl durch reine „bottom up“, als auch durch alleinige „top down“ Stimulation angeregt werden können. In der Regel ist es aber ein Zusammenspiel beider Verarbeitungsmodi, welche die im direkten Kontakt aktivierten Regungen in einen Kontext einordnen [67]. Wesentlicher Bestandteil einer funktionellen empathischen Reaktion ist die Fähigkeit, die durch Spiegelung aktivierten affektiven Zustände als fremd-generiert einzuordnen. Parietale Strukturen (u.a. der inferiore parietale Lobulus) sind für eine intakte SelbstFremd-Abgrenzung verantwortlich. Diese ermöglichen es uns, auch unangenehme Situationen Anderer empathisch miterleben und aushalten zu können. Eine unzureichende FremdZuordnung unangenehmer gespiegelter Affekte würde zu einer dysfunktionalen persönlichen Stressreaktion führen und den evolutionären Nutzen der Resonanz in Frage stellen. 6. Psychopathologie Die Erforschung sozialer Prozesse bei psychischen Erkrankungen, die mit verändertem sozialem Kontaktverhalten einhergehen, öffnet Einsichten in die sozialen Funktionsbereiche sowie in die Besonderheiten der genannten Erkrankungen. 6.1. Schizophrenie Mangelndes soziales Interesse mit entsprechendem Rückzug sowie Schwierigkeiten, mit Anderen in Kontakt zu kommen sind prominente Symptome von Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Diese der Negativsymptomatik zuzuordnenden Symptome werden durch Fehlinterpretationen sozialer Gegebenheiten in Form von (z.B. paranoidem) Wahn oder Schwächung der Ich-Grenze im Rahmen von Positivsymptomatik ergänzt [71]. Sozialkognitive Defizite sind in der Schizophrenie schon seit den 1990er Jahren bekannt und erforscht [33, 71]. Auf allen Ebenen sozialkognitiver Verarbeitung sind Einschränkungen zu finden: Auf der Ebene der Emotionserkennung, der TOM, der sozialen Kontextverarbeitung und der sozialen Attribution [7, 8, 30, 69, 80]. Eine Besonderheit schizophrener Erkrankungen ist das Phänomen einer subtil veränderten sozialen Rapports bereits in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung [9, 55]. Auch wenn ansonsten erst unspezifische Symptome vorliegen, kann diese feine Veränderung diagnostische Hinweise liefern. H.C. Rümke beschrieb dieses Phänomen 1943 als Präcoxgefühl: „ … Bei der kürzesten Untersuchung bemerkt der Arzt bereits, dass die Einfühlung fehlen lässt. Dabei geht es nicht nur um das Einfühlen des Affektes des Kranken, aber um das Nichtinkontakttretenkönnen mit seiner Persönlichkeit als Ganzes. Deutlich bemerkt man, dass dies durch etwas im Kranken geschieht. Der an Schizophrenie erkrankte Mensch ist aus der Gemeinschaft der Menschen geraten. Es Soziophysiologie: Grundlegende Prozesse der Empathiefähigkeit ist keine Störung im Gefühlsleben, die Störung betrifft etwas, was die Relation zwischen den Menschen bestimmt. Das Inkontakttreten der Menschen untereinander geschieht nicht als gewollte Tat, sondern nur instinktiv. Die Abschwächung dieses Instinktes, das der Verfasser Annäherungsinstinkt nennt, ist vielleicht das fundamentellste Symptom der Schizophrenie. Öfter ist das Präcoxgefühl schon erweckt worden, bevor man einige Worte mit dem Patienten gewechselt hat [81]. Bei Betrachtung mit blossem Auge zeigen sich bei Schizophreniekranken deutliche Defizite der empathischen Resonanz in Form von mangelnder Ansteckung durch Lachen und Gähnen [44] . Wir sehen diese verminderte Resonanz als Korrelat von Rümkes Präcoxgefühl. Mit sensitiveren Methoden, z. B. einem Elektromyogramm, können bei Schizophreniekranken Aktivierungen der mimischen Muskulatur während des Betrachtens emotional gefärbter Gesichtsausdrücke gemessen werden [82]. Dies spricht für eine intakte Reizaufnahme über das Spiegelneuronensystem bei reduzierter motorischer Reaktion. Diese Befunde passen zur subjektiven Einschätzung der eigenen Empathiefähigkeit von Schizophreniekranken. Diese beschreiben sich als weniger geübt in der kognitiven Perspektivübernahme aber genauso stark empathisch berührbar wie sich Gesunde einschätzen [44]. Die mangelnde Sichtbarkeit der empathischen Betroffenheit dürfte die emotionale Interaktion bremsen und so die soziale Isolation der Betroffenen verstärken. 6.2. Frühkindlicher Autismus und Asperger Syndrom Das vereinigende Merkmal von frühkindlichem Autismus und dem Asperger Syndrom sind entwicklungsbedingte Defizite in der sozialen Interaktion [3, 4]. Die meisten Formen von frühkindlichem Autismus gehen mit einer intellektuellen Minderbegabung einher und dürften Ausdruck einer mehr oder weniger breiten Entwicklungsstörung sein. Eine autistische Entwicklungsstörung geht immer mit einer Sprachentwicklungsstörung einher. Im Gegensatz dazu geht das Asperger Syndrom oft mit einer höheren intellektuellen Begabung und per definitionem mit einer normalen Sprachentwicklung einher [83]. So betrachten wir die Besonderheiten eines Asperger Syndroms eher als eine Art einseitige Begabung denn als Behinderung. Beiden Störungsbildern gemein ist eine Einschränkung kognitiver sozialer Fähigkeiten, insbesondere der ToM [3, 36]. Im Bereich der sozio-physiologischen Fähigkeiten zeigt sich bei autistischen Menschen Defizite bei Imitationsaufgaben [51, 79, 96]. Diesem Kontext entsteht die sogenannte „broken mirror“ Hypothese, welche ein dysfunktionales MNS postuliert. In wieweit Motivationsprobleme sowie das vermeiden der direkten Betrachtung sozialer Stimuli (z.B. Augen) diese Ergebnisse beeinflussen ist unklar. Beim Asperger Syndrom gibt es neuerdings Hinweise auf eine veränderte Prozessierung visueller Signale im MNS [47]. Diese sogenannte „unbroken mirror“ Hypothese beschreibt ein Defizit direkter, unreflektierter Imitation (Mimikry) bei intakter zielgerichteter Imitation (Emulation). D.h. Bewegungen oder Handlungen können bei klarem Ziel der Bewegung/Handlung imitiert werden, weniger gut jedoch, wenn es sich um eine sinn- oder ziellose Bewegung handelt. Demnach dürfte z. B. das rhythmische Mit-wippen zur Musik einem Menschen mit Asperger Syndrom schwer fallen, wohingegen das zielgerichtete Imitieren der Verwendung eines Werkzeugs mit weniger Schwierigkeiten verbunden sein sollte. Über diesen expliziten Weg der zielgerichteten Nachahmung, die Emulation können auch Menschen mit autistisch eingeschränkten sozialkognitiven Fähigkeiten soziale Prozesse zu verstehen lernen. Wie jede Art expliziter Reizverarbeitung sind auch diese Prozesse aufwändiger, langsamer und störungsanfälliger 157 und unterscheiden sich qualitativ von natürlicher automatisierter, impliziter sozialer Interaktion [84]. 6.3. Emotional-Instabile Stö­ rung und PTBS In einer eigenen Untersuchung erhoben wir die empathische Resonanz bei Patientinnen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline Typ. Die Resultate wiesen auf eine zu Extremen tendierende Resonanzfähigkeit bei intakten sozialkognitiven Funktionen hin. Jüngere Patientinnen mit kürzerer Krankheitsgeschichte zeigten verstärkte Resonanz, d.h. überschiessende Ansteckung [43]. Ältere Patientinnen mit längerer Krankheitsgeschichte zeigten eine verminderte Resonanz. Die Resonanzfähigkeit korreliert in dieser Patientengruppe positiv mit dem sozialen Funktionsniveau. Auch Patienten, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden zeigen eine verminderte Resonanzfähigkeit [68]. Wir nehmen an, dass chronischer Stress bei beiden Krankheitsbildern einen negativen Einfluss auf die Resonanzfähigkeit hat. 6.4. Psychopathie Der Begriff der Psychopathie, welcher der deutschsprachigen Psychiatriegeschichte entstammt, wird heutzutage in einem der amerikanischen Psychiatrie entstammenden Konzept gebraucht. Als psychopathisch werden in diesem Zusammenhang diejenigen Menschen mit antisozialer oder dissozialer Persönlichkeit bezeichnet, welche sich durch besondere Kaltherzigkeit auszeichnen [48, 63]. Das sprichwörtliche über Leichen Gehen beschreibt die fehlende Resonanzfähigkeit dieser Menschen. Mit der bereits oben erwähnten Methode, der Ansteckung durch Gähnen und durch Lachen, konnten wir bei einer Gruppe verurteilter Straftäter mit psychopathischen Wesenszüge (erfasst mit der Psychopathie Checkliste [49]) H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler praktisch keinerlei Resonanz erfassen [42]. Dieses Defizit stand in keinem Zusammenhang mit sozialkognitiven Defiziten. Dies passt gut zu den gelegentlich zu beobachtenden ausgeprägten manipulativen Fähigkeiten dieser Menschen, welche intakte sozialkognitive Funktionen voraussetzen. Wir nehmen an, dass eine primär verminderte MNS Aktivität Grundlage dieser Kaltherzigkeit ist. Das Ausführen grausamer Gewalttaten an Lebewesen ist bei intakter MNS Aktivität und empathischem Schmerzmitempfinden kaum vorzustellen. Wir unterscheiden diese scheinbar fehlende Hemmung, anderen Schmerzen zuzufügen von kontextbezogener veränderter Gewaltschwelle, wie sie z.B. in Krieg- oder Kampfsituationen durch kognitive „top down“ Kontrolle auch bei ansonsten normal empathiefähigen Menschen auftreten kann. 7. Zusammenfassung In dieser Übersicht haben wir Prozesse vorgestellt, welche dem komplexen Phänomen der menschlichen Empathie zugrunde liegen. Automatische, reflexartige Prozesse wie physiologische Ansteckung und Handlungsspiegelung werden über das Spiegelneuronensystem vermittelt und stellen eine Grundlage für die Weiterverarbeitung sozialer Signale dar. Im sozialen Kontakt entsteht also auf der körperlichen Ebene eine direkte Verbindung zweier Individuen. Diese Verbindung besteht auf der gleichzeitigen Aktivierung gemeinsamer motorischer Repräsentationen. Auf implizite Art werden die so geteilten Eindrücke durch individuelle Assoziationen im limbischen und vegetativen System zu einem affektiven Zustand. Die hier beschriebenen Prozesse fassen wir mit dem Begriff Soziophysiologie zusammen. Durch kontrolliert-reflektierende selbst-referentielle, d.h. auf die persönliche Innenwelt gerichtete (Weiter-)Verarbeitung solcher sozialen Signale, 158 entstehen schliesslich explizite Repräsentationen des Bewusstseins von Anderen [1, 12]. Diese höhergradigen Prozesse werden soziale Kognition genannt. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse entsteht das Phänomen der menschlichen Empathiefähigkeit. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf die neutrale Wertigkeit des Begriffs Empathie hinweisen. Er bezeichnet das ganzheitliche Wahrnehmen, Verstehen und Miterleben eines anderen Menschen. Dies kann sowohl positiv wie auch negativ genutzt werden. Wie das zuletzt beschriebene pathologische Beispiel der Psychopathie zeigt, kann das scharfsinnige sich in andere Hineinversetzen durchaus zu Ungunsten des Gegenübers, nämlich zu seiner Manipulation benutzt werden. Zudem handelt es sich bei den vorgestellten Prozessen um Fähigkeiten, die sofern in einem Menschen angelegt, nicht notwendigerweise auch im Alltag eingesetzt werden müssen. Auch ein noch so einfühlsamer und der Reflexion befähigter Mitmensch bedarf der Motivation, diese Fähigkeiten im sozialen Kontakt auch einzusetzen. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 8. Literatur [14] [1] [2] [3] [4] [5] Abu-Akel A.: A neurobiological mapping of theory of mind. Brain Res Rev 43, 2940 (2003). Apperly I.A.: Beyond Simulation-Theory and Theory-Theory: Why social cognitive neuroscience should use its own concepts to study "theory of mind". Cognition 107, 266-283 (2008). Baron-Cohen S.: Mindblindness: an essay on autism and theory of mind. MIT Press / Bradford Books, Cambridge, Massachusetts 1995. Baron-Cohen S., Jolliffe T., Mortimore C., Robertson M.: Another advanced test of theory of mind: evidence from very high functioning adults with autism or asperger syndrome. J Child Psychol Psychiatry 38, 813-822 (1997). Barresi J., Moore C.: Intentional relations and social understanding. Behavioral and Brain Sciences 19, 107-154 (1996). [15] [16] [17] [18] [19] Bavelas J.B., Black A., Chovil N., Lemery C.R., Mullet J.: Form and function in motor mimicry: Topographic evidence that the primary function is communication. Human Communication Research 14, 275-299 (1988). Bentall R., David A.S., Cutting J.: Cognitive biases and abnormal beliefs: towards a model of persecutory delusions. Cognitive biases and abnormal beliefs: towards a model of persecutory delusions. Lawrence Erlbaum Associates, Hove, UK 1994. Bentall R.P., Kaney S., Dewey M.E.: Paranoia and social reasoning: an attribution theory analysis. Br J Clin Psychol 30 ( Pt 1), 13-23 (1991). Bertrand M.C., Sutton H., Achim A.M., Malla A.K., Lepage M.: Social cognitive impairments in first episode psychosis. Schizophr Res (2007). Bischof-Kohler D.: [Self object and interpersonal emotions. Identification of own mirror image, empathy and prosocial behavior in the 2nd year of life]. [German]. Zeitschrift fur Psychologie Mit Zeitschrift fur Angewandte Psychologie. 202, 349-377 (1994). Blair R.J.R.: Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. Conscious Cogn 14, 698-718 (2005). Brune M., Brune-Cohrs U.: Theory of mind--evolution, ontogeny, brain mechanisms and psychopathology. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 30, 437-455 (2006). Brunet-Gouet E., Decety J.: Social brain dysfunctions in schizophrenia: A review of neuroimaging studies. Psychiatry Research: Neuroimaging 148, 75-92 (2006). Buber M.: Ich und Du. Reclam, Leipzig 1923. Buccino G., Lui F., Canessa N., Patteri I., Lagravinese G., Benuzzi F., Porro C.A., Rizzolatti G.: Neural Circuits Involved in the Recognition of Actions Performed by Nonconspecifics: An fMRI Study. The Journal of Cognitive Neuroscience 16, 114-126 (2004). Byrne R.W.: Social Cognition: Imitation, Imitation, Imitation. Current Biology 15, R498-R500 (2005). Byrne R.W., Bates L.A.: Sociality, Evolution and Cognition. Curr Biol 17, R714R723 (2007). Byrne R.W., Russon A.E.: Learning by imitation: A hierarchical approach. Behavioral and Brain Sciences 21, 667-684 (1998). Call J., Carpenter M., Tomasello M.: Copying results and copying actions in the process of social learning: chimpanzees (Pan troglodytes) and human child- Soziophysiologie: Grundlegende Prozesse der Empathiefähigkeit [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ren (Homo sapiens) Animal Cognition 8, 151-163 (2005). Calvo-Merino B., Glaser D.E., Grezes J., Passingham R.E., Haggard P.: Action Observation and Acquired Motor Skills: An fMRI Study with Expert Dancers. Cereb. Cortex 15, 1243-1249 (2005). Cattaneo L., Rizzolatti G.: The Mirror Neuron System. Archives of Neurology 66, 557-560 (2009). Chartrand T.L., Bargh J.A.: The chameleon effect: the perception-behavior link and social interaction. J Pers.Soc.Psychol. 76, 893-910 (1999). Corkum V., Moore C.: Origins of joint visual attention in infants British Journal of Developmental Psychology 34, 28-38 (1998). de Vignemont F., Singer T.: The empathic brain: how, when and why? Trends in Cognitive Sciences 10, 435-441 (2006). Decety J., Jackson P.L.: The functional architecture of human empathy. Behav Cogn Neurosci Rev 3, 71-100 (2004). Decety J., Jackson P.L.: A Social-Neuroscience Perspective on Empathy. Curr Dir Psychol Sci 15, 54-58 (2006). Decety J., Meyer M.: From emotion resonance to empathic understanding: a social developmental neuroscience account. Developmental Psychopathology 20, 1053-1080 (2008). di Pellegrino G., Fadiga L., Fogassi L., Gallese V., Rizzolatti G.: Understanding motor events: a neurophysiological study. Journal of Cognitive Neuroscience 10, 640-656 (1992). Dunbar R.I.: The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology 6 178190 (1998). Edwards J., Jackson H.J., Pattison P.E.: Emotion recognition via facial expression and affective prosody in schizophrenia: a methodological review. Clin.Psychol Rev. 22, 789-832 (2002). Ferrari P.F., Coude G., Gallese V., Fogassi L.: Having access to other minds through gaze: The role of ontogenetic and learning processes in gaze-following behavior of macaques. Social Neuroscience 3, 239 - 249 (2008). Ferrari P.F., Rozzi S., Fogassi L.: Mirror Neurons Responding to Observation of Actions Made with Tools in Monkey Ventral Premotor Cortex. Journal of Cognitive Neuroscience 17, 212-226 (2005). Frith C.D.: The cognitive neuropsychology of schizophrenia. Lawrence Erlbaum, Hove 1992. Frith C.D., Frith U.: Interacting minds-a biological basis. Science 286, 16921695 (1999). Frith U., Frith C.D.: Development and neurophysiology of mentalizing. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 358, 459473 (2003). [36] Frith U., Happé F.: Autism spectrum disorder. Current Biology 15, R786R790 (2005). [37] Gallese V.: Before and below 'theory of mind': embodied simulation and the neural correlates of social cognition. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 362, 659669 (2007). [38] Gopnik A.: Early theories of mind: what the theory theory can tell us about autism. In: Baron-Cohen, editor. Early theories of mind: what the theory theory can tell us about autism. Oxford University Press, Oxford 1999. [39] Gordon A.C.L., Olson D.R.: The Relation between Acquisition of a Theory of Mind and the Capacity to Hold in Mind. Journal of Experimental Child Psychology 68, 70-83 (1998). [40] Grafton S.T., Arbib M.A., Fadiga L., Rizzolatti G.: Localization of grasp representations in humans by positron emission tomography. 2. Observation compared with imagination. Exp.Brain Res. 112, 103-111 (1996). [41] Grafton S.T., Fagg A.H., Woods R.P., Arbib M.A.: Functional Anatomy of Pointing and Grasping in Humans. Cerebral Cortex 6, 226-237 (1996). [42] Hagenmuller F., Rossler W., Endrass J., Rossegger A., Haker H.: Empathy in Psychopathy: Impaired Resonance. Eingereicht. [43] Haker H., Hohl C., Rossler W.: Empathische Resonanz bei emotional instabiler Persönlichkeitsstörung. In Vorbereitung. [44] Haker H., Rössler W.: Empathy in schizophrenia: impaired resonance. European archives of psychiatry and clinical neuroscience 259, 352-361 (2009). [45] Haker H., Scherrer M., Rossler W.: Veränderungen der Empathiefähigkeit im höheren Lebensalter. In Vorbereitung. [46] Hamilton A.F.: Emulation and mimicry for social interaction: A theoretical approach to imitation in autism. Quarterly Journal of Experimental Psychology 61, 101-115 (2008). [47] Hamilton A.F., Brindley R.M., Frith U.: Imitation and action understanding in autistic spectrum disorders: how valid is the hypothesis of a deficit in the mirror neuron system? Neuropsychologia 45, 1859-1868 (2007). [48] Hare R.D., Hart S.D., Hartpur T.J.: Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. Journal of Abnormal Psychology 100, 391-398 (1991). [49] Hare R.D., Neumann C.S.: Structural models of psychopathy. Current Psychiatric Reports 7, 57-64 (2005). [50] Iacoboni M.: Imitation, Empathy, and Mirror Neurons. Annual Review of Psychology 60, 653-670 (2009). 159 [51] Iacoboni M., Dapretto M.: The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. Nat Rev Neurosci 7, 942-951 (2006). [52] Iacoboni M., Lieberman M.D., Knowlton B.J., Molnar-Szakacs I., Moritz M., Throop C.J., Fiske A.P.: Watching social interactions produces dorsomedial prefrontal and medial parietal BOLD fMRI signal increases compared to a resting baseline. NeuroImage 21, 1167-1173 (2004). [53] Iacoboni M., Woods R.P., Brass M., Bekkering H., Mazziotta J.C., Rizzolatti G.: Cortical mechanisms of human imitation. Science 286, 2526-2528 (1999). [54] Kelley W.M., Macrae C.N., Wyland C.L., Caglar S., Inati S., Heatherton T.F.: Finding the Self? An Event-Related fMRI Study. Journal of Cognitive Neuroscience 14, 785-794 (2002). [55] Kettle J.W., O'Brien-Simpson L., Allen N.B.: Impaired theory of mind in firstepisode schizophrenia: comparison with community, university and depressed controls. Schizophrenia Research 99, 96-102 (2008). [56] Keysers C., Gazzola V.: Integrating simulation and theory of mind: from self to social cognition. Trends in Cognitive Sciences 11, 194-196 (2007). [57] Knutson K.M., Mah L., Manly C.F., Grafman J.: Neural correlates of automatic beliefs about gender and race. Human Brain Mapping 28, 915-930 (2007). [58] Kokal I., Gazzola V., Keysers C.: Acting together in and beyond the mirror neuron system. NeuroImage 47, 2046-2056 (2009). [59] Lakin J.L., Chartrand T.L., Arkin R.M.: I am too just like you: nonconscious mimicry as an automatic behavioral response to social exclusion. Psychological Science 19, 816-822 (2008). [60] Lehmann H.E.: Yawning: a homeostatic reflex and its psychological significance. Bull Menninger Clin 43, 123-136 (1979). [61] Levinas E.: Humanismus des anderen Menschen. Felix Meiner, Hamburg 1989. [62] Lieberman M.D.: Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes. Annu Rev Psychol 58, 18.11 (2006). [63] Livesley W.J.: A framework for integrating dimensional and categorical classifications of personality disorder. Journal of Personality Disorder 21, 199-224 (2007). [64] Meltzoff A.N., Cicchetti D., Beiser M.: Foundations for developing a concept of self: the role of imitation in relating self to other and the value of social mirroring, social modeling, and self practice in infancy. Foundations for developing a concept of self: the role of imitation in relating self to other and the value of so- H. Haker, J. Schimansky, W. Rössler [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] cial mirroring, social modeling, and self practice in infancy. University of Chicago Press, Chicago 1990. Meltzoff A.N., Decety J.: What imitation tells us about social cognition: a rapprochement between developmental psychology and cognitive neuroscience. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 358, 491-500 (2003). Meltzoff A.N., Moore M.K.: Imitation of facial and manual gestures by human neonates. Science 198, 74-78 (1977). Mitchell J.P.: The false dichotomy between simulation and theory-theory: the argument's error. Trends in Cognitive Sciences 9, 363-364 (2005). Nietlisbach G., Rossler W., Maercker A., Haker H.: Are Empathic Abilities Impaired in Posttraumatic Stress Disorder? Psychological Reports, 106, 832-844 (2010). Penn D.L., Combs D.R., Ritchie M., Francis J., Cassisi J., Morris S., Townsend M.: Emotion recognition in schizophrenia: further investigation of generalized versus specific deficit models. Journal of Abnormal Psychology. 109, 512-516 (2000). Penn D.L., Corrigan P.W., Bentall R.P., Racenstein J.M., Newman L.: Social cognition in schizophrenia. Psychol Bull 121, 114-132 (1997). Penn D.L., Spaulding W., Reed D., Sullivan M., Mueser K.T., Hope D.A.: Cognition and social functioning in schizophrenia. Psychiatry. 60, 281-291 (1997). Perani D., Fazio F., Borghese N.A., Tettamanti M., Ferrari S., Decety J., Gilardi M.C.: Different brain correlates for watching real and virtual hand actions. Neuroimage. 14, 749-758 (2001). Perry A., Bentin S.: Mirror activity in the human brain while observing hand movements: A comparison between EEG desynchronization in the [mu]-range and previous fMRI results. Brain Research 1282, 126-132 (2009). Preston S.D., de Waal F.B.: Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behav Brain Sci 25, 1-20 (2002). Rizzolatti G., Craighero L.: The mirror neuron system. Annu Rev Neurosci 27, 169-192 (2004). Rizzolatti G., Fadiga L., Matelli M., Bettinardi V., Paulesu E., Perani D., Fazio F.: Localization of grasp representations in humans by PET: 1. Observation versus execution. Exp.Brain Res. 111, 246252 (1996). Rochat P.: Self-perception and action in infancy. Experimental Brain Research 123, 102-109 (1998). Rochat P., Striano T.: Perceived self in infancy. Infant Behavior and Development 23, 513-530 (2000). Rogers F.J., Pennington B.F.: A theoretical approach to the deficits in infantile 160 [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] autism. Developmental Psychopathology 3, 137-162 (1991). Rössler W., Lackus B.: Cognitive disorders in schizophrenics viewed from the attribution theory. Eur.Arch.Psychiatry Neurol.Sci. 235, 382-387 (1986). Rümke H.C.: Das Kernsyndrom der Schizophrenie und das "Praecox-Gefühl". Zentralblatt gesamte Neurologie und Psychiatrie 102, 168-169 (1941). Salem J.E., Kring A.M., Kerr S.L.: More evidence for generalized poor performance in facial emotion perception in schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology 105, 480-483 (1996). Sass H., Wittchen H.U., Zaudig M. (2003): Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen. . Göttingen: Hogrefe. Satpute A.B., Lieberman M.D.: Integrating automatic and controlled processes into neurocognitive models of social cognition. Brain Research 1079, 86-97 (2006). Scheflen A.E.: The significance of posture in communication systems. Psychiatry 27, 316-331 (1964). Singer T., Lamm C.: The Social Neuroscience of Empathy. Annals of the New York Academy of Sciences 1156, 81-96 (2009). Singer T., Seymour B., O'Doherty J., Kaube H., Dolan R.J., Frith C.D.: Empathy for Pain Involves the Affective but not Sensory Components of Pain. Science 303, 1157-1162 (2004). Sonnby-Borgström M.: Automatic mimicry reactions as related to differences in emotional empathy. Scandinavian journal of psychology 43, 433-443 (2002). Stevens J.A., Fonlupt P., Shiffrar M., Decety J.: New aspects of motion perception: selective neural encoding of apparent human movements. Neuroreport 11, 109-115 (2000). Tomasello M., Call J., Hare B.: Chimpanzees versus humans: it's not that simple. Trends in Cognitive Sciences 7, 239-240 (2003). Uddin L.Q., Iacoboni M., Lange C., Keenan J.P.: The self and social cognition: the role of cortical midline structures and mirror neurons. Trends Cogn Sci 11, 153-157 (2007). Uddin L.Q., Kaplan J.T., Molnar-Szakacs I., Zaidel E., Iacoboni M.: Self-face recognition activates a frontoparietal "mirror" network in the right hemisphere: an event-related fMRI study. Neuroimage 25, 926-935 (2005). Wallbott H.G.: Recognition of emotion from facial expression via imitation? Some indirect evidence for an old theory. British Journal of Social Psychology 30, 207-219 (1991). [94] Whiten A., McGuigan N., Marshall-Pescini S., Hopper L.M.: Emulation, imitation, over-imitation and the scope of culture for child and chimpanzee. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 364, 2417-2428 (2009). [95] Wicker B., Keysers C., Plailly J., Royet J.-P., Gallese V., Rizzolatti G.: Both of Us Disgusted in My Insula: The Common Neural Basis of Seeing and Feeling Disgust. Neuron 40, 655-664 (2003). [96] Williams J.H., Whiten A., Singh T.: A systematic review of action imitation in autistic spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders 34, 285-299 (2004). Dr. med. Helene Haker Psychiatrische Universitätsklinik Zürich [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 161–169 Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen Alex Hofer, Falko Biedermann, Nursen Yalcin und W. Wolfgang Fleischhacker Medizinische Universität Innsbruck, Department für Psychiatrie und Psychotherapie Univ.-Klinik für Biologische Psychiatrie, Innsbruck Schlüsselwörter: Neurokognition – soziale Kognition – schizophrene Störungen – affektive Störungen – Outcome Keywords: Neurocognition – social cognition – schizophrenia – mood disorders – outcome Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen Anliegen: Überblick über den aktuellen Kenntnisstand zu Neurokognition und sozialer Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen. Methode: Selektive Literaturübersicht zu krankheitsassoziierten Defiziten, Vorkommen und Auswirkungen. Ergebnisse: Defizite in den Bereichen Neurokognition und soziale Kognition sind bei Patienten mit schizophrenen Störungen stärker ausgeprägt als bei jenen mit affektiven Störungen. Für beide Krankheitsgruppen gilt, dass diese Defizite den subjektiven und funktionellen Outcome wesentlich beeinflussen. Schlussfolgerungen: Ein integrativer Behandlungsansatz sollte kognitive Defizite berücksichtigen, um eine umfassende psychische Stabilisierung zu fördern. © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Neurocognition and social cognition in patients with schizophrenia or mood disorders Objective: Overview on the current knowledge regarding neurocognition and social cognition in patients with schizophrenia or mood disorders. Methods: Selective literature research on deficits in neurocognition and social cognition intrinsic to schizophrenia and mood disorders, their occurrence and effects. Results: Deficits in neurocognition and social cognition are more pronounced in patients with schizoprenia than in those with mood disorders. However, regardless of diagnosis these impairments have significant negative impact on the patients’ subjective and functional outcome. Conclusions: It is important to consider cognitive deficits as an integral part of a treatment approach to achieve mental stabilization in patients with schizophrenia or mood disorders. Einleitung Neurokognitive und sozial-kognitive Dysfunktionen von Patienten mit schizophrenen bzw. affektiven Störungen sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses gerückt. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über diese Defizite und ihre Auswirkungen auf den Outcome dieser Patientengruppen. Methodik Die Literaturauswahl erfolgte mittels Medline-Recherche mit den Suchbegriffen „schizophrenia“, „major depression“ und „bipolar disorder“ in Kombination mit „neurocognition“ und „social cognition“ sowie durch Sichtung der weiterführenden Literaturhinweise. Ferner wurden nicht in Medline gelistete deutschsprachige Artikel und Buchbeiträge in die Auswertung einbezogen. Die zitierte Literatur stellt eine Auswahl der aus Sicht der Autoren im Hinblick auf wissenschaftliche und praktische Relevanz wichtigsten Artikel dar und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schizophrene Störungen und Neurokognition Neurokognitive Defizite stellen ein Kernsyndrom schizophrener Störungen dar und können je nach untersuchter kognitiver Funktion bei 60–80% der Patienten nachgewiesen werden [59]. Es gibt großen Konsens, dass verbales Gedächtnis, Exekutivfunktionen, Vigilanz, Wortflüssigkeit und motorische Fertigkeiten bei Patienten mit schizophrenen Störungen am stärksten beeinträchtigt sind [56], und es besteht ein enger Zusammenhang mit der Fähigkeit zum Erwerb psychosozialer Fertigkeiten, sozialem Problemlöseverhalten und Alltagsaktivitäten [53]. Beispielsweise bestehen Zusammenhänge zwischen A. Hofer, F. Biedermann, N. Yalcin, W. W. Fleischhacker Defiziten in den Bereichen Arbeitsgedächtnis und visuelles Gedächtnis und einer herabgesetzten Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt [67,73]. Weiters gilt der Grad der Arbeitsgedächtnis-Funktion als Prädiktor für die Dauer eines Angestelltenverhältnisses [50] und das allgemeine soziale Funktionsniveau [85]. Daneben werden auch Krankheitseinsicht [108] sowie Lebensqualität [6,100] dieser Patientengruppe mit neurokognitiven Fertigkeiten in Zusammenhang gebracht. Neurokognitive Dysfunktionen sind von Dauer und Phase der Erkrankung weitgehend unabhängig [58,119]. So können Defizite in den Bereichen Lernen und Gedächtnis bereits im Prodromalstadium nachgewiesen werden [116] und gehören bei Erstmanifestation zu den am schwersten beeinträchtigten kognitiven Funktionsbereichen [41,96], was die Notwendigkeit der Früherkennung und -intervention verdeutlicht [45]. Allerdings scheinen entsprechende Therapien während der Prodromalphase die Ausprägung der kognitiven Defizite bei Krankheitsausbruch lediglich in geringem Ausmaß zu beeinflussen [51]. Dem gegenüber sollen spezifische Trainingsprogramme durch eine signifikante Verbesserung von Exekutivfunktionen und Arbeitsgedächtnis die Arbeitsfähigkeit von Patienten mit schizophrenen Störungen positiv beeinflussen [13,14,44,54], wobei eine anhaltende Dauer bisher noch nicht nachgewiesen ist. Es gilt als gesichert, dass neurokognitive Defizite keinesfalls Konsequenzen der antipsychotischen Behandlung sind. Konventionelle Antipsychotika scheinen wenig therapeutische Wirkung auf die krankheitsimmanenten kognitiven Defizite zu haben: bisherige Studien weisen auf einen positiven Effekt im Hinblick auf die Aufmerksamkeitsfähigkeit hin, während motorische Fertigkeiten sowie Gedächtnisfunktionen negativ beeinflusst zu werden scheinen, was u. a. auf die häufige Notwendigkeit einer anticholinergen Zusatzmedikati- on zurückgeführt wurde. Demgegenüber haben Atypika wahrscheinlich günstigere Effekte auf die kognitiven Funktionen, wenngleich die relativ hohe Dosierung konventioneller Präparate in früheren Studien eventuell zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt haben mag und neuere Untersuchungen einen vergleichbaren Effekt von klassischen und neuen Substanzen beschreiben [66]. Entsprechende Ergebnisse erbrachte z.B. die EUFEST-Studie, in der Patienten mit schizophreniformer Erkrankung bzw. Erstmanifestation einer schizophrenen Störung untersucht wurden: die sechsmonatige Behandlung mit niedrig dosiertem Haloperidol, Amisulprid, Olanzapin, Quetiapin oder Ziprasidon führte zu vergleichbaren Verbesserungen der neurokognitiven Funktionen [34]. Auch die neueren Substanzen untereinander scheinen sich in Bezug auf den kognitionsfördernden Effekt nicht voneinander zu unterscheiden. So erbrachte die CATIE–Studie, in der chronisch kranke Patienten mit schizophrenen Störungen untersucht wurden, bezüglich der neurokognitiven Effekte von Olanzapin, Quetiapin, Risperidon und Ziprasidon nach einer Behandlungsdauer von zwei, sechs und 18 Monaten vergleichbare Ergebnisse [75]. Affektive Störungen und Neurokognition 35-70% der Patienten mit unipolarer Depression oder bipolaren affektiven Störungen (BD) leiden unter neuro­kognitiven Beeinträchtigungen [1,93], wobei unipolar depressiv Erkrankte geringere Beeinträchtigungen aufweisen als Patienten mit BD [20]. Die Bedeutung dieser Defizite liegt in ihrer Auswirkung auf das soziale und berufliche Funktionsniveau der Betroffenen [16,37,82,92]. Beeinträchtigungen von Lernen und Gedächtnis gehören neben Defiziten in der Informationsverarbeitung 162 [95,145] und den Exekutivfunktionen [95,98] zu den typischen Kennzeichen unipolarer Depressionen und betreffen sowohl das Arbeits- [134] als auch das Langzeitgedächtnis [28,95,120]. Es gibt Hinweise, dass ein später Erkrankungsbeginn mit besonders ausgeprägten Beeinträchtigungen der Informationsverarbeitung [28,120] und der Exekutivfunktionen [104] einhergeht, während ein früherer Erkrankungsbeginn [104] und wiederholte Krankheitsepisoden [46] möglicherweise mit besonders ausgeprägten episodischen Gedächtnisdefiziten assoziiert sind. Diese betreffen primär das Erlernen und den freien Abruf von neuem Material, während das Wiedererkennen sowie nondeklarative Gedächtnisinhalte erhalten bleiben [70]. Demgegenüber scheinen semantische Gedächtnisdefizite vom Alter bei Erkrankungsbeginn [28,120] sowie vom Schweregrad der Erkrankung [95] unabhängig zu sein. Bei BD sind kognitive Beeinträchtigungen bereits bei Erstmanifestation festzustellen [106]. Sie treten in allen Krankheitsphasen auf, also sowohl während der Krankheitsepisoden als auch in den Remissionsphasen [91]. Die Ausprägung dieser Defizite hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, wie z.B. mit dem Alter bei Erstmanifestation [130], der Anzahl der Krankheitsepisoden [43], der Krankheitsdauer sowie der Anzahl der Krankenhausaufenthalte und Suizidversuche [91]. Ähnlich wie bei Patienten mit unipolaren Depressionen finden sich bei depressiven bipolaren Patienten neben defizitären Exekutivfunktionen [91,138] Beeinträchtigungen im verbalen Gedächtnis [91], welche bei BD etwas stärker ausgeprägt sind [142,148]. Die Anzahl der depressiven Episoden korreliert mit Störungen des verbalen Lernens, des visuellen Gedächtnisses und des räumlichen Arbeitsgedächtnisses [121]. Vergleicht man die Gedächtnisleistungen von Patienten mit BD während manischer und depressiver Phasen, finden sich Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen bei manischen Patienten sowohl Beeinträchtigungen im episodischen als auch im Arbeitsgedächtnis, während depressive Patienten lediglich Defizite im episodischen Gedächtnis zeigen [140]. Andererseits scheinen das nonverbale Gedächtnis und die Wortflüssigkeit primär während depressiver Erkrankungsphasen beeinträchtigt zu sein [91]. Manische bipolare Patienten weisen in erster Linie Beeinträchtigungen von Daueraufmerksamkeit [30] und Exekutivfunktionen [105] auf, welche wiederum zu Defiziten im Erwerb und Behalten von verbalen und nonverbalen Informationen führen [91,140]. Im Vergleich zu depressiven BD Patienten sind manische BD Patienten sowohl in den Exekutivfunktionen als auch hinsichtlich verbaler Gedächtnisleistungen signifikant stärker beeinträchtigt [11,39]. Die Ausprägung dieser Defizite wiederum korreliert mit der Anzahl der manischen Episoden [121]. Sie sind nach Remission einer manischen Episode in stärkerem Umfang weiter nachweisbar als nach Remission einer (unipolaren oder bipolaren) depressiven Episode [55]. Ähnlich wie bei symptomatisch remittierten Patienten mit schizophrenen Störungen persistieren auch in der euthymen Phase von BD eine Reihe von kognitiven Defiziten [36,72,105,130], die sowohl die Lebensqualität [22] als auch das psychosoziale Funktionsniveau negativ beeinflussen [7,91,92,102]. Neben beeinträchtigten Frontalhirnfunktionen [16,117] finden sich während der euthymen Phase auch Gedächtnisdefizite. Diese betreffen das Arbeitsgedächtnis [8], das visuelle Gedächtnis [150] und das verbale episodische Gedächtnis [8,72,91,121], wobei sowohl das Lernen als auch das Wiedergeben und Wiedererkennen beeinträchtigt sind [90]. Andererseits erscheinen semantische Encodierungsstrategien während euthymer Erkrankungsphasen intakt [35]. Euthyme Patienten mit BD, die während der vorangegangenen affektiven Episode psychotische Symptome entwickelt hatten, weisen neben herabgesetzten Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionen [5] besondere Beeinträchtigungen des verbalen Lernens und Gedächtnisses auf [5,90]. Diese sind von der Polarität der zuletzt erlebten (manischen oder depressiven) Krankheitsepisode unabhängig [90,91]. Obwohl einige Psychopharmaka kognitive Beeinträchtigungen verursachen können, erscheinen diese Defizite durch eine medikamentöse Behandlung auch positiv beeinflussbar. Entsprechende Daten liegen vor für Lithium [103,131], Valproat [65,131], Lamotrigin [33,78], Monoaminooxidasehemmer [79,109], SSRI [107,143], SNRI [60], Risperidon [57,118] und Olanzapin [149]. Schizophrene Störungen und soziale Kognition Schwierigkeiten im Erkennen von Emotionen in Gesichtern oder Stimmen gelten als krankheitsimmanentes, im Krankheitsverlauf relativ stabiles Symptom einer schizophrenen Störung [2,68,81], können bei familiär belasteten, nicht erkrankten Individuen nachgewiesen werden [40] und sind durch die antipsychotische Behandlung lediglich in geringem Ausmaß zu beeinflussen [110]. Schon früh wurde gezeigt, dass schizophren erkrankte Patienten Emotionen langsamer als Nichterkrankte wahrnehmen [21]. Neuere Untersuchungen ergaben, dass Gesichter als solche zwar wie von Gesunden wahrgenommen werden, nicht aber die ausgedrückten Emotionen [89]. Dieses Defizit betrifft auch das Erkennen der verschiedenen Dimensionen einer Emotion (z.B. Steigerung von Ärger in Wut [42]), und zwar vor allem bei gewalttätigen Patienten mit schizophrenen Störungen [47,133]. Patienten mit schizophrenen Störungen sind sowohl im Decodieren als auch im Encodieren emotionaler 163 Gesichtsausdrücke beeinträchtigt, d.h. sie haben einerseits Schwierigkeiten im Erkennen emotionaler Gesichtsausdrücke und sind andererseits auch in ihrer Fähigkeit, bestimmte Emotionen im eigenen Gesicht auszudrücken, eingeschränkt [42]. Daneben besteht ein Zusammenhang zwischen Defiziten im Erkennen emotionaler Gesichtsausdrücke und der Ausprägung neurokognitiver Defizite [124]. Hinsichtlich eines eventuellen Zusammenhanges der genannten Defizite mit psychopathologischen Symptomen sind die in der Literatur beschriebenen Ergebnisse uneinheitlich. Während einige Studien keine entsprechende Korrelation nachweisen konnten, fanden andere einen Zusammenhang mit Negativsymptomen, wie Anergie [101], Alogie [80,124] oder gefühlsmäßigem Abstumpfen [61], wenngleich die Spezifität dieses Zusammenhanges unklar ist. Des Weiteren wird von einem Zusammenhang mit Positivsymptomen, wie bizarrem Verhalten [115,128], Halluzinationen und Denkstörungen [80] berichtet. Es gilt als relativ gesichert, dass eine Störung der Affektregulation und -verarbeitung unabhängig von Alter und Geschlecht ist [115,125,128], während Frauen mit schizophrenen Störungen hinsichtlich der Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, Männern mit der gleichen Diagnose möglicherweise überlegen sind [129,147]. Befunde hinsichtlich des Einflusses von Anzahl und Dauer der stationären Behandlungen sowie der Chronizität der Erkrankung sind kontrovers [2,3,42,114,125]. Verschiedenste Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Emotionserkennung und sozialer Kompetenz. Dies betrifft sowohl akut erkrankte als auch remittierte Patienten. Beispielsweise berichten Poole et al. [115] von einem Zusammenhang zwischen der Fähigkeit ambulant betreuter Patienten, Emotionen in Gesichtern oder Stimmen zu erkennen, und zwischenmenschlichen Beziehungsmustern, und andere Arbeitsgruppen fanden ei- A. Hofer, F. Biedermann, N. Yalcin, W. W. Fleischhacker nen Zusammenhang zwischen dieser Fähigkeit und Kommunikationsstil und Arbeitsfähigkeit [69]. Bei chronisch institutionalisierten Patienten zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Emotionen in Gesichtern zu erkennen, und sozialer Kompetenz, sozialen Interessen, und Hygiene [101,112]. Basierend auf diesen Befunden entwickelten Green et al. [53] ein Modell, wonach der Bereich der sozialen Kognition möglicherweise eine Mediatorrolle zwischen Neurokognition und sozialem Outcome darstellt. Diese Modellvorstellung wurde in neueren Untersuchungen bestätigt [4,97]. In Analogie zu einer rezenten Querschnittstudie [68] ergab eine von Kee et al. [74] durchgeführte prospektive Untersuchung von 94 ambulanten Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung einen auch im Längsschnitt nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, emotionale Inhalte in Gesichtern, Stimmen oder Videosequenzen zu erkennen, und Arbeitsfähigkeit bzw. der Fähigkeit, unabhängig zu leben, was auf einen relativ stabilen, möglicherweise kausalen Zusammenhang hinweist. Verschiedene Untersuchungen bestätigen, dass bei Patienten mit schizophrenen Störungen sozial-kognitive Prozesse nicht nur sekundär sondern selektiv, d.h. unabhängig von anderen kognitiven Funktionsstörungen, beeinträchtigt sein können [111], und dass die soziale Kompetenz der Patienten weit mehr mit Theory of Mind (ToM)-Fähigkeiten als mit Faktoren wie Intelligenz oder Exekutivfunktionen zusammenhängt [23]. Prinzipiell bezeichnet ToM die Fähigkeit eines Individuums, sich in andere hinein zu versetzen, um sich eine Vorstellung über deren Motive, Absichten, Gedanken, Gefühle oder Wissen machen zu können [136]. Die derzeitige Datenlage spricht insgesamt dafür, dass Störungen der ToM bei Patienten mit schizophrenen Störungen langzeitstabil sind, jedoch im Rahmen akuter Krankheitsphasen akzentuiert auftreten und möglicherweise auch im Verlauf der Erkrankung im Schweregrad zunehmen [19,26,137]. Aktuelle Untersuchungen bestätigen, dass Störungen der ToM einen deutlichen Prädiktor für eine herabgesetzte soziale Kompetenz darstellen [18,24,113]. Diese Beeinträchtigungen gehen dem Beginn der psychotischen Kernsymptomatik oft voraus und sind bei Erstmanifestation praktisch immer vorhanden. Prinzipiell führt die Behandlung mit Antipsychotika zu einer Reduktion von ToM-Defiziten [99], wobei Clozapin und Olanzapin hinsichtlich der diesbezüglichen Wirksamkeit den klassischen Substanzen und Risperidon möglicherweise überlegen sind [127]. Mehrere Studien belegen einen Zusammenhang zwischen dem Schweregrad von ToM-Defiziten und der im Vordergrund stehenden Symptomatik. Allgemein finden sich die größten Schwierigkeiten, sich in andere Personen hineinzuversetzen, bei Patienten mit vorherrschender Negativsymptomatik und bei jenen mit psychomotorischer Verarmung. Dem gegenüber schneiden Patienten mit Ich-Störungen oder akustischen Halluzinationen und remittierte Patienten bei ToM-Tests in der Regel besser ab [24]. In einer rezenten Studie wiederum korrelierte das Verständnis von Sarkasmus mit dem Grad der Positivnicht jedoch mit der Negativsymptomatik [76]. Interessanterweise fand sich in dieser Untersuchung kein Zusammenhang zwischen ToM-Defiziten und sozialem Funktionsniveau. Möglicherweise zeigen Männer mit schizophrenen Störungen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen, aber auch zu Frauen mit der gleichen Diagnose, eine herabgesetzte taktische Intelligenz [25], und dieses Defizit scheint bei vorherrschender Negativsymptomatik besonders stark ausgeprägt zu sein [94]. Daneben korrelieren ToM-Defizite mit auffälligem Sozialverhalten [24] und einem herabgesetzten sozialen Funktionsniveau [25], und Missverständnisse in der sozialen Kommunikation führen 164 bei gewalttätigen Patienten zu einer Erhöhung der Gewaltbereitschaft [133]. Affektive Störungen und soziale Kognition Depressive Patienten zeigen häufig ein allgemeines Defizit in der Wahrnehmung von Emotionen [146], wobei die krankheitsimmanente negative Grundemotion eine besondere Rolle zu spielen scheint [88]. Beispielsweise schreiben sich nach Sweeney et al. [139] depressive Patienten negative Ereignisse selbst zu und erklären in Anbetracht früher erlebter negativer Ereignisse ihre negativen Grundemotionen. Verschiedene Untersuchungen weisen auf einen Zusammenhang zwischen Grundemotion und Erkennen der entsprechenden Basisemotionen hin. Entsprechend haben depressive Patienten Schwierigkeiten im Erkennen fröhlicher Gesichtsausdrücke bei gleichzeitig erhaltener Fähigkeit, Angst, Trauer und Ekel zu erkennen [123,138]. Analog zu diesen Befunden bereitet manischen Patienten das Erkennen von fröhlichen Gesichtern keinerlei Schwierigkeiten, während das häufige Verwechseln von Angst und Überraschung als mögliche Ursache für unangebrachtes, distanzloses Verhalten interpretiert wird [84]. Untersuchungen von euthymen Patienten mit BD lieferten unterschiedliche Ergebnisse. Zwei Studien [2,84] fanden im Vergleich mit gesunden Kontrollprobanden hinsichtlich des Erkennens von emotionalen Gesichtsausdrücken keinen Unterschied. Roiser et al. [122] wiederum berichteten kürzlich, dass die Entscheidungsfindung und Aufmerksamkeitsleistung euthymer Patienten mit BD während der Durchführung emotionaler Testverfahren auch nach Induktion eines positiven Gefühlszustandes gegenüber einer gesunden Kontrollgruppe beeinträchtigt waren. Weites weisen Cuellar et al. [31] in einer rezenten Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen Studie auf eine bei remittierten bipolar affektiv Erkrankten erhöhte affektive Reaktivität auf Kritik hin und sehen darin einen möglichen Zusammenhang mit dem Outcome dieser Patientengruppe. Die verfügbaren Daten lassen erkennen, dass sowohl manische als auch depressive erwachsene Patienten ToM-Defizite aufweisen [17,77]. Remittierte Patienten waren in einer Studie von Kerr et al. [77] diesbezüglich mit gesunden Kontrollpersonen vergleichbar, während andere Arbeitsgruppen auch bei euthymen Patienten mit BD ausgeprägte ToMDefizite fanden [132], und zwar unabhängig von psychotischen Begleitphänomenen [83]. Vergleichsstudien: Neuro­ kognition Verglichen mit Patienten mit affektiven Störungen weisen schizophren Erkrankte stärker ausgeprägte, von der aktuellen Psychopathologie relativ unabhängige neurokognitive Defizite auf [9,27,126,144]. Beispielsweise fanden Hill et al. [64] bei Patienten mit Erstmanifestation einer schizophrenen Störung über einen Zeitraum von zwei Jahren konstante, auch nach klinischer Stabilisierung fortbestehende neurokognitive Beeinträchtigungen, während Untersuchungen von Patienten mit BD mit der klinischen Stabilisierung einhergehende Verbesserungen in den Bereichen nonverbales Gedächtnis, Exekutivfunktionen und Aufmerksamkeitsspanne zeigten [86,105], was sich wiederum auf den funktionellen Outcome der Patienten auswirkt [141]. Von Bedeutung ist allerdings, dass das neurokognitive Leistungsprofil von affektiv erkrankten Patienten durch eine gleichzeitig vorhandene psychotische Symptomatik nachdrücklich beeinflusst wird und sich qualitativ jenem von schizophren Erkrankten annähert [10,63]. Dementsprechend zeigen BD-Patienten mit psychotischen Symptomen stärker ausgeprägte Beeinträchtigungen von Exekutivfunktionen und räumlichem Arbeitsgedächtnis als nichtpsychotische Erkrankte mit BD [48]. Ähnliche Ergebnisse liegen auch für unipolar Depressive vor [52,62]. Insgesamt ist diese Aggravation von kognitiven Defiziten bei all jenen Patienten anzutreffen, die im Laufe ihres Lebens psychotische Symptome entwickeln, und zwar unabhängig von Diagnose und aktueller Krankheitssymptomatik [49], so dass diskutiert wird, dass psychotische Störungen möglicherweise ein Kontinuum und weniger kategoriell verschiedene Erkrankungen darstellen [71,135]. Verleichtsstudien: Soziale Kognition Verschiedene Arbeitsgruppen ver­ glichen Patienten mit schizophrenen Störungen bzw. BD und Gesunde hinsichtlich der Fähigkeit, Emotionen in Gesichtern zu erkennen [2,87]. An Schizophrenie Erkrankte zeigten in diesen Studien deutliche Schwierigkeiten im Erkennen von neutralen und glücklichen Gesichtern, während sich Patienten mit BD diesbezüglich nicht von den gesunden Kontrollpersonen unterschieden. Sowohl schizophren als auch affektiv erkrankte Menschen weisen prämorbid bereits im Jugendalter ein herabgesetztes soziales Funktionsniveau auf, allerdings manifestieren sich diese Anpassungsschwierigkeiten bei Patienten mit schizophrenen Störungen früher und sind mit mehr Einschränkungen verbunden als bei affektiv Erkrankten [29]. Nach Ausbruch der Erkrankung gibt es zwischen den beiden Gruppen kaum noch Unterschiede hinsichtlich sozialer Aktivitäten und der Häufigkeit sozialer Kontaktaufnahme [38], und sie zeigen ähnliche soziale Kompetenzdefizite [15,32]. Dem gegenüber ergaben neuere Studien, dass schizophren Erkrankte sowohl depressiven als auch manischen 165 Patienten hinsichtlich der Fähigkeit, die Absichten anderer Menschen zu erkennen, unterlegen sind [12]. Schlussfolgerungen Defizite in den Bereichen Neurokognition und soziale Kognition sind bei Patienten mit schizophrenen Störungen stärker ausgeprägt als bei jenen mit affektiven Störungen. Für beide Krankheitsgruppen gilt, dass diese Beeinträchtigungen für den Outcome der Betroffenen von wesentlicher Bedeutung sind. Die bisher verfügbaren pharmakologischen Maßnahmen beeinflussen diese Defizite lediglich marginal, so dass eine moderne neurorehabilitative Therapie neuro- und sozial-kognitive Remediationsprogramme erfordert, die im Wesentlichen auf die Förderung kognitiver Prozesse durch wiederholtes systematisches Üben oder den Aufbau von Kompensationsstrategien zielen. Ein entsprechend gestalteter integrativer Behandlungsansatz, der neurokognitive und sozial-kognitive Defizite berücksichtigt, könnte zu einer effizienteren Behandlung mit positiver Auswirkung auf den subjektiven und funktionellen Outcome führen. Interessenskonflikte Keine angegeben. Literatur [1] [2] [3] Abas MA, Sahakian BJ, Levy R. Neuropsychological deficits and CT scan changes in elderly depressives. Psychol Med 1990; 20: 507-520 Addington J, Addington D. Facial affect recognition and information processing in schizophrenia and bipolar disorder. Schizophr Res 1998; 32: 171-181 Addington J, Penn D, Woods SW et al. Facial affect recognition in individuals A. Hofer, F. Biedermann, N. Yalcin, W. W. Fleischhacker [4] [5] [6] [7] [8| [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] at clinical high risk for psychosis. Br J Psychiatry 2008; 192: 67-68 Addington J, Saeedi H, Addington D. Facial affect recognition: a mediator between cognitive and social functioning in psychosis? Schizophr Res 2006; 85: 142-150 Albus M, Hubmann W, Wahlheim C et al. Contrasts in neuropsychological test profile between patients with first-episode schizophrenia and first-episode affective disorders. Acta Psychiatr Scand 1996; 94: 87-93 Alptekin K, Akvardar Y, Kivircik Akdede BB et al. Is quality of life associated with cognitive impairment in schizophrenia? Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2005; 29: 239-244 Altshuler LL, Bearden CE, Green MF et al. A relationship between neurocognitive impairment and functional impairment in bipolar disorder: a pilot study. Psychiatry Res 2008; 157: 289293 Arts B, Jabben N, Krabbendam L, van Os J. Meta-analyses of cognitive functioning in euthymic bipolar patients and their first-degree relatives. Psychol Med 2008; 38: 771-785 Barrett SL, Mulholland CC, Cooper SJ, Rushe TM. Patterns of neuropsychological impairment in first-episode bipolar disorder and schizophrenia. Br J Psychiatry 2009; 195: 67-72 Barch DM. Neuropsychological abnormalities in schizophrenia and major mood disorders: similarities and differences. Curr Psychiatry Rep 2009; 11: 313-319 Basso MR, Lowery N, Neel J et al. Neuropsychological impairment among manic, depressed, and mixed-episode inpatients with bipolar disorder. Neuropsychology 2002; 16: 84-91 Bazin N, Brunet-Gouet E, Bourdet C et al. Quantitative assessment of attribution of intentions to others in schizophrenia using an ecological video-based task: a comparison with manic and depressed patients. Psychiatry Res 2009; 167: 28-35 Bell M, Tsang HW, Greig TC, Bryson GJ. Neurocognition, social cognition, perceived social discomfort, and vocational outcomes in schizophrenia. Schizophr Bull 2009; 35: 738-747 Bell MD, Zito W, Greig T, Wexler BE. Neurocognitive enhancement therapy with vocational services: work outcomes at two-year follow-up. Schizophr Res 2008; 105: 18-29 Bellack AS, Sayers M, Mueser KT, Bennett M. Evaluation of social problem solving in schizphrenia. J Abnorm Psychol 1994; 103: 371-378 Bonnín CM, Martínez-Arán A, Torrent C et al. Clinical and neurocognitive pre- [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26| [27] [28] [29] 30] dictors of functional outcome in bipolar euthymic patients: A long-term, followup study. J Affect Disord 2010; 121: 156-160 Bora E, Vahip S, Gonul AS et al. Evidence for theory of mind deficits in euthymic patients with bipolar disorder. Acta Psychiatr Scand 2005; 112: 110116 Bora E, Gökzen S, Veznedaroglu B. Empathic abilities in people with schizophrenia. Psychiatry Res 2008; 160: 23-29 Bora E, Yucel M, Pantelis C. Theory of mind impairment in schizophrenia: meta-analysis. Schizophr Res 2009; 109: 1-9 Borkowska A, Rybakowski JK. Neuropsychological frontal lobe tests indicate that bipolar depressed patients are more impaired than unipolar. Bipolar Disord 2001; 3: 88-94 Braff DL, Saccuzzo DP. Information processing dysfunction in paranoid schizophrenia: a two-factor deficit. Am J Psychiatry 1981; 138: 1051-1056 Brissos S, Dias VV, Kapczinski F. Cognitive performance and quality of life in bipolar disorder. Can J Psychiatry 2008; 53: 517-524 Brunet-Gouet E, Decety J. Social brain dysfunctions in schizophrenia: a review of neuroimaging studies. Psychiatry Res 2006; 148: 75-92 Brüne M,Abdel-Hamid M, Lehmkämper C, Sonntag C. Mental state attribution, neurocognitive functioning, and psychopathology: what predicts poor social competence in schizophrenia best? Schizophr Res 2007; 92: 151-159 Brüne M. “Theory of mind” in schizophrenia: a review of the literature. Schizophr Bull 2005; 31: 21-42 Brüne M, Juckel G. Social cognition in schizophrenia: mentalising and psychosocial functioning. Nervenarzt 2010;81:339-346 Burdick KE, Goldberg JF, Harrow M et al. Neurocognition as a stable endophenotype in bipolar disorders and schizophrenia. J Nerv Ment Dis 2006; 194: 255-260 Butters MA, Whyte EM, Nebes RD et al. The nature and determinants of neuropsychological functioning in late-life depression. Arch Gen Psychiatry 2004; 61: 587-595 Cannon M, Jones P, Gilvarry C et al. Premorbid social functioning in schizophrenia and bipolar disorder: similarities and differences. Am J Psychiatry 1997; 154: 1544-1550 Clark L, Iversen SD, Goodwin GM. Sustained attention deficit in bipolar disorder. Br J Psychiatry 2002; 180: 313-319 166 [31] Cuellar AK, Johnson SL, Ruggero CJ. Affective reactivity in response to criticism in remitted bipolar disorder: a laboratory analog of expressed emotion. J Clin Psychol 2009; 65: 925-941 [32] Cutting J, Murphy D. Impaired ability of schizophrenics, relative to manics or depressives, to appreciate social knowledge about their culture. Br J Psychiatry 1990; 157: 355-358 [33] Daban C, Martínez-Arán A, Torrent C et al. Cognitive functioning in bipolar patients receiving lamotrigine: preliminary results. J Clin Psychopharmacol 2006; 26: 178-181 [34] Davidson M, Galderisi S, Weiser M et al. Cognitive Effects of Antipsychotic Drugs in First-Episode Schizophrenia and Schizophreniform Disorder: A Randomized, Open-Label Clinical Trial (EUFEST). Am J Psychiatry 2009; 166: 675-682 [35] Deckersbach T, Savage CR, ReillyHarrington N et al. Episodic memory impairment in bipolar disorder and obsessive-compulsive disorder: the role of memory strategies. Bipolar Disord 2004; 6: 233-244 [36] Dias VV, Brissos S, Carita AI. Clinical and neurocognitive correlates of insight in patients with bipolar I disorder in remission. Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 28-34 [37] Dickerson FB, Boronow JJ, Stallings CR et al. Association between cognitive functioning and employment status of persons with bipolar disorder. Psychiatr Serv 2004; 55: 54-58 [38] Dickerson FB, Sommerville J, Origoni AE et al. Outpatients with schizophrenia and bipolar I disorder: Do they differ in their cognitive and social functioning? Psychiatry Res 2001; 102: 21-27 [39] Dixon T, Kravariti E, Frith C et al. Effect of symptoms on executive function in bipolar illness. Psychol Med 2004; 34: 811-821 [40] Eack SM, E Mermon D, Montrose DM et al. Social cognition deficits among individuals at famial high risk for schizophrenia. Schizophr Bull 2009; Apr 14 [Epub ahead of print] [41] Eastvold AD, Heaton RK, Cadenhead KS. Neurocognitive deficits in the (putative) prodrome and first episode of psychosis. Schizophr Res 2007; 93: 266-277 [42] Edwards J, Jackson HJ, Pattison PE. Emotion recognition via facial expression and affective prosody in schizophrenia: a methodological review. Clin Psychol Rev 2002; 22: 789-832 [43] Ferrier IN, Thompson JM. Cognitive impairment in bipolar affective disorder: implications for the bipolar diathesis. Br J Psychiatry 2002; 180: 293-295 Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen [44] Fisher M, Holland C, Subramaniam K, Vinogradov S. Neuroplasticity-Based Cognitive Training in schizophrenia: an interim report on the effects 6 months later. Schizophr Bull 2009; Mar 5 [Epub ahead of print] [45] Fitzgerald D, Lucas S, Redoblado MA et al. Cognitive functioning in young people with first episode psychosis: relationship to diagnosis and clinical characteristics. Aust N Z J Psychiatry 2004; 38: 501-510 [46] Fossati P, Harvey PO, Le Bastard G et al. Verbal memory performance of patients with a first depressive episode and patients with unipolar and bipolar recurrent depression. J Psychiatr Res 2004; 38: 137-144 [47] Fullam R, Dolan M. Emotional information processing in violent patients with schizophrenia: association with psychopathy and symptomatology. Psychiatry Res 2006; 141: 29-37 [48] Glahn DC, Bearden CE, Barguil M et al. The neurocognitive signature of psychotic bipolar disorder. Biol Psychiatry 2007; 62: 910-916 [49] Glahn DC, Bearden CE, Cakir S et al. Differential working memory impairment in bipolar disorder and schizophrenia: effects of lifetime history of psychosis. Bipolar Disord 2006; 8: 117123 [50] Gold JM, Goldberg RW, McNary SW et al. Cognitive correlates of job tenure among patients with severe mental illness. Am J Psychiatry 2002; 159: 13951402 [51] Goldberg TE, Burdick KE, McCormack J et al. Lack of an inverse relationship between duration of untreated psychosis and cognitive function in first episode schizophrenia. Schizophr Res 2009; 107: 262-266 [52] Gomez RG, Fleming SH, Keller J et al. The neuropsychological profile of psychotic major depression and its relation to cortisol. Biol Psychiatry 2006; 60: 472-478 [53] Green MF, Kern RS, Robertson MJ et al. Relevance of neurocognitive deficits for functional outcome in schizophrenia. In: Sharma T, Harvey P, Hrsg. Cognition in schizophrenia. New York: Oxford University Press Inc; 2000: 178-192 [54] Greig TC, Zito W, Wexler BE et al. Improved cognitive function in schizophrenia after one year of cognitive training and vocational services. Schizophr Res 2007; 96: 156-161 [55] Gruber S, Rathgeber K, Bräunig P, Gauggel S. Stability and course of neuropsychological deficits in manic and depressed bipolar patients compared to patients with Major Depression. J Affect Disord 2007; 104: 61-71 [56] Harvey PD, Green MF, Keefe RSF, Velligan DI. Cognitive functioning in schizophrenia: a consensus statement on its role in the definition and evaluation of effective treatments for the illness. J Clin Psychiatry 2004; 65: 361–372 [57] Harvey PD, Hassman H, Mao L et al. Cognitive functioning and acute sedative effects of risperidone and quetiapine in patients with stable bipolar I disorder: a randomized, double-blind, crossover study. J Clin Psychiatry 2007; 68: 1186-1194 [58] Hawkins KA, Keefe RS, Christensen BK et al. Neuropsychological course in the prodrome and first episode of psychosis: findings from the PRIME North America Double Blind Treatment Study. Schizophr Res 2008; 105: 1-9 RW, Zakzanis KK. [59] Heinrichs Neurocognitive deficits in schizophrenia: a quantitative review of the evidence. Neuropsychology 1998; 12: 426–445 [60] Hemmeter U, Brüderlin U, Hatzinger M et al. Short term and long term effects of venlafaxine and trimipramine on cognitive psychomotor performance in patients with major depression. Eur Neuropsychopharmacol 2000; 10 (Suppl 3): S243 [61] Henry JD, Green MJ, de Lucia A et al. Emotion dysregulation in schizophrenia: reduced amplification of emotional expression is associated with emotional blunting. Schizophr Res 2007; 95: 197204 [62] Hill SK, Keshavan MS, Thase ME, Sweeney JA. Neuropsychological dysfunction in antipsychotic-naïve firstepisode unipolar psychotic depression. Am J Psychiatry 2004; 161: 996-1003 [63] Hill SK, Reilly JL, Harris MS et al. A comparison of neuropsychological dysfunction in first-episode psychosis patients with unipolar depression, bipolar disorder, and schizophrenia. Schizophr Res 2009; 113: 167-175 [64] Hill SK, Schuepbach D, Herbener ES et al. Pretreatment and longitudinal studies of neuropsychological deficits in antipsychotic-naïve patients with schizophrenia. Schizophr Res 2004; 68: 4963 [65] Hirsch E, Schmitz B, Carreño M. Epilepsy, antiepileptic drugs (AEDs) and cognition. Acta Neurol Scand 2003; 180 (Suppl): 23-32 [66] Hofer A. Welche neuropsychologischen Funktionen können die neuen Antipsychotika verbessern helfen? Psychiatrie & Psychotherapie 2006; 2/4: 127-131 [67] Hofer A, Baumgartner S, Bodner T et al. Patients outcome in schizophrenia II: the impact of cognition. Eur Psychiatry 2005; 20: 395-402 167 [68] Hofer A, Benecke C, Edlinger M et al. Facial emotion recognition and its relationship to symptomatic, subjective, and functional outcomes in outpatients with chronic schizophrenia. Eur Psychiatry 2009; 24: 27-32 [69] Hooker C, Park S. Emotion processing and its relationships to social functioning in schizophrenia patients. Psychiatry Res 2002; 112: 41-50 [70] Ilsley JE, Moffoot APR, O’Carroll RE. An analysis of memory dysfunction in major depression. J Affect Disord 1995; 35: 1-9 [71] Jabben N, Arts B, Krabbendam L, van Os J. Investigating the association between neurocognition and psychosis in bipolar disorder: further evidence for the overlap with schizophrenia. Bipolar Disord 2009; 11: 166-177 [72] Jamrozinski K, Gruber O, Kemmer C et al. Neurocognitive functions in euthymic bipolar patients. Acta Psychiatr Scand 2009; 119: 365-374 [73] Kaneda Y, Jayathilak K, Meltzer HY. Determinants of work outcome in schizophrenia and schizoaffective disorder: role of cognitive function. Psychiatry Res 2009; 169: 178-179 [74] Kee KS, Green MF, Mitz J, Brekke JS. Is emotion processing a predictor of functional outcome in schizophrenia? Schizophr Bull 2003; 29: 487-497 [75] Keefe RS, Bilder RM, Davis SM et al. Neurocognitive effects of antipsychotic medications in patients with chronic schizophrenia in the CATIE Trial. Arch Gen Psychiatry 2007; 64: 633-647 [76] Kern RS, Green MF, Fiske AP et al. Theory of mind deficits for processing counterfactual information in persons with chronic schizophrenia. Psychol Med 2009; 39: 645-654 [77] Kerr N, Dunbar RI, Bentall RP. Theory of mind deficits in bipolar affective disorder. J Affect Disord 2003; 73: 253259 [78] Khan A, Ginsberg LD, Asnis GM et al. Effect of lamotrigine on cognitive complaints in patients with bipolar I disorder. J Clin Psychiatry 2004; 65: 14831490 [79] Knegtering H, Eijck M, Huijsman A. Effect of antidepressants on cognitive function of elderly patients. A review. Drugs Aging 1994; 5: 192-199 [80] Kohler CG, Bilker W, Hagendoorn M et al. Emotion recognition deficit in schizophrenia: association with symptomatology. Biol Psychiatry 2000; 48: 127-136 [81] Kohler CG, Martin EA. Emotional processing in schizophrenia. Cognit Neuropsychiatry 2006; 11: 250-271 [82] Laes JR, Sponheim SR. Does cognition predict community function only in schizophrenia?: a study of schizophre- A. Hofer, F. Biedermann, N. Yalcin, W. W. Fleischhacker [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] nia patients, bipolar affective disorder patients, and community control subjects. Schizophr Res 2006; 84: 121-131 Lahera G, Montes JM, Benito A et al. Theory of mind deficit in bipolar disorder: is it related to a previous historyof psychotic symptoms? Psychiatry Res 2008; 161: 309-317 Lembke A, Ketter TA. Impaired recognition of facial emotion in mania. Am J Psychiatry 2002; 159: 302-304 Liddle PF. Cognitive impairment in schizophrenia: its impact on social functioning. Acta Psychiatr Scand 2000; 400 (Suppl): 11-16 Liu SK, Chiu CH, Chang CJ et al. Deficits in sustained attention in schizophrenia and affective disorders: stable versus state-dependent markers. Am J Psychiatry 2002; 159: 975-982 Loughland CM, Williams LM, Gordon E. Schizophrenia and affective disorder show different visual canning behaviour for faces: a trait versus state-based distinction? Biol Psychiatry 2002; 52: 338-348 Mandal MK, Bhattacharya BB. Recognition of facial affect in depression. Percept Mot Skills 1985; 61: 13-14 Mandal MK, Palchoudhury S. Identifying the components of facial emotion and schizophrenia. Psychopathology 1989; 22: 295-300 Martinez-Aran A, Vieta E, Colom F et al. Cognitive impairment in euthymic bipolar patients: implications for clinical and functional outcome. Bipolar Disord 2004; 6: 224-232 Martinez-Aran A, Vieta E, Reinares M et al. Cognitive function across manic or hypomanic, depressed, and euthymic states in bipolar disorder. Am J Psychiatry 2004; 161: 262-270 Martinez-Aran A, Vieta E, Torrent C et al. Functional outcome in bipolar disorder: the role of clinical and cognitive factors. Bipolar Disord 2007; 9: 103113 Massman PJ, Delis DC, Butters N et al. The subcortical dysfunction hypothesis of memory deficits in depression: neuropsychological validation in a subgroup of patients. J Clin Exp Neuropsychol 1992; 14: 687-706 Mazza M, De Risio A, Tozzini C et al. Machiavellianism and Theory of Mind in people affected by schizophrenia. Brain Cogn 2003; 51: 262-269 McDermott LM, Ebmeier KP. A metaanalysis of depression severity and cognitive function. J Affect Disord 2009; 119: 1-8 Mesholam-Gately RI, Giuliano AJ, Goff KP et al. Neurocognition in firstepisode schizophrenia: a meta-analytic review. Neuropsychology 2009; 23: 315-336 [97] Meyer MB, Kurtz MM. Elementary neurocognitive function, facial affect recognition and social-skills in schizophrenia. Schizophr Res 2009; 110: 173179 [98] Micco JA, Henin A, Biederman J et al. Executive functioning in offspring at risk for depression and anxiety. Depress Anxiety 2009; 26: 780-790 [99] Mizrahi R, Korostil M, Starkstein SE et al. The effect of antipsychotic treatment on Theory of Mind. Psychol Med 2007; 37: 595-601 [100] Mohamed S, Rosenheck R, Swartz M et al. Relationship of cognition and psychopathology to functional impairment in schizophrenia. Am J Psychiatry 2008; 165: 978-987 [101] Mueser KT, Doonan R, Penn DL et al. Emotion recognition and social competence in chronic schizophrenia. J Abnorm Psychol 1996; 105: 271-275 [102] Mur M, Portella MJ, Martinez-Aran A et al. Influence of clinical and neuropsychological variables on the psychosocial and occupational outcome of remitted bipolar patients. Psychopathology 2009; 42: 148-156 [103] Mur M, Portella MJ, Martínez-Arán A et al. Neuropsychological profile in bipolar disorder: a preliminary study of monotherapy lithium-treated euthymic bipolar patients evaluated at a 2-year interval. Acta Psychiatr Scand 2008; 118: 373-381 [104] Murphy CF, Alexopoulos GS. Attention network dysfunction and treatment response of geriatric depression. J Clin Exp Neuropsychol 2006; 28: 96-100 FC, Sahakian BJ. [105] Murphy Neuropsychology of bipolar disorder. Br J Psychiatry 2001; 178 (Suppl 41): S120-127 [106] Nehra R, Chakrabarti S, Pradhan BK, Khehra N. Comparison of cognitive functions between first- and multiepisode bipolar affective disorders. J Affect Disord 2006; 93: 185-192 [107] Newhouse PA, Krishnan KR, Doraiswamy PM et al. A double-blind comparison of sertraline and fluoxetine in depressed elderly outpatients. J Clin Psychiatry 2000; 61: 559-568 [108] Niedźwiedzka I, Kühn-Dymecka A, Wciórka J. Unawareness of illness and neurocognition in schizophrenia Psychiatr Pol 2008; 42: 943-957 [109] Oxman TE. Antidepressants and cognitive impairment in the elderly. J Clin Psychiatry 1996; 57 (Suppl 5): 38-44 [110] Penn DL, Keefe RS, Davis SM et al. The effects of antipsychotic medications on emotion perception in patients with chronic schizophrenia in the CATIE trial. Schizophr Res 2009; 115: 17-23 168 [111] Penn DL, Sanna LJ, Roberts DL. Social cognition in schizophrenia: an overview. Schizophr Bull 2008; 34: 408411 [112] Penn DL, Spaulding W, Reed D, Sullivan M. The relationship of social cognition to ward behavior in chronic schizophrenia. Schizophr Res 1996; 20: 327-335 [113] Pijnenborg GH, Withaar FK, Evans JJ et al. The predictive value of measures of social cognition for community functioning in schizophrenia: implications for neuropsychological assessment. J Int Neuropsychol Soc 2009; 15: 239247 [114] Pinkham AE, Penn DL, Perkins DO et al. Emotion perception and social skill over the course of psychosis: a comparison of individuals "at-risk" for psychosis and individuals with early and chronic schizophrenia spectrum illness. Cognit Neuropsychiatry 2007; 12: 198212 [115] Poole JH, Tobias FC, Vinogradov S. The functional relevance of affect recognition errors in schizophrenia. J Int Neuropsychol Soc 2000; 6: 649-658 [116] Pukrop R, Ruhrmann S, Schultze-Lutter F et al. Neurocognitive indicators for a conversion to psychosis: comparison of patients in a potentially initial prodromal state who did or did not convert to a psychosis. Schizophr Res 2007; 92: 116-125 [117] Quraishi S, Frangou S. Neuropsychology of bipolar disorder: a review. J Affect Disord 2002; 72: 209–226 [118] Reinares M, Martínez-Arán A, Colom F et al. Long-term effects of the treatment with risperidone versus conventional neuroleptics on the neuropsychological performance of euthymic bipolar patients. Actas Esp Psiquiatr 2000; 28: 231238 [119] Rund BR, Melle I, Friis S et al. The course of neurocognitive functioning in first-episode psychosis and its relation to premorbid adjustment, duration of untreated psychosis, and relapse. Schizophr Res 2007; 91: 132-140 [120] Rapp MA, Dahlman K, Sano M et al. Neuropsychological differences between late-onset and recurrent geriatric major depression. Am J Psychiatry 2005; 162: 691-698 [121] Robinson LJ, Thompson JM, Gallagher P et al. A meta-analysis of cognitive deficits in euthymic patients with bipolar disorder. J Affect Disord 2006; 93: 105115 [122] Roiser J, Farmer A, Lam D et al. The effect of positive mood induction on emotional processing in euthymic individuals with bipolar disorder and controls. Psychol Med 2009; 39: 785-791 Neurokognition und soziale Kognition bei Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen [123] Rubinow DR, Post RM. Impaired recognition of affect in facial expression in depressed patients. Biol Psychiatry 1992; 31: 947-953 [124] Sachs G, Steger-Wuchse D, KryspinExner I et al. Facial recognition deficits and cognition in schizophrenia. Schizophr Res 2004; 68: 27-35 [125] Salem JE, Kring AM, Kerr SL. More evidence for generalized poor performance in facial emotion perception in schizophrenia. J Abnorm Psychol 1996; 105: 480-483 [126] Sánchez-Morla EM, Barabash A, Martínez-Vizcaíno V et al. Comparative study of neurocognitive function in euthymic bipolar patients and stabilized schizophrenic patients. Psychiatry Res 2009; 169: 220-228 [127] Savina I, Beninger RJ. Schizophrenic patients treated with clozapine or olanzapine perform better on theory of mind tasks than those treated with risperidone or typical antipsychotic medications. Schizophr Res 2007; 94: 128-138 [128] Schneider F, Gur RC, Gur RE, Shtasel DL. Emotional processing in schizophrenia: neurobehavioral probes in relation to psychopathology. Schizophr Res 1995; 17: 67-75 [129] Scholten MRM, Aleman A, Montagne B, Kahn RS. Schizophrenia and processing of facial emotions: sex matters. Schizophr Res 2005; 78: 61-67 [130] Scott J, Stanton BR, Garland A. Cognitive vulnerability in patients with bipolar disorder. Psychol Med 2000; 30: 467-472 [131] Senturk V, Goker C, Bilgic A et al. Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate. Bipolar Disord 2007; 9 (Suppl 1): 136-144 [132] Shamay-Tsoory S, Harari H, Szepsenwol O, Levkovitz Y. Neuropsychological evidence of impaired cognitive empathy in euthymic bipolar disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2009; 21: 59-67 [133] Silver H, Goodman C, Knoll G et al. Schizophrenia patients with a history of severe violence differ from nonviolent schizophrenia patients in perception of emotions but not cognitive function. J Clin Psychiatry 2005; 66: 300-308 [134] Smith DJ, Muir WJ, Blackwood DH. Neurocognitive impairment in euthymic young adults with bipolar spectrum disorder and recurrent major depressive disorder. Bipolar Disord 2006; 8: 40-46 [135] Smith MJ, Barch DM, Csernansky JG. Bridging the gap between schizophrenia and psychotic mood disorders: Relating neurocognitive deficits to psychopathology. Schizophr Res 2009; 107: 69-75 [136] Sodian B, Thoermer C.Theory of Mind. In: Schneider W, Sodian B, Hrsg. Enzyklopädie der Psychologie. Entwicklungspsychologie, Band 2: Kognitive Entwicklung. Göttingen: Hogrefe; 2006: 495-608 [137] Sprong M, Schothorst P, Vos E et al. Theory of mind in schizophrenia. Metaanalysis. Br J Psychiatry 2007; 191: 513 [138] Summers M, Papadopoulou K, Bruno S et al. Bipolar I and Bipolar II disorder: cognition and emotion processing. Psychol Med 2006; 36: 1799-1809 [139] Sweeney PD, Anderson K, Bailey S. Attributional style in depression:a meta-analytic review.J Pers Soc Psychol 1986; 50: 974-991 [140] Sweeney JA, Kmiec JA, Kupfer KJ. Neuropsychologic impairments in bipolar and unipolar mood disorders on the CANTAB neurocognitive battery. Biol Psychiatry 2000; 48: 674-684 [141] Tabarés-Seisdedos R, BalanzáMartínez V, Sánchez-Moreno J et al. Neurocognitive and clinical predictors of functional outcome in patients with schizophrenia and bipolar I disorder at one-year follow-up. J Affect Disord 2008; 109: 286-299 [142] Tavares JV, Drevets WC, Sahakian BJ. Cognition in mania and depression. Psychol Med 2003; 33: 959-967 [143] Tollefson GD, Holman SL. How long to onset of antidepressant action: a meta-analysis of patients treated with fluoxetine or placebo. Int Clin Psychopharmacol 1994; 9: 245-250 [144] Torrent C, Martínez-Arán A, Amann B et al. Cognitive impairment in schizoaffective disorder: a comparison with non-psychotic bipolar and healthy subjects. Acta Psychiatr Scand 2007; 116: 453-460 169 [145] Tsourtos G, Thompson JC, Stough C. Evidence of an early information processing speed deficit in unipolar major depression. Psychol Med 2002; 32: 259–265 [146] Van der Gucht E, Morriss R, Lancaster G et al. Psychological processes in bipolar affective disorder: negative cognitive style and reward processing. Br J Psychiatry 2009; 194: 146-151 [147] Weiss EM, Kohler CG, Brensinger CM et al. Gender differences in facial emotion recognition in persons with chronic schizophrenia. Eur Psychiatry 2007; 22: 116-122 [148] Wolfe J, Granholm E, Butters N et al. Verbal memory deficits associated with major affective disorders: a comparison of unipolar and bipolar patients. J Affect Disord 1987; 13: 83-92 [149] Yurgelun-Todd DA, Tohen MF, Risser R et al. Improved cognitive outcome with olanzapine treatment in bipolar patients. Poster presented at the 57th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, 2004 [150] Zubieta JK, Huguelet P, O’Neil RL, Giordani BJ. Cognitive function in euthymic bipolar I disorder. Psychiatry Res 2001; 102: 9-20 PD Dr. Alex Hofer Medizinische Universität Innsbruck Department für Psychiatrie und Psychotherapie Univ.-Klinik für Biologische Psychiatrie [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 170–181 Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge der Psychiatriereformen? Hans Schanda1,2, Thomas Stompe1,2 und Gerhard Ortwein-Swoboda1 1 2 Justizanstalt Göllersdorf, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wien Schlüsselwörter: Schizophrenie – Gewalttätigkeit – Kriminalität – Psychiatriereform – Gemeindepsychiatrie – Epidemiologie Keywords: Schizophrenia – Violence – Criminality – Psychiatry reforms – Community psychiatry – Epidemiology Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge der Psychiatriereformen? Anliegen: Die Reformen der allgemeinpsychiatrischen Versorgung strebten eine substantielle Verbesserung der Lebenssituation psychisch Kranker an. Die vorliegende Arbeit untersucht anhand nationaler und internationaler Daten die Frage eines möglichen Zusammenhanges zwischen den Psychiatriereformen und der seit längerem beobachteten Zunahme der Einweisungen in forensisch-psychiatrische Institutionen. Ergebnisse: Sämtliche neueren Untersuchungen belegen einen mäßigen, jedoch statistisch robusten Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Gewalttätigkeit, der mit zunehmender Schwere der Delin© 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 quenz deutlicher wird. Das Risiko für Tötungsdelikte ist gegenüber der Allgemeinbevölkerung um etwa das 10-fache erhöht. Komorbider Substanzmissbrauch hat zwar wesentlichen Einfluss auf die Risikoerhöhung, ist aber ebenso wie soziodemographische Faktoren nicht imstande, sie völlig zu erklären. Auch unter Berücksichtigung von Alkoholmissbrauch ist das Risiko für Tötungsdelinquenz noch immer 7-mal höher als das der Allgemeinbevölkerung. In sämtlichen europäischen Ländern kam es in den letzten Jahrzehnten zu einem deutlichen Anstieg der Inzidenz und der Prävalenz psychisch kranker Straftäter, wobei schizophrene Patienten davon überproportional häufig betroffen sind. Während allerdings deren Risiko für schwerste Gewaltdelinquenz im Laufe der Jahre völlig unverändert blieb, nahm der Anteil schizophrener Patienten mit vergleichsweise leichten Delikten stetig zu. Schlussfolgerungen: Aufgrund der vorliegenden Literatur ergeben sich Hinweise dafür, dass die Ursache für diese Entwicklung in allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen zu suchen ist, im Rahmen derer eine Änderung des Selbstverständnisses der Verantwortlichen stattgefunden hat. Dies hatte zur Folge, dass die Behandlungskonzepte der modernen Gemeindepsychiatrie die objektiven Bedürfnisse einer Subgruppe schwer und chronisch kranker psychotischer Patienten nicht mehr ausreichend berücksichtigen. Die Vernachlässigung bzw. Verleugnung dieses Umstands fördert die Verlagerung solcher Patienten in forensisch-psychiatrische Einrichtungen und beschädigt Reputation unseres Faches. Increasing criminality in patients with schizophrenia: fiction, logical consequence or avoidable side effect of the mental health reforms? Objective: The reforms of general mental health care aimed at a substantial improvement of the situation of the mentally ill. We examined the question of a possible association between the mental health reforms and the steady increase of the population of forensic mental hospitals becoming apparent since the introduction of community psychiatry. Results: All recent publications report a moderate albeit statistically significantly increased risk of criminality in patients suffering from schizophrenia, which becomes more obvious in severe, violent offences. In homicide it comes up to the 10-fold of that of the general population. Comorbid substance abuse has a substantial impact on the extent of illegal behaviour, however, even under consideration of alcohol abuse the risk of homicide amounts to about the 7-fold of that of the general population. Nearly all European countries give account on a remarkable increase of the incidence and prevalence rates of mentally disordered offenders. Patients suffering from Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge ... schizophrenia are disproportionately affected by this development. However, the substantially increased risk of homicide in schizophrenic patients, reported already in the pre-reform era, remained stable over time. Accordingly, the rate of patients admitted to forensic-psychiatric treatment because of offences of minor severity is on the rise. Conclusion: This development cannot be explained by single details of the mental health reforms, which show remarkable regional differences concerning numbers of mental hospital beds, ways of service provision, legal preconditions and rates of criminality and substance abuse. Rather, national and international data suggest changes of general societal attitudes to be the crucial factor. They have resulted in changes concerning the self-understanding of the representatives of modern mental healthcare. As aggressive behaviour is not integrated in the understanding of schizophrenia of present-day psychiatry, the objective needs of a subgroup of severely and chronically ill psychotic patients with high rates of comorbid substance abuse, lack of insight and compliance are increasingly neglected. The denial of these facts promotes the shift of ‘difficult-to-treat patients’ into forensic-psychiatric facilities and damages the reputation of psychiatry. Einleitung Seit einiger Zeit wird die international schon seit längerem bekannte Zunahme forensisch-psychiatrischer Patienten [23; 27; 28; 40; 48; 53; 54] auch im deutschsprachigen Raum registriert [6; 29; 52 - 56; 58]. Die Zahl der Behandlungseinrichtungen wächst stetig, ebenso die dafür aufzuwendenden Budgets. Die möglichen Ursachen für diese Entwicklung werden seit längerem (oft sehr emotional) diskutiert. Im Besonderen betreffen die Diskussionen die Frage, ob - und wenn ja, in welcher Form - ein Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und den Reformen der allgemeinpsychiatrischen Versorgung besteht [53 - 55]. Die Beantwortung dieser Frage ist untrennbar verbunden mit einer allgemeinen, nämlich der nach dem grundsätzlichen Ausmaß der Gewaltbereitschaft an Schizophrenie leidender Menschen. Deren angeblich besondere Gefährlichkeit ist seit jeher im Bewusstsein der Bevölkerung verankert und stellt einen wesentlichen Grund für die Stigmatisierung psychisch Kranker dar [50]. Aus der Zwischenkriegszeit stammende Untersuchungen versuchten, dieses Vorurteil zu entkräften, und in der Tat konnte nachgewiesen werden, dass in den USA Gewalttätigkeit bzw. Festnahmen unter aus psychiatrischen Krankenhäusern entlassenen Patienten nicht häufiger [39], in einer Studie sogar seltener [1] als in der Allgemeinbevölkerung zu finden waren. Allerdings ist bei der Interpretation dieser Zahlen die damalige Situation der psychiatrischen Versorgung zu berücksichtigen. So verfügten z.B. die USA zu dieser Zeit noch über mehr als 300 psychiatrische Betten pro 100.000 Bevölkerung [30]. Die stationäre Behandlungsdauer war um ein Vielfaches länger als heute, die Aufnahmen erfolgten zu einem beträchtlichen Teil gegen den Willen der Betroffenen, und außer unspezifischer Sedierung und verschiedenen Formen von Schocktherapien standen keine somatischen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ab Mitte der 1950er Jahre wurde in den USA mit der Reform der allgemeinpsychiatrischen Versorgung begonnen, kurze Zeit darauf folgte Großbritannien diesem Beispiel. In den übrigen europäischen Ländern wurden die Reformen mit zum Teil beträchtlicher Verzögerung eingeleitet, in Österreich etwa erst ab dem Ende der 1970er Jahre [52]. Deren Ziel war neben einer substantiellen Verbesserung der Situation psychisch Kranker auch der Abbau von Vorurteilen wie eben dem der besonderen Gefährlichkeit schizophrener Pati- 171 enten. Die Vorurteile beschränkten sich allerdings nicht auf die Kranken, sondern betrafen auch die Psychiatrie und ihre Repräsentanten. Die großen Asyle wurden häufig als Institutionen gesehen, in denen Psychiater in einer Doppelrolle - als Ärzte und zugleich als Agenten sozialer Kontrolle - Zwang gegen wehrlose psychisch Kranke ausübten. Dieser Sonderstellung innerhalb der medizinischen Fächer zu entkommen war der Psychiatrie ein wichtiges Anliegen. Im Wesentlichen wurden dabei zwei Wege beschritten: 1) „Medikalisierung“: Ausgehend von der Überzeugung, dass sich psychiatrische Erkrankungen grundsätzlich nicht von somatischen Erkrankungen unterscheiden, müssten für deren Behandlung die gleichen Grundprinzipien wie für die Behandlung somatischer Erkrankungen gelten. Diese Angleichung an die übrigen medizinischen Fächer sollte durch die Neustrukturierung der Versorgung (Bettenabbau, Dezentralisierung, Senkung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer, Einrichtung gemeindenaher Ambulanzen und Bereitstellung niederschwelliger Versorgungsangebote) erfolgen. Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass ab Mitte der 1950er Jahre wirksame Medikamente für die Behandlung von Psychosen zur Verfügung standen. 2) „Ideologie“: Die geänderte Versorgungssituation sollte es ermöglichen, Zwang auf ein absolut unvermeidliches Minimum zu reduzieren, die stigmatisierenden Symbole der Unterdrückung und Ausgrenzung - allen voran die großen psychiatrischen Asyle - zu beseitigen und zugleich das Vorurteil der besonderen Gefährlichkeit psychotischer Patienten zu widerlegen. All dies würde zu der angestrebten „Normalisierung“ der Sonderstellung der Psychiatrie und ihrer Patienten und daher zur Entstigmatisierung führen. Im Zuge der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckenden Veränderungen der psychiatrischen Versorgung ka- H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda men aus den USA erste Informationen über im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhte Raten von Kriminalität schizophrener Patienten [41], die vor allem bei schwersten Formen der Gewalttätigkeit nachweisbar waren [18]. Diese Informationen wurden zunächst weder von den nicht-psychiatrischen „Ideologen“ noch von den an der Reformfront Tätigen zur Kenntnis genommen. Und in der Tat wiesen namhafte Fachleute noch in den 1980er Jahren auf methodische Mängel der angeblich erhöhte Raten von Gewalttätigkeit belegenden Untersuchungen hin. Bei Berücksichtigung demografischer Variablen wie Alter, Geschlecht, Hautfarbe, soziale Schicht etc. sei die angebliche Risikoerhöhung nicht mehr nachweisbar [35]. Einige Jahre später kam es allerdings zu einem Meinungsumschwung. 1992 schrieb Monahan: “The data that have recently become available, fairly read, suggest the one conclusion I did not want to reach … there appears to be a relationship between mental disorder and violent behavior.” [34, S. 519]. Zugleich verschlechterte sich die soziale Situation schwer und chronisch psychisch Kranker in den USA derart, dass Talbott bereits 1979 von einer „nationalen Schande“ sprach [62] und anmerkte: “The chronic mentally ill patient had his locus of living and care transferred from a single lousy institution to multiple wretched ones” [61, S. 1113]. Mitteleuropa schien von diesen Entwicklungen zunächst nicht betroffen zu sein. Abgesehen davon, dass hier die Psychiatriereformen erst wesentlich später eingeleitet wurden, wies man zu Recht auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den US-amerikanischen Verhältnissen und denen etwa in Deutschland, Österreich oder der Schweiz hin. Im Gegensatz zu den USA existiert bei uns ein ausreichender Versicherungsschutz für die gesamte Bevölkerung, dementsprechend einfacher und unproblematischer gestaltet sich der Zugang zur medizinischen Versorgung. Da- rüber hinaus sind in Mitteleuropa die Raten von Kriminalität und Drogenmissbrauch deutlich niedriger als in den USA. Bis zum heutigen Tag berufen sich daher vor allem im deutschsprachigen Raum einige Repräsentanten unseres Faches noch immer auf die Aussage von Böker & Häfner, dass „… Geisteskranke und Geistesschwache insgesamt nicht häufiger aber auch nicht wesentlich seltener zu Gewalttätern werden als sogenannte Geistesgesunde“ [2, S. 94]. Jedoch werden auch bei uns gerade in der letzten Zeit zunehmende Schwierigkeiten mit aggressivem Verhalten psychisch Kranker registriert, weshalb vor allem bei den täglich mit den Konsequenzen der beschriebenen Entwicklung konfrontierten Kolleginnen und Kollegen ein zunehmendes Problembewusstsein zu bemerken ist. Im Folgenden wird versucht, die beiden eingangs gestellten Fragen - die nach dem Ausmaß der Gewaltbereitschaft an Schizophrenie leidender Menschen und die nach möglichen Zusammenhängen zwischen den Psychiatriereformen und der steigenden Zahl forensischpsychiatrischer Patienten - anhand der zur Verfügung stehenden Literatur zu beantworten. Ergebnisse Aktuelle Daten zu Kriminalität und Gewalttätigkeit schizophrener Pa­ tienten Sämtliche neueren Untersuchungen belegen einen Zusammenhang zwischen Schizophrenie und erhöhten Raten von Kriminalität bzw. Gewalttätigkeit. Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass dieser Zusammenhang tendenziell - teilweise auch statistisch signifikant - mit der Schwere der Gewalttätigkeit zunimmt und bei Frauen deutlicher zur Geltung kommt als bei Männern. Allerdings darf aus diesen Zahlen nicht unreflektiert auf eine generell erhöhte Gefährlichkeit psychotischer Patienten geschlossen 172 werden. So dokumentierten etwa die zum Teil an sehr großen Kollektiven erhobenen epidemiologischen Untersuchungen von Brennan et al., Hodgins et al., Mullen et al., Räsänen et al., Tiihonen et al. und Wallace et al. lediglich den Umstand, dass bei einer Person sowohl eine Eintragung in einem Straf- oder Arrestregister als auch in einem Spitalsregister vorliegt [3; 21; 36; 42; 64; 67]. Ein direkter („kausaler“) Zusammenhang zwischen Krankheit und Kriminalität lässt sich daraus nicht ablesen - könnte doch etwa die Festnahme oder strafrechtliche Verurteilung eines Patienten unter Umständen Jahre vor seinem ersten Kontakt mit dem psychiatrischen Versorgungssystem stattgefunden haben. Bei Lindqvist & Allebeck bzw. Modestin & Ammann ist der Zeitraum insofern eingeengt, als die Autoren die Strafregistereintragungen schizophrener Patienten nach Entlassung aus Spitalsbehandlung untersuchten und mit denen der Allgemeinbevölkerung verglichen [31; 33]. Aber auch hier ist ein direkter Zusammenhang zwischen Diagnose und Straffälligkeit nicht in jedem Fall anzunehmen. Anders verhält es sich bei den mit einer Ausnahme [19] ausschließlich auf Tötungsdelikte beschränkten Studien, bei denen durch eine ausführliche psychiatrische Untersuchung bzw. ein Gutachten - üblicherweise wegen des Verdachts auf Zurechnungsunfähigkeit - ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Erkrankung und einem bestimmten Delikt festgestellt wurde [10; 11; 51]. An dieser Stelle erfolgt üblicherweise der Einwand, dass die nachgewiesene Risikoerhöhung nicht auf die Psychose, sondern ausschließlich auf allgemeine kriminogene Faktoren - allen voran Substanzmissbrauch zurückzuführen sei. In der Tat liegen die Raten von (komorbidem) Substanzmissbrauch bei schizophrenen Patienten deutlich über denen der Allgemeinbevölkerung - bei Alkoholmissbrauch um das 3-fache, bei Drogenmissbrauch um das 5- bis 6- Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge ... Jede Art von Kriminalität RR, OR (95% CI) Gewaltdelikt RR, OR (95% CI) Lindqvist & Allebeck 1990 [31] (N) RR M 1,2 (0,7 - 2,1) F 2,2 (1,5 - 3,6) M +F 3,9 (3,0 - 5,1) Modestin & Ammann 1996 [33] (N) OR M 0,9 (0,7 - 1,3) M 5,2 (1,5 - 18,3) Eronen et al. 1996 [11] (D) OR Hodgins et al. 1996 [21] (K) RR 173 Tötungsdelinquenz RR, OR (95% CI) M 8,0 (6,1 - 10,4) F 6,5 (2,6 - 16,0) M 3,7 ( 3,5 - 4,0) F 4,5 (4,1 - 5,0) M 4,5 (3,9 - 5,1) F 8,7 (6,0 - 12,4) Tiihonen et al. 1997 [64] (K) OR M + F 7,2 (3,1 - 16,6) Räsänen et al. 1998 [42] (K) OR M + F 7,0 (2,8 - 16,7) Wallace et al. 1998 [67] (K) OR M 3,2 (2,6 - 3,9) F 4,2 (2,1 -8,4) M 4,4 (3,5 - 5,7) F 4,3 (1,6 - 11,6) Mullen et al. 2000 [36] (K) RR M 3,0 (1,9 - 4,9) M 6,0 (2,2 - 16,6) Brennan et al. 2000 [3] (K) OR Erb et al. 2001 [10] (D) OR Haller et al. 2001 [19] (D) RR Schanda et al. 2004 [51] (D) OR M 10,1 (5,5 - 18,6) F 10,6 (1,4 - 80,4) M 1,9 (1,4 - 2,6) F 7,1 (3,3 - 15,3) M + F 16,6 (11,2 - 24,5) M + F 1,6 (1,3 - 1,9) M + F 3,2 (2,4 - 4,2) M + F 38,1 (17, 9- 81,0) M 5,9 (4, 3- 8,0) F 18,8 (11,2 - 31,6) RR = Relative Risk, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall; N = Nachuntersuchung aus stationärer Behandlung entlassener Patienten, Strafregistereinträge während des Follow-up-Zeitraums, K = Koinzidenz einer Straf- bzw. Arrestregistereintragung und einer Eintragung in ein Krankenhausregister bei einer Person (bei Wallace et al. und Mullen et al. Registrierung nicht nur stationärer, sondern auch ambulanter Behandlungen), D = Delikt mit nachfolgender Exkulpierung und Einweisung in eine forensisch-psychiatrische Einrichtung; M = Männer, F = Frauen Tabelle 1: Schizophrenie, Kriminalität und Gewalttätigkeit: Aktuelle Befunde fache [25; 43; siehe auch 66]. Nun wurde in einigen Studien das Risiko für Kriminalität bzw. Gewalttätigkeit getrennt für Patienten mit und ohne Komorbidität berechnet (Tabelle 2). Ohne Zweifel hat Substanzmissbrauch einen entscheidenden Einfluss auf die Erhöhung des Risikos, jedoch finden sich mit einer Ausnahme auch für Schizophrenie ohne komorbiden Substanzmissbrauch durchwegs statistisch signifikante Risikoerhöhungen, am deutlichsten wiederum bei schwersten Formen der Gewaltdelinquenz [12; 51; 67]. (Bei der Studie von Räsänen et al. - teilweise auch bei der von Eronen et al. - werden die aufgrund der geringen Fallzahlen entstehenden, an den extrem großen Konfidenzintervallen ablesbaren methodischen Probleme offenkundig [12; 42].) Brennan et al. konnten im Rahmen einer Untersuchung in Dänemark an mehr als 300.000 Personen nachweisen, dass ein erhöhtes Risiko für Festnahmen und Verurteilungen wegen gewalttätigen Verhaltens auch nach Berücksichtigung soziodemografischer Variablen, komorbidem Substanzmissbrauch und komorbiden Persönlichkeitsstörungen bestehen bleibt - bei Frauen wiederum wesentlich deutlicher als bei Männern [3]. Zusammenfassend belegen die vorliegenden Daten entgegen allen gelegentlich auch von Fachleuten geäußerten anders lautenden Meinungen einen mäßigen, jedoch statistisch robusten Zusammenhang zwischen H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda 174 Jede Art von Kriminalität OR (95% CI) Komorbidität Gewaltkriminalität OR (95% CI) Tötungsdelinquenz OR (95% CI) M Ohne Alkoholmissbrauch Mit Alkoholmissbrauch 7,3 (5,4 - 9,7) 17,2 (12,4 - 23,7) F Ohne Alkoholmissbrauch Mit Alkoholmissbrauch 5,1 (1,9 - 13,7) 80,9 (25,7 - 255,0) Räsänen et al. 1998 [42] (K) M+F Ohne Alkoholmissbrauch Mit Alkoholmissbrauch Wallace et al. 1998 [67] (K) M Ohne Substanzmissbrauch Mit Substanzmissbrauch Eronen et al. 1996 [12] (D) Schanda et al. 2004 [51] (D) M+F 3,6 (0,9 - 12,3) 25,2 (6,1 - 97,5) 1,9 (1,4-2,5) 12,4 (9,1-16,8) 2,4 (1,7 - 3,4) 18,8 (13,5 - 26,5) 7,1 (3,3 - 15,5) 28,8 (10,7 - 77,9) Ohne Alkoholmissbrauch Mit Alkoholmissbrauch 7,1 (5,1 - 9,8) 20,7 (12,4 - 34,1) OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall; K = Koinzidenz einer Straf- bzw. Arrestregistereintragung und einer Eintragung in ein Krankenhausregister bei einer Person (bei Wallace et al. und Mullen et al. Registrierung nicht nur stationärer, sondern auch ambulanter Behandlungen), D = Delikt mit nachfolgender Exkulpierung und Einweisung in eine forensisch-psychiatrische Einrichtung; M = Männer, F = Frauen Tabelle 2: Schizophrenie, Kriminalität und Gewalttätigkeit: Komorbider Substanzmissbrauch 1980 | 1985 | 1990 | 1991 2.473 Deutschland [38] 1995 | 2000 | [+ 107% = 8,9%/a] Dänemark [27; 28] 1980 300 [+ 450% =18,8%/a] Österreich1) [5] 1980 106 1990 110 2005 | 2010 | 2003 5.118 2004 1.650 [+ 208% = 10,9%/a] 2009 339 1) Nur zurechnungsunfähige geistig abnorme Rechtsbrecher (§ 21/1 ÖStGB); Prävalenz inklusive zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher (§21/2 ÖStGB): 1980: 189, 1990: 228, 2009: 743 Tabelle 3: Zunahme der Prävalenz forensisch-psychiatrischer Patienten Schizophrenie und Gewalttätigkeit, der mit zunehmender Schwere der Gewalttätigkeit (Tötungsdelinquenz) bzw. in Populationen mit niedrigem Risiko (Frauen) deutlicher wird. Er ist aber in jedem Fall geringer als der zwischen Substanzmissbrauch bzw. Persönlichkeitsstörungen und Kriminalität bzw. Gewalttätigkeit [11]. Ko- morbider Substanzmissbrauch und komorbide Persönlichkeitsstörungen haben zwar Einfluss auf die Erhöhung des Risikos, sind aber ebenso wie soziodemografische Faktoren nicht im Stande, den Zusammenhang völlig zu erklären. Steigende Kriminalität schizo­ phrener Patienten? In nahezu sämtlichen europäischen Ländern wird in den letzten Jahrzehnten ein deutlicher Anstieg der Zahl (zurechnungsunfähiger) psychisch kranker Straftäter registriert [6; 23; 27 - 29; 40; 52 - 56; 58]. Tabelle 3 Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge ... 1) 175 Einweisungen nach § 21/1 ÖStGB, Curve estimation: F=81,07, p=0,000 Gefängnisstrafen : 1000, Curve estimation: F=3,76, p=0,063, n.s. Ab 2002 inklusive bedingte Einweisungen [52] Quelle: Statistik Austria 2008 [59] Abbildung 1: Jährliche Inzidenz von Einweisungen nach § 21/1 ÖStGB (zurechnungsunfähige Straftäter) und von Verurteilungen zu Haftstrafen, Österreich, 1990 - 20071) zeigt stellvertretend die Veränderung der Prävalenzen in Deutschland, Dänemark und Österreich. In Österreich kam es innerhalb von 19 Jahren zu einer Verdreifachung, in Dänemark innerhalb von 24 Jahren sogar zu einem Anstieg um mehr als das 5-fache [5; 27; 28], was jährlichen Zuwachsraten zwischen 8,9% und 18,8% entspricht. Das Argument, dass dies auf einen allgemeinen Anstieg der Kriminalität zurückzuführen sei, lässt sich - zumindest aufgrund der aus Österreich zur Verfügung stehenden Daten - entkräften. Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, dass die statistisch hochsignifikante Zunahme der jährlichen Inzidenzen seit Beginn der 1990er Jahre ausschließlich die Einweisungen in die vorbeugende Maßnahme gemäß § 21/1 ÖStGB (zurechnungsunfähige Straftäter) betrifft. Der leichte, statistisch nicht signifikante Anstieg der Haftstrafen seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist auf die Zunahme von Verurteilungen wegen vergleichsweise geringfügiger Eigentumsdelikte zurückzuführen. Da diese Delikte zumeist mit einer Haftstrafe von weniger als einem Jahr bedroht sind, können sie nach dem österreichischen Strafrecht nicht als Grundlage für eine Einweisung in die vorbeugende Maßnahme dienen [49]. Von diesem Anstieg sind nicht sämtliche Patienten gleichermaßen betroffen. Der Vergleich der Daten zweier österreichischer Stichtagserhebungen aus den Jahren 1992 und 2007 zeigt einen Anstieg der Prävalenz zurechnungsunfähiger Straftäter um das 2,5-fache (126 vs. 316), die Prävalenz derer, die an Schizophrenie leiden, nahm hingegen um das 3,3-fache zu. Dementsprechend litten 1992 „nur“ 54% aller zurechnungsunfähigen Straftäter unter Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, während es 2007 bereits 70,6 % waren [54]. Ähnliche Ergebnisse werden für Deutschland berichtet. Der Anteil schizophrener Patienten im Maßregelvollzug von Nordrhein-Westfalen (schuldunfähige und vermindert schuldfähige Patienten) betrug 1994 33,7%, 2006 hingegen bereits 43,1%. Bei 72,2% der Täter wurde ein komorbider Substanzmissbrauch diagnostiziert, 2/3 waren vorbestraft, der mittlere prädeliktische Krankheitsverlauf betrug mehr als 9 Jahre, 78,3% hatten zumindest eine stationäre Vorbehandlung, im Durchschnitt 7,5 [29]. Auch bezüglich der relativen Häufigkeit der einzelnen Deliktkategorien ergaben sich bemerkenswerte Veränderungen (Tabelle 4). Entsprechend H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda 1) 176 1990 (20 Einweisungen) % 2000 (60 Einweisungen) % 20071) (111 Einweisungen) % Curve estimation Eigentumsdelikte, Brandstiftung, Sexualdelikte 45,0 21,7 18,0 F = 11,77, p = 0,003 Tötungsdelikte, schwere Körperverletzung 35,0 35,0 23,4 F = 4,99, p = 0,04 Gefährliche Drohung, Nötigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt 20,0 43,3 58,6 F = 89,36, p = 0,000 Inklusive bedingte Einweisungen [52] Quelle: Statistik Austria 2008 [59] Tabelle 4: Jährliche Inzidenz der Einweisungen nach § 21/1 ÖStGB (zurechnungsunfähige Straftäter), Österreich. %-Anteile der einzelnen Deliktgruppen an sämtlichen Einweisungen der jeweiligen Jahre Erb et al 2001 [10]: Risiko für Tötungsdelikte (inkl. Versuche) bei Schizophrenie (Verurteilungen vs. Exkulpierungen, Männer + Frauen) Schizophrenie OR (95% CI) BRD 1955 - 19641) 12,7 (11,2 - 14,3) Hessen 1992 - 1996 16,6 (11,2 - 24,5) Statistisch signifikante Zunahme von komorbidem Alkoholismus (p< 0,001), Vorstrafen (p< 0,01) und Vorstrafen wegen Gewalttätigkeit (p< 0,01) bei schizophrenen Straftätern. Schanda, unveröffentlichte Daten: Risiko für Tötungsdelikte bei Schizophrenie (inkl. Wahnhafte Störung) (Verurteilungen vs. Exkulpierungen, Männer + Frauen) Schizophrenie OR (95% CI) Österreich 1976 - 1983 9,0 (6,3 - 12,9) Österreich 1992 - 1999 10,5 (7,8 - 14,0) Bei gleichbleibenden Raten von komorbidem Alkoholmissbrauch (37,1% bzw. 38,5%) deutliche Zunahme von komorbidem Polysubstanzmissbrauch (Alkohol + Drogen) von 8,6% auf 23,1% zwischen den Perioden 1976-1983 und 1992-1999 OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall 1) Die Basisdaten stammen aus der Untersuchung von Böker und Häfner [2] Tabelle 5: Schizophrenie und Tötungsdelikte im Laufe der Psychiatriereformen der Intention des Gesetzgebers, dass die vorbeugende Maßnahme nur „wirklich gefährlichen Delinquenten“ vorbehalten sein sollte, „bei denen andere strafrechtliche Maß- nahmen nicht in Betracht kommen oder nicht genügen“ [16], erfolgten in Österreich 1990 noch 35% aller Einweisungen wegen Tötungs- und Körperverletzungsdelikten und wei- tere 45% wegen Eigentumsdelikten (zumeist Raub), Brandstiftungen sowie Sexualdelikten. 2007 betrug der Anteil der schweren Gewaltdelikte weniger als ein Viertel, und Eigen- Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge ... tumsdelikte, Brandstiftung und Sexualdelikte machten lediglich 18% der Einweisungen aus. Hingegen wurden nahezu 60% aller Neueinweisungen des Jahres 2007 aufgrund von gefährlicher Drohung, Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt ausgesprochen - Delikte, die zumindest zum Teil als Ausdruck sozialer Störung und weniger als Ausdruck außerordentlicher Gefährlichkeit interpretiert werden können. Auch hier wird für Deutschland eine vergleichbare Entwicklung wird beschrieben [29]. Das Risiko für Tötungsdelikte schizophrener Patienten blieb in Österreich unverändert (Tabelle 5). Sowohl in den Jahren 1976 bis 1983 - also noch vor Einsetzen der Psychiatriereformen(!) - wie auch in den Jahren 1992 bis 1999 fand sich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine Risikoerhöhung um etwa das Zehnfache. Identische Resultate liegen aus Deutschland vor. Erb et al. errechneten das aktuelle Risiko für Tötungsdelikte bei Schizophrenie und verglichen es mit dem der Jahre 1955 bis 1964 [10] (Tabelle 5). Auch in Deutschland war das Risiko für Tötungsdelinquenz gegenüber der Allgemeinbevölkerung bereits vor Einsetzen der Psychiatriereformen deutlich erhöht, auch dort fand sich kein statistisch signifikanter Anstieg im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Simpson et al. kamen für Neuseeland, Taylor & Gunn für England zu ähnlichen Ergebnissen [57; 63]. Zusammenfassend ist also festzustellen, 1) dass sowohl die Inzidenz wie auch die Prävalenz (zurechnungsunfähiger) psychisch kranker Straftäter deutlich zunimmt, 2) dass davon überproportional häufig Patienten betroffen sind, die unter Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis leiden, 3) dass hingegen das bereits in der Zeit der traditionellen Anstaltspsychiatrie deutlich erhöhte Ri- siko für schwerste Gewaltdelinquenz schizophrener Patienten im Laufe der Jahre unverändert geblieben ist. Dies hat zur Folge, dass der Anteil zurechnungs­ unfähiger Straftäter, die wegen dieser Delikte eingewiesen ­werden, kontinuierlich abnimmt, und in forensisch-psychiatrischen Insti­tutionen in zunehmendem Ausmaß psychotische Patienten mit vergleichsweise leichteren Delikten zu finden sind [54]. Diskussion Diese Befunde werden mancherorts als Beweis dafür angesehen, dass kein Zusammenhang zwischen Psychiatriereformen und Zunahme der Zahl forensisch-psychiatrischer Patienten bestehen kann. Argumentiert wird mit der Unvereinbarkeit der als mögliche Erklärung für einen Zusammenhang dienenden Fakten: International findet sich eine relativ uniforme Zunahme der Inzidenz bzw. Prävalenz psychisch kranker Straftäter trotz zum Teil völlig unterschiedlicher Voraussetzungen bezüglich Zahl allgemeinpsychiatrischer Betten, Dichte und Details der ambulanten Versorgungsangebote, Gesetzeslage und Raten von Kriminalität bzw. Substanzmissbrauch [53; 54]. Die Hypothese, dass im Rahmen der Veränderung der Position der stationären Behandlung innerhalb der Versorgungskette die Kriterien für zivilrechtliche Unterbringungen zu eng wären, sodass ein Teil des Zwanges auf dem Umweg über das Strafrecht zur Anwendung kommt, ist ebenfalls nicht stichhaltig, da in Europa die Raten unfreiwilliger Aufnahmen an sämtlichen Aufnahmen bis zum 9fachen und die Raten unfreiwilliger Aufnahmen pro Bevölkerung sogar bis zum 29-fachen differieren [7; 46; 53; 54]. Das von Priebe et al. als entscheidender Faktor angesehene ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis unserer 177 heutigen Gesellschaft, das sich auch im Ansteigen der Gefängnispopulationen niederschlägt, mag durchaus zu der beschriebenen Entwicklung beitragen. Unzutreffend ist nach unserer Meinung jedoch die Annahme, dass die steigende Prävalenz psychisch kranker Straftäter ausschließlich darauf zurückzuführen ist und nichts mit den Praktiken der modernen Gemeindepsychiatrie zu tun haben kann [40]. Es sei daran erinnert, dass die relative Zunahme der Populationen forensisch-psychiatrischer Institutionen die der Gefängnispopulationen um ein Vielfaches übersteigt. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass sich ein wachsendes Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft trotz der seit einigen Jahrzehnten stattfindenden deutlichen Verbesserung der allgemeinpsychiatrischen Versorgungsangebote primär gegen psychotische Patienten richtet [53; 54]. Nicht auszuschließen ist allerdings die Möglichkeit, dass von Seiten der Gerichte vermehrt eine gutachterliche Überprüfung des Geisteszustands von Straftätern angeordnet wird, was theoretisch eine Zunahme der Zahl von Einweisungen zur Folge haben könnte. Zwar steigt die Wahrscheinlichkeit der Beiziehung eines Gutachters mit dem Schweregrad des Delikts - und die Inzidenz von Tötungsdelikten psychotischer Patienten ist, wie erwähnt, unverändert geblieben (vgl. Tabelle 5) -, im Falle der vermehrten Begutachtung leichterer Formen der Delinquenz könnte diese Hypothese jedoch zutreffen. Ein solches möglicherweise geändertes gerichtliches Vorgehen stellt jedoch wiederum keine primäre Ursache dar. Die entscheidenden Veränderungen fanden wohl in den Köpfen statt [53]. Nicht in Betracht gezogen wurde nämlich bisher der Umstand, dass die Erklärung für die steigende Zahl forensisch-psychiatrischer Patienten nicht in einzelnen immer wieder diskutierten (regional sehr unterschiedlichen) Details der allgemeinpsychiatrischen Versorgung, sondern vielmehr in den vielfältigen Auswir- H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda kungen allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen liegen könnte. Unsere heutige Gesellschaft ist geprägt durch den Anspruch auf „maximale“ persönliche Freiheit verbunden mit dem Anspruch auf „maximale“ persönliche Sicherheit und - als Konsequenz - durch zunehmende Formalisierung und Verrechtlichung bei gleichzeitig zu beobachtender Entsolidarisierung. Das muss naturgemäß Auswirkungen auf das Verhalten sämtlicher für die Versorgung Verantwortlichen haben. Dieser Entwicklung entspricht die weitgehende Umdefinierung Kranker - von durch das Gesundheitssystem zu versorgenden Patienten zu in einem Markt agierenden „Kunden“. Der „Konsum“ von „Gesundheitsprodukten“ setzt allerdings ausreichende Einsicht und Eigenverantwortlichkeit voraus, welche Eigenschaften bei einer Subgruppe schwer Kranker oft nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Patienten, die nicht zuletzt im Zusammenhang mit einer krankheitsbedingten kognitiven Beeinträchtigung möglicherweise gar nicht imstande sind, ihre Erkrankung überhaupt wahrzunehmen und daher notwendige (medikamentöse) Behandlungsmaßnahmen ablehnen, können die Angebote der modernen Gemeindepsychiatrie nur beschränkt nützen. Ihre Behandlung wird unter den heutigen Bedingungen zunehmend schwieriger, zeit- und kostenintensiver, unbedankter - und vor allem auch diskriminierender. Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, solche Patienten suffizient zu behandeln, geraten nicht nur unter Druck der Kostenträger [32], sie laufen auch Gefahr, als Befürworter der alten Anstaltspsychiatrie mit all ihren negativen Konnotationen denunziert zu werden. Es verwundert daher nicht, dass die Bedürfnisse der erwähnten Subgruppe schwer und chronisch Kranker mit hohen Komorbiditätsraten zunehmend ausgeblendet oder „vergessen“ werden. Schmidt-Quernheim merkt zu Recht an: „Dieses ‚Vergessen’ … diente - so könnte man vermuten - der eigenen Entlastung. Man konnte so sein (pseudo)fortschrittliches Selbstbild pflegen, nichts mit staatlichem Zwang zu tun haben und auf der ‚richtigen Seite’ stehen.“ [55, S. 219]. Offensichtlich ist das Problem aggressiven/gewalttätigen Verhaltens nicht in das aktuelle Schizophreniekonzept der Allgemeinpsychiatrie integriert, weshalb diese nicht mehr imstande ist, eine zugegebenermaßen „schwierige“ Klientel adäquat zu behandeln [23; 48; 53; 54; 69]. Zum einen hat die Fähigkeit, Risikopatienten zu identifizieren, abgenommen, zum anderen wurde versäumt, das für deren suffiziente Behandlung erforderliche Instrumentarium zu entwickeln [23; 47]. Walsh et al. stellten zutreffend fest, dass auch eine intensivere Behandlung mit den der Allgemeinpsychiatrie derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht imstande ist, aggressives Verhalten solcher Patienten zu reduzieren [68]. Diese Hypothese wird mehrfach bestätigt: In Dänemark sank die Zahl allgemeinpsychiatrischer Betten zwischen 1980 und 2004 von 8.000 auf 3.750, die Zahl forensischer Betten stieg hingegen im gleichen Zeitraum von 300 auf 1650 [27; 28]. Der Einwand, dass in Dänemark die Verfügbarkeit allgemeinpsychiatrischer Betten derart eingeschränkt wurde, dass Probleme unvermeidlich werden, ist nicht zutreffend. 2004 lag die Rate mit 70 pro 100.000 Bevölkerung [27] deutlich über der einiger anderer europäischer Länder, darunter auch Österreich [26]. Außerdem wurden die Betten nicht ersatzlos abgebaut. Dänemark verfügt über ein gut ausgebautes allgemeinpsychiatrisches Versorgungssystem mit einer Vielzahl gemeindenaher Ambulanzen, das Angebot inkludiert Case Management und Assertive Community Treatment Teams, wenn notwendig erfolgt auch intensive soziale Unterstützung. Vor allem aber wurden mehr als 2.700 Wohnplätze in sozialpsychiatrischen Einrichtungen, Wohnheimen etc. geschaffen [28]. Insgesamt blieb also die Zahl der „Behandlungsplätze“ 178 in den Jahren 1980 bis 2004 im Wesentlichen unverändert. Allerdings befanden sich 1980 nur 3,6% dieser Plätze in forensisch-psychiatrischen Einrichtungen, 2004 hingegen bereits 20,2%. Hodgins et al. verglichen im Rahmen einer internationalen Verbundstudie 184 aus der Forensik entlassene psychotische Patienten aus Deutschland, Schweden, Finnland und Kanada mit einer gematchten Gruppe von aus der Allgemeinpsychiatrie entlassenen Patienten [23]. Bemerkenswert waren zunächst die Charakteristika der aus der Allgemeinpsychiatrie Entlassenen: Sie hatten im Mittelwert neun stationäre Vorbehandlungen, bei 52,1% bestand komorbider Alkoholismus, bei 42,1% komorbider Drogenmissbrauch, 40,9 % hatten zumindest eine Vorstrafe, 20% zumindest eine Vorstrafe wegen Gewalttätigkeit, bei 30,3% war aus der Vorgeschichte aggressives Verhalten gegen andere Personen bekannt. Zum Zeitpunkt der Entlassung waren die allgemeinpsychiatrischen Patienten in einer eindeutig schlechteren Verfassung. Bei ihnen wurden statistisch signifikant häufiger Positiv-, Negativ- und Threat-Control-Override-Symptome [60] registriert, darüber hinaus hatten sie deutlich niedrigere GAF-Scores [23]. Die Nachuntersuchung beider Gruppen zeigte, dass die aus der Allgemeinpsychiatrie entlassenen Patienten häufiger körperlich gewalttätig waren, als die aus forensischer Behandlung entlassenen, und dass dieser Umstand auf das Vorhandensein (offensichtlich nicht oder nur unzureichend behandelter) psychotischer Symptome zurückzuführen war - dies auch nach Berücksichtigung antisozialer Persönlichkeitsstörungen, komorbidem Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie selbst berichtetem Alkohol- und Drogenkonsum [22; 23]. Nun ist die forensische Psychiatrie nicht das einzige „Asyl“, in welchem sich diese von der modernen Gemeindepsychiatrie zunehmend schlechter versorgten Patienten wiederfinden. Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge ... Soziale Exklusion und Armut bis hin zur Obdachlosigkeit wird nicht mehr ausschließlich als Problem der Slums großer amerikanischer Städte wahrgenommen, sondern vermehrt auch im deutschsprachigen Raum registriert [8; 14; 15; 29; 44]. Eikelmann et al. bemerkten unlängst: „Die klassische sozialpsychiatrische Hypothese, dass soziale Integration automatisch durch Enthospitalisierung geschehe, hat sich ebenso wie die Auffassung überlebt, dass ein Leben in der Gemeinde unterstützt von ambulanten und komplementären Diensten zur Integration führe.“ [9, S. 664]. Als Konsequenz dieser Entwicklung hat sich der seit jeher bestehende Unterschied zwischen den Mortalitätsraten schizophrener Patienten und denen der Allgemeinbevölkerung [4; 20; 37; 65] in den letzten Jahrzehnten noch vergrößert [45]. Es ist verständlich, dass diese Botschaft von den Repräsentantinnen und Repräsentanten der modernen Gemeindepsychiatrie nicht gerne gehört wird. Immer wieder wird die Sorge geäußert, Informationen dieser Art könnten die Intentionen von Antistigmakampagnen konterkarieren und von Seiten der Bevölkerung, der Politiker und der Medien reflexartig zu dem heutzutage immer häufiger zu hörenden Ruf nach mehr Sicherheit - und also restriktiven Maßnahmen gegen sämtliche psychiatrischen Patienten - führen. Nun ist für die Bevölkerung, und gleichermaßen für Politiker und Journalisten, vor allem die Gefährdung der Allgemeinheit von Interesse. Daher ist es von geringerer Bedeutung, ob eine Risikoerhöhung das Zwei-, Fünf- oder gar Zehnfache beträgt, sondern vielmehr, wie groß der Anteil der durch psychotische Patienten „verursachten“ Gewaltkriminalität ist. Einer Untersuchung von Fazel und Grann ist zu entnehmen, dass die „population attributable risk fraction“, also das einer bestimmten Gruppe zuzuschreibende Risiko, für Psychosen etwa fünf Prozent beträgt [13]. Das wäre der Gewinn an öffentlicher Sicherheit unter der Annahme, dass endogene Psychosen - und zwar nicht nur schizophrene Psychosen sondern auch wahnhafte Störungen, akute psychotische Zustandsbilder, manische Episoden, depressive und bipolare affektive Störungen mit psychotischen Symptomen - nicht existierten. Zahlen wie diese sollten geeignet sein, unqualifizierte Rufe nach undifferenzierten restriktiven Maßnahmen verstummen zu lassen. Unter Bezug auf die im Titel genannten Optionen ist abschließend festzustellen, dass die Zunahme der Zahl psychisch kranker Straftäter keineswegs als logische Konsequenz der Psychiatriereformen anzusehen ist. Ein Teil der negativen Entwicklung wäre nach unserer Ansicht wohl vermeidbar gewesen - allerdings nur unter der Voraussetzung eines realitätskonformen und bedürfnisgerechten Umgangs mit der genannten Risikoklientel. Nun mag das Ausmaß der durch diese Patienten entstehenden Probleme zu Beginn der Psychiatriereformen möglicherweise noch nicht vorhersehbar gewesen sein. Angesichts des heutigen Wissensstandes ist diese Erklärung allerdings nicht mehr stichhaltig. Schlussfolgerungen Bei einer Subgruppe psychotischer Patienten bestand bereits vor Beginn der Psychiatriereformen ein erhöhtes Risiko für gewalttätiges Verhalten, das sich vor allem durch eine im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhte Rate schwerer Gewalttaten manifestiert und nicht ausschließlich durch allgemeine kriminogene Faktoren erklärt werden kann. Die Behauptung, die nicht zuletzt durch das erhöhte Gewalttätigkeitsrisiko begründete Sonderstellung der Psychiatrie innerhalb der medizinischen Fächer beruhe ausschließlich auf Vorurteilen, ist daher falsch. Die Psychiatrie hat sehr wohl eine Sonderstellung, da im Gegensatz zu den übrigen medizinischen Fächern im Rahmen 179 ärztlicher Behandlung möglicherweise auftretende Konflikte zwischen Paternalismus und Patientenautonomie bei an schizophrenen Psychosen leidenden Menschen nicht nur die Persönlichkeitszüge der unmittelbar Beteiligten und die herrschende gesellschaftliche Situation abbilden, sondern vor allem auch im Wesen der Krankheit selbst begründet sind [24]. Deshalb wird es im psychiatrischen Alltag unabhängig vom empirischen Wissensstand immer Konfliktsituationen geben, für deren Bewältigung der Rückzug auf die evidenzbasierte Medizin erfahrungsgemäß nicht ausreicht. Hoff fordert in solchen Fällen zu Recht über evidenzbasiertes Vorgehen hinausgehende „verantwortungsvolle Wertentscheidungen“ [24; vergleiche auch 17]. Deren Unterlassung fördert die Verlagerung bestimmter Patienten in forensischpsychiatrische Einrichtungen und ist kontraproduktiv im Hinblick auf die Reputation unseres Faches. Die Autoren bitten insbesondere die Leserinnen um Verständnis dafür, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit im Text die männliche Form (Patienten, Politiker, Ärzte etc.) gewählt wurde. Sie gilt, so nicht gesondert angeführt, für beide Geschlechter. Literatur [1] Ashley M.C.: Outcome of 1000 cases paroled from the Middletown State Hospital. New York State Hospital Quarterly 8, 6-70 (1922). [2] Böker W., Häfner H.: Gewalttaten Geistesgestörter. Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1973. [3] Brennan P.A., Mednick S.A., Hodgins S.: Major mental disorders and criminal violence in a Danish birth cohort. Arch Gen Psychiatry 57, 494-500 (2000). [4] Brown St.: Excess mortality of schizophrenia. A meta-analysis. Br J Psychiatry 171, 502-508 (1997). [5] Bundesministerium für Justiz: Jahres­ bericht 2009. Bundesministerium für Justiz, Wien 2009. H. Schanda, Th. Stompe, G. Ortwein-Swoboda [6] Dönisch-Seidel U., van Treeck B., Geelen A., Siebert M., Rahn E., Scherbaum N., Kutscher S.-U.: Zur Vernetzung von forensischer Psychiatrie und Allgemeinpsychiatrie R & P 25, 183-187 (2007). [7] Dreßing H., Salize H.J.: Compulsory admission of mentally ill patients in European Union Member States. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 39, 797803 (2004). [8] Eikelmann B.: Nach Enquete und PsychPV - Wie steht es um die soziale Integration schizophrener Patienten? Nervenarzt S4, 499 (2008). [9] Eikelmann B., Reker T., Richter D.: Zur sozialen Exklusion psychisch Kranker - Kritische Bilanz und Ausblick der Gemeindepsychiatrie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Fortschr Neurol Psychiat 73, 664-673 (2005). [10] Erb M., Hodgins S., Freese R., MüllerIsberner R., Jöckel D.: Homicide and schizophrenia: Maybe treatment does have a preventive effect. Crim Behav Ment Health 11, 6-26 (2001). [11] Eronen M., Hakola P., Tiihonen J.: Mental disorders and homicidal behavior in Finland. Arch Gen Psychiatry 53, 497-501 (1996). [12] Eronen M., Tiihonen J., Hakola P.: Schizophrenia and homicidal behavior. Schizophr Bull 22, 83-89 (1996). [13] Fazel S., Grann M.: The population impact of severe mental illness on violent crime Am J Psychiatry 63, 1397-1403 (2006). [14] Fichter M.M., Koniarczyk M., Geifenhagen A., Koegel P., Quadflieg N., Wittchen H.U., Wölz J.: Mental illness in a representative sample of homeless men in Munich, Germany. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 246, 185-196 (1996). [15] Fichter M., Quadflieg N.: Three year course and outcome of mental illness in homeless men. A prospective longitudinal study based on a representative sample. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 255, 111-120 (2005). [16] Foregger E., Serini E.: Strafgesetzbuch (StGB). Manz, Wien 1984. [17] Fulford K.W.M., Broome M., Stanghellini G., Thornton T.: Looking with both eyes open: fact and value in psychiatric diagnosis? World Psychiatry 4, 78-86 (2005). [18] Giovannoni J.M., Gurel L.: Socially disruptive behaviour of ex-mental patients. Arch Gen Psychiatry 7, 146-153 (1967). [19] Haller R., Kemmler G., Kocsis E., Maetzler W., Prunnlechner R., Hinterhuber H.: Schizophrenie und Gewalttätigkeit. Ergebnisse einer Gesamterhebung in einem österreichischen Bundesland. Nervenarzt 72, 859-866 (2001). [20] Hiroeh U., Appleby L., Mortensen P.B., Dunn G.: Death by homicide, suicide, and other unnatural causes in people with mental illness. Lancet 358, 21102112 (2001). [21] Hodgins S., Mednick S.A., Brennan P.A., Schulsinger F., Engberg M.: Mental disorder and crime: Evidence from a Danish birth cohort. Arch Gen Psychiatry 53, 486-496 (1996). [22] Hodgins S., Hiscoke U.L., Freese R.: The antecedents of aggressive behavior among men with schizophrenia: a prospective investigation of patients in community treatment. Behav Sci Law 21, 523-546 (2003). [23] Hodgins S., Müller-Isberner R., Allaire J.F.: Attempting to understand the increase in the numbers of forensic beds in Europe: a multi-site study of patients in forensic and general psychiatric services. Int J For Ment Health 5, 173-184 (2006). [24] Hoff P.: Autonomie und psychiatrische Krankheitsmodelle - Die historische und die aktuelle Perspektive. In: Rössler W., Hoff P.: Psychiatrie zwischen Autonomie und Zwang. Springer, Heidelberg 2005, pp 7-25. [25] Jacobi F., Wittchen H.-U., Hölting C., Höfler M., Pfister H., Müller N., Lieb R.: Prevalence, co-morbidity and correlates of mental disorders in the general population: Results from the German General Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychol Med 34, 1-15 (2004). [26] Katschnig H., Denk P., Scherer M.: Österreichischer Psychiatriebericht 2004: Analysen und Daten zur psychiatrischen Versorgung der österreichischen Bevölkerung. Ludwig Boltzmann Institut für Sozialpsychiatrie, Wien 2004. [27] Kramp P.: Schizophrenia and crime in Denmark. Crim Behav Ment Health 14, 231-237 (2004). [28] Kramp P., Gabrielsen G.: Forensic patients in Denmark 1980-2004. 14th AEPCongress, Nice, March 4th-8th, 2006. [29] Kutscher S.-U., Schiffer B., Seifert D.: Schizophrene Patienten im psychiatrischen Maßregelvollzug (§ 63 StGB) Nordrhein-Westfalens. Entwicklungen und Patientencharakteristika. Fortschr Neurol Psychiat 77, 91-96 (2009). [30] Lamb H.R., Bachrach L.L.: Some perspectives on deinstitutionalization. Psychiatr Serv 52, 1039-1045 (2001). [31] Lindqvist P., Allebeck P.: Schizophrenia and crime. A longitudinal follow-up of 644 schizophrenics in Stockholm. Br J Psychiatry 157, 345-350 (1990). [32] Meise U., Hinterhuber H.: Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung - verliert die Psychiatrie? Neuropsychiatrie 12, 177-186 (1998). [33] Modestin J., Ammann R.: Mental disorder and criminality: Male schizophrenia. Schizophr Bull 22, 69-82 (1996). 180 [34] Monahan J.: Mental disorder and violent behavior. Perceptions and evidence. Am Psychologist 47, 511-521 (1992). [35] Monahan J., Steadman H.: Crime and mental illness: an epidemiological approach. In: Morris N., Tonry M.: Crime and Justice, Vol 4. University of Chicago Press, Chicago 1983, pp 145-189. [36] Mullen P.E., Burgess P., Wallace C., Palmer S., Ruschena D.: Community care and criminal offending in schizophrenia. Lancet 355, 614-617 (2000). [37] Ösby U., Correia N., Brandt L., Ekblom A., Sparen P.: Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm County, Sweden. Schizophr Res 45, 2128 (2000). [38] Osterheider M., Dimmek B.: Concepts and procedures in the Member States Germany. In: Salize H.J., Dressing H.: Placement and treatment of mentally disordered offenders - legislation and practice in the European Union. Pabst, Lengerich 2005, pp 225-235. [39] Pollock H.M.: Is the paroled patient a menace to the community? Psychiatr Q 12, 236-244 (1938). [40] Priebe S., Badesconyi A., Fioritti A., Hansson L., Kilian R., Torres-Gonzales F.: Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries. BMJ 330, 123-126 (2005). [41] Rappeport J., Lassen G.: Dangerousness - arrest rate comparisons of discharged patients and the general population. Am J Psychiatry 121, 776-783 (1965). [42] Räsänen P., Tiihonen J., Isohanni M., Rantakallio P., Lehtonen J., Moring J.: Schizophrenia, alcohol abuse and violent behavior: A 26-year follow-up study of an unselected birth cohort. Schizophr Bull 24, 437-440 (1998). [43] Regier D.A., Farmer M.E., Rae D.S., Locke B.Z., Keith S.J., Judd L.L., Goodwin F.K.: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. J Am Med Ass 264, 2511-2518 (1990). [44] Reker T.: Soziale Exklusion bei Patienten einer psychiatrischen Institutsambulanz. Nervenarzt S4, 450 (2008). [45] Saha S., Chant D., McGrath J.: A systematic review of mortality in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 64, 1123-1131 (2007). [46] Salize H.J., Dreßing H.: Epidemiology of involuntary placement of mentally ill people across the European Union. Br J Psychiatry 184, 163-168 (2004). [47] Sanders J., Milne St., Brown Ph., Bell A.J.: Assessment of aggression in psychiatric admissions: semistructured interview and case note survey. BMJ 320, 1112 (2000). Steigende Kriminalität schizophrener Patienten: Fiktion, logische Konsequenz oder vermeidbare Folge ... [48] Schanda H.: Psychiatry reforms and illegal behaviour of the severely mentally ill. Lancet 365:367-369 (2005). [49] Schanda H.: Die aktuelle Psychiatriegesetzgebung in Österreich: Zivil- und Strafrecht aus psychiatrischer Sicht. R& P 23, 159-165 (2005). [50] Schanda H.: Untersuchungen zur Frage des Zusammenhangs zwischen Psychosen und Kriminalität/Gewalttätigkeit: Studiendesigns, methodische Probleme, Ergebnisse. Fortschr Neurol Psychiat 74, 85-100 (2006). [51] Schanda H., Knecht G., Schreinzer D., Stompe T., Ortwein-Swoboda G., Waldhoer T.: Homicide and major mental disorders: a 25-year-study. Acta Psychiatr Scand 110, 98-107 (2004). [52] Schanda H., Stompe T., Ortwein-Swoboda G.: Psychisch Kranke zwischen Psychiatriereform und Justiz: Die Zukunft des österreichischen Maßnahmenvollzugs nach § 21/1 StGB. Neuropsychiatrie 20, 40-49 (2006). [53] Schanda H., Stompe T., Ortwein-Swoboda G.: Psychiatry reforms and increasing criminal behavior of the severely mentally ill: Any link? Int J For Ment Health 8, 105-114 (2009). [54] Schanda H., Stompe T., Ortwein-Swoboda G.: Dangerous or merely ’difficult’? The new population of forensic mental hospitals. Eur Psychiatry 24, 365-372 (2009). [55] Schmidt-Quernheim F.: Kommunizierende Röhren - Vom schwierigen Ver­hält­nis von Sozialpsychiatrie und Maßregelvollzug. Psychiatr Prax 34, 218-222 (2007). [56] Seifert D.: Kriminalprognose - gibt es auch Anwendungsmöglichkeiten für die Allgemeinpsychiatrie? 5. Hanse­ symposium, Rostock-Warne­münde, 24.25. August 2007. [57] Simpson A.I.F., McKenna B., Moskowitz A., Skipworth J., Barry-Walsh J.: Homicide and mental illness in New Zealand, 1970-2000. Br J Psychiatry 185, 394-398 (2004). [58] Spießl H., Binder H., Mache W., Osterheider M., Cording C.: Psychiatrische Regelversorgung und Maßregelvollzug: Gibt es Wechsel­ wirkungen? Nervenarzt (Suppl. 1), 294 (2005). [59] Statistik Austria.: Gerichtliche Kriminalstatistik Österreichs 1975-2007. Statistik Austria, Wien 2008. [60] Stompe T., Ortwein-Swoboda G., Schanda H.: Schizophrenia, delusional symptoms and violence: the threat/control-override-concept re-examined. Schizophr Bull 30, 31-44 (2004). [61] Talbott, J.A.: Deinstitutionalization: Avoiding the disasters of the past. Hosp Community Psychiatry 30, 621-624 (1979). Reprint in: Psychiatr Serv 55, 1112-1115 (2004). [62] Talbott J.: Care of the chronically mentally - still a national disgrace. Am J Psychiatry 136, 688-689 (1979). Reprint in: Psychiatr Serv 55, 1116-1117 (2004). [63] Taylor P.J., Gunn J.: Homicides by people with mental illness: myth and reality. Br J Psychiatry 174, 9-14 (1999). [64] Tiihonen J., Isohanni M., Räsänen P., Koiranen M., Moring J.: Specific mental disorders and criminality: A 26-year prospective study of the 1966 Northern Finland Birth Cohort. Am J Psychiatry 154, 840-845 (1997). [65] Tiihonen J., Wahlbeck K., Lönnqvist J., Klaukka T., Ioannidis J.P.A., Volavka J., Haukka J.: Effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of patients in community care after first hospitalisation due to schizophrenia and schizoaffective disorder: observational 181 follow-up study. BMJ 333, 224-227 (2006). [66] Volkow N.D.: Substance use disorders in schizophrenia - clinical implications of comorbidity. Schizophr Bull 35, 469472 (2009). [67] Wallace C., Mullen P., Burgess P., Palmer S., Ruschena D., Browne Ch.: Serious criminal offending and mental disorder. Case linkage study. Br J Psychiatry 172, 477-484 (1998). [68] Walsh E., Gilvarry C., Samele Ch., Harvey K., Manley C., Tyrer P., Creed F., Murray R., Fahy Th.: Reducing violence in severe mental illness: randomized controlled trial of intensive case management compared with standard care. BMJ 323, 1-5 (2001). [69] Weithmann G., Traub H.-J.: Die psychiatrische Vorgeschichte schizophrener Maßregelpatienten - Rahmenbedingungen der Deliktprävention durch die Allgemeinpsychiatrie. Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2, 112-119 (2008). Univ.-Prof. Dr. Hans Schanda Justizanstalt Göllersdorf [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 182–189 Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels Camberwell Assessment of Need (CANE) for the Elderly Gerda Kaiser, Annemarie Unger, Barbara Marquart, Maria Weiss, Marion Freidl und Johannes Wancata Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien Schlüsselwörter: Demenz – Angehörige – Bedarf interne Konsistenz des CANE ist zufrieden stellend. Key words: Dementia – caregivers – needs Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels Camberwell Assessment of Need (CANE) for the Elderly Anliegen: Ziel war eine Bedarfserhebung bei Demenzkranken mittels der deutschsprachigen Version des Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) und eine Prüfung der internen Konsistenz dieses Instrumentes. Methode: Eine Stichprobe von 45 Demenzkranken wurde mittels des CANE untersucht, wobei die Daten aus Sicht der Angehörigen erfasst wurden. Ergebnisse: Die meisten Demenzkranken hatten in zahlreichen Bereichen Probleme, wobei die Kranken durchwegs aus dem privaten Umfeld mehr Hilfen als von professionellen Diensten erhielten. Die Werte für die interne Konsistenz lagen zwischen 0,797 und 0,900 (Cronbach’s Alpha). Schlussfolgerungen: Die große Zahl der Probleme zeigt die Wichtigkeit einer langfristigen Planung der Versorgungsangebote für Demenzkranke auf. Die © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 The German language version of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) among dementia patients Objective: The purpose of the present study was to assess the needs of dementia patients using the German language version of the Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) and to investigate the internal consistency of German language. Methods: A sample of 45 dementia patients was investigated using the German CANE. Data were collected from family caregivers. Results: Most dementia patients showed a multitude of problems. In most cases, support was provided more frequently from informal caregivers than from social or medical services. Internal consistency ranged between 0.797 and 0.900 (Cronbach’s Alpha). Conclusions: The high frequency of problems indicates the importance of long-term planning of services for dementia patients. The internal consistency of the German CANE was sufficiently high. Einleitung Demenzerkrankungen gehen unweigerlich mit einer umfassenden Pflegebedürftigkeit einher [28, 32]. Die aus der Pflege resultierenden Kosten stellen eine gesundheitsökonomische Herausforderung dar. In unserer alternden, einem demographischen Wandel ausgesetzten Gesellschaft spielen Demenzerkrankungen somit eine immer größere Rolle. 1951 betrug die Anzahl an Demenzkranken in Österreich 35500. Bis zum Jahr 2050 soll die Anzahl Demenzkranker auf etwa 233800 ansteigen [30]. Auch wenn gerade in den letzten Jahren versucht wird, die Diagnostik zur frühzeitigen Behandlung zu verbessern, ist nicht absehbar, dass diese Maßnahmen einen geringeren Anstieg an Kranken zur Folge hätten [3, 4, 8, 13, 24]. Diese drastische Zunahme spricht für die besondere Bedeutung der Erfassung von Beeinträchtigungen und Alltagseinschränkungen von Patienten mit Demenzerkrankungen [23]. Demenzkranke leiden häufig auch unter zahlreichen somatischen Erkrankungen. Die Patienten benötigen aufgrund der Beeinträchtigungen und Alltagseinschränkungen eine Vielzahl von allgemeinen (Körperpflege, finanzielle Situation, Wohnverhältnisse, tägliche Aktivitäten) aber auch spezifischen (Medikamente, Unterstützung bei psychotischen Symptomen, Information der Angehörigen) Hilfeleistungen, die in zahlreichen Studien untersucht worden sind [11, 22]. Diese Hilfeleistungen gehören zum Standard der Behandlung von Demenzpatienten [21]. Sowohl im klinischen Alltag als auch für Zwecke der Versorgungsplanung Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels dem CANE werden heute Erhebungsinstrumente zur Erfassung des Bedarfs der Kranken als auch der Deckung dieses Bedarfs vorgeschlagen [10, 14]. In Großbritannien wurde aufgrund der komplexen Problematik älterer psychiatrisch Kranker ein gerontopsychiatrisches Bedarfserhebungsinstrument, das „Camberwell Assessment of Need for the Elderly“ (CANE [18]), entwickelt. Das CANE basiert auf dem Camberwell Assessment of Need (CAN [17]), das für jüngere schwer psychisch Kranke entwickelt wurde. Das CANE wurde speziell für gerontopsychiatrische Patienten im extra- und intramuralen Bereich, einschließlich jener, die an einer Demenz erkrankt sind, entwickelt. Das CANE [18] erfasst 24 Problembereiche (psychiatrische Symptome und Alltagseinschränkungen) bei Personen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Dieses Erhebungsinstrument kann aus Sicht verschiedener Berufsgruppen (z.B. Mediziner, Pflegepersonen), aus Sicht der Angehörigen, aus Sicht von Interviewern für wissenschaftliche Zwecke und aus Sicht der Erkrankten selbst ausgefüllt werden. Es ist relativ einfach zu handhaben und in ca. 30 Minuten auszufüllen. Zur Entwicklung des CANE in Groß­ britannien wurden anfangs Fokusgruppen verwendet, an denen Personen aus der Zielgruppe der Anwender (Patienten) und der Zielgruppe von im gerontopsychiatrischen Bereich arbeitenden Fachleuten teilnahmen. Eine Pilotstudie mit diesem Instrumententwurf wurde bei 70 gerontopsychiatrischen Patienten durchgeführt. Dieser Entwurf wurde in der Folge mit Hilfe eines modifizierten Delphi-Prozesses optimiert: Nach der Pilotstudie wurde der Instrumententwurf Patienten, Angehörigen und Fachleuten aus dem gerontopsychiatrischen Bereich zur Beurteilung der Wichtigkeit der Problembereiche und zur Erhebung möglicher zusätzlicher Problembereiche vorgelegt. Aufgrund deren Einschätzungen wurde ein weiterer Instrumententwurf erarbeitet und in einer Konsensus-Konferenz weiterentwickelt. Eine weitere Pilotstudie wurde an einer gerontopsychiatrischen Tagesklinik mit 10 Patienten und deren Angehörigen sowie den betreuenden Fachleuten durchgeführt. Geringfügige Veränderungen im Bereich der Fragestellungen und der Reihung der Problembereiche und eine damit verbundene Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit konnte erreicht werden. Zur Prüfung der Concurrent-Validity wurden der General Health Questionnaire (12 Items), der Barthel Activities of Daily Living Index, das Medical Outcomes Study-Instrument (MOS), der SF-36 und die Behaviour Rating Scale der Clifton Assessment Procedures for the Elderly (CAPEBRS) verwendet. Die Validität und Reliabilität des CANE wurde in Zentren in Schweden, England, Wales und den USA bestätigt. Vor einigen Jahren wurde das CANE von einer bundesdeutschen Arbeitsgruppe auf Deutsch übersetzt [2]. Von der deutschsprachigen Version gibt es bislang noch keine Daten zur Reliabilität der einzelnen Items des CANE zueinander und der Gesamtheit der übrigen Items (interne Konsistenz oder Inter-Item-Reliabilität). Ziel dieser Untersuchung war eine Bedarfserhebung bei Demenzkranken mittels des CANE und eine Untersuchung der internen Konsistenz der verschiedenen Skalen des CANE. Methodik Stichprobe Die zu untersuchende Stichprobe bestand aus 45 Demenzkranken, die an einer Studie zur Testung der Reliabilität des „Carers’ Needs Assessment for Dementia“ teilnahmen [10, 31]. Es wurden Patienten mit der Diagnose Demenz (ICD-10: F00-F03; [33]) eingeschlossen, falls Kranke und Angehörige im gleichen Haushalt lebten oder mehrmals pro Woche in persönlichen Kontakt standen. Es wurde da- 183 bei jener Angehörige eingeschlossen, der den meisten Kontakt zum Kranken hatte. Es wurden sowohl Kranke erfasst, die zum Zeitpunkt der Untersuchung in häuslicher Umgebung oder in Heimen lebten, um Kranke und Angehörige in unterschiedlichen Stadien der Akuität, in unterschiedlichen Behandlungssituationen und mit unterschiedlicher Krankheitsdauer zu erfassen. Erhebungsinstrumente Für diese Untersuchung wurde die deutsche Übersetzung des CANE [2] verwendet. Das Forschungsinterview beinhaltet 24 Problembereiche die Patienten betreffend. Die beiden zusätzlichen Problembereiche die Angehörigen betreffend wurden in der vorliegenden Studie nicht verwendet. Die Ausprägung der Problembereiche wird mit Hilfe einer 3-stufigen Skala (0 = keine Probleme, 1 = keine / geringe Probleme, da Hilfe vorhanden, 2 = ernste Probleme) bewertet. Wenn ernste Probleme vorhanden sind, werden auch die weiteren Fragen zu jedem Problembereich betreffend die erhaltenen bzw. benötigten Hilfen sowie zur Angemessenheit der Art und zur Zufriedenheit mit dem Ausmaß der Hilfen erfasst. Die Häufigkeit der von Freunden oder Angehörigen oder örtlichen Hilfsdiensten erhaltenen oder benötigten Hilfe wird mittels 4-stufiger Skalen (0 = keine, 1 = wenig Hilfe, 2 = mittlere Hilfe, 3 = viel Hilfe) bewertet. Die Angemessenheit der erhaltenen Hilfe wird durch die Bewertung „angemessen / nicht angemessen“, die Zufriedenheit mit der erhaltenen Hilfe mit „zufrieden / nicht zufrieden“ erfasst. Die Daten können mittels des CANE prinzipiell aus Sicht der professionellen Betreuer, aus Sicht der Kranken selbst (sofern die kognitiven Fähigkeiten dies zulassen), aus Sicht der Angehörigen und aus Sicht von z.B. Forschern erfasst werden [16]. Da in die Studie ausschließlich Demenzkranke (MMSE weniger als 18) eingeschlossen wurden, war eine Be- G. Kaiser et al. fragung der Kranken selbst nicht zielführend. Da viele der Kranken keine professionelle Betreuung hatten, kam die Möglichkeit der Datenerhebung beim professionellen Betreuer auch nicht in Frage. Daher wurden die Daten aus der Sicht der Angehörigen erfasst. Die Studie war von der Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien geprüft worden. Statistik Die statistischen Auswertungen erfolgten mittels des Superior Performing Software System (SPSS Inc.). Die Ergebnisse des CANE wurden zuerst mittels Häufigkeitsauswertungen dargestellt. Anschließend wurden Summenbildungen aus den sechs Einzelbeurteilungen jeweils über alle Problembereiche hinweg vorgenommen (Häufigkeit des Vorkommens der Probleme; Ausmaß, in dem der Kranke Hilfen von Freunden oder Verwandten erhält; Ausmaß, in dem der Kranke Hilfe von Hilfsdiensten erhält, Ausmaß, in dem der Kranke Hilfe von Hilfsdiensten benötigt; Einschätzung des Angehörigen über die Angemessenheit der erhaltenen Hilfen; Zufriedenheit des Angehörigen mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfen). Zur Beschreibung der Stichprobe und der Ergebnisse des CANE wurden deskriptiv-statistische Verfahren verwendet. Die interne Konsistenz der Summenscores wurde mittels Cronbach’s alpha untersucht [5]. Da ein Zusammenhang der erwähnten Summenscores nicht a priori ausgeschlossen werden kann, wurden alle Summenscores miteinander korreliert. Da Normalverteilung nicht zu erwarten war, wurde diese Korrelationen mittels Spearman’s Rho berechnet [5]. Ergebnisse Beschreibung der Stichprobe Zwei Drittel der Patienten waren Männer mit einem mittleren Alter von 184 77,5 Jahren. Die Hälfte der Patienten war verheiratet, circa 40 % waren verwitwet. Knapp zwei Drittel der Patienten lebten in einem Privathaushalt, der Rest in Institutionen. Über 80% der Patienten hatte die Diagnose „Demenz vom Alzheimer-Typ“ erhalten, nur 13% litten unter einer vaskulären Demenz. Die mittlere Krankheitsdauer betrug knapp 6 Jahre. Fast drei Viertel der in die Untersuchung eingeschlossenen betreuenden Angehörigen waren Frauen. Das mittlere Alter der befragten Angehörigen betrug 61 Jahre. Etwa 45% der Angehörigen waren Partner der Kranken und über der Hälfte Kinder der Kranken (41% Töchter). Nur 16,3% der Angehörigen standen im Berufsleben, mehr als die Hälfte der Angehörigen bezeichnete sich als Hausmann/Hausfrau. Fast die Hälfte der Angehörigen lebte im gleichen Haushalt mit dem Patienten. 75 % der Angehörigen hatten mehr als 10 Stunden pro Woche Kontakt mit dem Patienten. Bedarf erfasst mittels CANE Die mittels des CANE berichteten Häufigkeiten sind in Tabelle 1 dargestellt. 93,1% der Angehörigen gaben an, dass ihre Pfleglinge ernste Probleme mit dem Gedächtnis und Erinnerungsvermögen aufwiesen. (Diejenigen Personen, die laut Angaben der Angehörigen „keine Probleme mit dem Gedächtnis und Erinnerungsvermögen“ angaben, zeigten in einer separaten Testung MMSE-Scores von weniger als 18, also deutliche kognitive Einschränkungen.) Zu den weiteren Problemen, die von mehr als zwei Drittel genannt wurden, zählten Führen des Haushaltes (66,7%), Ernährung (79,6%), Körperpflege (77,8%), soziale Kontakte (75,9%) und die finanzielle Situation (68,9%). Bei keinem einzigen Kranken wurden Probleme bezüglich Alkohols und bezüglich „persönlicher Unversehrtheit“ (d.h. Erfahrung von Gewalt oder Misshandlung) angegeben. Falls Probleme vorhanden waren, wurde erfasst, in welchem Ausmaß Hilfen aus dem privaten Umfeld („informelle“) oder von sozialen oder medizinischen Diensten („formelle“) erhalten bzw. benötigt wurden. Von jenen, die Probleme berichtet hatten, gaben in jedem Problembereich mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die Kranken aus dem privaten Umfeld Hilfen erhielten. Bei zwei Problembereichen (Eigengefährdung, psychischer Stress) erhielten alle Kranken Hilfen von Angehörigen oder Freunden. Im Gegensatz dazu berichtete bei den meisten Problembereichen weniger als die Hälfte, dass sie „formelle“ Hilfen von Hilfsdiensten erhielten. Nur in den Bereichen Wohnverhältnisse, tägliche Aktivitäten, Mobilität, Kontinenz, körperliche Gesundheit, psychotische Symptome und soziale Kontakte erhielten mehr als die Hälfte auch „formelle“ Hilfen. Beim Großteil der Problembereiche war die Häufigkeit der benötigten „formellen“ Hilfen größer als die Häufigkeit der erhaltenen „formellen“ Hilfen. Ausschließlich bezüglich der finanziellen Situation wurden „formelle“ Hilfen geringfügig häufiger erhalten als benötigt. Bei den meisten Problemen war der allergrößte Teil (mehr als 80% jener, die Probleme hatten) mit dem Ausmaß und der Art der erhaltenen Hilfen zufrieden. Nur bei Problemen mit dem Sehvermögen, mit psychotischen Symptomen und finanzieller Unterstützung waren weniger als 80% mit dem Ausmaß oder der Art der erhaltenen Hilfen zufrieden. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Summenscores der sechs Einzelbeurteilungen dargestellt. Die meisten dieser Summenscores zeigen eine signifikante positive Korrelation miteinander (Tabelle 3). Ausschließlich das Ausmaß der erhaltenen informellen Hilfen zeigte keinen signifikanten Zusammenhang mit dem Ausmaß der erhaltenen und benötigten formellen Hilfen. Die Werte für die interne Konsistenz der sechs Sum- Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels dem CANE 185 Falls Probleme vorhanden waren: Vorhandensein von Problemen Ausmaß der erhaltenen informellen Hilfen Ausmaß der erhaltenen formellen Hilfen Ausmaß der benötigten formellen Hilfen Art der Hilfen angemessen Mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfen zufrieden (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1. Wohnverhältnisse 22,2 80,0 50,0 66,6 88,9 88,9 2. Führen des Haushaltes 66,7 71,4 35,7 63,0 92,3 85,2 3. Ernährung 79,6 79,4 47,0 57,6 100,0 94,1 4. Körperpflege 77,8 63,6 45,4 65,7 90,6 93,9 5. Mitversorgen eines Angehörigen 18,6 71,4 14,3 14,3 100,0 100,0 6. Tägliche Aktivitäten 62,2 75,0 60,7 77,8 92,9 89,3 7. Gedächtnis/Erinnerungsvermögen 93,1 75,0 48,7 60,0 92,1 90,2 8. Sehvermögen 34,9 60,0 20,0 40,0 84,6 73,3 9. Mobilität 55,5 68,0 60,0 70,9 91,7 92,0 10. Kontinenz 60,0 55,5 55,5 62,9 96,2 96,3 11. körperliche Gesundheit 41,5 53,1 53,0 58,9 100,0 100,0 12. Medikamente 27,3 75,0 33,3 33,3 100,0 100,0 13. Psychotische Symptome 29,6 69,3 61,6 69,2 76,9 76,9 14. Psychischer Stress 28,5 100,0 27,3 41,6 100,0 100,0 15. Gesundheitszustand 17,5 66,7 33,3 50,0 100,0 83,3 16. Eigengefährdung 16,3 100,0 42,9 57,1 100,0 100,0 17. unbeabsichtigte Selbstschädigung 52,3 73,9 43,4 59,1 100,0 95,7 18. persönliche Unversehrtheit 0,0 -- * -- * -- * -- * -- * 19. Verhalten 17,8 75,0 25,0 25,0 100,0 100,0 20. Alkohol 0,0 -- * -- * -- * -- * -- * 21. soziale Kontakte 75,0 91,0 54,5 66,7 96,9 90,0 22. Partnerbeziehung 23,3 60,0 10,0 10,0 80,0 80,0 23. finanzielle Situation 68,9 90,3 42,0 38,8 100,0 100,0 24. finanzielle Unterstützung 44,5 85,0 35,5 70,0 60,0 65,0 Problembereich (Nummer des Bereichs) * Da in diesen Bereichen keine Probleme angegeben wurden, konnten keine Auswertungen der weiteren Aspekte (benötigte bzw. erhaltene Hilfen, Angemessenheit der und Zufriedenheit mit den erhaltenen Hilfen) durchgeführt werden. Tabelle 1: Häufigkeit aller Beurteilungen zu den 24 Problembereichen des CANE G. Kaiser et al. 186 Mittelwert Std.-Abw. Vorhandensein von Problemen 15,16 7,28 Ausmaß der erhaltenen informellen Hilfen 22,37 13,00 Ausmaß der erhaltenen formellen Hilfen 13,31 13,83 Ausmaß der benötigten formellen Hilfen 15,93 12,84 Angemessenheit der Art der Hilfen 8,85 4,46 Zufriedenheit mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfen 8,92 4,32 Tabelle 2: Summenbildungen über alle Problembereiche Vorhandensein von Problemen Rho p Ausmaß der erhaltenen informellen Hilfen Rho p Ausmaß der erhaltenen formellen Hilfen Rho p Ausmaß der benötigten formellen Hilfen Rho p Art der Hilfen angemessen Rho p Mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfen zufrieden Rho p Vorhandensein von Problemen Ausmaß der erhaltenen informellen Hilfen Ausmaß der erhaltenen formellen Hilfen Ausmaß der benötigten formellen Hilfen Art der Hilfen angemessen Mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfen zufrieden -- 0,586 0,000 0,498 0,001 0,584 0,000 0,836 0,000 0,849 0,000 -- -0,158 0,331 -0,060 0,713 0,708 0,000 0,703 0,000 -- 0,915 0,000 0,345 0,029 0,328 0,042 -- 0,337 0,034 0,329 0,041 -- 0,987 0,000 -- Tabelle 3: Spearman-Korrelation der Summenbildungen aus den 6 Einzelbeurteilungen über alle CANE-Problembereiche (Korrelations-Koeffizient Rho) Cronbach's Alpha Vorhandensein von Problemen 0,804 Ausmaß der erhaltenen informellen Hilfen 0,849 Ausmaß der erhaltenen formellen Hilfen 0,900 Ausmaß der benötigten formellen Hilfen 0,862 Angemessenheit der Art der Hilfen 0,813 Zufriedenheit mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfen 0,797 Tabelle 4: Interne Konsistenz Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels dem CANE menscores lagen zwischen 0,797 und 0,900 (Cronbach’s Alpha). Diskussion Die in der vorliegenden Studie Untersuchten zeigten eine ganze Reihe von relevanten Problemen, wie Schwierigkeiten mit dem Führen des Haushaltes, der Ernährung, der Körperpflege oder der finanziellen Situation. In nur zwei untersuchten Bereichen wurden keine Probleme genannt: Alkoholmissbrauch und persönliche Unversehrtheit (z.B. Misshandlung der Kranken). Bei der Interpretation der Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Daten aus Sicht der Angehörigen und nicht der Kranken selbst erfasst wurden. Es ist davon auszugehen, dass selbst bei intensiver Befragung von Angehörigen gewisse Themen tabuisiert bleiben und somit Aussagen z.B. zu Fragen der persönlichen Unversehrtheit und Alkohol möglicherweise zu keinen wahrheitsgetreuen Ergebnissen führten. Zum Problembereich der persönlichen Unversehrtheit zählen nicht nur offensichtliche Gewaltanwendung sondern auch Vernachlässigung durch überforderte Pflegekräfte oder überforderte Angehörige [34] im Sinne von nicht durchgeführten pflegerischen Maßnahmen in Institutionen aber auch in der Hauskrankenpflege, wie zum Beispiel fehlende Zeit für das Füttern der Kranken. (So erleichtern beispielsweise parenterale Ernährung oder Sondenernährung den Pflegebetrieb, auch wenn die Kranken noch selbstständig schlucken könnten.) Bezüglich der negativen Antworten über Alkoholmissbrauch mag das Stigma dieser Erkrankung eine Rolle spielen. Es fällt auf, dass die Pflegebedürftigen in weit höherem Maß Hilfe von ihren Angehörigen und Freunden Unterstützung („informelle Hilfen“) bekamen als von örtlichen Hilfsdiensten („formelle Hilfen“), was möglicherweise mit der Problematik des zeit- lich gebundenen Systems der Heimhilfen in der Hauskrankenpflege, die noch finanziell leistbar sind, und dem großen Anteil an Betreuungsarbeit der Angehörigen und Freunde, die in Institutionen geleistet wird, zusammenhängt. Überraschend ist auch die hohe Zufriedenheit mit dem Ausmaß und der Art der erhaltenen Hilfen, was möglicherweise durch eine niedrige Erwartungshaltung und Resignation der Angehörigen erklärbar ist. Die Werte für die interne Konsistenz der sechs Summenscores waren sehr zufriedenstellend, was darauf hinweist, dass die mit diesen Scores gemessenen Inhalte in sich konsistent sind. Einschränkend muss man aber anmerken, dass diese Ergebnisse nur auf Demenzkranke zutreffen. Neben Demenzen sind jedoch eine Reihe weiterer psychiatrischer Krankheitsbilder wie beispielsweise Depressionen bei älteren Menschen von Bedeutung [1, 6, 7, 15, 25]. Die sechs Summenscores zeigen in zahlreichen Bereichen hohe positive Korrelationen zueinander. Das könnte ein Indikator dafür sein, dass die mittels der Summenscores erfassten Inhalte nicht unabhängig voneinander sind. Da das Vorhandensein von Problemen die Voraussetzung für einen Bedarf und die Inanspruchnahme von Hilfen ist, überraschen die positiven Korrelationen nicht. Das Ausmaß der von professionellen Diensten erhaltenen Hilfen korreliert hoch positiv mit den von professionellen Diensten benötigten Hilfen. Dies könnte darauf hinweisen, dass von professionellen Diensten in weiten Bereichen genau jene Hilfen angeboten werden, die benötigt werden. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die befragten Angehörigen über jegliche professionelle Hilfe und die daraus resultierende Entlastung so froh waren, dass sie bei erhaltenen Hilfen zumeist auch angaben, dass hier ein Bedarf gegeben ist. Das Ausmaß der von professionellen Diensten erhaltenen und benötigten Hilfen zeigt keinen Zusammenhang mit dem Ausmaß der vom privaten Umfeld er- 187 haltenen Hilfen. Es könnte sein, dass die Art der Hilfen, die von professionellen Diensten in einigen Bereichen völlig unterschiedlich von jenen sind, die aus dem privaten Umfeld angeboten werden können (z.B. bei Schwierigkeiten aufgrund einer depressiven Symptomatik tägliche Aktivitäten durchzuführen, wird ein Arzt ein Antidepressivum verschreiben und ein Angehöriger den Kranken bezüglich täglicher Aktivitäten unterstützen). Die Beschreibung der Einschätzung der Angehörigen über die Angemessenheit der erhaltenen Hilfe und die Beschreibung der Zufriedenheit mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfe entsprechen einander weitgehend, da mit diesen Fragen bis zu einem gewissen Ausmaß ähnliche Informationen erfasst wurden. Ein Grund der hohen Übereinstimmung in diesen Bereichen könnte in einer möglicherweise missverständlichen Interviewanleitung liegen. Obwohl inhaltlich etwas unterschiedlich, drängt sich die Frage auf, ob die getrennte Erhebung der beiden Bereiche wirklich sinnvoll möglich ist. Die große Zahl berichteter Probleme weist auf die Wichtigkeit der strukturierten Erfassung derartiger Probleme im klinischen Alltag hin. Angesichts der zunehmenden Zahl Demenzkranker zeigen die Ergebnisse auch die Bedeutung einer langfristigen Planung der Versorgungsangebote, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die psychiatrischen Versorgungsstrukturen einem ständigen Wandel unterworfen sind [9, 19, 20]. Für die Planung der Versorgung ist es aber genauso wie bei anderen psychischen Krankheiten notwendig, die Probleme und Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen zu berücksichtigen [12, 27, 29]. Wenn die Kranken und deren Angehörige im häuslichen Umfeld nicht ausreichend Hilfen und Unterstützung erhalten, wird eine deutliche Zunahme des Bedarfs an Pflegeheimplätzen die Folge sein [26]. G. Kaiser et al. 188 Literatur [1] Castro-Costa E., Dewey M., Stewart R., Banerjee S., Huppert F., Mendonca-Lima C., Bula C., Reisches F., Wancata J., Ritchie K., Tsolaki M., Mateos R., Prince M.: Prevalence of depressive symptoms and syndromes in ten European countries - the SHARE study. British Journal of Psychiatry 191, 393-401 (2007) [2] Dech H., Machleidt W.: Relevance and applicability of the CANE in the Germa health care system. In: Orrell M., Hancock G.: The Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE). Gaskell: London 2004, 29-34 [3] Defrancesco M., Marksteiner J., E Deisenhammer. A., Hinterhuber H., Weiss E. M.: Zusammenhang zwischen Mild Cognitive Impairment (MCI) und Depression. Neuropsychiatrie 23, 144–150 (2009) [4] Donath C., Gräßel E., Großfeld-Schmitz M., Haag C., Kornhuber J., Neubauer S.: Diagnostik und Therapie von Demenzerkrankungen in der hausärztlichen Praxis: ein Stadt-Land-Vergleich. Psychiatrische Praxis 35, 142-145 (2008) [5] Feinstein A.R.: Principles of medical statistics. Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton 2002 [6] Glaesmer H., Gunzelmann T., Martin A., Brähler E., Rief W.: Die Bedeutung psychischer Beschwerden für die medizinische Inanspruchnahme und das Krankheitsverhalten Älterer. Psychiatrische Praxis 35, 187-193 (2008) [7] Gräßel E., Bleich S., Meyer−Wegener K., Schmid U., Kornhuber J., Prokosch H.-U.: Gerontopsychiatrie versus Allgemeinpsychiatrie bei stationärer Behandlung von Depressionen im höheren Lebensalter. Psychiatrische Praxis 36, 115-118 (2009) [8] Grünberger J., Prause W., Frottier P., Stöhr H., Saletu B., Haushofer M., Rainer M.: Der Rezeptortest bei der Pupillometrie als Methode zur Differenzierung des dementiellen Syndroms. Neuropsychiatrie 23, 52–57 (2009) [9] Hübner-Liebermann B., Hajak G., Spießl H.: Versorgungsepidemiologie: Entwicklung in der stationär-psychiatrischen Versorgung 1996–2006. Psychiatrische Praxis 35, 387-391 (2008) [10] Kaiser G., Krautgartner M., Alexandrowicz R., Unger A., Marquart B., Weiss M., Wancata J.: Die Übereinstimmungsvalidität des „Carers’ Needs Assessment for Dementia” (CNA-D). Neuropsychiatrie 19, 134-140 (2005) [11] Kerer M., Marksteiner J., Hinterhuber H., Mazzola G., Steinberg R., Weiss E. M.: Demenz und Musik. Neuropsychiatrie 23, 1-3 (2009) [12] Krautgartner M., Unger A., Friedrich F., Stelzig-Schöler R., Rittmannsberger H., [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] Simhandl C., Grill W., Doby D., Wancata J.: Risiken für Depressivität bei den Angehörigen Schizophrenie-Kranker. Neuropsychiatrie 19, 148-154 (2005) Luck T., Busse A., Hensel A., Angermeyer M.C., Riedel-Heller S.G.: Leichte kognitive Beeinträchtigungen und Demenzentwicklung. Psychiatrische Praxis 35, 331-336 (2008) McWalter G., Toner H., McWalter A., Eastwood J., Marshall M., Turvey T.: A community needs assessment: the care needs assessment pack for dementia (CarenapD) – its development, reliability and validity. International Journal of Geriatric Psychiatry 13, 16-22 (1998) Neuner T., Schmid R., Hübner-Liebermann B., Felber W., Wolfersdorf M., Spießl H.: Suizidales Verhalten stationä r−psychiatrischer Patienten im höheren Lebensalter - Prävalenz und Risikofaktoren. Psychiatrische Praxis 36, 225-231 (2009) Orrell M., Hancock G.: The Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE). Gaskell, London 2004 Phelan M., Slade M., Thornicroft G., Dunn G., Wykes T., Strathdee G., Loftus L., McCrone P., Hayward P.: The Camberwell Assessment of Need: the validity and reliability of an instrument to assess the needs of people with severe mental illness. British Journal of Psychiatry 167, 589-595 (1995) Reynolds T., Thornicroft G., Abas M., Woods B., Hoe J., Leese M., Orrell M.: Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE), development, validity, reliability. British Journal of Psychiatry 176, 444-452 (2000) Rittmannsberger H., Sartorius N., Brad M., Burtera V., Capraru N., Cernak P., Dernovcek M., Dobrin I., Frater R., Hasto J., Hategan M., Haushofer M., Kafka J., Kasper S., Macrea R., Nabelek L., Nawka P., Novotny V., Platz T., Pojar A., Silberbauer C., Fekete S., Wancata J., Windhager E., Zapotoczky H.-G., Zöchling R.: Changing aspects of psychiatric inpatient treatment: a census investigation in five European countries. European Psychiatry 19, 483-488 (2004) Roick C., Heinrich S., Deister A., Zeichner D., Birker T., Heider D., Schomerus G., Angermeyer M.C., König H.-H.: Das Regionale Psychiatriebudget: Kosten und Effekte eines neuen sektorübergreifenden Finanzierungsmodells für die psychiatrische Versorgung. Psychiatrische Praxis 35, 279-285 (2008) Schmidt R., Neff F., Lampl C., Benke T., Anditsch T., Bancher C., Dal-Bianco P., Reisecker F., Marksteiner J., Rainer M., Kapeller P., Dodel R.: Therapie der Alzheimer Demenz: Derzeitiger Stand und zukünftige Entwicklung. Neuropsychiatrie 22, 153–171 (2008) [22] Schmidt R., Alf C., Bancher Ch., Benke Th., Berek K., Dal-Bianco P., Führwürth G., Imarhiagbe D., Jagsch Ch., Lechner A., Rainer M., Reisecker F., Rotaru J., Uranüs M., Walter A., Winkler A., Wuschitz A.: Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich: eine naturalistische Studie an 103 PatientInnen mit Alzheimer Demenz. Neuropsychiatrie 23, 58–63 (2009) [23] Schneider J., Murray J., Banerjee S., Mann A., Wancata J., Windhaber H., Friedmann A., Fischer P., Kolde K., Rainer M., Wuschitz A., Roelands M., Kragh-Sorensen P., Hansen E., Sulkava R. et al.: EUROCARE: a cross-national study of co-resident spouse carers for people with Alzheimer's disease: 1 - factors associated with carer burden. International Journal of Geriatric Psychiatry 14, 651-661 (1999) [24] Schwalen S., Förstl H.: Sechs Fragen zur Alzheimer Demenz: Wissen und Einstellung in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. Neuropsychiatrie 22, 35–37 (2008) [25] Sielk M., Altiner A., Janssen B., Becker N., Pilar de Pilars M., Abholz H.-H.: Prävalenz und Diagnostik depressiver Störungen in der Allgemeinarztpraxis: Ein kritischer Vergleich zwischen PHQ−D und hausärztlicher Einschätzung. Psychiatrische Praxis 36, 169-174 (2009) [26] Thomas P., Ingrand P., Calloue F., Hazif-Thomas C., Billon R., Vieban F., Clement J.P.: Reasons of informal caregivers for institutionalising dementia patients previously living at home: the Pixel Study. International Journal of Geriatric Psychiatry 19, 127-135 (2004) [27] Unger A., Krautgartner M., Freidl M., Stelzig-Schöler R., Rittmannsberger H., Simhandl C., Grill W., Doby D., Wancata J.: Der Bedarf der Angehörigen Schizophrenie-Kranker. Neuropsychiatrie 19, 141-147 (2005) [28] Wancata J., Benda N., Hajji M., Lesch O.M., Müller Ch.: Prevalence and course of psychiatric disorders among nursing home admissions. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 33, 74-79 (1998) [29] Wancata J., Freidl M., Friedrich F., Matschnig T., Unger A., Kucera A., Gössler R., Alexandrowicz R.: Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Betreuung von Schizophrenie-Kranken? Neuropsychiatrie 22, 83-91 (2008) [30] Wancata J., Kaup B., Krautgartner M.: Die Entwicklung der Demenzerkrankungen in Österreich vom Jahr 1951 bis zum Jahr 2050. Wiener Klinische Wochenschrift 113, 172-180 (2001) [31] Wancata J., Krautgartner M., Berner J., Alexandrowicz R., Unger A., Kaiser G., Marquart B., Weiss M.: The “Carers’ Die Erfassung des Bedarfs bei Demenzkranken mittels dem CANE Needs Assessment for Dementia”: development, validity and reliability. International Psychogeriatrics 17, 393-406 (2005) [32] Wancata J., Windhaber J., Alexandrowicz R., Krautgartner M.: The consequences of non-cognitive symptoms of dementia in medical hospital departments. International Journal of Geriatric Psychiatry 33, 257-271 (2003) [33] WHO (Herausgegeben von Dilling H., Mombour W., Schmidt M.: Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD-10. Verlag Hans Huber, Bern Göttingen 1993 [34] Wijeratne C.: Review: Pathways to morbidity in carers of dementia sufferers. International Psychogeriatrics 9, 69-79 (1997) 189 Mag.pharm. Dr.med. Gerda Kaiser Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Medizinische Universität Wien [email protected] Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 190–194 Original Original Der verbale Kurzzeitgedächtnistest von Arnold & Kohlmann – ein zu Unrecht in Vergessenheit geratenes Diagnostikum in der Psychiatrie? Kristina Stürz, Martin Kopp, Aline Moser und Verena Günther Abteilung für Klinische Psychologie, Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck Schlüsselwörter: Arnold-Kohlmann Gedächtnistest – Kurzzeitgedächtnis – Neuropsychologie Key words: Verbal Short-Term Memory Scale by ­Arnold & Kohlmann – short-term memory – Neuropsychology Der verbale Kurzzeitgedächtnistest von Arnold & Kohlmann – ein zu Unrecht in Vergessenheit geratenes Diagnostikum in der Psychiatrie? Anliegen: Unter den verschiedenen Verfahren zur Erhebung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses bei Menschen mit psychischen Störungsbildern erfüllt der Kurzzeitgedächtnistest von Arnold und Kohlmann trotz fraglicher Testgütekriterien wichtige Anforderungen wie Zeitökonomie, Anwenderfreundlichkeit und Alltagsnähe. Ziel der vorliegenden Studie ist es, dieses etwas in Vergessenheit geratene Verfahren auf seinen testpsychologischen Gehalt anhand der Übereinstimmungsvalidität mit einem anderen gut genormten Gedächtnistest mit ausgewiesener Reliabilität und Validität zu prüfen. Methode: 478 unselektierte Patienten des Departments für Psychiatrie und Psychotherapie Innsbruck, welche einer © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 psychologischen Testung zugewiesen wurden, wurden sowohl mit dem Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest als auch mit denjenigen 2 Subtests der Wechsler Memory Scale, welche speziell das verbale Kurzzeitgedächtnis erfassen, untersucht. Ergebnisse: Die Skalen beider Verfahren korrelieren signifikant positiv. Die Leistungen beider Gedächtnistests liegen in der Gesamtstichprobe im untersten bzw. knapp unter dem Streubereich der Norm. Schlussfolgerungen: Für eine zeiteffiziente differentialdiagnosti­ sche Einschätzung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses von Patienten einer Akutpsychiatrie erweist sich der Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest als praktikables und ausreichend valides Verfahren. The psychometric value of the Verbal Short-Term Memory Scale by Arnold & Kohlmann in psychiatry Objective: Of various tests used to determine verbal short-term-memory deficits in mentally ill persons the Verbal Short-Term Memory Scale by Arnold and Kohlmann meets the important criteria of being fast, user-friendly and every day life-like, despite its old norms and questionable validity. The aim of this study was to assess the psychological value of this instrument by correlating it with those two subtests of the standardized Wechsler Memory Scale (WMS), which assess verbal shortterm memory. Methods: 478 random patients at a university psychiatric hospital, who were referred for psychological testing, were examined with the Verbal Short-Term Memory Scale by Arnold & Kohlmann and the subtests “Logical Memory” and “Verbal Paired Associates” of the Wechsler Memory Scale. Results: Performance by the total sample on both memory tests was in the lowest or just below the range of dispersion for normal values. All scales of both tests showed significant positive correlation. Conclusions: Despite its age the Verbal Short-Term Memory Scale by Arnold & Kohlmann is especially recommended for quick differential diagnosis of a patient's memory in an acute psychiatric examination. Einleitung Viele psychische Erkrankungen gehen mit neuropsychologischen Defiziten einher, erfahrungsgemäß besonders alltagserschwerend erleben Patienten Störungen des verbalen Kurzzeitgedächtnisses. Lautenbacher & Möser [14] fassen die Studienergebnisse zu Gedächtnisstörungen bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis zusammen. Bei immer noch kontroverser Befundlage dürfte ein Viertel der schizophrenen Patienten ein hoch Der verbale Kurzzeitgedächtnistest von Arnold & Kohlmann selektives Defizit des verbalen Gedächtnisses aufweisen, während die übrigen Patienten eher unter globalen Gedächtniseinbußen leiden, die zudem noch mit Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsstörungen assoziiert sind [20]. Wenngleich die Gedächtnisdefizite schizophrener Patienten im Vergleich zu Patienten mit neurologischen Erkrankungen meist als mild einzustufen sind, erweisen sich schizophrene Patienten in verschiedenen Meta-Analysen gegenüber depressiven Patienten gedächtnismäßig deutlich stärker beeinträchtigt [14]. Nichts desto trotz folgern Beblo & Herrmann [3] aus der heterogenen Datenlage, dass auch Patienten mit affektiven Erkrankungen unter Störungen im Neugedächtnis leiden (beispielsweise bei Wiedergabe von Wortlisten), wobei Moderatorvariablen wie Schwere und Remission der depressiven Störung, Alter bei Erstmanifestation, psychologische Faktoren wie Motivation und Verarbeitung von Misserfolgen, Art und Effekt der antidepressiven Medikation, Dauer der Hospitalisierung, Anzahl depressiver Episoden und das Geschlecht immer mitberücksichtigt werden müssen. Auch bei Alkoholabhängigkeit gibt es eine Vielzahl von neuropsychologischen Befunden. In der sehr sorgfältig angelegten Studie von Mann et al. [16] kann gezeigt werden, dass alkoholkranke Personen besonders dann Gedächtnisschwierigkeiten aufweisen, wenn sie Wortlisten ohne ersichtliche assoziative Verbindungen untereinander abrufen sollen. Bei wieder einer ganz anderen Gruppe psychisch Kranker, nämlich Patienten mit Essstörungen, werden vereinzelt Auffälligkeiten sowohl des Kurz- als auch Langzeitgedächtnisses berichtet, welche jedoch vorwiegend vor dem Hintergrund unzureichender Aufmerksamkeitskapazität zu interpretieren sind. Grundsätzlich steht im deutschsprachigen Raum eine breite Palette von Testverfahren zur Erfassung von Gedächtnisfunktionen zur Verfügung. Sie beinhalten üblicherweise eine Reihe von Subtests, in denen neben verbalen auch figural räumliche und visuelle Aufgaben beinhaltet sind. Ein Beispiel dafür ist der Lern- und Gedächtnistest (LGT 3) von Bäumler [2]. Er erhebt anhand von diversen Subtests (wie Erinnern von Vokabeln, Gegenständen und Stadtplan) das Gedächtnis für kurzfristige Zeiträume. In der klinischen Praxis sehr häufig verwendet wird auch die deutsche Fassung der Wechsler Memory Scale (WMS-R) [9]. Mittels 13 Subtests (breite Palette verbaler und nicht verbaler Aufgaben) kann eine Einschätzung der allgemeinen Gedächtnisund Konzentrationsleistung erfolgen. Zwei dieser 13 Subtests erheben speziell das verbale Kurzzeitgedächtnis. Viele weitere Gedächtnisverfahren wären in diesem Zusammenhang zu nennen, etwa der „Visuelle und Verbale Merkfähigkeitstest“ [18], der „Berliner Amnesietest“ [17] oder auch der „Münchner Gedächtnistest“ [10]. Der große Vorteil all dieser genannten Verfahren liegt in ihren gut gesicherten Gütekriterien und Normierungen. Nachteilig ist ihre Dauer, denn die vollständige Durchführungszeit beträgt üblicherweise bis zu einer Stunde. Gerade für die Routinediagnostik einer psychiatrischen Akutklinik, in welcher Patienten nicht nur bezüglich Gedächtnisstörungen, sondern auch Konzentrationsleistung und Reaktionsgeschwindigkeit sowie hinsichtlich Persönlichkeits- und Befindlichkeitsparameter abgeklärt werden sollten, erscheinen diese Verfahren daher nur bedingt geeignet. Speziell in einer Psychiatrie ist es somit die Aufgabe des Klinischen Psychologen Testinstrumente auszuwählen, die größtmöglichen Informationsgehalt mit möglichst geringer Belastung für den Patienten verbinden. Verfahren sollten zeitökonomisch, anwendungsfreundlich sein und darüber hinaus inhaltlich die vom Patienten subjektiv erlebten Gedächtnisdefizite abbilden, also „Alltagsnähe“ herstellen, um eine optimale Motivationslage zu erreichen. 191 Zur orientierenden Abklärung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses waren deshalb an unserer Klinik die 3 Aufgaben zur Merkfähigkeit aus dem "Demenz-Tests" von O. H. Arnold und Th. Kohlmann [1] in jahrelanger Verwendung. Dieses Verfahren wurde von Arnold und Kohlmann bereits im Jahre 1952 konzipiert, primär um Demenzerscheinungen zu objektivieren. Insgesamt umfasste dieses Diagnostikum 16 unterschiedliche Subtests, von denen 3 das verbale Gedächtnis betreffen. Diese erfassen: „Kurzgeschichten merken“, „Assoziative Merkfähigkeit“ und „Zahlengedächtnis“. Beim Subtest „Kurzgeschichten merken“ werden dem Patienten 3 kurze Geschichten vorgelesen und ihm, nach einer Pause von 30 Sekunden, konkrete Fragen zu allen drei Geschichten gestellt. Beispielsweise: „Welche 4 Gegenstände hat der Rentner Max Krause bei seinem Umzug verloren?“ Zur Überprüfung der „Assoziativen Merkfähigkeit“ werden zehn Drei-Wort-Gruppen (beispielsweise Tisch-Lampe-Sessel) langsam vorgelesen. Im Anschluss daran wird jeweils das erste Wort, also „Tisch“ vom Versuchsleiter genannt. Der Patient sollte die zwei weiteren, nämlich „Lampe“ und „Sessel“ wortwörtlich wiedergeben. Beim „Zahlengedächtnis“ werden zehn zweistellige Zahlen einmal vorgelesen, die in der Folge sofort reproduziert werden sollen, wobei keine Reihenfolge eingehalten werden muss. Die richtigen Antworten pro Subtest werden summiert und in „Noten“ umgewandelt (der höchste Wert ist die Zahl 5, Note „sehr gut“, der niedrigste Wert die Zahl 1, Note „sehr schlecht“). Neben den Subtestwerten wird auch ein Gesamtsummenwert interpretiert: größer gleich 9: keine Hinweise auf Defizite im Bereich des verbalen Kurzzeitgedächtnisses; 8: gerade noch durchschnittlich, keine Hinweise auf Defizite; 7: leichte Defizite bzw. Beeinträchtigungen, 6: Defizite, <6: schwere Defizite bzw. Beeinträchtigungen im verbalen Kurzzeitgedächtnis. K. Stürz, M. Kopp, A. Moser, V. Günther Der Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest ist somit alltagsnah und abwechslungsreich gestaltet, aufgrund seiner Dauer von lediglich zehn Minuten wenig belastend und lässt sich in das umfangreiche „diagnostische Gesamtpaket“ bei psychiatrischen Patienten gut integrieren. Wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Diagnostikum finden sich allerdings nur wenige. Erwähnt wurde er in den 80er Jahren im Rahmen des ergopsychometrischen Ansatzes bei psychisch Kranken [5, 11, 13]. Gstättner & Gatterer [8] verwendeten ihn als Evaluationsinstrument im Kontext des SIMA-Gedächtnistrainings und Grünberger [7] im Bereich der forensischen Psychiatrie. Ziel der vorliegenden Studie ist es, dieses „altklassische“ Verfahren auf seinen testpsychologischen Gehalt näher zu überprüfen, in dem seine Übereinstimmungsvalidität, im Sinne von Korrelation mit einem anderen Diagnosegruppen n/% 192 genormten Gedächtnistest, erhoben wird. Methodik Stichprobe Alle Patienten, die im Zeitraum von Jänner 2007 bis Dezember 2008 ambulant oder stationär der Abteilung für Klinische Psychologie des Departments für Psychiatrie und Psychotherapie der Univ.-Klinik Inns­ bruck einer psychologischen ­Testung hinsichtlich unterschiedlichster Fragestellungen zugewiesen wurden, wurden in die Studie eingeschlossen. Es erfolgte keine Selektion der Patienten. Bei allen Patienten wurden nun der Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest und als Außenkriterium diejenigen 2 der 13 Subtests der Wechsler Memory Scale durchgeführt, welche speziell das verbale Kurzzeitgedächt- WMS SubtestIndex Arnold& KohlmannGesamtscore nis erfassen. Es sind dies der Subtest „Logisches Gedächtnis“, bestehend aus der Nacherzählung zweier vorgelesener Geschichten, sowie der Subtest „Verbale Paarerkennung“, bei welchem dem Probanden Wortpaare vorgelesen werden, von denen er in der Folge das jeweils zweite Wort nach Vorgabe des jeweils ersten Wortes erinnern soll. Der Summenwert dieser beiden Subtests lässt sich je nach Probandenalter in „Indizes“ für verbales Gedächtnis mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15 umwandeln. Statistik Anhand von Pearson Korrelationen (SPSS 15.0) wurden sowohl die Rohwerte als auch die Standardwerte beider Verfahren auf ihren Zusammenhang hin überprüft. Kurzgeschichten merken Assoziative Merkfähigkeit Zahlengedächtnis MW SD MW SD MW SD MW SD MW SD Affektive Störung 101 / 21,1 87,5 19,1 8,5 2,1 2,9 1,0 2,9 1,0 2,7 0,6 Abhängigkeitserkrankung 27 / 5,6 86,7 26,9 8,2 2,4 2,8 1,3 2,6 1,2 2,7 0,5 Schizophrenie/ Wahnhafte Störung 25 / 5,2 79,6 22,7 7,7 2,4 2,4 0,9 2,7 1,1 2,6 0,8 Essstörung 66 / 13,8 90,8 17,2 9,4 1,8 3,3 0,9 3,0 0,9 3 0,7 Angststörung 18 / 3,8 87,7 8,9 2,2 3,1 1,3 2,9 1,0 2,9 0,6 Somatoforme Störung 61 / 12,8 85,1 20,5 8,4 2,5 2,8 1,1 2,9 1,2 2,8 0,8 Persönlichkeitsstörung 23 / 4,8 84,5 22,0 8,7 2,4 3,3 1,0 3,0 1,1 2,4 0,8 Neurologische Störung 8/ 1,7 78,6 19,3 8,5 2,4 2,9 1,2 3,0 1,2 2,6 0,5 Geschlechtsidentitätsstörung 8/ 1,7 74,7 18,7 7,5 2,0 2,3 0,7 2,4 0,7 2,9 1,0 Arbeitsfähigkeit 60 / 12,6 79,6 19,2 7,4 2,1 2,4 1,1 2,4 1,0 2,5 0,6 Nicht näher zugeordnet 81 / 17,0 80,8 24,3 7,6 2,5 2,6 1,1 2,4 1,1 2,6 0,8 478 / 100,0 84,8 21,1 8,3 2,3 2,8 1,1 2,8 1,1 2,7 0,7 22,6 Zusätzlich: Gesamtgruppe Tabelle 1: Häufigkeiten der einzelnen Diagnosegruppen und Ergebnisse sowohl in der Wechsler Memory Scale (Index der 2 verbalen Subtests) als auch im Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest (Gesamtscore und Subtestscores) Der verbale Kurzzeitgedächtnistest von Arnold & Kohlmann 193 r p SW Kurzgeschichten merken x SW Assoziative Merkfähigkeit ,598 <0.001 SW Kurzgeschichten merken x SW Zahlengedächtnis ,341 <0.001 SW Assoziative Merkfähigkeit x SW Zahlengedächtnis ,354 <0.001 SW Kurzgeschichten merken x WMS-Index ,578 <0.001 SW Assoziative Merkfähigkeit x WMS-Index ,522 <0.001 SW Zahlengedächtnis x WMS-Index ,348 <0.001 Gesamtscore Arnold-Kohlmann x WMS-Index ,631 <0.001 r = Korrelationskoeffizient Tabelle 2: Korrelationen zwischen dem Index der 2 verbalen Subtests der Wechsler Memory Scale (WMS-Index) und den Standardwerten (SW) des Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest (Gesamtscore und Subtestscores) Ergebnisse Diskussion 478 Patienten der Univ.-Klinik für Psychiatrie wurden konsekutiv in die Studie eingeschlossen. Davon sind 279 (58,4%) Frauen und 199 (41,6%) Männer. Der Altersdurchschnitt beträgt 39,2 Jahre (SD=13,8). Tabelle 1 zeigt die hinsichtlich der einzelnen Diagnosegruppen unterteilten Mittelwerte und Standardabweichungen beider Verfahren. Die Gesamtgruppe weist insgesamt im untersten oder leicht unter dem Streubereich der Norm liegende Werte auf. Die besten Leistungen erbringen Patienten mit Essstörungen, die schlechtesten Patienten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Wie in Tabelle 2 ersichtlich korrelieren alle Skalen beider Verfahren hochsignifikant. Dies betrifft sowohl die Korrelationen der Standardwerte als auch der Rohwerte. Korrelationsberechnungen getrennt für Männer und Frauen ergaben keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Unter den verschiedenen Verfahren zur Erhebung von Gedächtnisfunktionen bei Menschen mit psychischen Störungsbildern erfüllt der ArnoldKohlmann-Gedächtnistest die wichtigen Kriterien der Zeitökonomie, Anwenderfreundlichkeit, Alltagstauglichkeit und vor allem Alltagsnähe. Nachteilig sind unzureichende Daten zu Normierung und Validität [1, 13] sowie eine, vereinzelte Items betreffende, wenig zeitgerechte Sprache. Die diagnostische Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens wurde daher in vorliegender Studie anhand der Korrelation mit den 2 Subtests zur Erhebung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses (Verbale Paarerkennung und Logisches Gedächtnis) der ausreichend validen Wechsler Memory Scale näher untersucht. Die Ergebnislage zeigt hochsignifikante positive Korrelationen beider Verfahren in allen Bereichen in einer psychiatrischen Stichprobe von 478 Patienten. Grundsätzlich weist die Gesamt- gruppe im verbalen Gedächtnis der WMS mit einem mittleren Index von 84,8 einen gerade noch im untersten Streubereich der Norm liegenden Wert auf (durchschnittlicher Index 85-115). Ganz ähnlich präsentieren sich die Ergebnisse im Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest, der mit einem mittleren Gesamtnotenwert von 8,3 nur knapp den von den Autoren angegebenen Mittelwert Gesunder unterschreitet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 21,1% der Gesamtgruppe an affektiven Störungen leidet, was in einer gewissen Schwerpunktsetzung unseres Hauses begründet liegt. Unter den verschiedenen Diagnosegruppen schneiden Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, Patienten mit Geschlechtsidentitätsstörung, neurologische Erkrankungen sowie Patienten, die aufgrund psychischer Auffälligkeiten zur testpsychologischen Untersuchung der Arbeitsfähigkeit zugewiesen wurden, in beiden Verfahren am schlechtesten ab. Wie zu erwarten, wies die Diag­ nosegruppe „Essstörungen“ die besten Leistungen, wenn auch im unteren Streubereich der Norm liegend, auf. Insgesamt fügen sich diese Ergebnisse in die eingangs erwähnte Datenlage zu Störungen des verbalen Kurzzeitgedächtnisses bei psychiatrischen Patienten stimmig ein. Zusammengefasst stellen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dem Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest ein besseres Zeugnis aus, als aufgrund seines „Alters“ zu erwarten war. Um seinen routinemäßigen Einsatz befürworten zu können, plant unsere Arbeitsgruppe eine Neunormierung und Überarbeitung des Verfahrens. Verbesserungswürdig scheinen beispielsweise vereinzelte Begriffe in den Geschichten, welche etwas veraltet und somit befremdlich wirken, wie etwa „Büchsenmacher“. In der derzeit vorliegenden Form kann der Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest vor dem Hintergrund der hohen Übereinstimmung mit dem verbalen Ge- K. Stürz, M. Kopp, A. Moser, V. Günther dächtnisindex der etablierten Wechsler Memory Scale als Testinstrument trotzdem in Betracht gezogen werden, wenn eine rasche differentialdiagnostische Einschätzung von Patienten erforderlich ist. Nahe liegend wäre - wie ursprünglich von Arnold und Kohlmann intendiert - sein vermehrter Einsatz speziell auch als gerontopsychologisches Diagnostikum (siehe auch seine Verwendung im Zuge des SIMA-Projekts [8]), denn seine Subtests haben eine hohe Nähe zu den von Crook [6] bzw. Kessler und Kalbe [12] beschriebenen Kriterien altersassoziierter Gedächtnisbeeinträchtigungen (unter anderem Schwierigkeiten beim Namenmerken, Probleme beim Erinnern von Telefonnummern oder Postleitzahlen). Gerade im geriatrischen Bereich sind diagnostische Verlaufskontrollen von zentralem Stellenwert. Um Lerneffekte zu vermeiden, liegt für den Arnold-Kohlmann-Gedächtnistest eine Paralleltestversion vor, die allerdings in vorliegender Studie nicht zum Einsatz kam und ebenfalls erst testgütemäßig abzusichern wäre. Literatur [1] Arnold O.H. & Kohlmann Th.: Leistungspsychologische Untersuchungen zum Demenzproblem. Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde und deren Grenzgebiete 6, 91-122 (1953). [2] Bäumler G.: Lern- und Gedächtnistest LGT-3. Hogrefe, Göttingen 1974. [3] Beblo T., Hermann M.: Neuropsychologische Defizite bei depressiven Störungen. Fortschr Neurol Psychiatr 68, 1-11 (2000). 194 [4] Beblo T.: Neuropsychologie affektiver Störungen. In: Lautenbacher S., Gauggel S.: Neuropsychologie psychischer Störungen. Springer, Berlin 2004. [5] Beiglböck W., Feselmayer S., Bischof B.: Ergopsychometrie. Neue Wege der experimentellen Psychodiagnostik pathologischer Belastungsreaktionen. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie 36 (1), 16-30 (1989). [6] Crook TH.: Diagnosis and treatment of normal and pathologic memory impairment in later life. Semin Neurol 9, 20-30 (1989). [7] Grünberger J.: Humaner Strafvollzug. Springer, Berlin 2007. [8] Gstättner R., Gatterer G.: Durchführung des Sima-Gedächtnistrainings im Geriatriezentrum am Wienerwald. Psychologie in Österreich 4, 151-154 (1998). [9] Haerting C., Markowitsch H.J., Neufeld H., Calabrese P., Deisinger K. & Kessler J.: WMS-R. Wechsler Gedächtnistest – Revidierte Fassung. Deutsche Adaption der revidierten Fassung der Wechsler memory Scale. Huber, Bern 2000. [10] Ilmberger J: Münchner Verbaler Gedächtnistest. Deutsche Forschungsadaptation des California Verbal Learning Test. Nichtveröffentlichtes Manuscript, 1988. [11] Karlick-Bolten E., Opgenoorth E., Presslich O., Berner W.: Merkfähigkeit nach dem körperlichen Drogenentzug. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung 9, 23-26 (1986). [12] Kessler J. & Kalbe E. Gedächtnisstörungen im Alter. Prodrom einer Demenz? In: Weis S. & Weber G.: Handbuch Morbus Alzheimer. Beltz Psychologie Verlags Union, Weinheim 1997. [13] Kryspin-Exner I.: Ergopsychometrie und Hirnleistungsdiagnostik in der klinischen Psychologie und Psychiatrie. S. Roderer Verlag, Regensburg 1987. [14] Lautenbacher S., Möser C.: Neuropsychologie der Schizophrenie. In: Lautenbacher S., Gauggel S.: Neuropsychologie psychischer Störungen. Springer, Berlin 2004. [15] Lautenbacher S., Gauggel S.: Neuropsychologie psychischer Störungen. Springer, Berlin 2004. [16] Mann K., Günther A., Stetter F., Ackermann K.: Rapid recovery from cognitive deficits in abstinent alcoholics: a controlled test-retest study. Alcohol Alcohol 34, 567-574 (1999). [17] Metzler P., Voshage J., Rösler P.: Berliner Amnesietest. Hogrefe, Göttingen 1992. [18] Schellig D., Schächtele B.: Visueller und Verbaler Merkfähigkeitstest. Swets, Frankfurt a.M. 2001. [19] Snitz B.E., Daum I.: The Neuropsychology of Schizophrenia: a Selective Review. Z Neuropsychol 12, 3-7 (2001). [20] Wexler B.E., Stevens A.A., Bowers A.A., Sernyak M.J., Goldman-Rakic P.S.: Word and tone working memory deficits in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 55, 1093-1096 (1998). [21] Wilson B., Cockburn J., Baddeley A., Beckers K., Behrends U.: Rivermead Behavioral Memory Test – German Version. Thames Valley Test Company, Suffolk 1992. tit. Ao. Univ.-Prof. Dr. Verena Günther Abteilung für Klinische Psychologie Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck [email protected] Kurze Originalarbeit Short Original Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 195–199 Zum Schnittstellenmanagement zwischen einem psychiatrischen Krankenhaus und einem gemeindepsychiatrischem Dienst Stefan Frühwald1, Angelika Karner1, Michaela-Elena Seyringer2, Teresa Skribe1, Patrick Frottier1 und Anna Entenfellner1 1 2 Psycho-Sozialer Dienst der Caritas der Diözese St. Pölten Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie & Evaluationsforschung, Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, AKH Wien Schüsselwörter: Schnittstelle – außerstationäre psychiatrische Dienste – Differentialindikation Key words: differential indication – aftercare – community mental health services Zum Schnittstellenmanagement zwi­schen einem psychiatrischen Krankenhaus und einem gemeinde­ psychiatrischem Dienst Hintergrund: Für die Zusammenarbeit zwischen psychosozialen Diensten (PSD) und psychiatrischen Krankenhäusern existieren bisher keine klaren Richtlinien. Methode: Die seitens des regionalen Fachkrankenhauses dem PSD der Versorgungsregion Zentralraum Niederösterreich (ca. 250.000 Einwohner) vorgestellten PatientInnen wurden ab 2002 systematisch registriert und regionalen MitarbeiterInnen des PSD zugewiesen. Die Routinedaten des Verbindungsdienstes im jeweils ersten Halbjahr der Jahre 2002 bis 2006 wurden ausgewertet. Ergebnisse: Im Beobachtungszeitraum wurden dem PSD halbjährlich zwischen 124 © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 und 189 PatientInnen zur weiteren Betreuung vorgestellt. Die diagnostische Zuordnung änderte sich von anfangs überwiegenden affektiven Störungen (ICD-10: F3 40,0 %) und Substanzmissbrauch (F1: 38,9 %) hin zu Schizophrenie (F2 von 25,4 % auf 49,7 %) und Persönlichkeitsstörungen (F6 von 6,4 % auf 22,4 %). Bei anfangs 30,7 % bzw. zuletzt 56,6% der Zugewiesenen kam es zu einem Erstgespräch im PSD, dazu erfolgten bei 39,9% bis 74,6 % der Zugewiesenen nachgehende Interventionen (Telefonanrufe, Briefe, Hausbesuche,...) seitens des PSD. Zusammenfassung: Die vorliegende Studie zeigt den Nutzen einer spezifischeren Zuweisung, um PatientInnen mit komplexer Problemstruktur eine Unterstützung durch psychosoziale Dienste zu ermöglichen. Weiters liegt eine erste Beschreibung routinemäßiger nachgehender Arbeit eines PSD vor. Quality assurance of take-over from in-patient to out-patient care: experiences in Lower Austria Objective: Community mental health teams (CMHT) provide support for severely disabled, chronic mentally ill patients. In this study, referrals to CMHT by a psychiatric hospital in Lower Austria were analysed, as were the first few weeks of care for referred patients. Methods: Referrals to CMHT of a catchment area (pop 250.000) were analysed for 20022006. Results: In the first 6 months of each year, 124 to 189 patients were referred to CMHT. Between 2002 and 2006, the percentage of affective disorders (ICD-10: F3: 40.0 %), and substance use disorders (F1: 38.9 %) within the referrals diminished, as compared to patients suffering from schizophrenia (F2 initially 25.4 % of referrals vs. 49.7 %) and personality disorders (F6 initially 6.4 % of referrals vs. 22.4 %). In 30.7 % vs. 56.6 % of patients, CMHT workers managed to establish contact to patients after discharge from hospital. They actively sought contact with 39.9 to 74.6 % of referred patients (by means of telephone calls, letters, home visits, etc.). In 26.5 to 46.9 % of the referrals, continuous care was planned. Conclusions: This study emphasizes the advantage of specific referrals to CMHT, if care for severely disabled individuals is needed and should be provided. Furthermore, a description of outreach activities, which are intended to maintain contact with patients characterized by poor compliance, is presented. These activities are not yet part of routine care in German speaking countries. St. Frühwald et al. Einleitung Im deutschen Sprachraum wird die psychiatrische Routineversorgung von mehreren Säulen getragen: Die stationäre Therapie erfolgt in psychiatrischen Krankenhäusern bzw. zunehmend in psychiatrischen Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern, ambulante Versorgung findet überwiegend in den Ordinationen niedergelassener Psychiater statt. Insbesondere zur Unterstützung jener PatientInnen, deren Erkrankung schwer und chronisch verläuft, wurden in vergangen Jahrzehnten sozial-psychiatrische (psychosoziale) Dienste und weitere psychosoziale Einrichtungen (Tagesstrukturzentren, Wohn- und Arbeitsrehabilitationseinrichtungen u.a.) etabliert [2, 8, 10, 11, 17, 18, 22, 25]. Aufgabe der sozial-psychiatrischen Dienste ist es insbesondere, jene schwer kranken und multimorbiden PatientInnen, deren Krankheitsverlauf durch rezidivierende Rückfälle und häufige (Zwangs-) Hospitalisierungen, durch mangelhafte Krankheitseinsicht und geringe Compliance gekennzeichnet ist, durch intensive Unterstützung und Begleitung soweit zu stabilisieren, dass stationäre (Zwangs-) Behandlungen seltener oder gar nicht mehr erforderlich sind [9, 13, 23]. Für diese – auch gesundheits­ öko­no­misch bedeutsame [15] – Dienst­leistung ist eine enge Zusammenarbeit der in sozial-psychiatrischen Diensten außerstationär tätigen Fachkräfte mit den stationären Behandlungseinrichtungen einer­seits, mit den niedergelassenen Fachärzten andererseits erforderlich [12, 21]. Über die Gestaltung dieser Zusammenarbeit existieren allerdings kaum Handlungsanleitungen [16, 19]. Übereinstimmung besteht bei der Einschätzung, dass der Wechsel von stationärer zu außerstationärer Betreuung problematisch und insbesondere bei der beschrieben Patientenpopulation häufig mit Behandlungsabbrüchen und schweren Rückfällen verbunden ist 196 [4, 14, 26]. Um diesen ungünstigen Entwicklungen vorzubeugen, ist die Qualitätssicherung des Schnittstellenmanagements ein bedeutsames Thema in der Diskussion über die Qualität psychiatrischer Versorgung [3, 4]. Die vorliegende Studie beschreibt den praktischen Versuch der Verbesse­ rung des Schnittstellenmanagemen ts zwi­­schen stationärer Psychiatrie und einem psycho-sozialen Dienst (PSD) in einer Versorgungsregion in Niederösterreich. Methode Der Zentralraum Niederösterreichs ist eine gemischt kleinstädtisch – ländliche psychiatrische Versorgungsregion mit ca. 250.000 Einwohnern. Die stationäre psychiatrische Versorgung dieses Sektors erfolgt durch ein nicht in der Versorgungsregion lokalisiertes psychiatrisches Fachkrankenhaus (Landesklinikum Mostviertel Amstetten-Mauer). Um eine Weiterbetreuung jener Patienten bereitzustellen, für die eine PSD-Betreuung als Ergänzung zum Angebot niedergelassener Fachärzte indiziert ist, besuchen 2 Mitarbeiter des PSD wöchentlich im Rahmen des sog. „Verbindungsdienstes“ sämtliche (nicht sektorisierten) Akutstationen des psychiatrischen Fachkrankenhauses, um die Angebote des PSD vorzustellen. Nach kurzer Begegnung mit dem stationsführenden Oberarzt der Station, welcher die Patienten nennt, denen PSD-Betreuung vorgestellt werden sollte, findet ein kurzes Gespräch mit diesen statt, in dem eine Einschätzung über die aktuelle Problemlage, die Motivation zur Betreuung und die Dringlichkeit einer PSD-Betreuung stattfindet. Danach erfolgt die Zuteilung zu konkreten PSD BetreuerInnen der drei PSD-Standorte des Sektors, welche in den Bezirksstädten lokalisiert sind. Die konkret beauftragten PSD MitarbeiterInnen erhalten, ebenso wie der Patient, eine kurze schrift- liche Notiz über das konsensual vereinbarte Betreuungsangebot, welches die Patienten zum Zeitpunkt der PSD – Vorstellung in Anspruch zu nehmen beabsichtigen. Gemeinsam konsentierte Vereinbarungen über weitere Behandlungsschritte versprechen bessere Erfolgsaussichten [7]. Da von den dem PSD seitens der Stationen zugewiesenen PatientInnen lediglich ein geringer Teil tatsächlich nach der Entlassung aus stationärer Behandlung in den Beratungsstellen des Sektors ankam, da darüberhinaus die angekommenen PatientInnen nicht selten solche waren, deren Behandlungsmotivation hoch (und damit die PSD – Indikation oft eher gering) war, wurde beschlossen, den in der Verantwortung des PSD liegenden Teil des Schnittstellenmanagements einer Revision zu unterziehen und durch qualitätssichernde Schritte zu verbessern. Hierfür wurde ein Formular entwickelt, welches neben den wesentlichen personenbezogenen Daten des Patienten Angaben zur gegenwärtigen Problemstruktur, zu wesentlichen Indikatoren des Krankheitsverlaufs und Angaben zur Dringlichkeit einer PSD–Betreuung sowie zur Therapiemotivation enthält. Dieses Formular, welches während der Vorstellung des PSD mit den Patienten im stationären Bereich ausgefüllt wird, wird an die jeweiligen Mitarbeiter des PSD übermittelt. Die Vorgabe an die Mitarbeiter ist, 10 Wochen nach der Zuweisung das um Angaben zur zwischenzeitlich abgelaufenen Initialphase der Betreuung ergänzte Formular an den Verbindungsdienst rückzuerstatten. So ist etwa anzumerken, ob ein erstes Gespräch nach dem stationären Aufenthalt stattgefunden hat, ob seitens der betreffenden MitarbeiterInnen insbesondere bei hoher PSD – Indikation ein aktives, nachgehendes bzw. aufsuchendes Vorgehen zur Kontaktaufnahme gewählt wurde (z.B. Anruf beim Patienten, Brief an Patienten, Hausbesuch, Kontakt zu den Angehörigen, sonstige nachgehende Intervention), und welche weiteren Schritte aus Sicht der rückmel- Schnittstellenmanagement zwischen psychiatrischem Krankenhaus und gemeindepsychiatrischem Dienst denden Mitarbeiter erforderlich erscheinen (etwa regelmäßige weitere Gespräche, Planung Arbeitsrehabilitation, Planung Wohnrehabilitation, Planung Angehörigenarbeit, etc.). Für diese Untersuchung wurden Daten jener PatientInnen ausgewertet, die dem psycho-sozialen Dienst im Zentralraum NÖ durch die zuständigen Stationen der Landesklinik Mostviertel Amstetten-Mauer jeweils im ersten Halbjahr 2002 bis 2006 zugewiesen wurden. Es wurden sämtliche patientenbezogenen Daten anonymisiert erfasst, EDV-mäßig eingegeben und deskriptiv statistisch ausge­wertet. Ergebnisse Während des Untersuchungszeitraums wurden dem PSD vom psychiatrischen Fachkrankenhaus halbjährlich zwischen 124 und 189 PatientInnen zugewiesen (Tabelle 1). Zwischen 66 und 80 % aller Patienten wurden innerhalb des PSD dem sozialen Dienst zugewiesen, 49 bis 64 % dem ärztlichen Dienst. Daraus ergibt sich, dass ein Teil der PatientInnen beiden Berufsgruppen zugewiesen wurde, überwiegend solche mit komplexer Bedürfnislage. Diagnostisch handelte es sich bei den zuge­wiesenen PatientInnen in 29,0 % bis 38,9 % um Substanzmissbrauch (F1), in 20,1 % bis 40,0 % um affektive Störungen (F3), und in ­ 2,8 % bis 16,9 % um neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4), wobei die Diagnosegruppen F3 und F4 über die Jahre abnahmen. Bei 25,4 % bis 51,6 % war die Diagnose Schizophrenie (F2) in über die Jahre zunehmender Tendenz, bei 6,4 % bis 22,4 % Persönlichkeitsstörung (F6) in ebenfalls über die Jahre zunehmender Tendenz (Tabelle 2). Bei Doppel- und Mehrfachdiagnosen wurden alle Diagnosen des Kapitels F erfasst und gezählt. Von den PSD-MitarbeiterInnen gingen zwischen 74 und 85 % Rückmeldungen betreffend die zugewiesenen PatientInnen ein. Es wurde also die Vorgabe, nach 10 Wochen den Verlauf der Initialphase der PSD-Betreuung rückzumelden, in einem hohen Ausmaß angenommen. Insgesamt wurden im ersten Jahr bei 30,7 % der Zugewiesenen Erstgespräche geführt, dieser Anteil konnte über die Jahre auf zuletzt 56,6 % gesteigert werden. Die PSD 197 MitarbeiterInnen versuchten bei 40 bis 75 % der zugewiesenen PatientInnen, von sich aus mit diesen in Kontakt zu treten (i.d.R. telefonisch, brieflich oder durch Hausbesuche). Die Anzahl der Kontaktversuche war zwischen 1 und 5, am häufigsten wurden 1 oder 2 Versuche unternommen. Die nachgehende Arbeit wurde über die Jahre mehrheitlich vom sozialen Dienst getragen (bei Sozialarbeitern Kontaktversuche zwischen 33 % und 76 % aller Zuweisungen; bei den Ärzten 17 % bis 7 % mit abnehmender Tendenz). Von jenen PatientInnen, die nicht angerufen/ angeschrieben wurden, kamen ebenfalls viele zu einem Erstgespräch wie auch zu weiterer Betreuung. Es ist naheliegend, dass es sich hierbei um 2002 2003 2004 2005 2006 Zuweisungen 189 179 130 124 176 Rückmeldungen (%) 78,8 73,7 85,4 85,5 75,5 Erstgespräch (%) 30,7 38,5 51,5 51,5 56,6 Kontaktversuche (%) 45,0 72,1 74,6 74,6 39,9 Weiterbetreuung (%) 26,5 31,8 44,6 44,4 46,9 Tabelle 1: Verbindungsdienst PSD Zentralraum NÖ mit NÖ Landesklinik Mauer, 2002 bis 2006 (2002-2003: Jan-Jul; 2004-2006: Jan-Jun) 2002 2003 2004 2005 2006 F0 4,3 4,5 3,1 3,2 0 F1 38,9 33,0 34,6 29,0 35,7 F2 25,4 37,4 40,0 51,6 49,7 F3 40,0 20,1 23,8 34,7 28,7 F4 12,4 8,4 16,9 8,1 2,8 F6 6,4 10,6 14,6 18,5 22,4 Tabelle 2: Diagnoseverteilung der zugewiesenenn PatientInnen Darstellung in Prozent der Zugewiesenen 2002 2003 2004 2005 2006 Erstgespräch (%) 30,7 38,5 51,5 51,5 56,6 Kontaktversuche (%) 45,0 72,1 74,6 74,6 39,9 Weiterbetreuung (%) 26,5 31,8 44,6 44,4 46,9 Tabelle 3: Verbindungsdienst PSD Zentralraum NÖ – LNK Mauer 2002-2008 St. Frühwald et al. Erstgespräche (%) 198 ∆ Kontaktversuche (%) x Weiterbetreuung (%) Abbildung 1: Kontaktversuche, Erstgespräche und Weiterbetreuungen in % aller Zuweisungen jene PatientInnen handelte, die schon beim Verbindungsdienst einen fixen Gesprächstermin erhalten und diesen eingehalten hatten, bzw. die den PSD von früher her schon kannten und daher nicht kontaktiert werden mussten. Eine längerfristige Weiterbetreuung wurde bei 26,5 bis 46,9 % der Zugewiesenen als vorgesehen rückgemeldet (Tabelle 3, Abbildung 1). Diskussion Die hier dargestellten Ergebnisse der Bemühung eines psycho-sozialen Dienstes (PSD), schwer und chronisch psychisch kranke Menschen im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt in Betreuung zu übernehmen, beleuchten in einer konkreten Versorgungsregion die Problematik des Schnittstellenmanagements zwischen stationärer und außer­stationärer Versorgung. Aus der Methodik dieser Studie ergibt sich, dass keine Angaben darüber gemacht werden können, ob seitens der zuweisenden psychiatrischen Klinik genau jene PatientInnen zugewiesen wurden, für die eine PSD – Betreuung am dringlichsten indiziert ist. Faktum ist, dass dem PSD im Verlauf des Auswertungszeitraumes etwa 30 – 40 % der in stationärer Betreuung befindlichen PatientInnen vorgestellt wurden. Ob es sich hierbei um genau jene handelt, deren schwerer und chronischer, mit häufigen Rückfällen verbundener Krankheitsverlauf eine PSD Betreuung als hoch indiziert erscheinen lässt, entzieht sich unserer Kenntnis. Aufgrund der initial (2002) einen hohen Anteil von affektiven (F3) und neurotischen (F4) Störungen aufweisenden Diagnoseverteilung erschien dies aber fraglich. Daher wurden durch den PSD regelmäßige Informationstreffen im zuweisenden psychiatrischen Krankenhaus angeregt, um das Tätigkeitsprofil und die Zuständigkeit des PSD speziell für Patienten mit komplexen Bedürfnissen, die sich häufig in den Diagnosegruppen F2 und F6 finden, genauer zu erklären. Als Effekt davon stieg in den folgenden Jahren innerhalb der Zuweisungen der Anteil an Patienten mit der Hauptdiagnose Schizophrenie (F2) oder Persönlichkeitsstörungen (F6). Für sozialpsychiatrische Dienste fehlen heute Empfehlungen zur konkreten Gestaltung „nachgehender“ Arbeit. Übereinstimmung besteht in der Einschätzung, dass schwer und chronisch psychisch Kranke durch außerstationäre Dienste aktiv kontaktiert und aufgesucht werden sollten [12, 13]. Konkrete Richtlinien für diese „nachgehende“ bzw. „aufsuchende“ Tätigkeit fehlen allerdings insbesondere im deutschsprachigen Versorgungskontext. Diese Untersuchung beschreibt die in einer konkreten österreichischen Versorgungsregion gelebte Praxis hinsichtlich nachgehender Arbeit: 40 - 75 % der Zugewiesenen wurden aktiv kontaktiert. Den MitarbeiterInnen des PSD wurde allerdings keine Vorgaben gemacht, wie oft bzw. wie intensiv die nachgehenden Bemühungen zu gestalten wären. Klarerweise ist einerseits auf die Indikation zu achten, andererseits auf Zeitökonomie und die weiterlaufende Routinearbeit mit bereits betreuten PatientInnen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die PSDMitarbeiterInnen in NÖ deutlich höhere Gesamtklientenzahlen (caseload) aufweisen als etwa MitarbeiterInnen des „Assertive Community Treatment“ im angloamerikanischen Sprachraum [9, 21, 24]. Andererseits ist darauf zu verweisen, dass im österreichischen (bzw. deutschsprachigen) Versorgungskontext gemein- Schnittstellenmanagement zwischen psychiatrischem Krankenhaus und gemeindepsychiatrischem Dienst depsychiatrische Dienste in der ambulanten Versorgung ja keineswegs alleine verfügbar sind – ein Großteil der stationären PatientInnen wird von niedergelassenen Fachärzten in deren Ordinationen nach betreut. Wir gehen davon aus, dass viele der zugewiesenen, aber nicht im PSD angekommenen PatientInnen dort ankamen und weiterbetreut werden. Die routinemäßige Zuweisung aller PatientInnen durch den Klinik-Verbindungsdienst und die von den MitarbeiterInnen angeforderte Rückmeldung läuft weiter. Wir gehen davon aus, dass insbesondere PatientInnen mit hoher PSD-Indikation (PatientInnen mit Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, Doppel-/Mehrfachdiagnosen, komplexe soziale Komplikationen) vermehrt erreicht werden können, und dass sich die nachgehende Arbeitsweise weiterentwickelt. Es ist geplant, die hier dargestellten Auswertungen regelmäßig zu wiederholen, um eine Verbesserung des Erreichens der zugewiesenen PatientInnen (zuletzt 56.6 % Erstgespräche) ebenso zu dokumentieren wie eine Intensivierung des aufsuchenden Vorgehens bei hoher PSD-Indikation. Wir hoffen, dass sich die Erfolge dieses Vorgehens zukünftig ebenfalls darstellen lassen, im klinischen Bereich etwa durch eine Abnahme von stationären Aufnahmen unter Zwangsbedingungen aus dem untersuchten Sektor. Bisherige Ergebnisse belegen, dass problematische soziale Bedingungen in Kombination mit geringem Professionalisierungsgrad und geringer Diversifikation psychosozialer Einrichtungen zu vermehrten Zwangshospitalisierungen und geringerer Berücksichtigung der Bedürfnisse der betreuten PatientInnen führen [1, 5, 6, 20]. Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Arvidsson H.: Met and unmet needs of severely mentally ill persons – The psychiatric care reform in Sweden. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 38, 373-379 (2003). Becker T., Hülsmann S., Knudsen H.C., Martiny K., Amaddeo F., Herran A., Knapp M., Schene A.H., Tansella M., Thornicroft G., Vazquez-Barquero J.L. and the EPSILON study group: Provision of services for people with schizophrenia in five European regions. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 37, 465474 (2002). Berghofer G., Schmidl F., Rudas S., Schmitz M.: Inanspruchnahme psychischer Behandlung. Psychiatr Prax 27, 372-377 (2000). Berghofer G., Schmidl F., Rudas S., Steiner E., Schmitz M.: Predictors of treatment discontinuity in outpatient mental health care. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 37, 276-282 (2002). Bindman J., Tighe J., Thornicroft G., Leese M.: Poverty, poor services, and compulsory psychiatric admission in England. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 37, 341-345 (2002). Bitter D., Entenfellner A., Matschnig T., Frottier P., Frühwald S.: Da-Heim im Heim? Bedeutete Ent-Hospitalisierung auch Ent-Institutionalisierung? Psychiatr Prax 36, 261-269 (2009). Borbe R., Jaeger S., Steinert T.: Behandlungsvereinbarungen in der Psychiatrie. Psychiatr Prax 36, 7-15 (2009) Bramesfeld A.: Wie gemeindenah ist die psychiatrische Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland wirklich? Psychiatr Prax 30, 256-265 (2003). Ford R., Barnes A., Davies R., Chalmers C., Hardy P., Muijen M.: Maintaining contact with people with severe mental illness: 5-year follow-up of assertive oureach. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 36, 444-447 (2001). Frühwald S., Bühler B., Grasl R., Gebetsberger M., Matschnig T., König F., Frottier P.: (Irr-) Wege in die Arbeitswelt – Langzeitergebnisse arbeitsrehabilitativer Einrichtungen für psychisch Kranke der Caritas St. Pölten. Neuropsychiatrie 20, 34-40 (2006). Frühwald S., Grill W.: Wege zum Patienten – Entwicklungen der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Niederösterreich. Das Gesundheitswesen (im Druck). Kallert T.W., Leiße M., Kreiner B., Bach O.: Erwartungen an Versor­ gungsleistungen sozialpsychiatrischer Dienste im Freistaat Sachsen. Fortschr Neurol Psychiat 65, 461-471 (1997) Katschnig H., Boissl W., Eichberger G., Etzersdorfer E., Fischer P., Fliedl R., Marksteiner A., Tatzer E., Wancata J., [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 199 Windhaber J.: Der Niederösterreichische Psychiatrieplan 1995. NÖ Schriften 87 – Wissenschaft (1996). Killaspy H., Banerjee S., King M., Lloyd M.: Prospective controlled study of psychiatric out-patient non-attendance. Br J Psychiatry 176, 160-165 (2000). Krautgartner M., Scherer M., Katschnig H.: Psychiatrische Krankenhaustage: wer konsumiert die meisten? Psychiatr Prax 29, 355-363 (2002). Krömker H., Krause-Döring R.: Aufbau eines vernetzten Versorgungssystems in einem Pflichtversorgungssystem. Psychiatr Prax 29, 218-221. (2002). Matschnig T., Frottier P., Seyringer M.E., Frühwald S.: Arbeitsrehabilitation psychisch kranker Menschen – ein Überblick über Erfolgsprädiktoren. Psychiatr Prax 35, 271-278 (2008) Meise U., Wancata J., Hinterhuber H. Psychiatrische Versorgung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen – Ausblick. Neuropsychiatrie 22, 148-152 (2008). Priebe S.: Die deutsche Psychiatrie – aus London gesehen. Psychiatr Prax 28, 361-364 (2002). Ramana R., Paykel E.S., Melzer D., Mehta M.A., Surtees P.G.: Aftercare of depressed inpatients – service delivery and unmet needs. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 38, 109-115 (2003). Roick C., Schindler J., Angermeyer M.C., Fritz-Wieacker A., Riedel-Heller S., Frühwald S.: Das Gesundheitsverhalten schizophren erkrankter Menschen: ein typisches Verhaltensmuster? Neuropsychiatrie 22, 100-111 (2008). Sibitz I., Schrank B., Amering M.: Nutzung der Angehörigenrunde. Neuropsychiatrie 23, 26-34 (2009) Spießl H., Schön D., Cording C. Zusammenarbeit sozialpsychiatrischer Dienste mit der psychiatrischen Klinik. Psychiatr Prax 27, 160-164 (2000). Tyrer P.: Are small case-loads beautiful in severe mental illness? Br J Psychiatry 177, 386-387 (2000) Wancata J., Freidl M., Krautgartner M., Friedrich F., Matschnig T., Unger A., Gössler R., Frühwald S.: Geder aspects of parents’ needs of schizophrenia patients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 43, 968-974 (2008) Zinkler M. Allgemeine und forensische Psychiatrie – wer kümmert sich um junge Menschen mit psychotischen Störungen? Psychiatr Prax 36, 103-105 (2009). Univ.-Doz. Dr. Stefan Frühwald Ärztliche Leitung PSD der Caritas St. Pölten [email protected]. Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 200–208 Kritisches Essay Critical Essay Sind Essstörungen Suchterkrankungen? Johann F. Kinzl und Wilfried Biebl Klinische Abteilung für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck Schlüsselwörter: Essstörungen – Suchterkrankungen – Persönlichkeitsstörungen – Multiimpulsivität - Komorbiditäten Key words: Eating disorders – addiction – personality disorder – multi-impulsivity – psychiatric co-morbidities Sind Essstörungen Suchterkran­ kungen? Die Essstörungen Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und „Binge-Eating“-Störung werden üblicherweise zu den psychosomatischen Störungen gerechnet. Bewährt hat sich gerade bei der Anorexia nervosa die Unterteilung des Störungsbildes in einen „restriktiven Typus“ und in einen „bulimischen Typus“. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass die Essstörungen keine homogene Gruppe darstellen, und dass auch die einzelnen Subtypen der verschiedenen Essstörungen heterogene Störungsbilder auf mehreren Ebenen darstellen. Bei Patienten mit Essstörungen findet man sehr häufig komorbide psychische Störungen, sowohl auf der DSM-IV-Achse I als auch auf der DSM-IV-Achse II. Während sich bei der Anorexia nervosa vom restriktiven Typus und der Orthorexia nervosa vor allem Komorbiditäten mit © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Angst- und Zwangsstörungen und mit zwanghaften bzw. selbstunsicher-vermeidenden Persönlichkeitsstörungen zeigen, findet man bei der Anorexia nervosa vom bulimischen Typus, der Bulimia nervosa und der „Binge-Eating“-Störung gehäuft Komorbiditäten mit Substanzmissbrauch, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen (meist vom Cluster B und C) und Multiimpulsivität (wie vermehrte Geldausgaben, selbstschädigendes Verhalten, Diebstähle, Promiskuität). Es gibt viele Hinweise darauf, dass sowohl den Essstörungen, vor allem dem bulimische Typus der Anorexia nervosa und der Bulimia nervosa, als auch den substanzabhängigen Süchten in vielen Fällen eine gemeinsame psychische Grundstörung, nämlich eine Persönlichkeitsstörung verbunden mit emotionaler Instabilität und erhöhter Impulsivität zugrunde liegt. Das Suchtverhalten bei den Essstörungen manifestiert sich in der Dauerbeschäftigung mit Essen und Nahrung, der Abstinenzsymptomatik, dem Kontrollverlust, der häufigen Rückfallsneigung und der Fortsetzung des gestörten Essverhaltens trotz negativer Konsequenzen. Die möglichen Zusammenhänge zwischen dem gemeinsamen Auftreten der verschiedenen Essstörungen und psychischen Störungen, vor allem Suchterkrankungen, werden diskutiert. Are eating disorders addictions? The various eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, and bingeeating disorder, are characterized by severe disturbances in eating behavi- or and are seen as typical “psychosomatic disorders”. The subdivision of anorexia nervosa into two subtypes, namely “anorexia nervosa restricting type” and “anorexia nervosa bulimic type” has proved to be very good. It is to be assumed that eating disorders are not a homogeneous group, and that the various subtypes of eating disorders are also heterogeneous at several levels. Co-morbid psychiatric disorders, especially affective disorders, anxiety disorders, substance-related disorders, and personality disorders, are often found in eating- disordered patients. Many anorectics of the restrictive type and orthorectics show co-morbid psychiatric disorders such as anxiety disorders, obsessive-compulsive disorders, and avoidant or obsessive-compulsive personality disorders, while a co-morbidity of affective disorders, addiction, personality disorders, especially multi-impulsivity and borderline personality disorder, is frequently found in anorectics of bulimic type, bulimics, and binge eaters. Addictive behavior manifests itself in permanent preoccupation with food and eating, withdrawal symptoms, continuation of disturbed eating behavior in spite of negative consequences, loss of control, and frequent relapse. There are some indications that there is a basic psychological disturbance common to eating disorders, especially bulimia nervosa, and to substance-related disorders, namely a personality disorder with an emotional instability and multi-impulsivity. The possible associations between eating disorders and mental disor- Sind Essstörungen Suchterkrankungen? ders, particularly addictions, will be discussed. Essverhalten und Essstö­ rungen Essen hat neben seiner physiologischen Funktion der Energiezufuhr eine hohe Bedeutung für den Beziehungsaufbau, das Beziehungserleben, die Entstehung von Bindung und die Entwicklung des Selbst. Weiters hat es für viele Menschen eine hohe Bedeutung für die Regulation ihrer Affekte. Schon in der Kindheit hat das Essen eine vielfältige Funktion, wobei neben dem Stillen des physiologisch bedingten Hungers dem mehr emotional bedingten Appetit eine zunehmende Bedeutung zukommt. Gerade zu bestimmten Zeiten und Situationen, meistens abends, wenn narzisstische Bedürfnisse z.B. nach Liebe, Zuwendung, Anerkennung zunehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrtes Essen als Belohnung zur Abwehr negativer Gefühle wie Angst und Depressivität eingesetzt wird, wobei abhängig von der zugrunde liegenden Persönlichkeitsstruktur bzw. -störung eine gute oder schlechte Fähigkeit zur Impulskontrolle besteht. Die Regulation des Essverhaltens geschieht im wesentlichen durch den Hypothalamus, wobei der Nukleus paraventrikularis eine besonders entscheidende Rolle zu spielen scheint. Er besitzt eine Reihe von Rezeptoren, bei deren Besetzung durch die Neurotransmitter Nahrungsmenge und spezifischer Nahrungsgehalt unterschiedlich ausfallen. Die Regulation der Nahrungsaufnahme ist sehr komplex und das Ergebnis vieler Prozesse, die sich aus sensorischen, peripheren und endokrinen Signalen bzw. aus genetischen und psychosozialen Einflüssen zusammensetzen [38]. Bei der Integration der unterschiedlichen Signale spielen auch verschiedene Transmitter im Sinne einer Stimulation und Inhibition eine wichtige Rolle. 201 Dazu gehören vor allem die zentralen Monoamine Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und Serotonin und viele Neuropeptide wie Cholecystokinin, Neuropeptid Y, Substanz P, CRH u.v.a.m., die eine appetitfördernde bzw. -hemmende Wirkung haben. Folgende Essstörungen, die nach dem ICD- 10 zu den Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung mit körperlichen Störungen und Faktoren gerechnet werden, werden unterschieden (DSM-IV-TR) [12]: 1. Anorexia nervosa: gekennzeichnet durch Untergewicht verbunden mit einer Gewichtsphobie und einer Körperschemastörung: a. Asketischer oder restriktiver Typus b. Bulimischer Typus 2. Bulimia nervosa: charakterisiert durch Essanfälle mit Kontrollverlust und anschließendem kompensatorischen Verhalten: a. „Purging“-Typus b. „Nicht-Purging“-Typus 3. „Binge-Eating“-Störung (BED): gekennzeichnet durch häufige Essanfälle mit Kontrollverlust ohne kompensatorische Verhaltensweisen. 4. Arbeitshypothese: Orthorexia nervosa: „krankhafte Gesundesser“. Die Essstörungen werden einerseits klassischerweise zu den sogen. „Psychosomatischen Störungen“ gerechnet, andererseits werden sie - wie es ihre deutschen Namen „Magersucht“, „Fress-Brech-Sucht“ und „Fettsucht“ auch ausdrücken – genauso wie andere substanzunabhängige exzessive Verhaltensweisen (Kaufsucht, Spielsucht, Sexsucht, Arbeitssucht usw.) zu den „stoffungebundenen Süchten“ gerechnet [25]. Dieser Begriff hat sich deswegen bis zu einem gewissen Grad bewährt, da kein wesentlich besserer Begriff existiert. Der Begriff „Sucht“ steht dabei für Symptomatiken und exzessive Verhaltensweisen, die nicht mit der Einnahme psychotroper Substanzen in Zusammenhang stehen [39]. Wie andere psychische oder psychosomatische Krankheiten sind auch die Essstörungen multifaktoriell bedingt. Neben genetischen und konstitutionellen Ursachen kommt psychischen und psychosozialen Faktoren eine entscheidende Bedeutung bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Essstörung zu, auch wenn - wie bei den meisten psychischen Störungen bezüglich der Ätiopathogenese noch vieles nicht bekannt ist. Die Ergebnisse vieler Studien weisen darauf hin, dass es sich bei den Essstörungen um eine sehr heterogene Gruppe handelt, und dass verschiedene Subtypen existieren, die unterschiedliche neurochemische Charakteristika aufweisen. Dabei kommt dem Serotonin, aber auch dem Dopamin – wie bei anderen Süchten - eine besondere Bedeutung zu. Besonders der Botenstoff Dopamin gilt als Antriebsfaktor im menschlichen Gehirn. Das dopaminerge System ist mit Gefühlen des Vergnügens, der Belohnung und mit positiven hedonistischen Prozessen verknüpft, die mit Essen, Sexualität und bestimmten Drogen zusammenhängen. Speziell Kohlenhydrate bewirken im Gehirn die Freisetzung von Neurotransmittern, welche die Befindlichkeit positiv verändern. Neuere Untersuchungen zeigen, dass Patientinnen mit einer Anorexia nervosa auch nach einer Gewichtsnormalisierung veränderte Serotonin- und Dopamin-Spiegel im Gehirn [1]. Die Dopaminveränderungen können wiederum eine Hyperaktivität, eine Einschränkung der Nahrungszufuhr und eine Freudlosigkeit verursachen. Komborbidität von Essstö­ rungen mit anderen psy­ chischen Störungen Eine große Anzahl von Studien konnte zeigen, dass Essstörungen mit verschiedensten anderen psychischen Störungen, sowohl DSM-IV-Achse I–Störungen als auch DSM-IV-Achse J. F. Kinzl, W. Biebl II-Störungen assoziiert sind. Komorbidität bedeutet dabei das gemeinsame Auftreten verschiedener psychischer Störungen bei einer Person. Nicht nur substanzbedingte sondern auch stoffungebundene Süchte haben sehr häufig den Status von komorbiden Störungen. Untersuchungen zur Komorbidität dienen [16]: 1. der Klärung ätiopathogenetischer Zusammenhänge wie z.B. dem Herausarbeiten gemeinsamer und spezifischer Risikofaktoren, psychobiologischer, psychodynamischer oder psychosozialer Mechanismen; 2. der Entwicklung, Anpassung und Verbesserung von differentieller Diagnostik, Indikation, Therapieplanung und Therapiedurchführung. Clarkin und Kendall [10] beschäftigten sich mit dem Auftreten von Komorbidität bei psychischen Erkrankungen. Dabei unterscheiden sie zwei Formen: - „Longitudinale Komorbidität“: das sind Krankheitsbilder, die nacheinander auftreten und bei denen das Auftreten der ersten Symptomatik die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch an der zweiten Symptomatik zu erkranken. Das wurde z.B. für chronische Angststörungen beschrieben, die mit einem erhöhten Risiko verbunden sind, nachfolgend an einer Depression oder Alkoholmissbrauch zu erkranken oder dass Suchterkrankungen durch Essstörungen bedingt oder ausgelöst werden. - „Cross-sectional comorbidity“ („Überkreuz- oder QuerschnittsKomorbidität“): Sie beschreibt das gleichzeitige Auftreten zweiter gleichrangiger Symptomenkomplexe (der Achse I des DSMIV) bei einer beiden zugrunde liegenden Störung (einer Störung der Achse II, wie z.B. einer Persönlichkeitsstörung). Dazu gehört die Annahme, dass Essstörungen und Süchte durch eine zugrunde 202 liegende Erkrankung bedingt sein können. Anorektische Patientinnen weisen eine hohe Komorbiditätsrate von Angst- und Zwangsstörungen auf, wobei angenommen wird, dass mehrere psychische Störungen klinische und neuropsychiatrische Verknüpfungen mit Zwangsstörungen haben. Zum „Spektrum der Zwangsstörungen“ [8] rechnet Hollander [18] u.a. Störungen, die mit einer zwanghaften Beschäftigung mit dem eigenen Körper einhergehen, vor allem die Körperdysmorphe Störung, die Trichotillomanie, die Hypochondrie und die Anorexia nervosa. Eine Reihe von PatientInnen mit einer Anorexia nervosa zeigen zwanghafte Züge bzw. Zwangssymptome; diese sind neben depressiven Symptomen die häufigsten Begleiterscheinungen einer Magersucht. Ein großer Teil der anorektischen Patientinnen entwickelt zudem im Verlaufe der Essstörung zwanghafte Verhaltensweisen. Diese beziehen sich häufig auf die Beschäftigung mit Nahrung, Essen, Gewicht und sportlicher Betätigung. Kaye und Mitarbeiter [23] fanden bei 41% der Anorektikerinnen eine Zwangsstörung, während die Prävalenzraten bei Bulimikerinnen bei 18-33% liegen [15]. Typisch für die Essstörungen Anorexie und Bulimie, aber auch für die Körperdysmorphen Störungen sind Störungen des Körperbildes. Essstörungen und Körperbildstörungen treten oft als komorbide Störungen der Zwangsstörung auf bzw. weisen große Ähnlichkeiten mit einer Zwangsstörung auf, es bestehen aber auch Unterschiede zwischen diesen Störungen. Als häufige komorbide Erkrankungen findet man bei Patientinnen mit einer Bulimie eine Dysthymie, eine Depression oder eine bipolar affektive Psychose. Dabei haben fast alle eine Zweitdiagnose bzw. mehrere Diagnosen. Besonders häufig treten Depressionen bei Patientinnen auf, deren Essstörung als Anorexie begonnen und sich dann zu einer Bulimie ent- wickelt hat. Bei den magersüchtigen Patientinnen bestehen Komorbiditätsraten zur Depression zwischen 40 und 60%. Die Überlegung, Essstörungen als eine Variante von affektiven Störungen zu klassifizieren, hat aber wenig Anklang gefunden [45]. Während Bulimikerinnen meist niedrige Serotonin-Spiegel aufweisen, ergeben andere Studien oft hohe Serotonin-Spiegel in verschiedenen Hirnarealen. Es wird vermutet, dass einerseits diese hohen SerotoninSpiegel zu einer starken inneren Unruhe und Angst führen, es aber andererseits durch die Reduktion der Kalorienzufuhr zu einem Absinken der Serotonin-Spiegel im Gehirn kommt, die zu einem Gefühl der innere Ruhe beitragen. Von den morbid Adipösen (BMI>40; etwa 1000 Adipöse in den letzten 10 Jahren; Verhältnis Frauen zu Männer = 4:1), die zur Voruntersuchung wegen einer bariatrischen Operation die Psychosomatische Ambulanz der Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck aufsuchten, wiesen etwas mehr als ein Drittel eine DSM-IVAchse I-Störung (je 15% eine Depression oder eine Anpassungsstörung, 4% eine Angststörung und 4% eine somatoforme Störung auf), und 15% eine DSM-IV-Achse II-Störung, d.h. eine Persönlichkeitsstörung auf, wobei es sich vor allem um eine selbstunsicher-vermeidende, eine emotional instabile, eine dependente oder eine paranoide Persönlichkeitsstörung handelte. [27]. Es fanden sich bei Adipösen mit einer BED - im Gegensatz zu Adipösen ohne eine BED - eine erhöhte Neigung zur Depression, Angststörungen und Suizidalität. Zahlreiche Familienstudien fanden erhöhte Prävalenzraten von Stimmungsstörungen bei Verwandten von Essgestörten [32]. Bestimmte psychische Störungen kommen häufig gemeinsam bei einer Einzelperson, als auch innerhalb von Familien vor, weshalb bei diesen Störungen auch von einem gemeinsamen kausalen Faktor ausgegangen werden kann. Sind Essstörungen Suchterkrankungen? Hudson und Pope [19,20] sprechen dabei von den „Affective Spectrum Disorders“ (ASD), einer Gruppe von Krankheiten, die auf verschiedene Antidepressiva ansprechen, weshalb angenommen wird, dass sie gemeinsame genetische Abnormalitäten aufweisen. Zu diesen Störungsbildern rechnen die Autoren die Major Depression, ADHS, Bulimie, Kataplexie, Dysthymie, Fibromyalgie, GAD, Colon irritabile, Migräne, Zwangsstörungen, Panikstörungen, PTSD, prämenstruelles Syndrom und dissoziale Phobie. Eine Familienstudie der selben Autoren [20] konnte zeigen, dass die verschiedenen Störungsbilder des ASD in Familien gehäuft auftreten, sodass von gemeinsamen pathophysiologischen Charakteristika ausgegangen wird. Viele klinische und epidemiologische Untersuchungen konnten zeigen, dass ein Großteil der Patientinnen mit einer Anorexia nervosa und Bulimia nervosa eine oder mehrere Angststörungen aufweisen [15, 45]. Dabei handelt es sich vor allem um eine soziale Phobie, eine spezifische Phobie oder um eine Zwangsstörung. Es besteht meist eine hohe Assoziation von Angststörungen mit schweren Essstörungssymptomen [50]. Silberg und Bulik [47] identifizierten bei Zwillingen einen genetischen Faktor, der die Anfälligkeit für die Entwicklung von Symptomen einer Überängstlichkeit, Trennungsängsten, einer Depression und einer Essstörung beeinflusst. Rosenberger und Mitarbeiter [42] untersuchten eine Gruppe morbid Adipöser vor einer bariatrischen Operation und fanden, dass bei mehr als einem Drittel bereits einmal eine psychische Störung bestanden hat bzw. etwa ein Viertel zum Zeitpunkt der Untersuchung eine psychische Störung aufwiesen. Dabei handelt es sich bei 22% um eine Depression, bei 15% um eine Angstkrankheit und bei 14% um eine Essstörung. Eine weitere Studie [49] konnte zeigen, dass Essgestörte, und zwar sowohl normalgewichtige Bulimikerinnen als auch Frauen mit einer „Binge-Eating“- 203 Störung eine oder mehrere Angststörungen als komorbide psychische Störung, vor allem eine generalisierte Angststörung und eine soziale Phobie, aufwiesen; auch zeigte sich eine hohe Assoziation zwischen der Frequenz des „Binge-Eatings“ bzw. des Erbrechens und Angststörungen und substanzgebundenen Süchten. Persönlichkeitsstörungen werden bei Essgestörten mit 27-93% angegeben. Besonders häufig werden Komorbiditäten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, histrionischen Persönlichkeitsstörungen und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen gefunden. Dabei scheinen diese Persönlichkeitsstörungen bei Bulimiepatientinnen, deutlich verbreiteter zu sein als bei Magersüchtigen, besonders dann wenn gleichzeitig ein Alkoholmissbrauch besteht. Bei Personen mit einer Anorexia nervosa vom restriktiven Typus ist dagegen die zwanghafte, die dependente und/ oder selnstunsichere Persönlichkeitsstörung am häufigsten zu finden [44]. Auch die Ergebnisse von Pickering und Mitarbeiter [38] im Rahmen einer epidemiologischen Untersuchung amerikanischer Frauen und Männer zeigen, dass bei den adipösen Frauen ein extremes Übergewicht mit antisozialer und/oder selbstunsicher-vermeidender Persönlichkeitsstörung assoziiert war. Die belgische Arbeitsgruppe um Vandereycken [9] konnte in ihrer Untersuchung bezüglich Persönlichkeitsstrukturen bei Essstörungen zeigen, dass einerseits bestimmte Persönlichkeitsprofile bzw. Persönlichkeitsstörungen bei den einzelnen Subtypen der Essstörungen gehäuft gefunden werden, dass aber andererseits auch bei den einzelnen Subtypen eine beträchtliche Varianz an Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsstörungen besteht. Spindler und Milos [49] untersuchten den Zusammenhang zwischen der Schwere einer Essstörung und den psychiatrischen Komorbiditäten. Dabei korrelierten Angst- und Affektstörungen vor allem mit gewichtsund körperbezogenen Ängsten, die Häufigkeit der Essanfälle und die Schwere des Kompensationsverhaltens mit den DSM-IV-Achse-I-Störungen Angst und Substanzabhängigkeit und mit Persönlichkeitsstörungen von Cluster B. Komborbidität von Essstö­ rungen und Störungen mit Substanzkonsum Auf der biologischen Ebene lassen sich Ähnlichkeiten zwischen den Essstörungen Anorexia nervosa bzw. Bulimia nervosa und den stoffgebundenen Süchten nachweisen. Es ist bekannt, dass körperliche Aktivität und Hungern die dopaminerge Belohnungsbahn des Gehirns aktivieren [3]. Einige Autoren [z.B. 6] meinen auch, dass Essstörungen eine Form von Drogenabhängigkeit sind, weil sie ähnliche klinische und biologische Charakteristika zeigen wie Rauchen, Alkoholismus und Kokainmissbrauch. Dazu zählen: - die gedankliche Dauerbeschäftigung bezüglich der Beschaffung, des Verzehrs und der Zubereitung von Nahrung („Graving“) („Niemand denkt so viel an Essen, wie der, der hungert, fastet oder Diät hält“); - die Fortsetzung des essgestörten Verhaltens trotz negativer sozialer, gesundheitlicher und finanzieller Konsequenzen (z.B. Isolation, Freudlosigkeit, Schwächegefühl, Hypotonie, Hypothermie, Hyperaktivität, Angst, Diebstähle); - die Toleranzentwicklung (das zu erreichende Gewicht wird immer niedriger angesetzt); - der Kontrollverlust (wenn z.B. die Bulimikerin einmal angefangen hat zu essen, isst sie meist so lange, bis sie nicht mehr kann und dann erbricht); - die starke Rückfallsneigung, auch nach längerer Abstinenz. Nicht nur bei den Patienten mit einer Anorexie und einer Bulimie, sondern J. F. Kinzl, W. Biebl auch bei Patienten mit einer „BingeEating“-Störung findet man typische Zeichen der Abhängigkeit: - das Denken dreht sich meist um das Essen (starkes Konsumbedürfnis); - das Essen ist häufig mit einem Kontrollverlust („Fressanfall“) verbunden; - das gestörte Essverhalten wird trotz zunehmend negativer gesundheitlicher Konsequenzen (z.B. Diabetes mellitus, metabolisches Syndrom) fortgesetzt; - psychische Abstinenzsymptome wie das Auftreten von Unruhe und Spannung, wenn nichts Essbares zur Verfügung steht. Während bei Patientinnen mit einer Anorexia nervosa vom restriktiven Typ selten ein Substanzmissbrauch als komorbide Störung vorliegt, besteht bei Patientinnen mit einer Anorexia nervosa vom bulimischen Typ, mit einer Bulimia nervosa und einer „Binge-Eating“-Störung eine hohe Komorbidität mit anderen Abhängigkeitsstörungen; so weisen bis zu 30% der bulimischen PatientInnen einen Alkohol-, Cannabis-, Amphetamin- und/oder Benzodiazepinmissbrauch bzw. -abhängigkeit als komorbide Störungen auf. Alkohol und Cannabis führen häufig zu einer Appetitsteigerung und begünstigen direkt und indirekt einen Kontrollverlust bezüglich des Essverhaltens [43]. Weiters besteht in vielen Fällen ein Missbrauch von Substanzen wie Laxantien, Diuretika, Schilddrüsenhormone und Süßstoffe, die nicht zu den abhängigkeitserzeugenden Substanzen gerechnet werden. Bulimikerinnen scheinen eine besonders starke Neigung zu Missbrauch von Alkohol und anderen Substanzen zu haben. So fanden Mitchell und Mitarbeiter [34] bei 34% der Patientinnen mit einer Bulimie eine Vorgeschichte von Alkohol- und Drogenproblemen, und bei 18% eine vorübergehende Behandlung wegen Tablettenabhängigkeit, wogegen bei anorektischen Patientinnen wesentlich niedrigere 204 Komorbiditätsraten zur Substanzabhängigkeit oder –missbrauch vorzuherrschen scheinen. Besonders bei PatientInnen mit einer bulimischen Symptomatik werden diese Substanzen alternativ zur Spannungs- und Affektregulation eingesetzt. Es gibt eine Anzahl von Theorien zur Erklärung der substantiellen Komorbidität zwischen Essstörungen und substanzabhängigen Störungen. Marrazzi [33] weist darauf hin, dass endogene Opioide auch während der initialen Phase des Hungerns ausgeschüttet werden und so eine Abhängigkeit vom Hungern erzeugen könnten. Durch atypische endogene Opioidsysteme könnten einige Individuen anfälliger sein, so dass bei ihnen eine restriktive Kost die Sucht triggert. Davis und Claridge [11] konnten bei Essgestörten zeigen, dass die Neigung zu süchtigem und zwanghaftem Verhalten in enger Beziehung zur Beschäftigung mit dem Gewicht und exzessiver körperlicher Aktivität steht. Viele Studien zeigen erhöhte Raten für Substanzmissbrauch bei Patientinnen mit Essstörungen. So wies Russell [43] schon in seiner ersten Beschreibung der Bulimie darauf hin, dass viele Bulimiepatientinnen dazu neigen, Drogen und Alkohol zu konsumieren. Auch Mitchell [34] fand bei mehr als einem Drittel der Bulimikerinnen Probleme mit Alkohol und Drogen. Insgesamt liegen die Angaben für die Prävalenz von Alkoholproblemen bei Patientinnen mit Essstörungen zwischen 9% und 50%. Auch umgekehrt wurden erhöhte Raten von Essstörungen bei Patienten mit einer Substanzabhängigkeit gefunden, wobei die Prävalenzraten für Essstörungen zwischen 8% und 41% schwanken. 40% der von Lacey und Mourelli [29] befragten Frauen mit einem Alkoholproblem gaben ein regelmäßiges „Binge-Eating“-Verhalten an. Diese Autoren betonen auch die Ähnlichkeiten im Verhalten zwischen den Fressanfällen von Bulimikerinnen und den Trinkanfällen von Alkoholikerinnen, gekennzeichnet durch einen intermittierenden Kontrollverlust und Zwangsgefühlen. Riva und Mitarbeiter [41] weisen wie andere Forscher - bei den morbid Adipösen, besonders denen mit einer BED, auf eine komplexe Ätiopathogenese der Störung hin und darauf, dass der genetische Einfluss (z.B. der Mangel an Dopaminrezeptoren) und psychosoziale Faktoren (z.B. der Drang nach Schlankheit und Diäten) als Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem Körper zusammenwirken. Adipöse zeigen in Bezug auf den Kontrollverlust und den zwanghaften Konsum von Nahrung große Ähnlichkeiten mit drogenabhängigen Personen, ohne dass die Mechanismen schon voll verstanden werden [53]. Es besteht auch eine Ähnlichkeit zwischen der morbiden Adipositas und der Substanzabhängigkeit in dem Sinne, dass beide ein Defizit an Dopaminrezeptoren im Striatum haben [41]. Dabei ist dieses Defizit umso stärker ausgeprägt, je übergewichtiger die Betroffenen sind. Es ist nicht bekannt, ob die Adipositas dieses Defizit bewirkt oder umgekehrt dieses Defizit an D2-Rezeptoren die Entstehung einer Adipositas begünstigt [53]. Nora Volkow [50] konnte mit Hilfe des PET zeigen, dass der jeweilige BMI der Adipösen sehr eng mit dem Dopaminrezeptor zusammen hängt. Je höher das Körpergewicht ist, desto weniger ist von der radioaktiv markierten Substanz Racloprid von D2Rezeptoren im Nucleus accumbens gebunden. Die Forscher vermuten, dass extrem Übergewichtige – wie auch andere Suchtkranke – unter einem Dopaminmangel leiden und deswegen ständig nach neuer Belohnung d.h. nach Essen, suchen. Den dadurch ausgelösten Dopaminschub versucht nun das Gehirn auszugleichen, indem es die Zahl der D2-Rezeptoren verringert. Eine Dysregulation der Dopaminwiederaufnahme stellt möglicherweise den gemeinsamen pathophysiologischen Mechanismus bei Essstörungen vom BED-Typ und bei Störungen im Zusammenhang mit Psychotropen Substanzen dar. Sind Essstörungen Suchterkrankungen? White und Grilo [54] untersuchten bei adipösen Frauen das komorbide Vorkommen einer psychischen Störung mit einer BED im Zusammenhang mit dem Nikotinmissbrauch. Dabei wiesen Raucherinnen signifikant häufiger eine komorbide psychische Störung auf als Nichtraucherinnen. Die Autoren vermuten, dass bei einigen adipösen Frauen mit einer BED Fressattacken und der Zigarettenkonsum eine gemeinsame Funktion haben, nämlich der Regulation negativer Affekte und der Angst dienen. Eigene Erhebungen an morbid Adipösen zeigten, dass zum Zeitpunkt der Erhebung bei 22% ein Nikotinmissbrauch bzw. -abhängigkeit bestand, und dass früher zusätzliche 18% eine solche Abhängigkeit aufgewiesen haben (bei fast allen kam es nach dem Aufhören mit dem Rauchen zu einer meist deutlichen Gewichtszunahme) [27]. Es ist bekannt, dass Rauchen, und zwar das Nikotin, meist mit einer verminderten Nahrungsaufnahme und einem niedrigeren Gewicht einhergeht, was auch besonders bei Frauen mit der häufigste Grund ist, zu rauchen. Neben der häufigen Nikotinabhängigkeit wiesen etwa 4% morbid Adipöser einen Alkoholmissbrauch bzw. Alkoholabhängigkeit und knapp mehr als 4% eine andere Suchtform, vor allem eine Kaufsucht oder Spielsucht, auf [27]. Andere Studien konnten zeigen, dass Zusammenhänge zwischen dem „Binge-Eating“-Verhalten und dem Alkoholkonsum bestehen, und dass Drogen mit Nahrung um Andockstellen im Gehirn konkurrieren, die für die Belohnung zuständig sind [28]. Es wird angenommen, dass das Überessen und Fettleibigkeit als protektive Faktoren dazu dienen, die Belohnung durch Drogen und Abhängigkeit von Drogen zu reduzieren. Verschiedene Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen dem BMI und dem Alkoholkonsum bei adipösen Frauen und fanden eine inverse Beziehung zwischen dem Körpergewicht und dem Alkoholkonsum [27, 28]. 205 Diskussion Ob es sich bei den Essstörungen um eine Suchtkrankheit oder um eine andere psychische Störungen wie Angst- bzw. Zwangsstörungen oder Depressionen handelt, ist Thema vieler Diskussionen, wobei es deutliche Hinweise darauf gibt, dass einerseits interindividuelle Unterschiede bestehen, und andererseits Mischformen bzw. Subtypen vorkommen. Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass die Patienten mit einer Essstörung keine homogene Gruppe sind, sondern eine sehr heterogene Gruppe darstellen. Dabei betrifft die Heterogenität sowohl biologische und psychosoziale Vulnerabilitäten als auch die zugrunde liegenden Persönlichkeitsstrukturen und psychiatrischen Komorbiditäten. Auch innerhalb der einzelnen Gruppen handelt es sich nicht um homogene Störungsbilder; es ist sinnvoll, die Essstörungen entlang eines Kontinuums zu betrachten, das einerseits von einer – fast – völligen Restriktion des Essverhaltens bis hin zum „Binge-Purge“-Verhalten, und andererseits von fehlender bis hin zu schwerer Persönlichkeitsstörung bzw. fehlenden bis mehrfachen komorbiden psychischen Störungen reicht. Einige Befunde sprechen dafür, dass bei vielen Essgestörten eine allgemeine psycho-biologische Verwundbarkeit besteht und die Betroffenen durch ihr Hungern und/oder Fressanfälle versuchen, ihre Affekte dadurch zu regulieren. Das Hungern, aber wahrscheinlich auch das Essen, führt zu somato-psychischen Veränderungen (z.B. erhöhte Störbarkeit des Essverhaltens, emotionale Labilisierung) [24] und auch dazu, dass der Körper vermehrt Endorphine produziert, was deswegen suchtfördernd ist, weil es die Dopaminproduktion im mesolimbischen System anregt, was wiederum als Belohnung wirkt. Warum die einen Alkohol, Nikotin oder Substanzen, die anderen Essen oder Nichtessen als „Droge“ verwenden, kann nicht immer schlüssig beantwortet werden; soziokulturelle Faktoren und andere, zum Teil noch nicht bekannte Faktoren spielen sicherlich eine erhebliche Rolle. Holderness und Mitarbeiter [17] konnten in ihrem Überblicksartikel bezüglich der Komorbidität von Essstörungen und Substanzmissbrauch zeigen, dass entsprechende Assoziationen häufig bei der Bulimie und bei den Anorexien vom bulimischen Typ gefunden werden, deutlich seltener bei der Anorexia nervosa vom restriktiven Typ. Auch bei den Orthorektikerinnen zeigte sich kein erhöhter Substanzkonsum, aber vermehrt ängstliche und zwanghafte Persönlichkeitscharakteristika [26]. Bezüglich des Zusammenhanges von Essstörungen und Suchterkrankungen lassen sich folgende Hypothesen aufstellen [13, 37]: - Essstörungen und Suchterkrankungen sind eigenständige Krankheitsbilder, die in keinem speziellen Zusammenhang stehen und unabhängig voneinander auftreten. - Essstörungen und Suchterkrankungen bedingen sich gegenseitig (wenn z.B. eine Patientin an einer Essstörung leidet, prädisponiert sie dies für die Ausbildung einer Suchterkrankung). - Essstörungen sind Suchterkrankungen. - Essstörungen und Süchten liegt ein übergeordnetes Syndrom zugrunde wie z.B. eine Persönlichkeitsstörung; d.h. die Essstörung und die Sucht sind nur Symptome oder Ausprägungen des übergeordneten Syndroms Viele Untersuchungen konnten zeigen, dass einerseits eine gewisse Korrelation zwischen der Schwere einer Essstörung und dem Ausprägungsgrad psychischer Komorbiditäten besteht, und andererseits, dass pathologische Persönlichkeitseigenschaften auch vor Beginn und nach dem Abklingen der Essstörung gehäuft bestehen, d.h. wohl einige Fehlverhaltensweisen Ausdruck des J. F. Kinzl, W. Biebl gestörten, zum Teil chaotischen Essverhaltens sind wie z.B. ängstliches oder zwanghaftes Verhalten, andere aber unabhängig von der Essstörung zu sehen sind. Mangweth und Mitarbeiter [32] konnten in einer Studie bei Essgestörten eine Häufung von Gemütserkrankungen finden, die vergleichbar ist mit der, die bei Depressiven gefunden wird. Ihre Befunde legen die Vermutung nahe, dass den Essstörungen und Gemütserkrankungen gemeinsame familiäre und vielleicht auch gemeinsame genetische Faktoren zugrunde liegen, eine Hypothese, die auch von Zwillingsstudien unterstützt wird [51, 52]. Das Vorliegen einer komorbiden Persönlichkeitsstörung lässt sich bei PatientInnen mit Essstörungen häufig nachweisen und stellt dabei einen besonderen Risikofaktor für einen zusätzlichen Substanzmissbrauch dar [5]. Dabei zeigte sich ein starkes Überwiegen von zwanghaftem Verhalten wie Perfektionismus und Rigidität und Zwangsstörungen bei Anorektikerinnen vom restriktiven Typ. Dagegen zeigte sich das Muster einer ausgeprägten Impulsivität und einer dramatisch-unausgeglichenen Persönlichkeitsstörung gehäuft bei bulimischen Patientinnen [6]. „Binge-Eater“ oder Alkoholmissbraucher zeigen meist einen hohen Grad an Impulsivität und sozial abweichendem Verhalten. Benjamin und Wulfert [2] bezeichnen diese Gruppe als „Externalisierer“. Bei Vorliegen beider Fehlverhaltensweisen zeigten die Betroffenen einen besonders hohen Grad an emotionaler Instabilität („Internalisierer“). Es wird angenommen, dass die Impulsivität, die instabile Stimmungslage und bestimmte Formen von Angst (besonders die soziale Phobie und Panik) die Schlüsselmerkmale sowohl für die Bulimie und die „Binge-Eating“-Störung als auch für den Substanzmissbrauch darstellen [16]. Hubert Lacey [29, 30] entwickelte den Begriff der „Multiimpulsivität“ bei Patienten mit einer Bulimie, meist 206 vom „Purging“-Typus. Die Multiimpulsivität ist dabei definiert durch mindestens drei der folgenden Kennzeichen: - schwerer Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit - Suizidversuche - selbstschädigendes Verhalten - Kaufsucht - sexuelle Beziehungen mit unbekannten Personen. Selbstschädigendes Verhalten, das fast süchtiges Ausmaß annimmt, wird vor allem bei Patienten mit einer Bulimie, einem Substanzmissbrauch und einer Persönlichkeitsstörung vom Cluster B gefunden, während dieses Verhalten bei Anorektikerinnen vom restriktiven Typ und bei Angststörungen eher selten gefunden wird. Eine japanische Untersuchung von Nagata und Mitarbeitern [36] fand eine Multiimpulsivität bei 2% der Anorektikerinnen vom restriktiven Typ, bei 11% der Anorektikerinnen vom bulimischen Typ, in 18% bei Patientinnen mit einer Bulimia nervosa und in 2% einer Kontrollgruppe. Bei 80% der multiimpulsiven Patientinnen ließ sich ein selbstschädigendes Verhalten schon vor Beginn der Bulimie nachweisen. Bei einem Großteil der Bulimiepatientinnen bestand eine enge Beziehung zwischen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und der Multiimpulsivität. Die Autoren schließen aus ihren Ergebnissen, dass bei dieser Patientengruppe sowohl eine primäre Multiimpulsivität, also eine, die bereits vor dem Auftreten der Essstörung besteht, als auch eine sekundäre Multiimpulsivität vorliegen kann, also eine, die sich als Resultat des chaotischen Essverhaltens entwickelt. Lilenfeld und Mitarbeiter [31] fanden bei Frauen mit einer Bulimie und einem komorbiden Substanzmissbrauch gehäuft eine erhöhte Impulsivität und verschiedene Persönlichkeitsstörungen vom Cluster B. Auch kamen diese Frauen oft aus Familien, in denen Substanzabhängigkeiten, Angststörungen, Impulsivität und affektive Instabilität häufig vorkamen. Die Autoren vermuten, dass die familiäre Vulnerabilität für erhöhte Impulsivität und affektiver Instabilität zur Entwicklung einer Substanzabhängigkeit bei einer Subgruppe von Bulimikerinnen beiträgt. Die traumatischen Erfahrungen erhöhen dabei sowohl das Risiko für die Entwicklung einer Essstörung, meist vom bulimischen Typ, die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung, vor allem aus dem Cluster B, oder/und Substanzmissbauch oder –abhängigkeit. Als gemeinsame Basis sowohl für die Essstörung und das süchtige Verhalten dürfte in vielen Fällen - im Sinne der „Cross-sectional comorbidity“ - die Persönlichkeitsstörung verbunden mit emotionaler Instabilität und Impulsivität sein. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die meisten Daten bei Essgestörten auf Frauen beziehen und nicht ohne weiteres auf Männer übertragen werden können. Es gibt aber viele Indizien - sowohl aus unserem eigenen Klientel als auch aus der Literatur dafür, dass Männer mit Essstörungen – egal welcher Art – eine stärker ausgeprägte Psychopathologie aufweisen als essgestörte Frauen und nicht nur Persönlichkeitsstörungen vom Cluster B sondern auch vom Cluster A gehäuft gefunden werden. Das Wissen um die häufige Komorbidität von psychischen Störungen und Persönlichkeitsstörungen bei PatientInnen mit einer Anorexia nervosa, einer Bulimia nervosa und/oder einer Adipositas mit einer Essstörung ist auch deswegen sehr wichtig, damit die therapeutischen Maßnahmen (Psychotherapie, Pharmakotherapie, Ernährungsmanagement) individuell ausgerichtet werden können, d.h. auch die komorbiden Störungen müssen berücksichtigt werden, um effizient zu sein. Dies stimmt mit den Therapierichtlinien der APA (2000) überein, dass neben den symptomfokussierten Therapiemaßnahmen der Persönlichkeitspathologie und den damit verbundenen Konflikten in der Behandlung von Essgestörten eine besondere Aufmerksamkeit ge- Sind Essstörungen Suchterkrankungen? schenkt werden muss, d.h. es gilt das „psychosomatische Prinzip“, dass „nicht nur die Krankheit, sondern vor allem der Kranke behandelt werden muss“. Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Barbarich N.C., Kaye W.H., Jimerson D.: Neurotransmitter and imaging studies in anorexia nervosa: new targets for treatment. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord 2, 61-72 (2003). Benjamin L., Wulfert E.: Dispositional correlates of addictive behaviors in college women: binge eating and heavy drinking. Eat Behav 6, 197-209 (2005). Bergh C., Sodersten P.: Anorexia nervosa, self-starvation and the reward of stress. Nat Med 2, 21-22 (1996). Bratman S.: Orthorexia nervosa: Overcoming the obsession with healthful eating. Broadway Books, New York 2000. Braun B.L., Sunday S.R., Halmi K.A.: Psychiatric comorbidity in patients with eating disorders. Psychol Med 24, 859867 (1994). Bruce K.R., Steiger H.: Treatment implications of Axis-I comorbidity in eating disorders. Eat Disord 13, 93-108 (2005). Cabanac M., Frankham P.: Evidence that transient nicotine lowers the body weight set point. Physiol Behav 76, 539542 (2002). Castle D.J., Phillips K.A.: Obsessivecompulsive spectrum of disorders: a defensible construct? Aust NZ J Psychiatry 40, 114-120 (2006). Claes L., Vandereycken W., Luyten P., Soeness B., Pieters G., Vertommen H.: Personality protypes in eating disorders based on the Big Five model. J Person Disord 20, 401-16 (2006). Clarkin J.F., Kendall P.C.: Comorbidity and Treatment Planning: Summary and Future Directions. J Consult Clin Psychology 60, 904-8 (1992). Davis C., Claridge G.: The eating disorders as addiction: a psychobiological perspective. Addict Behav 23, 463-475 (1998). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-IVTR). Hogrefe, Göttingen 2003. Eger J.: Essstörungen und Suchterkrankungen. Dissertation, TU München 2004. Godart N.T., Flament M.F. Perdereau F., Jeammet P.: Comorbidity between eating disorders and anxiety disorders: a review. Int J Eat Disord 32, 253-270 (2002). 207 [15] Hart K.E.: Obsessive-Compulsiveness in obese weight-loss patients and normal weight adults. J Clin Psychol 47, 358-360 (1991). [16] Herzog T., Stiewe M., Sandholz A., Hartmann A.: Borderline-Syndrom und Essstörungen. Psychother Psychosom medPsychol 45, 97-108 (1995). [17] Holderness C.C., Brooks-Gunn J., Warren M.P.: Comorbidity of eating disorders and substance abuse review of literature. Int J Eat Disord 16, 1-34 (1994). [18] Hollander E.: Obsessive-compulsive spectrum disorders: an overview. Psychiatr Annals 23, 355-358 (1993). [19] Hudson J.I., Pope H.G.: Affective spectrum disorder: does antidepressant response identify a family of disorders with a common pathophysiology? Am J Psychiatry 147, 552-564 (1990). [20] Hudson J.I., Mangweth B., Pope H.G., DeCol C., Hausmann A., Gutweniger S., Laird N.M., Biebl W., Tsuang M.T.: Family study of affective spectrum disorder. Arch Gen Psychiatry 60, 170-177 (2003). [21] Jarry J.L., Vaccarino F.J.: Eating disorder and obsessive-compulsive disorder: neurochemical and phenomenological commonalities. J Psychiatry Neurosci 21, 36-48 (1996). [22] Jo Y.H., Talmage D.A., Role L.W.: Nicotinic-receptor-mediated effects on appetite and food intake. J Neurobiol 53, 618-632 (2002). [23] Kaye W.H., Bulik C.M., Thornton L., Barbarich N., Masters K.: Comorbidity of Anxiety Disorders With Anorexia and Bulimia Nervosa. Am J Psychiatry 161, 2215-2221 (2004). [24] Keys A., Brozek J., Henschel A., Mickelsen O., Taylor H.L.: The Biology of Human Starvation. University of Minnesota Press, Minneapolis (1950) [25] Kinzl J.F., Trefalt E.: Esssucht – Theorie und Empirie. In: Poppelreuter S., Gross W.: Nicht nur Drogen machen süchtig. Beltz, Weinheim 2000. [26] Kinzl JF, Hauer K, Traweger C, Kiefer I. Orthorexia nervosa in dieticians. Psychother Psychosom 75, 395-6 (2006). [27] Kinzl J.F.: Bedeutung der psychologischen Betreuung morbid Adipöser nach bariatrischer Operation. Aktuel Ernaehr Med 32, 1-4 (2007). [28] Kleiner K.D., Gold M.S., Frost-Pineda K., Lenz-Brunsman B., Perri M.G., Jacobs W.S.: Body mass index and alcohol use. J Addict Dis 23, 105-118 (2004). [29] Lacey J.H., Moureli E.: Bulimic alcoholics: Some findings of a clinical subgroup. Br J Addiction 81: 389-93 (1986). [30] Lacey JH. Self-damaging and addictive behaviour in bulimia nervosa: A catchment area study. Br J Psychiatry 163: 190-4 (1995). [31] Lilenfeld L.R., Kaye W.H., Greeno C.G., Merikangas K.R., Plotnicor K., Strober M., Bulik C.M., Nagy L.: Psychiatric disorders in women with bulimia nervosa and their first degree relatives: effects of comorbid substance dependence. Int J Eat Disord 22, 253-64 (1997). [32] Mangweth B., Hudson J.I., Pope H.G., Hausmann A., DeCol C., Laird N.M., Biebl W., Tsuang M.T.: Family study of the aggregation of eating disorders and mood disorders. Psychol Med 33, 13191323 (2003). [33] Marrazzi M.A., Luby E.D., Kinzie J., Munjal I.D., Spector S.: Endogenous codein and morphine in anorexia and bulimia nervosa. Life Sci 60, 1741-7 (1997). [34] Mitchell J.E., Hatsukami D., Eckert E.D., Pyle R.L.: Characteristics of 275 patients with bulimia nervosa. Am J Psychiatry 142, 482-485 (1985). [35] Miyata G., Meguid M.M., Fetissov SO, Torelli G.F., Kim H.J.: Nicotine`s effect on hypothalamic neurotransmitters and appetite regulation. Surgery 126, 255263 (1999). [36] Nagata T., Kawarada Y., Kiriike N., Iketani T.: Multi-impulsitivity of Japanese patients with eating disorders: primary and secondary impulsivity. Psychiatry Res 17, 239-50 (2000). [37] Neale M.C., Kendler K.S.: Models of comorbidity for multifactorial disorders. Am J Hum Genet 57, 935-953 (1995). [38] Pickering R.P., Grant B., F., Chou S.P., Compton W.M.: Are overweight, obesity, and extreme obesity associated with psychopathology? Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 68, 998-1009 (2007). [39] Poppelreuter S., Gross W.: Nicht nur Drogen machen süchtig. Beltz, Weinheim 2000. [40] Pudel V., Westenhöfer J.: Ernährungspsychologie. Hogrefe, Göttingen 2003. [41] Riva G., Bacchetta M., Cesa G., Conti S., Castelnuovo G., Mantovani F., Molinari E.: Is severe obesity a form of addiction? Rationale, clinical approach, and controlled clinical trial. Cyberpsychol Behav 9, 457-479 (2006). [42] Rosenberger P.H., Henderson K.E., Grilo C.M.: Psychiatric disorder comorbidity and association with eating disorders in bariatric surgery patients: A cross-sectional study using structured interviewbased diagnosis. J Clin Psychiatry 67, 1080-1085 (2006). [43] Russell G.: Bulimia nervosa: An ominous variant of anorexia nervosa. Psychol Med 9, 429-48 (1979). [44] Sansone R.A., Levitt J.L., Sansone L.A.: The prevalence of personality disorders among those with eating disorders. Eat Disord 13, 7-21 (2005). J. F. Kinzl, W. Biebl [45] Schwalberg M.D., Barlow D.H., Alger S.A., Howard L.J.: Comparison of bulimics, obese binge eaters, social phobics, and individuals with panic disorder on comorbidity across DSM-III-R anxiety disorders. J Abnorm Psychol 101, 675681 (1992). [46] Schweiger U., Peters A., Sipos V.: Essstörungen. Thieme, Stuttgart 2003. [47] Silberg J.L., Bulik C.M.: The developmental association between eating disorders symptoms and symptoms of depression and anxiety in juvenile twin girls. J Child Psychol Psychiatry 46, 1317-1326 (2005). [48] Södersten P., Bergh C.: Comorbidity of Anxiety With Eating Disorders and OCD. Am J Psychiatry (Letter)163, 327 (2006). [49] Spindler A., Milos G.: Links between eating disorder symptom severity and 208 [50] [51] [52] [53] psychiatric comorbidity. Eat Behav 8, 364-373 (2007). Volkow N., Wiese R.A.: How can drug addiction help us understand obesity? Nature Neuroscience 8, 555-560 (2005). Wade T.D., Bulik C.M., Neale M., Kendler K.S.: Anorexia nervosa and major depression: shared genetic and environmental risk factors. Am J Psychiatry 157, 469-471 (2000). Walters E.E., Neale M.C., Eaves L.J., Heath A.C., Kessler R.C., Kendler K.S.: Bulimia nervosa and major depression: a study of common genetic and environmental factors. Psychol Med 22, 617622 (1992). Wang G., Volkow N., Logan J., Pappas N., Wong C., Zhu W., Netusll N., Fowler J.: Brain dopamine and obesity. The Lancet 357, 354-357 (2004). [54] White M.A., Grilo C.M.: Psychiatric comorbidity in binge-eating disorder as a function of smoking history. J Clin Psychiatry 67, 594-599 (2006). Univ. Prof. Dr. Johann F. Kinzl Klinische Abteilung für Psychosomatische Medizin Universitätsklinik für Psychiatrie Medizinische Universität Innsbruck Email: [email protected] Kritisches Essay Critical Essay Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 209–216 „Sexsucht“: Chimäre oder klinisches Syndrom? Plädoyer für eine klinische Konzeptualisierung Roland Wölfle Therapiestation Lukasfeld der Stiftung Maria Ebene, Meiningen Schlüsselwörter: Sexualität – Abhängigkeit – Sexsucht – Diagnose Keywords: sexuality – dependency – sexual addiction – diagnosis Sexsucht“: Chimäre oder klinisches Syndrom? Plädoyer für eine klinische Konzeptualisierung Das Phänomen der Sexsucht als klinisches Syndrom gilt als umstritten. In diesem Artikel werden zunächst einige mythologische, historische und literarische Quellen erwähnt, die auch namensgebend Pate gestanden sind, z.B. die Nymphomanie. Eine wissenschaftliche Befassung gab es schon im 19. Jahrhundert, in dieser Zeit erfolgte aber auch eine stark moralisch gefärbte Pathologisierung, die insbesondere bei Frauen zu barbarisch anmutenden „Therapien“ und Maßnahmen geführt hat. Im ICD-10 und DSM-IV finden sich keine Kategorien für „Sexsucht“, die mit der klinischen Erfahrung vieler Fachleute korrespondieren würde. Die Anwendung der Abhängigkeitskriterien der WHO wäre grundsätzlich möglich, scheitert aber daran, dass es große interkulturelle und individuelle Unterschiede gibt, wenn es etwa darum geht, eine normale Sexualität als Ausgangspunkt für pathologische Abweichungen zu definieren. Es werden © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 dann einige nosologische Konzepte und therapeutische Ansätze vorgestellt. Einer Kritik am Begriff „Sexsucht“ folgt die Kritik an der Kritik. Schließlich wird die Überzeugung vertreten, dass es eine nützliche und sinnvolle Aufgabe für die Psychiatrie wäre, sich zu einem verbindlichen Krankheitsbegriff durchzuringen, um diesen häufig von starkem Leid und Scham betroffenen Menschen und ihren Angehörigen einen leichteren Zugang zu seriöser professioneller Hilfe zu erleichtern. Sexual addiction: chimera or clinical syndrom? A plea for a clinical conceptualization The phenomenon of sexual addiction as a clinical syndrom is discussed controversially. The article first deals with some mythological, historical and literary sources, which have been an inspiration for the nomenclature, e.g. nymphomania. Scientific research started in the 19th century, but also a classification in terms of a morally contaminated pathology, which led to barbaric forms of „therapies“ and procedures, especially for women. The ICD-10 and the DSM-IV do not contain categories that correspond with the clinical experience of many experts. The application of the WHO criteria should be possible, but this might fail due to big intercultural and individual differences in defining normal sexuality as the point of origin for pathological aberrances. Later some nosological concepts and therapeutic approaches are presented. The criticism of the term of „sexual addiction“ is followed by the criti- cism of the criticism. The article ends with the conviction, that it should be a useful and reasonable challenge for psychiatrists to come to a reliable classification of this disorder to provide easier access to serious and professional help to those who often suffer enormous pain and shame. Zum Begriff der „Sexsucht“ Die Chimäre ist ein mythologisches Mischwesen. Damit sollen zwei Aspekte der „Sexsucht“ zum Ausdruck gebracht werden: Erstens einmal gilt es als umstritten, ob eine Sexsucht als einheitliches Krankheitsbild existiert. Dann wäre dieses Syndrom ein fantastisches Gebilde ohne Entsprechung in der Realität. Zweitens: Selbst wenn die „Sexsucht“ als klinisches Syndrom existiert, kann sie uns in unterschiedlichster Ausprägung und Symptomatologie begegnen, entsprechend der Vielgestaltigkeit der Chimären. Goodman (1998) unterteilt die Theorien zur „Sexsucht“ in fünf Kategorien ein: biologisch, soziokulturell, kognitiv-behavioral, psychoanalytisch und integrativ. Wie bei Substanzabhängigkeit handle es sich um eine heterogene Gruppe von Störungen. Schließlich wird auch diskutiert, ob es sich eher um eine kompulsive Störung („compulsion“), eine Störung der Impulskontrolle („impulsivity“) oder um eine Sucht („addiction“) im engeren Sinne handelt. Wie andere Süchte auch, kann eine „Sexsucht“ bei verschiedenen Persönlichkeiten ganz unterschiedliche Funktionen R. Wölfle erfüllen. So kann promiskuitives und hypersexuelles Verhalten bei narzisstischer Persönlichkeitsstruktur dazu dienen, die eigene Besonderheit und überragende Potenz zu bestätigen. Bei geringem Selbstwertgefühl kann sexuelles Verhalten kompensatorisch zu Unterdrückung, Erniedrigung und Machtausübung benutzt werden. Ängstlich-depressive Menschen mit Verlassenheitsängsten wiederum können versuchen, ihre Partner durch intensive sexuelle Erlebnisse an sich zu binden und eine Situation von gegenseitiger Abhängigkeit zu schaffen. Intensive Sexualität kann damit auch als eine Abwehrstrategie bei Angst verstanden werden, insbesondere vor Objektverlust. Roth (2000) verweist darauf, dass süchtiges Erleben und Verhalten im Bereich der Sexualität ein geläufiges klinisches Phänomen ist. Gleichzeitig hält er fest, dass sie „nosologisch unspezifisch“ und „in ihrer diagnostischen Zuordnung umstritten“ ist (S. 144). Zur Geschichte der „Sex­ sucht“ In der Geschichte der Sexsucht finden sich eine Reihe von Synonymen wie Erotomanie, sexuelle Hyperästhesie, Hyperlibidinosität, Don-Juanismus, Satyriasis, Nymphomanie oder Hypersexualität. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde dieses Phänomen erstmals auch als Krankheit beschrieben, sowohl von Phillipp Pinel als auch von dessen Schüler Jean Etienne Esquirol, der in seiner Monomanielehre die erotische Monomanie als spezielle Krankheit beschrieb (Knecht, 2005). Ausführlich ging dann Richard von Krafft-Ebing in seiner 1886 erschienenen klinisch-forensischen Studie „Psychopathia Sexualis“ auf diese und andere sexuelle Störungen ein, wobei aus Sorge vor Anstößigkeit zumindest in der Erstauflage einige Teile in lateinischer Sprache erschienen. Der Aspekt der Sucht kommt gut zum Ausdruck, wenn er von einem abnormen sexuellen Appetit schreibt, der alle Gedanken und Gefühle durchdringe. Auch die Folgen für die Betroffenen werden von Krafft-Ebing sehr plastisch beschrieben. So sei die Störung eine Plage für den Betroffenen, da er sich in der ständigen Gefahr befinde, die Gesetze oder die Moral zu verletzen, die Ehre zu verlieren, seine Freiheit – ja sogar sein Leben. Sigmund Freud schrieb 1897 an Wilhelm Fliess, dass ihm aufgegangen sei, dass die Masturbation die einzige große Gewohnheit sei, sozusagen die „Ursucht“, als deren Ersatz die anderen Süchte ins Leben treten würden (Stumpfe, 2001). Daraus könnte abgeleitet werden, das süchtige Verlangen nach sexueller Betätigung und Befriedigung als den Kern sämtlicher süchtiger Störungen zu verstehen. Die Sucht nach libidinöser Betätigung wäre dann sozusagen die Mutter aller Süchte. Stoffgebundene Abhängigkeiten und verschiedene Verhaltenssüchte müssten dann als sekundäre Phänomene verstanden werden: als transformierte Manifestationen, als Erscheinungsformen, die mit dem Konsum bestimmter Chemikalien verknüpft werden oder als maskierte Phänomene, die in ihrer Eigendynamik die primären Beweggründe verdecken. Die sexuellen Aspekte jeglichen süchtigen Verhaltens würden dann aus ihrem Schattendasein treten und im Zentrum von Aufmerksamkeit und Interesse stehen. 1936 erschien das Buch „Die Süchtigkeit“ von Ernst Gabriel und Ernst Kratzmann, in welchem unter dem Kapitel „Tätigkeitssüchte“ auch die „Sexualsucht“ erwähnt wird. Beschrieben wird sie als ein süchtig gesteigertes Verlangen nach sexuellem Erleben, um seelische Spannungen und Gleichgewichtsstörungen auszugleichen. Bezeichnungen: Nymphoma­ nie, Satyriasis, Don-Juanismus, Mesalina-Komplex Als Namensgeber für hypersexuelles Verhalten wurden mythologische, literarische und historische Figuren herangezogen. Nymphen haben etwa insofern eine Nähe zu hypersexuellem (nymphomanischem) Verhalten, als damit nicht nur weibliche Gottheiten gemeint sind, sondern auch willige Mädchen oder Prostituierte, die außerordentlich gut aussehen und verführerisch sind. Frühreife Mädchen werden auch in heutiger Zeit manchmal noch als „Nymphchen“ bezeichnet. Satyrn wiederum, die Taufpaten des Satyrismus, des männlichen Pendants zur Nymphomanie, sind wollüstige Waldgeister, welchen neben der Liebe zu Wein auch ein intensives Sexualleben zugeschrieben wird. Ein Satyr steht für triebhafte und animalische Sexualität. Aus dem Mittelalter stammt die Figur des Don Juan, der schon 400 Jahre vor Casanova den typischen Frauenhelden repräsentierte. Es geht um einen Mann, der die ewige Liebe sucht, ohne selbst lieben zu können. Dies bringt das tragische Motiv vieler Süchtiger zum Ausdruck, immer etwas zu suchen und niemals fündig zu werden. Einen anderen Aspekt bringt Christian Dietrich-Grabbe 1928 im Drama „Don Juan und Faust“ zum Ausdruck: Betroffene sind zu reifer Liebe vielfach nicht fähig und bauen sich wie andere Süchtige eine Scheinwelt auf. Der Diener Leporello sagt in diesem Stück zu Don Juan, dass dieser nie geliebt, sondern immer nur Genuss und Phantasie gekannt hätte. Darauf antwortet Don Juan: „So ist Phantasie tausendmal besser als die Wirklichkeit!“ Im Roman „Don Juan de la Mancha“ von Robert Menasse findet sich ebenfalls die Diskrepanz zwischen der Gedankenwelt und der gelebten Realität. So sagt der Protagonist, er hätte noch nie so ein intensives Sexualleben wie jetzt, wo Sex ihn langweile. Der Trieb, die Lust zu „Sexsucht“: Chimäre oder klinisches Syndrom? Plädoyer für eine klinische Konzeptualisierung spüren, könne stärker werden, als die Lust zu befriedigen. Zu erwähnen ist schließlich noch der Messalina-Komplex. Messalina heiratete 38 n. Chr. 14-jährig den späteren römischen Kaiser Claudius und gilt als die berühmteste Nymphomanin der Antike. Ihr wird eine unersättliche Gier zugeschrieben, hemmungslose Vergnügungssucht, aber auch Grausamkeit und Brutalität. Sie starb 48 n. Chr. über Veranlassung ihres verschmähten Liebhabers Narcissus. Brachiale Behandlungsmethoden Nachdem Ende des 19. Jahrhunderts die Nymphomanie als Krankheit etabliert war, wurden die betroffenen Frauen zu Objekten der psychiatrischen Medizin, da weibliche Lust als krankhaft angesehen wurde. Nicht selten waren stationäre Behandlungen die Folge, bei welchen die betroffenen Frauen isoliert wurden, es erfolgten Aderlässe, induziertes Erbrechen, kalte Duschen, etc. Da davon ausgegangen wurde, dass vergrößerte Genitalien ursächlich eine Rolle spielen würden, galt die Entfernung der Klitoris als eine probate Therapie. Dass bis in die jüngere Vergangenheit noch derartige kastrierende Operationen erfolgten, ist dokumentiert (Orford, 2001) und es ist auch heute noch ein Thema: In einem Internet-SexsuchtForum schreibt eine Teilnehmerin am 9.7.2007, dass sie 23 Jahre alt und seit 15 Jahren sexsüchtig sei: „Ich bin also eine Sexsüchtige, die ihre Sexualität nur alleine ausleben kann, schau mal, ich überlege sogar, mir die Klitoris entfernen zu lassen.“ Epidemiologie und Diagnostik Mäulen (2000) geht davon aus, dass „Sexsucht“ bei ein bis drei % der Erwachsenen vorkomme. Sie sei durch zunehmendes sexuelles Phantasieren und Handeln sowie eine klare Gewöhnung mit der Notwendigkeit, Häufigkeit oder Intensität des Verhaltens zu steigern, gekennzeichnet. Trotz gravierender Konsequenzen in Familie, Arbeit oder Finanzen werde das Verhalten beibehalten und alle Versuche, es zu kontrollieren, würden scheitern. Ein ausführlicher Diagnose-Fragebogen von P. Carnes enthält gegenwärtig 170 Fragen, ist aber zurzeit nicht ins Deutsche übersetzt. Sexuelle Abhängigkeit wird nach Carnes als eine Familienerkrankung betrachtet, wie andere Abhängigkeitserkrankungen auch. Die Anamnese ergebe bei Betroffenen und ihren Partnern oder Partnerinnen sehr oft eine Missbrauchserfahrung in der Kindheit. Oft würden später aus Opfern Täter, so dass mehrere Generationen betroffen seien. Bei ca. 60 % wird eine zusätzliche Abhängigkeit von Alkohol oder Medikamenten angenommen. Bei Mehrfachabhängigkeit sollte die Substanzabhängigkeit zuerst und anschließend die Sexabhängigkeit behandelt werden. Die „Sexsucht“ oder „sexuelle Abhängigkeit“ sind im ICD-10 keine eigenen Kategorien. Es können stattdessen verschiedene andere Diagnosen herangezogen werden. 1. F66.8: Psychosexuelle Entwicklungsstörung 2. F65: Paraphilien 3. F63.8: Störung der Impulskontrolle, oft im Zusammenhang mit posttraumatischer Belastungsstörung (F43.1) 4. F43.25: Anpassungsstörung mit Störung von Gefühlen und des Sozialverhaltens 5. F52.7: Gesteigertes sexuelles Verlangen. Hier wäre etwa die Libidosteigerung zu verschlüsseln. Dazu heißt es in der Erläuterung, dass Männer und Frauen (meist Teenager oder junge Erwachsene) gelegentlich über ein gesteigertes sexuelles Verlangen als eigenständiges Problem klagen würden, welches von affektiven Störungen oder frühen Stadien einer Demenz abzugren- 211 zen sei. Nymphomanie und Satyriasis gelten als dazugehörige Begriffe. „Sexsucht“ und die Ab­ hängigkeitskriterien des ICD-10 Bei der Diagnose einer stoffgebundenen Abhängigkeit (F1) müssen von den sechs Kriterien (1) Verlangen, (2) Dosissteigerung, (3) Toleranz und Gewöhnung, (4) körperliche Entzugssymptome, (5) großer Aufwand sowie (6) Konsum trotz besseren Wissens während des letzten Jahres mindestens drei zur selben Zeit vorhanden gewesen sein. Im Folgenden wird auf einige dieser Merkmale eingegangen. Es ist zwar möglich, diese Kriterien bei der „Sexsucht“ anzuwenden, dieses Vorhaben ist aber mit großen Schwierigkeiten hinsichtlich der Operationalisierbarkeit verbunden. Dies ist allerdings bei stoffgebundenen Süchten ebenso der Fall, etwa, was die Grenzen zwischen noch normaler oder schon erhöhter Menge betrifft. Auf große individuelle Bandbreiten wird immer wieder hingewiesen. Zunächst zum Verlangen oder „Craving“: Ein Druck, sexuelle Bedürfnisse abzuagieren und sich sexuell zu betätigen, um eine zunehmend unerträgliche Spannung los zu werden, ist ein häufig beschriebenes Phänomen. Ein aktueller Patient in der stationären Drogentherapie teilt mit, wenn er am Tag nicht mindestens fünfmal masturbiere, komme er nicht über die Runden. Eine Frau in ihren letzten Berufsjahren als Krankenschwester sagt, sie brauche jeden Abend mindestens einmal Sex, sonst könne sie nicht schlafen. Dazu sei ihr jeder Partner recht. Wenn einmal kein Mann zu Verfügung stehe, müsse sie Alkohol trinken oder Beruhigungsmittel – oder beides - nehmen, um sich zu narkotisieren und einschlafen zu können. Diese Phänomene machen für sich noch keine Sucht aus, R. Wölfle verweisen aber auf die Entwicklung von Abhängigkeitsstrukturen und großen Leidensdruck. Zum Phänomen der Dosissteigerung: Wo werden die Grenzen zwischen normaler und abnormer Sexualität angesiedelt? Masters, Johnson und Kolodny halten 1987 fest, dass es nicht besonders schwer falle, eine Person, die nur dann zu einer sexuellen Erregung gelangen kann, wenn sie auf einem Kamel reitet, als „abnorm“ einzustufen. Wie ist es aber etwa bei Masturbation? So habe ein Mensch, der zweimal wöchentlich masturbiere, wahrscheinlich ein normales Sexualverhalten, eine andere Person hingegen, die es zwanghaft ein Dutzendmal täglich machen müsse, wohl nicht. Aber wo solle man die Grenze setzen? Bei einmal täglich? Dreimal oder Sechsmal? Hinsichtlich der Standards und Vergleichswerte sind auch kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Aspekte zu beachten. Für manche Menschen ist schon die Masturbation an sich sündhaft und abnorm, vor allem wenn man verheiratet ist. Ein Medizinstudent mit Masturbationszwang und intensiven sexuellen Bedürfnissen hoffte, durch eine Heirat sexuell ausreichend gesättigt zu werden und nicht mehr masturbieren zu müssen. Dem war nicht so und seine Enttäuschung war groß. Lange versuchte er, sein erneutes Masturbieren vor der Gattin zu verheimlichen und es entstanden zunehmend Stress und Spannungen. Wissenschaftlich seriöse Untersuchungen zum Sexualverhalten, die die Frequenz des Geschlechtsverkehrs im transkulturellen Vergleich thematisieren, scheint es nicht zu geben. Sehr wohl gibt es dazu aber Befragungen, die in Massenmedien publiziert werden, in Zeitschriften oder im Internet, beispielsweise von einem Kondomhersteller (www.durex.com). Demzufolge lag gemäß Ländervergleich 2005 die durchschnittliche jährliche Frequenz des Geschlechtsverkehrs bei 103. In diesem Bereich liegen alle deutschsprachigen Län- der, das Maximum in Europa wird für Griechenland mit 138 angegeben, das Minimum für Schweden mit 92. In Japan liegt nach dieser Umfrage die jährliche Frequenz bei 45. Große Länder wie Russland oder China sowie viele afrikanische oder südamerikanische Staaten waren dabei nicht einbezogen. Eine „hohe Dosis“ findet sich in einer Kasuistik von Gabriel und Kratzmann (1936). Demzufolge „verbraucht“ eine 30-jährige Küchengehilfin jede Nacht 10 bis 12 Männer, auch in der Zeit der Menstruation, und sie sei sehr verstimmt, wenn sie daran gehindert werde. Sie habe sonst keine Interessen, arbeite aber fleißig und verlässlich und sage von sich: „Nur wenn ich lieben kann, kann ich auch arbeiten.“ Die Differenzierung von normalem und abnormalem Sexualverhalten hat aber nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte. Auch darauf gehen Gabriel und Kratzmann ein und beschreiben einen 45-jährigen, verheirateten Mann, „in bester Ehe lebend“, der anfallsartig exhibitionistische und pädophile Impulse hat, insbesondere zu kleinen Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren, selbst zu den eigenen Töchtern. Zu Phänomenen wie Craving, Kontrollverlust oder Entzugserscheinungen gibt es auch literarische Zugänge, exemplarisch etwa „Die Schopenhauer-Kur“ von Irvin D. Yalom (2005, S. 40 ff). Dort teilt ein Mann seinem ehemaligen Psychiater mit: „Ich hatte es nicht unter Kontrolle. Alles worauf ich aus war, war Sex. Ich war davon besessen. Ich war unersättlich. Es schaudert mich, daran zu denken, wie ich damals war, an das Leben, das ich führte. Ich versuchte so viele Frauen wie möglich zu verführen. Nach dem Koitus hatte ich für kurze Zeit Ruhe, aber bald überwältigte mich das Verlangen wieder“. „Und es war eine Sucht. Das wusste ich. Und ich wusste, dass ich sie nur durch einen kalten Entzug loswerden konnte. Es dauerte lange, aber irgend- wann wurde mir klar, dass sie keine Ahnung hatten, wie sie mir helfen sollten und ich verlor das Vertrauen in unsere gemeinsame Arbeit.“ Das Standardwerk: „Wenn Sex zur Sucht wird“ von Patrick Carnes Für Carnes (1993) gehört die „Sexsucht“ zu den destruktivsten Suchtkrankheiten in einer suchtanfälligen Gesellschaft. Er definiert sie als ein außer Kontrolle geratenes Verhalten, das mit den klassischen Anzeichen der Sucht einhergeht: Besessenheit, Machtlosigkeit und die Benutzung von Sex als Schmerz- oder Beruhigungsmittel. „Sexsucht“ kann monogam und promiskuitiv gelebt werden. Carnes unterscheidet elf Verhaltenstypen bei sexueller Abhängigkeit: 1. Phantasie-Sex 2. sexuelle Verführerrolle 3. anonymer Sex 4. Sex gegen Geld 5. mit Sex handeln 6. voyeuristischer und visueller Sex 7. exhibitionistischer Sex 8. zudringlicher Sex 9. schmerzhafter Sex 10. Sex mit Objekten (Transvestitismus, Fetischismus, Sodomie) 11. Sex mit Kindern (bei 30 % der befragten Männer und 14 % der Frauen) Aus dieser Auflistung geht hervor, dass Perversionen oder Paraphilien einen sexsüchtigen Hintergrund haben können, aber nicht müssen. Carnes listet Anzeichen von sexueller Abhängigkeit auf, die durchaus mit den ICD-10-Kriterien korrespondieren, etwa ein außer Kontrolle geratenes sexuelles Verhalten, schwere Folgen, die Unfähigkeit, trotz schädlicher Konsequenzen aufzuhören oder sich ständig zunehmende sexuelle Erlebnisse zu verschaffen, weil die augenblicklichen Aktivitäten nicht mehr „Sexsucht“: Chimäre oder klinisches Syndrom? Plädoyer für eine klinische Konzeptualisierung ausreichen. Entsprechend seiner Untersuchungen leiden 89% der Betroffenen unter körperlicher Erschöpfung infolge sexueller Ausschweifungen, 72% denken an Selbstmord als Ausweg aus ihrer Sucht und 17% haben Suizidversuche begangen. Weitere klinische Aspekte Hinweise auf gehäuftes Vorkommen von „Sexsucht“ bestehen nach Gölz (1998) bei: 1. Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit 2. frühkindlicher Missbrauch 3. Essstörungen 4. krisenhaft-suizidaler Zusammenbruch Weitere Hinweise sind: 1. häufiger Arbeitsplatzverlust 2. Schulden 3. Pairing und Durchbrechen von Regeln einer Klinik 4. abgebrochene stationäre Therapien („Rausschmiss“) 5. Sexualisierung jeglichen Kontakts 6. akute Partnerschaftskrisen 7. Aids 8. Hinweise von Angehörigen 9. während der Therapie sich nicht an Ereignisse vor dem 10. Lebensjahr erinnern können. Ein Fall aus der suchtmedizi­ nischen Ambulanz des Kh. Maria Ebene, Frastanz: „Ich möchte jeden Abend Sex haben, aber meine Frau nicht.“ Dieser Satz beschrieb einen langjährigen Leidensweg eines 41-jährigen Mannes. Ursprünglicher Anlass für die Kontaktaufnahme war eine Alkoholproblematik. Der Betroffene kam aber von sich aus auf seine schwer beherrschbaren sexuellen Bedürfnisse zu sprechen, so dass er in diese Richtung gezielt exploriert wurde. Der Patient stammt aus einem Land des ehemaligen Yugoslawien, war zum damaligen Zeitpunkt verheiratet und hatte zwei Kinder. In der Exploration teilte er mit, dass der Sex mit der Gattin gut sei, es störe ihn aber, dass sie nur zwei- bis dreimal in der Woche bereit sei, mit ihm zu schlafen. Als er vor einigen Jahren nicht mehr in der Lage gewesen sei, seine sexuellen Bedürfnisse zu unterdrücken, hätte er begonnen, Prostituierte aufzusuchen. Als Schichtarbeiter sei es ihm leicht gefallen, dies unauffällig zu machen und vor seiner Gattin zu verbergen, da diese tagsüber gearbeitet hätte. Die Kontakte hätte er über die Annoncen einer lokalen Zeitung telefonisch hergestellt. Es seien daraus aber zunehmend finanzielle Engpässe entstanden, außerdem seien Schuld- und Schamgefühle stärker und immer weniger erträglich geworden. In diesen Spannungszuständen hätte Alkoholkonsum Erleichterung gebracht und es ist eine sekundäre Abhängigkeit entstanden. Die Situation hätte ihn schließlich überfordert und er führte – wohl unbewusst – folgendes Ende herbei: Er sei gemeinsam mit seiner Frau mit dem Auto unterwegs gewesen und ohne es beabsichtigt zu haben, hätte er ihr, als sie „zufällig“ an dem Haus mit den Prostituiertenwohnungen vorbei gekommen seien, mitgeteilt, das sei ein „Puff“ und er sei schon öfter dort gewesen. Die Gattin hätte sehr betroffen und erschüttert reagiert. Sie hätte sich emotional von ihm distanziert und deponiert, dass sie es nicht akzeptieren würde, dass er weiter zu Prostituierten gehe. So hätte er diese Besuche eingestellt, aber darunter gelitten, denn die sexuellen Bedürfnisse seien weiterhin da gewesen und jetzt hätte noch dazu die Gattin begonnen, sich sexuell zu verweigern. Mit zunehmendem Verzicht sei der Triebdruck immer ­stärker geworden und er sei erneut in einen Teufelskreis geraten. Kurzfristig hätten Pornofilme und Masturbation etwas Erleichterung gebracht. Genügt hätte das jedoch nicht. Zu einem geplanten Partnergespräch kam es allerdings nicht, die telefonische Terminabsage wurde folgendermaßen begründet: 213 „Wir haben Partnertausch gemacht, jetzt hat sich meine Frau in den Anderen verliebt und will mich wegen ihm verlassen.“ Der seit Beginn der ambulanten Behandlung alkoholabstinente Patient erlitt kurz darauf einen schweren Alkoholrückfall, beging einen Suizidversuch und war zum Zeitpunkt des Abfassens dieses Artikels stationär an der Psychiatrie. Cybersex-Addiction Mit dem Internet eröffnete sich für Menschen mit „Sexsucht“ ein neues Feld. Es ist ein Überangebot entstanden, welches vermutlich latentes und bislang ungelebtes hypersexuelles Verhalten fördern kann, da Hemmungen und Widerstände in vielerlei Hinsicht abgebaut werden können. Kimberley Young erwähnte schon 1996 die Cybersex-Abhängigkeit als eine von fünf Internet-Abhängigkeiten. Der Vorteil, sich des Mediums Internet zu bedienen, hat demzufolge drei Aspekte, die nach dem ACEModell beschrieben werden: Anonymity bedeutet einen problemlosen Partnerwechsel, einen problemlosen Abschied nach dem Orgasmus und die Konstruktion einer sexuellen Laborsituation. Convinience heißt, es ist bequem und leicht verfügbar, in aller Selbstverständlichkeit. Durch die Verbreitung und Vermassung sinken die Hemmschwellen. Begrifflichkeiten wie „Fetish Room“ schockieren und erregen initial zugleich. Mit Escape ist die Flucht in Phantasiewelten oder andere Identitäten gemeint. Akutelle Zahlen sind schwer zu erhal­ ten, zumal das Medium Internet großen Veränderungen unterworfen ist und ständig wächst. Im Sommer 2007 hat die Google-Suche nach dem Begriff „Sex“ 489 Millionen Ergebnisse gebracht, 3 Jahre später waren es 590 Millionen. Eine andere Quelle ist das amerikanische Good-Magazin (www. GOODmagazine.com), welches die Zahlen auf die Haut einer Darstellerin schreibt, die selbst eine Pornoseite R. Wölfle unterhält. Folgende Zahlen und Fakten werden u.a. ange­geben: 1. 12 % aller Internetseiten sind pornographisch 2. 25 % aller Anfragen bei Suchmaschinen haben pornographische Inhalte 3. Jede Sekunde betrachten fast 30.000 Internetuser pornographische Seiten 4. Jede Sekunde werden $ 89,-- für Internetpornographie ausgegeben 5. Jeden Tag kommen 266 neue Pornographieseiten dazu 6. Es gibt ca. 372 Millionen pornographische Webseiten 7. 89 % werden in den USA produziert, 4 % in Deutschland, 3 % in Großbritannien 8. 72 % der Internetnutzer sind männlich 9. 70 % der Besuche auf pornographischen Seiten erfolgen zu den Arbeitszeiten an Werktagen Zur Therapie von „Sex­ sucht“ In den U.S.A. liegen die Schätzungen bezogen auf Betroffene mehr als doppelt so hoch als in Europa. Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass es dort eine andere Ethik und andere Moralvorstellungen gibt, wenn es etwa eine Reihe von Personen und Gruppierungen gibt, die schon vorehelichen Geschlechtsverkehr als sexsüchtiges Verhalten klassifizieren. Die Unschärfe in der Diagnostik bei geringer Beachtung dieser Problematik durch die professionelle Szene führt zu einer Entsachlichung und schafft einen Boden für eine fachfremde, vielfach auch unseriöse Befassung mit der Thematik, was neben dem Umstand, von vielen belächelt und nicht ernst genommen zu werden, wohl eine besonders unglückliche Komponente dieser Störung darstellt. Insbesondere die Interpretation angeblich sexsüchtigen Verhaltens als Sünde drückt der Sexualität den Stempel des Bösen auf und kann ohnehin bestehende Schuld- und Schamgefühle der Betroffenen noch verstärken, sodass sehr verzweifelte Situationen entstehen. Hilfe wird dann weniger bei Therapeuten oder Ärzten gesucht, sondern manchmal auch bei privaten Organisationen oder Sekten. Daneben gibt es sich vor allem in Amerika von den verschiedensten Glaubensgemeinschaften und anderen Einrichtungen getragene Beratungen und Behandlungen, die einen Schwerpunkt auf spirituelle Aspekte setzen, inhaltlich aber moralische Belehrungen oder esoterische Praktiken anbieten. Dass mit Versprechungen und Angeboten für Menschen mit vermeintlicher Sexsucht viel Geld zu verdienen ist, lässt sich aus der Vielzahl von Anzeigen oder Literatur im angloamerikanischen Sprachraum erkennen. Auch Kliniken haben „sexual addiction“ und deren Behandlung im Programm. Eine der prominentesten Kliniken in den Vereinigten Staaten ist die Sierra Tucson-Klinik in Arizona, die dieses Angebot auch auf der Homepage explizit anbietet: „Sexual Addiction Treatment Center: Sexual Compulsivity Programs“ (http://www.sierratucson.com/program_details_addiction.php?id=50). Es ist in den U.S.A. auch möglich, sich als Sexsuchttherapeut zertifizieren zu lassen. Die Notwendigkeit, Partner oder Partnerin in den therapeutischen Prozess mit einzubeziehen, wird etwa von Schneider und Weiss (2001) sehr betont. Im Anhang ihres Buches über Cybersex werden die 12 Schritte der Anonymen Alkoholiker für Menschen mit „compulsive sexual behaviours“ modifiziert. Für die Fragestellung dieses Artikels fällt auf, dass in diesem Buch eine große begriffliche Unklarheit besteht, die Autoren sprechen von „cybersex addicts“ (S. 132), „compulsive cybersex“ (S. 105) und benutzen auch andere Begriffe. So ist dann auch im Untertitel ihres Buchs eine Frage formuliert: „simple fantasy or obsession?“ und bringt damit die Span- nung zwischen den beiden Polen zum ­Ausdruck, die auch im Titel dieses Artikels enthalten sind. Unklarheiten, Zuordnungspro­ bleme und andere konzeptuelle Defizite Strauß (2001) sieht zunächst einmal Schwierigkeiten zur Abgrenzung zu den Paraphilien, wobei teilweise auch von paraphiler und nicht-paraphiler sexueller Abhängigkeit gesprochen wird. Sexsüchtiges Verhalten wird von verschiedenen Autoren verschiedenen psychischen Störungsbildern zugeordnet: Sucht, obsessiv-kompulsive Störung oder Störung der Impulskontrolle. Er zitiert in seiner Arbeit auch Gold & Heffner (1998), die die Problematik plakativ zum Ausdruck bringen: „many conceptions – minimal data“. Es gibt auch kaum Studien über die Wirksamkeit unterschiedlicher Behandlungsmethoden. Ein aktuelles Fachbuch aus dem deutschen Sprachraums stammt von Kornelius Roth (2007). Auch dieser Autor hält fest, dass es keine verbindliche Definition gebe. Da für „Sexsucht“ keine eigene Diagnoseziffer bestehe, seien reale Zahlen kaum zu erheben. Auch Grüsser & Thalemann (2006) betonen, dass es bislang für exzessives sexuelles Verhalten, das bei den Betroffenen viel Leid hervorrufen könne, keine einheitliche Definition gebe. Es handle sich um eine Diagnose, die sich Personen oft selbst verschreiben würden. Das Verhalten könne dann einem gewissen Störungsbild zugeordnet werden, die Diagnose liefere somit eine Erklärung, aber auch eine Entschuldigung. Hinsichtlich der Möglichkeiten, die sich aus dem ICD-10 oder dem DSM-IV ergeben, meinen die Autoren, dass eine Zuordnung in diese Klassifikationssysteme nicht alle klinischen Bilder abdecke und auch nicht unbedingt zu mehr Klarheit führe, etwa bei der Diagnose „nicht näher bezeichnete sexuelle Störung“. „Sexsucht“: Chimäre oder klinisches Syndrom? Plädoyer für eine klinische Konzeptualisierung Im Lehrbuch „Sexuelle Störungen und ihre Behandlungen“ von Volkmar Sigusch (2001) ist die „Sexsucht“ nicht einmal erwähnt, auch im Stichwortverzeichnis finden sich weder Nymphomanie noch Satyriasis o. ä. Der Begriff „Hypersexualität“ kommt fünfmal vor, und zwar im Zusammenhang mit dem Diagnoseschlüssel des DSM-IV und des ICD-10, mit dem Vorkommen hypersexuellen Verhaltens bei der Einnahme von Aphrodisiaka oder prosexuellen Substanzen wie Sidenafil sowie mit Hinweisen auf das Vorkommen hypersexuellen Verhaltens bei Krankheitsbildern wie der Epilepsie. Kritik und Kritik an der Kritik Eine kritische Grundhaltung hinsichtlich des Begriffs „Sexsucht“ ist mit Sicherheit berechtigt. Es lässt sich beobachten, dass der Begriff in den Medien inflationär verwendet und missbraucht wird, um mit einem angeblich sexsüchtigen Prominenten eine auffällige Schlagzeile zu kreieren. In einer Vorlesung dazu wurde der Fall eines österreichischen Priesters besprochen, der Tausende von kinderpornographischen Bildern auf seine Festplatte gespeichert hatte und der versuchte, sich vor Gericht mit seiner Sucht und somit einer Krankheit zu verteidigen. Von Seiten einiger Teilnehmer wurde dies als eine billige Ausrede abqualifiziert. Für andere wiederum stellt die „Sexsucht“ eine Möglichkeit dar, mit diesbezüglich verunsicherten Menschen in Kontakt zu kommen und für Sekten oder fundamentalistische Glaubensgemeinschaften zu gewinnen. Es können mit einer einfachen und manchmal platten diagnostischen Zuschreibung vielschichtige Probleme in ihrer Komplexität überdeckt werden. Monodimensionale und symptomatische Therapien verhindern eine Bearbeitung der zu Grunde liegenden Dynamik. Kritik am Begriff der „Sexsucht“ erfolgt v.a. auch dann, wenn die so genannten Verhaltens- süchte generell aus dem Kanon der Abhängigkeitserkrankungen herausgenommen werden und wenn lediglich substanzgebundene Formen als „echte“ und ernst zu nehmende Süchte klassifiziert werden. Alles Andere erscheint dann als nicht richtig krank und somit als eine „mindere“ Störung. Derartige Zuschreibungen enthalten ein entwertendes und herabwürdigendes Element. Das Störungsbild erscheint aus heutiger Sicht aber durchaus konsistent und in sich stimmig genug, dass es hilfreich erscheint, die „Sexsucht“ in einen klinischen und wissenschaftlichen Kontext zu stellen und als Krankheit anzuerkennen, vergleichbar dem Alkoholismus in den 60er-Jahren. Wäre dies damals nicht erfolgt, würden wir „Alkoholiker“ immer noch als amoralische, haltlose und ungehemmte Individuen betrachten und von professioneller Behandlung ausschließen. Ein ähnliches Schicksal haben heute Menschen mit „sexsüchtiger“ Symptomatik. Wäre diese Störung als Abhängigkeitsstörung und Krankheit anerkannt, würde es schwerer, den Begriff unseriös zu missbrauchen und Betroffene wären dann Patienten und Patientinnen, die zu ihrer Störung stehen könnten und in einem professionellen Setting von qualifizierten Therapeuten Hilfe erfahren könnten. Sie wären dann auch nicht mehr so stark fragwürdigen und unseriösen Angeboten ausgesetzt. Stoffgebundenheit als fundamentales Merkmal für eine Suchtdiagnose zu verstehen, erscheint heute als überholt. Die Neurowissenschaften belegen, dass etwa auch bei Spielsucht oder bei online-dependency im Gehirn Substanzen freigesetzt werden und Prozesse ablaufen, die mit stoffgebundenen Rauschzuständen durchaus vergleichbar sind. Auch Entzugserscheinungen wie Schlafstörungen, Unruhe oder Gereiztheit kommen bei Verhaltenssüchten vor. Phänomene wie Craving, Kontrollverluste oder Toleranzentwicklung finden sich bei „Sexsucht“ wie bei anderen nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten, 215 z.B. der Spielsucht. Gemäß ICD-10 ist es schließlich für eine Suchtdiagnose auch nicht zwingend notwendig, dass körperliche Entzugserscheinungen bestehen. Cox und Klinger (1998) weisen darauf hin, dass eher motivationale Faktoren das entscheidende Kriterium für Sucht sind. Es geht also in erster Linie um die emotionalen Effekte, die Süchtige erreichen wollen. Wenn Lawrence Sanders (1988) in einem Roman eine Protagonistin aussprechen lässt: „Sex ist Valium für die denkende Frau“, dann weist sie damit auf zweierlei hin: 1. „Sex“ ist gerade bei Spannungen und emotionalem Stress ein effizientes Beruhigungsmittel. 2. Wie bei den Benzodiazepinen gibt es das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung. Schlussfolgerungen Es ist schwierig, über eine Störung oder Krankheit zu schreiben, deren Existenz vielfach angezweifelt wird und die in Diagnostikmanualen wie dem ICD-10 gar nicht aufscheint, obwohl viele Fallberichte zu Verfügung stehen, aus welchen sich ergibt, dass Betroffene darunter leiden und dass sie ihr Verhalten als krankhaft erleben. Die Fachliteratur ist trotzdem inzwischen recht umfassend und beim Fehlen einheitlicher Standards naturgemäß sehr heterogen, sodass es schwierig ist, sich zu orientieren und fachliche Klarheit zu gewinnen. Der Bogen spannt sich von einer Bewertung als unkontrolliertes und sündhaftes Tun amoralischer Individuen bis zu einer Einordnung als Krankheit die mit „anerkannten“ Verhaltenssüchten wie Essstörungen oder pathologischem Spielen korrespondiert. Solange es keine Aufnahme in den Katalog der krankhaften Störungen gibt, werden Entwicklungen begünstigt, die Menschen eher dazu bringen, sich an zweifelhafte und unseriöse paramedizinische oder an- R. Wölfle derwärtig problematische Personen oder Einrichtungen zu wenden, als professionelle psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe aufzusuchen. Gerade für Störungen, die derart schambesetzt sind, wie dies bei sexuell abnormen Verhaltensweisen der Fall ist, erscheint es als besonders erstrebenswert, ein fachgerechtes Angebot zu schaffen, das bekannt ist und auch angenommen wird. Andernfalls werden die betroffenen Personen, die oft stark mit Verachtung oder entrüsteter Ablehnung des Umfelds konfrontiert sind, wenige Möglichkeiten sehen, angemessene Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Somit werden Krankheitsprozesse und zerstörirische Entwicklungen protrahiert, die Symptomatik hält an, sie chronifiziert und es wird das Leiden für viele Betroffene und Angehörige sowie für die Objekte des sexsüchtigen Verhaltens perpetuiert. Dazu ist es aber notwendig, dieses chimärenhafte Phänomen zu entmystifizieren, als krankhafte Störung anzuerkennen und einen konzeptuellen Konsens hinsichtlich der „Sexsucht“ zu erarbeiten. Dabei können die ICD10-Kriterien durchaus einen Raster darstellen, der sich für eine Diagnostik eignet und es kann die Behandlung dieser Störung dann auch zu einer Versicherungsleistung werden. Die Anerkennung als eigenständiges Krankheitsbild würde neben der Entlastung für die Betroffenen schließlich auch mehr Forschung und wissenschaftliche Untersuchungen ermöglichen. Dies ist beim derzeitigen Stand des Wissens hinsichtlich der biologischen Hintergründe, der Psychodynamik, der Abgrenzung zu anderen Störungen, des Verlaufs sowie hinsichtlich therapeutischer Konzepte noch dringend notwendig. Literatur [1] Carnes P: Wenn Sex zur Sucht wird, Kösel, München, 1993 [2] Cox WM, Klinger E (1988): A motivational model of alcohol use. Journal of Abnormal Psychology, May Vol 97 (2), 1988, 186-180 [3] Gabriel D, Kratzmann E: Die Süchtigkeit. Eine Seelenkunde. Neuland, Berlin, 1936 [4] Gölz J: Moderne Suchtmedizin. Thieme, Stuttgart, 1998 [5] Goodman A: Sexual Addiction. An integrated approach. International University Press, Madison Connecticut, 1998 [6] Grüsser SM, Thalemann CM: Verhaltenssucht. Diagnostik, Therapie, Forschung. Huber, Bern, 2006 [7] Kasl CD: Women, Sex and Addiction. A Search for Love and Power. Harper & Row, New York, 1989 [8] Knecht T: Stalking - Erotomanie im neuen Gewand? Schweiz Med Forum 5, 2005, 171-176 [9] Mäulen B: Süchtiges sexuelles Verhalten. In: Zerdick Joachim (HG): Suchtmedizin aktuell, VWB, Berlin, 2000 [10] Masters WH, Johnson VE, Kolodny RC: Liebe und Sexualität, Ullstein, Berlin, 1987 [11] Orford J: Excessive appetites: A Psychological View of Addictions. Wiley, Chichester, 2001 [12] Roth K: Sexsucht – Theorie und Praxis. In Poppelreuther S. und Gross W. (Hrsg.): Nicht nur Drogen machen süchtig. Entstehung und Behandlung von stoffungebundenen Süchten. Beltz, 2000 [13] Roth K: Sexsucht. Krankheit und Trauma im Verborgenen. Linksverlag, Berlin, 2007 [14] Sanders L: Die Verführung des Peter S. Goldmann, München, 1988 [15] Schneider J, Weiss R: Cybersex Exposed. Simple Fantasy or Obsession? Hazelden, Minnesota, 2001 [16] Sigusch V: Symptomatologie, Klassifikation und Epidemiologie sexueller Störungen. In Sigusch V (Hg): Sexuelle Störungen und ihre Behandlung. Thieme, Stuttgart, New York, 2001 [17] Stumpfe KD: Sigmund Freud und das Rauchen. SuchtMed 3 (2) 2001: 101106 [18] Strauß B: Die so genannte Sex-Sucht – klinische Aspekte süchtigen sexuellen Verhaltens. Sucht 47 (2) 2001: 82-87 [19] Sanders L: Die Verführung des Peter S. Goldmann, München, 1988 [20] Yalom ID: Die Schopenhauer-Kur, btb, München, 2005 [21] Young KS: Caught in the Net: How to Recognize Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery. John Wiley & Sons, New York, 1996 Dr. Roland Wölfle Therapiestation Lukasfeld der Stiftung Maria Ebene, Meiningen, [email protected] In Memoriam In memoriam Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 217–218 In Memoriam Chefarzt Prof. Dr. Stephan Rudas Georg Psota Psychosychosozialer Dienst, Wien Am 19.06.2010 verstarb in Wien – auch für viele seiner Freunde vollkommen überraschend – Chefarzt Prof. Dr. Stephan Rudas. Im Rahmen seines außergewöhnlichen Wesens lag es, dass Prof. Dr. Stephan Rudas seine schwere Krankheit mit unendlicher Gelassenheit ­ sowie größter Diskretion getragen hat. Die ihm eigene Liebenswürdigkeit hat er auch in den schwersten Stunden nicht verloren. Sein letzter großer öffentlicher Auftritt, der von minutenlangen Standing Ovations gefolgt war, war am 19.01.2010 im Rahmen seiner Verabschiedung im Wiener Rathaus vor etwa 400 Festgästen aus dem In- und Ausland, aus Psychiatrie, Medizin, Kunst, Kultur und Politik. Die letzten Worte seiner Rede waren: „Wenn ich wieder auf die Welt komme, werde ich erstens wieder Psychiater und zweitens wieder in Wien“. Herr Prof. Dr. Stephan Rudas ist am 27.05.1944 in Budapest geboren. © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Seine Familie kam 1956 nach Österreich. Das Gymnasium und ebenso das Medizinstudium hat er in Wien absolviert. Seine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Neurologie erfolgte an der Psychiatrischen Universitätsklinik und am Anton Proksch Institut. Sehr früh schloss er eine psychoanalytische Ausbildung ab, ebenso ein WHO Diplom für Psychiatrieplanung. Allein dieser Werdegang bis Anfang 30 ist ein sehr besonderer. In dieses, sein 4. Lebensjahrzehnt, fällt auch seine Heirat mit Frau Drin jur. Holle Rudas, die Geburt seines ersten Kindes Paul Rudas, später dann seiner Tochter Laura Rudas. Entscheidend für seinen weiteren Lebens- und Karriereverlauf war die eher zufällig entstandene Begegnung mit dem damaligen Wiener Stadtrat für Gesundheit und Soziales, Herrn Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Alois Stacher, der auf grobe Missstände in der stationären psychiatrischen Versorgung (wie sie in dieser kustodialen Zeit der psychiatrischen Versorgung weltweit üblich waren) aufmerksam wurde und dringend – seinem Wirken typisch „am besten vorgestern“ – konstruktive, weitreichende und nachhaltige Veränderungen forderte.Was folgte waren extrem engagierte gemeinsame Diskussionen und Planungen beider Genannter – selbstredend intensivst, nächtelang – aus denen der „Zielplan zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung in Wien“ entstanden ist. Prof. Dr. Stephan Rudas wurde von Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Alois Stacher 1977 zum Wiener Psychiatriebeauftragten ernannt, 1979 wurde der bereits genannte Zielplan veröffentlicht, in der Folge im Wiener Gemeinderat einstimmig beschlossen und 1980 das Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien (PSD Wien) gegründet – unter der Leitung des Wiener Psychiatriebeauftragten und Chefarztes des PSD Wien, Dr. Stephan Rudas. Die Implementierung von ambulant tätigen Krankenanstalten war ein ungeheuerlicher Schritt, der von Prof. Dr. Stephan Rudas gegangen wurde, unterstützt von einer Gruppe junger und engagierter PsychiaterInnen, mit aller Konsequenz, mit aller Nach­ folgewirkung für ganz Österreich. Und auch noch heutzutage – 30 Jahre später – ist dies ein Schritt, den sowohl in Österreich, als in Europa, als auch in der gesamten westlichen Welt wenige bewerkstelligen konnten. Prof. Dr. Stephan Rudas hat in der weiteren Folge die psychiatrische Landschaft Wiens und das Ansehen psychisch Kranker grundlegend und nachhaltig verbessert, zahlreiche beratende und koordinierende Funktionen innegehabt, u.a. das erste Wiener Konzept zur Behandlung Drogenkranker verfasst, wurde Lektor für psychiatrische Versorgung an der Med. Uni. Wien (1983-1997). Er war Dozent an der Akademie für Sozialarbeit 1973-2006, hatte bis 2010 einen Lehrauftrag an der Sigmund Freud Universität Wien, wurde Hauptmitglied des Sanitätsrates für G. Psota 218 Wien, des Psychotherapiebeirates, des Beirates für Psychische Gesundheit des Bundes, des wissenschaftlichen Beirates des Vereins für Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft, war Gründung svorstandsmitglied und Ehrenmitglied auf Lebenszeit der ÖGPB und vieles andere mehr. Suizide in Wien 1979: 405, 2008: 189. Was sein Wirken klarer ausdrückt als viele Details, sind folgende Zahlen: Stationäre Psychiatriebetten in Wien 1979: 3858, 2008: 655; Psychiatrische Aufnahmen in Wien 1979: 4 von 5 unfreiwillig, 2008 3 von 4 freiwillig; Zu seinen persönlichen Bekannten zählten Bennet, Wing, Basaglia, Kernberg und Yalom, mit Kruckenberg und Häfner war er sehr verbunden, mit Dörner hielt er bei verschiedensten Veranstaltungen Dr. Stephan Rudas hat im Verlauf seiner Berufslaufbahn zudem über 100 wissenschaftliche Arbeiten verfasst und 2001 das Buch „Österreich auf der Couch“ herausgegeben. Vorträge und der WHO Direktor für psychische Gesundheit, Dr. Benedetto Saraceno, folgte mehrfach seiner Einladung gemeinsame Vorträge in Wien zu halten. Zum genannten großen Abschiedsfest für den Gründer und Langzeitchefarzt des PSD Wien schickte er ein Mail mit der Bitte um Veröffentlichung und mit nur einem Satz daraus möchte ich diesen Nachruf beenden: “As the WHO Director of Mental Health I am proud of the contribution of Dr. Rudas and I think you all should be proud of his work and ­leadership.“ In Memoriam In memoriam Neuropsychiatrie, Band 24, Nr. 3/2010, S. 219–220 In Memoriam Univ.-Prof. Dr. Hans Georg Zapotoczky Hartmann Hinterhuber Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie Innsbruck Hans Georg Zapotoczky wurde am 24. September 1932 in Linz geboren. Beide Elternteile – sein Vater war Arzt in Linz-Süd – vermittelten Hansjörg und seinen beiden jüngeren Brüdern ein kulturelles Umfeld, das Begabungen förderte, zur Neugier anregte, Wissen vermittelte und zu eigenem kreativen Denken beförderte. Seine Gymnasialzeit absolvierte er mit vielseitigen künstlerischen Interessen am humanistischen Gymnasium in Linz-Spittelwiese. Jede Begegnung mit Hans Georg Zapotoczky war ein Gewinn: Seine tiefe Menschlichkeit, sein großes Wissen und seine pointierten Formulierungen, sein oft mit feiner Ironie gewürzter Wortwitz, seine brillante freie Rede und sein nimmermüder Einsatz für die Belange der Psychiatrie haben in uns allen tiefe Spuren hinterlassen, die sich fest in unsere Erinnerung eingeprägt haben. Schwer hat folgedessen seine vielen Freunde, ja die gesamte österreichische Psychiatrie, die Nachricht getroffen, dass Hans Georg Zapotoczky am 3. Juli 2010 unerwartet aus dem Leben gerissen wurde. Sein jugendlicher Elan, sein Schwung, seine Schlagfertigkeit und seine geistige Präsenz ließ alle vergessen, dass er bereits im 78. Lebensjahr stand. Alle, die ihn kannten, schätzten seine tiefsinnigen Betrachtungen, aber auch seinen Humor, seine pointierten Aussprüche, seine Schlagfertigkeit und seine stets gewinnende Art. © 2010 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 1958 promovierte Hans Georg Zapotoczky an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien zum Doktor der gesamten Heilkunde. 1961 trat er in die von Prof. Dr. Hans Hoff geleitete Psychiatrisch-Neurologische Universitätsklinik Wien ein, 1966 wurde er Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Stets um ein umfassendes medizinisches Wissen bemüht, war Hans Georg Zapotoczky anschließend Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Bleuler an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich/Burghölzli, um dann zu Prof. Dr. Isaac Marks an das Institute of Psychiatry in London und zu Prof. Dr. Vic Meyer in das Middlesex-Hospital überzuwechseln. H. G. Zapotoczky erfuhr in Wien eine profunde individualpsychologische Ausbildung, in England begann ihn die Verhaltenstherapie zu faszinieren, zu deren wissenschaftlichen Fundierung er vieles beigetragen hat. Auf Grund seiner großen Verdienste wählt ihn 1993 die “Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin” zu ihrem Präsidenten. Nach seiner Habilitation im Jahr 1976 ­wurde Hans Georg Zapotoczky 1982 von der medizinischen Fakultät Wien der Titel eines a.o. Professors für Psychiatrie verliehen. Die Medizinische Fakultät der Karl-FranzensUniversität hat ihn am 1.5.1991 als o. Universitätsprofessor für Psychiatrie nach Graz berufen: Durch 10 Jahre stand er engagiert und umsichtig der Univ.-Klinik für Psychiatrie vor, deren Auf- und Ausbau er sehr erfolgreich leitete. Seinen Assistentinnen und Assistenten war er stets ein vorbildhafter, richtungsweisender, immer anregender und von tiefer Menschlichkeit geprägter Lehrer. Hansjörg Zapotoczky verfügte über ein umfassendes psychiatrisch-psychotherapeutisches Fachwissen, das er gerne und mit Freude weitergab. Ihn kennzeichnete eine brillante Intellektualität und eine hohe rhetorische Begabung. Mit profundem Wissen, mit Humor und Charme konnte er aus seinen – viele Gebiete der Psychiatrie umfassenden – Arbeitsbereichen für jeden verständlich und nachvollziehbar vortragen: H. G. Zapotoczky war bei vielen nationalen und internationalen Symposien ein sehr beliebter und gefragter Referent. Prof. Zapotoczky genoss das uneingeschränkte Vertrauen der österreichischen Psychiater: Von 1998 bis 2000 bekleidete er das Amt des Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie und Psychiatrie, während dieser Zeit setzte er entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft. Bis zu seinem Tod stand er der Sektion „Psychopathologie“ der Österreichischen Gesellschaft für H. Hinterhuber Psychiatrie und Psychotherapie vor. Ihm verdankt die österreichische Psychiatrie vieles von ihrer internationalen Reputation. Vielfältige Anerkennungen dokumentieren seine nationale und internationale Geltung: Die Republik Österreich würdigte seine vielen Verdienste und zeichnete ihn mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse für Kunst und Wissenschaften aus, das Land Steiermark ehrte ihn als den Begründer der wissenschaftlichen Psychiatrie in Graz und als Initiator vieler sozialpsychiatrischer Projekte. Die Deutschsprachige Gesellschaft für Kunst und Psychopathologie des Ausdrucks verlieh ihm 2007 die Hans-Prinzhorn-Medaille: Durch die Übergabe dieses Preises ehrte und würdigte die DGPA sein der Vertiefung der wissenschaftlichen Psychiatrie, der psychopathologischen Forschung und vielfältigen kulturellen Fragestellungen gewidmete Lebenswerk. Die Zahl seiner wissenschaftlichen Arbeiten und der von ihm verfassten bzw. herausgegebenen Bücher ist gewaltig und gebietet größte Bewunderung: Sein Verzeichnis umfasst weit über 300 wissenschaftliche Arbeiten und 20 Publikationen in Buchform. In der Psychiatrie sah er nicht nur die biologischen, psychologischen und soziologischen Aspekte, er berücksichtigte – wie kein Zweiter – auch den sozialen und philosophischen sowie den kulturellen und religiösen Hintergrund unserer Disziplin. Hans Georg Zapotoczky verstand es meisterlich, die verschiedenen Wissensgebiete und Fachrichtungen zu versöhnen und zu verbinden, ohne aber 220 die Eigenständigkeit der einzelnen Denkrichtungen in Frage zu stellen. Mit seiner umfassenden humanistischen Bildung, mit seinem analytischen Blick und seiner pointierten Formulierungsgabe hat er die Psychiatrie und deren Grenzgebiete bereichert und vertieft. Seit 13 Jahren gab H. G. Zapotoczky im Springer-Verlag die „Psychopraxis“ als „Zeitschrift für praktische Psychiatrie und deren Grenzgebiete“ heraus: Dieser seiner Zeitschrift gab er ihre charakteristische Prägung. Die „Psychopraxis“ ist die einzige deutschsprachige Fachzeitschrift, in der die bio-psycho-sozialen Aspekte unseres Faches in die großen kulturellen Strömungen unserer Zeit eingebunden werden: Seine Leitartikel vermittelten Orientierung und Werte und regten zu selbstständigem Denken an. Regelmäßig reflektierte er in profunden Beiträgen sehr engagiert aktuelle Entwicklungen und Strömungen in Kunst, Literatur und Philosophie. Er öffnete den Lesern den Blick für die Grenzgebiete der Psychiatrie, für Psychologie, Soziologie und vergleichende Religionswissenschaften, scharfsinnig präsentierte er immer wieder Analysen zu gesellschaftlichen Problemen. Seine „Briefe des Herausgebers“ wurden von vielen mit großer Spannung erwartet: Es ist ihm immer wieder gelungen, pointiert auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, schädliches Verhalten aufzuzeigen und negative Erscheinungen des „Zeitgeistes“ zu demaskieren. Die Kraft zu seinen vielen Aktivitäten fand er in seiner Familie, besonders in seiner lieben Gattin und in seinen 2 tüchtigen Kindern: Ihnen gebührt un- ser uneingeschränkter Dank, unsere große Wertschätzung und unsere tief empfundene Anteilnahme. Nach seinem Tod erreichte uns in der Nummer 3/10 der „Psychopraxis“ sein letzter „Brief“: Er trägt die bezeichnende Überschrift „Von Asche und Glut“. Ich empfinde diese Ausführung als Vermächtnis und erachte sie als verpflichtenden Auftrag, eine Psychiatrie zu leben, die die Würde des Menschen ohne Einschränkungen achtet, seine Entfaltung fördert und ein Mehr an Freiheit, Toleranz und Humanität beinhaltet. Am Ende seiner Überlegungen wendet er sich an seine Leser, an Fachärzte und Ausbildungskandidaten: „Was kann noch aus unserer Tiefe kommen? Bemühen um Veränderung, Arbeit an besserer Einsicht, Aufbruch zur Verständigung mit anderen Menschen, Gleichklang mit uns selbst, auch wenn wir scheinbar verstört und unsicher erscheinen. Auftrag, sich weiter zu bilden und weiter zu lernen …Was bleibt ist die Glut – das Feuer, das uns beseelt.“ Die österreichischen Psychiater und ein sehr großer internationaler Freundeskreis sowie tausende von Patienten beklagen den Tod von Hansjörg Zapotoczky: Sie trauern um eine vor­bildhafte, große Persönlichkeit mit starker Ausstrahlung, sie dankt ihm für sein Engagement und seine Freundschaft. Mit seiner tief empfundenen Berufung zum Arzt hat er Generationen von Psychiater geprägt und geformt. Es bleiben Dankbarkeit und freundschaftliche Verbundenheit.