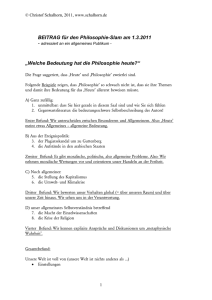Interkulturelle Konzeptionen des Philosophiebegriffs und der
Werbung

Interkulturelle Konzeptionen des Philosophiebegriffs und der Philosophiegeschichte von Heinz Kimmerle Für Kant und Hegel, aber auch für Nietzsche und Heidegger, für White‐ head und Russell, für Gadamer und Habermas sowie für Rorty und Put‐ nam beginnt Philosophie in der griechischen Antike – in einem vorläufigen Sinn mit den Vorsokratikern und definitiv mit Platon und Aristoteles.1 Phi‐ losophie wird damit für Europa und seine Geschichte reklamiert. Daß die Geschichte der Philosophie von Griechenland über das antike römische Reich ins Europa nördlich der Alpen verläuft, ist immer noch eine weit verbreitete Auffassung. Wie man häufig lesen kann, gibt es eine Vorge‐ schichte der Philosophie, die bis zu den Upanishaden in der indischen Tra‐ dition (750‐550 v.u.Z.) und Laozi in der chinesischen Tradition (geb. 604 v.u.Z.) zurückreicht. Und es werden Einflüsse anerkannt, auf die ursprüng‐ lich europäische Philosophie der Griechen aus dem Vorderen Orient mit seinen orphischen Geheimlehren sowie aus Ägypten mit seiner Mysterien‐ religion und den rechtlichen und moralischen Lehren der Ma’at. Daß im Mittelalter die Auffassungen von islamischen Gelehrten, besonders al‐ Die folgenden Ausführungen bilden eine Neufassung des Schluß‐Kapitels mei‐ nes Buches: Interkulturelle Philosophie zur Einführung, Hamburg 2002: Erweite‐ rung und neue Präzisierung des Philosophiebegriffs und der Philosophiege‐ schichte (125‐140). Dabei wird neben einzelnen mehr stilistischen Verbesserun‐ gen ergänzend zu dem genannten Text der interkulturelle Philosophiebegriff und die zugehörige Konzeption der Philosophiegeschichte von der Position der Hermeneutik Gadamers abgesetzt, die er selbst als eine Weiterentwicklung der Auffassungen Heideggers versteht. Ferner wird die Bedeutung Afrikas als einer Kultur mit überwiegend mündlichen Formen der Kommunikation und Überlie‐ ferung für den Philosophiebegriff der interkulturellen Philosophie herausge‐ stellt. 1 Farabi, Avicenna und Averroes, in die europäische Theologie und Philoso‐ phie aufgenommen werden, wird in der Geschichte der Philosophie durch‐ aus berichtet. Das ändert aber nichts an der Annahme, daß die Philosophie einen europäischen Charakter hat. Sofern sich mit der Entwicklung von Nordamerika seit etwa 1800 die europäische Zivilisation auf diesem Konti‐ nent ausbreitet, ist es dann angemessen, von einem nordatlantischen oder in einer etwas weniger geographisch orientierten Terminologie von einem europäisch‐westlichen Charakter d(ies)er Philosophie zu sprechen. Hegel hat die Philosophie von Platon und Aristoteles bis zu ihm selbst als die innere Linie der Weltgeschichte aufgefaßt, die er bekanntlich als »Fort‐ schritt im Bewußtsein der Freiheit« begreift. Auch Nietzsche sieht die Ge‐ schichte der europäischen Philosophie unter einem einheitlichen Gesichts‐ punkt. Für ihn ist sie freilich eher eine Geschichte des Verfalls als des Fort‐ schritts. Den ›christlichen Platonismus‹ mit seiner zunehmenden Leibfeind‐ lichkeit und Abstraktheit versteht er insgesamt als die ›Heraufkunft des europäischen Nihilismus‹. Heideggers Betrachtung der Geschichte der Phi‐ losophie als anwachsende ›Seinsvergessenheit‹ schließt bei Nietzsche an, geht aber einen entscheidenden Schritt weiter. Zum Verständnis des ›Seins des Seienden‹ wird in dieser Geschichte immer nur auf wechselnde Art und Weise auf ein ›höchstes Seiendes‹ verwiesen, ohne an das Sein selbst zu denken. Diese Denkweise nennt Heidegger ›Metaphysik‹, so daß er auch von der Geschichte der europäischen Philosophie als von der Ge‐ schichte der Metaphysik sprechen kann. Sofern er die diese Denkweise hin‐ terfragt und das Sein selbst zum Thema macht, geht er zugleich zu dem äl‐ testen Alten zurück, etwa zu Anaximander, bei dem es noch ›eine frühe Spur des Unterschieds‹ von Sein und Seiendem gibt, die aber auch hier schon ›ausgelöscht‹ ist. So scheint es, daß ›die Vergessenheit des Seins in das durch sie selbst verhüllte Wesen des Seins‹ gehört.2 Heidegger positioniert sich mit diesen Auffassungen nach der Geschichte der Metaphysik als der Geschichte der Seinsvergessenheit oder – besser ge‐ sagt – dieser Seinsvergessenheit der europäischen Geschichte der Philoso‐ phie. Diese Philosophie ist und bleibt für ihn freilich – und zwar in einem definitiven Sinn – die einzige Philosophie, die es gibt. Was sich in der Martin Heidegger, Der Spruch des Anaximander, in: ders., Holzwege, Frank‐ furt/M. 1952, S. 296‐343, s. bes. 336. 2 240 Nachgeschichte d(ies)er Philosophie geändert hat, ist nicht, daß Heidegger das Sein beziehungsweise die ›Wahrheit des Seins‹ unverhüllt zu sehen be‐ käme, sondern daß er um die wesensgemäße Verhülltheit dieser Wahrheit weiß. Das bringt ihn zu einer Bescheidenheit, die der Selbstbescheidung der interkulturellen Philosophie durchaus verwandt ist, sofern diese keiner der Philosophien, die durch eine bestimmte Kultur geprägt sind, die abso‐ lute Wahrheit zuerkennt. Heidegger kann sich jedoch von der Hegelschen Gleichsetzung von Philosophie und Europa nicht lösen. Deshalb befindet er sich seiner eigenen Einschätzung nach in einer Zeitperiode nach der Ge‐ schichte der (mit Europa identifizierten) Philosophie und bezeichnet sich selbst nicht mehr als Philosophen, sondern als Denker. Es entbehrt nicht der Ironie, wenn seine denkende Explikation der Seinsfrage von nicht‐ europäischen, vor allem japanischen und chinesischen Philosophen als verwandte Unternehmung zu ihrer Philosophie erfahren wird. Man kann sagen, daß Heidegger interkulturelle Philosophie wider Willen betreibt, wenn er als Denker oder ›Fragender‹ Gespräche mit fernöstlichen Partnern führt, die sich selbst als Philosophen verstehen.3 Was als Philosophie verstanden wird, hängt also offenbar mit der Auf‐ fassung über ihre Geschichte, wann und wo sie sich ereignet hat, auf das Engste zusammen. Die interkulturelle Philosophie geht davon aus, daß es Philosophie nicht nur in einer Kultur gibt. Sofern mit dem Ernstnehmen der Philosophie des subsaharischen Afrika auch Kulturen, die überwiegend mündlich kommunizieren und ihr Wissen überliefern, Philosophie zuer‐ kannt wird, ist der Weg frei für die Auffassung, daß es für jede Kultur eine ihr zugehörige Philosophie gibt. Mit dieser Erweiterung des Philosophie‐ begriffs wird es notwendig, in entsprechender Weise auch die Konzeption der Philosophiegeschichte zu verändern. Philosophie kann nicht länger ein Synomym für Europa sein. Auf dem Weg über die Entdeckung der Philo‐ sophie im Osten, wobei Indien, China und Japan nur Beispiele sind (be‐ sonders wichtig scheint es mir, auch die tibetische Philosophie zu nennen), die Einbeziehung der arabisch‐islamsichen, der latein‐ oder iberoamerika‐ nischen und der subsaharisch‐afrikanischen Philosophie hat sich der Hori‐ zont geöffnet für einen Begriff der Philosophie, nach dem diese mit dem Heidegger, Aus einem Gespräch von der Sprache. Zwischen einem Japaner und einem Fragenden, in: ders., Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1959, 83‐155. 3 241 Menschsein und menschlicher Kultur als solcher in einem wesensmäßigen Zusammenhang steht. Aber auch hier gibt es noch eine Verwandtschaft der interkulturellen Phi‐ losophie mit Heideggers angeblich nachphilosophischem Denken. In einer 1935 in Rom gehaltenen Rede »Europa und die deutsche Philosophie« kon‐ statiert er, wenn auch im Kontext einer befremdlichen Deutschtümelei, daß im ›Bereich der Kunst‹ etwas geschieht, das für die Philosophie wegwei‐ send ist. Diese Parallelität von Kunst und Philosophie wird auch in der in‐ terkulturellen Philosophie herausgestellt. Ferner sagt der Denker Heideg‐ ger über die ›Vielfältigkeit der Standpunkte‹ und den ›Wechsel der Syste‐ me‹ in der (europäischen) Geschichte der Philosophie, über ihre sich auf‐ türmende Komplexität und ihre immer schwerer zugängliche Abstraktheit, daß es darin im Grunde um die ›Einfachheit des Einzigen und Selbigen‹ gehe, nämlich die sich verbergende Wahrheit des Seins.4 Damit sucht Hei‐ degger auch zu einer anderen Sprache zurück zu finden, die er selbst als ›das einfache Sagen‹ charakterisiert. Und er weiß, daß das Einfachste oft das Schwerste ist. Ebendies erfahren auch Philosophen, die von der euro‐ päisch‐westlichen Tradition geprägt sind und von dieser Grundlage aus Dialoge mit anderen philosophischen Traditionen angehen wollen. Die dialogische Form des Philosophierens, die sich in der bisherigen Pra‐ xis der interkulturellen Philosophie als die am meisten angemessene erwie‐ sen hat, kann sich für ihre methodische Vergewisserung an Gadamer orien‐ tieren, der Heideggers Neuansatz des philosophischen Nachdenkens für die Arbeit der Geisteswissenschaften und auch für das Sichverstehen der Menschen in ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit konkretisiert hat. Gada‐ mer legt Wert darauf, daß seine hermeneutische Philosophie oder seine Konzeption der Philosophie als Hermeneutik eine Weiterentwicklung des Heideggerschen Ansatzes ist, der die Hermeneutik von einer technischen oder Hilfsdisziplin der historischen Geisteswissenschaften zu einer philo‐ sophischen Fundamentaltheorie gemacht hat. Daß die Hermeneutik eine ›Hermeneutik der Faktizität‹ ist, die das Seinsverständnis des menschli‐ chen Daseins expliziert, das sein eigenes Sein als unterschieden vom Sein Heidegger, Europa und die deutsche Philosophie (1935), in: H.‐H. Gander (Hrsg.), Europa und die Philosophie, Frankfurt/M. 1993, 31‐41, s. bes. 32‐34. 4 242 der anderen Seienden (des Zuhandenen und Vorhandenen) erfaßt,5 wird von Gadamer aufgenommen, indem er für das Verstehen in den Geistes‐ wissenschaften und auch im alltäglichen Lebenszusammenhang eine ›Grenze‹ annimmt, die mit dem ›Geworfensein‹ des menschlichen Daseins zusammenhängt, das verstehend nicht eingeholt werden kann, so daß die‐ se Grenze ›immer weiter zurückweicht‹. Was sich so dem Verstehen ent‐ zieht, im Leben und im Denken dunkel oder ›diesig‹ bleibt, bezeichnet er auch mit dem Ausdruck Schellings als ›das Unvordenkliche‹.6 Mit Heidegger und auch mit Derrida sucht die Hermeneutik Gadamers einen Beitrag zu leisten an der ›Destruktion‹ beziehungsweise ›Dekon‐ struktion‹ der Geschichte der europäisch‐westlichen Philosophie als Meta‐ physik. Diese Unternehmungen gehen insgesamt ›gegen Verdeckung‹ und arbeiten an der ›Freilegung dessen, was zugedeckt war‹: das Sein selbst als das ganz Andere der Seienden beziehungsweise das radikale Anderssein des/der Anderen. Dabei nimmt Gadamer auch den Vorzug für den Begriff ›Spur‹ auf, den er bei Derrida konstatiert und der – wie soeben bemerkt – auch schon bei Heidegger eine wichtige Rolle spielt. Ähnlich wie Derrida sieht Gadamer, daß von Levinas zu lernen ist, wie sehr jede Spur ›verge‐ hende Spur‹ ist, nicht ›irgend etwas zurückrufen‹ will. Das gilt bei Levinas in besonderer Weise von den Spuren, die das Leben und das Leiden ›in ein Antlitz eingezeichnet‹ hat. Deshalb sieht Gadamer auch darin eine Grenze der Hermeneutik und des Verstehens. In dem Beitrag ›Hermeneutik auf der Spur‹ von 1994 sagt er erstaunliche Dinge darüber, wo ›das Verstehen zu schweigen hat‹, die den früher so stark hervorgehobenen Universali‐ tätsanspruch der Hermeneutik doch in einem anderen Licht erscheinen las‐ sen. Auf diese Weise wird auch klar, daß ›Horizontverschmelzung‹ nicht das Entstehen einer neuen dritten Position bezeichnet, in der die früheren Positionen der Gesprächspartner ganz und gar aufgenommen und zur Übereinstimmung gebracht sind. Am Ende steht Gadamer wieder ganz nahe bei Plato, der im Siebenten Brief deutlich gemacht hat: ›Dialektik muß Heidegger, Sein und Zeit (1927), Tübingen 19537, 5‐15. Hans‐Georg Gadamer, Hermeneutik und ontologische Differenz (1989), in: ders. Gesammelte Werke, Bd. 10, Tübingen 1995, 58‐70, s. bes. 64‐65 und 70, auch zum Folgenden. 5 6 243 immer wieder Dialog werden, und Denken muß sich immer im Miteinan‐ der des Gesprächs bewähren‹.7 Damit hat sich die Hermeneutik Gadamers in beträchtlichem Maß auf die interkulturelle Philosophie zu bewegt. Zugleich macht es ihm seine Ver‐ wurzelung in der antiken griechischen Philosophie offenbar unmöglich, den entscheidenden Schritt zu tun und auch in anderen Kulturen Philoso‐ phie anzunehmen. Er hält es für ›ganz gewiß richtig, daß die Philosophie ... ganz und gar in Europa entstanden ist‹. Sein Verhältnis zu den nicht‐ westlichen Kulturen behält etwas Zwiespältiges. Einerseits gibt es diesen schwerwiegenden Unterschied, daß Philosophie der europäisch‐westlichen Kultur vorbehalten ist und nirgendwo sonst, auch nicht in der ›indischen ... oder chinesischen Weisheit‹ zu finden ist.8 Andererseits ist es möglich, die Menschen aller verschiedenen Kulturen prinzipiell in der gleichen Weise zu verstehen. Denn sie alle haben Sprache und sind (im) Gespräch. Dem‐ gemäß kann mit ihnen ein Dialog geführt werden, der zum gegenseitigen Verstehen führt. Besondere Barrieren des Verstehens auf Grund größeren Fremdseins der Anderen aus anderen Kulturen, ›Steigerungsgrade des Fremdseins‹, wie Waldenfels es nennt,9 braucht man nicht in Rechnung zu stellen. Die ›babylonische Sprachverwirrung‹ bedingt ›das Ganze der Fremdheit, das zwischen Mensch und Mensch sich auftut‹, und ›darin ist auch die Möglichkeit ihrer Überwindung eingeschlossen [...] Man muß das Wort suchen und kann das Wort finden, das den anderen erreicht. Man kann die Fremde, seine, des Anderen Sprache lernen. Man kann in die Sprache des Anderen übergehen, um den Anderen zu erreichen. All das vermag Sprache als Sprache.‹10 Gadamer, Hermeneutik auf der Spur (1994), in: ders., Gesammelte Werke, Bd 10, a.a.O., 148‐174, s. bes. 160 und 172, vgl. ders. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1961, zur ›Verschmelzung der Horizonte‹ 359‐360, zum ›Universalen Aspekt der Hermeneutik‹ 449‐465. 8 Gadamer, Europa und die Oikoumene (1993), in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 10, a.a.O., 267‐284, s. bes. 267 und 284. 9 Bernhard Waldenfels, Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden I, Frankfurt/M. 1997, 35‐37. 10 Gadamer, Destruktion und Dekonstruktion (1985), in: ders. Gesammelte Werke, Bd. 2, Tübingen 1993, 361‐372, s. bes. 364. 7 244 Vorsprachliche und außersprachliche Kommunikationsformen des Dia‐ logs werden nicht berücksichtigt. Der Blickkontakt, die Gestik, das Ausse‐ hen mit seinem ethischen und ästhetischen Appell, einschließlich dem sex appeal, die Überzeugungskraft der Stimme und des Stils spielen für Gada‐ mer keine Rolle. Wenn es besondere Schwierigkeiten des Verstehens gibt, etwa bei Dialogen mit Philosophen und Philosophien anderer Kulturen, die nicht auf technischem Weg, durch das Erlernen der Sprache des Ande‐ ren, zu bewältigen sind, gilt es, alle nur möglichen Mittel einzusetzen, die zu einem besseren Verstehen führen können, und gewiß auch die extra‐ diskuriven und multisensorischen Elemente der Dialoge.11 Ferner ist im Miteinander‐sprechen der Aspekt des Hörens auf den Anderen wesentlich zu verstärken, so daß ich schon nach ersten Erfahrungen, Dialoge mit afri‐ kanischen Philosophen anzugehen, eine ›Methodologie des Hörens‹ vorge‐ schlagen und später näher ausgearbeitet habe. ›Auch Hören will gelernt sein: es erfordert Offenheit, Konzentration, Disziplin und eine methodisch geleitete Technik. Wie das Verstehen, das viel später kommt, ist es Kunst‹.12 Eine interkulturelle Hermeneutik wird schließlich im Ergebnis der Verste‐ hensbemühung das vorläufige und das definitive Nichtverstehen stärker herausstellen müssen, als es bei Gadamer geschieht und als es in einer auf die eigene Tradition bezogenen Verstehenslehre notwendig ist. Das steht deutlich im Vordergrund, auch wenn in Bezug auf bestimmte Sachgebiete, besonders ästhetische und politische Urteile, die umgekehrte Erfahrung möglich ist, daß man mit Gesprächspartnern aus anderen Kuklturen zu ei‐ nem besseren gegenseitigen Verständnis kommen kann als mit solchen aus der eigenen Umgebung.13 Die Erweiterung der Philosophie von Europa und seiner Geschichte auf die gesamte Menschheit und ihre Geschichte verlangt wie auch andere Heinz Kimmerle, Dialoge als Form der interkulturellen Philosophie, in: ders., Afrikanische Philosophie im Kontext der Weltphilosophie, Nordhausen 2005, 97‐ 117, s. bes. 111‐114. 12 Kimmerle, Philosophie in Afrika – afrikanische Philosophie. Annäherungen an einen interkulturellen Philosophiebegriff. Frankfurt/M. 1991, 8. Vgl. ders., Die Dimension des Interkulturellen, Amsterdam/ Atlanta, GA 1994, 126‐128. 13 Heinz Kimmerle/Henk Oosterling (Hrsg.), Sensus communis in Multi‐ and Inter‐ cultural Perspective. On the Possibility of Common Judgments in Arts and Poli‐ tics, Würzburg 2000, 11‐16. 11 245 Prozesse der Globalisierung als Gegenbewegung eine Regionalisierung. Die eine Weltphilosophie gibt es nur im Chor der vielen Stimmen kultur‐ spezifischer Philosophien. Senghaas, der von kulturtheoretischen Überle‐ gungen aus zur interkulturellen Philosophie kommt, sieht die ›große Chan‐ ce […] für interkulturelle Philosophie‹ darin, daß ›alle Kulturen‹, in der Gegenwart ›mehr als je‹, und dies gilt dann nicht nur geographisch ›in der Welt von heute‹, sondern auch historisch in entsprechenden anderen Situa‐ tionen der Geschichte der Menschheit, ›mit sich selbst in Konflikt geraten und darüber selbstreflexiv werden‹.14 Eben dieses Selbstreflexiv‐werden in Konflikt‐ oder Notsituationen einer Kultur ist die Geburtsstunde der Philosophie in der Geschichte dieser Kul‐ tur. Dasselbe gilt auch für erneute Begründungsversuche der Philosophie innerhalb ihrer Geschichte, bei denen sie zu ihren Quellen zurückgeht oder zu den Sachen selbst vorzudringen sucht. So erwartet Heidegger in der an‐ gegebenen Rede von der Philosophie (in dem erwähnten problematischen Kontext sagt er: ›von der deutschen Philosophie und damit von der Philo‐ sophie überhaupt‹) durch eine ›schöpferische Auseinandersetzung mit der ganzen bisherigen Geschichte‹ einen Beitrag zur ›Rettung Europas‹, das sich 1935 wegen seiner ›eigenen Entwurzelung und Zerplitterung‹ in ›ge‐ steigerter Bedrängnis‹ befindet.15 Und Hegel spricht 1801 in seinem ersten philosophischen Buch, in dem er seine eigene Position gegenüber derjeni‐ gen Fichtes und Schellings herauszustellen sucht, von der ›geschichtlichen Ansicht philosophischer Systeme‹. Er sagt dort: ›Entzweiung ist der Quell des Bedürfnisses der Philosophie‹.16 Entzweiung heißt dabei, daß eine Zeit oder eine Kultur in die Krise gerät, weil die Menschen mit sich selbst, mit dem was sie ›bewußtlos suchen‹, und den bestehenden, in sich verfestigten Strukturen und Institutionen ihrer Gemeinschaft, ›dem Leben, das ihnen Dieter Senghaas, Interkulturelle Philosophie in der Welt von heute, in: ders., Zi‐ vilisierung wider Willen. Der Konflikt der Kulturen mit sich selbst, Frankfurt/M. 1998, 27‐49, s. bes. 48. 15 Heidegger, Europa und die deutsche Philosophie, a.a.O. (in Anm. 4), 31. 16 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie (1801), in: Gesammelte Werke, hrsg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 4: Jenaer Kritische Schriften, hrsg. von H. Buchner und O. Pöggeler, Hamburg 1967, 1‐92, s. bes. 9 und 12. 14 246 angeboten und erlaubt wird‹, in einen wachsenden ›Widerspruch‹ gera‐ ten.17 Solche Situationen, die Philosophie (in besonderer Weise) erfordern und hervorrufen, kommen in der Geschichte jeder Gemeinschaft immer wieder vor. Eine Kulturgemeinschaft, die auf die eine oder andere Art mit sich selbst in Konflikt gerät, muß sich und wird sich über ihre eigenen Grund‐ lagen, die Bedingungen ihres Bestehens und Fortbestehens inmitten ande‐ rer Kulturen und der Natur vergewissern. Sie muß und wird in erster Linie artikulieren, daß sie sich in Frage gestellt sieht, und dabei auffächern, wel‐ che Fragen sich in diesem Zusammenhang im Einzelnen stellen. Indem mit den Mitteln des Denkens, Hegel sagt: der ›Vernunft‹, der Zusammenhang dieser Fragen und die möglichen Antworten oder der Hinweis darauf, in welcher Richtung die Antworten gesucht werden müssen, schrittweise ent‐ faltet werden, entsteht die Philosophie der betreffenden Kulturgemein‐ schaft. Aus diesen Aussagen Hegels zur Entstehung und zum Begriff der Philo‐ sophie in dem soeben angegebenen Kontext, ergibt sich seine damalige Konzeption des Verhältnisses von Philosophie und Geschichte.18 Wie man leicht erkennen wird, unterscheidet sich diese Konzeption radikal von He‐ gels späteren Auffassungen. Hegel geht davon aus, daß ›jede Vernunft, die sich auf sich selbst gerichtet und sich erkannt hat,‹ unter den jeweiligen be‐ sonderen Bedingungen ›eine wahre Philosophie producirt und sich die Aufgabe gelöst hat, welche […] zu allen Zeiten dieselbe ist‹. Dies bedeutet, daß Philosophen auf Grund der ›verwandten Kraft des Geistes‹ einander erkennen, daß sie in der Philosophie eines Anderen, auch wenn diese unter sehr unterschiedlichen historischen Bedingungen konzipiert worden ist, ›Geist von ihrem Geist, Fleisch von ihrem Fleisch‹ finden. Anders ausge‐ Hegel, Der immer sich vergrößernde Widerspruch … (1799/1800), in: Werke in zwanzig Bänden, hrsg. von E. Moldenhauer und K.M. Michel, Band 1: Frühe Schriften, Frankfurt/M. 1971, 457‐460, s. bes. 457. 18 Vgl. zu dieser Passage Kimmerle, Das Verhältnis von Philosophie und Geschich‐ te am Anfang der Jenaer Periode des Hegelschen Denkens und dessen aktuelle Bedeutung, in: ders. (Hrsg.), Die Eigenbeudeutung der Jenaer Systemkonzeptio‐ nen Hegels, Berlin 2004, 11‐24. 17 247 drückt: ›Der lebendige Geist, der in einer Philosophie wohnt, verlangt, um sich zu enthüllen, durch einen verwandten Geist geboren zu werden‹.19 Auch dieser Gedanke Hegels, der sich auf die Philosophie – und übrigens auch auf die Kunst – aus früheren Perioden der eigenen Geschichte bezieht, bewährt sich in der Erfahrung der interkulturellen Philosophie. Auch wenn unter fremden geschichtlichen und geographischen Bedingungen eine Kul‐ tur selbstreflexiv wird und sich über ihr Bestehen und Fortbestehen verge‐ wissert, wird die Philosophie, die daraus hervorgeht, für Philosophen einer anderen Kultur erkennbar sein. Die Philosophien verschiedener Kulturen werden dann ebensosehr wie die Philosophien aus verschiedenen Perioden derselben Kultur bei allen inhaltlichen und den Stil des Philosophierens be‐ treffenden Unterschieden dem Rang nach gleich, Hegel sagt: ›in sich voll‐ endet‹, sein. Wie es in der Philosophie ›weder Vorgänger noch Nachgän‐ ger‹ gibt, sofern jede Philosophie ihre Aufgabe unter den Bedingungen ih‐ rer Zeit und Umgebung gelöst hat, so gibt es auch keine Rangunterschiede zwischen Philosophien verschiedener Kulturen. Entscheidend ist (im Blick auf die historischen und die kulturellen Unterschiede), daß die jeweiligen Philosophien die Fraglichkeit ihrer Situation sowie den Zusammenhang einzelner Fragen und möglicher Antwort(richtung)en mit den Mitteln der Vernunft, das heißt des Denkens und nur des Denkens, reflektieren. Für die Philosophie innerhalb der europäisch‐westlichen Tradition läßt sich aus der hier herangezogenen Position Hegels von 1801 ableiten, daß es für das eigentlich Philosophische keine Geschichte in dem Sinn gibt, daß die Späteren gegenüber den Früheren besser sind oder höher stehen. Das‐ selbe läßt sich, mit einer größeren Erwartung auf Zustimmung für das ei‐ gentlich Künstlerische in der Kunst sagen. Was sich ändert, ist ›das Bau‐ zeug eines Zeitalters‹, sind die herrschenden Vorstellungen und Auffas‐ sungen, ist die Sprache einer Zeit. Auch die technischen Mittel sind wich‐ tig, in der Philosophie sind dies vor allem die Medien der Sprachlichkeit und Schriftlichkeit. Bei ihnen gibt es Geschichte und auch geschichtliche Fortschritte, man denke an Diskussionstechniken, Regelungen für Debat‐ ten, persönliche oder telefonische Interviews oder auch an handgeschrie‐ bene Manuskripte, gedruckte Bücher oder digitalisierte Texte. Das eigent‐ Hegel, a.a.O. (in Anm. 16), S. 9‐10 und 12, s. auch zum Folgenden. 19 248 lich Philosophische, die Aufgabe der Philosophie und ihre Lösungswege, wird von den technischen Mitteln nicht tangiert. Wir wagen es nun, die 1801 von Hegel so gefaßte ›geschichtliche Ansicht philosophischer Systeme‹ auf die kulturellen Unterschiede der Philoso‐ phien zu übertragen. Dann ergibt sich: Die kulturellen Unterschiede betref‐ fen nicht das eigentlich Philosophische, das in den höchst unterschiedli‐ chen kulturellen Zusammenhängen dasselbe ist und für Philosophen aus anderen Kulturen als Philosophie erkennbar ist. Deshalb können wir fest‐ halten, daß es für die Philosophien in den verschiedenen Perioden der ei‐ genen Geschichte und in den verschiedenen Kulturen mit ihrer jeweiligen Ge‐ schichte prinzipiell keine Rangunterschiede und keine Entwicklung von weniger gut nach besser oder von tiefer stehend nach höher stehend gibt. Das soll indessen nicht heißen, in der Philosophie gäbe es überhaupt kei‐ ne Rang‐ oder Qualitätsunterschiede. Es ist lediglich gemeint, daß eine Phi‐ losophie nicht deswegen geringeren Rang hat als eine andere, weil sie ge‐ schichtlich gesehen früher ist oder weil sie geographisch gesehen aus ei‐ nem anderen Weltteil und einer anderen Kultur stammt. Innerhalb des ge‐ schichtlichen Zusammenhangs einer bestimmten philosophischen Traditi‐ on oder innerhalb des kulturellen Zusammenhangs einer bestimmten Form des Philosophierens gibt es durchaus Unterschiede des Rangs, der Qualität und des sachlichen Gewichts. Und es gibt auch zeit‐ und kulturübergrei‐ fende Höhepunkte philosophischer Arbeit. Die letzteren müssen jedoch mit besonderer Vorsicht beurteilt werden. Es darf nicht dazu kommen, daß dann doch eine Kultur als philosophisch prinzipiell höherstehend gegen‐ über anderen angesehen wird. Die herausragende Bedeutung von Platon und Aristoteles, Descartes und Spinoza, Kant und Hegel, Heidegger und Wittgenstein in der europäisch‐ westlichen philosophischen Tradition soll ebensowenig in Abrede gestellt werden wie etwa diejenige Laozis und Kongzis in der chinesichen oder der Upanishaden, der Bhagavadgita und der Brahma‐Sutras in der Vedanta‐ Tradition der indischen Philosophie. Andere wichtige Strömungen sind weniger allgemein anerkannt. Der Deutsche Idealismus oder die im angel‐ sächsischen Bereich entstandene Ordinary language philosophy, zwei heraus‐ ragende Richtungen der europäisch‐westlichen Philosophie, werden schon innerhalb dieser Tradition durchaus unterschiedlich beurteilt. Dabei ist die 249 Bedeutung Kants am wenigsten umstritten. Gerade Kant genießt indessen in nicht‐westlichen Philosophien häufig relativ geringere Anerkennung. Was sich am Beispiel der indischen Philosophie zeigt, tritt im Kontext der afrikanischen und anderer nicht primär schriftlich überlieferter philosophi‐ scher Traditionen noch stärker in den Vordergrund, daß nämlich maßgeb‐ liche oder herausragende Beiträge nicht immer mit den Namen ihrer Urhe‐ ber verknüpft sind und wie im Fall afrikanischer philosophischer Traditio‐ nen nicht als bestimmte benennbare und als solche zugängliche Texte oder Textsammlungen anweisbar sind. Vielfach ist hier auch die heutige Kennt‐ nis zu begrenzt, weil die Traditionslinien primär mündlich überlieferter Philosophien mit und seit der Alphabetisierung und Modernisierung der enstprechenden Kulturen abgerissen sind. Wo überhaupt viel philosophi‐ sches Wissen der Menschheit verloren gegangen ist, müssen wir auch den Verlust der Kenntnis besonderer Höhepunkte in diesen Traditionszusam‐ menhängen beklagen. Daß (a) spätere Philosophien prinzipiell nicht besser sind als frühere oder (b) solche der eigenen Tradition prinzipiell nicht besser sind als solche aus anderen Traditionen soll dann auch nicht heißen, daß (a) spätere Philoso‐ phen sich nicht auf frühere zu beziehen brauchen und daß sie nicht nach einer neuen Philosophie streben sollen, in der die positiven Aspekte der äl‐ teren mit aufgenommen werden, oder (b) die Philosophien des einen Kul‐ turraumes nicht kritisiert und bereichert werden können und sollen durch Dialoge mit Philosophien anderer Kulturräume. Im ersteren Fall (a) gibt es so etwas wie einen tragenden Anfang, bei dem von den Früheren für die Späteren der Möglichkeitsspielraum abgesteckt wird, der von diesen durchmessen werden kann oder muß. Das meint Heidegger, wenn er auf den Anfang der europäisch‐westlichen Philosophie bei den Griechen verweist, der die Grundlage für die philosophischen Be‐ mühungen von Platon und Aristoteles bis zu Hegel und Nietzsche bildet und dem gegenüber im 20. Jahrhundert an der Vorbereitung eines ›ande‐ ren Anfangs‹ gearbeitet werden soll. Vergleichbares ließe sich auch hier für die chinesischen und indischen philosophischen Traditionen sagen, die durch Jahrtausende bestimmte anfänglich umgrenzte Möglichkeiten aus‐ messen. Eine besondere Situation ist dabei für einige religiös gebundene Philoso‐ phien gegeben, wie die buddhistische, jüdische, christliche oder islamische 250 Philosophie. Sie berufen sich auf einen tragenden Anfang, dem zugleich eine nicht einholbare oder ersetzbare Autorität zukommt. Die Religionsstif‐ ter und ihre Lehren behalten für die sich darauf berufenden Religionen und die im Kontext dieser Religionen konzipierten Philosophien diese Art von Autorität: Buddha Gautama für den Buddhismus, Moses und die Pro‐ pheten für das Judentum, Jesus und die Apostel für das Christentum, und Mohammed als letzter und maßgebender Prophet für den Islam. Philoso‐ phien, die sich für den sie konstituierenden Begründungszusammenhang auf den Hinduismus oder den Animismus beziehen, wie bestimmte fern‐ östliche, ozeanische oder afrikanische philosophische Traditionen, stehen den nicht religiös gebundenen Philosophien näher, sofern sie nicht von ei‐ nem Religionsstifter ausgehen oder einem solchen die beschriebene Form von Autorität zuerkennen. Der tragende Anfang kann für die Späteren, die sich in dem davon eröff‐ neten Möglichkeitsspielraum ansiedeln, nur von Bedeutung sein, sofern er bei ihnen bekannt ist. Und bestimmte auszumessende Möglichkeiten erhal‐ ten in dem Maß ihre Kontur, wie sie sich von anderen im Allgemeinen und im Einzelnen absetzen. Bei den religiös gebundenen Philosophien, die sich auf Religionsstifter und deren Lehren berufen, ist mit dem tragenden An‐ fang ein in sich unendlicher, aber prinzipiell nicht zu überschreitender Möglichkeitsspielraum gegeben. Der Rückbezug auf den jeweiligen Anfang ist bei ihnen immer notwendig und besonders intensiv. Bei philosophi‐ schen Traditionen, die primär mündlich überliefert worden sind, ist es oft schwer auszumachen, wann und wo der tragende Anfang zu suchen ist und welche darauf aufbauenden oder diesen variierende Möglichkeiten be‐ reits vorliegen. Im Fall der subsaharisch‐afrikanischen Philosophie wird von einigen Autoren auf das alte Ägypten verwiesen,20 dessen Bevölkerung vor der Arabisierung und Islamisierung der Hautfarbe und dem Phänoty‐ 20 Für die religiöse und philosophische Tradition des Ma’at im alten Ägypten gibt es mündliche und schriftliche Überlieferungen. Das wichtigste Zeugnis der letz‐ teren ist das Ägyptische Totenbuch, eine um 1550 v.u.Z. verfertigte Sammlung von zum Teil viel älteren Sprüchen, die bis zu den Pyramiden‐Texten von 2500 v.u.Z. zurückreichen. S. die Einleitung von B. van der Meer in: Het Egyptische doden‐ boek, aus dem Altägyptischen ins Niederländische übers. von M.A. Geru, De‐ venter 1992, 25‐26. 251 pus nach zu Schwarzafrika gehört haben soll.21 Die lateinamerikanische Philosophie konzentriert sich bislang sehr viel mehr auf Dialoge mit euro‐ päisch‐westlichen Partnern, insbesondere mit den Vertretern der Diskurs‐ ethik, als auf die Zuwendung zu einheimischen philosophischen Traditio‐ nen.22 Für die methodische Seite des Umgangs späterer mit früheren Philoso‐ phien in einer bestimmten Tradition möchte ich mich bei dem oben er‐ wähnten von Gadamer vorgeschlagenen Modell von ›Dialogen mit der Ge‐ schichte‹ anschließen, obgleich ich – wie oben gesagt – in Bezug auf das Er‐ gebnis solcher Dialoge und das Maß der jeweils zu erreichenden Verstän‐ digung vorsichtiger sein und ein mögliches bleibendes Nichtverstehen stärker in Rechnung stellen möchte.23 Wer der jeweilige Dialogpartner ist, ergibt sich aus den Besonderheiten und den Bedürfnissen der jeweiligen Gegenwart. Daraus konstituiert sich auch das in einer Gegenwart relevante Bild der Geschichte, nicht als eines Kontinuums von Vorgängern und Nachgängern, sondern eher als eine Art Lostrommel, aus der, freilich nicht blindlings, bestimmte Lose gezogen werden. So ist auch in dem Fall (b) für das Umgehen von Philosophen verschie‐ dener Kulturen mit einander von europäisch‐westlicher Seite aus das Mo‐ dell von Dialogen vorzuschlagen. Das habe ich in anderem Zusammen‐ hang genauer begründet.24 Die Probleme der Gegenwart bedürfen zu ihrer Die These von der schwarzafrikanischen Bevölkerung des alten Ägypten ist von dem senegalesischen Philosophen, Historiker, Physiker und Politiker Cheikh Anta Diop (in Texten von 1959 bis 1981) aufgestellt und näher ausgearbeitet und vielfach sowohl bestritten als auch verteidigt worden. Die altägyptische Philoso‐ phie soll nicht nur für Afrika, sondern auch für das antike Griechenland und über die Griechen für Europa eine konstituive Bedeutung haben. S. Leonhard Harding/Brigitte Reinwald (Hrsg.), Afrika – Mutter und Modell der europäi‐ schen Zivilisation. Zur Rehabilitierung des Schwarzen Kontinents durch Cheikh Anta Diop, Berlin 1990. 22 Raoul Fornet‐Betancourt, Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt/M. 1988; ders., Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Inter‐ kulturalität, Frankfurt/M. 1997. 23 Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O. (in Anm. 7), S. 344‐360. 24 Kimmerle, Dialoge als Form der interkulturellen Philosophie, in: ders. Afrikani‐ sche Philosophie im Kontext der Weltphilosophie, a.a.O. (in Anm. 11). 21 252 adäquaten Behandlung der Zuwendung zu bestimmten Instanzen, Auto‐ ren, Textkonstellationen oder Perioden der jeweils eigenen Geschichte. Das ist indessen nicht genug. Diese Probleme sind so schwierig und in ihrer Zuspitzung für große Teile der Welt oder den Planeten Erde im Ganzen so bedrohlich, daß zu ihrer Lösung oder – was von der Philosophie redli‐ cherweise erwartet werden kann – zum Aufweis der Richtung, in der diese Lösungen zu suchen sind, die philosophischen Potentiale aller Kulturen ge‐ nutzt werden müssen. Die Vorräte an atomaren Waffen ermöglichen noch immer, nach verschiedenen Abrüstungsabkommen, einen overkill der ge‐ samten Menschheit. Und die Gefahr, daß diese Waffen in die Hände von Fanatikern und/oder gewissenlosen Verbrechern geraten, ist in der letzten Zeit sehr gewachsen. Aber auch die Risiken der so genannten friedlichen Nutzung der Atomenergie sind in ihren Ausmaßen kaum abzuschätzen. Schließlich soll hier noch auf die ungeklärten möglichen Folgen der Gen‐ technologie hingewiesen werden. Die wissenschaftlich‐technische Erfor‐ schung und Erprobung der genetischen Manipulation, einschließlich des Klonens von Menschen, wird sich nicht aufhalten lassen. Es wird darauf ankommen, daß die Philosophen aller Länder und Weltteile ihre Potentiale und Kräfte zusammenfassen, um wenigstens gesagt zu haben, wo die ethi‐ schen und vernünftigen Grenzen des Gebrauchs solcher Energien und Technologien verlaufen. Es ist leicht ersichtlich, daß im bisherigen Diskurs zum Philosophiebe‐ griff und zur Philosophiegeschichte primär von den Voraussetzungen der kontinentalen europäischen Philosophie und den von hier aus geführten Dialogen mit den Philosophien anderer Kulturen ausgegangen worden ist. Ergänzend hierzu möchte ich den afrikanischen Philosophen Odera Oruka zu Wort kommen lassen, der sich in seinem Philosophieverständnis einer‐ seits innerhalb der europäisch‐westlichen Philosophie auf die angelsäch‐ sisch geprägte Ausübung dieses Faches beruft, wie sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts dort vor‐ herrschend ist, und andererseits auf die Traditionen der afrikanischen Phi‐ losophie, besonders auf die Philosophen der traditionellen afrikanischen Gemeinschaften, die er sages nennt. Er steht also für einen im bisherigen Diskurs weniger herangezogenen Traditionszusammenhang der europä‐ isch‐westlichen Philosophie und für den Versuch, von diesem aus oder auf diesen hin die Relevanz der afrikanischen philosophischen Traditionen 253 sichtbar zu machen. Die Erörterung seines Philosophieverständnisses bil‐ det eine Fallstudie, die den bisherigen Überlegungen zur Seite gestellt werden soll, die vor allem von kontinental‐europäischen philosophischen Richtungen und der darin sich begründenden interkulturellen Philosophie ausgehen. Nun hat es in der europäisch‐westlichen Ausübung des Faches Philoso‐ phie vierzig Jahre gedauert, bis das Schisma zwischen kontinental‐ europäischer und britisch‐nordamerikanischer Philosophie überwunden worden ist, das nach dem Zweiten Weltkrieg von Ausnahmen abgesehen in den philosophischen Diskussionen dieses Traditionszusammenhangs geherrscht hat. Seit den 1980er Jahren beschäftigt man sich in der angel‐ sächsischen Philosophie auch sehr viel mit Kant und Hegel, Husserl und Heidegger, Sartre und den Differenzphilosophen. Umgekehrt werden von der europäisch‐kontinentalen Philosophie Peirce und Russell, Austin und Searle, Wittgenstein und Putnam intensiv rezipiert und diskutiert. Dem‐ entsprechend wird vermutlich auch eine längere Zeitperiode erforderlich sein, bevor die europäisch‐westliche Philosophie sich in ihren offiziellen Vertretern und Wortführern und in ihrer Breite für die Philosophien ande‐ rer Kulturen öffnet. Orukas Bestimmung der Philosophie und des Um‐ gangs mit ihrer Geschichte, die in Hinsicht auf ihre Orientierung an einer spezifisch angelsächsischen Ausübung der Philosophie bereits einer ver‐ gangenen Periode angehört, kann indessen für die Zukunftsaufgabe der Öffnung der Philosophien verschiedener Kulturen für einander durchaus von Bedeutung sein. Was den Umgang mit der Geschichte der eigenen Phi‐ losophie betrifft, steht Oruka mit der ihm eigenen Entschiedenheit auf der Seite der hier vertretenen interkulturell philosophischen Position, wobei er in Bezug auf die eigenen Traditionen auch durchaus kritisch urteilt.25 In der Bestimmung dessen, was Philosophie ist, betont Odera Oruka zu‐ nächst ihre enge Verbindung mit den Wissenschaften, insbesondere den exakten Naturwissenschaften. Er stimmt dem Argument zu, es sei ›die Hauptaufgabe der Philosophie […] die Natur und die Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft zu bestimmen‹. Später präzisiert und modi‐ Henry Odera Oruka, Mythologies as African Philosophy (1972), in: A. Graness/K. Kresse (Hrsg.), Sagacious Reasoning. Henry Odera Oruka in memo‐ riam, Frankfurt/M. u.a. 1997, 23‐34. 25 254 fiziert er diesen Standpunkt dahingehend, daß es die Aufgabe der Philoso‐ phie ist, die Grundlagen der Wissenschaften zu klären. Das kann nach der Auffassung Orukas die Philosophie nur leisten, wenn sie auch ihre eigenen Annahmen immer wieder in Frage stellt.26 Grundsätzlich gilt: ›Im exakten Sinn ist Philosophie eine rationale und kritische Reflexion auf den Men‐ schen, die Gesellschaft und die Natur‹. Wenn er sagt, eine ›Beschreibung‹ sei deshalb nicht genug, läßt er offensichtlich die spezifischen Möglichkei‐ ten der auf das Wesen gerichteten phänomenologischen Beschreibung au‐ ßer Acht. Wenn es sich um die Philosophie einer bestimmten Gemeinschaft handelt, die nicht von einem individuellen Philosophen konzipiert ist, handelt es sich seiner Meinung nach allenfalls um Philosophie in einem herabgesetzten Sinn (in a debased sense). Dieser einseitig am angelsächsisch geprägten Philosophieverständnis der Zeit bis etwa 1985 orientierte Philosophiebegriff Orukas führt zu einigen recht problematischen Positionen. Dazu gehört, daß er religiös gebundene Philosophien nicht als solche anerkennt. Zwischen Mythologie und Philo‐ sophie sieht er eine tiefe Kluft. Das sicher mit einigen nicht adäquaten Vor‐ aussetzungen belastete, aber im Ergebnis für die afrikanische Philosophie positive Unternehmen von Placide Tempels, der als Europäer die Philoso‐ phie der Bantu aus der Sprache, Mythologie und den Gebräuchen eines Bantu‐Volkes rekonstruiert, kann Oruka nur rundheraus ablehnen. Und im Blick auf die von ihm entdeckte Philosophie der sages sieht er sich veran‐ laßt, einen nicht sehr überzeugend durchgeführten Unterschied zwischen folk sages und philosophical sages einzuführen, wobei nur die Letzteren sei‐ nem einseitigen Kriterienkatalog für das, was ›Philosophie‹ ist, entspre‐ chen. Indessen erreicht Oruka auf diesem Weg durchaus ein strategische Ziel: wer selbst bei der Anwendung dieser äußerst eng gefaßten Kriterien als Philosoph ›im exakten Sinn‹ klassifiziert wird, dem wird dieser Titel von niemandem mehr streitig gemacht werden können. Schließlich gibt Oruka seinem Philosophieverständnis eine Wendung, die das entschiedene ethische Engagement für die armen Länder innerhalb der Weltgesellschaft erklärt, das sich in seinen späteren Schriften findet. Indem 26 Odera Oruka, Philosophy and other Disciplines (1974), in: Graness/Kresse (Hrsg.), Sagacious Reasoning a.a.O (vorige Anm.), 35‐45, s. bes. 42‐43, s. zum Folgenden den in Anm. 25 genannten Aufsatz 28‐31. 255 er die Philosophie von den Wissenschaften abgrenzt, betont er gerade für die afrikanischen Länder, daß sie neben ihrer Aufgabe, Grundlagenfor‐ schung zu betreiben, zum Entstehen und zum Ausbau einer ›kulturellen Plattform‹ Wichtiges beitragen kann. Sie kann mithelfen, daß einem rein technologisch orientierten Entwicklungsbegriff eine kulturelle Dimension hinzugefügt wird, so daß ein ›besseres‹ Leben sich nicht nur auf den mate‐ riellen Lebensstandard bezieht, sondern auch darauf, daß die Menschen ›glücklicher, würdiger, im Umgang mit einander freundlicher, friedlicher und wohlhabender‹ werden.27 Das sind Ziele, die nicht nur durch eine Mo‐ dernisierung und Verwestlichung nicht‐westlicher Länder erreicht werden können, sondern die Einflüsse in beide Richtungen, eine gemeinsame Ar‐ beit der Philosophen aus verschiedenen Kulturen, voraussetzen. Es wird deutlich geworden sein, daß sich interkulturelle Philosophie nicht ausschließlich am Schreibtisch oder vor dem PC entwickeln läßt. Aus diesem Grund habe ich in meinem Artikel ›Afrikanische Philosophie als Weisheitslehre?‹ von einer ›Methodologie der Tat‹ gesprochen.28 Für euro‐ päisch‐westliche Philosophen ist es wichtig, daß sie sich der anderen Kul‐ tur aussetzen, mit deren Philosophie sie in einen Dialog kommen wollen, indem sie längere Zeit am Ort und in der Umgebung der dortigen Kollegen am Prozeß der Forschung und Lehre teilnehmen sowie umgekehrt mit die‐ sen Kollegen am eigenen Ort und in der eigenen universitären Umgebung zusammen arbeiten. Das müßte auf die Dauer zu einem Austausch von Professoren, Dozenten und Studenten führen. Die Arbeit der Gesellschaf‐ ten und Stiftungen für interkulturelle Philosophie mit ihren Kongressen und Symposien sowie den bisher bestehenden Buchreihen und Zeitschrif‐ ten, die zum Teil auch im Internet präsent sind, bilden in dieser Hinsicht einen Anfang. Die offiziellen, auch mit entsprechenden Mitteln ausgestatteten europä‐ isch‐westlichen Wissenschaftsinstitutionen geben der interkulturellen Di‐ mension der Philosophie nur wenig Raum. In den Ländern des europäi‐ schen Kontinents ist dies in noch weitergehendem Maß der Fall als in den Odera Oruka, a.a.O. (vorige Anm.), 43‐45. Kimmerle, Afrikanische Philosophie als Weisheitslehre?, in: R.A. Mall/D. Loh‐ mar (Hrsg.), Philosophische Grundlagen der Interkulturalität, Amster‐ dam/Atlanta, GA 1993, 159‐180, s. bes. 159 und 178 Anm. 1. 27 28 256 angelsächsischen Ländern, besonders in den USA. Es hat zur Folge, daß die Beschäftigung mit buddhistischer und hinduistischer Philosophie zwar auf breiter Front, aber überwiegend in außeruniversitären Kontexten geschieht. Das gilt noch mehr für islamischer Philosophie, obwohl aktuelle Ereignisse, in denen der islamische Fundamentalismus unübersehbar vor der Weltöf‐ fentlichkeit präsent ist, zu einer gründlicheren Beschäftigung herausfor‐ dern. Die Dialoge mit lateinamerikanischer Philosophie bleiben am Rande offizieller akademischer Arbeit. Das Schlusslicht bilden afrikanische und andere traditionell primär mündlich überlieferte Philosophien. Sofern gerade auch die letzteren zu einer Neubesinnung auf den Philo‐ sophiebegriff und die Philosophiegeschichte Anlaß geben, kann ihre Ein‐ beziehung einen Umschlag herbeiführen. Weil mündliche Formen der Kommunikation und Überlieferung im Vorgerund stehen, ergibt sich die Frage, was die besonderen Möglichkeiten und Ausdrucksformen primär mündlichen philosophischen Denkens sind und wie sie sich zur primär schriftlich betriebenen Philosophie verhalten. Odera Oruka weist für die oben erwähnte Philosophie der sages darauf hin, daß sie in wesentlich grö‐ ßerem Maß als schriftlich betriebene Philosophien von der Kapazität des Gedächtnisses Gebrauch machen.29 Damit hängen bestimmte sprachliche Ausdrucksformen zusammen wie die Wiederholung bestimmter charakte‐ ristischer Wendungen und die Zusammenfassung in kondensierten Formu‐ lierungen. Die Weitergabe des Wissensvorrats geschieht im Zusammen‐ hang gemeinsamen Lebens und Philosophierens älterer und jüngerer Phi‐ losophen. Bindung an die Tradition und kritische Weiterbildung des Über‐ lieferten spielen zugleich eine Rolle. In seiner Habilitationsschrift, in der er die Besonderheiten primär münd‐ lichen philosophischen Denkens gegenüber schriftlichen Formen der Philo‐ sophie thematisch behandelt, hebt Mabe, der aus Kamerun stammt und in Deutschland lehrt, drei ›Methoden der Oralität‹ besonders hervor: Media‐ tion, Inspiration und Initiation, die sich spezifisch auf die mündlichen Formen des philosophischen Denkens im subsaharischen Afrika bezie‐ 29 Odera Oruka, Sage Philosophy. Indigenous Thinkers and Modern Debate on Af‐ rican Philosophy, Leiden u.a. 1990, 27‐32. 257 hen.30 ›Mediation‹ meint, daß jemand ein Medium sein kann und Botschaf‐ ten aus einer übersinnlichen Welt erhält. Dabei grenzt Mabe philosophi‐ sche Mediation ausdrücklich ab von dem ›mystischen Medium der Magier, Hexen, Heiliger und (wie er sagt) sonstiger Scheinpropheten‹. Es geht ihm vielmehr um ›mediatisierte oder mediative Vernunft‹, durch die eine ›syn‐ thetische Verbindung von Geist und Körper oder Seele und Leib‹ entsteht. Der Geist oder die Seele hat nicht nur Verbindung zur übersinnlichen Welt der Ideen, er oder sie kann auch von den Geistern Verstorbener Informa‐ tionen empfangen. ›Inspiration‹ und Intuition sind auch beim primär schriftlichen Philoso‐ phieren unverzichtbar. Als Methode der Oralität wird sie von Mabe we‐ sentlich weiter gefaßt. Traum, Musik, Tanz, rhetorisches Sprechen sind nach seiner Darstellung Ausdrucksformen der Inspiration. Sie ermöglicht Zugang zur ›unsichtbaren Seite des Universums‹. Die ›Initiation‹ bezieht sich auf die rituelle Einweihung nicht nur in bestimmte Lebensphasen, sondern auch in ein anders nicht ohne weiteres zugängliches Wissen. Als Beispiel erwähnt Mabe den ›Regenmacher‹, der auf Grund einer Initiation über ein Wissen der ›dem Klima zugrunde liegenden Gesetze‹ verfügt, das es ihm ermöglicht, diese zu beeinflussen. Dem Projekt einer Konvergenzphilosophie gemäß, an dem Mabe arbeitet, sucht er orales und schriftliches Philosophieren zusammen zu bringen und zu harmonisieren. Den Methoden der Oralität ordnet er Methoden des primär schriftlichen Philosophierens zu. So will er Mediation mit ›Analy‐ se‹, Inspiration mit ›Experiment‹ verbinden. Für Initiation findet sich kein methodisches Äquivalent im schriftlichen Philosophieren, obwohl das Sich‐ berufen‐fühlen (›Vokation‹) auch hier eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Beide Grundtypen philosophischen Denkens können sich nach Mabes Dar‐ stellung ergänzen, so daß ein sehr viel stärkeres Instrumentarium für die weltweite philosophische Arbeit entsteht. Jacob Emmanuel Mabe, Schriftliche und mündliche Formen des philosophischen Denkens in Afrika, Diss. habil., TU Berlin 2004, 196‐213. (Einfügung in Klam‐ mern im Zitat von mir, HK.) Die Zusammenfassung dieser Passage aus dem Werk Mabes und die daran anschließenden Überlegungen machen Gebrauch von dem Schluß‐Abschnitt meines Buches: Afrikanische Philosophie im Kontext der Weltphilosophie, a.a.O. (in Anm. 11), 119‐122. 30 258 Es ist zweifellos wichtig und zukunftsweisend, Möglichkeiten der Kon‐ vergenz primär schriftlichen und primär mündlichen Philosophierens auf‐ zuweisen. Daneben scheint es mir auch sinnvoll, nicht nur eine Vermi‐ schung und Harmonisierung beider Formen philosophischen Denkens an‐ zustreben, sondern auch jede für sich weiter zu entwickeln und auszubau‐ en. Jedenfalls sollte die Möglichkeit bestehen, schwerpunktmäßig mit den Methoden der Oralität oder denen der Schriftlichkeit zu arbeiten. Bei den interkulturell philosophischen Dialogen, die sich beider Formen des Philo‐ sophierens bedienen und die auf diesen Wegen inhaltliche Ergänzung und Bereicherung durch die Kombination und das Auf‐einander‐Beziehen der Philosophien verschiedener Kulturen zustande zu bringen suchen, ergeben sich Gemeinsamkeiten und Divergenzen. So sind zum Beispiel afrikani‐ scher Gemeinschaftssinn und europäisch‐westlicher Individualismus beide in Bewegung, teils durch wechselseitiges Kennenlernen und Dialogisieren, teils auch in anderen Zusammenhängen. Aus den interkulturell philoso‐ phischen Dialogen zu diesem Thema ergibt sich schließlich: einerseits wird im afrikanischen Denken das Ich im Wir verstärkt, andererseits gewinnt im europäisch‐westlichen Denken das Eingebettetsein des Ich ins Wir an Be‐ deutung. Aber es bleiben unterschiedliche Akzentuierungen beider Instan‐ zen. Häufig geht es nicht darum, die Position des Anderen, soweit es gelingt sie zu verstehen, ganz oder teilweise zu übernehmen. Die Erweiterung des Verstehenshorizonts, auch wenn dieser nicht mit dem Horizont des Ge‐ sprächspartners ›verschmilzt‹, hat als solche bereits eine nicht unerhebliche wissensmäßige und ethische Bedeutung. So kann die ganz andere Behand‐ lung der Wahrheitsfrage durch afrikanische Philosophen, um dieses Bei‐ spiel hier heran zu ziehen, dabei helfen, in der eigenen Tradition und aktu‐ ellen Denksituation weniger Beachtetes oder Vergessenes ans Licht zu bringen. Eine allgemeine Sensibilisierung für Unterströmungen, bewußt oder unbewußt Ausgeschlossenes in den eigenen Diskursen ist als solche bereits wertvoll und von Nutzen. Das Streben nach Gemeinsamkeiten und Konvergenzen steht in der heutigen Welt an erster Stelle. Zur Lösung der weltweiten Probleme auf den Gebieten des Umweltschutzes, der Friedens‐ sicherung und des Umgangs mit gefährlichen Möglichkeiten gentechnolo‐ gischer Manipulation sind alle verfügbaren Mittel des Denkens und klä‐ render Reflexion einzusetzen. Aber auch das Festhalten von Diversität und 259 (noch) nicht harmonisierbaren Unterschieden ist wichtig. Auf diesem Weg bleibt ein dynamisches Reservoir an Denkmitteln und Denkmöglichkeiten erhalten, aus dem auch in Zukunft geschöpft werden kann, wenn es gilt, neuen Herausforderungen zu begegnen und an der Lösung jetzt noch nicht bekannter Probleme zu arbeiten. Literaturangabe: Kimmerle, Heinz: Interkulturelle Konzeptionen des Philosophiebegriffs und der Philosophiegeschichte, in: Wege zur Philosophie. Grundlagen der Interkultu‐ ralität, hrsg. v. Hamid Reza Yousefi, Klaus Fischer und Ina Brau, Nordhau‐ sen 2006 (239‐260). 260