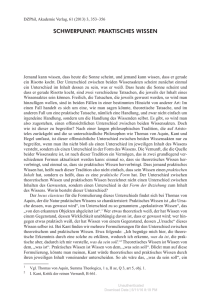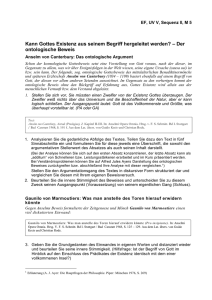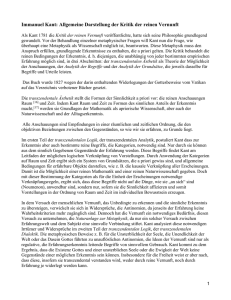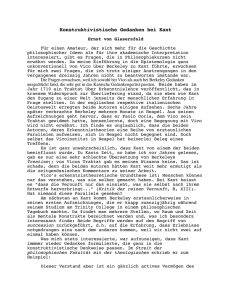Was kann ich wissen? Kants „veränderte Methode der Denkungsart
Werbung
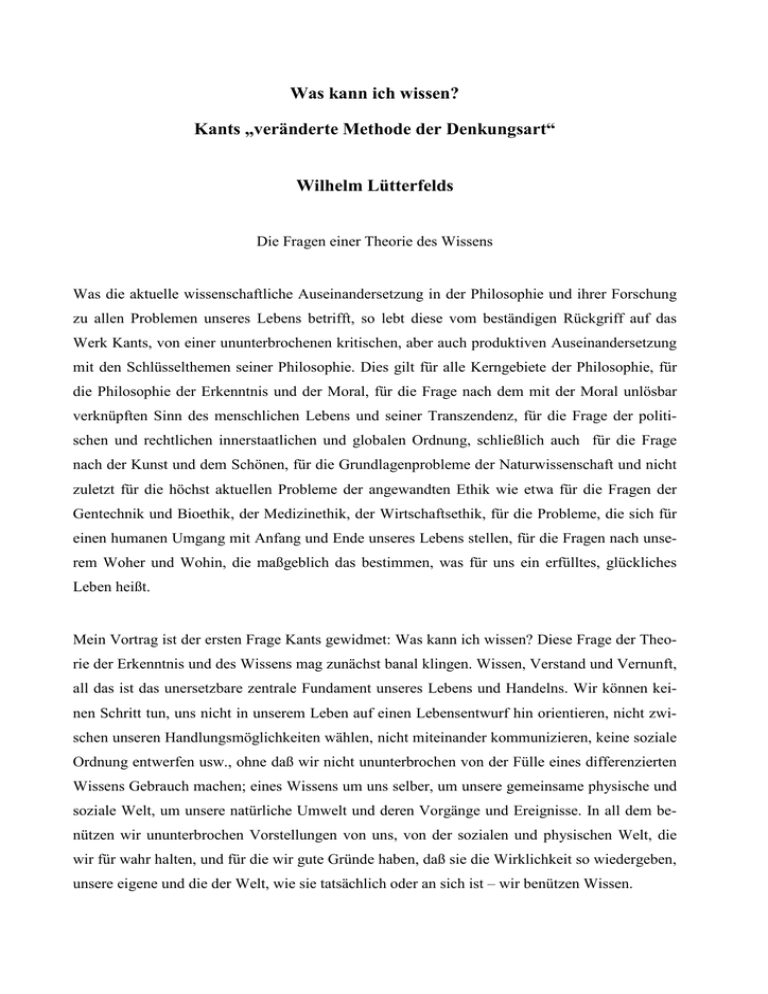
Was kann ich wissen? Kants „veränderte Methode der Denkungsart“ Wilhelm Lütterfelds Die Fragen einer Theorie des Wissens Was die aktuelle wissenschaftliche Auseinandersetzung in der Philosophie und ihrer Forschung zu allen Problemen unseres Lebens betrifft, so lebt diese vom beständigen Rückgriff auf das Werk Kants, von einer ununterbrochenen kritischen, aber auch produktiven Auseinandersetzung mit den Schlüsselthemen seiner Philosophie. Dies gilt für alle Kerngebiete der Philosophie, für die Philosophie der Erkenntnis und der Moral, für die Frage nach dem mit der Moral unlösbar verknüpften Sinn des menschlichen Lebens und seiner Transzendenz, für die Frage der politischen und rechtlichen innerstaatlichen und globalen Ordnung, schließlich auch für die Frage nach der Kunst und dem Schönen, für die Grundlagenprobleme der Naturwissenschaft und nicht zuletzt für die höchst aktuellen Probleme der angewandten Ethik wie etwa für die Fragen der Gentechnik und Bioethik, der Medizinethik, der Wirtschaftsethik, für die Probleme, die sich für einen humanen Umgang mit Anfang und Ende unseres Lebens stellen, für die Fragen nach unserem Woher und Wohin, die maßgeblich das bestimmen, was für uns ein erfülltes, glückliches Leben heißt. Mein Vortrag ist der ersten Frage Kants gewidmet: Was kann ich wissen? Diese Frage der Theorie der Erkenntnis und des Wissens mag zunächst banal klingen. Wissen, Verstand und Vernunft, all das ist das unersetzbare zentrale Fundament unseres Lebens und Handelns. Wir können keinen Schritt tun, uns nicht in unserem Leben auf einen Lebensentwurf hin orientieren, nicht zwischen unseren Handlungsmöglichkeiten wählen, nicht miteinander kommunizieren, keine soziale Ordnung entwerfen usw., ohne daß wir nicht ununterbrochen von der Fülle eines differenzierten Wissens Gebrauch machen; eines Wissens um uns selber, um unsere gemeinsame physische und soziale Welt, um unsere natürliche Umwelt und deren Vorgänge und Ereignisse. In all dem benützen wir ununterbrochen Vorstellungen von uns, von der sozialen und physischen Welt, die wir für wahr halten, und für die wir gute Gründe haben, daß sie die Wirklichkeit so wiedergeben, unsere eigene und die der Welt, wie sie tatsächlich oder an sich ist – wir benützen Wissen. 2 Es ist aber nicht nur deshalb eine philosophische Kernfrage, von welcher Art nun dieses Wissen ist und worin der Umfang, die Grenzen und die Grundlagen unseres Wissens von der gesamten Wirklichkeit bestehen. Sondern mit der Antwort auf diese Fragen nach Art, Umfang, Grenzen und Grundlagen unseres Wissens steht und fällt auch der Anspruch unserer menschlichen Vernunft, die letzten und entscheidenden Sinnfragen des menschlichen Lebens beurteilen und bewerten zu können. Können wir wissen oder ist es unserem Wissen prinzipiell entzogen, daß wir vernünftige, geistige Wesen sind und nicht nur ein hochkomplexes deterministisches Gehirn? Können wir wissen, daß wir die Fähigkeit haben, unter moralischen Normen und Gesetzen frei zu entscheiden und zu handeln, dafür Verantwortung zu tragen und auch dafür, daß wir moralisch korrektes Verhalten verfehlen können? Können wir wissen, daß wir in einem Kosmos leben, dessen Anfang und Ende und dessen natürliche Struktur von uns letztlich erkennbar ist, der eine Schöpfung eines Absoluten, Gottes ist oder aber nur die Wirklichkeit einer sich selbst immer wieder erschaffenden Natur? Sind wir nur ein Produkt einer biologischen Evolution, oder gehört unsere Vernunft mit all ihren kulturellen Leistungen zu einer geistigen Welt, die sich aus der biologischen und physikalischen Natur gerade nicht ableiten läßt? All dies sind Fragen der sogenannten Metaphysik, d. h. der zentralen philosophischen Disziplin. „Alle unsere Erkenntnis fängt mit Erfahrung an ...“ Der große Gegenspieler einer traditionellen Metaphysik, die all diese Fragen positiv beantwortete, war und ist in der Geschichte der Philosophie und der Gegenwart der Empirismus: Art und Umfang, Grenzen und Grundlagen unseres Wissens bestimmen sich allein und ausschließlich von dem sinnlichen, empirischen Fundament unserer Kenntnis her, von der Erfahrung unserer Sinne. Auch in Kants „Kritik der reinen Vernunft“ beginnt alle menschliche Erkenntnis mit Erfahrung. Zeitlich vor der sinnlichen Wahrnehmung der Welt verfügen wir nicht über ein Wissen – etwa über ein angeborenes Wissen, das wir hätten, ohne zuvor mit unseren Augen gesehen, mit unseren Ohren gehört zu haben usw. Doch die Schlüsselfrage für Kant ist, im Gegensatz etwa zu David Hume oder den modernen Empiristen, ob alles menschliche Wissen auch ausschließlich aus Erfahrung entspringt. Denn wenn wir davon ausgehen, daß die für den Menschen wichtigsten und bedeutsamsten Themen seines Wissens eben nicht die Dinge und Ereignisse der sinnlich wahrnehmbaren Welt sind, sondern die Vorstellungen oder besser: Ideen seiner Vernunft, wie etwa die Ideen der Freiheit, der Immaterialität seines Geistes, der Unsterblichkeit seiner Seele, 3 der Moral und des Glücks als des höchsten Gutes seines Lebens, der Existenz eines Absoluten, Gottes, des Ursprungs und des Endes des Kosmos; und wenn all diese Ideen Sachverhalte und Phänomene darstellen, die wir gerade nicht in unserer sinnlichen, raumzeitlichen Erfahrung antreffen, dann müssen wir für diese wichtigsten Ideen unseres Selbstverständnisses die Frage völlig offen lassen, ob es denn von ihnen ein begründetes wahres Wissen gibt – wenn denn alles gegenständliche Wissen aus der Wahrnehmung entspringt. Zwar können wir uns all dies irgendwie denken und vorstellen. Aber denken können wir, was wir wollen, ohne daß es auch wahr sein muß, d. h. ohne daß all das von uns Gedachte auch wirklich existiert: Wenn wir all dies bloß denken, bleibt die Frage völlig offen und es bleibt umstritten, ob in all diesen Ideen unserer Vernunft auch begründetes Wissen vorliegt. „ ..., aber nicht alle unsere Erkenntnis entspringt aus Erfahrung“ Kant kritisiert radikal einen solchen skeptischen Empirismus mit seiner These zum Beginn der „Kritik der reinen Vernunft“, nämlich daß zwar alle menschliche Erkenntnis mit Erfahrung anfängt, aber eben nicht alle aus Erfahrung entspringt. So wissen wir zwar nicht aufgrund unserer sinnlichen Wahrnehmung von einer Existenz Gottes und nicht aus Erfahrung, daß es einen Ursprung und ein Ende des Kosmos gibt, daß wir eine immaterielle Seele und einen freien Willen haben. Aber wenn es dennoch nach Kant eine Möglichkeit geben soll, auch für diese zentralen und elementarsten Themen unserer Vernunft so etwas wie ein Wissen und eine Erkenntnis geltend zu machen, dann muß dies Wissen einen anderen Ursprung haben als in unserer Erfahrung und Wahrnehmung. Nichtempirisches apriorisches Wissen in Alltag und Wissenschaft Dieses Problem eines nicht aus Erfahrung stammenden Wissens von uns, von Gott und der Welt, betrifft freilich nicht nur die metaphysischen Ideen, die für unser Leben von größter Bedeutung sind. Vielmehr betrifft es bereits ein Wissen, das wir alltäglich ununterbrochen benützen und das zu unserer Orientierung im Leben und Handeln unerläßlich ist: So unterstellen wir z.B. in jeder 4 Situation unseres Lebens, daß immer dann, wenn irgend etwas passiert, das wir sinnlich wahrnehmen, dieses Ereignis eine Wirkung ist, die ihre Ursache in einem anderen Ereignis haben muß, auch wenn wir diese Ursache noch nicht kennen; bzw. daß jenes seinerseits wiederum eine Ursache für ein anderes Ereignis, für eine Wirkung ist, die wir ebenfalls aufgrund unserer Erfahrung erst zu identifizieren haben. Davon, daß dieses Gesetz der Kausalität objektiv und wirklich gilt in den Ereignissen dieser Welt, davon machen wir unser Leben abhängig. Es ist für uns absolut gewiß. Man muß nur an den berühmten Ziegelstein – das Beispiel des lebensfremden Philosophen – denken, der von einem Haus herunterfällt und unvermeidlich eine Wirkung, einen Schaden verursacht, etwa einen Menschen verletzt. Auch jeder, der sich ins Auto setzt und Auto fährt, weiß um die möglichen Wirkungen, die er dadurch hervorruft, wie etwa möglicherweise Unfälle. Und jeder, der sich ernährt, weiß, daß er diese Wirkung nur hervorruft, wenn er sie dadurch verursacht, daß er ißt und trinkt. Er weiß, daß dann, wenn er die Hand ins Feuer hält, als Wirkung eine Verbrennung an seiner Hand auftritt. Er weiß, wenn er nicht schwimmen kann und ins Wasser fällt, daß er ertrinken wird – um einige Beispiele von David Hume zu nennen. Dieses Wissen um die Kausalität der Ereignisse gilt uns als objektiv, wahr, allgemein gültig und unbedingt lebensnotwendig. Doch woher wissen wir um diese objektive, wirkliche Geltung des Kausalitätsgesetzes von Ursache und Wirkung? Aufgrund unserer individuellen Erfahrung und selbst auf Grund der stammesgeschichtlichen Erfahrungen der Menschen, die kulturell weitergegeben wurden, verfügen wir nur über Kenntnisse eines winzigen Bruchteils der Ereignisse in der Welt. Wir dürften eigentlich auf dieser äußerst beschränkten empirischen Basis unserer Erfahrungen, die für das Kausalgesetz sprechen, nur geltend machen, daß es in unseren bisherigen Erfahrungen offenbar gegolten hat. Wir dürften aber nicht mit einer absoluten Sicherheit erwarten, daß es auch für alle unsere zukünftigen Erfahrungen von Ereignissen objektiv gelten wird, was wir jedoch immerzu unterstellen. Demnach kann unser Wissen um die Ursache–Wirkungs–Zusammenhänge der Ereignisse nicht aus Erfahrung entspringen – es ist (so Kant) a priori oder nichtempirisch, d. h. erfahrungsunabhängig und erfahrungsvorgängig. Aber wie können wir dann dieses allgemeingültige, notwendige und objektive Wissen um die kausale Struktur der Ereignisse in der Welt, das a priori ist und jeder Erfahrung vorangeht, in seiner Herkunft erklären und begründen? Ähnliches gilt etwa für die Struktur unserer räumlichen Wahrnehmung oder Anschauung und für jene Struktur, die wir allen Dingen in der Zeit zuschreiben, uns als menschliche Personen einge- 5 schlossen. Denn für all dieses unterstellen wir, daß dann, wenn die Dinge sich verändern, und das tun sie ununterbrochen, dennoch etwas in ihnen als ein und dasselbe dauert, identisch bleibt – dieselbe Person, dasselbe Buch, dasselbe Auto. Ein weiteres Beispiel: Daß unser Anschauungsraum, wo auch immer wir in der Welt hinkommen und was auch immer wir anschaulich wahrnehmen, dreidimensional ist, daß er eine perspektivische Struktur hat, nämlich mich selbst als Anschauungszentrum, daß darin die Dinge und Ereignisse immer kleiner werden, je weiter wir sie von uns entfernt wahrnehmen –, auch dieses Wissen samt seiner ständigen Korrektur kann nicht bloß unserer bisherigen Erfahrung entspringen. Denn wir dehnen es von vornherein oder a priori auf alle unsere möglichen Erfahrungen und Anschauungen aus, die wir jemals von Dingen oder Ereignissen in unserer anschaulichen Welt machen werden. Wir wissen um die Struktur unseres Gesichtsraumes bereits jetzt im Sinne eines apriorischen Zukunftswissens, wir wissen, daß alle raum–zeitliche Wirklichkeit, die wir jemals wahrnehmen werden, diese Struktur hat, obwohl wir die zukünftige Wirklichkeit überhaupt noch nicht kennen. Wie können wir aber dieses Wissen rechtfertigen und begründen, wenn es nicht aus unserer bisherigen Erfahrung entspringen kann und wenn wir doch darüber mit größter Sicherheit verfügen? Ähnliches gilt etwa für unser Wissen darum, daß wir alle Dinge im Raum immer so sehen und sehen werden, daß sie an einem anderen Ort existieren, als wo wir uns selber befinden, daß sie räumlich ausgedehnte, meßbare Größen sind, daß sie sich in einer räumlichen Ordnung mit anderen Gegenständen im Raum befinden. Und ein berüchtigtes Beispiel für ein solches apriorisches, nichtempirisches Wissen um die Struktur der Wirklichkeit ist für Kant schließlich das formale Wissen darum, daß 5 + 7 = 12 sind – dies gilt nicht nur für alles, was wir jemals gezählt und addiert haben. Sondern es gilt auch für alles, was wir jemals zählen und addieren werden. Denn wo auch immer wir 5 Objekte zu 7 Objekten hinzufügen – es werden notwendig und objektiv 12 Objekte sein. Kants „veränderte Methode der Denkungsart“: Die „kopernikanische Wende“ Wie läßt sich für Kant dieses nichtempirische, apriorische Wissen erklären und rechtfertigen? Dies geht nur, wenn wir unsere „Denkungsart“ ändern – so Kants These der „kopernikanischen Wende“ in der Erkenntnistheorie. Das berühmteste Zitat dazu lautet: „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche sie a priori etwa durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach 6 unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll“. „Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen“ (KrV, B XVII). Und die berüchtigste Formulierung dieses Sachverhalts lautet: «Der menschliche Verstand schreibt der Natur seine Gesetze vor» (Prolegomena, §36). Das klingt auf den ersten Blick nicht nur völlig unverständlich, sondern geradezu unsinnig. Erleben wir uns denn nicht als Lebewesen, die gerade Teil der Natur sind, etwa der biologischen Evolution, so daß es deren Gesetze sind, die unser Leben bestimmen und nicht umgekehrt? Kants These der „kopernikanischen Wende“ in der Theorie menschlicher Erkenntnis und menschlichen Wissens, nach der sich das Abhängigkeitsverhältnis der menschlichen Vernunft von der Welt gerade umkehrt, indem die Vernunft der Natur Gesetze vorschreibt, so wie sich in der Revolution des Kopernikus die Sonne nicht mehr um die Erde drehte, sondern umgekehrt, diese These ist die härteste, berühmteste, aber eben auch berüchtigtste These Kants, die immer wieder radikale Ablehnung hervorgerufen hat (Kritik der reinen Vernunft, B XVIf; vgl. Prolegomena § 36). Wie ist sie zu verstehen, wenn sie denn sinnvoll sein soll, und erst recht objektiv gültig oder wahr? Natürlich sind wir auch für Kant in unserem empirischen Wissen um die Welt, um ihre Dinge, Ereignisse, Zustände, radikal davon abhängig, daß wir nur das erfahren und wissen können, was es denn tatsächlich in der Welt gibt. Ein Mensch, der sich nicht ununterbrochen im Alltag auf das Zeugnis seiner Sinne von der Außenwelt verläßt, und der insofern nicht zuerst durch Erfahrung feststellt, was die Wirklichkeitssituation ist, in der er sich befindet, der also gerade der Welt und ihren Ereignissen nicht vorschreibt, ob es sie gibt und wie sie beschaffen sind –, ein solcher Mensch könnte nicht einmal eine auch nur kurze Zeit überleben. Diese Erfahrungsabhängigkeit menschlichen Wissens von der Außenwelt kommt auch Kant nicht einmal in den Sinn zu bestreiten. Und das kantische Bild von der „kopernikanischen Wende“ im Abhängigkeitsverhältnis von Erkenntnis und Wirklichkeit kann diese Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses des menschlichen Wissens von der Welt nicht besagen. 7 In Kants Formel von der „kopernikanischen Wende“ sind es denn auch nur Anschauungs– und Denkformen bzw. Gesetze, die unser Verstand der Natur vorschreibt, dagegen nicht, welche konkreten, einzelnen, individuellen Ereignisse und Zusammenhänge es in der Welt gibt, bzw. er schreibt nicht vor, ob es sie gibt oder nicht. Was wir in der Welt im einzelnen anschaulich wahrnehmen, welche Personen, Dinge und Ereignisse, ja auch welche eigenen Zustände – all dies ist uns durch die äußere und eigene Wirklichkeit, also auch durch unsere eigenen leiblichen und psychischen Zustände vorgegeben. Wir produzieren all dies nicht, wir machen nicht die Welt, wir sind vielmehr in unserem Wissen von der Wirklichkeit abhängig. Aber daß alles in der Welt, was wir anschaulich wahrnehmen, die anschauliche Struktur unseres Wahrnehmungsraumes, unseres Gesichtsfeldes, haben muß, daß alle Ereignisse, die uns begegnen, verursacht sein müssen bzw. Wirkungen hervorrufen werden, daß alle Dinge in der Welt in eine räumliche Ordnungsstruktur eingebunden sind, eine bestimmte räumliche Größe haben, daß wir schließlich in jeder Veränderung einer Sache, die wir im einzelnen wahrnehmen, etwas unterstellen, das darin mit sich identisch bleibt – für diese Gesetzmäßigkeit unserer Anschauung und unseres Denkens beansprucht Kant mit seiner These, daß sie der menschlichen Vernunft und der menschlichen Anschauung entspringen und daß für uns nur jene Natur und jene Außenwelt, wie aber auch nur jene interne psychische Eigenwelt erfahrbar ist, die diese Struktur a priori, notwendig und allgemein, unabhängig von aller Erfahrung aufweist. Das: „,Ich denke“ muß alle meine Vorstellung begleiten können“ Wenn der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt, dann müssen diese Gesetze ihm selber entspringen. Er kann sie der Natur nicht entnehmen. Daß diese Gesetze des Verstandes ihm selber entspringen, bedeutet für Kant, daß sie an ein selbstbewußtes Denken zurückgebunden sind, an ein „,Ich denke’, das alle meine Vorstellungen muß begleiten können.“ Denn ich kann mir alles, was ich vorstelle, nur derart vorstellen, daß ich es in der Ordnung einer inhaltlichen Einheit vorstelle, z. B. einer zeitlichen Einheit einer regelmäßigen Folge eines Ereignisses auf ein anderes Ereignis. Weil ich das Subjekt aller meiner Vorstellungen bin und weil ich als Subjekt alle meine Vorstellungen, die ich habe, z. B. die von den Teilen eines Hauses, notwendig zu einer Einheit verknüpfe – denn ich bin die eine identische Subjektinstanz in allen meinen Vorstellungen – deshalb muß auch aller Inhalt meiner Vorstellungen diese Einheitsstruktur aufweisen. Z. B. muß es sich bei den fraglichen Teilen irgendeines Gebäudes um Teile eines Hauses han- 8 deln. Die Teile müssen irgendwie in einem geordneten Ganzen zusammenhängen. Anders kann ich sie nicht vorstellen. Dies gilt etwa auch dafür, daß ich sehe, wie etwas passiert. Ich kann dieses Ereignis nur so vorstellen oder wahrnehmen, daß ich es in der Zeit anderen Ereignissen zuordne, die auf es folgen, oder die ihm vorausgehen. D. h. ich muß das Ereignis in die Einheit einer zeitlichen Folge mit anderen Ereignissen stellen, was wiederum zur Folge hat, daß das Ereignis möglicherweise immer auf ein bestimmtes anderes Ereignis in meiner Wahrnehmung folgt, daß es also von diesem verursacht wird. Insofern ist das „Ich denke“ für Kant der Ursprung aller, etwa auch der kausalen Einheitsordnung von verschiedenen, aufeinanderfolgenden Ereignissen. Aktuelle Kantianische Erkenntniskonzepte Es ist denn auch dieser Kantianismus der Abhängigkeit der Natur von den gesetzmäßigen Strukturen unseres Anschauens und Denkens, der in den aktuellen Theorien des menschlichen Wissens wieder aufgegriffen, allerdings erheblich modifiziert und verengt wird. So etwa im aktuellen Konstruktivismus, demzufolge die Welt nichts anderes ist als das Konstrukt unseres Bewußtseins und unserer Sprache. Oder auch in Theorien der neurobiologischen Erklärung des menschlichen Wissens, nach denen unser Gehirn die Welt für uns entwirft – eine Welt, die möglicherweise völlig anders ist als die anderer Lebewesen mit einem anderen biologischen kognitiven Apparat. Wir wissen nicht, wie ein Nachtfalter in der Wahrnehmung einer Fledermaus oder auch eine Wurst in der Wahrnehmung eines Hundes aussieht. Aber auch in den Thesen der evolutionären Erkenntnistheorie, nach der die menschliche kognitive Vernunft ein stammesgeschichtliches Produkt der Entwicklung des Lebewesens Mensch ist, steckt ein Kantianismus. Und zwar derart, daß unsere Anschauungsformen von Raum und Zeit wie auch unsere Denkformen, die in der Grammatik der Sprache niedergelegt sind, für ein stammesgeschichtlich entstandenes Anpassungsprodukt des Lebewesens Mensch an die Welt gelten. Aber für uns individuelle Menschen sind sie nunmehr gleichsam eine unabnehmbare, angeborene Brille im Gesicht, die wir notwendig benützen, wenn wir erkennen. Durch sie wird all das bestimmt, was für uns überhaupt in der Außenwelt, in unseren Erfahrungen zugänglich ist und was nicht. Zurück zur Ausgangsfrage der Überlegungen: Was können wir wissen? Wir verfügen neben der unermeßlichen Fülle des einzelnen Erfahrungswissens um die Zustände, Dinge und Ereignisse in der Welt immer auch über ein nichtempirisches apriorisches Wissen um die gesetzmäßige Struk- 9 tur der Welt für uns, um deren anschauliche Form und begriffliche Gesetzmäßigkeit. So etwa auch darum, daß alle Ereignisse in einer eindimensional geordneten, nicht umkehrbaren Ordnung der Zeitreihe auftreten müssen, also immer in der Relation des Früher und Später gegenüber anderen Ereignissen stehen, und daß sie in die subjektive Zeitordnung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft eingebunden sind. Über ein solches apriorisches Wissen um die natürliche Welt verfügen wir deshalb, weil wir die Strukturen unseres Erkenntnisapparates, unserer sinnlichen Anschauung und unseres begrifflichen Denkens ermitteln können und kennen. Zwei wissensskeptische Konsequenzen: Diese positive Antwort Kants auf die Frage: „Was können wir wissen?“, darf jedoch eines auch nicht übersehen lassen, nämlich die zwei radikal skeptischen Konsequenzen bezüglich der Grenzen unseres Wissens, die aus Kants Konzeption folgen. (1) Die Wirklichkeit der unerkennbaren „Dinge an sich“ Da ist zum einen die radikale Reduktion des menschlichen Wissens auf die Welt, wie sie uns erscheint, nämlich in unseren Anschauungs– und Denkformen. Wie die Wirklichkeit „an sich“ ist, d. h. unabhängig von der Art und Weise, wie sie für uns ist oder uns erscheint, das können wir prinzipiell nicht und niemals wissen. In dieser Trennung von Welt als „Erscheinung“ für uns und als „Ding an sich“ ist zugleich die kantische Position innerhalb der Erkenntnistheorien angegeben: Kant ist ebensowohl empirischer Realist wie transzendentaler Idealist. Diese merkwürdige Formel besagt, und sie hat zu vielen Mißverständnissen Anlaß gegeben, daß Kant das menschliche Wissen gerade nicht auf irgendwelche gehirnimmanenten Vorstellungen im Kopfe reduziert. Sondern für ihn ist die räumlich– zeitliche natürliche Welt wie auch die soziale Welt real in dem Sinne, daß es Dinge, Ereignisse und Personen unabhängig von uns in Raum und Zeit, d. h. in einer wirklichen Außenwelt gibt, und daß wir um sie als diese weltlichen Objekte wissen können. Schließlich existieren auch wir in der Welt von Raum und Zeit, innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes, sowie an bestimmten räumlichen Orten. Insofern ist Kant gerade nicht mit irgendeinem gehirnkonstruktivistischen oder neurobiologischen Kognitivisten zu verwechseln, für den die Welt nur als Vorstellungen im Gehirn existiert. Ich sehe Sie selber vor mir sitzen und sehe Sie nicht als Bilder in meinem Ge- 10 hirn. Doch dieser empirische Außenwelt–Realismus unseres Wissens ist für Kant zugleich mit einem transzendentalen Idealismus verbunden. Und das ist in der Tat das schwierigste, problematischste und unverstandenste Stück seiner Theorie. Was soll das heißen: „transzendentaler Idealismus“? Wenn ich Sie selber vor mir sitzen sehe, während ich mich hier gleichzeitig an einem Pult stehen sehe, so sind Sie zwar für mich empirisch real, also nicht nur eine bloße Vorstellung oder ein Gedanke in meinem Kopf. Aber Sie existieren gleichwohl für mich – wie alle Außenweltdinge – nur in meinem Gesichtsfeld bzw. in meinem Gesichtsraum, d. h. in einer Welt, die Inhalt meiner Wahrnehmung ist. Und diese Wahrnehmung, die ich von Ihnen habe, ist meine eigene, eine andere kenne ich nicht. Ich verfüge nicht über Ihr Sehen und Wahrnehmen. Wenn Sie für mich aber nur Inhalt meiner Wahrnehmung sind, obwohl ich Sie wie auch alle anderen Dinge immer an einem anderen Ort sehe als wo ich mich selbst befinde, dann sind Sie gerade auch in ihrer empirischen, von mir unabhängigen Wirklichkeit Inhalt meiner Vorstellung, d. h. eine Anschaung, die ich von Ihnen habe. Und deshalb muß ich – so Kant – einen Idealismus der äußeren Wirklichkeit in Raum und Zeit vertreten – die Welt als meine Vorstellung (Schopenhauer) – ohne daß ich die Realität dieser Außenwelt in Zweifel ziehen müßte. Und genau dies ist schließlich auch die kantische Bestimmung der Welt in Raum und Zeit als einer Erscheinungs–Welt, die nicht mit einem subjektiven Schein in unseren Köpfen und Gehirnen zu verwechseln ist. Dies ist nicht zuletzt auch der Sinn der häufig mißverstandenen These Kants, Raum und Zeit seien subjektive Formen unserer Anschauung. Mißverstanden wird diese These dann, wenn sie so aufgefaßt wird, daß es in Wirklichkeit Raum und Zeit gar nicht gibt, sondern dies nur Konstrukte unseres Gehirns sind. Denn wir selber existieren als natürliche, vernünftige Lebewesen in Raum und Zeit, also nicht in irgendeinem eigenen Gehirnkonstrukt. „Subjektiv“ kann in diesem Zusammenhang nicht heißen, daß Raum und Zeit bloß fiktive Konstrukte des Menschen wären, so daß etwa auch die ganze physische Existenz des Kosmos in Raum und Zeit nur ein Gedankenkonstrukt wäre, die Existenz des Menschen darin selber eingeschlossen. Raum und Zeit sind als subjektive Anschauungsformen gerade empirisch real – unser Leben selbst beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort in Raum und Zeit, und dies ist keine fiktive Konstruktion. Korrekt verstanden kann die Subjektivität der Anschauungsformen von Raum und Zeit nur besagen, daß sie transzendental ideal sind. D. h. gerade auch dann, wenn sie physisch reale Bestimmungen oder Eigenschaften der Natur und ihrer Ereignisse sind, werden sie in unse- 11 ren Formen von Raum und Zeit von uns so angeschaut, begriffen, gedacht und aufgefaßt – sind also subjektiv. Soweit die eine skeptische Begrenzung unseres Wissen von der Welt. (2) Die letzten Strukturen der Welt, die Realität unserer Freiheit, die Existenz einer unsterblichen Seele und das Dasein Gottes - für unser Wissen offene Fragen Und zum anderen folgt aus Kants „Revolution der Denkungsart“ eine radikal skeptische Konsequenz für die wichtigsten Fragen des menschlichen Lebens, nämlich für die Fragen nach Gott, Immaterialität, Unsterblichkeit und Freiheit des menschlichen Geistes, für das Problem einer Erkenntnis vom Ursprung und Ende des Kosmos. Denn indem Kant alles menschliche Wissen und Erkennen radikal an die sinnliche Anschauung und deren Formen von Raum und Zeit, und nicht nur an die Denkformen unserer Begriffe bindet, und sofern sich diese metaphysischen Ideen jeder sinnlichen Anschauung prinzipiell entziehen, müssen wir die Frage nach Gott, Seele und Welt prinzipiell offen und unbeantwortbar lassen. Sie sind durch keine Naturwissenschaft, aber eben auch nicht durch eine Philosophie beantwortbar. Und damit sieht Kant die menschliche Vernunft in einem unauflösbaren Dilemma. Nämlich in dem Dilemma, daß zwar die Vorstellungen oder Ideen von Gott, Seele und Welt, von der Existenz des Absoluten, von der Immaterialität, der Freiheit und der Unsterblichkeit der Seele, und schließlich vom Anfang und Ende des Kosmos unvermeidlich der menschlichen Vernunft entspringen. Denn diese sucht letzte Erklärungen und letzte Gründe für die gesamte Wirklichkeit. Aber trotz dieses unvermeidlichen Ursprungs derartiger Ideen einer unbedingten, vollständigen Erklärung aller Wirklichkeit vermag die menschliche Vernunft nicht zu entscheiden, ob diese Ideen wahr sind, warum sie wahr sind und inwieweit sie ein fundiertes und objektives Wissen darstellen. Im Gegenteil, wie auch die Geschichte der Philosophie nach Kant und vor allem die aktuelle Situation der Metaphysik zeigt, es sind alle Antworten, positive wie negative, auf diese Fragen naturwissenschaftlich und philosophisch möglich, obwohl sie sich, etwa in der Frage nach der Existenz eines freien Willens, gegenseitig radikal negieren und ausschließen, ja sogar die Unwahrheit einer gegenteiligen, alternativen Position detailliert nachzuweisen versuchen – für Kant ein völlig fruchtloses Unterfangen. Genau dies ist auch die Situation der großen Themenfelder der aktuellen philosophischen Situation. In der Philosophie des Geistes, in der Philosophie der menschlichen Freiheit, in der Philosophie des Kosmos sowie in der Philosophie der Existenz Gottes steht alles ununterbrochen in Streit. Das Unbedingte, wie Kant die Ideen von Gott, Welt und Seele nennt, ist nach wie vor und erst recht auch heute ein „wahrer Abgrund für die menschliche Vernunft“ (Kritik der reinen 12 Vernunft, B 641). Materialistische Erklärungen des menschlichen Geistes stehen gegen idealistische Erklärungen in den unterschiedlichsten Varianten. Naturwissenschaftliche Widerlegungen der menschlichen Freiheit etwa in der Neurobiologie konkurrieren mit philosophischen, etwa moralisch und kulturell gespeisten Überzeugungen von der Freiheit des menschlichen Willens. Die physikalische Urknalltheorie des Kosmos sieht sich dem alternativen Theoriemodell gegenüber, das einen zeitlichen Anfang der kosmischen Welt vor dreizehn Milliarden Jahren radikal bezweifelt. Und immer wieder werden schließlich aufs neue Gottesbeweise formuliert, die permanent ihre eigene Kritik und Widerlegung hervorrufen. Gleichwohl kann menschliche Vernunft nicht darauf verzichten, derartige Fragen zu stellen und sie auch zu beantworten – will sie sich nicht selber aufgeben. Sie ist ihr eigener „Abgrund“. Die Beantwortung der metaphysischen Fragen Bedeutet all das nun, daß Kant Atheist ist, oder daß er die Frage der Existenz Gottes zumindest offen läßt? Daß er das Problem der Willensfreiheit als ein Scheinproblem auffaßt? Daß er die Immaterialität und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele verneint oder nicht einmal für ein offenes Rätsel hält? Dem ist nicht so. (1) Nicht in Wissenschaft und Philosophie All diese Fragen entscheiden sich nicht auf der Ebene der theoretischen Erkenntnis und des begründeten Wissens, hier müssen sie für immer offen bleiben. Wenn sich menschliche Vernunft mit diesem Dilemma der Unentscheidbarkeit nicht zufrieden gibt, sondern die metaphysischen Fragen zu beantworten sucht, gerät sie für Kant unvermeidlich in Widersprüche, in unzureichende Beweis- und Widerlegungsverfahren, ja in Antinomien, d. h. in völlig gegensätzliche, sich ausschließende Thesen. So läßt sich dann ebenso die These formulieren und angeblich beweisen, daß es in der Welt keine menschliche Freiheit gibt – wie ihre Antithese, daß der Mensch über die Fähigkeit einer spontanen, freien Willensbildung verfügt. Aber dann sind beide angeblichen Beweise wertlos, weil sie ihr eigenes theoretisches Gegenteil zulassen und nicht als falsch ausschließen können. Gleichwohl haben die metaphysischen Ideen, von denen es kein begründetes Wissen geben kann, eine unentbehrliche Funktion für die menschliche Vernunft. Diese Funktion besteht zum einen 13 darin, daß etwa die Idee des Anfangs und des Endes des Kosmos oder die Idee seiner letzten, elementarsten physikalischen Bestandteile und Strukturen für die naturwissenschaftliche Forschung eine unentbehrliche Funktion haben. Nämlich die einer forschungsregulativen Idee. Derartige Ideen sind unverzichtbare Ziele der naturwissenschaftlichen Forschung, deren Prozeß des Erkenntnisgewinnes sich an ihnen normativ orientiert. Menschliche Vernunft muß in der Naturwissenschaft die Frage zu beantworten versuchen, wann dieser Kosmos entstanden ist, oder aber ob es keinen zeitlichen Ursprung dieses Kosmos gibt. Welche dieser forschungsrelevanten regulativen Ideen objektiv gilt und wahr ist, dies vermag die Naturwissenschaft allerdings nach Kant nicht zu entscheiden. Aber wird dann nicht das gesamte Forschungsvorhaben der kosmologischen Naturwissenschaft oder der Elementarteilchenphysik zur bloßen Fiktion eines „Als–ob“? Sichere Erkenntnis über etwas zu erreichen versuchen, von dem wir wissen, daß sie nicht möglich ist, ist nicht auch dies ein zutiefst paradoxes, weil in sich selbst widersprüchliches Unterfangen? Nicht anders steht es um die metaphysische Idee einer immateriellen, unsterblichen Seele des Menschen. Ob es sie denn gibt oder aber nicht –, auch diese Frage hält Kant naturwissenschaftlich und philosophisch für nicht entscheidbar. Dennoch schreibt er ihr die Funktion eines Forschungsregulativs zu: Menschliche Vernunft muß herauszufinden versuchen, ob es eine solche immaterielle Seele gibt, oder nicht, obwohl sie zugleich davon ausgehen muß, daß eine wissenschaftlich begründete, objektive und wahre Erkenntnis darüber nicht möglich ist und sein wird. Damit kann Kant auch alle materialistischen Erklärungsversuche der menschlichen Seele gerade nicht ausschließen, sondern er muß auch sie fordern, ohne ihnen allerdings einen definitiven Erkenntniswert einzuräumen, im Gegenteil. Beide Fragenfelder, das der Kosmologie wie das der Philosophie des Geistes bleiben nach Kant notwendig Räume für wissenschaftlich unentscheidbare Hypothesen. (2) Ausschließlich im Kontext der Moral Anders steht es mit den metaphysischen Ideen der Willensfreiheit und der Existenz Gottes als eines Schöpfers der Welt. Hier vertritt Kant einen geschmeidigen, sympathischen Dualismus des menschlichen Wissens. Und dies wiederum setzt voraus, daß er ein dualistisches Bild vom Menschen hat. Zum einen ist der Mensch für ihn Teil der Natur, ein natürliches Lebewesen. Und als solcher ist er Gegenstand unserer alltäglichen Erfahrung wie der naturwissenschaftlichen Er- 14 kenntnis und Erklärung. Und das zentrale Gesetz dieser Erklärung ist das der Kausalität. Dies bedeutet, daß auch alle menschlichen Handlungen für Kant durch Ursachen externer und interner Art verursacht sind, etwa durch die genetisch–biologische Konstitution, durch psychische Faktoren wie Interessen, Bedürfnisse, Wünsche und Begierden, aber auch durch externe Faktoren wie z. B. das soziale Umfeld. Der Mensch als psycho–physisches, natürliches Wesen handelt und entscheidet notwendig, d. h. ursächlich durch seine psychische und leibliche Natur bestimmt. Daß menschliches Handeln möglicherweise immer auch aus Freiheit geschieht, aus spontanen, wenn auch begründeten freien Entscheidungen – dieser Gedanke kommt in einer naturwissenschaftlichen Handlungserklärung des Menschen nicht vor. Denn sie ist eine kausale Erklärung der menschlichen Handlung und der Willensentscheidung. Trotz dieses naturwissenschaftlichen Determinismus ist dieser Sachverhalt aber gerade keine Entscheidung gegen die Möglichkeit, ja gegen die objektive Geltung einer gleichzeitigen Freiheitserklärung der menschlichen Handlung. Genau dieser Sachverhalt wird in der aktuellen Diskussion um gehirnphysiologische und neurobiologische Erklärungen der Willensfreiheit gerne übersehen. Denn der Mensch ist, wie Kant so schön formuliert, auch ein „intelligibles Wesen“, d. h. ein Wesen, das nicht nur in der natürlichen Welt der Physik und der Biologie existiert, sondern auch in der geistigen Welt der Gedanken, der moralischen und rechtlichen Regeln, samt allen damit verknüpften moralischen und rechtlichen Phänomenen wie denen der Pflicht, der Strafe, der Verantwortung und der Schuld. Ein elementares Beispiel für diese Zugehörigkeit zur geistigen Welt ist unsere Fähigkeit, Urteile über die Tatsachen der Welt zu fällen, die wahr oder falsch sein können und d. h. Wissen über die Wirklichkeit auszubilden, dessen objektive Geltung wir mit Gründen in Argumentationen zu belegen haben. Wissen, Wahrheit, Sprache, Moral, Recht, Kunst, Wissenschaft, Religion – sofern all dies die geistige Welt der menschlichen Kultur ausmacht und sofern der Mensch immer auch in dieser geistigen Welt lebt, muß er sich, also auch seine Handlungen, seine Willensentscheidungen, sein Wählen von Handlungsmöglichkeiten immer auch anders erklären als natürlich kausal. Und die Gesetzmäßigkeit, die für Kant dieser Erklärung zugrunde liegt, ist die Kausalität aus Freiheit: Menschen binden sich frei, und d. h. nicht determiniert, an moralische und rechtliche Verpflichtungen; sie wählen frei bestimmte Handlungsmöglichkeiten und entscheiden sich für sie; und schließlich vollziehen sie ihre Handlungen frei, d. h. derart, daß sie sie hätten auch unterlassen können. Die Begrenzung des menschlichen Wissens durch den „Vernunftglauben“ 15 Die entscheidende Frage, die sich nun stellt, lautet: Wissen wir also, daß wir uns in unserem Willen frei entscheiden und daß wir frei handeln? Trotz der bisherigen Überlegungen wird diese Frage – wie auch die nach der Existenz der Seele und nach dem Dasein Gottes – von Kant negativ beantwortet, was auf den ersten Blick nicht einleuchtet. Doch wenn man sich daran erinnert, daß er alles mögliche menschliche Wissen streng an eine sinnliche Anschauung bindet, und wenn in unseren Begriffen die menschliche Freiheit nur als Phänomen der geistigen Welt existiert, die gerade nicht sinnlich wahrnehmbar ist, dann wird Kants Skeptizismus bezüglich eines sicheren Wissens um menschliche Freiheit verständlich. Müssen wir also trotz des Dualismus zweier Welten, der natürlichen und der geistigen kulturellen Welt, und trotz eines Dualismus der Handlungserklärung aus Naturkausalität und aus Freiheit die Frage offen lassen, ob wir zurecht eine Freiheit für uns in unserem Handeln annehmen? Nein – so Kants Antwort. Und zwar deshalb nicht, weil der Mensch sich dann, wenn er sich als ein moralisches Vernunftwesen versteht – und dies ist für Kant zwar ein „Faktum der Vernunft“, aber ein alternativloses, unabänderliches Faktum –, notwendig auch Freiheit zuschreiben muß. Und dies gilt dann auch für die Frage nach der Unsterblichkeit der menschlichen Seele und nach der Existenz Gottes. Das Glück des Menschen besteht in einem letztlich erfüllten und moralischen Leben. Beides ist für uns Menschen „das höchste Gut“. Beides wäre aber im Grunde „fantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt“, wenn wir uns nicht Freiheit und nicht eine unsterbliche Seele zuschreiben würden und wenn wir nicht die Existenz eines Absoluten, Gottes unterstellen dürften (Kritik der praktischen Vernunft, A 205). Denn nur dann kann der Mensch berechtigter Weise annehmen und erwarten, daß er das „höchste Gut“ seines Lebens – in einem jenseitigen Leben und mit Hilfe Gottes – auch irgendwie zu erreichen vermag. Da jedoch diese lediglich in der Moral begründeten Überzeugungen vom freien Willen, von einer unsterblichen Seele und vom Dasein Gottes radikal davon abhängen, daß wir uns als moralische Wesen verstehen, und da die moralische Welt in unserem Leben sich gerade jeder sinnlichen Wahrnehmung entzieht, können wir im Sinne einer immer auch anschaulichen Erkenntnis nicht wissen, daß wir frei sind, eine unsterbliche Seele haben und daß Gott existiert. Mehr als einen vernünftigen „Glauben“ an die objektive Realität derartiger metaphysischer Ideen unseres Selbstverständnisses haben wir nicht zur Verfügung. Aber ein „Vernunftglaube“, also nicht ein religiöser Glaube, ist kein Wissen (Kritik der praktischen Vernunft, A 227). Dies weiß Kant auch, wenn er feststellt, und dies faßt die ganze Intention seiner Theorie des menschlichen Wissens zusammen, daß wir unser Wissen aufheben müssen, „um zum Glauben Platz zu bekommen“. 16 „Ich mußte also das W i s s e n aufheben, und zum G l a u b e n Platz zu bekommen“ Was sollen wir nun unter einem derartigen „Vernunftglauben“ genauer verstehen? Kant hat des öfteren die epistemischen Einstellungen Meinen, Glauben und Wissen eindeutig bestimmt. Und zwar mit Hilfe des Kriteriums des subjektiven und objektiven Für–wahr–Haltens. Während dieses Kriterium auf das Meinen nicht zutrifft, sofern das Meinen weder subjektiv noch objektiv Wahrheit für seinen propositionalen Gehalt beansprucht, wird im Glauben an einen Sachverhalt dieser subjektiv für wahr gehalten, dagegen nicht auch objektiv. Schließlich treffen auf das Wissen beide Kriterien des Für–wahr–Haltens zu, die subjektive und die objektive Sicherheit. Ist der „Vernunftglaube“ an die postulierte Freiheit, Unsterblichkeit und Existenz Gottes ein derartiger Glaube? Dann wäre er in seiner Wahrheit subjektiv sicher, aber objektiv unsicher. Doch Kant spricht von einer praktischen objektiven Realität der Ideen der Freiheit, Unsterblichkeit und der Existenz Gottes. Sowenig der „Vernunftglaube“ ein religiöser Glaube ist, sondern ein praktischer, sowenig kann er aber auch die subjektive Sicherheit eines Für–wahr–Haltens sein. Denn darin liegt gerade keine objektive Realität dieser Ideen vor, wenn diese auch nur im praktischen Kontext der Moral existieren. Wenn ich mit Kant sage, ich glaube, daß ich frei bin und ein geistiges Wesen, daß Gott existiert –, dann ist dieser Glaube nicht so etwas wie ein gleichsam subjektiv starkes Meinen ohne objektive Sicherheit und Gewißheit der Realität meiner Freiheit und Geistigkeit. Man kann mit Wittgenstein diesen Kantischen „Vernunftglauben“ als das „Fundament“ all unserer praktischen Überzeugungen auffassen, als die „unwankende Grundlage“ unseres praktischen Lebens (Über Gewißheit, § 403, 411, 414). Und es ist nicht sinnvoll, von diesem „Vernunftglauben“ als der „unwankenden Grundlage“ unseres praktischen Lebens noch zu verlangen, daß man ihn seinerseits auch noch objektiv begründen müßte. Denn wenn dies möglich wäre, dann müßte man ihn durch ein subjektiv und objektiv sicheres Wissen ersetzen können. Dieser „Vernunftglaube“ ist demgegenüber ein Überzeugungsfundament unseres praktischen Lebens, das all unserem praktischen Wissen um unser Leben und dessen Moralität zugrunde liegt; und dann auch all unseren Versuchen einer kognitiven Erklärung, Begründung und Rechtfertigung unseres praktischen Wissens. In diesem „Vernunftglauben“ kommen insofern – so Wittgenstein – alle Begründungen und Rechtfertigungen an ein Ende. Aber nicht deshalb, weil wir unfähig zu derartigen 17 Begründungen und Rechtfertigungen wären. Sondern deshalb, weil der Gedanke der Begründung, Erklärung und Rechtfertigung auf ihn keine sinnvolle Anwendung mehr findet. Er ist insofern so wie das Sittengesetz ein aller Erklärung, Begründung und Rechtfertigung entzogenes „Faktum der Vernunft“. Wenn Kant das Wissen aufhebt, „um zum Glauben Platz zu bekommen“ (Kritik der reinen Vernunft, B XXX), dann formuliert er eine Einsicht, die in Wittgensteins Terminologie so lauten müßte: Unser „Vernunftglaube“ an die postulierten Ideen der Freiheit, Unsterblichkeit und Existenz Gottes „steht da so wie unser Leben“, für das es auch nicht sinnvoll ist, es noch einmal begründen und rechtfertigen zu wollen, um dessen objektive Realität nachzuweisen. Es liegt mit seiner begründungslosen Sicherheit und Gewißheit all derartigen Versuchen als die „unwankende Grundlage“ zugrunde. Und dieser „Vernunftglaube“ an Gott, Freiheit und Unsterblichkeit ist keineswegs ein dem bloßen Meinen gegenüber subjektives Für–wahr–Halten, das keinerlei objektiv–reale Wahrheit hätte, und das insofern kein Wissen wäre. Sondern dieser „Vernunftglaube“ ist „mehr“ und nicht „weniger“ als Wissen.