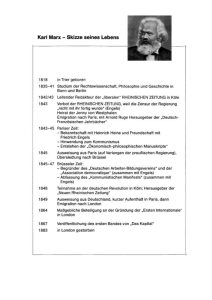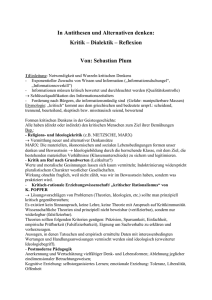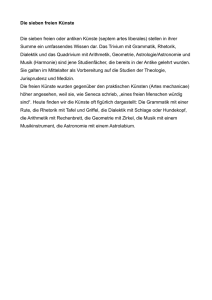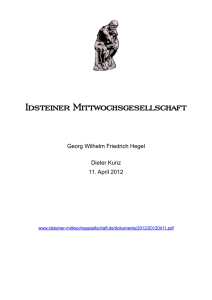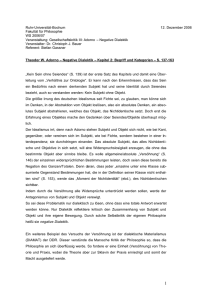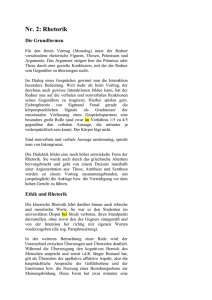Identität und Nichtidentität - Institut Philosophie TU Darmstadt
Werbung

Christoph Hubig, Stuttgart Identität und Nichtidentität Kleiner Kommentar zu Hans Heinz Holz’ „Koordinaten dialektischer Konstruktion“ Ein zentrales Kapitel aus „Weltentwurf und Reflexion. Versuch einer Grundlegung der Dialektik“ enthält Hans Heinz Holz’ Darlegung der „Koordinaten dialektischer Konstruktion“ (Holz 2005, 410-462). Anspielend auf die Spiegel-Metapher, die Holz’ Philosophieren orientiert, könnte man hier von einem Brennspiegel sprechen, in dem verschiedene Impulse zusammengeführt sind, um die Denkfigur der Dialektik aufscheinen zu lassen. 1. Monismus, Identität, Nichtidentität Unter Verweis auf Leibniz’ Satz vom zureichenden Grund betont Holz, dass jede „konsequent materialistische wie jede konsequent idealistische Philosophie“ monistisch sein müsse, da die Konzession einer Vielheit von Seinsgründen die Frage nach dem absoluten Grund dieser Vielheit entstehen ließe (410). Das „Nichts ist ohne Grund“ erlaubt jedoch zunächst nicht die Begründung eines Monismus. Aus „Für alle x gilt, dass es einen Grund G gibt, so dass G (x)“ folgt nicht „Es gibt einen Grund G, so dass für alle x gilt G (x)“. Die Angabe des Grundes (nicht zu verwechseln mit Ursache) freilich fällt zusammen mit einer Bestimmung des Wesens. Denn über die Faktizität hinaus, die uns als solche „scheint“, ist die Bestimmung des Wesens eines Phänomens die Projektion einer einheitlichen abstrakten (Theorie-)Struktur auf jenes, welches dann als Modell (Erfüllung) dieser Struktur erscheint. (So sind natürliche Zahlen ein Modell der Peano-Axiome, die ihr Wesen ausmachen und den Grund ihres Soseins abgeben.) Dass ein x das ist, was es ist, hat seinen Grund, „sein Sein in einem Anderen, das als dessen Identisches mit sich sein Wesen ist“ (Hegel, Enz. § 121), jenseits der Grenzen des sich verändernden Daseins. Das Dasein des Grundes ist mithin die „Einheit der Identität und des Unterschieds“ insofern, als es die vorgestellte Erfüllung des Wesens durch die Erscheinung (Identität) und die Unterschiedlichkeit zwischen beiden auf den Begriff bringt. Dazu gehört insbesondere, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften zu unterscheiden – ein Unterschied, der dem Wesensbegriff inhärent ist. Wir haben also bei genauerer Analyse zwei Unterschiede zu betrachten, die sprachlich auf verschiedenen Ebenen liegen: Objektstufig den Unterschied zwischen wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften, der zur Intension von „Wesen“ gehört und somit extensional das sich akzidentiell Veränderliche umfasst; höherstufig (reflexiv, nicht metatheoretisch) den Unterschied zwischen Wesen und Schein, die „absolute Nicht-Identität“, die die Identität von „Wesen“ ausmacht, den „Grund nur, insofern es [das Wesen] Grund von Etwas, von einem Andern ist“ (ebd.). Wird auf dieser Basis „Wesen“ zur Klassenbildung („Gattung“) eingesetzt, werden bestimmte Extensionen ausgegrenzt, nämlich diejenigen, für die dasjenige, was für das erstere Wesen akzidentiell ist, ihrerseits wesentlich sein kann. Ein solchermaßen enger Begriff von Wesen erweist sich als einer, der durch Verstandesabstraktion zustande kommt. Für den Verstand gilt der Satz der Identität A = A (A als klassenbildende Intension), der eine Tautologie ist und dafür sorgt, dass die Extensionen gleich bleiben und einer weiteren logischen Verarbeitung unterzogen werden können. Für die Vernunft hingegen, die nicht auf Extensionen absieht, sondern über die Definitionsbereiche reflektiert, gehören die ausgeschlossenen Extensionen mit zur Wesensbestimmung als jeweiliger höherstufiger Bestimmung von „Intension“ als Bestimmungsregel, als Angabe des Grundes der Bestimmung, da sie ja den Definitionsbereich ausmachen, auf den das Unterscheiden zielt, gemäß der Hegelschen Charakterisierung der Vernunft als „Trieb“ des Bestimmenwollens. Für den bloßen Verstand erscheinen die „Seiten“ des Unterschieds als Gegensatz (die beiden verschiedenen Extensionen), eins durchs andere bestimmt. Bliebe es dabei, dann „schlösse sich das Denken selbst aus“, es vergäße seine Intention, träte zu sich in Widerspruch (Hegel, Logik II, 49). Ich habe entsprechend versucht, den dialektischen Widerspruch zu rekonstruieren als diejenige aus der Sicht des Verstandes vorliegende und genauer zu analysierende „Störung“ des Tripels Intension, Extension und Intention, die im Lichte einer Reflexion auf das Wesen (den identitätsstiftenden Grund) von „Unterschied“ ersichtlich wird (Hubig 1978). Das Denken kann diese „Störung“ vermöge seiner „Kraft, den Widerspruch in sich zu fassen“, als Widerspruch zwischen einem Verharren bei der „falschen Selbständigkeit“ der Opposita, den einander sich ausschließenden Extensionen, und der Erkenntnis, dass das SichAusschließende die Extension der reflektierten Intension als Intention ausmacht, identifizieren. Die Opposita „richten sich zugrunde“, indem sie auf ihren Grund zurückgeführt werden (Hegel, Logik II, 51 f.). Insofern kann das Denken diesen Widerspruch „aufheben“, indem es ihn als Reflexion des Unterschieds begreift. Identität wird als das „Andere des Anderseins“ begriffen: Anderssein als Ergebnis der verstandesmäßigen Bildung von Extensionen unter einer Intension (Wesen) qua Abstraktion; Andersheit des Andersseins als Ergebnis der Reflexion auf die Intension als Wesen (Grund), unter dem wir die Abstraktionen vornehmen. Identität als „Identität von Identität und Nichtidentität“ ist also unterkomplex bestimmt, wenn sie einfach als Identität des Nicht-Identischen bestimmt wird – die Formel, mit der die Dialektiker die Logiker verschrecken. Zurück nun zu den beiden anfangs erwähnten Monismen (Idealismus – Materialismus). Worin liegt – wenn wir diese performativ widersprüchliche Formulierung nicht dulden, d.h. in der verstandesmäßigen Schreckenstarre vor diesen Opposita verharren – ihr Wesen, ihr Grund? Hegel hat diesen Gegensatz immer zurückgewiesen: Gegenbegriff zum „Idealismus“ (als subjektiver Idealismus eines Fichte etwa) ist für ihn „Realismus“ als Annahme eines Wirklichen unabhängig von Denken; Gegenbegriff zum „Materialismus“ ist „Spiritualismus“ (der behauptet, die Welt sei ein Denkprodukt). Hegels „spekulativer Idealismus“ zielt auf die Vorstellung davon, wie wir uns Vorstellungen machen und liegt jenseits dieser Alternativen, die „Standpunkten“ verpflichtet sind, gegen die er in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes polemisiert. (Man ist an David Hilberts Diktum erinnert: „Ein Standpunkt ist ein Horizont vom Radius Null“.) Entgegen der verbreiteten Rede von einer Trias subjektiver Dialektik, objektiver Dialektik und einer Dialektik der Wirklichkeitsaneignung (z.B. Hörz, 2006) ist nur letztere geeignet, den auf Abstraktion beruhenden Dualismus der ersteren beiden aufzuheben. „Konsequent“ wäre dementsprechend weder eine idealistische noch eine materialistische (monistische) Philosophie, so lange sie nicht das Wesen von Wirklichkeitsaneignung reflektiert. Die rein verstandesmäßige Fixierung beider wird daran erkenntlich, dass sich diese Dialektikformen als „allgemeine“ Theorien (abhebend auf „Strukturen“) entweder von Denk- oder von Naturprozessen verstehen. Sie sind abhängig vom Stand der Fachwissenschaften und repetieren in abstrakter (Hegel: „schlecht abstrakter“) Terminologie, was diese präziser und elaborierter darlegen. Sie provozieren damit den Vorwurf, Dialektik sei überflüssig, und sehen sich dem Hase- und Igel-Effekt gegenüber: Die Fachwissenschaften arbeiten längst dort (nämlich an der Aufhebung von irritierenden Dualismen), wo eine solche Dialektik entweder das Vorhandensein einer Baustelle verkündet oder abstrakte Gebäude errichtet, die der nächste empirische Windstoß umbläst. Demgegenüber erinnert Hegel an einen radikaleren Anspruch von „Allgemeinheit“ im Unterschied zu derjenigen, die qua Abstraktion klassenbildend wirkt. „Allgemeinheit“ steht unter dem (nie einlösbaren) Anspruch einer vollständigen Bestimmung (Totalität) des 2 Besonderen. Sie steht unter dem (spekulativen) Anspruch, die Vorstellung zu benennen, unter der wir uns Vorstellungen machen. Zu diesem Zweck ist sie auf die Betrachtung unserer Vorstellungen und ihrer Verhältnisse untereinander angewiesen, eben deshalb spekulativ. Sie findet ihren Ausdruck in spekulativen Sätzen der Art „Ich begreife A als B“ bzw. „Das A ist ein B“ und unterscheidet sich entsprechend von prädikativen Sätzen der Form „a ist B“ (einschließlich deiktischer Sätze „Dieses ist B“), die auf Abstraktionen, Auszeichnung einer Eigenschaft, beruhen. Das Allgemeine ist mithin „übergreifend“ (König, 1978, 34); seine Bestimmungen sind „Momente“ in der „setzenden Reflexion“ (Hegel), seine gesetzte Bestimmtheit macht es zu einem Besonderen, das es „von sich selbst“ (seinem Anspruch) unterscheidet. Als solches Besonderes ist es jedoch von allen anderen möglichen Bestimmungen nicht ablösbar, wollte es seinen Allgemeinheitsanspruch nicht verfehlen. Das Allgemeine, mithin jegliche „Gattung“ ist, so gesehen – d.h. nicht als Resultat einer Abstraktion/Klassifikation und den sich anschließenden exkludierenden Subsumptionsverfahren – Gattung und Besonderes, benannt durch den Gattungsausdruck. In den Worten Königs: „Gattung ihrer selbst und ihres Gegenteils“ (ebd.). Dies erscheint rätselhaft, solange nicht deutlich ist, dass diese Charakterisierung sich auf spekulative – und nicht auf prädikative – Sätze bezieht. Ein Satz wie „Paarhufer ist Gattung der Paarhufer und der Unpaarhufer“ ist abwegig. Ein spekulativer Satz (auf diesem Niveau) würde hingegen beschreiben, wie wir uns – im Prozess – eine Vorstellung der Vorstellung Paarhufer machen, nämlich über die Gattung „Huftier“: „Der Paarhufer ist das Huftier mit der und der HufStruktur“. Der vollständige Begriff von Huftier enthält jedoch, neben der Hinsicht („Moment“), dass es Hufe hat noch (unendliche) weitere Bestimmungen (einschließlich der relationalen zu allen anderen Entitäten der Welt). So verstanden ist Huftier, sofern Huftiere Warmblüter, Fellträger sind, nicht fliegen können etc. Gattung seiner selbst und ihres „Gegenteils“ (Besonderung der Hufträgerschaft), in der die anderen Eigenschaften als für die Vorstellung jener Vorstellung ausgeschlossen werden. Höchste spekulative Sätze wie „Das Sein ist das Nichts“ (als Unbestimmtes) oder „Das Schicksal ist das Notwendige“ (als NichtDisponibles, weil nicht anders sein Könnendes) bestimmen den jeweils besonderen Aspekt, unter dem wir uns eine Vorstellung von der Vorstellung machen, d.h. die jeweilige Vorstellung bestimmen und dabei deren Allgemeines (im radikalen Sinne) notwendigerweise als Besonderes bestimmen. „Aufgehoben“ wird diese Besonderung im Gattungsbegriff, wenn dieser sukzessive weiterbestimmt wird mit Blick auf die Eigenschaften, die ihm (als „Gattung seiner selbst“) weiter inhärent sind. Eine solche a limine vollständige Bestimmung der Gattung wäre zugleich eine vollständige Bestimmung der Welt. 2. Möglichkeit Es war davon die Rede, dass die Besonderungen (oder Bestimmungen) des Allgemeinen diesem „inhärent“ seien. Holz verweist darauf, dass hier Aspekte der Modalkategorie „Möglichkeit“ ins Spiel kommen, wie sie Ernst Bloch unter „Latenz“ und „Tendenz“ geltend gemacht habe, die aber noch „ganz unerforscht“ seien (Holz, 419). Die Koordinate „Hegel“ (als Element eines philosophischen Bezugssystems) scheint mir aber noch mehr herzugeben. Zum einen ist auf die modale Kennzeichnung des Dreischrittes An-sich – Für-sich – An-und Für-sich zu verweisen, wie sie in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes angelegt ist und sich durch die gesamte Phänomenologie hindurch zieht: Das (unmittelbare) An-sich wird als real möglich, leere, vorbereitete Form charakterisiert, als „Nacht der Möglichkeit“ oder „Vermögen“. Das Für-sich als abstraktes Bestimmtsein, als besonderes „einfach bestimmt“, führt erst qua Reflexion in sich zur Wirklichkeit als „Erfahrung der Sache“ im Zuge der Arbeit, dem „Ernst des erfüllten Lebens“, zum An- und Für-sich. Auf dieser Ebene, der Ebene der Spekulation, auf der wir uns eine Vorstellung der Vorstellung (des reinen, einfachen Fürsich machen), wird der Widerspruch als Widerspruch festgehalten und „aufgehoben“ – in eine Vorstellung überführt, nämlich die Vorstellung (Einheit) von der Differenz zwischen dem An3 sich als Bestimmungskandidaten in seiner Möglichkeit und der besonderen Bestimmung des Für-sich. Diese neue Vorstellung birgt eine neue Möglichkeit des Weiterbestimmens, sie ist ein neues An-sich. Analog zur bereits besprochen Doppelung von „Unterschied“ wird auch in modaltheoretischer Perspektive der doppelte Aspekt von „Widerspruch“ als reflektiertem Unterschied ersichtlich: Zum einen als reflektierter Unterschied der Bestimmungen gegeneinander, die die Möglichkeit, das An-sich, im Medium des Verstandes ausfüllen. Zum anderen als Widerspruch zwischen der einseitigen Ausfüllung/Bestimmung der Möglichkeit und ihrem Totalitätsanspruch (Gattung ihrer selbst), der durch diese Bestimmung negiert wird. Dies erfährt die reflektierende Vernunft, sofern sie sich nicht dem „Spiel“ der Verstandesbestimmungen ergibt, sondern in Erfahrung der „Hemmung ihrer Begierde“ im Prozess der Arbeit mit der Einseitigkeit konfrontiert wird. Sie „bildet“ sich eine Vorstellung von dem, was die Widersprüchlichkeit ihrer Vorstellungen ausmacht (An- und Für-sich) und gewinnt hier ein neues An-sich, das seiner Bestimmung harrt. Dieses neue An-sich ist die neue Gattung seiner selbst (Für-sich) und ihres Gegenteils. Die strukturelle Übereinstimmung mit der Rekonstruktion vermittels der Kategorien Intension, Extension und Intention ist offensichtlich: Intension als Regel des Bestimmens – wie sie die moderne Semantik fasst – drückt die bloße Möglichkeit der Bestimmung, die leere Form unabhängig von ihrer Ausfüllung/Erfüllung aus. Sie markiert mögliche Extensionen. Jede Regel ist mithin ein „Mehr“ gegenüber ihrer Instantiierung, andererseits enthält jede Instantiierung mehr Eigenschaften als die Regel, die sie instantiiert. Die Einseitigkeit der vollzogenen extensionalen Bestimmung relativ zur Intension (ihr Andres, ihr NichtIdentisches) ist das Eine, der stumme Verweis auf ein „Auch von Eigenschaften“ (Hegels Charakterisierung von Medium (Phän. 91)), das der Bestimmung harrt, das Andere. Das ist die Dialektik von Regel und Regelvollzug. (Die Differenz zwischen Dialektik und Spekulation, zwischen Erfahrung des Widerspruchs und seiner Aufhebung, in der die Differenz des Modalgefälles An-sich/Für-sich auf ihren Grund zurückgeführt wird, wird oftmals in der Hegel-Rezeption nicht hinreichend berücksichtigt.) Wird dieses Verhältnis Gegenstand der Vorstellung, so ist der Widerspruch zwischen der gattungsbildenden Intension und ihrem „Gegenteil“, der extensionalen Erfüllung, aufgelöst, da die Bestimmungsoptionen in neuer (relativer) Totalität („Gattung ihrer selbst“, das „übergreifende Allgemeine“) vorgestellt werden. Die Intension wird als erfüllte Allgemeinheit rehabilitiert und fortgeschrieben, und die Intention ist ihrer Erfüllung ein Stück näher gekommen. Denn dass jede extensionale Erfüllung mehr Eigenschaften aufweist als die Intension kennzeichnet, erweist sich als Resultat des Wechselspiels zwischen der Intention des Bestimmens und ihrer Hemmung in der Arbeit, der Praxis. Das ist der Punkt, an dem der spekulative Idealismus Hegels (im Gegensatz zum subjektiven Idealismus Fichtes) dem „Materialismus“ näher steht als viele wahrnehmen wollen. Denn die „Hemmung der Begierde“, die im Modus der Theorie, dem „Spiel der Verstandeskräfte“, nicht erscheint, vollzieht sich einzig im Modus der Arbeit, der Realisierung des extensionalen Bezugs vorgegebener Intensionen. Das Kapitel „Herrschaft und Knechtschaft“ in der Phänomenologie des Geistes ist die Zäsur, die aus dem Theoretischen herausführt – noch nicht in die Beziehungen zwischen subjektiven Bewusstseinen verschiedener Personen (dies wird erst im Geistigen Tierreich rekonstruiert) –, sondern zunächst in der Binnenrelation zwischen verschiedenen „Momenten“, „Seiten“ des Bewusstseins, das sein Anderes, die arbeitende Seite und diese jenes (als Herr-Seite) anerkennen muss. Die „Leipziger Schule“ der HegelInterpretation (Stekeler-Weithofer (2005), Hubig (1985, 2006), Luckner (1997) hat dies als Rekonstruktion des Leib-Seele-Verhältnisses gedeutet, das auf dieser Stufe formal charakterisiert und dann – im „objektiven Geist“ bestimmungsmäßig ausgefüllt wird. Leib ist – im Unterschied zu Körper – bewusst und ist das Andere zur bloßen leeren Idee der HerrSeite; insofern besteht die Konkurrenz zweier Bewusstseine unter dem Titel 4 „Selbstbewusstsein“, welches sich als Gattung seiner Selbst/Identität eben nur als Differenz zwischen der Vorgabe der Herr-Seite und dem Werk (mit dem es sich nicht identifizieren darf) erfährt. An der Differenz zwischen der Vorgabe als abstrakter Form und ihrer Realisierung lesen wir dasjenige ab, was wir heute Fähigkeit oder Kompetenz nennen. Das „wahre“ Selbstbewusstsein als „knechtisches“ ist das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten als Potential. Und dieses ist eben nicht subjektiv-idealistisch als solches der Herr-Seite erweisbar, so wie sie zum Spott Jean Pauls wurde: Das wäre wie „jener betrunkene Kerl, der sein Wasser in einem Springbrunnen hinein ließ und die ganze Nacht davor stehen blieb, weil er kein Aufhören hörte und mithin alles, was er fort vernahm, auf seine Rechnung schrieb“ (Jean Paul 1961, 767).) Vielmehr ist die Arbeit der Knechtseite ein materielles Verhältnis (qua Verwirklichung der Möglichkeit) zwischen den Vorgaben der Herr-Seite und der gegenständlichen Welt im Zuge der „Bildung eines Werkes“ (Hegel) bzw. der „Produktion“ (Marx). Mit Blick auf die von Marx im Kapital (I, cap. 21) vorgenommene Analyse des Verhältnisses der Produktion zu dem von ihr Unterschiedenen (Konsumtion und Reproduktion) analysiert Holz konsequent die Produktion als das Allgemeine der Produktion selbst und der produktiven Konsumtion, welche als Konsumtion von Produktionsmitteln gleichzeitig Konsumtion der Arbeitskraft des Arbeiters ist. Diese wird wieder hergestellt in der individuellen Konsumtion des Arbeiters, die auch eine Art produktiver Konsumtion ist, denn sie erzeugt das Produkt Arbeitskraft (Holz, 428 f.). „Die Figur des Übergreifens gewinnt so Stufen“ (ebd.): Produktion Produktion Produktion Reproduktion produktive Konsumtion produktive Konsumtion individuelle Konsumtion M.E. lassen sich diese Stufen zwanglos als Modalgefälle rekonstruieren, als jeweilige Verwirklichung des Potentials in entsprechenden Produktionsverhältnissen. Diese Dialektik finden wir im Allgemeinsten in der Großarchitektonik des Verhältnisses von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, welches im Prozess der Arbeit/der Produktion weiter entwickelt wird: Produktivkräfte als reale Möglichkeiten aktualisieren sich unvollkommen in den realen Produktionsverhältnissen, in denen sie aber allererst erscheinen. Als Vorstellungen sind sie mithin „Gattung ihrer selbst und ihres Gegenteils“: Einerseits Intensionen/Eigenschaften der vorliegenden Realisierung als „Weisen der Produktion“, wie sie Marx in einer frühen Bestimmung fasste, andererseits als überschießende Möglichkeiten zugleich umfassender, was die Produktionsverhältnisse als „ihr Gegenteil“ erscheinen lässt. Wird dieses Verhältnis als Modalgefälle erkannt, erscheint der Gegensatz als Widerspruch (im dialektischen Sinne), der aufhebbar ist, wenn das umfassende Allgemeine der Produktivkräfte in veränderten Produktionsverhältnissen eine entsprechendere – dem Totalitätsanspruch nähere – Verwirklichung findet. Freilich lässt sich diese Konstellation aus Verstandesperspektive – extensional – auch umgekehrt modellieren und wird dann ideologisch: Produktionsverhältnisse umfassen die Produktivkräfte extensional als Aktualisierungen, die doch aber ein „Mehr“ an Bestimmungen erlauben, als es in den Kategorien der Produktionsverhältnisse vorgesehen ist (welche z.B. Arbeitskraft auf Ware in der Zirkulation reduzieren). Hier wären im ideologischen Sinne die Produktionsverhältnisse Gattung ihrer selbst und ihres Gegenteils, nämlich der Produktivkräfte. Mithin können wir formulieren: Bestimmungen sind ideologisch, wenn aus der Perspektive des Verstandes nur mit Subsumptionen gearbeitet und das Modalgefälle zwischen Intension und Extension ignoriert wird. 3. Wie kann Mögliches gedacht werden – die Koordinate Leibniz/Wittgenstein und ihre Amphibolie 5 Hegel fasst im § 143 seiner Enzyklopädie Möglichkeit als das „Wesentliche zur Wirklichkeit, aber so, dass sie zugleich nur Möglichkeit sei“, also „unwesentliche Wesentlichkeit“, modern formuliert: als Intension ohne Extension, Gedanke als Inhalt ohne Bestehen desselben. Wirklichkeit hingegen ist nicht das bloß „Gesetzte, sondern das in sich vollendete Konkrete“. Aber nun, auf den ersten Blick irritierend: „Aber alles ist ebenso sehr unmöglich, [...]“. Der Grund hierfür liegt darin, dass Möglichkeit, gefasst als bloße Konsistenz (Leibniz’ Kompatibilität) in dieser Fassung das Unmögliche birgt. Denn Konsistenz ist ebenfalls zu gewinnen durch die konsequente Verneinung aller Möglichkeitsbehauptungen einer Totalität T, also ihrer Ersetzung durch eine „negative“ Totalität T’. Solcherlei bezeichnet Hegel als „abstrakte und unwesentliche [d.h. noch nicht als Wesen einer konkreten Erscheinung gesetzte] Wesentlichkeit“. Holz kommentiert: „ [...] Das Denkmögliche überhaupt – auch solches, das nie wirklich werden wird – kommt doch vor und ist sicher kein widergespiegeltes Seiendes“ (Holz, 437). Solcherlei ist gegeben, solange wir Möglichkeit als bloße Konsistenz fassen. In ihrem Lichte erscheint das Wirkliche als Zufälliges (Hegel, Enz. § 144). Entsprechend kritisiert Hegel „das hohle Ersinnen von Möglichkeiten und recht vielen Möglichkeiten“ (§ 143) und fordert eine Berücksichtigung des „Inhalts“, des wesentlichen Bestimmungsgrundes (§ 145). Diesen sieht Holz in dem „materiellen Verhältnis von tätigen Subjekten und gegenständlicher Welt“ (Holz, 434), innerhalb derer wir neben vollständiger Bedingtheit (Wirklichkeit) partielle Bedingtheit (Möglichkeit) als „Offenheit infolge eines nicht vollständig zureichenden, also mehr oder minder unzureichenden vorliegenden Bestimmungsgrundes antreffen“ (Holz, Bloch zitierend, 439). Diese Problematik nun sucht Holz im Rekurs auf Leibniz und Wittgenstein zu klären, und hier sehe ich einige offene Punkte, die aus meiner Sicht diese Rekurse fragil werden lassen. Warum sollte es denn überhaupt erforderlich sein, jenseits einer Begründung der „Offenheit“ auf der Basis des materiellen Verhältnisses von tätigen Subjekten und gegenständlicher Welt noch eine ontologische Begründung dieser Offenheit zu entwerfen, die erhebliche metaphysische Hypotheken mit sich führt? Zwar benötigen wir, über die Kompatibilität hinaus, ein stärkeres Möglichkeitskonzept, eine „realphilosophische [...] Interpretation durch ihre Konkretisierung als Kompossibilität“ (Holz, 461). Durch Kompossibilität im Leibnizschen Sinne? Sicherlich gilt, dass die Erklärung, dass fehlende Kompatibilität verhindere, dass das eine zur Existenz gelange, das andere nicht (Holz ebd.) eine zu schwache Erklärung ist. Leistet aber das Kompossibilitäts-Prinzip die Ausfüllung dieser Lücke bzw. liefert es einen Bestimmungsrahmen, der sich dann in materialistischer Absicht ausfüllen ließe? Kompossibilität im Leibnizschen Sinne ist eine Forderung an mögliche Welten, die über die logische Forderung hinausgeht, dass die Bildung maximal widerspruchsfreier Aussagemengen geleistet werden kann (größtmöglicher Reichtum und Vielfalt in den möglichen Welten), reformuliert: dass die Bildung maximaler Mengen widerspruchsfreier Intensionen gewährleistet ist. Über diese logische Fassung von Kompossibilität hinaus vertritt nämlich Leibniz die stärkere ontologische These, dass „Kompossibilität“ bedeutet, dass Dinge nebeneinander als Teile derselben möglichen Welt existieren können, d.h. die Möglichkeit der zwischen den Dingen bestehenden raumzeitlichen Relationen, die Koexistenz dieser Relationen, gegeben ist. Damit wird Kompossibilität raumzeitlich relativiert, sie ist zu einem Zeitpunkt eine andere als zu einem anderen Zeitpunkt. Eine solche Prozessualität nun scheint für eine dialektische Ontologie interessant zu sein. Man darf aber nicht übersehen, dass Leibniz’ Konzept der Kompossibilität eingebettet ist (und sein muss) in das Konzept der praestabilierten Harmonie einer vollständig determinierten Schöpfung (im Verstande „Gottes“). Lässt sich in diesem Rahmen das Konzept eines dialektischen Widerspruchs verorten, der doch aus jener Sicht bloß als durch die Unzulänglichkeiten des menschlichen Verstandes bedingt erscheinen muss, mithin als irrtümliche Einschätzung von Gegensätzen, die sich sub specie aeterna als kompossibel zu erweisen hätten? Verliert nicht dialektisches 6 Denken seinen „Stachel“ der Initiierung einer Praxis, die ein uns als widersprüchlich erscheinendes Modalgefälle so einzurichten hat, dass Möglichkeiten, die uns als solche vorkommen, aktualisierbar werden? Haben wir uns nicht in anderer Weise zu verstehen als als Seismographen eines determinierten Prozesses, der nur zu denken wäre, wenn wir die aneignende Dialektik aufgeben und die Dialektik als theoria des Weltganzen entwerfen? Wenn dies ohne Theologie möglich sein sollte (sei sie eine Leibnizsche oder sei sie eine Theologie der Materie) – von welchem Standpunkt auch sollte sie uns zugänglich sein? Radikaler wäre zu fragen: Verliert Dialektik nicht ihren Charakter, wenn sie als Ontologie auftritt? Büßt sie nicht den Erfahrungsschatz gehemmter Praxis ein, wenn sie über ein Konzept zu verfügen glaubt, die Defizienzerfahrungen der Praxis objektiv bewerten zu können, wie es Leibniz – konsequent – in seiner Theodizee unternommen hat? Eine materialistische Leibniz-Interpretation läuft Gefahr, der von Immanuel Kant aufgezeigten Amphibolie der Reflexionsbegriffe zu erliegen: die Möglichkeiten de re , die auf der Basis einer Vergleichung (logische Comparation) von Vorstellungen erscheinen, zu ontologisieren und die Erträge transzendentaler Reflexion, nämlich ihrer Zuordnung zu dem Erkenntnisvermögen, „darin sie zusammengehalten werden“, zu ignorieren (Kant KrV B 319). Mit der Vermeidung jener Amphibolie ist aber die Option einer materialistischen Interpretation keinesfalls aufgegeben. Diese sollte jedoch m.E. nicht auf eine Ontologie zielen, sondern ihren Ausgang aus der Einsicht gewinnen, dass wir unsere Weltbezüge nicht im Modus der theoria, sondern im Zuge einer Praxis gewinnen, an deren Hemmung uns das Gegenständliche der Gegenstände erscheint. „Es gibt nichts Absolutes, außer man tut es!“ Umgekehrt: Wir erreichen nicht das Absolute, indem wir die Allgemeinheit allgemeiner Theorien immer weiter steigern. Das „übergreifende Allgemeine“ ist nicht durch Abstraktion zu gewinnen, sondern nur reflexiv, indem gehemmte produktive Praxis abduktiv die Bedingungen ihrer Hemmung aufspürt und sie in ihr gestaltendes Tun einbezieht. Das ist der Kern menschlicher Technik, die Welten baut, welche sie dann notwendigerweise ex post erschließt. Hierin ist die unhintergehbare Technomorphizität problematischer Metaphysik begründet, welche die Dialektiker, insbesondere Hegel, bereits bedacht hatten, bevor die Phänomenologie eines Husserl oder Heidegger dies als neue Einsicht präsentierte. Unter einem ähnlichen Amphibolie-Verdacht dürfte auch der von Holz vollzogene Rekurs auf Wittgensteins „Tractatus“ stehen. Die Welt, begriffen als „Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge [...] bestimmt, was der Fall ist, und auch was alles nicht der Fall ist“ (Wittgenstein, Tractatus 1.1, 1.12). Was der Fall ist, ist das Bestehen von Sachverhalten, diese wiederum eine „Verbindung von Gegenständen“ (2.01, 2.06). „Jedes Ding ist, gleichsam, in einem Raume möglicher Sachverhalte“ (2.013). Daraus folgt: „Wenn ich den Gegenstand kenne, so kenne ich auch sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten [...]. Es kann nicht nachträglich eine neue Möglichkeit gefunden werden“ (2.0123). Die Möglichkeit eines Vorkommens in Sachverhalten nennt Wittgenstein die „Form des Gegenstandes“ (2.0141). Diese logische Form nun, habe, so Holz, eine „ontologische Interpretation“ (Holz, 453). Denn: „Sind alle Gegenstände gegeben, so sind damit auch alle möglichen Sachverhalte gegeben (Wittgenstein, 2.0124). Es handele sich um die „Wirklichkeit des Möglichen“ (Holz, ebd.), von der die verwirklichten Wirklichkeiten eine Teilmenge abgäben. Insofern „mündet der Umweg über Wittgenstein wieder bei Aristoteles“ (ebd.), gemeint ist dessen Lehre der Verwirklichung wirklicher Formen unter den Möglichkeiten der Materie durch die ermöglichende Wirklichkeit der kinesis. Jedoch ist zu fragen: Wie passt Wittgensteins Konzept einer Welt, nach der diese alles ist, was der Fall ist (als Bestehen von Sachverhalten) zu dem Konzept einer Welt, „die nicht anders [zu] denken [ist] als in der Form „alle möglichen Sachverhalte“ (Holz, ebd.)? Wenn eine Prozessualität (aristotelisch) „von der Möglichkeit zu einer Wirklichkeit zu einer neuen Möglichkeit usw.“ (Holz, 453) als ontologische Prozessualität gedacht wird, stellt sich wieder die Frage nach dem 7 Bestimmungsgrund („Motor“) dieser Prozessualität bzw. nach dem Seinsgrund, die alternativ („konsequent“) idealistisch oder materialistisch zu beantworten wäre, mit allen Problemen der Begründung des jeweiligen Standpunktes, die eben nicht über Abstraktion und Steigerung der Allgemeinheit zu gewinnen ist. Eine „aneignende“ Dialektik hätte gerade diese Alternative zu überwinden. Wie steht der Wittgenstein des Tractatus zu dieser Frage? Er rechnet die Welt zur Kategorie der Tatsachen, dass Gegenstände in Verbindungen stehen. Das macht die Sachverhalte aus, deren „Möglichkeit“ in den Dingen „präjudiziert sein“ muss (Wittgenstein, 2.012). Diese Möglichkeit wird über den Begriff des „logischen Raumes“ bestimmt, der so viele Dimensionen hat, als es voneinander unabhängige Beschreibungen der Welt gibt. Unabhängig voneinander sind atomare Sachverhalte, die zu verschiedenen Dimensionen des logischen Raumes gehören. Atomare Sachverhalte, die zu ein und derselben Dimension gehören, sind unverträglich – nur einer kann der Fall sein. Für Wittgenstein, der den logischen Raum als JaNein-Raum fasst, treten in jeder Dimension nur zwei Sachverhalte auf, die entsprechend miteinander unverträglich sind. Nur solche Sachverhalte sind atomare Sachverhalte. Die „Unendlichkeit“ des logischen Raumes (4.463) bedeutet, dass seine Dimensionen unendlich sind. Nach Wittgenstein ist diese Unendlichkeit gegeben, da die Zahl der Zeitpunkte unendlich ist, zu denen die atomaren Sachverhalte bestehen, welche als unabhängig voneinander gelten müssen, sofern sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestehen. Seine Behauptung nun, dass „Gegenstände farblos“ sind (2.0232), weist auf den logischen Raum als Ja-Nein-Raum zurück: Seine Gegenstände sind nicht Erfahrungsgegenstände, seine Sachverhalte, deren Elemente sie ausmachen, sind grammatisch durch ein „dass [...]“ gekennzeichnet. Dieses „dass“ hat keine Farbe, mithin auch nicht seine Elemente als Einzeldinge und Relationen bzw. Attribute, die keine Farbe haben. Die „Bilder von den Tatsachen“ dürfen daher nicht realistisch oder gar naturalistisch interpretiert werden, sondern sind selbst Tatsachen (i.S. von dem, was Mathematiker als Abbildung verstehen): komplexe abstrakte Relationen, die strukturgleich zu den abgebildeten sind. „Das Bild ist nicht a priori wahr“ (2.225), denn die Gleichheit seiner Struktur mit dem Abgebildeten impliziert noch nicht deren Isomorphizität, die im Zeigen des Einen durch das Andere liegt und ein „Bestandteil“ des Bildes ist. Ein möglicher Sachverhalt liegt – erkenntnistheoretisch – in seiner Darstellbarkeit in seiner bildlichen Struktur. Dass hier nur die Möglichkeit erreicht wird, liegt daran, dass die Zeichen in der Darstellung selbst nicht auf das Dargestellte verweisen (also ein Ausdruck aRb nicht auf zwei Individuen und eine Relation), sondern erst die Tatsache, dass a rechts von R und b links von R steht (was sich zeigt), einen interpretationsfähigen Sinn ausmacht, der zeigt, wie es sich verhält, wenn er wahr ist. Diese Wahrheit ist jedoch im Bild selbst nicht impliziert. Über sie kann man nicht reden, wir können „nicht sagen, das und das gibt es in der Welt, jenes nicht“ (5.61). Wittgensteins Abbildtheorie verabschiedet explizit jegliche Realontologie. Ex negativo wird m.E. deutlich, dass ein Philosophieren, welches seine Hoffnung in eine Analyse von „Abbildung“ oder „Spiegelung“ setzt, die Frage unbehandelt lassen muss, wie es dazu kommt, dass sich Interpretationsregeln herausbilden, auf deren Basis eine Darstellung (oder Spiegelung) von Sachverhalten als wahren oder falschen, verzerrten oder adäquaten Spiegelungen zu erachten wäre. Dies zu klären, ist (jenseits idealistischer oder materialistischer Dialektik) das Anliegen einer „aneignenden“ Dialektik, die sich darauf verwiesen sieht, im Ausgang von gehemmter Praxis ihre Weltbezüge auf den Prüfstand zu stellen und beständig hierbei diese Praxis zu reflektieren, die sich nur in einem Grenzgang von Innen (Wittgenstein) erschließt. Da uns ein göttlicher Verstand abgeht, der auf der Basis einer Kenntnis der notiones completae die Welt überschaut, bleibt uns – mit Hegel – nur der Weg über die Absicherung einer Praxis, die ihr Fundament nicht in einem gesicherten Weltbezug sieht, sondern in der intersubjektiven Gemeinsamkeit der Modellierung und 8 Bewertung von Praxen. Diese thematisiert Kriterien für gelingendes Tun (worauf auch der späte Wittgenstein abhebt), um die Wahrheit von Darstellungen eben nicht qua unterstellter Isomorphie zu gewährleisten, sondern durch eine provisorische und mithin prinzipiell revidierbare Sicherung des gemeinsam als gelingend eingeschätzten Tuns. So gefasst, könnte Dialektik in der Tat nicht mehr als Ontologie auftreten, sondern würde zum permanenten Korrekturmechanismis jeglicher ontologischer Hypostasierungen. Spekulativ bliebe sie, sofern sie diejenigen Irritationen spiegelt, die wir in Ansehung unserer Spiegelbilder haben. Spekulative Sätze, an denen wir diese Irritationen erfahren, sind Spiegelbilder, in denen wir sehen, wie wir uns Vorstellungen von Vorstellungen gemacht haben. Niemals können wir jedoch sehen, wie wir uns Vorstellungen machen. Die Spiegelmetapher stößt dort an ihre Grenzen, wo sie ihren Bildcharakter selbst nicht mehr spiegelt. Aus dieser Aporie vermögen uns weder Leibniz noch der Wittgenstein des Tractatus herauszuführen. Uns bis zu dieser Grenze geführt zu haben, ist ein Verdienst von Hans Heinz Holz. LITERATUR Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1807/1952) Phänomenologie des Geistes. Hamburg: Meiner Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1812/1969) Wissenschaft der Logik II. Hamburg: Meiner Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1830/1961) Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Hamburg: Meiner Holz, Hans Heinz (2005) Weltentwurf und Reflexion. Versuch einer Grundlegung der Dialektik. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler Hubig, Christoph (1978) Dialektik und Wissenschaftslogik. Eine sprachphilosophischhandlungstheoretische Analyse. Berlin/New York: deGruyter Hubig, Christoph (1985) Handlung – Identität – Verstehen. Weinheim/Basel: Beltz Hubig, Christoph (2006) Die Kunst des Möglichen I. Grundlinien einer dialektischen Philosophie der Technik. Bielefeld: transcript Hörz, Herbert (2006) Dialektik als Heuristik, in: EWE 17 (2006) 2, 167-176 Kant, Immanuel (1797/1990) Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Meiner König, Josef (1978): Vorträge und Aufsätze. Freiburg/München: Alber Marx, Karl (1961): Das Kapital (MEW 23-25). Berlin Jean Paul (1961) Titan, in: Werke III. München: Hanser Luckner, Andreas (1994) Geneologie der Zeit. Berlin: Akademie-Verlag Stekeler-Weithofer, Pirmin (2005) Philosophie des Selbstbewusstseins. Frankfurt/M.: Suhrkamp Wittgenstein, Ludwig (1971) Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt/M.: Suhrkamp 9