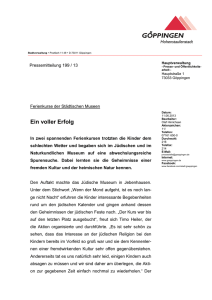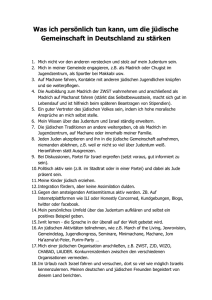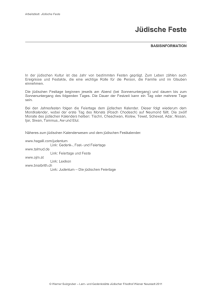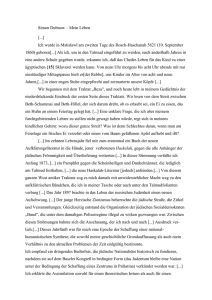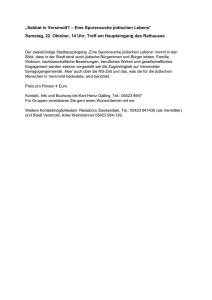Dispositive des Schreibens - Jüdische Schriftstellerinnen und
Werbung

ANDREAS B. KILCHER EXTERRITORIALITÄTEN Zur kulturellen Selbstreflexion der aktuellen deutsch-jüdischen Literatur Unmöglichkeiten vielmehr als Möglichkeiten sind die Bedingungen einer deutsch-jüdischen Literatur nach 1945. Als unmöglich erscheint die Fortsetzung einer Literatur, deren Ende, so Siegmund Kaznelson 1959 in seiner Sammlung „Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten“, nach 1945 unmittelbar abzusehen war. „Diese Sammlung wird als ‚abschließend‘ bezeichnet“, so Kaznelson, „weil nach menschlichem Ermessen die deutschsprachige Dichtung jüdischen Inhalts mit unsrer oder vielleicht der nächsten Generation zu Ende geht.“1 Als unmöglich erscheint eine jüngere deutsch-jüdische Literatur in einem politischen und kulturellen Raum, in dem jüdisches Leben nicht mehr sein sollte, in dem aber auch nach 1945 Aufklärung und Dialog kaum anders als unter negativen Vorzeichen erfolgte. „Jeder schweigt von etwas anderem“, so der Holocaust-Überlebende Jakob Scheinowiz in Doron Rabinovicis „Suche nach M“ (1997).2 Als unmöglich erscheint diese Literatur auch aus einer jüdischen Perspektive, der deutsche Sprache und Literatur – bis in die Weimarer Republik Garant kultureller Integration in Deutschland und Österreich – in höchstem Masse suspekt geworden sind. Als fragwürdig erscheint vor allem vom Standpunkt gesicherterer jüdischer Existenzen und Identitäten der Nachkriegszeit wie der amerikanischen und der israelischen, dass nun eine jüngere jüdische Generation an den Rändern der deutschen Kultur wieder in deutscher Sprache schreibt. Angesichts solcher Unmöglichkeitsbedingungen drängt sich dieser jüngeren Generation die Frage nach der kulturellen und ästhetischen Bestimmung des eigenen Schreibens geradezu als Legitimationszwang auf. Exemplarisch beschreibt Rabinovici, wiederum in der „Suche nach M.“, diesen Begründungsnotstand des Schreibens der zweiten Generation an der Figur eines Sohnes von Holocaust-Überlebenden: „Dani konnte den vielfältigen Erwartungen nicht nachkommen: Er sollte ein Bursche sein wie alle anderen seiner Klasse, doch durfte er sein Herkommen nicht vergessen, sollte den anderen seine Gleichwertigkeit und die der Juden schlechthin beweisen, sollte mithalten in der deutschen Sprache, ja besser noch als all die übrigen sein, und gleichzeitig Hebräisch studieren, sollte die Dichter und Denker herbeten können, doch nie an sie glauben, sollte das Fremde sich aneignen, ohne sich dem Eigenen zu entfremden.“3 Es werden, mit anderen Worten, von jener jüngeren Generation Erklärungen darüber erwartet, wie sie ihr eigenes kulturelles, politisches und ästhetisches Dispositiv begründet, wie sie ihr prekäres Schreiben in deutscher Sprache interpretiert und problematisiert. Unmöglichkeiten des Schreibens wie auch Versuche, diese zu verstehen, sind für die deutschjüdische Literatur zwar nichts Neues; Auschwitz aber hat sie – nachhaltig auch für jene jüngere Generation – radikal zugespitzt. Dies kann ein kurzer Blick auf die kulturelle Lage der deutsch-jüdischen Literatur vor 1933 deutlich machen:4 Von Anfang an nämlich zeigt das aus der Haskala hervorgegangene Vorhaben der Akkulturation aporetische Züge. Als aporetisch erwies sich das Programm kultureller Integration nicht nur, weil es in unterschiedlichem Maß eine Selbstaufgabe jüdischer kultureller Identität verlangte, sondern auch, weil es eine prekär 1 Siegmund Kaznelson: Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten. Eine abschließende Anthologie, Berlin 1959, S. 14. 2 Doron Rabinovici: Suche nach M., Frankfurt/Main 1997, S. 16. 3 Ebd., S. 36. 4 Vgl. dazu Andreas Kilcher: Was ist „deutsch-jüdische Literatur“? Eine historische Diskursanalyse, in: Weimarer Beiträge 45, 1999, S. 485-517. 1 „einseitige Liebe“5 war, von deutscher Seite mit Argusaugen beobachtet und schließlich wahnhaft als subversive Unterwanderung und Usurpation deutscher Kultur dämonisiert. Als aporetisch erschien schließlich auch die tendenziell zionistische Konsequenz aus der gescheiterten Assimilation, das paradoxale Programm nämlich einer dissimilativen deutsch-jüdischen Literatur, einer dezidiert „jüdischen Nationalliteratur“ in deutscher Sprache also, wie sie etwa Moritz Goldstein 1912 in seinem berühmt gewordenen Aufsatz „Deutsch-jüdischer Parnaß“ forderte. Mit außerordentlicher Treffsicherheit beschrieb Franz Kafka 1921 diese Aporien der „kleinen Welt der deutsch-jüdischen Literatur“, in seinen Worten „eine von allen Seiten unmögliche Literatur“.6 Eine erste ist die „Unmöglichkeit, nicht zu schreiben“; sie ist gleichsam die Prämisse der deutsch-jüdischen Interkulturalität und entspricht der Situation, außer der symbolischen Welt der Literatur keinen Ort zu haben. Die zweite ist die „Unmöglichkeit, deutsch zu schreiben“, was der Not der Assimilation entspricht, die deutsch sein will, jedoch immer auch „jüdisch“ bleibt bzw. auf das Judentum zurückgeführt wird. Die dritte ist die „Unmöglichkeit, anders zu schreiben“, was der Not des Zionismus entspricht, der nicht deutsch, sondern hebräisch schreiben will, aber vom Deutschen nicht loskommt. Kafkas vierte Unmöglichkeit schließlich kumuliert die vorangegangenen in der „Unmöglichkeit zu schreiben“ überhaupt. Aus dieser historischen Perspektive erweisen sich die kulturellen Unmöglichkeiten der deutsch-jüdischen Literatur als geradezu strukturell angelegt. Angesichts dessen aber, dass jüdisches Leben in Deutschland ausgelöscht werden sollte, verschärfen sie sich aufs Äußerste. Paradigmatisch zeigt sich dies daran, dass die von jüdischer Seite vormals erhoffte kulturelle „Symbiose“ in eine Konstellation umschlug, die Dan Diner treffend als „negative Symbiose“ bezeichnet hat,7 Deutsche und Juden nämlich unauflöslich aneinander gebunden, ineinander verkeilt in den Konsequenzen und Nachwehen einer Katastrophe. Um so dringender stellt sich deshalb für die jüngere Generation einer deutsch-jüdischen Literatur die Frage nach den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des eigenen Schreibens an einem prekär gewordenen Ort und in einer prekär gewordenen Sprache und Kultur. Spätestens hier wird auch deutlich, dass es bei der Frage nach der kulturellen Konstitution der aktuellen deutsch-jüdischen Literatur nicht etwa um Faktizitäten oder Definitionen mit ihren möglichen Antinomien geht, sondern vielmehr um Polysemien der Interpretation, um verschiedene Formen und Verfahren der Konstruktion kultureller Identitäten. In dem Maß nämlich, wie die jüngere Generation vor Brüchen und Unmöglichkeiten steht, muss sie ihre Literatur neu begründen, mehr noch: neu erfinden. Die Frage nach der kulturellen Konstitution der aktuellen deutsch-jüdischen Literatur erweist sich deshalb letztlich als die ganz grundsätzlich Frage, was „deutsch-jüdische Literatur“ für die zweite Generation nach 1945 bedeuten kann. Die Antworten auf eben diese Frage, die kulturellen Begründungen und Erfindungen jenes Schreibens also sind es, die im folgenden zur Diskussion stehen. Genau genommen müsste man dabei singuläre Interpretationsakte unterscheiden.8 Die folgenden Beispiele lassen sich jedoch auf zwei konträre und komplementäre Begründungsmuster deutsch-jüdischer Literatur zurückführen. Sie erweisen sich, mit anderen Worten, als Versionen zweier Antworten auf die Frage nach der aktuellen deutsch-jüdischen Literatur. Gemein5 Vgl. Gershom Scholem: Wider den Mythos vom deutsch-jüdischen Gespräch (1964), in: Ders.: Judaica 2, Frankfurt/Main 1970, S. 7-11, hier: S. 10. 6 Franz Kafka: Briefe 1902-1924, hg. v. Max Brod, Frankfurt/Main 1975, S. 337. 7 Vgl. Dan Diner: Negative Symbiose. Deutsche und Juden nach Auschwitz, in: Ders.: Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Zu Historisierung und Historikerstreit, Frankfurt/Main 1987, S. 185-197. Vgl. auch Sander L. Gilman: Negative Symbiosis. The Reemergence of Jewish Culture in Germany after the Fall of the Wall, in: The German-Jewish Dialogue Reconsidered: A Symposium in Honour of George L. Mosse, hg. v. Klaus L. Berghahn, New York 1996, S. 207-232. 8 Das ist das Konzept des „Metzler Lexikons der deutsch-jüdischen Literatur“, hg. v. Andreas B. Kilcher, Stuttgart, Weimar 2000. Vgl. dort die Einleitung. 2 sam ist beiden, als Konsequenz auch aus den Unmöglichkeiten, die These der Randständigkeit des jüdischen Schreibens gegenüber der deutschen Kultur. Sie unterscheiden sich deshalb als zwei Formen jüdischer Exterritorialität, als zwei Schreibweisen nämlich am Rande oder außerhalb der deutschsprachigen Literatur. Eine erste, förmlich physische Form der Randständigkeit gründet auf der geographischen und existentiellen Dislozierung des Schreibstandortes aus Deutschland. In der Emigration aber, fernab vom aktuellen Deutschland wird nicht nur eine unproblematischere, auch religiöse jüdische Existenz möglich, sondern überraschenderweise auch eine deutsch-jüdische Literatur, die mit eher klassischen ästhetischen Mitteln und traditionellen Erzählweisen ein sublimiertes Kultur- und Literatur-Deutschland konstruiert, das dem historischen und realen entgegensteht. Die zweite Form des Schreibens verlegt die Randständigkeit förmlich nach innen; es sind jene Schreibformationen deutsch-jüdischer Literatur, die sich bewusst vor Ort lokalisieren, auf Emigration ebenso wie auf eine gesicherte jüdische Identität verzichten. Dieses Schreiben setzt sich den Schwierigkeiten und Disharmonien der ‚negativen Symbiose’ bewusst aus. Skeptisch auch gegenüber der deutschen Sprache und Literatur geht es auf Distanz zu traditionellen Ästhetiken und sucht nach neuen Schreibweisen, die im äußersten Fall in einer radikal dissimilativen deutsch-jüdischen Literatur münden. I. Die physisch greifbarste Konsequenz aus den verschärften Unmöglichkeiten eines jüdischen Schreibens in Deutschland nach 1945 ist die Emigration, das Auftreten folglich einer neuen deutsch-jüdischen Emigrationsliteratur. Demonstrativ erscheint sie schon auf Buchtiteln. Was Hermann Kesten mit „Ich lebe nicht in der Bundesrepublik“ (1964) für die Generation der Überlebenden artikulierte, formulierte für eine jüngere Generation Lea Fleischmann 1980 mit „Dies ist nicht mein Land“, im Untertitel präzisierend „eine Jüdin verlässt die Bundesrepublik“, dem zwei Jahre später – ebenso programmatisch im Titel – die Fortsetzung „Ich bin Israelin“ folgte. So schematisch dieser Ortswechsel bei Lea Fleischmann erscheint, können doch vergleichbare, allerdings weitaus differenziertere Beispiele die kulturellen und ästhetischen Konsequenzen und Implikationen deutlich machen. Chaim Nolls Ortswechsel, um mit ihm zu beginnen, führt von der DDR über die Bundesrepublik zunächst nach Italien und von da aus nach Israel. So nahe bei Noll eine Distanznahme zur deutschen kulturellen und literarischen Tradition auch läge, so sehr er insbesondere in seinen „Nachtgedanken über Deutschland“ (1992) gerade auch den deutschen Mythos des „Volks der Dichter und Denker“ bezweifelte und die Existenz einer deutschen Literatursprache überhaupt in Frage stellte,9 bleibt er doch geradezu programmatisch der europäischen Kultur und der deutschen Sprache verpflichtet. In seiner Essaysammlung „Leben ohne Deutschland“ (1995) reflektiert er die kulturellen und ästhetischen Parameter seines Ortswechsels: Deutschland kann nur noch in kultureller, nicht aber in politischer und existentieller Hinsicht Ort jüdischen Lebens sein: „Deutsch ist ihre Muttersprache, aber dieses Land kann nicht ihre Heimat sein“,10 so Nolls kulturelle Formel für seine Kinder, und ebenso für sich als Schriftsteller, wie er einem amerikanischen Publikum erklärte: „Ich wurde Ihnen als deutscher Schriftsteller angekündigt. Ich muss mich fragen, ob ich das wirklich bin. Deutsch ist meine Muttersprache, die Sprache, in der ich meistens schreibe. […]. Ich glaube, das Beste, was Deutschland besitzt, ist seine Sprache. Die Sprache ist ein Ort, an dem ich mich zu Hause fühle.“11 Es ist entscheidend, die Konsequenz aus dieser kulturellen Standortbestimmung nachzuvollziehen. Letztlich nämlich zielt sie auf eine Idealisierung und, allerdings in einem selbst wie9 Chaim Noll: Nachtgedanken über Deutschland, Reinbek 1992, S. 61. 10 Chaim Noll: Leben ohne Deutschland, Reinbek 1995, S. 59. 11 Ebd., S. 91. 3 derum politischen Sinne, auf eine Entpolitisierung der deutschen Sprache und Kultur. Die Ungleichzeitigkeit von Land und Sprache lässt die deutsche Sprache und ihre literarische Bücherwelt zu einem exterritorialen Ort werden, in der Funktion durchaus utopisch, der die Auswanderung im Status des Imaginären präfiguriert. Gerade darin nun erkennt Noll, und auch das ist entscheidend, eine spezifisch jüdische Praxis literarischer Emigration. Nolls Muster ist Heines Begriff der Juden als „dem Volk des Buches“: „ein Buch ist ihr Vaterland, ihr Herrscher, ihr Glück und ihr Unglück. Sie leben in den umfriedeten Marken dieses Buches, hier üben sie ihr unveräußerliches Bürgerrecht, hier kann man sie nicht verjagen.“12 In eben dieses ästhetische Diaspora-Modell nun schreibt Noll auch sein eigenes Schreiben ein: „Bevor ich wenig später die DDR verließ, war ich innerlich längst ausgewandert auf die Art, wie Juden das seit Jahrhunderten halten: mit Hilfe der Bücher.“13 Diese literarisch-imaginäre Emigration erweist sich gerade für die kulturelle Konstitution jüdischer Intellektueller der DDR als plausibel: die Konstruktion einer guten literarischen gegen eine schlechte politische Realität erscheint als intellektuelles Überlebensprogramm. Gegen die „zwanghafte Politisierung“ des Lebens und der Literatur hielt Noll, wie er auch im „Journal meiner Ausreise aus der DDR“ (1985) deutlich macht, das, was offiziell als „bürgerlicher Humanismus“ verschrien war.14 Die eklatante „Kulturfeindlichkeit“15 der DDR im Bann der „Lehre Lenins“ beantwortete er mit einer dezidiert jüdischen Buchkultur. In der realen Emigration nun in Italien und Israel konstatierte Noll zwar eine zunehmende Entfremdung von der nicht mehr alltäglichen deutschen Kultur: „Wir leben uns auseinander“16, stellte er 1995 fest. Dennoch bleibt das kulturelle Diaspora-Profil ‚Sprache als Heimat‘ erhalten, mehr noch: hier gewinnt es an neuer Bedeutung. Nicht zufällig folgt er dem Ratschlag eines Freundes, „in anderen Sprachen zu schreiben“, nicht und bleibt bei seiner Muttersprache, die er in der realen Emigration erneut zur Literatursprache sublimiert. Verstanden als „eine der großen europäischen Sprachen“ erhebt Noll die deutsche Sprach- und Bücherwelt geradezu zum Garant humanistischer Kultur, die gegen das nachhaltig „hässliche Deutschland“17, wie es Noll nicht nur in der DDR, sondern auch in der BRD erlebte, besteht. Zwar hebraisierte Noll seinen Namen von Hans, so noch im „Journal meiner Ausreise“, zu Chaim. Zwar tritt er gegen die deutsch-jüdische Tradition der Assimilation, die sein Vater – der als Parteischriftsteller bekannte Dieter Noll – für die DDR geradezu modellhaft vollzogen hatte, immer bewusster „die Erbschaft eines verleugneten Judentums an“.18 Zwar wurde er 1998 israelischer Staatsbürger und arbeitet seither als „Writer in Residence“ an der Sommeruniversität für Hebräisch und Jüdische Studien der Ben Gurion Universität. Dennoch schreibt er weiterhin in jener klassischen Literatursprache, die ihm, gegen das Deutschland in seiner hässlichen Gestalt, als Inbegriff europäischer Kultur gilt. Mit diesem kulturellen Schreibprofil ist dasjenige von Barbara Honigmann in vieler Hinsicht vergleichbar.19 Fast gleichzeitig mit Noll vollzog sie ihren kulturellen Ortswechsel, dessen Ausgangspunkt ebenfalls in der DDR liegt und in einem religiösen Judentum, allerdings nunmehr in Strassburg, sein vorläufiges Ziel hat. Diesen Ortswechsel hat sie in dem „Roman von einem Kinde“ (1986) auf eine Formel gebracht, die den Tod – in Kontrast zu allen früheren Todesfugen – in einer Artistik entdramatisiert: „Hier bin ich gelandet vom dreifachen To12 Ebd., S. 29. 13 Noll [Anm. 9], S. 34. 14 Hans Noll: Der Abschied. Journal meiner Ausreise aus der DDR, Hamburg 1985, S. 26; S. 86. 15 Ebd., S. 247. 16 Noll [Anm. 10], S. 153. 17 Ebd., S. 45. 18 Noll [Anm. 9], S. 19. 19 Vgl. Petra Fiero: Identitätsfindung und Verhältnis zur deutschen Sprache bei Chaim Noll und Barbara Honigmann, in: GDR Bulletin 24, 1997, S. 59-66. 4 dessprung ohne Netz: vom Osten nach Westen, von Deutschland nach Frankreich und aus der Assimilation mitten in das Thora-Judentum hinein.“20 Es ist für die Konstruktion ihres Schreibstandortes entscheidend, dass Honigmann diesen kulturellen Sprung auch als Ausweg aus der negativen Symbiose verstanden hat, mit der auch sie das Verhältnis zwischen Deutschen und Juden nach 1945 beschreibt: „Es kommt mir manchmal vor, als wäre erst das jetzt die so oft beschworene deutsch-jüdische Symbiose, dieses Nicht-voneinander-loskommenKönnen, weil die Deutschen und die Juden in Auschwitz ein Paar geworden sind, das auch der Tod nicht mehr trennt.“21 Insofern diese negative Symbiose die „Unmöglichkeit, in Deutschland über die ‚jüdischen Dinge‘ unbelastet, unverkrampft zu sprechen“,22 bedeutet, wird die Emigration zur entscheidenden Bedingung eines unproblematischeren jüdischen Lebens und Schreibens: „Hier in Frankreich, geht mich alles viel weniger an, ich bin nur ein Zuschauer, ein Gast, eine Fremde. Das hat mich von der unerträglichen Nähe zu Deutschland befreit.“23 Die Distanznahme gegenüber dem realen Deutschland im Bann seiner Geschichte ermöglicht aber nicht nur ein bewussteres jüdisches Leben, sondern, scheinbar paradox, zugleich auch ein unbefangener deutsches Schreiben. Die Abgrenzung vom realen und politischen geht einher mit der Annäherung an ein imaginäres, kulturelles Deutschland. Wenn sie wie ihr Urgroßvater, Großvater und Vater davon „träumt“, „in der deutschen Kultur ‚zu Hause‘ zu sein“, dann freilich eben nicht im symbiotischen Sinne der Assimilation, sondern vielmehr ihrer Negation: Trennung vom Leben in Deutschland als Möglichkeitsbedingung des Schreibens: „Mein Schreiben war im Grunde genommen aus einer mehr oder weniger geglückten Trennung gekommen.“24 Die deutsche Gesellschaft ist damit nicht der gesicherte Ort eines neuen deutsch-jüdischen Schreibens; es steht dazu vielmehr in einem exterritorialen Verhältnis: ein Schreiben am Rand oder gar außerhalb Deutschlands im imaginären und symbolischen Raum einer sublimierten deutschen Kultur. Solche Distanznahme zum aktuellen Deutschland geht bei Honigmann mehr noch als bei Noll mit einer Ästhetisierung zum Land der Klassiker einher. Das kulturell sublimierte Deutschland, auf das die jüdischen Schriftsteller der Moderne lange schon vertraut haben, mehr noch: das wahrscheinlich ihre spezifische Erfindung ist, erweist sich als ein bürgerliches Refugium auch und gerade für jüdische Intellektuelle in der „Scheiß-DDR“,25 die mit dem ideologischen Kunstbegriff der „Bürokraten und Funktionäre“ die größte Mühe hatten.26 Wenn also Honigmann auf Distanz zum realen Deutschland geht, so lokalisiert sie ihren kulturellen Schreibort nicht etwa im hebräischen Osten, sondern eben im Kultur-Deutschland Goethes und Kleists: Ich bin auch eine Schriftstellerin, und es wird leicht gesagt, eine jüdische. Aber dessen bin ich mir nicht so sicher, denn all das, was ich da gesagt habe, macht mich ja noch nicht zu einer jüdischen Schriftstellerin. Es macht, dass ich mich existentiell mehr zum Judentum als zum Deutschtum gehörig fühle, aber kulturell gehöre ich wohl doch zu Deutschland und sonst gar nichts. Es klingt paradox, aber ich bin eine deutsche Schriftstellerin, obwohl ich mich nicht als Deutsche fühle und nun auch schon seit Jahren nicht mehr in Deutschland lebe. Ich denke aber, der Schriftsteller ist das, was er schreibt, und er ist vor allem die Sprache, die er schreibt. Ich schreibe nicht nur auf deutsch, sondern die Literatur, die mich ge20 Barbara Honigmann: Roman von einem Kinde, Darmstadt 1986, S. 111. 21 Barbara Honigmann: Damals, dann und danach, München 1999, S. 16. 22 Ebd. 23 Ebd., S. 17. 24 Ebd., S. 46. 25 Barbara Honigmann: Alles, alles Liebe!, München 2000, S. 51. 26 Ebd., 15. 5 formt hat, ist die deutsche Literatur, und ich beziehe mich auf sie, in allem was ich schreibe, auf Goethe, auf Kleist, auf Grimms Märchen und auf die deutsche Romantik.27 Bis in die Formulierung stimmen hier Honigmann und Noll überein: „[…] ich schreibe gern deutsch. Kehre gern dorthin zurück,“28 so Noll, und Honigmann: „Als Jude bin ich aus Deutschland weggegangen, aber in meiner Arbeit, in einer sehr starken Bindung an die deutsche Sprache, kehre ich immer wieder zurück.“29 Dass auch Barbara Honigmann ein kulturell sublimiertes Literatur-Deutschland vor Augen hat, wenn sie sich als dezidiert deutsche und nicht als jüdische Schriftstellerin versteht, zeigt nicht zuletzt auch ihr bewusstes Absehen davon, dass „die Herren Verfasser“ – Goethe, Kleist, Grimm, etc. – „wohl alle mehr oder weniger Antisemiten waren.“30 Dieses Schreiben im sublimen Raum der deutschen Literatur ist zudem nicht nur im inhaltlichen Sinne klassizistisch. Es schließt auch in seinen ästhetischen und poetologischen Praktiken eher problemlos an klassische Formen – Linearität und Verständlichkeit – an und lässt die komplizierten und hermetischen Ästhetiken bzw. Anästhetiken der Shoah hinter sich. Die integrative kulturelle Konstitution dieser sublimierten deutschen Literatur korreliert schließlich auch bei Honigmann mit einem ästhetischen Diasporabegriff. Bewusst zwischen der deutschen, der jüdischen und der französischen Kultur sich plazierend31 interpretiert auch sie die Trennung von Land und Literatur als jüdisches Modell einer dezidiert literarischen Existenz: „Ich begriff, dass Schreiben ein Getrenntsein heißt und dem Exil sehr ähnlich ist, und dass es in diesem Sinne vielleicht wahr ist, dass Schriftsteller sein und Jude sein sich ähnlich sind.“32 In der Exterritorialität gegenüber dominanten gesellschaftlichen Systemen wird die Sprache, das Schreiben, die Literatur zur eigentlichen, dezidiert jüdischen ‚Heimat‘. Noll und Honigmann evozieren damit einen ästhetischen Begriff der Diaspora, wie ihn zuvor nicht nur Heine, sondern auch Lion Feuchtwanger33 oder Alfred Wolfenstein34 konstruiert haben: jüdische Literatur als Inbegriff einer nicht-nationengebundenen, einer dezidiert kosmopolitischen Literatur, für die das Exil zum ästhetisch-politischen Programm geworden ist. Indem sie die Substitution von Land durch Sprache und Literatur geradezu systematisiert, wird diese jüdische Literatur zum ästhetischen Prototyp der europäisch-kosmopolitischen Moderne überhaupt. In diese humanistische und weltbürgerliche Moderne der Klassik und Romantik schreibt sich Honigmanns Literatur ein. 27 Honigmann [Anm. 21], S. 17f. 28 Noll [Anm. 10], S. 155. 29 Honigmann [Anm. 21], S. 18. 30 Ebd., S. 18. 31 „[…] wenigstens am Rande berührte ich ja drei Kulturen, die französische, die deutsche und die jüdische nämlich, und wenn es ein guter Tag ist, fühle ich mich bereichert und denke, dass ich Glück habe, an drei Kulturen teilhaben zu können, und wenn es ein schlechter Tag ist, fühle ich mich zwischen allen Stühlen sitzend und verstehe gar nichts mehr.“ Honigmann [Anm. 21], S. 72. 32 Ebd., S. 47. 33 Dieses anti-nationalistische Modell einer dezidiert jüdischen Moderne hat gemäß Feuchtwanger in der Literatur die eigentliche Erfüllung: nicht der Boden nämlich ist die „Heimat“ der Juden, sondern zunächst das heilig gewordene „Buch“, dann aber die „Literatur“ überhaupt. „Zweitausendfünfhundert Jahre wurden sie“ – die Juden – „einzig und allein durch ein Buch zusammengehalten – durch die Bibel. […] Ehrfurcht […] vor der Literatur wurde zu einem Teil ihres Daseins. Literarische Tätigkeit sahen sie als den höchsten aller Berufe an.“ Lion Feuchtwanger: Nationalismus und Judentum (1933), in: Ders.: Centum Opuscula, Rudolstadt 1956, S. 495. 34 Alfred Wolfenstein hält gegen Assimilation wie Zionismus, die beide demselben bürgerlichen Wunsch nach sicherem „Boden“ folgen, den in der Literatur beheimateten Juden als „Nomaden“ entgegen: „Der Dichter ist der unter die Völker Verstreute; aus tieferem Grunde kommend und in höherem Sinne ortlos; der Verbannte.“ Alfred Wolfenstein: Jüdisches Wesen und Dichtertum, in: Der Jude 6, 1921/22, S. 428-440, hier: S. 428f. 6 II. Es mag als paradoxal erscheinen, dass ein Schreiben vor Ort, sei es in Deutschland oder Österreich, die kulturelle Disposition und die ästhetischen Praktiken der Exklusion verschärft – und nicht etwa überwindet. Dies zeigt sich schon daran, dass dieses Schreiben vor Ort, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, in der Konstruktion einer mehr oder weniger dezidiert „jüdischen Literatur“ kulminieren mag, einer dissimilativen Literatur also, deren Verhältnis zur deutschen Kultur, Sprache und Literatur prekär geworden ist. Diese gesteigerte Problematik ergibt sich daraus, dass sich das Schreiben vor Ort der „negativen Symbiose“ und ihren Projektionen nicht entzieht, sondern verstärkt aussetzt. Dann aber ist die Exterritorialität des jüdischen Schreibens förmlich mitten im Raum der deutschen Sprache und Literatur – also gerade auch auf kultureller Ebene – lokalisiert. Solche gesteigerte Negativität der Symbiose zeigt sich bei Esther Dischereit schon in der Formel, dass die Juden in Deutschland nicht mehr „deutsche Juden“ sein können, sondern auch „gegeneinander“ „Juden und Deutsche“.35 Symptomatisch für diese radikalisierte Exterritorialität auf kultureller Ebene ist die Problematisierung der deutschen Sprache. Mit Rekurs nicht nur auf Victor Klemperers „LTI“, sondern auch auf die Unsagbarkeiten der Generation der Überlebenden wie Paul Celan und Nelly Sachs, richtet Dischereit den Blick gerade auf die Unmöglichkeiten der deutschen Sprache. „Auch das Deutsche als Sprache ist mir gleich und nichtgleich. Mir stehen nicht mehr alle Wörter zur Verfügung, zum Beispiel das Wort ‚Rampe‘“.36 Solche Zweifel an der deutschen Sprache angesichts ihrer gewaltsamen Ideologisierung artikuliert auch die jüdische Schriftstellerfigur Hermann Gebirtig in Robert Schindels „Gebürtig“ (1992), dem die „Kanzlei- und Kommandantensprache“ vollends unmöglich geworden ist,37 oder auch, für ein reales Schreiben, Gila Lustiger in ihren „Überlegungen zur Lage der jüdischen Autoren in Deutschland“ (1999). Lustiger macht den Bruch mit der Konstruktion einer sublimierten deutschen Literatursprache unmissverständlich deutlich, indem sie sich von Hannah Arendts Antwort auf die Frage, was von der deutsch-jüdischen Beziehung bleibe, distanzierte: Arendts „Es bleibt die Sprache“ kommentiert Gila Lustiger als spezifische Antwort der Exilanten-Generation: „Diese Sprache, die Sprache der Aufklärung, der deutschen Klassik und Romantik, diese Sprache, in der Lessing programmatisch ausrufen ließ: ‚Sei mein Freund!‘, diese Sprache haben sie sich nicht nehmen lassen. Und noch im Exil, auf der Flucht, hat sie ihnen in den Ohren geklungen.“ Welche Bedeutung aber kann die deutsche Sprache, so fragt Lustiger, für ihre Generation noch haben? Was besteht davon fort? Kann Sprache noch Heimat sein? Hat sie die magische, hat sie die schützende Kraft? Oder lassen Sie es mich anders ausdrücken, können wir, die Nachgeborenen, die Aufklärung und den Humanismus des 18. Jahrhunderts als Erbe annehmen, ohne das, was ihm folgte? Die Heimat der Nachgeborenen bleibt die Sprache, doch der Zauberstab ist zerbrochen. Die Sprache, wie wir sie kennen, lässt sich nicht liebkosen. Sie ist keine Geliebte, wir beäugeln sie misstrauisch, sind vor ihr auf der Hut. Es ist eine Sprache, die von Worten wie ausmerzen, Blutschande, erbtüchtig, fremdvölkisch, Herrenvolk, judenrein, Rassenlehre...‘ aufgesprengt worden ist, von den Worten und ihrer Realität. Es ist ei- 35 Esther Dischereit: Übungen jüdisch zu sein, Frankfurt/Main 1998, S. 29. 36 Ebd., S. 19. 37 Robert Schindel: Gebürtig, Frankfurt/Main 1992, S. 89f; S. 103. 7 ne Sprache, in die die Katastrophe eingebrochen ist. Dieser Bruch lässt sich nicht leugnen, auch nicht mit den Mitteln der Dichtung weglügnen.38 Einzig in diesem problematisierenden Bewusstsein, dass die deutsche Sprache nicht nur Kultur, sondern auch Unkultur transportierte, vermögen Lustiger wie Dischereit in ihr zu schreiben. Deformationen und Unsagbarkeiten vor Augen wird vor allem bei Dischereit die Sprache kompliziert, die Syntax delinearisiert, die Semantik mehrdeutig. Wenn Dischereit dabei dennoch an der deutschen Sprache festhält, dann tut sie dies auch gegen die Forderung der Hebraisierung. Indem sie sich trotz allem für ein jüdisches Schreiben in deutscher Sprache entscheidet, lehnt sie die Sicherheiten ab, die eine große jüdische Sprache und Literatur bieten könnte und zieht die prekäre Exterritorialität vor, im Land und in der Sprache der Mörder zu schreiben. Mit acht Jahren lernte ich ein wenig Hebräisch, mit dreizehn Jahren noch einmal und wieder mit vierzig Jahren – und, immer wieder, ohne Erfolg. Dieses Scheitern muss damit zu tun haben, dass ich mich gegen die Negation meiner selbst als Kind und jüdisches Kind, sperrte, sofern ich mich nicht durch das Hebräische ausweisen konnte, statt dessen nur Deutsch, ausgerechnet Deutsch, und dann noch ein betont interessiertes, gestaltetes. […] Andere Juden, die ich kennenlernte in diesen späten fünfziger Jahren, sprachen in der Regel nicht Deutsch, Fetzen polnischer, jiddischer, rumänischer Sprache und Ivrith natürlich – das Ivrith der Zurückgekommenen. So musste ich mich in diesem Kreis des Deutschen eher schämen.39 Dischereit „sperrt“ sich geradezu gegen die legitimen jüdischen Sprachen und „beharrt“ „auf meinem schwachen, sich im Deutschen suchenden Ich“,40 und damit auf der Exterritorialität in Relation auch zu den dominanten jüdischen Kulturen. Anders als die israelische und amerikanische „Selbstverständlichkeit“ jüdischer Identität sieht Dischereit ihr Schreiben in Deutschland einer geradezu antinomischen Unmöglichkeit ausgesetzt: der Unmöglichkeit, deutsch zu schreiben und zugleich derjenigen, nicht deutsch zu schreiben. Es ist dies ein Ausdruck letztlich jener unauflöslichen Verstrickung deutscher und jüdischer Geschichte, die als ‚negative Symbiose‘ bezeichnet werden kann und der ein kompliziertes, auch mehrdeutiges Schreiben entspricht. Ein solches gesteigertes Problembewusstsein zeichnet auch das Schreiben von Doron Rabinovici aus. Es ist auch dies ganz bewusst ein Schreiben vor Ort, wie schon sein politisches Engagement in Österreich deutlich macht.41 Dabei geht es ihm jedoch nicht unmittelbar um eine jüdische Abgrenzung; explizit verwehrt er sich dagegen, zu einem „jüdischen Schriftsteller“ reduziert zu werden. „Ich bin kein jüdischer Schriftsteller. Ich bin Jude und Schriftsteller. Ich glaube, dass Einteilung in Schubladen nicht funktioniert“, so Rabinovici 1997.42 Wenn er für sich dennoch ein dezidiert „jüdisches Erzählen“ entwickelt, dann jenseits von innerjüdischer Apologie oder außerjüdischer Zuschreibung. Dies klingt kurz darauf in der Differenzierung der Antwort auf die Frage nach seinem kulturellen Selbstverständnis als Schriftsteller an: „Ich weigere mich einerseits, als jüdischer Schriftsteller angesprochen zu werden, und andererseits 38 Gila Lustiger: Einige Überlegungen zur Lage der jüdischen Autoren in Deutschland, in: Altes Land, neues Land. Verfolgung, Exil, biographisches Schreiben. Texte zum Erich Fried Symposium 1999, Wien 1999, S. 50-53, hier: S. 53. 39 Dischereit [Anm. 35], S. 36f. 40 Ebd., S. 37. 41 Rabinovici wurde u.a. im Rahmen der „Demokratischen Offensive“ aktiv, die sich im Widerstand gegen die Koalition von ÖVP und FPÖ formiert hatte. Vgl. auch Österreich. Berichte aus Quarantanien. Hg.v. Isolde Charim und Doron Rabinovici, Frankfurt/Main 2000. 42 GrauZone. Zeitschrift über neue Literatur 13, 1997, Heft 4, S. 16. 8 weigere ich mich, das Jüdische im Schreiben zu verleugnen.“43 Anlässlich der Beantwortung der Frage „Gibt es ein jüdisches Erzählen im Deutschen?“ präzisiert Rabinovici weiter, wenn er sich zunächst sowohl gegen eine Reduzierung auf das Judentum wie auch gegen seine Verleugnung wendet. Eine „Festschreibung“ auf ein „jüdisches Schreiben“ von außen, „ob sie Ausschluss oder Vereinnahmung bezweckt,“44 läuft die Gefahr einer Vereinheitlichung und der Isolation. Die jüdischen Autoren sind, so Rabinovici, „keine vereinheitlichte Schule des Denkens, des Ausdrucks und des Stils.“45 Dies aber kann für die jüdischen Schriftsteller dennoch nicht bedeuten, ihr Judentum zu verbergen oder gar aufzugeben; das wäre ein vorauseilender Gehorsam gegenüber einem nichtjüdischen Umfeld, dem alles Jüdische immer schon suspekt ist: „Dennoch ist ein Verleugnen des Herkommens dieser Autoren nichts als die Kehrseite jeglicher Festschreibung.“46 Konsequenterweise lokalisiert Rabinovici deshalb sein Schreiben irgendwo zwischen zwei Mustern jüdischer Selbstbestimmung, einem assimilativen – „manche Schriftsteller leugneten ihr Judentum, wollten nichts als Deutsche sein“ – und einem dissimilativen – „einige hoben ihr Judentum voller Trotz besonders hervor“.47 „Ich bin ein Jude und ich schreibe“, so präzisiert Rabinovici seine Antwort, „noch genauer; ich bin ein Jude aus Tel Aviv, der in Wien lebt, und ich schreibe auf Deutsch. […] ich gehöre zu den jüdischen Autoren deutscher Sprache, und ich verleugne nicht meine Biographie.“48 Dies nun ist die subjektive Prämisse für Rabinovicis affirmative Antwort auf seine Frage: „Gibt es ein jüdisches Erzählen im Deutschen?“ Hauptsächlich zwei Funktionen sind es, die er der neueren deutsch-jüdischen Literatur zuspricht und die er, durch ihre Verbindung mit der Tradition, als ein „jüdisches Erzählen“ ausweist und ansatzweise – Rabinovici spricht auch von einer „Demarkationslinie“49 – von einem nichtjüdischen Erzählen unterscheidet: Erinnerung und Witz. Beide Schreibverfahren erweisen sich als Figuren von Brüchen und Randständigkeiten. Erinnerung nämlich wird erst da zur zentralen Funktion von Literatur, wo sie in Gefahr ist, und der Witz wird erst da zum zentralen Erzählverfahren, wo Tabus gebrochen und Katastrophen verarbeitet werden müssen. „Gemeinsam sind den Autoren, die Juden sind,“ so Rabinovici, „nicht die Unversehrtheit ihrer Identität, sondern die Brüche zwischen ihnen und der Überlieferung, zwischen ihrem Leben heute und jedem der Juden vor Auschwitz, zwischen ihnen und den Menschen des Landes, in dem sie aufwuchsen.“50 Angesichts solcher Brüche wird Erinnerung für eine jüdische Literatur geradezu zum „Überlebenstraining“.51 Im „Zakohr“ liegt deshalb „ein Merkmal jenes jüdischen Erzählens, das sich in einer Umwelt, die allzu gern vergessen möchte, der Erinnerung verschreibt. Ist es ein Zufall, wenn heutzutage eine Renaissance des jüdischen Erzählens, des jüdischen Erinnerns, in Wien, just an dem Ort jahrzehntelangen Verleugnens, zu finden ist.“52 Gerade für das Schreiben vor Ort, am Ort historischer Verbrechen und deren Verdrängung, erweist sich Erinnerung als eine zentrale Funktion des neuen jüdischen Erzählens. Ähnlich hat auch Robert Schindel die Funktion des Judentums in seinem Schreiben als „Erinnerung und Widerstand“ 43 Ein Gepeinigtsein von Peinlichkeiten. Jüdisch sein in Österreich – ein Dreiergespräch, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 158, 11./12. Juli 1998, S. 51. 44 Doron Rabinovici: Angeln aus christlicher Sicht oder Gibt es ein jüdisches Erzählen im Deutschen, in: Altes Land, neues Land. Verfolgung, Exil, biographisches Schreiben. Texte zum Erich Fried Symposium 1999, Wien 1999, S. 62-68, hier: S. 62. 45 Ebd., S. 63 46 Ebd. 47 Ebd. 48 Ebd., S. 62. 49 Ebd., S. 67. 50 Ebd. 51 Ebd. 52 Ebd., S. 66. 9 formuliert: „1. Erinnerung an die Traditionen, die da auch und vor allem sind: Humanismus, Toleranz, Emanzipation, soziales Engagement […] 2. Der Zusammenschluss mit den Beleidigten, Verjagten, Vernichteten, und damit die schöpferische Wiederaneignung der eigenen Wurzeln.“53 Der Witz wiederum erweist sich für Rabinovici, und ebenfalls auch für Schindel,54 als ein dezidiert jüdisches Schreibverfahren des Gedenkens.55 Die ästhetischen Erzählweisen des „jüdischen Witzes“ nämlich entfalten ihre Funktion präzise da, wo Tradition nicht mehr überliefert, wo Geschichte tabuisiert wird. Die jüngeren jüdischen Autoren, so Rabinovici, „lauschen den Mißtönen des offiziellen Gedenkens nach, versuchen gar mit Witzen den Ritualen der Verdrängung, den Tabus des Verschweigens, beizukommen. Der Humor ist ein Wagnis, kann zuweilen ausrutschen, zum Zynismus verkommen, doch der Witz sucht den Ausweg vor dem Kitsch des Todes, vor der Verklärung des Massenmordes. Neben den Traditionen des Erinnerns greifen die jüdischen Autoren auf diejenigen des Lachens zurück. Dieses Gelächter will im Halse stecken bleiben.“56 Der Witz funktioniert damit als ein erzählerisches Verfahren zur Überlistung von vorgeschobener „Deckerinnerung“,57 als Umgehung von Vergessenswünschen, mehr noch: als Tabubruch. Der Witz benennt, was gesellschaftlich sanktioniert ist; er ist im freudianisch-analytischen wie im politischen Sinn eine ästhetische Strategie gegen das Vergessen. Subtiler als der hypertrophe Ernst des Zynismus vermag das Lachen des Witzes Verschwiegenes zur Sprache zu bringen, Verdrängtes anzusprechen. Der Witz ist damit eine exterritoriale Schreibform am Ort des Verschweigens und Vergessens. Mit der Erinnerung und dem Witz hat Rabinovici vorsichtig Ansätze zu einem „jüdischen Erzählen im Deutschen“ formuliert. Er hat damit eine Klärung dessen vorgeschlagen, was in manchen Untertiteln als „jüdische Geschichte“ ausgewiesen wird und ein bewusst jüdisches Schreiben nahe legt, so etwa bei Esther Dischereit, Katja Behrens oder Henning Pawel.58 Die Abgrenzung von einer deutschen Literatur kann freilich auch schärfere Züge annehmen, wie auch Rabinovici es beurteilt: „Manche dieser Schriftsteller schildern die Demarkationslinie […], die sie von Österreichern und Deutschen trennt.“59 Esther Dischereit hat ein solches markant dissimilatives Schreibdispositiv vor Ort auch als „Trotz-Judentum“60 bezeichnet. Diese Figur einer trotzigen Demarkation konstruiert am radikalsten wohl Maxim Biller, indem er solchen Trotz geradezu zu einem methodischen „Hass“ zuspitzt.61 Von einem therapeutischen „Hass“ hat zwar auch Rafael Seligmann gesprochen, als er 1991 eine „neue deutsch-jüdische Literatur“ forderte: „Je länger Deutschlands jüdische Schreiber es nicht wagen, ihren ‚hässlichen Hass‘ auf die Mörder und ihr Volk kundzutun, desto mehr zerstört er ihre Seelen.“62 Dennoch hat Seligmann selbst diese Forderung kaum eingelöst, wenn er sich, 53 Robert Schindel: Judentum als Erinnerung und Widerstand, in: Ders.: Gott schütz uns vor den guten Menschen. Jüdisches Gedächtnis – Auskunftsbüro der Angst, Frankfurt/Main 1995, S. 32. 54 So auch im Gespräch mit Doron Rabinovici, in: GrauZone. Zeitschrift über neue Literatur 13, 1997, Heft 4, S. 17f. Ähnlich äußert sich Schindel, ebd., S. 20f. 55 Vgl. dazu auch den Essay über den jüdischen Witz, der in Doron Rabinovicis „Credo und Credit. Einmischungen“ erscheinen wird. 56 Rabinovici [Anm. 44], S. 67. 57 Zu dem Begriff vgl. Diner [Anm. 7], S. 190. 58 Esther Dischereit: Joëmis Tisch. Eine jüdische Geschichte, Frankfurt/Main 1988; Katja Behrens: Salomo und die anderen. Jüdische Geschichten, Frankfurt/Main 1993; Henning Pawel: Shapiro & Co. Jüdische Geschichten, Frankfurt/Main 1992; Lea Fleischmann: Nichts ist so wie es uns scheint. Jüdische Geschichten, Hamburg 1986. 59 Rabinovici [Anm. 44], S. 67. 60 Dischereit [Anm. 35], S. 48. 61 Vgl. Maxim Biller: Tempojahre, München 1991. 62 Rafael Seligmann: Mit beschränkter Hoffnung. Juden, Deutsche, Israelis, Hamburg 1991, S. 137. 10 nach einem mehr heuristischen Hass, mit der deutschen Kultur und Geschichte versöhnte und schließlich identifizierte: Deutsch war meine Muttersprache, ich dachte und träumte in dieser Sprache. Die deutsche Kultur war meine Kultur. […] Nun, da meine Angst und mein Unterlegenheitsgefühl gegenüber den Antisemiten gewichen waren, fand ich endlich die seelische Kraft, mich zu meiner Identität zu bekennen: ‚ich bin ein deutscher Jude‘. Mit diesen Worte beendete ich meinen Roman, den ich ‚Rubinsteins Versteigerung‘ nannte.63 Maxim Billers Hass-Figuren und -Gesten nun haben nicht das therapeutische Ziel, dass aus den Juden in Deutschland wieder deutsche Juden werden, die ihre guten Beiträge zur deutschen Kultur liefern. Im Gegenteil: die Konsequenz von Billers programmatischem Konfrontationskurs, in München schreibend, ist die gesteigerte Negativität nicht nur der gesellschaftlichen, sondern gerade auch der kulturellen Symbiose: „[…] die deutsche Literatur [wird] nie mehr zum Synonym für jüdische Literatur werden […]. Wir leben mit ihnen, wir arbeiten mit ihnen, wir lachen mit ihnen – aber wir werden auf immer geschiedene Leute sein,“64 so Biller 1995 in einem Essay über „die Unterschiede von jüdischer und deutscher Literatur“. Dieser Unterschied wird nach Biller insbesondere in der Art und Weise des Umgangs mit Geschichte, genauer mit dem Holocaust, signifikant. Während die jüdischen Autoren gemäß Biller „Geschichte schreiben“ – „alles, was uns politisch und intellektuell beschäftigt“ ist, so Biller, „ein Echo auf die schrecklichste aller schrecklichen Zeiten“65 – vermeiden ihre „nichtjüdischen Kollegen“ unter dem Eindruck von mehr oder weniger bewussten Normalisierungswünschen historische Aufklärung: „Die meisten meiner nichtjüdischen Kollegen aber ignorieren, im Gegensatz zu den jüdischen Schriftstellern deutscher Sprache, die kollektive Erinnerung ihres eigenen Volkes vollkommen,“66 was Biller auch zu dem Empörung hervorrufenden Schimpfwort der „Schlappschwanz-Literatur“ bewegte, einer unpolitischen und morallosen Literatur nämlich, die „den Kampf gegen das Schlechte und für das Gute in unserer verschwiegenen Wohlstandsmeinungsdiktatur aufgegeben“ hat.67 Eine neue jüdische Literatur ist deshalb innerhalb des deutschen Kulturraumes als kritische Instanz historischer und politischer Aufklärung gefordert, wie Biller kurz darauf in einem weiteren Artikel mit dem Titel „Über die Voraussetzungen jüdischer Literatur“ formulierte. Eben nicht an den gesicherten und normalisierten Orten wie Israel oder Frankreich ist jene neue jüdische Literatur zu schreiben, sondern präzise da, wo sie die größte Konfrontation und Provokation hervorruft: in Deutschland: Juden, die schreiben, gibt es […] natürlich überall auf der Welt, in Russland, in Argentinien, in Frankreich. Aber wo sind die jüdischen Schriftsteller? Wo leben, wo arbeiten sie noch? In Deutschland, wo sonst – genau dort also, wo es sie am allerwenigsten geben dürfte, wäre es einst nach dem Willen der Nazis gegangen und würde es heute nach dem Willen der meisten Juden auf der ganzen Welt gehen, denen ein Jude in Deutschland genauso deplaziert vorkommt wie ein Rabbiner im Bordell.68 63 Seligmann [Anm. 52], S. 145. Vgl. auch ebd., S. 316. 64 Maxim Biller: Geschichte schreiben. Über die Unterschiede von jüdischer und deutscher Literatur, in: Süddeutsche Zeitung, 4.1.1995, S. 11. 65 Ebd. 66 Ebd. 67 Maxim Biller: Feige das Land, schlapp die Literatur. Über die Schwierigkeiten beim Sagen der Wahrheit, in: Die Zeit, Nr. 16, 13. April 2000, S. 47ff. 68 Maxim Biller: Goodbye Columbus. Randlage oder: über die Voraussetzungen jüdischer Literatur, in: Frankfurter Rundschau, 2.3. 1995. 11 Billers neue deutsch-jüdische Literatur ist eine dezidiert jüdische Literatur, verbale Instanz „jüdischer Trotzigkeit, Enttäuschung und Eigenheit“ zugleich; in Billers Worten: „Dass ich als Jude in Deutschland nicht leben und schreiben sollte, ist logischerweise gleich der erste Grund dafür, warum man ausgerechnet als Jude in Deutschland besonders bewusst jüdisch lebt und schreibt.“69 Die Konsequenz dieser negativen Symbiose besteht in einer radikal dissimilativen jüdischen Literatur in Deutschland. Anders als in den normalisierten und gesicherten jüdischen Existenzen, Politiken und Ästhetiken, wo wie etwa in Amerika jüdische Literatur tendenziell integrativ und assimilativ ist, ist die jüdische Literatur im deutschen Sprachraum verschärft exterritorial und dissimilativ. Während etwa Philipp Roth, so Biller, „sich ganz automatisch immer weiter auf die amerikanische Gesellschaft zubewegen konnte, musste ich mich von der deutschen Gesellschaft ebenso automatisch entfernen.“70 Diesem kulturellen Dispositiv der Dissimilation und der Randständigkeit entspricht Billers politisierte Poetologie der deutsch-jüdischen Literatur der „zweiten Generation“. Provokativ spricht er von dem „so unglaublich kreativen Prozess der Absonderung der Juden von den Deutschen“, aus dem jene „originäre, selbstbestimmte jüdische Literatur“ erst hervorgeht.71 Dies aber bedeutet eine Demythologisierung des guten Kultur-Deutschland und seiner harmonischen Ästhetiken. Die randständige Aufklärungsinstanz, als welche Biller die neue jüdische Literatur in deutscher Sprache versteht, artikuliert sich vielmehr durch ästhetische Praktiken der Hässlichkeit: Zynismus, satirische Hypertrophien, Chuzpe als Methode. Billers jüdische Literatur in deutscher Sprache widerstrebt jeder Romantik und Klassik, es ist eine Literatur der Aufklärung. Deutlich wird damit zunächst der Unterschied zur neuen deutsch-jüdischen Literatur der Emigration. Billers Randständigkeit vor Ort konstituiert sich geradezu als Gegensatz zu einer Exterritorialität der Emigration: Der deutsch-jüdischen Literatur als Residuum des Goetheund-Kleist-Deutschland hält er eine dezidiert jüdische Literatur in deutscher Sprache entgegen, eine Literatur, die sich kulturell scharf von der deutschen abgrenzt. Zugleich wird aber auch der Unterschied zu jenem „jüdischen Erzählen“ deutlich, wie es Rabinovici vorgeschlagen hat. Billers und Rabinovicis Schreiben exponieren sich zwar beide gleichermaßen der negativen Symbiose und verfolgen dasselbe Ziel: Aufklärung, Geschichtsbewusstsein, Erinnerung. Doch in den Verfahren, dieses zu erlangen, unterscheiden sie sich grundlegend. Billers dezidiert „jüdische Literatur“ arbeitet mit den Strategien der Polemik und des Zynismus. Rabinovicis vorsichtig „jüdisches Erzählen“ jedoch weist Zynismus explizit zurück und stellt dagegen die Erzählverfahren des Witzes. Während der Zynismus mit hypertrophem Ernst einen gewissen Schockwert einlösen will, versucht der Witz mithilfe des Lachens Verschwiegenes zur Sprache zu bringen. Und während Biller zwischen jüdisch und deutsch wie zwischen Opfer und Täter, gut und böse, aufgeklärt und unaufgeklärt, geschichtsbewusst und normalisierungsbedürftig, etc. polemisch polarisiert, stellt Rabinovici solchen auf Eindeutigkeit zielenden Demarkationsfiguren eine Vieldeutigkeit und Kompliziertheit entgegen. Während folglich Billers kulturelle Exterritorialität auf einer deutlich umrissenen jüdischen Andersheit des Schreibens gründet, baut Rabinovicis Randständigkeit auf einer brüchigen, versehrten und prekären jüdischen Identität, deren kultureller Standort gerade nicht eindeutig bestimmbar ist. 69 Ebd. 70 Ebd. 71 Ebd. 12